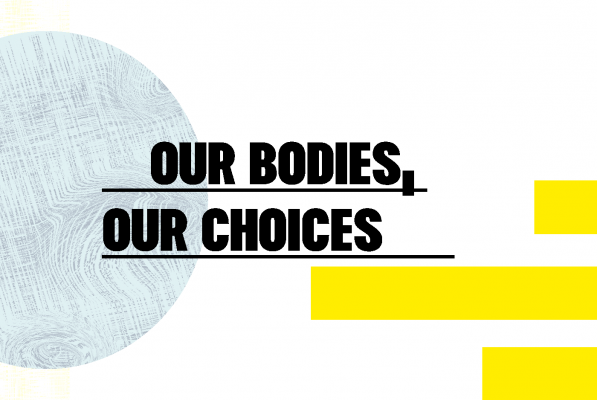100 Jahre KPD-Gründung: Schwere Geburt

Bruno Tesch, Neue Internationale 234, Dezember 2018/Januar 2019
Im November 1918 brach in Deutschland die Revolution aus. Nicht nur das morsche monarchistische System hatte sich überlebt. Der Kapitalismus selbst stand zur Disposition.
Die traditionelle ArbeiterInnenführung, die SPD, hatte 1914 Klassenverrat
begangen und den imperialistischen Krieg unterstützt. Im Verlauf des Krieges
spaltete sie sich in Mehrheitspartei und Unabhängige SozialistInnen (USPD).
Revolutionäre Krise
Die ArbeiterInnenmassen waren ausgehungert und aufrührerisch. Die politischen und gesellschaftlichen Strukturen befanden sich in Auflösung. Am Ende des Ersten Weltkrieges steckte Deutschland in einer revolutionären Krise.
Spontan bildeten sich in vielen Orten Räte aus ArbeiterInnen und heimkehrenden Frontsoldaten, die den Machtfreiraum – die Bourgeoisie war wie gelähmt – zunächst ausfüllten. RevolutionärInnen waren in ihnen jedoch klar in der Minderheit.
Anders als die Bolschewiki, die in Russland vor der Revolution 1917 schon einen jahrzehntelangen unerbittlichen Fraktionskampf gegen den reformistischen Menschewismus geführt hatten, setzte sich die deutsche revolutionäre Linke aus einer Vielzahl von Strömungen und Gruppen zusammen, deren kleinster gemeinsamer Nenner in der Absetzung von der Sozialdemokratie bestand. Einige von ihnen wie z. B. der Lichtstrahlen-Kreis aus Berlin entstand außerhalb der Sozialdemokratie, während die bedeutendste Formation, der Spartakusbund um Luxemburg und Liebknecht, sich erst 1918 von der zentristischen USPD abgespalten hatte.
Diese Gruppen standen in mehr oder minder engem Zusammenhang und stimmten auf dem Rätekongress Mitte Dezember 1918, der über das weitere Schicksal der Räteorgane und der politischen Zukunft des Landes befinden sollte, oft gemeinsam ab, vor allem in der Frage der Macht im künftigen Staatswesen. Sie traten für eine Räterepublik ein. Es gelang ihnen jedoch nicht, die Mehrheit der Delegierten dafür zu gewinnen. Hier setzte sich klar die Linie des Gewerkschaftsbundes ADGB durch, der die Macht dem Regierungsprovisorium unter Ebert (SPD) übertragen wollte.
Ebert war der letzte Trumpf, den die Bourgeoisie ausspielen konnte, um ihre Herrschaft abzusichern, denn sie selbst war damals nicht in der Lage, die Revolution zu bremsen. Ebert hatte einen klaren Fahrplan für die demokratische Konterrevolution im Visier. Er orientierte auf die Durchsetzung demokratischer Rechte, parlamentarische Wahlen und eine neue bürgerlich-demokratische verfassunggebende Versammlung. Dies vertrug sich natürlich nicht mit der Aufrechterhaltung der Doppelmachtsituation zwischen Regierung und Räten.
Obleute
Ein entscheidender Faktor für die weitere Weichenstellung waren die revolutionären Obleute, die während des Krieges FührerInnen von Massenstreiks waren und eine wichtige Rolle bei der Entstehung der Räte spielten. Sie waren größtenteils in der USPD organisiert und hatten in wichtigen Fragen mit der alten SPD-Politik gebrochen. Doch in der entscheidenden Frage der Errichtung einer Räterepublik, d. h. der Übernahme der ganzen Staatsmacht und der Zerschlagung des bürgerlichen Staates, nahmen sie eine zögerliche Haltung ein.
Statt den provisorischen Rat der Volksbeauftragten unter Ebert zu kontrollieren und ihm klare Weisungen zu erteilen, ließen sich die Angeordneten der Räte oft vor vollendete Tatsachen stellen. Ebert und seine HelfershelferInnen nutzten derweil ihre alten Verbindungen mit dem Herrschaftsapparat in Verwaltung und Militär aus, bauten die angeschlagene alte Machtmaschinerie wieder auf und ermöglichten und ermunterten schließlich die Offensive der Konterrevolution und den Terror der reaktionären Freikorps, dem bald auch Luxemburg und Liebknecht zum Opfer fallen sollten.
Der Rätekongress entmachtete sich durch sein mehrheitliches Votum für den Kurs auf eine Nationalversammlung praktisch selbst. Damit war die einmalige Chance vertan, die ArbeiterInnenrevolution in Deutschland in einem Zug zum Sieg zu führen.
Kinderkrankheiten
Erst nach diesem herben Rückschlag für die Revolution, dem Scheitern der Rätebewegung, erfolgte zur Jahreswende 1918/1919 die Gründung einer Partei, die sich die sozialistische Revolution auf die Fahnen geschrieben hatte: der KPD. Der Schärfe des Klassenkampfes entsprach die, mit der die unterschiedlichen Strömungen, die an der Parteigründung beteiligt waren, aufeinanderprallten und an der die junge Partei fast schon gescheitert wäre, noch ehe sie gegründet war.
Die KPD kam mit einigen Geburtsfehlern zur Welt. Die Notwendigkeit der Revolution zwang die RevolutionärInnen zum Hissen einer revolutionären Parteifahne, aber diese war ein Flickenteppich. Der Diskussions- und Klärungsprozess vor der Parteigründung war oft unzureichend. Vor allem gelang es nicht, die revolutionären Obleute dabei einzubeziehen und für die KPD zu gewinnen.
Das Parteiprogramm, vor allem aber die politische Praxis ließen Einheitlichkeit und klare Linie vermissen. Selbst der Spartakusbund war keineswegs homogen. Dies schlug sich in Form der Parteistrukturen nieder. Die KPD blieb zunächst eher föderalistisch organisiert, wirklichen demokratischen Zentralismus gab es nicht.
Die widerstrebenden Interessen brachten es mit sich, dass sich in der Organisation eher Strömungen durchsetzten, die eine antibolschewistische Ausrichtung verfolgten und einen nationalen Sonderweg bevorzugten. Auch in der Frage, ob in den Gewerkschaften oder nur bei den revolutionäre Obleuten interveniert werden sollte, wurde keine Einigkeit erzielt. Das taktische Eingehen auf eine Nationalversammlung, wie Rosa Luxemburg es vertrat, lehnte die Mehrheit ab. Stattdessen ließ sie sich unter Führung von Liebknecht im Januar 1919 in ein militärisches Abenteuer ziehen, den sog. Spartakus-Aufstand in Berlin.
Die Konterrevolution ermordete noch vor den Wahlen zudem mit Luxemburg und Liebknecht sowie im März mit Jogiches die wichtigsten FührerInnen der jungen KPD. Von diesem Schlag erholte sich die Partei erst allmählich.
Trotz aller Unreife war ihre Gründung ein historisch notwendiger und bedeutender Schritt, um eine eigenständige politische Entwicklung und Organisierung von revolutionären MarxistInnen zu ermöglichen. Nur eine solche eigenständige Partei konnte überhaupt einen politischen und organisatorischen Attraktionspol für die ArbeiterInnenklasse verkörpern. Trotz vieler Fehler und Schwankungen der KPD in den Jahren bis 1933 erwies sich, dass sie für die Vorhut der Klasse, für die kämpferischsten Teile durchaus eine Alternative zu Reformismus und Zentrismus darstellte.
Möglichkeiten
Nach 1918 gab es mehrere revolutionäre Situationen, zunächst der Kapp-Putsch 1920, der darauf folgende Generalstreik und die Kämpfe der Roten Ruhrarmee. Auch der von der jungen Sowjetunion gewonnene Bürgerkrieg und die Festigung der Sowjetmacht hatten international große Anziehungskraft auf die ArbeiterInnenmassen. In vielen Ländern entstanden danach revolutionäre Parteien.
Der Durchbruch der KPD zur ArbeiterInnenmassenpartei erfolgte aber erst, als die zentristische USPD zerfiel und sich Ende 1920 immerhin 300.000 USPDlerInnen mit der KPD vereinigten (VKPD). Die KPD verfügte bis dahin höchstens über ein Fünftel dieser Mitgliedschaft – auch als Folge zahlreicher innerparteilicher Konflikte, Ausschlüsse und Austritte.
Der politische, aber auch zahlenmäßige Niedergang begann nach den politischen Fehlern von 1923, als die KPD (und die Komintern) die tiefe revolutionäre Krise im Sommer viel zu spät erkannt hatten und dann einen inkonsequenten Kurs auf den Aufstand verfolgten.
Die blutige Festigung der bürgerlichen Herrschaft nach 1923 in Deutschland – Sturz der „ArbeiterInnenregierungen“ in Sachsen und Thüringen durch die Armee, Niederschlagung des Hamburger Aufstandes – sowie der Aufstieg Stalins, die Machtübernahme durch die Bürokratie und die Beseitigung der innerparteilichen ArbeiterInnendemokratie in der Sowjetunion waren dabei weitere wesentliche Faktoren. Selbst 1932 zählte die KPD immer noch nicht mehr als 320.000 Mitglieder!
Doch noch viel stärker wirkte sich aus, dass sie unter Thälmann endgültig eine stalinistische Organisation geworden war: zunächst zentristisch, ab 1935 – mit der Annahme der Volksfrontstrategie – sogar reformistisch.
Sie war aufgrund ihrer von Moskau aufgezwungenen Doktrin außerstande, eine ArbeiterInneneinheitsfront gegen den Faschismus zu schaffen und unterlag ihm schließlich – kampflos. Bei aller Kritik dürfen wir allerdings nicht den revolutionären Opfermut, den Willen und die Tatkraft der KPD-GenossInnen vergessen – aus ihren, oft bitteren, Erfahrungen müssen wir lernen!
Lehren
Momentan gibt es in Deutschland keine revolutionäre Situation. Aber der Kapitalismus ist weltweit in einer tiefen strukturellen Krise. Deshalb werden die Klassenkämpfe zunehmen.
Die Geschichte zeigt, dass sich gerade in zugespitzten Situationen die Sozialdemokratie als völlig unbrauchbar erwiesen hat – nicht nur für die Überwindung des Kapitalismus, sondern auch bei der Verteidigung grundlegender Errungenschaften der ArbeiterInnenklasse. Doch auch der linke Reformismus oder der Zentrismus stellten keine Alternative zur SPD dar, wie das Schicksal der USPD und gegenwärtig die Linkspartei zeigen.
Die KPD war insofern ein notwendiges, ein logisches Resultat des Versagens von SPD und USPD. Doch zugleich zeigte sich, dass die KPD im Unterschied zu den Bolschewiki in Russland angesichts großer historischer Chancen und deutlich besserer objektiver Bedingungen zum Aufbau des Sozialismus nicht in der Lage war, die Führung der Klasse im Kampf zu erringen und den Kapitalismus zu stürzen.
Was waren die entscheidenden Unterschiede zwischen der Entstehung der KPD und jener der Bolschewiki?
Die MarxistInnen um Lenin führten schon frühzeitig einen kompromisslosen politischen Kampf innerhalb der russischen Sozialdemokratie um Fragen der Perspektive der Revolution und des Parteiaufbaus. Was damals viele, darunter auch Trotzki, als überspitzte, sektiererische Manöver ansahen, erwies sich 1917 als entscheidend. Lenins bolschewistische Partei erwarb in diesen fraktionellen Kämpfen gerade jene Eigenschaften, die den Bolschewiki in der Revolution den Erfolg brachten: eine Beharrlichkeit in programmatischen Grundfragen, die zugleich mit der Flexibilität verbunden war, die eigene Politik an der Praxis zu messen und, wenn nötig, zu verändern, und einen geschulten, gestählten Kaderkern, der im Feuer der Revolution standhielt.
Anders als Lenin versäumte es Rosa Luxemburg aber viel zu lange, ihren politischen Kampf gegen den aufkommenden Reformismus in der SPD – den sie viel eher und klarer sah als Lenin – mit entsprechenden organisatorischen Schritten zu verbinden. Indem sie einen Fraktionskampf ablehnte, erschwerte sie nicht nur die politische und organisatorische Polarisierung in der SPD, sie verzögerte damit auch entscheidend die politisch-programmatische Klärung innerhalb der revolutionären Kräfte. Als die Revolution dann auf der Tagesordnung stand, gab es keine dieser Aufgabe gewachsene kommunistische Partei.
Luxemburgs Fehler und Schwächen – so tragisch sie vielfach waren – tun dem revolutionären Charakter ihrer Politik aber keinen Abbruch. Sie gehört ganz ohne Zweifel zu den wichtigsten kommunistischen TheorikerInnen und PolitikerInnen.
Die Geburtsschwächen der KPD müssen uns jedoch heute eine politische Lehre sein. Der Kampf für eine revolutionäre ArbeiterInnenpartei und die Entwicklung einer kommunistischen Programmatik dürfen nicht leichtfertig auf die Zukunft verschoben werden. Er muss hier und jetzt geführt werden.