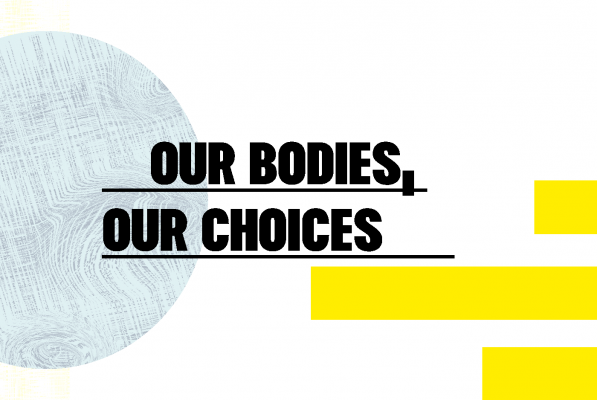US-Imperialismus vor, während und nach Trump

Moritz Sedlak, Revolutionärer Marxismus 53, November 2020
1 US-Imperialismus: Geschichte und Perspektiven
Die USA sind die weltweit wichtigste imperialistische Macht. Das bedeutet, die Dynamik des weltweiten Kapitalismus ist maßgeblich von Entwicklungen bestimmt, die von den Vereinigten Staaten ausgehen oder sich, wie die zunehmende Konkurrenz aus China, auf ihre Rolle beziehen.
Der Fall der Sowjetunion zementierte die vermeintlich unanfechtbare Führungsrolle der USA. Seitdem ist sie aber zunehmend unter Beschuss geraten. Die ökonomische Seite dieser Entwicklung sind der anhaltende Verlust der Kostenvorteile in der Industrie, die Errichtung von Hochtechnologiezentren außerhalb der USA und die relative Abnahme der Bedeutung der US-Finanzindustrie. Politisch sind die Formierung der EU als imperialistischer Block (der aber weiterhin zu instabil für eine Unabhängigkeit vom US-Kapital bleibt), aber vor allem der Aufstieg Chinas zur imperialistischen Macht Ausdruck dieser Anfechtbarkeit.
Dementsprechend steht die Außenpolitik der Trump-Regierung für eine bedeutende Veränderung des US-amerikanischen Imperialismus. Der Bruch mit vielen internationalen Handelsbündnissen und eine forschere Intervention in die Militärbündnisse, aber auch der Austritt aus der Weltgesundheitsbehörde WHO oder dem Pariser Klimaabkommen wird von den bürgerlichen Medien gerne als irrational dargestellt. Teilweise versteigen sich die angeblichen ExpertInnen sogar in einen Vergleich der Trump-Politik mit den Forderungen der Linken in der antiimperialistischen und Antiglobalisierungsbewegung besonders gerne unter Bemühung eines sehr vagen Begriff von Populismus.
Marxistische Analyse
Ulrich Küntzel skizziert in seinem Buch „Der nordamerikanische Imperialismus“ eine marxistische Analyse der US-Außenpolitik seiner Zeit. Wie Hilferding und Lenin versteht er die zentrale Rolle des Kapitalexports in der Zuspitzung internationaler Spannungen und damit in der Gestaltung des imperialistischen Weltsystems. Während wir über den zeitlichen Horizont seiner Darstellung hinausgehen, wollen wir uns in diesem Artikel an denselben Leitlinien orientieren:
„Es liegt auf der Hand, daß Militarismus und Wettrüsten schon für sich allein die internationalen Spannungen verschärfen können. Das Finanzkapital spitzt jedoch die internationalen Konflikte auch wirtschaftlich zu: durch Kapitalausfuhr. Die Trusts jeder imperialistischen Nation suchen sich Rohstoffquellen und Absatzmärkte außerhalb der eigenen Staatsgrenzen zu sichern und ihre Konkurrenten mittels der eigenen Diplomatie und Wehrmacht – die USA daneben durch ihre Geheimdienste CIA und NSA – von den eigenen Einflußgebieten fernzuhalten.“i
Das NAFTA-Freihandelsabkommen der USA mit Kanada und Mexiko war ein Paradebeispiel für imperialistische Machtausübung durch Handelsbündnisse und eines, an dem sich GlobalisierungskritikerInnen jahrelang abarbeiteten. Aus NAFTA sind die USA unter Trump ebenso ausgestiegen wie aus dem fertig verhandelten TPP im Pazifikraum und den TTIP-Verhandlungen mit der EU. Dazu kommen die offene und parteiische Unterstützung amerikanischer Unternehmen durch die außenpolitischen Institutionen und der Handelskrieg. Hier brach die Regierung Trump mit der Außenpolitik der letzten Jahrzehnte – eine wichtige Machtverschiebung zwischen den US-Kapitalfraktionen.
Trump begründete den Handelskrieg mit China mit „unfairen“ Wettbewerbspraktiken und forderte für zeitweise Deeskalationen den Kauf amerikanischer Waren ein. Auch der populäre Boykott von Huawei und das drohende Verbot der Social-Media-Plattform TikTok sind eine offene Ansage, MarktführerInnenschaften von chinesischen Unternehmen nicht zu akzeptieren. An die Stelle der Rhetorik vom freien Wettbewerb ist eine offene Rückendeckung von Firmeninteressen durch Außenpolitik und militärisches Säbelrasseln getreten.
Trumps Versprechen
Zentrale Wahlversprechen von Trump waren der weitgehende Truppenabzug aus Irak und Afghanistan und eine Einstellung der Einmischungen in Syrien und Libyen. Das ist so nicht umgesetzt worden. Auch aus dem „angedrohten“ Rückzug aus den NATO-Militärbasen in Europa ist ein Verschieben von Truppen in Länder mit vermeintlich US-freundlicheren Regierungen geworden. Dennoch haben Trump und seine Verbündeten eine zentrale Änderung der außenpolitischen Doktrin, weg von der „Weltpolizistin USA“, angekündigt. Die Bekanntgabe dieses Vorhabens wird von heftigen, aber kurzen Aggressionen begleitet, zum Beispiel dem angedrohten Krieg gegen den Iran. Das ist ein deutlicher Unterschied zu den dauerhaft angelegten Besatzungs- und Einschüchterungskampagnen unter Bush und Obama.
Eine noch wichtigere Verschiebung gab es in Bezug auf Freihandelsabkommen, die man als zentrales Werkzeug imperialistischer Staatspolitik verstehen kann. In den 1980er und 1990er Jahren trieben sie und das „regelbasierte Handelssystem“ den Zugriff amerikanischer Kapitale auf die Halbkolonien des globalen Südens voran. Das war auch das Ergebnis einer jahrzehntelangen Kampagne der politischen Unterwanderung, geheimdienstlicher Kampagnen und militärischer Aggression gegen Regierungen, die sich dem nicht unterordnen wollten und vor allem in Lateinamerika größtenteils beseitigt wurden. Angesichts der weitgehend verlorengegangenen Wettbewerbsvorteile amerikanischer Unternehmen und des verschärften Wettbewerbs imperialistischer Kapitalexporte um die Überausbeutung des globalen Südens wurde die imperialistische Konkurrenz zunehmend zur Gefahr für die amerikanische Vorherrschaft.
Die militärischen Interventionen der USA waren ab den 1990er Jahre vor allem auf die Sicherstellung der Energieversorgung, direkt durch Erdölimporte und indirekt durch geostrategische Absicherung, motiviert. Die Blutbäder in den beiden Golfkriegen, die Invasion Afghanistans und die Besatzung des Irak waren die konkreten Ergebnisse, außerdem die stetige Einflussnahme auf afrikanische Länder und die Drohungen gegen Libyen und Iran. Hier veränderten der technologische Wandel und der Aufstieg der USA zur Energieexporteurin die Bedingungen. Die Interessen, zumindest aus der Energieindustrie, sind sogar umgedreht, weil sich die teure Förderung aus Schiefergas und Teersand nur bei hohen Weltmarktpreisen überhaupt lohnt.
Der imperialistische Staat
Die Rolle des kapitalistischen Staates ist die des „ideellen Gesamtkapitalisten“ii. Das bedeutet drei Dinge: Zuerst einmal muss der Staat das Gesamtinteresse, die kapitalistische Ordnung aufrechtzuerhalten, durchsetzen mit Repression und Befriedung gegen aufbegehrende ArbeiterInnen und Unterdrückung, mit Regulierung und Gesetzen gegen die kurzfristigen Profitinteressen der EinzelkapitalistInnen. Historisch bedeutete das auch und vor allem das (teilweise gewaltsame) Durchsetzen von Märkten, Eigentumsrechten und dem System der Lohnarbeit, die von Konservativen fälschlich als „natürliche Ordnung“ des Kapitalismus dargestellt werden.iii
Zweitens muss der Staat die Interessen der EinzelkapitalistInnen gegeneinander abwägen, im Großen den aufstrebenden Fraktionen den Vortritt erlauben, aber auch eine Art „fair play“ zwischen diesen sicherstellen. Aber zuletzt tritt der Staat auch selbst als Kapitalist in Erscheinung, ist also nicht nur Werkzeug der KapitalistInnen, sondern entwickelt eigene unternehmerische Interessen.
Diese Rolle wird noch einmal auf die Spitze getrieben vom imperialistischen Staat. Der hat wiederum zwei zentrale Aufgaben: (1) Das Erweitern der Absatzmärkte für die Warenproduktion des inländischen Kapitals und für den Kapitalexport, (2) das Abwägen der Interessenswidersprüche zwischen Kapitalfraktionen im eigenen Land. Für die USA als weltweite Führungsmacht kommt, wie für andere imperialistische Länder auch, noch das Abwägen der Interessen von verbündeten Staaten und ausländischen Kapitalfraktionen dazu.
Wo der Kapitalismus an die Grenzen der inländischen Kapitalakkumulation stößt, erweitern die stärksten Kapitale ihren Einflussbereich über die Staatsgrenzen hinweg. Beim Erschließen von Absatzmärkten, aber auch günstigen Ressourcen und Arbeitskraft werden sie in der Regel vom militärischen und diplomatischen Staatsapparat unterstützt. Mit anderen Worten orientiert sich die Aufgabenstellung des ideellen Gesamtkapitalisten Staat am Expansionsdrang der Einzelkapitale.
Sie orientiert sich nur oberflächlich am Warenverkauf. Tatsächlich ist die zentrale Aufgabe jeden Kapitals die Akkumulation, also die Verwertung durch die Ausbeutung von Arbeitskraft. Die imperialistische Wirtschaftspolitik orientiert sich deshalb auch zentral am Kapitalexport. Für die USA bedeutet das, die Profite aus US-amerikanischen Unternehmen entweder direkt oder durch Kredite in die Ausbeutung außerhalb der USA zu investieren, wobei die Profite in der Regel wieder an das Ursprungskapital zurückfließen. Buchhalterisch ist das angesichts der heute weit verbreiteten multinationalen Steuerkonstruktionen nicht ganz so einfach nachzuzeichnen, Konzernstrukturen und die Nationalität der BesitzerInnen der weltweit größten Unternehmen geben hier aber deutliche Hinweise.
Auf dieser Grundlage werden wir in diesem Artikel die Interessen der US-Kapitalfraktionen in verschiedenen Perioden und die Auswirkungen auf die Außenpolitik nachzeichnen. Nach einer kurzen Aufzählung der Veränderungen aus den letzten Jahren in Abschnitt 2 zeichnen wir die Entwicklung des US-Kapitalismus skizzenhaft nach. Abschnitt 3 beschäftigt sich mit der Kolonisierung der USA, dem Aufbau des US-amerikanischen Kapitalismus und erster imperialistischer Bestrebungen sowie den qualitativen Brüchen im Ersten Weltkrieg und der Großen Depression. Abschnitt 4 behandelt die Ablösung der europäischen Kolonialreiche und der alten Koloniallogik durch den modernen Imperialismus, die Rolle des US-Finanzkapitals und die Konsolidierung der USA als imperialistische Führungsmacht nach dem Zweiten Weltkrieg. Abschnitt 5 beschreibt die geostrategischen Herausforderungen des Kalten Krieges, während Abschnitt 6 die Interventionen in Lateinamerika untersucht, auch um den Zusammenhang von Kapital- und Warenexport der USA mit Beispielen zu illustrieren. In Abschnitt 7 widmen wir uns schließlich der Periode des Freihandels und der „regelbasierten Weltordnung“ und besonders der Frage, welche Kapitalfraktionen diesen Kurs gegen andere, und zu deren Nachteil, durchsetzen wollten. Das erlaubt uns, im Abschnitt 8 die Bruchpunkte der US-Außen- und Wirtschaftspolitik in die Konflikte innerhalb des US-Kapitals einzuordnen. Die Vorstöße, aber auch Niederlagen der Trump-Regierung lassen sich dann ganz ohne Psychologisierung erklären. In Abschnitt 9 beschreiben wir schließlich die neue globale Situation, den grundlegenden Widerspruch zwischen den Interessen an protektionistischer Durchsetzung von kapitalistischen Einzelvorhaben und teurer geostrategischer Eingrenzung Chinas.
Das Ergebnis des Artikels ist eine historische Definition des US-Imperialismus, die eng an ein Verständnis der Kapitalexportdynamiken gebunden ist. Dieses auf die Situation besonders seit 2008 anzuwenden, und der Abgleich mit den Veränderungen der Trump-Außenpolitik im Vergleich zu den Regierungen Bush und Obama erlaubt uns schließlich, den Grundkonflikt im US-Imperialismus des 21. Jahrhunderts herauszuarbeiten.
2 Außenpolitik vor, während und nach Trump
Die Außenpolitik der USA steht auf drei stabilen Füßen militärischer, diplomatisch-geheimdienstlicher und wirtschaftlicher Herrschaft. Die Rolle als weltweite imperialistische Führungsmacht ist mehr als nur ein Regime des Kapitalexports (aber auch Kapitalimport über die amerikanischen Finanzmärkte), aber untrennbar damit verbunden.
Wie in jedem kapitalistischen Land ist ein stabiler politischer Herrschaftsanspruch, zum Beispiel des US-Präsidenten, an die Interessen wichtiger Teile des Kapitals und die weitgehende Duldung durch den Rest geknüpft. Das bedeutet in der Regel, dass scharfe Wendungen in der Regierungspolitik auch einen Wandel der Kapitalinteressen oder der Machtverhältnisse zwischen verschiedenen Kapitalfraktionen widerspiegeln. Umgekehrt sind Logik und Stoßrichtung politischer Veränderungen nur mit einer vernünftigen Analyse der Kapitalinteressen verständlich.
Aus zwei Gründen sind es in den USA vor allem die Außen-, Handels- und Kriegspolitik, in denen sich die Machtverschiebungen im Klassenkampf widerspiegeln. Zum weltweiten Führungsanspruch als wichtigste imperialistische Macht kommt noch die weitgehende Dezentralisierung der Wirtschaftsgesetzgebung auf die Bundesstaaten (also Steuern, Mindestlöhne und Regulierungen) und ein komplexes System von „checks and balances“ (Gewaltenteilung) auf Bundesebene hinzu. Aus diesen beiden Gründen sind es vor allem die Außen-, Handels- und Kriegspolitik, in denen sich die Machtverschiebungen im Klassenkampf oft zuerst widerspiegeln. Gleichzeitig hat die internationale Konkurrenz, zum Beispiel der Führungsanspruch Chinas oder die Formierung der EU als imperialistischer Block, mehr Auswirkungen auf die führenden Kapitalfraktionen in den USA als in anderen Ländern.
In den 1980er Jahren fügte das Kapital in den imperialistischen Ländern, ausgehend von den USA und Britannien, der ArbeiterInnenbewegung mit der erfolgreichen neoliberalen Wende entscheidende Niederlagen zu. Der historische Burgfrieden SozialpartnerInnenschaft, der die Stabilität in den Zentren gesichert und eine stabile Überausbeutung der Halbkolonien ermöglicht hatte, wurde abgelöst durch eine gezielte Absenkung der Lohn- und Steuerkosten.
Gleichzeitig veränderte sich auch der außenpolitische Fokus der USA, von regelbasierten Absprachen in der Wirtschaftspolitik (beispielsweise das Bretton-Woods-Abkommen zur Währungsstabilität) hin zu immer wichtiger werdenden Freihandelsabkommen. Diese sicherten freie Wege für den imperialistischen Kapitalexport, Zugang zu Absatzmärkten für (vor allem technologieintensive) Konsumwaren und nicht zuletzt eine Kontrolle der ölfördernden Staaten, die mit der Ölpreiskrise ab 1973 für die imperialistische Herrschaft zu einem Unsicherheitsfaktor geworden waren. Die Freihandelsabkommen sollten Protektionismus verhindern und den Wettbewerbsvorteil der Industriekapitale in den imperialistischen Staaten auch auf Absatzmärkten fern der Produktionsstätte verwertbar machen. Gleichzeitig hängt die internationale Arbeitsteilung in Form von globalen Produktionsketten von ungehindertem Transport ab. Und zuletzt ermöglichten die InvestorInnenschutz-Paragraphen der multilateralen Abkommen wie GATT und WTO den finanziellen Kapitalexport, der zum Hauptgeschäft der US-amerikanischen Finanzindustrie wurde.
In dieser Zeit wurde auch die Eskalation von Schuldenkrisen in den Halbkolonien zu einer regelmäßigen Erscheinung. In der neoliberalen Neuordnung der internationalen Beziehungen wurde diese Verschuldung zum zentralen Hebel. IMF und Weltbank forderten im Gegenzug für „Rettung“ vor der Staatspleite den Ausverkauf verstaatlichter Infrastruktur, aber auch massive Angriffe auf die ArbeiterInnenklasse ein. Davon profitierte das US-Kapital, das Investitionsmöglichkeiten in den privatisierten Industrien und fast unbegrenzte Ausbeutung von Rohstoffen und günstiger Arbeit erschloss.
Die Militärpolitik in dieser Zeit verband drei Hauptmotive: den geostrategischen Kampf gegen die Ausbreitung des Stalinismus (Vietnamkrieg), die Absicherung gegen erstarkende Ölrentenstaaten und das Eindämmen demokratischer und sozialer Bestrebungen in Lateinamerika und Afrika.
Vor allem seit dem Zusammenbruch der stalinistischen „Ostblock“staaten und ihrer Einflusssphäre sind die Interessen des US-Kapitals im Wandel. Der Wettbewerbsvorteil bei Lohnkosten und Profitabilität in der Industrieproduktion ist seit den 1990er Jahren weitgehend verschwunden, die Auslagerung von Produktion deutlich wichtiger. Danach war es vor allem die Vorherrschaft in der Hochtechnologie- und Finanzindustrie, die eine weitere Orientierung auf Freihandelsabkommen und die so genannte „regelbasierte Ordnung“ legitimierten. Dem Hochtechnologiesektor kommt der überproportionale Fokus auf geistiges Eigentum (TRIPS-Klauseln), dem Finanzsektor die Öffnung für Auslandsinvestitionen zugute, die in diesen Verträgen wichtige Rollen spielen.
Andere US-Kapitalfraktionen, die höhere Lohnkosten haben als die internationale Konkurrenz, wurden von diesen Abkommen aber teilweise schlechtergestellt. Und außerdem bedeuteten die europäische Integration durch das Zusammenwachsen der EU sowie der Aufstieg Chinas zur imperialistischen Macht, dass zunehmend Produktionsketten ohne Endmontage in den USA aufgebaut wurden.
Gleichzeitig erschloss die Energiebranche in den USA neue Methoden der Ölförderung (vor allem Schiefergas und Teersand), deren Profitabilität aber an einen möglichst hohen Weltmarktpreis für Öl und Gas gekoppelt ist. Ihre Erwartungen an die US-Außenpolitik sind weniger, niedrige Öl- und Gaspreise sicherzustellen, sondern direkte Unterstützung gegen die Konkurrenz auf dem Weltmarkt. Das ist mitverantwortlich für die Debatten um russische Pipelineneubauten (zum Beispiel der Nordstream 2), zu denen die amerikanischen Unternehmen auch auf Schiffen transportiertes Flüssiggas (Liquified Natural Gas, LNG) als Alternative anbieten. Folgerichtig stand im „Friedensvertrag“ am Ende der Strafzölle gegen die EU auch eine Selbstverpflichtung, die LNG-Einfuhr bis 2023 zu verdoppeln. Für den Ausbau der Terminals sind 650 Millionen Euro an Subventionen geplant.iv
Das hat die Interessen des US-Kapitalexports deutlich verschoben. Statt im Freihandel eigene Vorteile auszuspielen (die es so auch nicht mehr gibt), rufen wichtige Kapitalfraktionen nach einer direkten Subvention ihrer Wettbewerbsfähigkeit durch militärische und diplomatische Aggressionen. Dafür steht der Schwenk unter Trump, vor allem der Rückzug und die Neuverhandlung von Abkommen wie NAFTA, TTIP und TPP nach kurzen, aber heftigen Handelskriegen und das direkte Embargo gegen chinesische Hochtechnologie und russische Öl- und Gasprodukte.
Auch die Verschiebung in der Militärpolitik spiegelt diese neuen Interessen wider (auch wenn Trump sie bisher nicht gegen die entscheidenden Fraktionen im militärisch-industriellen Komplex der USA durchsetzen konnte). Der versprochene Rückzug aus Irak und Afghanistan sowie die kurzzeitig angestrebte Entspannung mit Iran und Russland sind möglich, weil das US-Kapital als Ganzes weniger von niedrigen Ölpreisen abhängig ist, teilweise sogar von hohen Kursen profitiert.
Die Außenpolitik der Trump-Regierung steht für den Anfang einer möglichen Verschiebung der US-Kapitalinteressen auf dem Weltmarkt. Sie ist nicht abgeschlossen und steht im Kampf mit anderen Kapitalfraktionen (vor allem in der Finanzindustrie), die den deregulierten Handel und Kapitalexport höher schätzen.
Gleichzeitig versucht sie aber den Spagat zwischen höherer Überausbeutung der Halbkolonien durch US-Kapitale und kostspieliger geostrategischer Absicherung gegen den imperialistischen Konkurrenten China. Dieser Widerspruch ist nicht einfach auflösbar und wird durch die Wirtschaftskrise seit 2019 weiter zugespitzt. Bei gleichzeitigem Aufstieg Chinas wird er auf eine weltweite Eskalation hinauslaufen.
3 Der Aufstieg der USA von der Kolonie zur Militärmacht
Die USA begannen ihren aufhaltbaren Aufstieg zur Weltmacht als Ansammlung englischer, französischer und spanischer Kolonien. Die spätere herrschende Klasse ebenso wie die amerikanischen ArbeiterInnen und KleinbürgerInnen gingen aus den KolonisatorInnen des nordamerikanischen Kontinents hervor. Die Besiedelung erfolgte nach bekanntem kolonialem Muster – Befestigung strategischer Landepunkte, schrittweise Eroberung oder Aneignung von Siedlungsgebieten auf Kosten der lokalen Bevölkerung und schließlich Zerstörung der bestehenden politischen Strukturen bis hin zur genozidalen Vernichtung aller indigenen Ethnien, die den Widerstand wagten.
Siedlerkolonialismus und Widerspruch zur kapitalistischen Produktionsweise
Die besondere Form des Siedlerkolonialismus bedeutete gewisse Herausforderungen für die Durchsetzung des globalen Kapitalismus. Nachdem die britische Vorherrschaft über die amerikanischen Kolonien mehr oder weniger feststand, wurde das zunehmend zum Problem. In Britannien war der Prozess (oder die erste Runde) der „ursprünglichen Akkumulation“ weitgehend abgeschlossen und alle wesentlichen Teile des Wirtschaftskreislaufs waren der kapitalistischen Produktionsweise unterworfen. Die Subsistenzwirtschaft der Kleinbauern/-bäuerInnen war mit dem „enclosure movement“ zerstört und die ehemaligen SelbstversogerInnen waren entweder zu LandarbeiterInnen ohne Besitz an Grund und Boden als Produktionsmitteln degradiert oder als Proletariat in die Städte gezwungen worden.
In den amerikanischen Kolonien hatte diese Trennung von ProduzentInnen und Produktionsprozess, die berühmte Expropriation der ProduzentInnen, noch nicht stattgefunden. Ganz im Gegenteil drängte der Kolonisationsgedanke die KolonisatorInnen aus der Alten Welt zur Landnahme auf Kosten der lokalen Bevölkerung, aber damit auch zum Landbesitz und zur Selbstausbeutung als unabhängige ProduzentInnen. Marx macht im 25. Kapitel der Ersten Bandes des „Kapital“ auf den diametralen Widerspruch zwischen Mutterland und Kolonie aufmerksam:
„Das kapitalistische Regiment stößt dort überall auf das Hindernis des Produzenten, welcher als Besitzer seiner eignen Arbeitsbedingungen sich selbst durch seine Arbeit bereichert statt den Kapitalisten. Der Widerspruch dieser zwei diametral entgegengesetzten ökonomischen Systeme betätigt sich hier praktisch in ihrem Kampf.“v
Folgerichtig beriefen sich die emigrierten KapitalistInnen auf ihre Macht und die Unterstützung „ihrer“ Regierung, um dieser Unausbeutbarkeit zu begegnen. Und das englische Parlament folgte mit Erlässen, die die Lohnarbeit vorschrieben, allerdings mit begrenztem Erfolg. Einen Kolonisator in Westaustralien, Peel, beschreibt Marx wie folgt: „Herr Peel war so vorsichtig, außerdem 3000 Personen der arbeitenden Klasse, Männer, Weiber und Kinder mitzubringen. Einmal am Bestimmungsplatz angelangt, ‚blieb Herr Peel, ohne einen Diener, sein Bett zu machen oder ihm Wasser aus dem Fluß zu schöpfen’. Unglücklicher Herr Peel, der alles vorsah, nur nicht den Export der englischen Produktionsverhältnisse nach dem Swan River!.“vi
Die englischen Produktionsverhältnisse waren durch große landwirtschaftliche Betriebe und Industriekapital geprägt, an die die Masse der ehemaligen Kleinbauern/-bäuerInnen ihre Arbeitskraft verkaufte. Der Verkauf der eigenen Arbeitskraft war erzwungen durch die systematische Enteignung und die Gesetze gegen Arbeitslosigkeit inklusive der Arbeitslager ähnlichen „poor houses“ (Arbeitshäuser für Arme).
Die systematische Enteignung war im sich noch ausbreitenden amerikanischen Kolonialismus schwer möglich. Um die Kolonien zu vergrößern, musste das Land den indigenen „first nations“ gewaltsam abgenommen, aber auch bestellt werden. Familiäre bäuerliche und forstwirtschaftliche Betriebe an der „frontier“ waren das politökonomische Werkzeug der Wahl, was den Besitz der ProduzentInnen an ihren eigenen Produktionsmitteln ausdehnte, statt ihn einzuschränken.
Zentralisierte Produktionsverhältnisse herrschten vor allem in der Plantagenbewirtschaftung vor. Diese war vor allem für größere zusammenhängende Betriebe profitabel. Statt auf enteignete Kleinbauern/-bäuerinnen griffen die KolonistInnen, vor allem in den südlichen Kolonien, auf Sklavenarbeit und Schuldknechtschaften von AuswanderInnen zurück.
Schuldknechtschaft
In den amerikanischen Städten wurden die industriellen Produktionsverhältnisse, vor allem aber die bürgerliche Hauswirtschaft, auch gewaltsam mit Zwangsarbeitskraft bestückt. Vor allem die ärmsten EinwanderInnen tauschten für die Überfahrt eine jahrelange Arbeitsverpflichtung ein, die an die europäische Leibeigenschaft erinnert. Wie die Sklaverei hatten diese Arbeitsverhältnisse ihren Ausgang in den südlichen Kolonien, beginnend mit Virginia. Diese ArbeiterInnen leisteten ihre Schulden auch auf Plantagen ab.
Dieses Modell funktionierte vor allem im 17. Jahrhundert, als entlassene Haus- und FabrikarbeiterInnen quasi nahtlos durch die massenhaft nachkommenden EmigrantInnen ersetzt werden konnten. Ab dem 18. Jahrhundert nahm die Zahl der „indentured serfs“ (KontraktsklavInnen, -leibeigene) langsam ab. Der zentrale Unterschied zur Sklaverei bestand darin, dass kein gewaltsamer Menschenraub, sondern ökonomische Not den Ausgangspunkt bildete. Gleichzeitig waren die Leibeigenschaftsverhältnisse in der Regel zeitlich begrenzt, und die Betroffenen gingen danach als freie ArbeiterInnen, HandwerkerInnen oder SiedlerInnen in das Wirtschaftsgefüge über.vii
Sklaverei
Die großräumige Plantagenwirtschaft breitete sich ab dem 17. Jahrhundert von Virginia ausgehend vor allem in den südlichen Kolonien aus. Wie die Wollproduktion in England nahmen der zentralisierte Anbau und die industrielle Verarbeitung von Tabak, Reis, Baumwolle und Zuckerrohr die zentrale Rolle in der ursprünglichen Akkumulation von Kapital in den amerikanischen Kolonien ein. Die ursprüngliche Akkumulation ist entscheidend, weil sie nicht nur die notwendige Monopolisierung der Produktionsmittel in den Händen der KapitalistInnen, sondern das Schaffen eines auszubeutenden Proletariats bedeutet. Die ursprüngliche Akkumulation schafft die wirtschaftlichen Voraussetzungen und die politischen Institutionen von Kapital und Lohnarbeit.
Ende des 17. Jahrhunderts wurde die Akkumulation auf Kapitalseite vor allem durch die Ausbeutung von SklavInnen, die aus afrikanischen Ländern und Gesellschaften verschleppt wurden, erreicht. Die terroristische Zerstörung von Familien- und Gesellschaftsstrukturen in Afrika durch SklavenhändlerInnen wurde auf dem amerikanischen Festland durch den Terror von Folter, Unterversorgung und riesigen Arbeitspensen fortgesetzt. Vor allem in den ersten Jahrzehnten der Sklaverei waren SklavInnen unglaublich günstig und wurden rasend schnell zum Tod durch Arbeit gezwungen. Entsprechend wurden von Virginia Gesetze erlassen, die die Entrechtung der SklavInnen (beziehungsweise die rechtliche Verfügung der SklavenbesitzerInnen) bis zur vollkommenen Entmenschlichung der AfroamerikanerInnen ausdehnten.
Unabhängigkeitskrieg
Bis zum Unabhängigkeitskrieg dehnte sich die Sklaverei so weit aus, dass in manchen Bundesstaaten mehr schwarze als weiße Menschen lebten. Gleichzeitig nahm die Bedeutung der Schuldknechtschaft bereits vor dem Unabhängigkeitskrieg ab, sowohl im Vergleich mit der Sklaverei als auch mit Lohnarbeitsverhältnissen in den nördlichen Kolonien. Mit den schweren wirtschaftlichen Krisen des späten 18. Jahrhunderts wurden langfristige Arbeitsverträge für die unter Druck stehenden amerikanischen KapitalistInnen auch mehr zur Belastung. Die massive Beschränkung der Einwanderung nach der Unabhängigkeit und die etablierten sozialen Strukturen der freien Lohnarbeit lösten die Schuldknechtschaft als ökonomischen Motor der kapitalistischen Akkumulation schließlich ab.
1776 riefen 13 ehemals britische Kolonien die amerikanische Republik aus. Der Unabhängigkeitskrieg war gleichzeitig kolonialer Aufstand und eine vollwertige bürgerlich-demokratische Revolution. Er wälzte die bestehenden sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse, die immer mehr zum Hindernis der Produktivkraftentwicklung geworden waren, grundlegend um.
Es hatte sich nämlich herausgestellt, dass der Nachbau der feudalen englischen Verhältnisse noch schwieriger war als die der kapitalistischen Produktionsbeziehungen. Bis auf das Hudson-Tal im heutigen Bundesstaat New York war es der britischen Krone nie gelungen, tatsächlich feudale Beziehungen in Amerika durchzusetzen (die feudale Enklave hielt dafür bis lange nach der Unabhängigkeitserklärung, nämlich bis 1839, durchviii). Trotzdem trug zum Beispiel die Beschwirtschaftung der Wälder in den westlichen Kolonialgebieten, die der Krone und der Marine vorbehalten war, durchaus feudale Züge. Auch der Landbesitz in den amerikanischen Kolonien war zunächst nach britischem feudalen Recht organisiert gewesen. Das bedeutete, die Krone (beziehungsweise ihre VertreterInnen vor Ort) vergab/en Landrechte und kassierte/n den Lehnszins (englisch: „quit rent“). Auch die Verdrängung der kolonialen Konkurrenz aus den Niederlanden, Spanien, Frankreich und sogar Deutschland hatte die Macht der britischen Krone gefestigt.
Gleichzeitig war es die Plantagenwirtschaft, in der neue Formen der Landwirtschaft (Monokultur) mit einer „neuen“ Form der Klassenausbeutung (Sklaverei) kombiniert wurden (Moore 2020)ix. Rechtlich war auch die Plantagenwirtschaft im Feudalismus verankert, die moderne Sklaverei war aber mit dem aufkommenden Kapitalismus ebenso vereinbar. Tatsächlich spielten die PlantagenbesitzerInnen der südlichen Kolonien eine wichtige Rolle in der Unabhängigkeit von der britischen Krone – ein klassisches Beispiel für die marxistische Überzeugung, dass die Entwicklung der Produktivkräfte die Grenzen der Produktionsverhältnisse sprengt.x
Dem Aufstand gegen die Monarchie gingen wichtige Rebellionen gegen lokale FeudalherrInen und SklavInnenhalterInnen voraus. Aufstände von SklavInnen und Schuldknechten/-mägden waren seit dem 17. Jahrhundert Teil der amerikanischen Geschichte und wurden nicht immer problemlos niedergeschlagenxi. Die Rebellion in Virginia 1676 („Bacon’s Rebellion“) brannte zum Beispiel die Hauptstadt der Kolonie, Jamestown, nieder.
Bei der Unterdrückung von ArbeiterInnen und SklavInnen standen KapitalistInnen und Kolonialbehörden auf derselben Seite. Aber die feudalen Landrechte standen der explosiven Produktivkraftentwicklung der amerikanischen KapitalistInnen im Weg. Steuern und Einfuhrbeschränkungen, aber auch die künstliche Verknappung der Geldmenge in den Kolonien, sollten verhindern, dass englische KapitalistInnen von ihren Landsleuten in den Kolonien ernsthafte Konkurrenz bekamen.
Gleichzeitig hatte sich im Krieg gegen indigene Nationen und die französische Kolonialkonkurrenz durch die ideologische Spaltungsrolle des Rassismus und die enorme Bedeutung, die den Kleinbauern/-bäuerinnen an der „frontier“ zukam, ein amerikanisches Nationalbewusstsein entwickelt. Dem stand die tyrannische Arroganz der britischen Krone als Feindbild gegenüber. Ein klassenübergreifendes Zweckbündnis wurde zum ersten Mal im Widerstand gegen die Stamp-Act-Steuern 1765 aktiv und begab sich vor allem im Streit um Steuern und Zölle in den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg, der 1776 gewonnen wurde.xii
Der amerikanische Kapitalismus nach der Unabhängigkeit
Zu diesem Zeitpunkt waren die ehemaligen Kolonien keine Außenstellen des britischen Empires mehr. Plantagenwirtschaft, Bodenschätze und die enthemmte Ausbeutung der SklavInnen bildeten eine ernstzunehmende wirtschaftliche Grundlage, die Zusammenarbeit auf dieser Basis stellte eine eigenständige politische Kraft dar.
Die Schutzzollpolitik der ersten amerikanischen Regierungen schaffte es schließlich auch, eine eigene Schwerindustrie vor allem in den nördlichen Bundesstaaten aufzubauen. Die protektionistische Politik war bereits ein Streitpunkt unter der Kolonialherrschaft gewesen. Die britische Krone hatte schließlich aktiv versucht, den Aufbau einer eigenständigen amerikanischen Industrie zu verhindern. Es dauerte allerdings bis 1789, bis der amerikanische Kongress überhaupt das Recht bekam, bundesweite Zölle einzuführen, und bis nach dem Krieg gegen England 1812, bis diese hoch genug angesetzt waren, um als Schutzzölle bezeichnet zu werden.xiii Die Frage der Schutzzölle wurde auch zu einem zentralen Streitpunkt zwischen den späteren nördlichen und südlichen FeindInnen im BürgerInnenkrieg 1861 – 1865: Die Industriellen im Norden bauten sich ihre Produktion hinter den Zollmauern auf, während die landwirtschaftlichen GroßbesitzerInnen im Süden von günstig importierten Industrieprodukten weitgehend abhängig waren.
Nach dem Sieg der Nordstaaten im BürgerInnenkrieg setzten sich die Industrieproduktion und die doppelte Freiheit der ArbeiterInnen durch. Gleichzeitig wurde die systematische Entrechtung der schwarzen Bevölkerung weitgehend in anderer Form fortgesetzt. Das diente einerseits der enthemmten Ausbeutung von landlosen schwarzen Schuldknechten/-mägden als „sharecroppers“ (PächterInnen) in den großen landwirtschaftlichen Betrieben, andererseits dem Bündnis mit dem finanzstarken und enorm rassistischen Kapital in den Südstaaten.
Wendepunkt im Weltkrieg
In den ca. 50 Jahren zwischen BürgerInnenkrieg und Erstem Weltkrieg entwickelten sich die USA zu einer führenden Industrienation. Die Entwicklung zur imperialistischen Macht erfolgte jedoch bis zum Ersten Weltkrieg auf besondere Weise. Von einer dominanten Rolle des Kapitalexports, vor allem außerhalb des amerikanischen Kontinents, kann erst nach 1918 gesprochen werden.
„Bis 1914 ähnelten die Kapitaleinfuhr und die Handelsbilanz der USA derjenigen eines unterentwickelten Landes, obwohl sie bereits die erste Industrienation der Welt waren. […] Wie ein unterentwickeltes Land führten sie [die USA; d. Red.] Agrar- und Montanerzeugnisse aus, und wie ein solches waren sie per saldo Schuldnerland, das heißt: das in den USA angelegte europäische, hauptsächlich britische Kapital betrug etwa 7,2 Milliarden US-Dollar, war also etwa doppelt so umfangreich wie das eigene Auslandskapital der USA, das etwa 3,5 Milliarden US-Dollar ausmachte.”xiv
Das war aber kein „Zurückbleiben“ des sich entwickelnden amerikanischen Imperialismus, sondern eher eine Besonderheit, eine Form von ungleichzeitiger und kombinierter Entwicklung, die wir auch bei anderen Großmächten vor dem Ersten Weltkrieg (z. B. dem ökonomisch rückständigen Russland) finden. Durch den fortschreitenden Landraub an den indigenen „first nations“ richtete sich die Expansion des US-Kapitals über weite Strecken nach innen. Die Staaten verfügten außerdem über eine breite Palette an natürlichen und seltenen Rohstoffen. Die Expansion auf der Suche nach Ressourcen war also nicht so drängend wie für kleinere imperialistische Staaten. Und zuletzt entwickelten sich die USA zu spät, um einen klassischen Kolonialismus anzustreben. Aus diesen Gründen stieß das US-Kapital in dieser Periode noch nicht an die nationalen Grenzen der Akkumulation.
In anderer Hinsicht beteiligte sich das Land aber sehr wohl an der imperialistischen Konkurrenz. Der Spanisch-Amerikanische Krieg 1898 und die folgende Besatzung von Kuba, Puerto Rico, Guam und den Philippinen bedeuteten die Durchsetzung der eigenen Vormachtsansprüche auf beiden amerikanischen Halbkontinenten. Auch der gewonnene Krieg gegen Mexiko 1846 – 1848 war getrieben vom Anspruch, den potentiellen Konkurrenten klein zu halten. Mexiko war den USA als unabhängig gewordene Kolonie, geprägt von Plantagenwirtschaft, Genozid an der indigenen Bevölkerung und rascher kapitalistischer Entwicklung, recht ähnlich und durchaus ein natürlicher Konkurrent um die regionale Vorherrschaft – wobei der Begriff der Region auf die 12 Millionen Quadratkilometer Mexikos und der USA schwer anwendbar ist. Zu verhindern, dass sich andere ImperialistInnen in der eigenen Einflusssphäre entwickeln oder festsetzen konnten, war mehr als nur eine Vorbereitung des eigenen Aufstiegs, es war die Vorwegnahme der eigenen imperialistischen Kapitalexportpolitik.
Bereits vor dem Eintritt in den Ersten Weltkrieg war das amerikanische Kapital tief in die Kampfhandlungen auf dem Kontinent verstrickt. Milliardenkredite an die kriegführenden Länder bedeuteten widersprüchliche Loyalitäten der amerikanischen Banken. Diese waren gleichzeitig groß genug und mit dem Industriekapital verwachsen, um die Voraussetzungen für den imperialistischen Kapitalexport darzustellen. Mit Kriegseintritt übernahm die Bundesregierung die Ausfallrisiken für die umfassenden Kriegskredite und gab selbst Kriegsanleihen an ihre europäischen Verbündeten von ungefähr 9 Milliarden US-Dollar aus. Die deutschen Reparationen aus dem Vertrag von Versailles gingen großteils direkt an die amerikanischen GläubigerInnen, ab 1924 auch sogar ohne den Umweg über französische oder britische Konten.xv
Durch diese Kredite wurden die USA während des Ersten Weltkriegs schlagartig zum weltweit führenden Kapitalexporteur. Gleichzeitig brachen sie mit dem System der britischen Vorherrschaft, das immer eine passive Waren- bei aktiver Kapitalbilanz aufrechterhalten hatte (also mehr Waren importierte als ins Ausland verkaufte). Die Schutzzollpolitik und die weitgehende Selbstversorgung mit Rohstoffen aus den sehr großen eigenen Gebieten ließen die USA zur ersten weltwirtschaftlichen Vorreiterin mit doppelt aktiver Außenbilanz werden.
Der Kapitalexport über Kredite und Auslandsinvestitionen führte über die Erträge zu einem stetigen Zahlungsfluss in die USA. Dasselbe galt für die Waren, die ins Ausland verkauft und aus dem Ausland bezahlt wurden. Strukturell waren die Importe durch geringen Arbeitseinsatz (und daher Arbeitswert), die großteils industriellen Exporte durch hohen Arbeitswert geprägt. „Kurz: als weltwirtschaftliches Führungsland sprengen die USA die weltwirtschaftliche Arbeitsteilung.“xvi
Hier zeigt sich auch, dass in der politisch-ökonomischen Analyse Imperialismus- und Krisentheorie nicht voneinander trennbar sind. Die hohe Abhängigkeit der amerikanischen Profite von inländischer Arbeit und die geringen Einsparpotentiale auf Kosten von Lohnsenkungen vertieften die Weltwirtschaftskrise in den 1920er Jahren ungemein.
Geschichte: Veränderte Lage durch Depression und Weltkrieg
Die Regierung unter Roosevelt versuchte zwischen 1933 und 1939, die strukturelle Krisenanfälligkeit und die soziale Instabilität durch Fiskalpolitik und einen garantierten Lebensstandard für die amerikanische ArbeiterInnenklasse zu lösen. Die durch die imperialistischen Extraprofite finanzierte höhere Absicherung der ArbeiterInnenaristokratie im Speziellen und der Klasse im Allgemeinen ist eine wichtige Voraussetzung für Stabilität in den imperialistischen Zentren. Dabei stützten sich die Vorschläge des „New Deal“ auf eine Koalition aus Teilen des Finanz- und Industriekapitals und versprachen die Befriedung der verarmten ArbeiterInnen und KleinBauern/-bäuerinnen. Die wichtigsten Elemente waren ein institutionalisiertes gewerkschaftliches Koalitionsrecht, eine Fixpreisgarantie für größere FarmerInnen, die Entflechtung der Industrie und die Trennung von Anlage- und Geschäftsbanken (Glass-Steagle-Act).
Das zweite große Versprechen des New Deals war eine frühkeynesianische Krisenstrategie, die zusammengebrochene Binnennachfrage durch Fiskalpolitik, also erhöhte und teilweise schuldenfinanzierte Staatsausgaben, wieder aufzurichten. Das scheiterte weitgehend. Erst der Zweite Weltkrieg, der über Rüstungspolitik und Preiskontrollen sowohl Beschäftigung als auch Profite stabilisierte, führte die USA aus der Krise. Aber auch die Schaffung staatlicher und genossenschaftlicher Energieträger wirkte sich stabilisierend auf Preise und Inflation aus.
4 Die veränderte Lage nach dem Zusammenbruch der europäischen Kolonialherrschaft
In Folge des Zweiten Weltkriegs standen sich zwei Modelle in der amerikanischen Außenpolitik gegenüber. Eine wirtschaftliche Vernichtung der europäischen KriegsgegnerInnen wurde, zum Beispiel durch den Morgenthau-Plan symbolisiert, vorgeschlagen, der die Binnennachfrage in Europa nachhaltig zerstört hätte. Dem gegenüber stand die großzügige Aufbauhilfe unter antikommunistischem Banner des Marshall-Plans, der schließlich zum Modell der amerikanischen Außenpolitik werden sollte.
Imperialistische Abhängigkeit der Halbkolonien
Die internationale Vorherrschaft durch Entwicklungspolitik und geopolitische Abhängigkeiten wurde für die USA umso wichtiger, als nach dem Zweiten Weltkrieg die verbliebenen europäischen Kolonialreiche zusammenbrachen. Anstelle der direkten Besatzung, die vor allem Britannien und Frankreich eine Vormachtstellung in der imperialistischen Aufteilung der Welt sicherte, trat die Dominanz durch Kapitalexport, Handelsabkommen, militärische Bedrohung und Geheimdienstapparate. Hier konnten die USA sich sowohl mit ihren besonders großen Ressourcen hervortun als auch vom weggefallenen Wettbewerbsnachteil gegenüber den ehemaligen Kolonialreichen profitieren.
„Seit dem zweiten Weltkrieg ist das Imperium der Vereinigten Staaten an die Stelle der europäischen Kolonialreiche getreten. Es besteht aus völkerrechtlich unabhängigen Staaten, nicht Kolonien. Organisiert ist es durch nordamerikanische Kapitalausfuhr, und zwar durch direkte Investitionen (Bestand Ende 1972 25,2 Milliarden in den unterentwickelten Ländern, 94 Milliarden insgesamt), subsidiär durch die ,Auslandshilfe’. Die nordamerikanische Kontrolle variiert zwischen einerseits indirektem, elastischem Einfluß, dem nicht nur unterentwickelte Länder unterliegen, sondern auch die bis zum zweiten Weltkrieg selbständigen imperialistischen Mächte Europas sowie Japan, andererseits unverhüllter Waffengewalt, womit Marionettenregierungen wie die südvietnamesische, südkoreanische, guatemaltekische gegen ihre eigene Bevölkerung verteidigt werden.“xvii
Das drückte sich auch in der Politik des „Cordon sanitaire“ (Sicherheitsgürtel) aus, mit dem sich die USA gegen ihre neuen Hauptfeinde Sowjetunion und China umgaben. Die USA bauten ihre geostrategische Absicherung auf der Abhängigkeit neokolonialer Staaten in Asien und Afrika auf. In einige dieser Länder gab es kaum Kapitalexport, und die „Entwicklungshilfe“ beruhte fast ausschließlich auf geostrategischen Interessen (Taiwan, Korea, Vietnam, Laos, Kambodscha, Pakistan, Türkei, Israel und Griechenland). In Afrika mischten sich militärische mit wirtschaftlichen Interessen, wo es amerikanischen KapitalistInnen gelingen sollte, Profite mit Rohstoffausbeutung zu machen, zum Beispiel in Libyen (Erdöl), im späteren Kongo (Kobalt, Kupfer, Uran) und in Ägypten. In Südafrika profitierten AnlegerInnen von der höheren Profitrate aufgrund der Apartheiddiktatur und der systematischen Überausbeutung der schwarzen ArbeiterInnenklasse.
Umkehr in die Verschuldung
Die 1960er Jahre führten zum ersten entscheidenden Bruch in der Rolle des amerikanischen Imperialismus. Während in den 1920er Jahren die Zahlungsunfähigkeit der europäischen KreditnehmerInnen, die Schwierigkeiten hatten, ausreichend Dollars für Rückzahlungen zusammenzukratzen, das Bankensystem unter Druck gesetzt hatte, begannen die USA spätestens ab 1965, sich massiv in europäischen Währungen und Yen zu verschulden. Die Schulden überstiegen die Deviseneinnahmen um ein Vielfaches und dienten nicht zuletzt dazu, den extrem teuren Vietnamkrieg zu finanzieren.
„Diese Verschuldung bewerkstelligten die USA vermittels der damaligen Stellung des Dollar als Weltwährung: die ausländischen Notenbanken mit Ausnahme der Banque de France hielten ihre Notendeckung überwiegend nicht in Gold, sondern in Devisen, hauptsächlich Dollardevisen.“xviii
In dieser Periode drückte sich die imperialistische Vormachtstellung nicht mehr durch die internationale Dominanz der US-Kredite, sondern durch die militärische und politische Vormachtstellung innerhalb des westlichen Blocks aus. Diese militärisch-geheimdienstliche Überlegenheit wurde ab den 1960er Jahren wiederum zur Grundlage des Aufbaus weiterer ökonomischer Abhängigkeiten, auch und vor allem in Südamerika.
Amerikanischer Kapitalexport und der Krieg in den Hinterhöfen
Neben den genannten Interventionen in Asien und Afrika konzentrierte sich die US-Außenpolitik in den 1960er Jahren auch auf Lateinamerika. Das war eine direkte Fortführung der Marionettenregierungen und direkten Eroberungen seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert. Vor allem die engen Verflechtungen der fast monopolartig agierenden United Fruit Company mit dem Militär- und Geheimdienstkomplex der USA, inklusive Putschen, Diktaturen und Mordschwadronen gegen GewerkschafterInnen sind auch weltweit skandalisiert worden.
Eine zentralisierte Strategie in Lateinamerika wurde über die Entwicklungshilfe organisiert. Zur effizienten Verteilung und Erzwingung von politischen Reformen wurde 1961 die „Allianz für den Fortschritt“ gegründet, die Hilfszahlungen an konkrete politische Projekte und vor allem Landreformen knüpfen sollte.xix Das gleichzeitige Entwicklungsversprechen, in der Abhängigkeit massives Wirtschaftswachstum in den betroffenen Staaten zu ermöglichen, blieb selbstverständlich unerfüllt.
Die Dependenztheorie erkennt richtig, dass die Entwicklung der süd- und mittelamerikanischen Wirtschaften in dieser Periode fast ausschließlich vom Investitionsverhalten des US-Kapitals und den importierten Technologien abhängt.xx Der Kapitalexport aus den imperialistischen Ländern baut und festigt so die Grundlagen der internationalen Arbeitsteilung. Diese war bereits in der kolonialen Unterentwicklung durch den Kolonialismus festgelegt, wo die Rohstoff- und Arbeitsressourcen der Kolonien das Wachstum der Zentren finanzierten und das eigene dadurch gehemmt wurde. Die Übersetzung der wirtschaftlichen Abhängigkeit in entsprechende politische Strukturen sollte zum Beispiel durch die „Allianz für den Fortschritt“ institutionalisiert werden.
Die imperialistische Rolle der USA in Süd- und Mittelamerika beginnt knapp vor dem Ersten Weltkrieg, fällt also mit ihrem Aufstieg zur imperialistischen Macht zusammen. Zwischen 1897 und 1914 verfünffachten sich die US-Investitionen von 308 Millionen US-Dollar auf 1,6 Milliarden US-Dollar.xxi
Ab den 1960er Jahren nahmen die Direktinvestitionen erneut massiv zu und stiegen bis 1980 um das Dreifache, bis 1990 sogar um das Fünffache an.xxii In den meisten Ländern sank das Verhältnis ausländischer Direktinvestitionen zum Bruttoinlandsprodukt zwischen 1914 und 1960 recht massiv, stieg jedoch bis 1990 wieder leicht an. Sowohl von den Interessen des US-Kapitals als auch von der Abhängigkeit der süd- und mittelamerikanischen Halbkolonien ausgehend, blieb der verächtlich „Hinterhof Amerikas“ genannte Halbkontinent also immer zentral für den US-Imperialismus.
Warenexporte
Wie zuvor ausgeführt, war der Aufstieg der USA zur imperialistischen Weltmacht nach dem Ersten Weltkrieg aus zwei Gründen bemerkenswert. Erstens war für den Durchbruch die amerikanische Kolonialgeschichte deutlich weniger relevant als die Kreditabhängigkeit anderer imperialistischer Staaten; die Bedeutung direkt-kolonialer Überausbeutung blieb für den amerikanischen Imperialismus weitgehend marginal. Zweitens waren die USA gleichzeitig Waren- und Kapital-Nettoexporteurinnen.
Mit dem Umdrehen der Kreditabhängigkeit nahm in den 1970er Jahren die Bedeutung des Warenexports wieder deutlich zu. Zwischen 1970 und 1974 stieg der Anteil der Exporte am US-Bruttoinlandsprodukt von 6 auf 10 %. Auf eine kurze Dämpfung des Exportwachstums 1981 – 1987 (wegen des gestiegenen Dollarkurses) folgte ein weiterer Anstieg bis in die 1990er Jahre.xxiii
5 Kalter Krieg und das „Ende der Geschichte“
Der Kalte Krieg war die prägende geopolitische Ordnung nach dem Sieg über den Nazifaschismus. Er war Ausdruck der Teilung der Welt in zwei Hauptblöcke, in denen die USA und die UdSSR jeweils wirtschaftlich vorherrschend waren. Der Kapitalismus zeichnet sich dadurch aus, dass kapitalistische Produktionsformen vorherrschend sind und andere Produktionsverhältnisse dem untergeordnet werden. Genauso funktioniert das auch mit dem Imperialismus, der durch das kapitalistische Herrschaftsverhältnis zwischen Nationen „definiert“ ist, deren ökonomische und politische Dynamik die Grundlage einer Imperialismusanalyse sein muss. Eine „Checkliste“, mittels derer Kriterien abgehakt werden, um festzustellen, ob ein Land nun imperialistisch wäre oder nicht, gibt es nicht.
Imperialismus stellt vielmehr eine internationale, ökonomische und politische Ordnung dar. Es ist diese Totalität, nicht einzelne Eigenschaften, die einem Land und dessen Gesamtkapital eine bestimmte Stellung zuweist/zuweisen. Darüber bestimmt sich, ob ein Land imperialistisch ist oder nicht.
Der Sieg über den Faschismus erlaubte der Sowjetunion die umfassende Ausbreitung der bürokratischen Planwirtschaft und die endgültige Durchsetzung der Theorie von den geopolitischen „Einflusssphären“. Diese war gleichzeitig eine vorgeblich zeitweise Anerkennung der kapitalistischen Vorherrschaft außerhalb der sowjetischen Einflusssphäre. Auf der anderen Seite wurde durch den Sieg im Krieg ohne große wirtschaftliche Zerstörung im eigenen Land die Vorherrschaft der USA in den kapitalistischen Ländern abgesichert. Das US-amerikanische Kapital war in der Lage, durch Kriegsproduktion und Aufbau die Weltwirtschaftskrise zu überwinden.
Die antisowjetische Haltung wurde in den Nachkriegsjahren zu den Leitlinien der US-imperialistischen Politik. Militärbündnisse, Wirtschaftsverträge und „Entwicklungshilfe“ waren neben dem profitablen Kapitalexport auf die geostrategische Absicherung ausgerichtet. Die gemeinsame „Bedrohung“ erlaubte auch eine relative Einheit der konkurrierenden nationalen Kapitale unter amerikanischer Führung, zumindest in den imperialistischen Ländern.
Ein wichtiges strategisches Element des kalten Kriegs bildete der Rüstungswettlauf. Nachdem die sowjetischen Einflusszonen zu groß waren, um sie mit Embargos oder Boykotts erfolgreich in die Knie zu zwingen, stellten das Wettrüsten und kostspielige Kriege (Afghanistan, Kambodscha, Angola, Mosambik, Äthiopien und Nicaragua) einen Versuch dar, die bereits stagnierende bürokratische Planwirtschaft in die Krise zu treiben. Gleichzeitig war die Aufrüstung aber auch in den imperialistischen Ländern kostspielig, was diese durch Überausbeutung der Halbkolonien nicht immer ausgleichen konnten. Außerdem beförderte sie den Aufbau der Friedensbewegung und damit politischer Opposition in den imperialistischen Zentren – ein riskanter Widerspruch für ein System, das die Kontrolle über die Peripherie mit Privilegien für die heimischen ArbeiterInnen absichert. Die Unterdrückung des US-Proletariats in diesen Jahrzehnten war vor allem durch die rassistische Spaltung und weitgehende demokratische Entrechtung, aber auch das Fehlen einer ArbeiterInnenpartei und weitgehende Bindung der Gewerkschaften an die bürgerliche Ddemokratische Partei, abgesichert.
In der voranschreitenden Krise der sowjetischen Wirtschaft und damit der Herrschaft der Parteibürokratie waren vor allem die niedrige Arbeitsproduktivität und die Überproduktion nicht nachgefragter oder qualitativ minderwertiger Waren (in anderen Worten ein Versagen in der Gebrauchswertproduktion) bestimmend. Als Antwort fand die Fraktion unter Gorbatschow die Wiedereinführung kapitalistischer Marktmechanismen in der Perestroika-Politik (russisch: „Umstrukturierung“), während der zunehmenden Opposition aus der ArbeiterInnenklasse (zum Beispiel in Polen) mit einer Lockerung der politischen Repression im Rahmen der Glasnost (russisch: „Öffnung“) geantwortet wurde.
Dadurch kam es zum rapiden Aufstieg von neuen KapitalistInnen, die sich im Außenhandel eng an InvestorInnen aus den imperialistischen Ländern banden. Die planwirtschaftliche Bürokratie in ihrer Stagnation war nicht in der Lage, dieser explosiven Kraft zu widerstehen, und binnen weniger Jahre wurde die kapitalistische Wiederaneignung in der gesamten sowjetischen „Einflusssphäre“ zum großen Nachteil der ArbeiterInnen durchgesetzt.
Zu Beginn des Kalten Kriegs hatten sich die USA als unbestrittene Führungsmacht in der imperialistischen Welt durchgesetzt, wozu der gemeinsame Außenfeind aller KapitalistInnen mindestens ebenso bedeutend war wie der Kriegsgewinn. Dafür hatte sich eine andere „Supermacht“ als direkte Konkurrentin zum US-Imperialismus aufgestellt. Mit deren Untergang schien die Vorherrschaft des US-Kapitals besiegelt, einbetoniert, was sich im berühmten Buchtitel von Francis Fukuyama vom „Ende der Geschichte“ als Sieg der neoliberal-militaristischen Politik ausdrückte. Nur 30 Jahre später steht diese Vorherrschaft aber wieder auf dem Spiel. Es scheint fast, als würde die Geschichte der Klassengesellschaften kein kapitalistisches Ende kennen.
6 Freihandelsabkommen und regelbasierte Weltordnung, Krieg gegen die „islamische Welt“
Der Rückzug der Trump-Regierung aus zahlreichen multilateralen (also zwischen mehr als zwei Ländern abgeschlossenen) Verträgen von Pariser Klimaabkommen bis NAFTA wurde als potentielles Ende der „regelbasierten Weltordnung“ diskutiert. Diese wird auch als Gegenentwurf zum Chaos der imperialistischen Konkurrenz zwischen Handelskrieg und StellvertreterInnenkonflikten verhandelt. So schreibt zum Beispiel das deutsche Außenministerium in seiner Bewerbung um einen Platz im UN-Sicherheitsrat: „Als global vernetztes Land setzen wir uns für eine regelbasierte Weltordnung ein, die von der Stärke des Rechts und nicht durch das Recht des Stärkeren geprägt ist.“xxiv
Die Ideologie von der regelbasierten, multinationalen und kapitalistischen Weltordnung findet ihren ersten Ausdruck in internationalen Organisationen wie dem Völkerbund, dem Vorläufer der Vereinten Nationen (UNO). Die liberal-demokratische Kritik an deren politischer Zahnlosigkeit wird vor allem deutlich, als im Gegensatz dazu weltweite Wirtschaftsabkommen ihre Durchsetzungsfähigkeit beweisen. Das Währungsabkommen von Bretton Woods und der Aufbau der Weltbank und des IWF nach dem Zweiten Weltkrieg sind erste Beispiele für diese vertragliche Institutionalisierung.
Für die US-Vorherrschaft besonders bedeutend sind aber die Verhandlungsrunden um das Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen GATT 1947 (die 1995 in der Welthandelsorganisation WTO aufging) und die Gründung der G7 (Gruppe der sieben „wichtigsten“ kapitalistischen Nationen) nach der Ölpreiskrise 1973. Die Zahl der Freihandels- und Präferenzabkommen liegt mittlerweile in den Hunderten.xxv
Vorgeblich dienen diese Abkommen dem Zweck, gleichberechtigte oder sogar für unterentwickelte Länder vorteilhafte Bedingungen im Kapital- und Warenexport zu schaffen. Das baut auch auf den neoricardianischen oder neoklassischen Ideologien auf, dass ungehinderter (also zoll- und quotierungsfreier) Handel immer und für alle Beteiligten vorteilhafter ist.
Tatsächlich zeigt aber genau der wirtschaftliche Aufstieg der USA, wie „freier“ Handel die globalen Ungleichheiten und Abhängigkeiten noch verstärkt. Im kapitalistischen Wettbewerb setzen sich in der Regel die stärkeren Kapitale durch, und wo es Ungleichheiten im Warenfluss gibt werden diese nicht durch Gegengeschäfte, sondern durch Schuldenfallen ausgeglichen. Die Illusion von einer globalen Arbeitsteilung zum gegenseitigen Vorteil präsentiert sich in der Realität als Dystopie der imperialistischen Überausbeutung, organisiert von exportiertem Kapital.
7 Bruchpunkte: Wo machen die Trump-Maßnahmen einen Unterschied?
Rückzug aus multilateralen Abkommen
Die öffentlichkeitswirksamste Veränderung der US-Außenpolitik unter Trump war der Rückzug aus mehreren internationalen Abkommen, die zur Handschrift der Obama-Regierung gehört hatten. Neben dem Pariser Klimaabkommen und der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zog sich Trump aus der „Transpazifischen Partnerschaft“ TPP der transatlantischen Handels- und Investmentpartnerschaft TTIP und dem nordamerikanischen Freihandelsabkommen NAFTA zurück.
NAFTA war ein Modellbeispiel für den ausbeuterischen Charakter von Freihandelsabkommen, ein Symbol, gegen das linke AntiimperialistInnen und GlobalisierungskritikerInnen seit Jahrzehnten Sturm liefen. Während sich Ängste der Gewerkschaften nach einem Lohnverfall bei amerikanischen ArbeiterInnen durch vereinfachte Abwanderung nicht belegbar bewahrheitetenxxvi, zementierte NAFTA mit seinen Verkaufsquoten und Zollverboten die Abhängigkeit Mexikos von den USA. Die berüchtigten „InvestorInnenschutz“paragraphen, die es Unternehmen erlaubten, Staaten für unliebsame und profitgefährdende Gesetze zu verklagen, sowie Eingriffsrechte der USA in den Außenhandel Mexikos (zum Beispiel mit Kuba, Bolivien oder Venezuela) unterstrichen den offenen Herrschaftscharakter von scheinbar gleichberechtigten Freihandelsabkommen. Selbst konservative (neoklassische) ÖkonomInnen schätzen, dass die direkten wirtschaftlichen Vorteile, die NAFTA den US-KapitalistInnen brachte, nicht auf „ungehinderten“ Handel zurückzuführen sind, sondern auf Kosten der halbkolonialen VertragspartnerInnen gingen.xxvii NAFTA wurde 2018 von Trump aufgekündigt und durch das USMCA-Abkommen ersetzt, das außer einer schrittweisen Verbesserung der US-Position (Zugang zum kanadischen Markt für Landwirtschaftsprodukte, vorteilhafter Protektionismus in der Autoproduktion) keinen Bruch mit NAFTA darstellt. (USMCA = United States-Mexico-Canada-Agreement)
Auch TTIP war in Europa Gegenstand linker und linksliberaler Kritik, ebenfalls wegen des InvestorInnenschutzes und der Angleichung (also in Europa überwiegend der Verschlechterung) von Umweltschutz- und KonsumentInnenschutzregeln. Auch der offene Versuch, einen westlichen Wirtschaftsblock mit militärischer Hintergrundmusik gegen imperialistische Rivalinnen in China und Russland aufzubauen, drückte zwar nur die zunehmenden imperialistischen Zuspitzungen aus, weckte aber durchaus Widerstand. Die Verhandlungen um TTIP wurden 2016 von Trump abgebrochen. Nach dem vorläufigen Abschluss des Handelskriegs gegen die EU wurden 2019 Verhandlungen um ein neues Abkommen wieder aufgenommen.
Die transpazifische Partnerschaft TPP wurde als Bündnis von Australien, Brunei, Kanada, Chile, Japan, Malaysia, Mexiko, Neuseeland, Peru, Singapur und Vietnam unter Führung der USA 2016 unterschrieben. Es war das Kernstück von Obamas Asienstrategie zur Eindämmung des chinesischen Einflusses und wäre mit einer Abdeckung von 40 % der globalen Wirtschaft das größte Freihandelsabkommen der Welt gewesen. Die gegenseitige Bevorteilung in Handel, Zoll und vor allem Wertschöpfungsketten wäre nicht bloß auf den amerikanischen Kapitalexport, sondern auch auf die geopolitische Eindämmung Chinas ausgelegt gewesen. Die Trump-Regierung zog sich nur wenige Monate nach der Regierungsübernahme aus TPP zurück, das damit eigentlich hinfällig ist.
Ihr Rückzug ist generell nicht als Absage an den Freihandel und erst recht nicht als ideologische Ablehnung von Globalisierung oder weltweiten Produktions- und Ausbeutungsketten zu verstehen. Die von Trump als Feindbild bemühten „GlobalistInnen“ sind Elemente einer antisemitische Verschwörungstheorie und haben mit Globalisierung nichts zu tun. Vor allem die rasche Neuverhandlung nach dem Säbelrasseln von Handelskrieg und Embargodrohungen (die vor allem 2017 und 2018 das Verhältnis von USA, China und EU prägten) zeigt, dass kein Ende des „freien“ Handels ansteht. Vielmehr geht es darum, die implizite ökonomische Wahrheit, dass freierer Wettbewerb zugunsten der stärkeren Kapitale geht, noch einmal mit der militärischen, diplomatischen und geheimdienstlichen Stärke des US-„Gesamtkapitalisten“ zu unterstreichen.
Das amerikanische Kapital zeichnete sich zu Beginn seines ökonomischen Aufstiegs durch Wettbewerbsvorteile sowohl in der Industrieproduktivität als auch der Finanzinstitutionen aus. Nach der umfassenden Kapitalzerstörung in Europa und Ostasien durch den Zweiten Weltkrieg waren freierer Handel und Investititionsfluss die Schlüsselstrategie zur weltweiten amerikanischen Machtausübung.
Der Vorteil in der Produktivität ist dank partiellem Technologieexport, niedrigeren auwärtigen Lohnkosten und der teilweise maroden US-Infrastruktur ein abnehmender für den US-Imperialismus. Die zunehmende Bedeutung von „handelsbezogenen geistigen Eigentumsrechten“ (TRIPS), die konservativen ÖkonomInnen ein theoretischer Graus sindxxviii waren ein Versuch, diesen Prozess zu verlangsamen. Gleichzeitig konnten Ende des 20. Jahrhunderts solche Positionsverluste durch die unangefochtene MarktführerInnenschaft in den Bereichen Hochtechnologie und Finanzwirtschaft ausgeglichen werden. Folgerichtig waren es diese Kapitalfraktionen, die den Freihandelskurs und besonders die steigende Bedeutung der Klauseln zum geistigen Eigentum und seine VertreterInnen stützten.
Auch der systematische Aufbau einer US-amerikanischen Energieunabhängigkeit war ein zentrales Ziel der Regierungen Bush und Obama, die spätestens 2019 die USA zu Nettoölexporteurinnen machten. Diese Unabhängigkeit wird mit vergleichsweise hohen Ölpreisen (zu denen sich nur die sehr schmutzige und teure Schieferöl- und Teersandausbeutung lohnt) erkauft, die andere Seite der Medaille der Kriege um Öl, die die US-Außenpolitik seit den 1990er Jahren prägt.
Die US-Vorherrschaft im Bereich der Hochtechnologie ist nicht mehr unangefochten. Vor allem im ostasiatischen Raum werden heute ähnlich leistungsfähige Halbleiterprodukte hergestellt und die entsprechende Software entwickelt wie um das Silicon Valley. Die Bedeutung der US-Finanzwirtschaft ist deutlich weniger bedroht, auch wenn die Abwicklung von Teilen des Welthandels mit chinesischen Renmibi und teilweise sogar Euros die Bedeutung anderer Börsen steigert. In der Folge der Finanzkrise 2008 sank jedoch die Bedeutung der Finanzindustrie im Vergleich zu anderen Kapitalfraktionen, die vom „regelbasierten“ Freihandel weniger hielten.
Der Kurs der Trump-Regierung widerspiegelt in erster Linie das Bedürfnis, diese stärksten Kapitalfraktionen im internationalen Wettbewerb zu stärken. Die gezielten Angriffe auf chinesische Technologieunternehmen (Huawei, TikTok) sprechen hier ebenso dafür wie die offene Forderung, mehr amerikanische Landwirtschafts- und Industrieprodukte zu kaufen.
Kriegspolitik
Die Präsidentschaften von Bush und Obama waren außenpolitisch vor allem von den Überfällen auf Afghanistan und Irak geprägt. Wie schon die ersten Golfkriege waren diese ökonomisch von einem Bedarf nach günstigem und preisstabilem Erdöl getrieben. Unter dem ideologischen Deckmantel des Kriegs gegen den Terror (und als institutionalisierter Hintergrund des modernen antimuslimischen Rassismus) stationierten die US-Truppen Hunderttausende SoldatInnen in und rund um die ölfördernden Länder Westasiens und im kleineren Ausmaß auch Afrikas.
In den letzten Jahren der Obama-Regierung wurde der direkte Konflikt mit Russland als potentiellem imperialistischen Konkurrenten wichtiger Treiber der Kriegspolitik. Die Unterstützung der rechtsextrem-neoliberalen Koalition in der Ukraine durch US-Truppen sowie die Interventionen in Libyen und Syrien hatten mehr mit diesem geopolitischen Konflikt als der Sicherung von Öl- und Gasversorgung zu tun. Tatsächlich bewegten sich die USA schon seit 2014 auf einen Energie-Nettoexport (bei ausreichend hohen Weltmarktpreisen, die die Förderungsmethoden profitabel machten) zu.
Das führte zu einer Verschiebung der Interventionen, weg vom Ziel, einen niedrigen Weltmarktpreis für Öl und Gas sicherzustellen. Es schuf aber neue Konflikte, die die Abnahme von amerikanischen Energieprodukten sicherstellen sollten. So muss man auch die zeitweise US-Forderung verstehen, keine neue Pipeline für russisches Gas zu bauen (Nordstream-2-Konflikt). Dasselbe gilt dafür, dass die EU sich im Auslaufen des Handelskrieges verpflichtet, ihre Einfuhr an amerikanischem LNG-Flüssiggas zu verdoppeln.
In diesem Lichte müssen auch der von Trump versprochene Truppenabzug aus Irak und Afghanistan sowie die kurzfristig angekündigte Entspannung mit Iran und Nordkorea gesehen werden. Hinter seinem Versprechen steht die Kosten-Nutzen-Rechnung der Kapitalfraktionen, die den Präsidenten offen gefördert haben. Vor allem für die Energieindustrie ist der Nutzen gering, der den enormen finanziellen und moralischen Kosten des Dauerkrieges gegenübersteht. Auch die versuchte Entspannung mit Russland hatte sich deutlich von Obamas Politik abgehoben, der in der Ukraine und in Syrien eigentlich StellvertreterInnenkriege eskaliert hatte.
In diesen Fällen überwiegt aber die Kontinuität und die Durchsetzungsfähigkeit des für die Außenpolitik relevanten industriell-militärischen Komplexes, also die Rüstungsindustrie und Teile von Armee und BeamtInnenapparat. Tatsächlich konnte sich Trump hier aber auch nicht gegen die „Falken“, die dortigen kriegsbegeisterten IrangegnerInnen durchsetzen. Folgerichtig deshalb wurde der Abzug nicht organisiert, und die USA intervenieren auch rund um die Ölvorkommen in Nordsyrien, zwischen Rojava und Südkurdistan (Nordirak). Es ist dennoch wichtig zu verstehen, dass es politökonomische Hintergründe für diese Wahlversprechen gibt.
In anderen Bereichen ist diese außenpolitische Verschiebung aber durchgesetzt worden. Die Bündnispolitik im arabischen Raum zielt auf Einzelabkommen, ideologische und militärische Zugeständnisse (Botschaftsverlegung in Israel, möglicher Verkauf von F-35-Kampfflugzeugen an Saudi-Arabien) ab. Unter Obama orientierte die Strategie noch klarer darauf, die lokalen Mächte gegeneinander auszubalancieren, und war auch weniger auf direkte Loyalität zu den USA zugeschnitten. Der offene Unilateralismus, also das US-Diktat der Bedingungen, hat aber auch nicht nur zum Ziel, Einzelstaaten unter Druck zu setzen, sondern auch die Beziehungen zu anderen Verbündeten der USA zu verändern.
Auch an den reaktionären Entwicklungen in Lateinamerika waren die USA führend beteiligt. Das bedeuten zum Beispiel das Zurückdrängen von progressiven und linken Regierungen in Brasilien, Chile, Bolivien, der Abbruch der Entspannung mit Kuba und die Putschversuche in Venezuela. Diese Entwicklungen haben aber unter den Regierungen Bush und Obama begonnen und wurden unter Trump recht konsequent weiter vorangetrieben. Dahinter steht aber nicht nur die chauvinistische „Hinterhof“ideologie der 1970er Jahre, sondern der Versuch, chinesischen Einfluss in der Region zu beschränken. Das bezieht sich zum Beispiel darauf, dass sich Brasiliens Bergbau (vor allem die Kupferproduktion) als Zulieferer für Chinas Industrie zum weltwirtschaftlichen Motor in der Krise ab 2008 entwickelte, oder auch auf den chinesisch-nicaraguanischen Vertrag zum Bau eines Atlantik-Pazifik-Kanals (als direkte Konkurrenz zum amerikanisch kontrollierten Panama-Kanal).
Zusammengefasst scheint die Trump-Regierung in der Durchsetzung ihres außenpolitischen Programms schwach, hat aber in entscheidenden Punkten eine andere Stoßrichtung als die vorhergegangenen Regierungen. Die außenpolitischen Interessen des US-Kapitals verschieben sich, hin- und hergerissen zwischen einem zunehmenden Bedürfnis nach militärischer Schützenhilfe auf dem Weltmarkt und geostrategischer Bündnispolitik gegen den aufstrebenden Konkurrenten China. Dieser Widerspruch ist nicht ohne weiteres auflösbar und wird zuerst in den USA eskalieren, um sich dann weltweit in offenen militärischen Konflikten zu entladen.
8 Ausblick: Die Rolle des Staates als ideeller Gesamtkapitalist, sich zuspitzende Widersprüche nach der Krise und die Konfrontation mit China
Der US-Imperialismus steht vor einer grundlegenden Neuordnung. Weil die USA die weltweit führende imperialistische Macht sind, gilt dasselbe für die globale Ordnung, und umgekehrt sind die Veränderungen in den USA auch Produkt der globalen Machtverschiebungen. Für die Analyse der US-Rolle sind drei Punkte entscheidend (1) die Machtverschiebung zwischen den Kapitalfraktionen im Inland, (2) der Aufstieg von China und Russland sowie die Formierung der EU zu imperialistischen Blöcken und (3) die widersprüchlichen Interessen, die sich in der amerikanischen Außenpolitik niederschlagen.
Der grundlegende Widerspruch zieht sich zwischen den Gründen für den und den Auswirkungen des Aufstieg/s von China zur imperialistischen Macht und direkten Konkurrenten der USA. Die direkten Gründe sind, dass US-amerikanische Kapitale schon im 20. Jahrhunderts den Kostenvorteil in der Industrieproduktion an andere aufstrebende Staaten abgeben mussten. Das ist eine direkte Folge der Tatsache, dass Wert nur aus menschlicher Arbeit entsteht und der zeitweise Kostenvorteil durch Produktivitätssteigerungen langfristig zu einer niedrigeren Profitrate tendiert.
Diese Entwicklung führte in den USA zu starkem Druck auf Lohnsenkungen. Ein Erhalt des Lebensstandards vieler ArbeiterInnen wurde durch den Import günstiger chinesischer Konsumprodukte ermöglicht. Das löste wiederum für China das Nachfrageproblem, wo KapitalistInnen ihre ArbeiterInnen sehr schlecht bezahlen konnten, ohne sich gesamtkapitalistisch Sorge um die Konsumnachfrage machen zu müssen. Diese Rolle übernahmen die amerikanischen ArbeiterInnen.
Durch die Dominanz der Finanzindustrie und des Hochtechnologiesektors der USA bedeutete der zunehmende Verlust der globalen „Wettbewerbsfähigkeit“ noch nicht, dass deren Stellung als imperialistische Führungsmacht gefährdet war. Der Aufbau von globalen Produktionsketten, die von amerikanischen Kapitalen dominiert wurden, erlaubte gleichzeitig den Kapitalexport über die Finanzindustrie und das Abschöpfen der Profite am Ende der „Wertschöpfungskette“ durch amerikanische IndustriekapitalistInnen. Der Aufbau von profitableren Hochtechnologiefirmen in Japan, Korea und China, der relative Bedeutungsverlust der US-Finanzindustrie im Laufe der Krise ab 2008 und der erfolgreiche Aufbau von Produktionsketten ohne amerikanische Beteiligung setzt aber dieser Periode ein Ende.
Das bedeutet eine Verschiebung der Interessen innerhalb des US-Kapitals. Weniger KapitalistInnen können erwarten, auf dem Weltmarkt der Freihandelsabkommen zukünftig bestehen zu können, und die das bewältigen, sind im inneramerikanischen Vergleich schwächer geworden. Dafür fordern mehr Kapitalfraktionen die direkte Unterstützung ihrer Wettbewerbsteilnahme auf dem Weltmarkt durch die militärische, diplomatische und geheimdienstliche Überlegenheit ein. Typische Beispiele sind vertragliche Abnahmequoten zum Beispiel für Agraprodukte oder Flüssiggas, Sanktionen gegen KonkurrentInnen, und Schutzzölle gegen ausländische Konsumgüter.
Gleichzeitig erfordert die Eindämmung Chinas aber breite geopolitische Bündnisse mit kleineren imperialistischen Staaten ebenso wie mit Halbkolonien. Denen muss dafür aber ein ökonomisch besseres Angebot gemacht werden als die klassischen chinesischen Infrastrukturinvestitionen im Billionenbereich. Neben direkten Kapitalanlagen zählt dazu auch das Angebot, gemeinsame Märkte zu konsolidieren, die im TPP-Abkommen eine wichtige Rolle gespielt hätten. Beides ist aber teuer und läuft den Einzelinteressen bedeutender US-KapitalistInnen ziemlich direkt zuwider.
Diesen Widerspruch zu lösen, wäre die Aufgabe des Staates als imperialistischem Gesamtkapitalisten. Das geht sich nur aus, wenn die eigene Führungsrolle weiter abgesichert wird, eine weitgehend unrealistische Aussicht. Wir stehen am Ende der Periode der klaren US-Dominanz über die globale imperialistische Ordnung, die mittelfristig durch eine multipolare Herrschaft abgelöst werden wird.
Das spitzt aber auch die Widersprüche zwischen den imperialistischen Staaten zu. Die vergangenen zwei Krisen ab 2008 und ab 2019 haben schon gezeigt, dass die Kapitalakkumulation in den imperialistischen Zentren an ihre Grenzen stößt. Es ist kein Zufall, dass diese Grenzen in den USA und der EU schneller erreicht sind als zum Beispiel in China oder Russland. Aber auch diese Länder haben definitiv krisenhafte Entwicklungen durchgemacht.
Die einzige Perspektive der kapitalistischen Krisenlösung ist für die imperialistischen Blöcke die Ausweitung der eigenen Absatz-, Rohstoff- und Arbeitsmärkte. Der Imperialismus ergibt sich aus den Krisentendenzen des Kapitalismus und ein Verständnis der imperialistischen Dynamiken macht eine tiefgehende Kenntnis der Krisendynamiken notwendig.
Weil die Halbkolonien und Einflusssphären weitgehend aufgeteilt sind, läuft das auf einen Konflikt um die Neuaufteilung der Welt hinaus. In kleinerem Ausmaß sehen wir das bereits am internationalen Auftreten Chinas, das geschickt die Spielräume aus der Freihandelslogik und in von den USA aufgegebenen Gebiete nutzt, um sich eine bessere Ausgangsbasis zu verschaffen. Ein anderes Beispiel ist der Zusammenprall russischer und amerikanischer Interessen in Bezug auf die EU. Dieser Widerspruch ist in der Ukraine eskaliert. Die daraus entstehende Kriegsgefahr ist nicht unmittelbar, aber unausweichlich.
Endnoten
i Küntzel, Ulrich: Der nordamerikanische Imperialismus. Zur Geschichte der US-Kapitalausfuhr. Sammlung Luchterhand 161. Neuwied und Darmstadt: 1974, S. 24
ii Engels, Friedrich: „Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft“, in: Marx, Karl / Engels, Friedrich: Werke (MEW) Band 19, (Karl) Dietz Verlag, Berlin/Ost, 4. Auflage 1987, unveränderter Nachdruck der 1. Auflage 1962, S. 222
iii Wood, Ellen Meiksins. The Origin of Capitalism: A Longer View. New ed. London: Verso, 2002. Deutsche Ausgabe: Der Ursprung des Kapitalismus. Eine Spurensuche. Ausgewählte Werke Band I, LAIKA Verlag, LAIKAtheorie Band 55, Hamburg 2015
iv https://www.dw.com/de/eu-strebt-massive-steigerung-der-fl%C3%BCssiggas-importe-aus-usa-an/a-48572023
v Marx, Karl: „Das Kapital. Kritik der Politischen Ökonomie“, in: MEW Band 23 (Karl) Dietz Verlag, Berlin/Ost, 4. Auflage 1987, unveränderter Nachdruck der 1. Auflage 1962, S. 792
vi Ebenda, S. 794
vii Galenson, David W.: „The Rise and Fall of Indentured Servitude in the Americas: An Economic Analysis,“ 2020, S. 27
viii https://jacobinmag.com/2017/10/anti-rent-war-movement-feudalism-new-york
ix Moore, Jason W.: „Nature and the Transition from Feudalism to Capitalism,“ 2020, S. 77
x Marx, Karl/Engels, Friedrich: „Das Manifest der Kommunistischen Partei“, in: MEW Band 4, (Karl) Dietz Verlag, Berlin/Ost 1959, S. 467
xi Kilson, Marion D. de B.: „Towards Freedom: An Analysis of Slave Revolts in the United States“, Phylon (1960-) Vol. 25, no. 2 (2nd Otr.. 1964), S. 175 – 187, https://doi.org/10.2307/273653
xii Aptheker, Herbert: „The American Revolution, 1763-1783: A History of the American People: An Interpretation“ Vol. 2, International Publishers Co, New York 1960
xiii Chang, 2007, 79f., in: Aptheker, Herbert, a. a. O.
xiv Küntzel, Ulrich: Der nordamerikanische Imperialismus …, a. a. O., S. 53
xv Ebenda, S. 83
xvi Ebenda, S. 90
xvii Ebenda, S. 148
xviii Ebenda, S. 132
xix Bodenheimer, Susanne: „Dependency and Imperialism: The Roots of Latin American Underdevelopment.“ Politics & Society 1, no. 3 (1971), https://doi.org/10.1177/003232927100100303
xx Dos Santos, 1968, 2. 28
xxi Taylor, Alan M.: „Foreign Capital in Latin America in the Nineteenth and Twentieth Centuries“, Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, March 2003, S. 13, https://doi.org/10.3386/w9580
xxii Ebenda, S. 29
xxiii Schmidt, Timothy J.: „The Rise of U.S. Exports to East Asia and Latin America“, 1994, S. 68, <https://duckduckgo.com/?q=Schmidt%2C+Timothy+J.%3A+%E2%80%9EThe+Rise+of+U.S.+Exports+to+East+Asia+and+Latin+America%E2%80%9C%2C+1994&t=ffab&atb=v1-1&ia=web>
xxiv https://verfassungsblog.de/voelkerrecht-klar-benennen-deutschland-im-sicherheitsrat-und-der-einsatz-fuer-die-regelbasierte-internationale-ordnung/
xxv Bhagwati, Jagdish N.: „Termites in the Trading System: How Preferential Agreements Undermine Free Trade“, Oxford University Press, Oxford/New York 2008, S. 12
xxvi Caliendo, Lorenzo/Parro, Fernando: „Estimates of the Trade and Welfare Effects of NAFTA“, The Review of Economic Studies 82, no. 1 (January 1, 2015), S. 1 – 44, https://doi.org/10.1093/restud/rdu035.
xxvii Rodrik, Dani: „What Do Trade Agreements Really Do?“, Journal of Economic Perspectives 23, no. 2 (May 1, 2018, S. 73 – 90), S. 74, https://doi.org/10.1257/jep.32.2.73, https://j.mp/2EsEOPk
xxviii Bhagwati, Jagdish N.: „Termites in the Trading System … “, a. a. O.