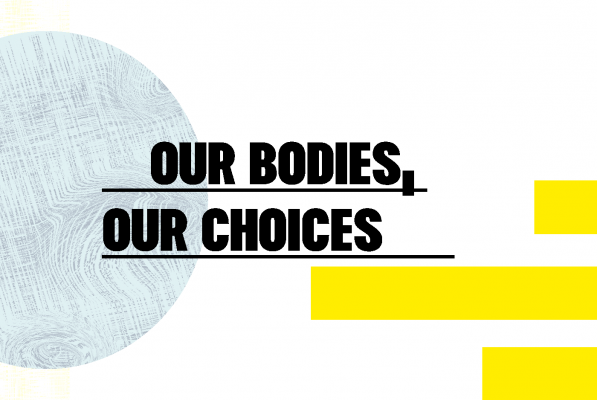Große Koalition abgewählt – übernimmt Schwarz/Gelb/Grün?

Martin Suchanek, Neue Internationale 223, Oktober 2017
Ein politisches Erdbeben wurde es dann doch. Auch wenn die Gebäude oder Institutionen der Bundesrepublik nicht eingestürzt sind, erschüttert wurden sie, auch wenn Merkel mit einer neuen Regierungskoalition weitermachen wird.
Die bürgerlichen Parteien
Abgewählt wurde die Große Koalition, deren Parteien verloren 13,8 Prozent der Stimmen, sackten also von insgesamt 67,2 Prozent auf 53,5 Prozent ab (1).
Allen Verlusten zum Trotz verkündet die CDU, dass sie ihre drei „strategischen Wahlziele“ errungen habe, also weiter die stärkste Partei und Fraktion stellt, gegen die keine Regierung gebildet werden könne und dass sie außerdem Rot-Rot-Grün verhindert hätte. Solcherart kann sich die Union trotz des Verlustes von 8,6 Prozent zur Wahlsiegerin erklären, immerhin bleibt ihr die Führung der nächsten Regierung. In Wirklichkeit dient eine solche „Bilanz“ offenkundig vor allem dem Schönreden der eigenen Niederlage.
AfD und FPD hingegen waren vor unverhohlenem Triumphalismus kaum zu bremsen. Im nationalen Überschwang verkündete AfD-Vorsitzender Gauland nicht nur, dass seine Partei die Regierung jagen werde, sondern auch noch, dass sie sich das „Land und das Volk“ zurückholen würde. Sprachlich war das zwar einigermaßen verunglückt. Klar ist aber, worum es der AfD geht – nicht das „eigene“ Volk soll zurückgeholt werden, vielmehr sollen jene, die nach Meinung der AfD nicht zu diesem gehören, aus dem Land vertrieben oder eingedeutscht werden.
Was die AfD an rassistischer Zuspitzung verspricht, will die FDP an der Regierung in Sachen „Liberalismus“, also an Privatisierungen, Flexibilisierung und neo-liberaler Politik, „einbringen“. Frei ist das Land, nämlich vor allem dann, wenn die großen Unternehmen und Konzerne frei für die Profitmacherei sind – notfalls auch auf Kosten der Umwelt und der Bevölkerung, wie die Verteidigung des Braunkohlebergbaus und der wahnwitzige Lobbyismus für den innerstädtischen Berliner Flughafen Tegel zeigen.
Dabei geht der Sieg der FDP, immerhin eine Verdoppelung ihrer Prozente und Stimmen, auch auf einen „taktischen“ Wechsel von früheren Union-WählerInnen zurück.
Die Grünen zeigten, dass man sich auch über den letzten Platz im Rennen um Parlamentssitze freuen kann – mag es auch nicht immer so überzeugend gelingen. In der nächsten Regierung stehen sie für „Umwelt“, „Offenheit“ und „Europa“. Mit Europa ist die „demokratische“ Vertiefung der EU in Allianz mit Frankreich zum Wohle „der europäischen Wirtschaft“ gemeint. Unter Umwelt geht es um den „ökologischen Umbau“ im Rahmen eines Green New Deal mit der Großindustrie. Und unter „Offenheit“ verstehen sie die „faire“ Selektion der MigrantInnen und die humanitäre Ausgestaltung der Abschiebung.
All das ist eine Basis für zähe, aber letztlich wohl erfolgreiche Koalitionsverhandlungen zwischen Union, Grünen und FDP. Eine neue Regierung wird wahrscheinlich erst nach längeren Verhandlungen zustande kommen, zu einem „Gelingen“ des Unternehmens haben aber diese drei Parteien schon jetzt keine Alternative mehr.
Der Grund dafür ist einfach: Diese drei Parteien stehen in wesentlichen Fragen für eine Fortsetzung, allenfalls für eine Modifikation der Politik der Großen Koalition. Vor allem aber stehen sie dafür, dass die Lösung der Krise der EU eine, ja die Kernaufgabe der nächsten Bundesregierung sein wird. Wobei es darum geht, den „Kern“ Europas, also die Achse um Frankreich und Deutschland zu stärken und verlorenes Terrain in der Weltpolitik gegenüber den USA und China aufzuholen – wozu notwendigerweise auch Aufrüstung, Interventionen, verstärktes globales Agieren und die Sicherung der Investitionsbedürfnisse des Großkapitals gehören.
Verliererin SPD
Nur eine Partei vermochte am Wahlabend an ihrer Niederlage nichts zu deuten – die SPD. Sie verlor 5,2 Prozent der Stimmen und fuhr mit 20,5 Prozent das schlechteste Ergebnis seit dem Zweiten Weltkrieg ein. In absoluten Zahlen verlor sie fast zwei Millionen WählerInnen.
Die Niederlage kam zwar angesichts der Umfragen weniger überraschend als die Einbußen der Union. Aber die Union hatte 2013 immerhin ein extrem starkes Ergebnis (plus 7,7 Prozent), während die SPD sich von der Agenda-Politik bis heute nicht zu erholen vermochte.
Offenkundig hatte die Parteispitze dieses Debakel schon einkalkuliert. So verkündete sie kurz nach den ersten Hochrechungen, dass sie für eine Fortsetzung der Großen Koalition nicht zur Verfügung stünde. So war Schulz wenigstens ein Wahl-Coup gelungen.
Der Gang in die Opposition blieb ihr als einzige Möglichkeit, den finalen politischen Selbstmord zu verhindern – ob sie sich in dieser zu regenerieren vermag, ist allerdings fraglich. Die „Taktik“, so zu tun, als wäre nur die CDU für die Regierungspolitik und den Mangel an politischer Debatte im Land verantwortlich gewesen, wird wohl erst recht nicht als „Strategie“ reichen.
Die Verluste der SPD sind zweifellos wohlverdient und vor allem auf dem eigenen Mist gewachsen. In den Altersgruppen unter 45 schnitt sie nach Umfragen noch einmal stark unterdurchschnittlich ab (19 Prozent bei den 18-24-Jährigen, 18 bei den 25-35-Jährigen und 16 Prozent bei den 25-44-Jährigen).
Bei den ArbeiterInnen (24 Prozent), RentnerInnen (24 Prozent) und Arbeitslosen (23 Prozent) ist sie zwar überdurchschnittlich stark vertreten – aber auf einem historisch geringen Niveau. Es sind aber jene Teile der Bevölkerung, die der SPD noch eher die Stange hielten als Angestellte oder gar Selbstständige. Es liegt eine gewisse – unfreiwillige – Ironie darin, dass jene Schichten, die sie in den letzten Jahren immer wieder verraten hat, noch eher zu ihr hielten als die viel umworbene „Mitte“.
Erhebungen unter Gewerkschaftsmitgliedern (2) zeigen, dass die SPD mit 29 Prozent noch immer den höchsten Anteil erzielen konnte. Die Union erreichte im Landesdurchschnitt 20, die Linkspartei 12 Prozentpunkte. Damit lag sie aber nur auf dem vierten Platz – hinter der AfD, die 15 Prozent erzielen konnte. Im Osten kommt sie ebenso wie die Linkspartei unter Gewerkschaftsmitgliedern auf 22 Prozent – gegenüber 24 Prozent der Union und 18 der SPD. Allein das ist ein politisches Alarmsignal.
Das drückt sich z. T. auch in den Wählerwanderungen aus. Die SPD verlor fast nichts an die Union, aber 380.000 Menschen an die Grünen und 470.000 an die FDP. Das dürften eher Angestellte und Selbstständige gewesen sein. Sie verlor zugleich 470.000 an die AfD, was sicher auch den erschreckend hohen Anteil von ArbeiterInnen und Arbeitslosen an den AfD-Stimmen miterklärt. An die Linkspartei wanderten 430.000 ehemalige SPD-WählerInnen, vor allem im Westen, wo die Linkspartei weit überdurchschnittlich abschnitt.
Zweifellos sind gerade an diese Parteien auch Stimmen des Protests und der Unzufriedenheit verloren gegangen, nachdem klar geworden war, dass die SPD ohnedies keine Regierungsoption zu bieten hatte. Sie haben gewissermaßen taktisch gegen die Sozialdemokratie gestimmt, aber aus durchaus entgegensetzten Motiven. Die Stimmen der AfD brachten zwar sicher auch Unzufriedenheit mit allen anderen Parteien zum Ausdruck, sie waren aber auch eine Stimme für mehr, offeneren und unverhüllten Rassismus und Nationalismus, wie die Umfragen zu den Motiven der AfD-WählerInnen zeigen.
Die Linkspartei wurde aus anderen Gründen – im Grunde als Zeichen für eine „echte“ sozialdemokratische Politik, für Reformen im Interesse der ArbeiterInnen und Jugend gewählt.
Die Linkspartei
Betrachten wir nur die Stimmenanteile der Linkspartei, so scheint sich mit einem Plus von 0,6 Prozent (8,6 auf 9,2) wenig verändert zu haben. Dahinter verbergen sich jedoch enorme Veränderungen innerhalb ihrer WählerInnenschaft.
Erstens hat DIE LINKE in den neuen Bundesländern, also ihren traditionellen Bastionen, durchgängig verloren und ist auf den dritten Rang hinter CDU und AfD abgerutscht. Damit wird eine Entwicklung fortgesetzt, die sich schon in den Landtagswahlen (insbesondere in Berlin) gezeigt hatte. Hinsichtlich der Wählerwanderungen drückt sich das deutlich in Verlusten an die AfD aus – und zwar rund 400.000!
Zugleich hat die Linkspartei in allen westlichen Bundesländern sowie in Berlin zugelegt – und zwar durchaus beachtlich. In Berlin konnten die Verluste in den Ostbezirken durch Gewinne in den westlichen Bezirken kompensiert werden, so dass die Partei gegenüber den Bundestagswahlen 2013 leicht zulegen konnte. DIE LINKE schaffte es außerdem in allen westlichen Bundesländern, deutlich über die 5-Prozenthürde zu kommen, sogar in Ländern wie Bayern (6,2 Prozent), Baden-Württemberg (6,4), Rheinland-Pfalz (6,8) oder Nordrhein-Westfalen (7,5), wo sie bei den Landtagswahlen deutlich gescheitert war.
Sicherlich ist ein Teil dieser Stimmen auch auf taktisches Verhalten sozialdemokratischer WählerInnen zurückzuführen, die für die Linkspartei stimmten, da die SPD ohnedies keine Chance auf die Kanzlerschaft hatte und ihre Stimme somit auch nicht „verschwendet“ werden würde.
Das Wahlergebnis zeigt aber auch den Wandel an der sozialen Basis der Partei auf, Auch wenn die Linkspartei nur leicht überdurchschnittlich ArbeiterInnen (10 Prozent), Arbeitslose (11 Prozent) ansprechen konnte, so repräsentiert sie die bewussteren, (links)reformistischen Teile der ArbeiterInnenklasse. Hinzu kommt, dass sie unter jüngeren WählerInnen (18-34 Jahre) mit 11 Prozent besser als unter allen anderen Altersgruppen abschneidet.
Zweifellos haben die relative Stabilität des deutschen Imperialismus, das geringere Niveau gewerkschaftlicher Kämpfe und Niederlagen der Refugee-Bewegungen die Chancen der Linkspartei geschmälert. Ein Rechtsruck der Gesellschaft erschwert durchaus auch das Anwachsen links-reformistischer Parteien, zumal wenn große Teile der ArbeiterInnenklasse sozialpartnerschaftlich integriert sind und das Niveau der Klassenkämpfe relativ gering ist.
Trotz leichter Zuwächse vermocht die Linkspartei der vorhandenen Unzufriedenheit keinen umfassenden Ausdruck zu geben und konnte die Krise der SPD weniger als möglich nutzen. Die Gründe dafür sind hausgemacht, sie sind Resultat von Anpassung und Anbiederung. Erstens an die rassistische und chauvinistische Hetze gegen Geflüchtete, wie sie auch von „Linken“ wie Wagenknecht verbreitet wurde, zweitens an die Gewerkschaftsführungen, die allenfalls zaghaft kritisiert werden, und an den „demokratischen“ Mainstream, wie im Zuge von Distanzierungen nach dem G20-Gipfel zu sehen war. Und drittens in der Regierungspolitik in Thüringen, Berlin, Brandenburg. Dass die Partei vielen nicht gerade als „oppositionell“ erscheint, ist kein „Vermittlungsproblem“, sondern, wenn auch im kleineren Maßstab, ähnlich wie bei der SPD die notwendige Folge bürgerlicher Regierungspolitik, der Verwaltung sog. Sachzwänge.
Aufstieg der AfD
Zweifellos hat die AfD davon – noch viel mehr natürlich von der Politik der SPD – profitiert. Die beiden, sich historisch und organisch auf die ArbeiterInnenklasse stützenden Parteien verloren insgesamt 870.000 WählerInnen an die Rechts-PopulistInnen, also fast so viele wie die Union (980.000). Darüber hinaus hat sie mit 1,2 Millionen Stimmen als einzige Partei ehemalige NichtwählerInnen wirklich mobilisieren können.
Die AfD konnte sich als einzige „anti-systemische“ Partei präsentieren und damit auch Unzufriedenheit aller Art auf sich kanalisieren. Aber die Umfragen, die zeigen, dass eine Mehrheit der AfD-WählerInnen die Rechten nicht wegen ihrer Politik, sondern vor allem wegen der Ablehnung anderer Parteien wählte, sind kein Grund zur Entwarnung.
Der „Protest“ ist eindeutig mit einem politischen Inhalt verbunden. Die WählerInnen der AfD nehmen deren offenen Rassismus und aggressiven Deutschnationalismus nicht nur billigend in Kauf, viele wählen sie auch gerade deshalb.
Das zeigten z. B. Umfragen über die Ansichten der AfD-WählerInnen am Wahlabend. So erklärten 99 Prozent, dass sie gut finden, dass die AfD „den Einfluss des Islam in Deutschland verringern will“. 96 Prozent „finden es gut, dass sie den Zuzug von Flüchtlingen stärker begrenzen will.“ Zu diesen Einstellungen kommt hinzu, dass die AfD als beste Law-and-Order-Partei erscheint, die Kriminalität – vorzugsweise von AusländerInnen – wirklich bekämpfen wolle.
Außerdem treibt ihre WählerInnen um, dass wir angeblich „einen Verlust der deutschen Kultur erleben“ (95 Prozent) und der „Einfluss des Islam in Deutschland zu stark wird“ (94 Prozent).
Rassismus und – zunehmend auch völkisch begründeter – Nationalismus bilden den Kitt der AfD. Vermeintliche und wirkliche Ängste werden so zu einer aggressiven chauvinistischen, rechten Ideologie verbunden, die heute zwar noch vor allem parlamentarisch ausgerichtet ist, die sich jedoch auch weiter radikalisieren kann, wie die Verbindungen der AfD zu offen faschistischen Kräften zeigen.
Auch wenn diese Partei noch um einiges von der Stärke einer FPÖ oder FN entfernt ist, so hat sich zweifellos eine rechts-populistische, rassistische Partei in Deutschland etabliert. Diese wird sich – gerade angesichts der globalen politischen Verwerfungen und verschärften Konkurrenz – auch trotz innerer Konflikte und (noch) fehlender unumstrittener Führungsfigur – kaum „selbst zerlegen“. Erst recht wird sie nicht durch den Parlamentarismus „entzaubert“ werden. Im Gegenteil. Die Politik der nächsten Regierung wird ihr Stoff geben, sich als Opposition aufzuspielen, zumal wenn SPD und Linkspartei den Fehler machen sollten, den Kampf gegen die Regierung zugunsten der imaginären Einheit der „DemokratInnen“ hintanzustellen.
Die AfD ist kein Fremdkörper in der bürgerlichen Gesellschaft, sondern die Entstehung einer rechts-populistischen Partei verdeutlich die krisenhaften Prozesse, die – schon vor einer ökonomischen Zuspitzung – aus dem Untersten der Gesellschaft empordrängen.
Nationalismus, Chauvinismus, Bevorzugung der Deutschen, Abschottung gegen MigrantInnen, anti-muslimischer Rassismus – all das sind keine Alleinstellungsmerkmale der AfD, sondern in allen bürgerlichen Parteien vertreten und in der Form des Sozial-Chauvinismus auch bei SPD und Linkspartei. Die AfD erntet diese Früchte, die andere gesät haben.
Die Mobilisierung gegen die AfD und ihren Rassismus darf daher nicht als eine vom Klassenkampf getrennte Aufgabe verstanden werden. So wie es gilt, der rechten, rassistischen Hetze entgegenzutreten, so muss das mit dem Kampf gegen den staatlichen Rassismus, für offene Grenzen und gleiche Rechte, aber auch mit der „sozialen Frage“, also für Mindestlohn, Rente, gleichen Zugang zu Bildung, gegen Mietenspekulation usw. verbunden werden.
Es braucht aber auch einen bewussten Kampf gegen das Gift von Rassismus und Nationalismus in den Reihen der ArbeiterInnenklasse, in den Betrieben, an Unis und Schulen.
Regierungsbildung – das Problem des Unvermeidlichen
Ein von der nächsten Regierung unabhängiger Kurs der Linken und der Gewerkschaften ist eine unabdingbare Voraussetzung nicht nur für einen erfolgreichen Kampf gegen die AfD und die Stimmungen, auf die sie sich stützt.
Die Niederlage der Union, aber auch die Schwierigkeiten, eine Jamaika-Koalition rasch auf die Beine zu bringen, zeigen auch, dass es für die herrschende Klasse einen zweiten, wichtigeren Grund als den Aufstieg der AfD für Beunruhigung gibt.
Nach dem Zweiten Weltkrieg hatte sich das Parteienspektrum in Westdeutschland lange praktisch auf drei Parteien verengt. Schon die Entstehung der Linkspartei und der Grünen unterminierte das. Mit der AfD kam noch eine Kraft hinzu.
So sehr sich aber auch CDU, CSU, Grüne, FDP sowie die SPD in wichtigen Zielsetzungen – gerade wenn es um die Ordnung Europas geht – ähneln, so sind ihre Gegensätze auch real und nicht wahltaktisch vorgeschoben. Das trifft nicht nur auf FPD und Grüne zu, die beide gerne mit der Union (wenn auch nicht miteinander) koalieren möchten, sondern auch auf CDU/CSU. Gerade in der Europapolitik orientieren die CDU-Führung und auch die Grünen auf einen Pakt mit Macron, die FDP ist zwar nicht grundsätzlich dagegen, lehnt dafür aber seine finanzpolitischen Vorschläge kategorisch ab. Ähnliches gilt für andere Politikfelder.
Hinzu kommt, dass gerade FDP und Grüne, aber angesichts ihres katastrophalen Wahlergebnisses und baldiger Landtagswahlen auch die CSU, um ihre „Alleinstellungsmerkmale“ fürchten.
Die Verhandlungen werden noch zusätzlich erschwert, weil es für den deutschen Imperialismus angesichts der verschärften globalen Konkurrenz und der Krise der EU auch darum geht, dass die nächste Regierung eine klarere Strategie verfolgt, um die EU unter deutscher Führung zu „einen“ und neu zu formieren. Formelkompromisse mögen daher zwar im Koalitionsschacher funktionieren, für die strategischen Zielsetzungen Deutschlands wären sie aber selbst ein Problem.
Die Weigerung der SPD, in Verhandlungen mit der Union einzutreten, zwingt die drei anderen Parteien praktisch zu einer Koalitionsbildung. Kein Wunder, dass alle auf die SPD schlecht zu sprechen sind, engt deren Entscheidung ihre Optionen doch massiv ein.
Während Merkel und die Union die SozialdemokratInnen höflich ums Überdenken ihrer Haltung auffordern, macht es die FDP schriller. So wirft ihr Parteivorsitzender Lindner der SPD Landesverrat vor, da sie erstmals seit 1919 die Interessen der Partei über jene des Landes stelle.
Dass die SozialdemokratInnen so weit gehen, doch noch Koalitionswilligkeit zu signalisieren, um den Spielraum der FDP beim Jamaika-Poker zu erhöhen, darf bezweifelt werden, auch wenn die Partei für ihre selbstmörderische Entscheidungen immer wieder zu haben war.
Hinter der Aufregung ob der „harten“ Haltung der SPD zeigt sich aber mehr. Die Bourgeoisie möchte die Option auf eine „große“ Koalition, auf eine zweite Wahl für den Fall innerer Zerwürfnisse von CDU/CSU, Grünen und FDP offenhalten.
In den nächsten Jahren will die herrschende Klasse kein Szenario, das zu mehr Polarisierung zwischen den Klassen, zu einer „härteren“ Sozialdemokratie oder auch zu einer weniger regierungsnahen Politik der Gewerkschaften führt.
In der Ablehnung der Großen Koalition liegt nämlich – durchaus entgegen den Intentionen aller SPD-FührerInnen – ein Moment, das auf mehr Konfrontation entlang sozialer und ökonomischer Fragen verweist. Wenn sie irgendwie „Glaubwürdigkeit“ zurückgewinnen wollen, „soziale Gerechtigkeit“ in den Vordergrund rücken, dann müssen sie sich als Opposition nicht nur zur Regierung präsentieren, sie müssen sich auch der Konkurrenz der Linkspartei stellen – wie diese umgekehrt aufpassen muss, dass ihr die SPD ihr sozialdemokratisches Programm nicht einfach klaut.
Einige Schlussfolgerungen
Die kurzen Betrachtungen führen zu einigen ersten Schlussfolgerungen.
- Die Wahlen sind eine Warnung an die Linke und an die ArbeiterInnenbewegung. Sie bringen einen Rechtsruck der Gesellschaft zum Ausdruck. Der Sieg der AfD und ihre Hetze ist nur der extremste Ausdruck. Der triumphale Widereinzug der FDP ist das ebenso wie die Rechtsentwicklung der Grünen.
- Die Verhältnisse sind zugleich auch instabiler geworden. Wir müssen damit rechnen, dass die Krise Europas, die instabile Weltlage, aber auch die Drohung eines weiteren Zulaufs zur AfD als Disziplinierungsmittel nicht nur in der Regierung, sondern auch gegenüber der parlamentarischen Opposition und den Gewerkschaften genutzt wird, indem die „Einheit der Demokraten“ beschworen wird.
- Daher gilt es nicht nur, den offenen RassistInnen auf der Straße, in den Betrieben, in Stadt und Land konfrontativ entgegenzutreten – es muss dies durch Klassenpolitik, durch ein Bündnis der ArbeiterInnenorganisationen, der MigrantInnen und Flüchtlinge, der Gewerkschaften und Linken, nicht durch gemeinsame Erklärungen mit der Regierung geschehen.
- Der Kampf gegen die Angriffe der nächsten Regierung, auf sozialer, gewerkschaftlicher, vor allem aber auch internationaler Ebene muss im Zentrum linker Politik stehen. Die aktuelle Lage erfordert und ermöglicht, den Widerstand nicht nur auf nationaler Ebene, sondern vor allem auch auf europäischer und internationaler zu koordinieren. Gerade von der Linkspartei und den Gewerkschaften – respektiven deren linkeren Kräften – ist hier eine entschlossene Initiative gefordert, die es erlaubt, den Kampf in Frankreich, den Widerstand in Katalonien, den Kampf gegen Militarisierung, Interventionen und die Abschottung der EU koordiniert zu führen.
- Daher schlagen wir eine Aktionskonferenz vor, auf der die Politik der nächsten Regierung analysiert und ein Forderungs- und Mobilisierungsplan verabschiedet wird. Dazu sollten vorbereitende Treffen in allen Großstädten, an Schulen, Unis und in den Betrieben und Gewerkschaftsgruppen stattfinden.
Endnoten
(1) Die Zahlen beziehen sich auf das vorläufige amtliche Ergebnis vom 25. September. Diese und andere Zahlen sind der Homepage der Tagesschau entnommen. Einzige Ausnahme bilden die Zahlen zur WählerInnenpräferenz von Gewerkschaftsmitgliedern.
(2) Bundestagswahl 2017: So haben Gewerkschaftsmitglieder gewählt