Finanzkapital, Imperialismus und die langfristigen Tendenzen der Kapitalakkumulation

Markus Lehner, Revolutionärer Marxismus 39, August 2008
Von Zeit zu Zeit liest sich das vor 140 Jahren von Marx geschriebene „Kapital“ wie eine tagesaktuelle Glosse. So auch die folgende Bemerkung zu Finanzkrisen:
„Eben noch erklärte der Bürger in prosperitätstrunkenem Aufklärungsdünkel das Geld für leeren Wahn. Nur die Ware ist Geld. – Nur das Geld ist Ware! gellts’s jetzt über den Weltmarkt. Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit seine Seele nach Geld, dem einzigen Reichtum … Die Geldhungersnot bleibt dieselbe, ob in Gold oder Kreditgeld, Banknoten etwa, zu zahlen ist.“ (MEW 23, S.152)
Ganz in dieser Weise schreien die Finanzkapitalisten aller Länder seit dem Platzen der „Immobilienblase“ 2007 in den USA nach „Liquidität“, nach sicherem Geld, nach Absicherung ihrer Zahlungsfähigkeit – wenn es sein muss durch massive Intervention des Staates. Bis dahin schienen „innovative Finanzprodukte“ die Aufbringung von Kapital von den Schranken jeder klassischen Liquiditätssicherung befreit zu haben.
„Dieses plötzliche Umschlagen aus dem Kreditsystem in das Monetarsystem fügt den theoretischen Schrecken zur praktischen Panik: und die Zirkulationsagenten schaudern vor dem undurchdringlichen Geheimnis ihrer eigenen Verhältnisse.“ (ebd.)
Hier wird offenbar, dass das Verständnis der kapitalistischen Ökonomie nicht mit einer positiven (z.B. statistisch-empirischen) Darstellung ihrer konkreten („modernen“) Formen, z.B. auf den Finanzmärkten, beginnen kann. Gerade in der Krise zeigt sich der Charakter dieses scheinbar „Gegebenen“ als komplexe, voraussetzungsbeladene und widerspruchsvolle Totalität. Die Aktualität der Marxschen Analyse auch für die scheinbar so neuartigen Erscheinungen der heutigen Finanzmärkte ergibt sich gerade dadurch, dass Marx sich nicht auf eine Beschreibung des tagesaktuellen Kapitalismus seiner Zeit beschränkt. Seine Methode zielt vielmehr auf die grundlegenden Kategorien der kapitalistischen Warenproduktion und ihrer Bewegungsgesetze in einer solchen Weise, dass in einem Aufsteigen von abstrakt-einfachen Gesamtzusammenhängen zu konkret-komplexen Totalitäten auch die Entwicklungsdynamik dieser Formen deutlich wird.
Die theoretischen und alltäglichen Verwirrungen um Finanzkapital und Finanzkrisen beginnen notwendig bei einem falschen Verständnis der Geldform – und erfordern daher die Ableitung der Geldform aus der Warenform als Ausgangspunkt der Analyse. Im Gegensatz dazu verschleiern alle Versuche, Geld oder neue Geldformen bloß instrumentell-pragmatisch als clevere Mittel zur Vereinfachung und Beschleunigung von Marktprozessen darzustellen, die zentrale und zutiefst widersprüchliche Rolle des Geldes in der kapitalistischen Ökonomie. Geld kann nur funktionieren, da es Ware ist – gleichzeitig negiert es zwangsläufig seinen Warencharakter. Dieser Widerspruch erscheint in immer neuen Formen. Ohne einen Nachvollzug der Ableitung des Grundwiderspruchs und seiner Bewegungsformen verliert sich das Denken unwillkürlich in der goldenen Spiegelwelt.
1. Geld, Zirkulation und Kredit
1.1. Zur Genese der Geldform
Die Wertgegenständlichkeit der Waren unterscheidet sich dadurch von der Wittib Hurtig, dass man nicht weiß, wo sie zu haben ist.“ (MEW 23, S. 62) Nichts am Warenkörper selbst lässt ihren Wert greifen. Sie besitzt Wertgegenständlichkeit nur als Ausdruck einer gesellschaftlichen Einheit, der in ihr vergegenständlichten abstrakt-menschlichen Arbeit. Sie kann daher auch nur im (gesellschaftlichen) Verhältnis zu anderen Waren zum Ausdruck, zur Erscheinung gebracht werden. In der Wertform wird der Gebrauchswert einer Ware, d.h. der materielle Warenkörper selbst, zur Erscheinungsform seines Gegenteils, des Werts. Die Wertform ist daher gleichgültig gegen die konkrete Natur dieses als Äquivalent dienenden Gebrauchswerts. In der allgemeinen Wertform, in der eine spezielle Ware (z.B. Gold) zur gesellschaftlich anerkannten Äquivalentform selektiert wird, wird diese Ware zur Ware, „deren Naturalform zugleich unmittelbar gesellschaftliche Verwirklichungsform der menschlichen Arbeit in abstracto ist.“ (ebd.) Geld als allgemeine Wertform bleibt Ware, deren Wert zum Vergleichsmaßstab, zum Maß der Werte wird (Preisausdruck). Andererseits wird ihr Gebrauchswert gleichgültig. Was auch immer „menschliche Arbeit in abstracto“ in klar definierten Quantitäten und auf lange Dauer repräsentieren kann, kann auch zu Geld werden. Letztlich kann die Funktion des Geldes in der Zirkulation W-G-W durch ein Zeichen der Geldware ersetzt werden – was die Gleichgültigkeit des materiellen Trägers der Wertform in der Geldform perfekt zum Ausdruck bringt.
Marx bemerkt in Bezug auf Ricardos Wertanalyse: „Die politische Ökonomie hat nun zwar, wenn auch in unvollkommener Weise, Wert und Wertgröße und den in diesen Formen versteckten Inhalt entdeckt. Sie hat aber niemals auch nur die Frage gestellt, warum dieser Inhalt jene Form annimmt …“ (ebd. S. 94f.). D.h. Ricardo hat zwar Wertquantität durch die verkörperte Arbeit definiert – nicht jedoch das qualitative Moment: dass dabei gesellschaftlich notwendige Arbeit mit abstrakt-menschlicher Arbeit gleichgesetzt wird; dass damit eine Form für die Materialisierung dieser abstrakt-menschlichen Arbeit gefunden werden muss; dass also der Wert aller Arbeitsprodukte die Form von Geld annehmen muss. „Die Wertform der Arbeitsprodukte ist die abstrakteste, aber auch allgemeinste Form der bürgerlichen Produktionsweise, die hierdurch als eine besondere Art gesellschaftlicher Produktion und damit zugleich historisch charakterisiert wird. Versieht man sie für die ewige Naturalform gesellschaftlicher Produktion, so übersieht man notwendig auch das Spezifische der Wertform, also der Warenform, weiter entwickelt der Geldform, Kapitalform usw. Man findet daher bei Ökonomen, welche über das Maß der Wertgröße durch Arbeitszeit durchaus übereinstimmen, die kunterbuntesten und widersprechendsten Vorstellungen von Geld.“ (ebd.)
D.h. die differentia specifica der kapitalistischen Vergesellschaftung, dass sich der Zusammenhang der gesellschaftlichen Arbeiten erst durch die nachträgliche Vergleichung abstrakter Arbeitsquanta (verkörpert in den Arbeitsprodukten) ergibt, erzeugt auch unmittelbar den widersprüchlichen Charakter von Geld als Ware und Nicht-Ware und damit die notwendige Verwirrung seines Wesens bei Ausblendung dieser gesellschaftlich-historischen Genese der Geldform.
1.2 Abstrakte Arbeit und Wert
Marx bemerkt in den ökonomisch-philosophischen Manuskripten, dass es Hegel in der „Phänomenologie des Geistes“ gelungen ist, das „Wesen der Arbeit“ zu fassen. Während es in der bürgerlichen Ökonomie und Philosophie ansonsten den unmittelbaren Weg vom „Bedarf“ zum „Produkt“ gibt, und Arbeit dabei nur eine instrumentelle Rolle spielt, unterscheidet Hegel: einerseits die instinkthafte Bedürfnisbefriedigung durch das „bloße Zugreifen“, die „Vernichtung des Gegenstandes“; andererseits menschliche Arbeit: nach der objektiven Seite wird der Gegenstand in seiner Eigengesetzlichkeit erkannt, verändert, umgeformt (also nicht einfach vernichtet, sondern auf eine andere Stufe gehoben). Nach der subjektiven Seite ist dies nur möglich, indem das arbeitende Subjekt in gesellschaftlicher Wechselwirkung diese Auseinandersetzung mit der materiellen Welt führt, und sich dabei entsprechend selbst verändert. In diesem Sinn wird Arbeit zum Selbstproduktionsprozess des Menschen als eines gesellschaftlichen Wesens und ist selbst wesentlich gesellschaftlicher Arbeitsprozess (Prozess der Produktion und Reproduktion eines immer entwickelteren gesellschaftlichen Seins).
Von daher wird es dem menschlichen Bedürfnis dem Begriff nach verbaut, „die Arbeit von sich abzutrennen“ (Hegel, Realphilosophie) (1). Gleichzeitig ist genau diese Trennung von Bedürfnisbefriedigung und Arbeit das Wesen von gesellschaftlicher Arbeit unter Bedingungen der Klassenherrschaft (Herr/Knecht-Dialektik). Unter Bedingungen verallgemeinerter Warenproduktion wird dieses Verhältnis zur Entfremdung zugespitzt. Der Gebrauchswert eines Produkts ist nur noch Inhalt des Arbeitsprozesses, insofern er notwendig ist zur Realisierung des Tauschwerts; d.h. der Arbeitsprozess wird bereits zum Bestandteil des gesellschaftlichen Arbeitsprozesses dadurch, dass in ihm „Arbeit an sich“, eine Quantität des gesellschaftlichen Arbeitsvermögens (gemessen in Zeit) verausgabt wurde und erst sekundär dadurch, dass auch tatsächlich gesellschaftlicher Bedarf für das Arbeitsprodukt besteht.
Der gesellschaftliche Charakter des Arbeitsprozesses in einer warenproduzierenden Gesellschaft kommt daher darin zum Ausdruck, dass die scheinbar unmittelbare Zuordnung von Wert zur Ware tatsächlich ein gesellschaftlicher Vermittlungsprozess zwischen der konkreten, tatsächlich im Einzelnen geleisteten Arbeit und der darin enthaltenen abstrakten Arbeit ist, der sich nur im Verhältnis zur gesellschaftlichen Gesamtarbeit dem Einzelnen zuordnen lässt.
Das Nichtverstehen des Zusammenhangs von Entfremdung des menschlichen Arbeitsprozesses und Herausbildung der gesellschaftlichen Kategorie „abstrakte Arbeit“ als Grundlage des Wertbegriffs führt zu verschiedenen falschen Verständnissen der Werttheorie. Einerseits ist es eine vulgär-marxistische Verkürzung anzunehmen, Wert ließe sich einem einzelnen Arbeitsprodukt unmittelbar durch Messung bestimmter Arbeitsquanta bestimmen. Dies ist ein Rückfall auf die Ricardosche Identifizierung von Wertgröße und -substanz (Wertmengentheorie). Ein bestimmtes Quantum konkret verausgabter Arbeit wird so zu Wert, statt der Zumessung abstrakter Arbeit zum Einzelprodukt, die sich erst aus dem Gesamtzusammenhang der Produktion auf diese zurückspiegelt. Dennoch ist diese mechanistische Auffassung von Wert gerade in der Nach-Marxschen Zeit bei vielen Theoretikern der 2. Internationale vorherrschend. Bei Hilferding (2) führt diese Wertauffassung unmittelbar zur Aufgabe der Werttheorie für das Geld selbst, das sich für ihn aufgrund der Entwicklung des Kreditwesens und entsprechender Geldformen nicht mehr mit der Marxschen Analyse des Wertes von Waren erklären lasse.
Auf der anderen Seite stehen Auffassungen von Wert, die sich auf I. Rubin zurückführen lassen und heute etwa von der „monetären Werttheorie“ vertreten werden (3). Danach besitzt das Einzelprodukt mit der Produktion keinen Wert, sondern dieser wird erst durch die Zirkulation, den Warentausch, aufgrund des gesellschaftlichen Reproduktionszusammenhangs bestimmt. Der Wert wird hier identisch mit seinem Wertausdruck gesetzt, ja Wert wird ohne Geldausdruck zu einer „metaphysischen Konstruktion“. Die sich aus der Widersprüchlichkeit der Arbeit als konkreter und abstrakter ergebende Notwendigkeit, dass Wert sich in einer gegenständlichen Wertform ausdrücken muss, führt in dieser Theorie zur Untrennbarkeit von Wert und Wertform. Auch diese Vereinseitigung der Werttheorie führt dazu, dass Geld nicht als Ware werttheoretisch untersucht werden kann – es repräsentiert ja allen anderen Waren gegenüber den Wert und kann dies ohne Tautologie ja sich selbst gegenüber nicht mehr tun.
Nicht „abstrakte Arbeit“ an sich ist ein gesellschaftliches „Konstrukt“, das nur dem Kapitalismus eigen ist (siehe Rubin, Heinrich (4), Hein(5)), sondern die spezifisch kapitalistische, gesellschaftliche Konstruktion ist es, dass Arbeit, reduziert auf abstrakte Arbeit, schon als solche zu gesellschaftlicher Arbeit wird. So ist nicht erst der Markt „die einzige Sphäre der Gesellschaftlichkeit in kapitalistischen Ökonomien“ (Hein, S.30), sondern dieser ist die Sphäre, in der sich erst diese in der Produktion vorweggenommene Gesellschaftlichkeit nachträglich beweisen muss – indem sich der Wert „realisiert“.
Die gesellschaftliche Kategorie „abstrakte Arbeit“ ergibt sich nicht daraus, dass der Gesamtzusammenhang der gesellschaftlichen Arbeiten erst durch den Markt hergestellt wird. Abstrakte Arbeit, als Verausgabung menschlichen Arbeitsvermögens im Verhältnis zur gesellschaftlichen Gesamtarbeitskraft, gibt es dem Prinzip nach unter allen gesellschaftlichen Bedingungen. Die spezifisch-historische gesellschaftliche Kategorie, die abstrakte Arbeit in der Wertform zur Erscheinung bringt, besteht vielmehr in der Auflösung der naturwüchsigen gesellschaftlichen Zusammenhänge von Arbeit und Bedürfnisbefriedigung, in der unmittelbaren Gesellschaftlichkeit von „bloß verausgabter Arbeit“, deren gegenständliches Resultat sich im Nachhinein seinen Bedarf zu suchen hat. Hinter dem Rücken der Akteure entsteht dabei eine „zweite Natur“: eine scheinbar „naturwüchsige Beziehung“ zwischen Arbeit und vergegenständlichten Wertformen, die zum eigentlichen Zweck und gesellschaftlichen Akteur des ökonomischen Prozesses zu werden scheinen. Diese zweite Naturwüchsigkeit macht die Gewalt der Fetischcharaktere der verschiedenen Wertformgestalten aus.
Hier ist nicht der Ort, diese beiden Interpretationsstränge der Werttheorie einer eingehenden Kritik zu unterziehen. Wesentlich ist, dass beide gravierende Folgen für das Verständnis von marxistischer Geld- und Krisentheorie haben.
Sowohl Hilferdings Auffassung von der Funktionsweise hochkonzentrierter und mit imperialistischen Staaten verknüpften Finanzmonopolen, als auch die Auffassung der Rolle des Kreditsystems in der monetären Werttheorie lassen die Möglichkeit eines (von kurzfristigen Störungen abgesehen) krisenfreien kapitalistischen Akkumulationsregimes zu. Grundlegende Krisen können hier nur noch durch fehlerhaftes Agieren der finanz- und wirtschaftspolitischen Spitzen (ob in Politik oder Konzernen) entstehen – also durch die Missachtung der angeblich „marxistischen“ Erkenntnisse in die monetäre Steuerbarkeit der kapitalistischen Akkumulation.
1.3. Hilferdings falsche Geldtheorie und die Konsequenzen
Auch wenn Lenin in seiner Imperialismus-Schrift (6) wichtige Erkenntnisse aus Hilferdings Finanzkapital-Buch übernommen hat, so warnt er doch vor dessen „falscher Geldtheorie“ und Hilferdings einseitiger Definition des Finanzkapitals, die sich auf die Zirkulationssphäre beschränkt (LW 22, S.199 und 230). Lenin hatte offenbar – aus guten Gründen – keine Zeit, auf diese Schwächen Hilferdings näher einzugehen. In der weiteren historischen Entwicklung von Finanzkapital und Imperialismus erweisen sich allerdings diese Schwächen Hilferdings als Hindernisse für ein zeitgemäßes Erfassen des Imperialismus. Anders als Lenin können wir es heute daher nicht nur bei kritischen Nebenbemerkungen belassen.
Was Hilferdings Geldtheorie betrifft, so fangen die Probleme in seiner Darstellung der Werttheorie an. Der Wert von Waren wird durch Verwandlung von konkreter, individueller Arbeitszeit in „abstrakte Arbeitszeit“ im Tauschprozess gebildet (Hilferding, S.11). Es ist kein Wunder, dass sich bei Marx nirgends so etwas wie „abstrakte Arbeitszeit“ findet – vielmehr findet die Wertsubstanz („abstrakte Arbeit“) ihr Maß, die Wertgröße, in der Arbeitszeit. Diese Verwechslung von Wertsubstanz und -größe beinhaltet sowohl die Identifizierung eines bestimmten Teils der tatsächlichen Arbeitszeit als „abstrakte Arbeitszeit“, die auf ein Produkt verwandt wurde, mit dem Wert, als auch die Auffassung, dass die Identifizierung dieses Teils als wertbildend erst im Zirkulationsprozess, im Austausch geschieht.
Mit dieser besonderen Rolle des Zirkulationsprozesses bei der Wertbildung wird dann aber auch die Bestimmung des Geldes zum Problem.
Nachdem sich die Werte aller Waren in einer allgemeinen Wertform, dem Geld, darstellen, kann der unmittelbare Warentausch durch die zeitlich mehr oder weniger gestreckte Metamorphose der Ware aus der Warenform zur allgemeinen Wertform und wieder zurück (W-G-W) ersetzt werden; aus dem einfachen, zufälligen Warentausch wird ein stetiger Prozess, der Zirkulationsprozess, und Geld wird Zirkulationsmittel. Der Wert aller Waren drückt sich dabei in Geld als Maß des Wertes aus (Preisform). Aus verschiedenen Gründen erwiesen sich besonders Edelmetalle besonders geeignet, dieses Maß des Wertes darzustellen. Ihr Wert, d.h. die in der Metallgewinnung verausgabte gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit, lässt sich z.B. durch Gewichtsangaben in präzise Einheiten teilen, die sich auch über längere Zeiträume als Gebrauchswerte erhalten lassen.
Nachdem sich bei Hilferding (im Unterschied zu Marx) nun aber der Wert erst in der Zirkulation bildet, muss das Zirkulationsmittel letztlich unabhängig von der Wertbildung selbst sein. Dies wird bei Hilferding (in Form eines „Gedankenexperiments“) letztlich in einer „reinen Papierwährung“ verwirklicht. Hier wird das Geld „unabhängig vom Wert des Goldes und reflektiert direkt den Wert der Waren“. (Hilferding, S. 21) Der Gesamtwert der auf den Markt gebrachten Waren im Verhältnis zur Umlaufgeschwindigkeit des Geldes bestimmt dann den Wert der einzelnen Geldeinheiten – statt dass das Geld zum Maß der Werte wird, wird umgekehrt der „Zirkulationswert der Waren“ (ebd.) zum Maß des Geldwerts. „Der wirkliche Wertmesser ist nicht das Geld, sondern der ‚Kurs‘ des Geldes wird bestimmt durch das, was ich den gesellschaftlich notwendigen Zirkluationswert nennen möchte.“ (S. 33)
Hier zeigt sich eine Methode, die alle weiteren Ableitungen von Kapitalbegriffen bei Hilferding, bis zu Kredit und Finanzkapital durchzieht. Ist erst einmal das fundamentale Marxsche Prinzip des Primats der Produktionssphäre aufgegeben, werden in der Zirkulationssphäre eigenständige Mechanismen entdeckt, die den Widersprüchen der kapitalistischen Produktion durchaus entgegen wirken können.
Insofern behauptet Hilferding später, dass eine moderne, konzentrierte Bankenökonomie, in der eine Staatsbank die Kontrolle über die Geldpolitik ausübt, in der Lage ist, die „klassische“ Finanzkrise als einer Etappe der zyklischen Krisen des Kapitalismus, zu vermeiden. „Die Entwicklung der Kreditkrise auf der einen Seite zur Bankkrise, auf der anderen Seite zur Geldkrise ist erschwert“ durch die Herausbildung des monopolistischen Finanzkapitals (Hilferding, S. 392) „Entscheidend ist aber, dass der Mangel an Zahlungsmitteln überhaupt nicht eintritt“, einmal wegen der „Entwicklung des Kredits“. „Dann aber können diese Zahlungsmittel zur Verfügung gestellt werden durch die Notenbanken, deren Kredit auch während der Krise unerschüttert bleibt.“ (Ebenda, S. 393)
Banken werden bei Hilferding in der Epoche des Finanzkapitals zu unerschütterlichen, immer totalitäreren Organisationen, die das „romantische Zeitalter“ des spekulativen Finanzkapitals ablösen würden. Hilferding geht ernsthaft von einem unvermeidlichen Bedeutungsverlust von Börsen und Spekulation aus. Die Funktion der Börsen zur Kapitalbeschaffung würde vollständig von riesigen Banken übernommen – der „nüchterne“ Bankbeamte ersetzt den „romantischen“ Börsenspekulanten. Hilferding entwickelt letztlich das Bild einer vom Finanzkapital organisierten Wirtschaft, die vom Staat bis zu den industriellen Monopolen von den Entscheidungen einer kleinen Finanzoligarchie abhängt.
Offensichtlich war Lenins Auffassung von finanzkapitalistischer Herrschaft eine andere. Für ihn wuchs die Herrschaft des Finanzkapitals weiterhin aus der Monopolisierung des Industriekapitals (Lenin, Imperialismus, S. 230). Vor allem aber akzeptierte Lenin offensichtlich nicht Hilferdings Auffassung der Möglichkeit eines planvollen und nachhaltigen finanzkapitalistischen Krisenmanagements. Gerade diese Elemente Hilferdings wurden allerdings später in der Theorie des „staatsmonopolistischen Kapitalismus“ zur herrschenden Interpretation von Lenins Imperialismustheorie. In dieser Theorie wurden die aus den immanenten Widersprüchen der kapitalistischen Produktion notwendig folgenden Krisen endgültig zu rein politischen Konflikten zwischen Finanzoligarchie und den von ihr Beherrschten.
1.4. Die monetäre Werttheorie und die Folgen
Anders als bei Hilferding ist das Problem der Schlussfolgerungen der „monetären Werttheorie“ nicht, dass sie zu einer Beherrschbarkeit kapitalimmanenter Krisenhaftigkeit, insbesondere auch was Finanzkrisen betrifft, führt. Ihre Geldtheorie ist wesentlich komplexer und geht von der Wertbestimmung in der „Einheit von Produktions- und Zirkulationsprozess“ aus. Das Problem, dass hier die Zirkulationssphäre als gleichrangig mit der Produktionssphäre behandelt wird, führt aber in dieser Theorie zwangsläufig dazu, dass Krisen nicht durch werttheoretische Bestimmungen in der Produktion (Tendenz zur Verdrängung lebendiger Arbeitskraft, Kapitalintensivierung, Grenzen der Produktion von relativem Mehrwert …) erklärt werden können.
Die Ablehnung einer langfristigen Tendenz der Profitratenentwicklung wie auch der organischen Zusammensetzung des Kapitals sind in dieser Theorie daher zwangsläufig. Es folgt dann theoretisch, dass sich Krisen aus einer Kombination von Entwicklungen in der Produktion, die durchaus Kapitalintensivierungen beinhalten können, mit langfristigen Akkumulationsentscheidungen (Investitions- oder Sparentscheidungen), die wesentlich von Bedingungen in der Zirkulationssphäre abhängen (z.B. Zinsraten, Preisentwicklung), ergeben. Daraus folgt als Programm dieses Theoriestrangs eine Verknüpfung von „marxistischer“ und post-keynesianischer Krisentheorie, um „konkrete wirtschaftliche Phänomene“ zu erforschen. So ergibt sich, „dass die Kapitalakkumulation in dieser Ökonomie keiner ehernen Gesetzmäßigkeit unterworfen ist. Dieses Ergebnis steht im Gegensatz zu den Schlussfolgerungen der orthodoxen Interpretation der Marxschen Akkumulationstheorie und auch zu den Marxschen Überlegungen im dritten Band des Kapitals, in denen für die lange Frist – ausgehend vom tendenziellen Fall der Profitrate – die Zwangsläufigkeit einer Überakkumulationskrise des Kapitals abgeleitet wird. Der kapitalistische Akkumulationsprozess vollzieht sich nach der in dieser Arbeit entwickelten Position vielmehr in konkret historisch und institutionell geprägten Akkumulationsphasen, die hier als mögliche Akkumulationsregimes unterschieden wurden.“ (Hein, S. 284)
Die Faktoren, die durch ein solches Regime bestimmt seien, betreffen dabei zentral die Entwicklung des Kräfteverhältnisses von Kapital und Arbeit, den technischen Wandel in seinem Einfluss auf Verteilungsverhältnisse und Akkumulationsentscheidungen sowie die Zentralbank- und staatliche Finanzpolitik. Die dadurch bestimmte Struktur von „effektiver Nachfrage“ und Akkumulationsrate bestimme die langfristige Tendenz der Kapitalakkumulation Richtung Krise jeweils historisch spezifisch.
Auch hier führt die Aufgabe des Primats der Produktionssphäre zu einer Leugnung der langfristigen Krisentendenzen des Kapitalismus. Während für Hilferding die Epoche des Finanzkapitals noch die letzte mögliche Entwicklungsform des Kapitalismus war, die bereits wesentliche Momente des Übergangs zum Sozialismus enthielt, wird hier eine beliebige Folge von Akkumulationsregimes ohne historische Tendenz postuliert. So wird die durchaus richtige Analyse der wesentlichen Krisenhaftigkeit des gegenwärtigen „finanzmarkt-getriebenen“ Akkumulationsregimes, zur möglichen Grundlage einer reformistischen Politik zur Hervorbringung eines weniger krisenhaften, aber weiterhin kapitalistischen Akkumulationsregimes.
1.5. Geld und Krise
Nach der Ableitung des Geldes aus der Warenform wurde Geld bisher in seinen Funktionen als Maß der Werte und als Zirkulationsmittel dargestellt. Mit der zeitlichen Streckung des Austausches, dem Unabhängigwerden der Tauschgüter vom unmittelbaren wechselseitigen Bedarf durch die Vermittlung des Geldes, kann auch der Prozess W-G-W nach Ort und Zeit in W-G und G-W auseinandergerissen werden.
„Keiner kann verkaufen, ohne dass ein anderer kauft. Aber keiner braucht unmittelbar zu kaufen, weil er selbst verkauft hat. Die Zirkulation sprengt die zeitlichen, örtlichen und individuellen Schranken des Produktentausches eben dadurch, dass sie die hier vorhandene unmittelbare Identität zwischen dem Austausch des eigenen und dem Eintausch des fremden Arbeitsprodukts in den Gegensatz von Verkauf und Kauf spaltet.“ (MEW 23, S.127)
Mit dieser Spaltung wird eine neue Funktion des Geldes geboren, als auch die abstrakte Möglichkeit der Krise. Geld wird einerseits zum Selbstzweck („Geld als Geld“), indem aus dem Verkauf gewonnenes Geld nicht zu neuem Kauf verwendet wird, sondern zur „Wertaufbewahrung“ dient („Schatzbildung“); andererseits, indem sich W-G und G-W zeitlich umkehren können, ein Geschäft „auf Vorschuss“ gemacht wird, und Geld zu einem späteren Zeitpunkt als „Zahlungsmittel“ eingesetzt wird. Hier kommt es nicht mehr nur darauf an, dass der Verkäufer (der hier auch „Schuldner“ ist) einen bestimmten Wert produziert, sondern auch darauf, dass er ihn zu einem bestimmten Termin (entsprechend der Laufzeit des Schuldverhältnisses) produziert. Schließlich sprengt „Geld als Geld“ auch die lokalen Grenzen von Zirkulationssphären, indem sich das Geld dieser Sphären vergleichbar macht („Weltgeld“).
Offenbar entsteht hier ein neuer Gegensatz von der bloßen Wert-Zeichenhaftigkeit des Geldes als Zirkulationsmittel und seiner Geld-als-Geld-Funktion: ein Sparer, Gläubiger, Besitzer fremder Währung will „bares Geld“ sehen und kein „Zeichen“. Andererseits kann der Abfluss von Geld aus der Zirkulation – ob durch übermäßiges Sparen, nichtbezahlte Schulden, Abfließen ins Ausland – einhergehen mit der Stockung der Zirkulation und der Unterbrechung der Warenmetamorphose (unverkäufliche Waren, mangelnde geldgestützte Nachfrage …). Mit der Funktion „Geld als Geld“ ist also die allgemeine Möglichkeit der Krise als „Zusammenbruch der Märkte“ bzw. Überproduktion von Waren gegeben.
Diese Möglichkeit der Krise durch allgemeine Überproduktion wird sowohl von klassischer wie auch von neo-klassischer bürgerlicher Ökonomie geleugnet. Wesentlicher logischer Grund dafür ist gerade das Nicht-Verständnis des Geldes im werttheoretischen Sinn. Gemeinsame Argumentationsbasis ist dabei das „Saysche Gesetz“, nachdem sich – grob gesagt – jedes Angebot seine Nachfrage schafft. „Jeder, der seit Adam Smith sich mit der politischen Wirtschaftslehre beschäftigt hat, gibt zu, dass wir, genau genommen, unsere Bedürfnismittel nicht mit dem Gelde, dem Umlaufwerkzeuge, wirklich kaufen, mit dem wir sie bezahlen. Wir müssen erst vorher das Geld selbst durch den Verkauf unserer Erzeugnisse eingekauft haben. (…) weil die Wertmenge, die wir einkaufen können, derjenigen gleich ist, die wir hervorzubringen vermögen, so werden auch die Menschen desto mehr kaufen, je mehr sie hervorbringen werden. Daher die andere Folgerung (…), dass die Ursache, warum gewisse Waren nicht verkauft werden können, darin liegt, weil andere nicht hervorgebracht werden ….“ (Brief von Say an Maltus, Zitiert nach Hein).
Daran anschließend vertrat auch Ricardo in der Debatte um die Möglichkeit einer allgemeinen Überproduktionskrise, dass die Nachfrage nur durch das Niveau der Produktion beschränkt sei. Zwar könne es in einzelnen Bereichen Überproduktion geben, dies aber nur durch falsche Verteilung in den Märkten, was durch einen Ausgleichungsprozess (vermittelt über die Preisentwicklung) wieder ins Gleichgewicht gebracht würde. In der herrschenden bürgerlichen Ökonomie wird die Möglichkeit eines nachhaltigen Mangels aggregierter (i.e. über alle Märkte zusammengefasster) Nachfrage eben aufgrund dieses Gleichgewichtspostulats geleugnet – und dies ist bis heute Grundlage der „herrschenden Lehre“.
Marx setzte sich in den „Theorien über den Mehrwert“ mit Ricardos Argumenten auseinander und stellte hier noch mal die Unfähigkeit von Ricardos Werttheorie dar, die Rolle des Geldes in der kapitalistischen Ökonomie zu verstehen. Letztlich wird in der bürgerlichen Ökonomie (in der „Neo-Klassik“ ist dies noch extremer) Kapitalismus auf eine Tauschökonomie reduziert, in der Geld als zusätzliches, nützliches Instrument eingeführt wird, ohne seine zentrale Rolle in der kapitalistischen Vergesellschaftung zu verstehen: „Hier werden also Krisen dadurch wegräsoniert, dass die ersten Voraussetzungen der kapitalistischen Produktion, das Dasein des Produkts als Ware, die Verdopplung der Ware in Ware und Geld, die daraus hervorgehenden Momente der Trennung im Warentausch, endlich die Beziehung zwischen Geld oder Ware zur Lohnarbeit vergessen oder geleugnet werden“ (MEW 26.2, S.502).
Hier wird noch einmal klar gemacht, dass die aus der Wertformanalyse sich ergebenden Geldfunktionen sowohl zum weitestgehenden Auseinanderfallen von Kauf und Verkauf in W-G-W führen können, als auch zum Festhalten des Geldes als „Wert an sich“. Hierzu direkter:
„Die Zufuhr von allen Waren kann im gegebenen Augenblick größer sein als die Nachfrage von allen Waren, indem die Nachfrage nach der allgemeinen Ware, dem Geld, dem Tauschwert, größer ist als die Nachfrage nach allen besonderen Waren oder indem das Moment, die Ware als Geld darzustellen, ihren Tauschwert zu realisieren, überwiegt über das Moment, die Ware in Gebrauchswert zurückzuverwandeln“. (Ebenda S. 505)
Diese von Marx auch als „abstrakte Form der Krise“ bezeichnete Situation glaubt die bürgerliche (Neo-)Klassik durch die Ausweitung ihrer Gleichgewichtstheorie vermeiden zu können. „Freie Märkte“ vorausgesetzt, würde sinkende allgemeine Nachfrage durch übermäßiges Sparen ausgeglichen werden durch sinkende Zinsen, was wiederum zum Anstieg der Investitionen und damit der Nachfrage führe.
Das Problem ist hierbei, dass wiederum der „Geldmarkt“ behandelt wird wie jeder andere Warenmarkt, und somit seine Abhängigkeit von der Kapitalakkumulation und deren Krisentendenzen nicht miteinbezogen wird. Dies müssen wir also erst später, nach der Darstellung dieses Zusammenhangs, in das Konzept der abstrakten Möglichkeit der Krise einbauen.
Interessanterweise gibt es an der Stelle eine wichtige Ausnahme in der bürgerlichen Ökonomie. Ähnlich Marx geht auch Keynes von einer scharfen Ablehnung des „Sayschen Gesetzes“ aus. Auch für ihn ist die Geldfunktion im Kapitalismus mit der systematischen Möglichkeit einer Überproduktionskrise verbunden („Mangel an effektiver Nachfrage“). Hier anerkennt Keynes auch explizit, dass Marx das Verständnis der bürgerlichen Ökonomie als bloße Tauschwirtschaft überwunden hat:
„The distinction between a co-operative and an entrepreneur economy bears some relation to a pregnant observation made by Karl Marx (…). He pointed out that the nature of production in the actual world is not, as economists often do suppose, a case C-M-C, i.e. of exchanging commodity (or effort) for money in order to obtain another commodity (or effort). That may be the standpoint of the private consumer. But it is not the attitude of business, which is a case of M-C-M‘, i.e. of parting with money for commodity (or effort) in order to obtain more money. (…) An entrepreneur is interested, not in the amount of product, but in the amount of money which will fall to his share”. (7)
Dieser Übergang von der Tauschwirtschaft W-W, bzw. der Warenzirkulation W-G-W zur Produktion von Kapital G-W-G‘ ist tatsächlich entscheidend, um die aus der Geldanalyse entwickelten Formen von Fixierung des Werts um seiner selbst willen und der daraus folgenden abstrakten Möglichkeit der Krise, in ihrer tatsächlichen, realisierten Bewegung(sform) zu verstehen. Keynes teilte zwar mit Marx die Analyse der Möglichkeit der Krise, nicht jedoch die Analyse der tatsächlichen Kapitalbewegung.
Exkurs: „Kaufkraftparitäten“ – ein neuer Versuch zur Reduktion der kapitalistischen Geldwirtschaft auf eine Tauschökonomie
Gerade um die wirtschaftlichen Gewichte zwischen imperialistischen Ökonomien und „aufstrebenden Neu-Industrieländern“ (z.B. China, Indien) in der Darstellung zu minimieren, gefällt sich bürgerliche Statistik seit einiger Zeit darin, wirtschaftlichen Output in „Kaufkraftparitäten“ zu messen – also statt Weltgeldeinheiten (Dollar) einen imaginären Warenkorb, der mit der lokalen Arbeitsleistung bezogen werden kann, zum Vergleichsmaßstab zu nehmen. Mit dieser Einheit gemessen erscheinen dann Ökonomien wie die Chinas schon als ökonomische Supermächte. Leider lassen sich auch „Marxisten“ von solchen Taschenspielertricks irreführen. Kapitalismus ist eben keine Barter-Ökonomie, in der nur hilfsweise Geld als Tauschmittel eingeführt wird; es ist auch keine „Werttheorie“, wenn über unmittelbaren Warenvergleich die „Verzerrung“ durch Preiskategorien „herausgerechnet“ wird (wie dies einige „Marxisten“ meinen). Es ist eben kein Nebending, dass z.B. die chinesische Währung systematisch gegenüber dem Dollar unterbewertet ist, und landwirtschaftliche Produkte dort nicht den Weltmarktpreisen entsprechen. Eine entsprechende Ausgleichbewegung, z.B. Aufwertung der chinesischen Währung bzw. Liberalisierung des Agrarsektors (z.B. Exportorientierung) würde die Konkurrenzfähigkeit chinesischer Industrieprodukte stark mindern – und damit auch rasch die in Kaufkraftparitäten gemessenen Werte. Der komplexe Zusammenhang von wertmäßig bestimmten Verhältnissen und ihrer geldmäßigen Widerspiegelung lässt sich eben nicht dadurch umgehen, dass man die Analyse auf einfache Tauschverhältnisse zurückfallen lässt. Tatsächlich ergibt sich durch die importierte Dollarinflation eine Dynamik, die die jetzt noch günstigen Kaufkraftparitäten langfristig untergräbt (so wie auch die chinesische Währung in den letzten zwei Jahren um 20% aufwertet werden musste).
1.6. Geldzirkulation, Wertzeichen und Geldkrise
1.6.1. Geldwert und Preisentwicklung
In verschiedenen Stufen lässt sich aus der Marxschen Geldtheorie das Verhältnis von Warenwerten und Geldwert auf der einen Seite und Preisniveau bzw. Geldmenge auf der anderen Seite entwickeln.
Im einfachsten Fall einer Goldumlaufwährung ergibt sich (anders als in Hilferdings Quantitätstheorie) eine direkte Bestimmung der beiden letzteren durch die beiden ersteren:
Sei Wg der Wert der Geldeinheit (als Resultat der gesellschaftlich notwendigen Arbeit in der Geldproduktion), Wi der Wert der Ware i (wobei es 1<=i<=n Waren gäbe), xi die Anzahl der Stücke von Ware i in Transaktionen der Periode T, Pi der Preis der Ware i in Geldeinheiten, q die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes (durchschnittliche Anzahl der Transaktionen, in denen ein und dasselbe Geldstück in der Periode T verwendet wird) und Mz die Menge der Geldstücke, so gilt die Gleichung:
q Mz = ∑n xiPi = ∑n Wi/Wg
Nach dieser einfachen Relation ergibt sich ein Steigen der Preise entweder aus dem Sinken des Geldwerts oder aus dem Steigen der Warenwerte. Oder andersherum: die Entwertung des Geldes kann ohne Auswirkungen auf die Preise bleiben, wenn gleichermaßen die Werte sinken (so wie lange die Inflationstendenzen der hoch-verschuldeten Dollarökonomie durch den „China“-Effekt ausgeglichen wurden).
Abbildung 1 zeigt das Ansteigen der Geldmenge (8) M3 im Verhältnis zur Preissumme des Bruttoinlandsprodukts (BIP) in Deutschland von 1995-2007. War die Geldmenge im Verhältnis zum BIP 1995 noch bei 56%, so war sie 2007 bei 72% (die Zahlen für die USA sind, wie später gezeigt wird, noch höher). Offensichtlich hat sich im letzten Jahrzehnt ein hohes Inflationspotential aufgebaut.
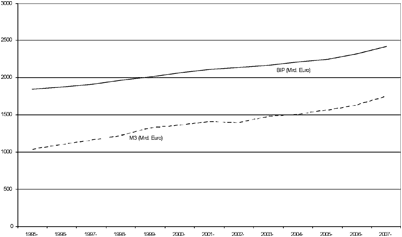
Abbildung 1: Entwicklung der Geldmenge (M3) im Vergleich zum nominellen BIP (jeweils in Mrd. Euro) – jeweils für Deutschland 1995-2007
Bei einer reinen Goldumlaufwährung wird die Geldmenge durch die Wertrelationen (Geld, Waren) eindeutig bestimmt, genauso wie die Preise. Wird nun Gold durch Wertzeichen ersetzt (die durch eine Goldreserve gedeckt sind), so mag es vorkommen, dass die Geldzeichenmenge, die eigentlich erforderliche Geldmenge übersteigt oder unterbietet. Dann können die Relationen der obigen Gleichung nur erfüllt sein, indem der Wert (der entsprechende Anteil an der Deckungsware) des entsprechenden Wertzeichens entsprechend fällt oder steigt (umgekehrtes Verhältnis zur Geldzeichenmenge). Entsprechend steigen oder fallen wiederum die Preise. Auf diese Weise wird bei Geldzeichenwährungen das Preisniveau zum Regulator der Geldmenge, sofern die geldausgebende Institution auf steigende oder fallende Preise reagiert und diese nicht auf Wertveränderungen bei den Waren zurückführt.
1.6.2. Geldumlauf und Kredit
Diese Relationen werden wesentlich modifiziert, sobald die Funktionen von „Geld als Geld“ in die Analyse treten. Sobald Schuldverhältnisse im Spiel sind, findet mit ihrer Hilfe einerseits Warenzirkulation ohne Geld statt (bzw. mit Geld bloß als Maßstab des Werts). Andererseits muss es als Zahlungsmittel zum Fälligkeitstermin in die Zirkulation eintreten können, also vorhanden sein. Der Schuldner muss Verkäufe W-G tätigen, mit dem einzigen Zweck, Zahlungsmittel für seine Schuld zu akkumulieren. Schuldverhältnisse und „Schatzbildung“ (Sparen) treten also in der entwickelten Warenzirkulation in ein bestimmtes Verhältnis: „Die Entwicklung des Geldes als Zahlungsmittel ernötigt Geldakkumulation für die Verfallstermine der geschuldeten Summen. Während die Schatzbildung als selbstständige Bereicherungsform verschwindet mit dem Fortschritt der bürgerlichen Gesellschaft, wächst sie umgekehrt mit demselben in der Form von Reservefonds der Zahlungsmittel.“ (MEW 23, S.156) Zusätzlich nehmen alle möglichen anderen gesellschaftlichen Verhältnisse die Form von mit Zahlungsmitteln zu bedienenden Schuldverhältnissen an (z.B. Steuern, Renten).
Durch die Vermittlung der Zahlungsverpflichtungen durch eigene Institutionen, z.B. Banken, brauchen nicht alle Zahlungen mit „realem“ Geld getätigt zu werden. Die wechselseitigen Zahlungsverpflichtungen können in einer Zahlungsbilanz saldiert werden, so dass die tatsächlich notwendige Masse an Zahlungsmitteln minimiert wird. Hier tritt nun im Geld als Zahlungsmittel ein Problem auf: „Die Funktion des Geldes als Zahlungsmittel schließt einen unvermittelten Widerspruch ein. Soweit sich die Zahlungen ausgleichen, funktioniert es nur ideell als Rechengeld oder Maß der Werte. Soweit wirkliche Zahlung zu verrichten, tritt es nicht als Zirkulationsmittel auf, als nur verschwindende und vermittelnde Form des Stoffwechsels, sondern als die individuelle Inkarnation der gesellschaftlichen Arbeit, selbständiges Dasein des Tauschwerts, absolute Ware. Dieser Widerspruch eklatiert in dem Moment der Produktions- und Handlungskrisen, der Geldkrise heißt.“ (MEW 23, S. 151f)
D.h. der Vorteil eines entwickelten Geldsystems, die unterschiedlichen zeitlichen Verfügbarkeiten von Waren durch wechselseitige Schuldverhältnisse („bargeldlosen Verkehr“) auszugleichen, bringt den Widerspruch von Geld als bloßes Zirkulationszeichen und Geld als (absolute) Ware unmittelbar zum Vorschein.
Für die Gesamtgeldmenge ergibt sich jetzt als Gleichgewichtsforderung:
M = Mz + Ms + Mh
Wo Mz die Masse des zirkulierenden Geldes, Ms das Saldo der Zahlungsverpflichtungen und Mh die Masse des gehorteten (gesparten) Geldes sei (von der Bilanz im internationalen Zahlungsverkehr wird hier noch abgesehen). Jetzt kommt es nicht mehr nur darauf an, ob bei gegebener Umlaufgeschwindigkeit, die Menge der Geldzeichen der umgesetzten Wertmenge entspricht, sondern auch darauf, dass zu bestimmten Fälligkeitsterminen genug Geld aus Mz in Mh übergegangen ist, um Ms auszugleichen. Andernfalls gibt es hier einen weiteren Grund für die Entwertung von Geld. Dies um so mehr, als die längerfristige Fälligkeit von Schuldforderungen selbst die Möglichkeit eröffnet, diese Forderungen als Geldwertzeichen zu verwenden. Das Kreditgeld, in seiner ursprünglichsten Form als Wechsel und seiner Diskontierung, wird mit der entwickelten Geldzirkulation zur Haupterscheinungsform von Geld: „Andererseits, wie sich das Kreditwesen ausdehnt, so die Funktion des Geldes als Zahlungsmittel. Als solches erhält es eigene Existenzform, worin es die Sphäre der großen Handelstransaktionen behaust, während die Gold- und Silbermünze hauptsächlich in die Sphäre des Kleinhandels zurückgedrängt wird.“ (MEW 23, S. 154)
Da Marx im 3. Band des „Kapitals“ die Entwicklung von Papiergeld aus dem Wechselgeschäft von Notenbanken entwickelt, ergibt sich dann ein weiteres Zurückdrängen des Münzgeldes durch Kreditgeld auch in der Sphäre des „Kleinhandels“. Soweit zum Mythos, Marx müsse aufgrund des Konzepts der „Geldware“ letztlich alles Geld auf Gold o.ä. Metallgeldformen zurückführen. Mit der Entwicklung des Kreditgeldes wird sich später zeigen, dass es eine weitere Ware gibt, die sich ganz zentral für die Darstellung von Geld als Inkarnation von gesellschaftlicher Arbeit eignet: sobald nämlich Kapital selbst, in Form von zinstragendem Kapital, zur Ware geworden ist. Hier findet dann Geld als Kreditgeld die Schranke seiner Expansion nur noch in den Schranken der Kapitalakkumulation selbst. Dies zu zeigen, erfordert allerdings noch einige vermittelnde Analyseschritte.
Unmittelbare Folgerung wird sein, dass es nicht die „Steuerung der Geldmenge“ oder sonstige Geldpolitik sein kann, welche die Probleme der Kapitalakkumulation lösen oder hervorbringen kann. Es sind umgekehrt die Grundwidersprüche der Kapitalakkumulation, die zu Turbulenzen und Krisen in der Geldsphäre führen.
Abbildung 2 zeigt, dass die Inflationsrate (9) (gemessen in den Veränderungen des Verbraucherpreisindex) in Deutschland von 1995-2007 sich entgegen dem monetaristischen Dogma nicht parallel mit dem Geldmengenwachstum bewegt. Wie in diesem Abschnitt dargestellt, wirken hier andere Faktoren entgegen: z.B. das zeitweilige Sinken von Erzeugerpreisen (z.B. Wertsenkung von Produkten durch Import billiger Ausgangsmaterialien) oder der Anstieg der Sparquote ab dem Jahr 2000. Ein Wegfall dieser Faktoren (siehe Kapitel zum Derivatenhandel) muss dann die Inflationstendenzen umsomehr zum Ausbruch bringen.
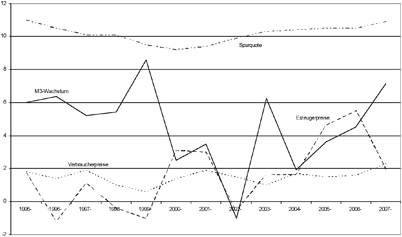
Abbildung 2: Komponenten der Inflation (Geldmengenwachstum, Erzeuger- und Verbraucherpreise, Sparquote) – jeweils für Deutschland 1995-2007
2. Geld als Kapital (10)
2.1. Werttheoretische Bestimmungen des Kapitals im Allgemeinen
Mit der Verwandlung von Geld in Kapital als weiterer Geldfunktion („Geld als Kapital“) erhält Geld, und damit der Widerspruch von Ware und Geld, eine selbstständige Bewegungsform: G-W-G‘. Während die Warenzirkulation ihren Zweck außer sich hat (Verwandlung der Gebrauchswertform), ist die Kapitalzirkulation reiner Selbstzweck: Vorschuss von Geld, um mehr Geld zu erhalten. Dies kann zwar nicht in der Zirkulation selbst erreicht werden (Verkauf über Wert führt langfristig entweder bloß zur Umverteilung von Mehrwert oder allgemeiner Teuerung); wohl aber durch Einhalten der Gesetze des Äquivalententausches.
Mit der Ware Arbeitskraft ist diejenige Ware gefunden, deren Gebrauchswertkonsumtion ihren Wert erhält und darüber hinaus mehr Wert erzeugt. Dabei setzt die Verwandlung des Arbeitsprozesses aus einem bloßen Wertbildungsprozess in einen Verwertungsprozess von Geldvorschuss ein antagonistisches gesellschaftliches Verhältnis im Produktionsprozess voraus: den unmittelbar Arbeitenden stehen ihre Arbeits- und Subsistenzmittel in Warenform so gegenüber, dass sie nur durch Verkauf ihrer Arbeitskraft diejenigen Arbeitsmittel anwenden können, mit denen letztlich auch die zu ihrer Reproduktion notwendigen Mittel hergestellt werden können. Es stehen sich Eigner von Produktionsmitteln und Eigner von nichts als eigener Arbeitskraft gegenüber, deren Verhältnis durch Warenproduktion vermittelt und gleichzeitig verschleiert wird. Während im Zirkulationsprozess individuelle Warenbesitzer in Beziehung treten, tritt das gesellschaftliche Verhältnis im Produktionsprozess zu Tage, als Verhältnis von produktivem „Gesamtarbeiter“ und sich Mehrwert aneignendem Gesamtkapital.
Auf der Grundlage dieses gesellschaftlichen Verhältnisses im kapitalistischen Produktionsprozess lassen sich grundlegende werttheoretische Bestimmungen für die Gesetzmäßigkeiten der Kapitalakkumulation ableiten. Die Mehrwertrate (m/v) ist wesentlich durch das gesellschaftliche Kräfteverhältnis von Kapital und Arbeit bestimmt (Arbeitstag, Lohnniveau, Entwicklung der Reproduktionskosten der Ware Arbeitskraft im Verhältnis zur Arbeitsproduktivität …). Ebenso sind Arbeitsproduktivität und Entwicklung der Zusammensetzung des Kapitals (c/v) nicht nur durch technische Entwicklungen, sondern auch durch gesellschaftliche Auseinandersetzungen bestimmt, wie auch der Umfang der Produktion (absolute Masse der produktiven Arbeitszeit und Arbeitskräfte). Diese wertmäßigen Bestimmungen sind die wesentlichen Parameter für die Entwicklung der Kapitalakkumulation (Fortsetzung von G-W-G‘ über beliebig viele Perioden, wobei jeweils ein Teil des realisierten Mehrwerts aus der Vorperiode neu investiert, i.e. akkumuliert wird), die ihrerseits auf diese zurückwirkt. Zu diesen Entwicklungstendenzen gehört die steigende organische Zusammensetzung des Kapitals (langfristiges Wachsen von c/v), ebenso die Tendenz zum Drücken des Lohnniveaus Richtung Existenzminimum in Verbindung mit der Unvermeidlichkeit von Arbeitslosenheeren. Zu diesen Tendenzen gehört auch die notwendig wachsende Konzentration des Kapitals (mit dem immer höheren Kapitalaufwand für die wesentlichen produktiven Bereiche, sind dort immer weniger Einzelkapitale zur Akkumulation in der Lage), als auch die zunehmende Zentralisation als Beschleunigung der Akkumulation (Übernahme oder Zusammenschluss von Kapitalen).
Diese Entwicklungstendenzen analysiert Marx auf der Ebene des Kapitals im Allgemeinen, also aufgrund der werttheoretischen Analyse des kapitalistischen Produktionsprozesses, ohne dabei auf Besonderheiten der Zirkulation eingehen zu müssen. Die im 2. Band des „Kapitals“ folgende Analyse des Zirkulationsprozesses des Kapitals in seiner Einheit mit dem Produktionsprozess fügt nur Kategorien hinzu, die im 3. Band erlauben, die konkreten Formen dieser Entwicklungsgesetze darzustellen. Alle Versuche, diese Elemente der Zirkulationssphäre gleichwertig in die Marxsche Krisentheorie einzuführen, müssen daher – wie bei der „monetären Werttheorie“ oder im Austromarxismus – in einer Revision derselben enden.
2.2. Konkurrenz und Monopol
Dies gilt auch für die Bedeutung der Konkurrenz der Einzelkapitale. Weit davon entfernt, das „Wesen des Kapitalismus“ auszumachen, ist die Konkurrenz vielmehr eine Folge der Selbstbewegung des Kapitals, der Verwertung von Kapital um seiner selbst Willen. Mit der Akkumulation des Kapitals auf immer höherer Stufenleiter ist verbunden, dass sich der Verwertungsspielraum der Einzelkapitale zwangsläufig mehr und mehr verengt, und sie somit in einen Kampf um Leben und Tod gezwungen werden. „Stellt sich die Akkumulation daher einerseits dar als wachsende Konzentration der Produktionsmittel und des Kommandos über Arbeit, so andererseits als Repulsion vieler individueller Kapitalisten voneinander. (…) Die Konkurrenz rast hier im direkten Verhältnis zur Anzahl und im umgekehrten Verhältnis zur Größe der rivalisierenden Kapitale. Sie endet stets mit Untergang vieler kleiner Kapitalisten, deren Kapitale teils in die Hand des Siegers übergehen, teils untergehen.“ (MEW 23, S. 654f)
In seiner Schrift zum „Imperialismus“ hat Lenin richtigerweise die Tendenz zur Herausbildung des Monopolkapitals in dieser von Marx erkannten wechselseitigen Beziehung von Konkurrenz und Konzentration der Kapitale in der Entwicklungsgeschichte der Akkumulation festgemacht: „Vor einem halben Jahrhundert, als Marx sein Kapital schrieb, erschien der überwiegenden Mehrheit der Ökonomen die freie Konkurrenz als ein ‚Naturgesetz‘. Die offizielle Wissenschaft versuchte, das Werk von Marx totzuschweigen, der durch seine theoretische und historische Analyse des Kapitalismus bewies, dass die freie Konkurrenz die Konzentration der Produktion erzeugt, diese aber auf einer bestimmten Stufe ihrer Entwicklung zum Monopol führt. Das Monopol ist jetzt Tatsache.“ (LW 22, S. 204)
Jetzt – verkünden die Kapitalismus-Apologeten – sei Marx natürlich überholt, da Kapitalismus ganz anderen Gesetzen folge als im „Konkurrenz- oder Manchesterkapitalismus“. Hier wird verkannt, dass für Marx die Konkurrenz Folge, nicht Wesen der Kapitalentwicklung ist. Anders als Hilferding, der die neue Kapitalepoche vornehmlich definierte durch eine Neuorganisation der Zirkulationssphäre, nämlich die Herausbildung eines hochkonzentrierten Bankenkapitals, das dann in Folge zu einer umfassenden Kontrolle über das Industriekapital gelangt, stellt Lenin fest: „Diese Definition ist insofern unvollständig, als ihr der Hinweis auf eines ihrer wichtigsten Momente fehlt, nämlich auf die Zunahme der Konzentration der Produktion und des Kapitals in einem so hohen Grade, dass die Konzentration zum Monopol führt und geführt hat.“ (LW 22, S. 230)
Auch die extreme Konzentration im Monopolkapital führt letztlich nicht zur Aufhebung des Grundgesetzes, dass Akkumulation sowohl zu wachsender Konzentration als auch zu immer zugespitzterer Konkurrenz führt. Das betrifft sowohl die Konkurrenz der Monopole (auf internationaler Ebene) untereinander, als auch die Verschärfung der Konkurrenzsituation der nicht-monopolistischen Sektoren bzw. der Spin-offs der Monopole.
2.3. Gleichgewichtsbedingungen und Kapitalakkumulation
Ähnlich wie die Frage der Vermeidung der von Marx entdeckten Krisentendenzen der Kapitalakkumulation durch die sog. Ausschaltung der Konkurrenz, geht es auch mit anderen Elementen der Analyse der Zirkulationssphäre. In der Analyse der Zirkulation des Kapitals geht es nicht nur um den Preiskampf der Kapitale, sondern wesentlich um die Bedingungen, unter denen der im kapitalistischen Produktionsprozess in Warenform produzierte Wert auch realisiert werden kann. Da sich der gesellschaftliche Zusammenhang der Produktion im Kapitalismus erst nachträglich, über die Zirkulation vermittelt und durchsetzt, muss sich in der Zirkulation erweisen, ob die Verteilung der gesellschaftlichen Arbeit auf die verschiedenen Bereiche der Produktion auch zur Reproduktion fähig ist.
In den Reproduktionsschemata zeigt Marx die Bedingungen auf, unter denen die Verteilung der gesellschaftlichen Arbeit auf die Produktionsgüter und Konsumgüterproduktion bei erweiterter Reproduktion jeweils auch die gesteigerte Nachfrage für die gesteigerte Produktion hervorbringt. Diese Schemata sind „Gleichgewichtsbedingungen“, die durch den ungeplanten gesellschaftlichen Zusammenhang zumeist nicht erfüllt sind – aber gerade dadurch zu Ausgleichsbewegungen führen, die den Disproportionen entgegenwirken. Marx hatte also keine Theorie eines „letztlich begrenzten Marktes“, der absolute eine Nachfrageschranke für die Kapitalakkumulation schaffe (wie etwa Rosa Luxemburg behauptet). Marx zeigte mit den Reproduktionsschemata vielmehr, dass der kapitalistische Produktionsprozess sich die jeweils notwendige Nachfrage nach seinen Produkten selbst schafft, so lange die Ausdehnung der Produktion mit Steigerung der Mehrwertproduktion verbunden ist. Die Schranke der Kapitalakkumulation ist letztlich das Kapital selbst, das mit der Beschleunigung der Akkumulation gleichzeitig die Quelle der Mehrwertproduktion untergräbt: die menschliche Arbeitskraft.
Andere Elemente der Analyse der Zirkulation des Kapitals sind die Unterscheidung von fixem und zirkulierendem Kapital, sowie die Bedeutung der Umschlagzeiten oder Lagerzeiten. Während z.B. Rohstoffe, Energie, Werkstoffe jeweils in der Produktionsperiode verwertet werden, so gehen von Maschinen jede Periode nur Teile ihres Werts auf das Produkt über. Die unterschiedlichen Umschlagzeiten von Fixkapitalen erfordern die Rücklage großer Amortisationsfonds bzw. das Aufbringen großer Kapitalvorschüsse zu bestimmten Terminen. Diese Umschlagszeiten sind daher verbunden mit zyklischen Zahlungsspitzen, bzw. mit den Konjunkturzyklen. Andererseits bedeutet Beschleunigung des Kapitalumschlags, z.B. durch Reduktion von Lagerzeiten, Transportkosten oder raschere Realisierung der produzierten Waren eine Beschleunigung der Akkumulation und ebenso eine von Konkurrenz und Konzentration.
2.4. Bildung einer allgemeinen Durchschnittsprofitrate
Mit der Verwandlung von Mehrwert in Profit erscheint dem Einzelkapitalisten sein Gewinn als etwas von der einzelnen Ware unabhängiges – der gesamtgesellschaftliche Zusammenhang der Wertzumessung nimmt eine eigene, fetischartige Form an. Zunächst ist dem Einzelkapitalisten wesentlich, wie viel mehr Geld („Profit“) er aus dem Verkauf seiner Ware erhält, als er der Produktion in Form von Ankauf von Produktionsmitteln und Arbeitskraft vorschießen musste („Kostpreis“). Im „Kostpreis“ verschwindet die eigentlich wertbildende Arbeitskraft als Bestandteil der variablen Kosten gegenüber den „Fixkosten“. Dass die Profitrate (m/c+v) weiterhin durch die wesentlichen Wertparameter der Produktion (Mehrwertrate m/v und Wertzusammensetzung c/v) bestimmt ist, verschwindet an der gesellschaftlichen Oberfläche.
Dieser Unterschied wird wesentlich, sobald sich Einzelkapitale in der Konkurrenz sowohl innerhalb einer Branche, als auch als Investoren in verschiedenen Branchen gegenüber stehen. Die unterschiedliche Wertzusammensetzung, selbst bei annähernd gleicher Mehrwertrate, führt hier unweigerlich zu unterschiedlichen Profitraten. Die Branchen mit geringerem technischen Aufwand und Kapitaleinsatz ergeben theoretisch zunächst bessere Profitraten. Doch gerade dieses „leichtere Geldmachen“ in diesen Bereichen zieht notwendig mehr Kapitale an, während die Bereiche mit höherer Wertzusammensetzung geringeres Angebot produzieren werden. Die sich so ergebende Verteilung des Gesamtkapitals erzeugt Verhältnisse von Angebot und Nachfrage ihrer jeweiligen Waren, die die Preise der „Leicht“-Bereiche unter ihren Wert treibt, und diejenigen der „Schwer“-Bereiche über ihren Wert. D.h. es findet eine Umverteilung des jeweiligen Mehrwerts statt.
Dieser Ausgleichungsprozess führt zur Bildung einer Durchschnittsprofitrate, indem der Preis der Waren (Produktionspreis) sich ergibt aus dem Kostpreis plus einen darauf aufgeschlagenen, für alle Kapitalisten gleichen, Durchschnittsprofit. Zusammenfallen von Wert und Preis werden auf diese Weise zum Zufall, auch wenn die wertmäßigen Grundparameter die Transformation der Wert in Produktionspreise wesentlich bestimmen. Nur vom Standpunkt des Gesamtkapitals aus ergibt sich weiterhin eine Identität, indem die Wertsumme aller in einer Periode produzierten Waren, ihrer Produktionspreissumme entspricht.
Marx nennt diesen Ausgleichprozess zur Bildung einer Durchschnittsprofitrate auch Grundgesetz der Konkurrenz: „Die beständige Ausgleichung der beständigen Ungleichheiten vollzieht sich um so rascher, 1. je mobiler das Kapital, d.h., je leichter es übertragbar ist von einer Sphäre und von einem Ort zum anderen; 2. je rascher die Arbeitskraft von einer Sphäre in die andre und von einem lokalen Produktionspunkt auf den andren werfbar ist. Nr. 1 unterstellt vollständige Handelsfreiheit im Innern der Gesellschaft und Beseitigung aller Monopole außer den natürlichen, nämlich aus der kapitalistischen Produktionsweise selbst entspringenden. Ferner Entwicklung des Kreditsystems, welches die unorganische Masse des disponiblen gesellschaftlichen Kapitals den einzelnen Kapitalisten gegenüber konzentriert; endlich Unterordnung der verschiedenen Produktionssphären unter Kapitalisten.“ (MEW 25, S. 206)
Die hier angedeuteten Bedingungen erklären sogleich, dass es sich bei dem Ausgleichungsprozess nur um eine Tendenz, einen Annäherungsprozess handelt, der in vielen Bereichen durch Monopolbildung oder staatliche Restriktionen modifiziert wird. Trotzdem drückt sich in dieser Tendenz die Bildung des Kapitals zur gesellschaftlichen Macht (und dies auch in seinen ideologischen, fetischhaften Formen) aus: „Bei der kapitalistischen Produktion handelt es sich nicht nur darum, für die in Warenform in die Zirkulation geworfene Warenmasse eine gleiche Wertmasse in anderer Form – sei es des Geldes oder einer anderen Ware – herauszuziehen, sondern es handelt sich darum, für das der Produktion vorgeschossene Kapital denselben Mehrwert oder Profit herauszuziehen wie jedes andere Kapital von derselben Größe, in welchem Produktionszweig es auch angewandt sei; es handelt sich also darum, wenigstens als Minimum, die Waren zu Preisen zu verkaufen, die den Durchschnittsprofit liefern, d.h. zu Produktionspreisen. Das Kapital kommt sich in dieser Form selbst zum Bewusstsein als eine gesellschaftliche Macht, an der jeder Kapitalist teilhat im Verhältnis seines Anteils am gesellschaftlichen Gesamtkapital.“ (MEW 25, S. 205)
Inhalt dieser „Macht“ ist natürlich, „dass jeder einzelne Kapitalist (…) an der Exploitation der Gesamtarbeiterklasse durch das Gesamtkapital (…) direkt ökonomisch beteiligt ist, weil, alle andern Umstände, darunter den Wert des vorgeschossenen konstanten Gesamtkapitals als gegeben vorausgesetzt, die Durchschnittsprofitrate abhängt von dem Exploitationsgrad der Gesamtarbeit durch das Gesamtkapital.“ (MEW 25, S. 207)
Daher bilden die Kapitalisten, bei aller Konkurrenz untereinander, doch „einen wahren Freimaurerbund“ (MEW 25, S. 208) gegenüber ihrem Hauptkonkurrenten, der Gesamtarbeiterklasse, d.h. hier wird Konkurrenz zum Monopol, zum „Lohnkartell“.
2.5. Die langfristigen Tendenzen der Kapitalakkumulation
Die allgemeinen Tendenzen der kapitalistischen Akkumulation, wie sie von Marx bereits auf der Ebene des Kapitals im allgemeinen analysiert wurden, konkretisieren sich nun, da die Bewegungsformen an der gesellschaftlichen Oberfläche betrachtet werden, im Gesetz vom tendenziellen Fall der Profitrate. Dieses ist unmittelbare Folge der Tendenz zum Steigen der Wertzusammensetzung des Kapitals, bei jeweils gegebenen Schranken der Ausbeutbarkeit der Arbeiterklasse. „Die progressive Tendenz der allgemeinen Profitrate zum Sinken ist also nur ein der kapitalistischen Produktionsweise eigentümlicher Ausdruck für die fortschreitende Entwicklung der gesellschaftlichen Produktivkraft der Arbeit.“ (MEW 25, S. 223)
Die verschiedenen entgegenwirkenden Ursachen, die Reaktionsformen des Kapitals auf dieses Sinken der Profitrate, sind nicht auf der selben theoretischen Ebene angesiedelt wie das Gesetz selbst. Sie sind Elemente, mit denen der Fall der Profitrate für gewisse Zeiträume aufgehalten werden kann (deswegen ist das Gesetz ja auch nur eine „Tendenz“), die aber auf lange Sicht jeweils die Ursache, i.e. die kapitalistische Form der Entwicklung der Produktivkräfte nicht wesentlich modifizieren können.
Dies ist klar bei Elementen wie Erhöhung der Ausbeutungsrate, Lohndrückerei, Verbilligung von konstantem Kapital. Doch die genaue Analyse ist nicht Thema dieses Artikels. Die von Marx angeführten Elemente „auswärtiger Handel“ und „Zunahme des Aktienkapitals“ werden wir gleich betrachten.
Die längerfristige Tendenz zum Fallen der Profitrate führt nicht unmittelbar zur Krise. Im Gegenteil ist sie zunächst Stachel für „beschleunigte Akkumulation“. Das wachsende konstante Kapital kann trotz fallender Profitrate insgesamt die Profitmasse weiterhin steigen lassen. „Die Akkumulation erfolgt trotz fallender Profitrate in fortschreitend rascherem Tempo, weil der Umfang der Akkumulation sich nicht im Verhältnis zur Höhe der Profitrate entwickelt, sondern im Verhältnis der Wucht, die das bereits akkumulierte Kapital besitzt.“ (Grossmann, S. 119f)
Wie Grossmann (11) an einem Standard-Modell der Akkumulation zeigt, bewirkt die beschleunigte Akkumulation ab einem bestimmten zyklischen Höhepunkt, dass auch die Profitmasse zu fallen beginnt, und damit nicht mehr genug akkumuliertes Geldkapital zur Verfügung steht, um die ausgeweitete Kapital- und Konsumgüterproduktion durch weitere Investitionen in Produktionssteigerung umsetzen zu können. „Überproduktion von Kapital heißt nie etwas anderes als Überproduktion von Produktionsmitteln – Arbeits- und Lebensmitteln -, die als Kapital fungieren können, das heißt zur Ausbeutung der Arbeit zu einem gegebenen Exploitationsgrad angewandt werden können; indem das Fallen dieses Exploitationsgrades unter einen gegebenen Punkt Störungen und Stockungen des kapitalistischen Produktionsprozesses, Krisen, Zerstörungen von Kapital hervorruft.“ (MEW 25, S. 266) Insofern ist die an einem bestimmten Punkt erreichte „Überproduktion“ nichts anderes als Überakkumulation von Kapital, das sich nicht mehr mit dem entsprechenden Ausbeutungsgrad verwerten lässt.
Die Auswirkungen dieser Überakkumulation stellen sich dar einerseits als brachliegendes, nicht- oder gering-verwertbares Kapital, mitsamt massenhaft „überflüssiger“ Arbeitsbevölkerung. Andererseits als „Kapitalmangel“, als Mangel an produktiv investierendem Kapital, bei gleichzeitig vorhandenen Massen an spekulativ verausgabten oder gehorteten Geldvermögen. Darin eingeschlossen ist unweigerlich die Unterbrechung der schon analysierten Kette der Zahlungsverpflichtungen, und damit das Eklatieren der Krise in der Geldkrise. All diese Momente laufen hinaus auf den Übergang zur Phase der „Entwertung von Kapital“, ob in Geldform (Finanzkrise), Warenform (Preisverfall), oder physischer Vernichtung von Produktionsmitteln.
Damit wird die in der Tendenz zur Überakkumulation analysierte Zusammenbruchstendenz der Kapitalakkumulation zu einer Krisentheorie, die die „normale“ zyklische Krise zum Ausdruck einer grundlegenderen Krisentendenz macht. „Auf diese Weise zerfällt die ‚Grundtendenz‘ des kapitalistischen Systems in eine Reihe von scheinbar voneinander unabhängigen Zyklen, wo die Zusammenbruchstendenz nur periodisch immer wieder von neuem einsetzt (…) Die Marxsche Zusammenbruchstheorie ist daher die notwendige Basis und Voraussetzung seiner Krisentheorie, weil die Krise nach Marx bloß eine momentan unterbrochene und nicht zur vollen Entfaltung gelangte Zusammenbruchstendenz, also eine vorübergehende Abweichung von der Trendlinie des Kapitalismus darstellt.“ (Grossmann, S.140)
Die zyklischen Krisen stellen mit ihren Entwertungsprozessen und Beschleunigung der Akkumulation über Einsetzen bestimmter entgegenwirkender Ursachen zum Profitratenfall ein notwendiges Element zur Vermeidung des kapitalistischen Zusammenbruchs dar. Mit jeder Krise ergibt sich ein modernisierteres, die Blockaden der Vorperiode durchbrechendes Kapital, das eine weitere Stufe beschleunigter Kapitalverwertung erklimmt. Die Gegentendenzen, die jeweils zu einer neuen Runde der Akkumulation führen, sind aber jeweils auch die Beschleuniger für die nächste Krise.
„Aber trotz aller periodischen Unterbrechungen und Abschwächungen der Zusammenbruchstendenz geht der Gesamtmechanismus mit dem Fortschreiten der Kapitalakkumulation immer mehr seinem Ende entgegen, weil mit dem absoluten Wachstum der Kapitalakkumulation die Verwertung dieses gewachsenen Kapitals progressiv schwieriger wird. Werden einmal diese Gegentendenzen selbst abgeschwächt oder zum Stillstand gebracht (…), dann gewinnt die Zusammenbruchstendenz die Oberhand und setzt sich in ihrer absoluten Geltung als die ‚letzte Krise‘ durch.“ (Grossmann, S.140)
Der zyklischen Abfolge von beschleunigter Akkumulation, Krise, Entwertung, Einsetzen von Gegentendenzen sind also Grenzen gesetzt, sie kann nicht unendlich fortgehen. An bestimmten Punkten setzt eine Krise ein, die die Frage der Fortexistenz des Kapitalismus als ganzes auf die Tagesordnung setzt.
2.6. Die langfristigen Tendenzen der Kapitalakkumulation und der Imperialismus
Mit der Aufnahme von „Zunahme des Aktienkapitals“ und „Der auswärtige Handel“ unter die entgegenwirkenden Ursachen des Profitratenfalls, hat Marx bereits wesentliche Elemente der Imperialismustheorie vorweg genommen. Das Auftreten von Aktienkapital ermöglicht „ungeheure Ausdehnung der Stufenleiter der Produktion und Unternehmungen, die für Einzelkapitale unmöglich waren. Solche Unternehmungen zugleich, die früher Regierungsunternehmungen waren, werden gesellschaftliche.“ (MEW 25, S. 452) Da in Aktiengesellschaften, die unmittelbaren Kapitaleigner mit Gewinnbeteiligungen nahe der Zinsrate zufrieden sind (Dividende), geht hierdurch ein nach oben zeigender Effekt auf die Ausgleichung der Profitrate aus, „indem diese Unternehmungen, wo das konstante Kapital in so ungeheurem Verhältnis zum variablen steht, nicht notwendig in die Ausgleichung der allgemeinen Profitrate eingehen.“ (MEW 25, S. 453)
Wie Hilferding später gezeigt hat, ist diese „Bescheidenheit“, die Beschränkung auf die Dividende gegenüber dem Profit, eine nur scheinbare, kurzfristige. Die Differenz wird sehr wohl von den großen, die Kapitalaufbringung vermittelnden Finanzkapitalen in Form des „Emmissionsgewinns“ wieder eingebracht. Diese Extraprofite bildeten und bilden eine wichtige Quelle der schnellen Bereicherung des Finanzkapitals (siehe Kapitel „Finanz- und Monopolkapital“). Tatsächlich stellt sich diese Gegentendenz damit vor allem als Mittel zur Beschleunigung von Kapitalkonzentration, Monopolbildung und immer stärkerer Kontrolle der gesellschaftlichen Produktion durch eine kleine Anzahl an Großkapitalien heraus. Die Modifikation der Ausgleichung der allgemeinen Profitrate wird damit zum System: die monopolisierten Bereiche gehorchen anderen Gesetzmäßigkeiten von Kapitalzu- und Abfluss, von Barrieren für Einstiegsinvestitionen, Preiskonkurrenz und Verhandlungsposition gegenüber der Arbeiterklasse. Die Monopolprofitrate trennt sich daher von der allgemeinen Profitrate. Gleichermaßen modifizieren sich tendenzieller Fall der Profitrate und Krisentendenz.
Monopole können einen wesentlich stetigeren Akkumulationsprozess organisieren, ohne sich aber von den gesetzmäßigen Grundtendenzen abkoppeln zu können. Diese Verstetigung ist auch erkauft durch die Verschärfung der Krisentendenzen in den nicht-monopolistischen Bereichen. Dies trifft insbesondere auf Länder zu, in denen die Herausbildung von Monopol- und Finanzkapital hinter den kapitalistischen Großmächten zurück geblieben ist. Diese werden zu einer zentralen Quelle monopolistischer Extraprofite, die den Nachteilen einer hohen Kapitalzusammensetzung in der Profitratenausgleichung der Metropolen entgegenwirken können. Dazu kommt, dass hier das überakkumulierte Kapital durch Kapitalexport ein profitables Ventil findet.
Die Grundtendenzen der kapitalistischen Akkumulation, ihre Krisenhaftigkeit und die daraus entspringenden Versuche ihrer monopolistischen Abmilderung, führen daher zwangsläufig zum Imperialismus: i.e. der konfliktbeladenen Aufteilung der Welt unter monopolistische Kapitalverbände, deren politisches Geschäft durch entsprechende Großmachtpolitik erledigt wird. „Der Imperialismus ist der Kapitalismus auf jener Entwicklungsstufe, wo die Herrschaft der Monopole und des Finanzkapitals sich herausgebildet, der Kapitalexport hervorragende Bedeutung gewonnen, die Aufteilung der Welt durch die internationalen Trusts begonnen hat und die Aufteilung des gesamten Territoriums der Erde durch die großen kapitalistischen Länder abgeschlossen ist.“ (LW 22, S. 271).
Dieses Stadium umfasst sowohl einen bereits erreichten hohen Vergesellschaftungsstand insbesondere in der monopolistischen Produktion. Andererseits erhöht das Ausmaß des zu verwertenden Kapitals die Krisentendenzen, wie sehr auch das Monopolkapital zur „Entschleunigung“ der Akkumulation, zur Beschränkung der Produktivkraftsteigerung (Kapitalintensivierung) und zum „Parasitismus“ drängt. Daher ist die allgemeine Tendenz der imperialistischen Epoche eine der Stagnation, unterbrochen von heftigen Akkumulationsphasen mit ebenso scharfen Krisenzyklen.
2.7. Die Modifikation der Durchschnittsprofitrate in der Zirkulation des Kapitals
Es bleibt nicht dabei, dass die Profitrate des industriellen Kapitals durch die Konkurrenz um die Produktionspreise zur Durchschnittsprofitrate drängt. Die beständige Kapitalakkumulation erfordert die Realisierung der produzierten Waren, und damit eine effiziente, kapitalistische Organisation der Zirkulationssphäre. Das industrielle Kapital, das sich in der entwickelten kapitalistischen Arbeitsteilung zumeist nicht mehr mit dem Verkauf seiner Waren an die „Endkunden“ befasst, delegiert diese Aufgabe an das kommerzielle Kapital. Dieses kann auch die Zirkulationsarbeit – auch wenn diese selbst keinen Wert schafft – als kommerzielle Lohnarbeit organisieren. Je höher der Ausbeutungsgrad dieser Lohnarbeit, desto größer der Teil des industriellen Profits, der vom kommerziellen Kapitalisten angeeignet werden kann – nur der Rest des industriellen Profits verbleibt für den Lohn der Handelsangestellten.
Insofern können nunmehr die Zirkulationskosten des Kapitals in den Ausgleichsprozess der Profitratenbildung eingehen, während sich der Verkaufspreis nun aus Produktionspreis (mit vermindertem Durchschnittsprofit) und „Handelskosten“ ergibt.
Als besondere Kosten im Zirkulationsprozess erscheinen ab einem bestimmten Entwicklungsstand des Kapitalismus zusätzlich diejenigen des „Geldhandlungskapitals“. Die Operationen wie Einkassieren, Auszahlen, Verwalten von Reservefonds, Wechselgeschäft, Saldieren kurzfristiger Zahlungsverpflichtungen, Skonto, Ratenzahlungen etc. gehören notwendig zu einer effizienten Organisation des kapitalistischen Zirkulationsprozesses. Auch ihre Aktivitäten können daher von eigenen Kapitalen organisiert werden, die später zu Ausgangspunkten des Bankenkapitals wurden. Dabei gehen die reinen Geldhandlungs-Aktivitäten noch in den Ausgleich zur Durchschnittsprofitrate und bestimmen ähnlich wie das kommerzielle Kapital wesentlich die Erscheinungsform der Preise im Gesamtzirkulationsprozess des Kapitals. Auch wenn hier Preise oder Zahlungen bereits mit zinsähnlichen Zusätzen versehen werden, ist hier der „Zins“ noch in einer der bloßen Warenzirkulation zugehörigen Weise zu verstehen. Seine eigenständige Form erhält der Zins erst im zinstragenden Kapital, das die Hauptfunktion des Bank- und Finanzkapital darstellt.
3. Finanzkapital
3.1. Zinstragendes Kapital
Die der Bildung einer Durchschnittsprofitrate nähert sich Geld, als rein quantitativ bestimmte Wertsumme (Verkörperung eines Quantums abstrakter Arbeit), seiner idealen, verselbständigten Form. Eine Geldsumme kann in einen konkreten Verwertungsprozess geworfen werden, um am Ende doch den selben durchschnittlichen Profit im Verhältnis zur Ausgangssumme abzuwerfen. Geld erhält die zusätzliche Funktion, als Kapital zu fungieren – und kann in dieser Funktion selbst zur Ware werden! D.h. der Eigentümer der Geldsumme kann diese einem anderen Kapitalisten „verkaufen“, der damit in produktives Kapital investiert und die ursprüngliche Geldsumme mit Profit verwertet. Der ursprüngliche Eigner kann dann sowohl die Ausgangssumme zurück erhalten, als auch einen Anteil am Profit: den Zins.
In dieser Bewegung des Geldes als zinstragendes Kapital (G-G‘) sind sämtliche Voraussetzung aufgehoben und verschleiert – tatsächlich setzt es den Gesamtprozess der kapitalistischen Produktion voraus: die Genese von Waren- und Geldform; die Verwandlung aller Produktionsbedingungen in Warenkapital, welches durch Lohnarbeit verwertet wird; die Verwandlung von Geld in Geldkapital; die Einheit von Produktions- und Zirkulationsprozess als Akkumulationsprozess des Kapitals; die Herausbildung einer gesellschaftlichen Durchschnittsprofitrate. Umgekehrt erscheint es nun so, als sei es eine Eigenschaft von „Geld als Kapital“, dass es an sich den Zins hervorbringe. Kapital als Ware erscheint als „Gegenstand“, der den Gebrauchswert hat, Wert zu verwerten, Mehrwert abzuwerfen. Entsprechend erscheint der Zins als Ausdruck des Tauschwerts dieser speziellen Ware. Damit ist die Fetischform des Kapitals vollendet.
Während Geld- und Warenkapital im Zirkulationsprozess des Kapitals selbst nur Kapital sind, indem sich Ware in Geld und umgekehrt verwandelt, besteht Kapital im Gesamtprozess für sich nur im Produktionsprozess, im Ausbeutungsprozess der Arbeitskraft. Anders beim zinstragenden Kapital: „Der Geldbesitzer, der sein Geld als zinstragendes Kapital verwerten will, veräußert es an einen dritten, wirft es in die Zirkulation, macht es zur Ware als Kapital; nicht nur als Kapital für ihn selbst, sondern auch für andere; es ist nicht bloß Kapital für den, der es veräußert, sondern es wird dem anderen von vornherein als Kapital ausgehändigt, als Wert, der den Gebrauchswert besitzt, Mehrwert, Profit zu schaffen; als ein Wert, der sich in der Bewegung forterhält und zu seinem ursprünglichen Ausgeber, hier dem Geldbesitzer, nachdem er fungiert hat, zurückkehrt; also nur für eine Zeitlang von ihm entfernt, aus dem Besitz seines Eigentümers nur zeitweilig in den Besitz des fungierenden Kapitalisten tritt, also weder weggezahlt noch verkauft, sondern nur ausgeliehen wird; nur entäußert wird, unter der Bedingung, nach einer bestimmten Zeitfrist erstens zu seinem Ausgangspunkt zurück zu kehren, zweitens aber als realisiertes Kapital zurück zu kehren, so dass es seinen Gebrauchswert, Mehrwert zu produzieren, realisiert hat.“ (MEW 25, S. 355f)
Damit ergibt sich abgeleitet vom Prozess der Kapitalzirkulation G-W-G‘ die Bewegungsform des zinstragenden Kapitals, des als Kapitalware fungierenden Geldes:
G – G – W – G‘ -G‘
G-G: Der Prozess beginnt nicht mit dem Kauf oder Verkauf von Ware. Die Verausgabung von „Geld als Kapital“ in G-G ist gar kein Element der Warenmetamorphose oder der Reproduktion von Kapital; er ist einfach eine zeitweilige Eigentumsübertragung an einer bestimmten Geldsumme, das Verleihen von Geld als Kapital. Es findet eine fiktive Dopplung statt: das Geld besteht nun einerseits in der Schuldverschreibung des ursprünglichen Eigners, mit Anspruch auf termingerechte Zahlung; andererseits ist es als „reales Geld“ unter Verfügung des fungierenden Kapitalisten.
G-W-G‘: Als Geldkapital kann es nun verwertet werden, um mindestens den Durchschnittsprofit abzuwerfen (G‘).
G‘-G‘: der doppelten Verausgabung des Geldes als Kapital entspricht der doppelte Rückfluss. Außer der ursprünglich übertragenden Kapitalsumme hat der fungierende Kapitalist dem Kapitaleigner einen Teil des Profits – den Zins – zu überlassen, „da dieser ihm das Geld nur gegeben hat als Kapital, d.h. als Wert, der sich nicht nur erhält, sondern seinem Eigner Mehrwert schafft.“ (ebd., S. 353)
Hier haben wir also einerseits eine Dopplung der Kapitalisten: einerseits als Eigner von Geld als Kapital, andererseits als fungierende, investierende Kapitalisten (ob sie nun in produktives oder kommerzielles Kapital investieren). Vom Standpunkt des Gesamtkapitals ist es dabei die selbe Profitmasse, die zu verteilen ist: der Zins kann nur als Teil des Gesamtprofits angeeignet werden, als „Preis“ für das Überlassen von Geld als Kapital an die fungierenden Kapitalisten.
Dabei verwickelt sich in Widersprüche, wer die einfachen Wertform-Bestimmungen auf die Ware Kapital anwendet: „Will man den Zins den Preis des Geldkapitals nennen, so ist dies eine irrationale Form des Preises, durchaus im Widerspruch mit dem Begriff des Preises der Ware (…) Hier hat eine Ware einen doppelten Wert (…) Das Geldkapital ist zunächst nichts als (…) der Wert einer bestimmten Warenmasse als Geldsumme fixiert (…) Wie soll nun eine Wertsumme einen Preis haben außer ihren eigenen Preis, der in ihrer eigenen Geldform ausgedrückt ist?“ (ebd., S. 367)
Die Analogie von Verkauf und Kauf im Verhältnis von Gläubiger und Schuldner von Geldkapital trägt also nicht weit, was das Verständnis des Zinses betrifft.
Der Zins als Bestandteil des Profits ist ein Maß für die Verwertung des Kapitals – und als solches erscheint er wie ein Preis, da ja das Kapital zur Verwertung auf dem Markt angeboten wurde. In seiner Erscheinungsform als Preis verschleiert der Zins seine eigentliche Ableitung aus dem Profit. Dies um so mehr, als erst im Gesamtprozess durch entsprechende Ausgleichungsprozesse sich die Gesamtzinszahlungen aus der Verwertung des gesellschaftlichen Produktivkapitals ergeben. Im einzelnen ist dem Geldverleiher egal, woher der Schuldner seine Zinszahlungen leistet, d.h. über wie viele Vermittlungsschritte sie aus dem Gesamtprofit gespeist sind (z.B. Staatskredite, die durch Steuern finanziert werden). Für ihn reduziert sich die Gesamtbewegung auf die abstrakt-inhaltslose Form G-G‘. Er selbst tritt auf als Anbieter von Geldkapital auf einem Markt. Der Zins erscheint ihm als Preis seiner Ware, ganz gemäß dem Verhältnis von Angebot und Nachfrage auf dem Geldmarkt.
Entsprechend wird in der bürgerlichen Ökonomie, insbesondere in der „Neoklassik“ (z.B. bei Marshall), das zinstragende Kapital als das Kapital im eigentlichen Sinn und der Zins als Preis für „Konsumverzicht auf Zeit“ aufgefasst. Damit wird nicht nur der Unterschied zwischen Waren- und Geldmärkten verwischt. Es wird auch verschleiert, dass zinstragendes Kapital eine eigene, abgeleitete Kapitalsorte ist, die nur auf Grundlage des produktiven Kapitals verstanden werden kann. Diesen macht auch Keynes, der den Zins aus der Relation zwischen der Präferenz auf Liquidität (Besitz von Zahlungsmitteln) gegenüber den Verwertungsraten des „Realvermögens“ ableitet. Auch wenn hier eine Abhängigkeit des Zinses vom produktiven Kapital besteht, wird doch jedem Kapital eine Art innewohnender Eigenzinssatz unterstellt. Dagegen ist bei Marx der Zins ein Spezifikum einer bestimmten Kapitalsorte, der Verwertung des bloßen Eigentumstitels auf Kapital im Gegensatz zum Verwertungsprozess des fungierenden Kapital, der die Basis der abgeleiteten Verwertung ist.
Trotzdem wird schon hier deutlich, warum Marx und Keynes die zentrale Rolle des Zinssatzes für die Begründung des „Sayschen Gesetzes“ durch die Neoklassik ablehnen. Während in der Neoklassik der Geldmarkt ein Warenmarkt wie jeder andere ist, und daher ein Abfließen von Geld aus den sonstigen Märkten in den Geldmarkt über das Sinken des Zinses (Überangebot) den Gleichgewichtszustand wieder herstellt, kann sich diese Rückflusstendenz bei Marx wie bei Keynes durch die noch ungünstigere Entwicklung der Profitrate ins Gegenteil verkehren. Gerade am Ende eines Konjunkturzyklus verbinden sich Überschusskapital, steigende Kreditnachfrage und sinkende Profitraten sowohl zu steigenden Zinsen als auch zu einem dadurch bedingten beschleunigten Fall der Unternehmensgewinne. D.h. die Zinsentwicklung wirkt sogar als Katalysator des Abschwungs – ganz im Gegensatz zu (neo)liberalen Dogmen.
Marx bemerkte in den „Theorien über den Mehrwert“, dass es hier in der bürgerlichen Ökonomik eine bezeichnende Veränderung gab: Adam Smith hatte noch den Profit als den „Ertrag“ des Kapitals bezeichnet; dagegen war es in der „Vulgärökonomie“ üblich geworden, die Formel „Boden – Rente, Kapital – Zins, Arbeit – Lohn“ zu verwenden. Die Klassik spricht also das Kapitalverhältnis mit dem Profit noch an: „Im Profit ist noch die störende Beziehung auf den Prozess enthalten und die wahre Natur des Mehrwerts und der kapitalistischen Produktion im Unterschied von ihrer Erscheinung, noch mehr oder minder erkennbar. Dies hört auf, wenn der Zins als das eigentliche Produkt des Kapitals dargestellt und damit der andere Teil des Mehrwerts, der industrielle Profit, ganz verschwindet und unter die Kategorie des Arbeitslohns fällt.“ (MEW 26.3, S. 490) So erscheint es auch den fungierenden Kapitalisten, die erklären, den „Kapitalwert“ (d.h. den Zins) erwirtschaften zu müssen, während der Unternehmergewinn bzw. die Managergehälter als eine Art Lohnkosten erscheint.
In G-G‘ erfährt das kapitalistische Aneignungsgesetz – Eigentum an und Reproduktion von vergegenständlichter fremder Arbeit als Grundlage für die Aneignung von mehr fremder Arbeit auf immer erweiterter Stufenleiter – seine letzte und äußerlichste Darstellungsform. Der bloße Eigentumstitel auf Wert wird Kapital, d.h. Mittel zur Aneignung fremder Mehrarbeit, ohne dass es für den Kapitaleigentümer notwendig wäre, den mühsamen Prozess industrieller oder kommerzieller Profiterwirtschaftung zu durchlaufen. Dies aber, ohne dass diese abgeleitete Form der Mehrwertaneignung damit unabhängig würde von der Grundlage, der Reproduktion des Kapitals durch lebendige, produktive Arbeit (siehe Krüger, S. 581).
3.2. Die Aufteilung des Profits und die „natürliche Zinsrate“
Das Verschwinden der Vermittlung, der nur indirekte Bezug auf seine Quelle – den Profit – hat auch Konsequenzen für die Bestimmtheit des Zinses selbst. In der Aneignung von Mehrwert durch Veräußerung eines Titels auf Kapital liegt natürlich kein Gramm eigene Arbeit, trotzdem erscheint es als eine Art von „Verkaufen“ einer Ware. Es ist hier aber ein Verkaufen und Kaufen im Spiel, das in der Substanz nichts mit einem dabei gehandelten Wert zu tun hat (nur mit dem Eigentumstitel auf einen Wert), jedoch formal den Gesetzen des Marktes, der Konkurrenz und der Preisbildung gehorcht. Während daher bei der Bildung des Marktpreises einer realen Ware Angebot und Nachfrage ein Schwanken des Preises um den Wert bedeutet, um bei Gleichstand genau den Wert zu ergeben, wird der Zins durch nichts anderes als Angebot und Nachfrage bestimmt: „Die Konkurrenz bestimmt hier nicht die Abweichungen vom Gesetz, sondern es existiert kein Gesetz der Teilung außer dem von der Konkurrenz diktierten.“ (MEW 25, S. 369)
Damit wird der Zinssatz zum Ausdruck des Kräfteverhältnisses zwischen fungierenden und finanzierenden Kapitalen, wobei dieses Verhältnis durch die Bildung und Bewegungsgesetze der allgemeinen Durchschnittsprofitrate bestimmt ist. Es gibt daher kein selbstständiges Gesetz von der Bewegung der Zinsrate. Die Grenze nach oben wird bestimmt durch die Durchschnittsprofitrate. Je näher die Zinsrate sich der allgemeinen Profitrate annähert, desto weniger Spielraum hat das fungierende Kapital für die Ausweitung der Akkumulation und die Nachfrage nach zinstragendem Kapital sinkt. Umgekehrt wird bei einem Sinken der Zinsrate gegen 0 (oder gar darüber hinaus), der Anreiz für Beschleunigung der Akkumulation gesteigert, mitsamt der Nachfrage nach zinstragenden Kapital. Zwischen diesen Extremen gibt es Spielraum für tag-tägliche Schwankungen und Zufälligkeiten. „Wo hier die Konkurrenz als solche entscheidet, ist die Bestimmung an und für sich zufällig, rein empirisch, und nur Pedanterie oder Phantasterei kann diese Zufälligkeit als etwas Notwendiges entwickeln wollen.“ (MEW 25, S. 375) Von daher ist so etwas wie eine „natürliche Zinsrate“ auf ein Kapital für Marx theoretischer Unsinn.
Ebenso wesentlich ist, dass sich die Zinsrate auf den Durchschnittsprofit bezieht – und nicht auf besondere, zeitweise mögliche Profitraten (bzw. Extraprofite) bestimmter Einzelkapitale. Denn gerade die Verwertbarkeit eines bloßen Eigentumstitels auf Kapital, als Veräußerung des Gebrauchswerts von Kapital zur Selbstverwertung, ist gänzlich gleichgültig gegen die spezifische Anwendungsform des Kapitals:
„Auf dem Geldmarkt stehen sich nur Verleiher und Borger von Kapital gegenüber. Die Ware hat dieselbe Form, Geld. Alle besonderen Gestalten des Kapitals (…) sind hier ausgelöscht. (…) Die Konkurrenz der besonderen Sphären hört hier auf; sie sind alle zusammengeworfen als Geldborger, und das Kapital steht allen auch gegenüber in der Form worin es gleichgültig gegen die bestimmte Art seiner Anwendung ist. Als was das industrielle Kapital nur in der Bewegung und Konkurrenz zwischen besonderen Sphären erscheint, als an sich gemeinsames Kapital der Klasse, tritt es hier wirklich, der Wucht nach, in der Nachfrage und Angebot von Kapital auf. Andererseits besitzt das Geldkapital auf dem Geldmarkt wirklich die Gestalt, worin es als gemeinsames Element, gleichgültig gegen seine besondere Anwendung, sich unter die verschiedenen Sphären, unter die Kapitalistenklasse verteilt, je nach den Produktionsbedürfnissen jeder besonderen Sphäre. Es kommt hinzu, dass mit Entwicklung der großen Industrie das Geldkapital mehr und mehr (…) nicht von einzelnen Kapitalisten vertreten wird, (…) sondern als konzentrierte, organisierte Masse auftritt, die ganz anders als die reelle Produktion unter der Kontrolle der das gesellschaftliche Kapital vertretenden Bankiers gestellt ist.“ (MEW 25, S. 380f)
Während das Gesamtkapital also im Prozess der realen Kapitalzirkulation nur im Gesamtprozess auftritt, tritt mit dem zinstragenden Kapital eben nicht „das Gesamtkapital“, sondern nur eine besondere Kapitalform auf – dafür aber nun umgekehrt, in einer konzentrierten, gesellschaftlichen Form!
Während sich die Durchschnittsprofitrate an der gesellschaftlichen Oberfläche hinter der Vielfalt der Bedingungen der einzelnen Anlagesphären verbirgt, sich über die Konkurrenz und Ausgleichsbewegungen nur zyklisch und hinter dem Rücken der Produzenten durchsetzt, spiegelt sich diese Gesellschaftlichkeit des Kapitals somit in der Bestimmung der Zinsrate durch diese Bewegung unmittelbar, in harten Zahlen ausgedrückt, auf der Preisebene des Geldmarktes wider. „Die Durchschnittsprofitrate erscheint nicht als unmittelbar gegebene Tatsache, sondern als erst durch die Untersuchung festzustellendes Endresultat der Ausgleichung entgegengesetzter Schwankungen. Anders mit dem Zinsfuß. Er ist in seiner, wenigstens lokalen, Allgemeingültigkeit ein täglich fixiertes Faktum, ein Faktum, das dem industriellen und merkantilen Kapital sogar als Voraussetzung und Posten in der Kalkulation bei seinen Operationen dient.“ (ebd., S. 380).
Somit wird das Verhältnis endgültig umgedreht, und die Zinsrate erscheint als die Vertreterin der Durchschnittsprofitrate an der Oberfläche. Gerade da sich die Durchschnittsprofitrate langsamer ändert als die quartalsweisen Profitschwankungen besonderer Anlagesphären, erscheint auch der Zinsfuß als beständigere Größe, d.h. in verkehrter Weise als die Konstante, um welche die Profitraten schwanken. „Die allgemeine Profitrate erscheint daher in der Tat als empirisches, gegebenes Faktum wieder in der Durchschnittszinsrate, obgleich die letztere kein reiner und zuverlässiger Ausdruck der ersteren.“ (ebd., S. 377f)
3.3. Die Mannigfaltigkeit von Zinsarten
Die scheinbare Konkretheit der Zinsrate als vermittelter Aneignungstitel auf Mehrwert relativiert sich wieder in den Differenzierungen von Zinsarten und den ihnen entsprechenden Geldkapitalarten.
Am unteren Ende stehen die Operationen von Geldhandlungskapital und kommerziellem Kredit. Damit zusammenhängend werden kurzfristige Kredite vergeben mit einfacher Verzinsungsart und engen Grenzen, was Sicherheiten als auch Kreditrahmen betrifft. Diese Kreditart ist noch stark verbunden mit dem unmittelbaren Reproduktions- und Zirkulationsprozess, und somit nimmt auch der Zins die Form einer konstanten Verzinsung auf die verliehene Geldsumme an. D.h. im Gegensatz zum Zinseszins (der bei dieser Kreditart als „Wucher“ gilt) wird bei Kontokorrent oder ähnlichen Kreditarten der in Periode x zu zahlende Zins in der nächsten Verzinsungsperiode nicht in das zu verzinsende Gesamtkapital einbezogen.
Ist n die Anzahl der Tage bis zur Schuldtilgung, z die Verzinsungsperiode (z.B. 360 Tage) und i die Zinsrate, so ergibt sich aus einer Anfangsschuld K eine Endschuld Kn:
Kn = K ( 1+i n/z )
Diese lineare Verzinsung wird zumeist auch für kurzfristige (unter-jährige) Geldanlage verwendet. Hier ist die Differenz von Leih- und Verleihzinsen der Banken zumeist sehr groß, d.h. für kurzfristige Anlagen tendiert die Verzinsung gegen Null.
Für längerfristige, mehrjährige Geldanlage wird der Zusammenhang mit einer selbständigen Form der Aneignung eines Profitteils auch in der Akkumulationsform deutlicher. D.h. das in G-G‘ zurückkehrende Geldkapital wird auch als solches aufgefasst, also auch als ganzes dem nächsten Zyklus überantwortet, d.h. es wird mit Zinseszins verwertet und der Anleger erwartet eine deutlich höhere Zinsrate als für kurzfristige Anlage. Sei n die Anzahl von Jahren einer Anlage eines Ursprungskapitals K zur Zinsrate i, so erwartet der Anleger als Endwert:
Kn = K ( 1 + i )n
Der Anleger mag dabei nicht bis zum Endtermin auf die Rückzahlung des Schuldners warten. Ähnlich der Verwertung von fixem Kapital ist es auch möglich, dass Kreditgewährung zur Quelle einer konstanten Revenue wird, in der Form der Rentenzahlung. Hier berechnet sich z.B. eine jährliche Rente für eine Kapitalanlage K mit Laufzeit von n Jahren durch die Erfüllung folgender Gleichung (es sei q = 1+i):
Rn = K qn = R (qn – 1) / (q – 1)
Die Höhe von Rentenzahlungen hängt also von der Laufzeit und der zu Beginn vereinbarten Zinsrate ab, mit Rn ergibt sich der endgültige Rentenwert. Umgekehrt ist bei einem Annuitätenkredit der Endwert vorgegeben – aber die Tilgungsrate R ergibt sich dann genauso aus Laufzeit und Zinsrate.
In der Zinseszins- bzw. der Rentenformel kommt die ganze Mystifikation des zinstragenden Kapitals zum Ausdruck. Das Kapital wird „ohne Rücksicht auf die Bedingungen der Reproduktion und der Arbeit, als selbständiger Automat betrachtet, als eine bloße, sich selbst vermehrende Zahl“ (MEW 25, S. 409), deren Wachstum grenzenlos, weil exponential zu sein scheint. Nichts drückt besser den Drang des Kapitals zu schrankenlosem Wachstum aus. Gleichzeitig muss gerade diese Schrankenlosigkeit durch die tatsächliche Beschränktheit in den Bedingungen der Reproduktion die Widersprüchlichkeit zum Eklat bringen. Denn abstrahiert wird davon, dass das real zu reproduzierende Kapital periodisch notwendige Entwertungen durchmacht (nicht nur in der Krise, sondern auch aufgrund der Produktivitätsfortschritte) und dass mit der Profitrate auch notwendigerweise die Zinsrate sinken muss. „Durch die Identität des Mehrwerts mit der Mehrarbeit ist eine qualitative Grenze für die Akkumulation des Kapitals schon gesetzt: der Gesamtarbeitstag, die jedesmal vorhandene Entwicklung der Produktivkräfte und der Bevölkerung, welche die Anzahl der gleichzeitig exploitierbaren Arbeitstage begrenzt. Wird dagegen der Mehrwert in der begrifflosen Form des Zinses gefasst, so ist die Grenze nur quantitativ und spottet jeder Phantasie (…) Das Produkt vergangener Arbeit, die vergangene Arbeit selbst, ist hier an und für sich geschwängert mit einem Stück gegenwärtiger oder zukünftiger lebendiger Mehrarbeit. Man weiß dagegen, dass in der Tat die Erhaltung, und insoweit auch die Reproduktion des Werts der Produkte vergangener Arbeit nur das Resultat ihres Kontakts mit der lebendigen Arbeit ist.“ (ebd., S. 412).
Die Geschichte vom Groschen, der zu Christi Geburt zu 5% angelegt wurde, und nun allen Reichtum der Welt umfassen würde, vernachlässigen daher die beschränkte produktive Grundlage der Finanzakkumulation. Trotzdem wird dasselbe Märchen z.B. bei der Anpreisung „privater Rentenvorsorge“ über Kapitalanlage wieder verkauft.
Während der Markt für kurzfristiges Geldkapital („Geldmarkt“) bestimmt wird durch den Umschlag des zirkulierenden Kapitals (kurzfristige Zahlungsverpflichtungen), wird der eigentliche Kapitalmarkt vor allem durch die Umschlagzeiten des fixen Kapitals bestimmt. Es sind also die verschiedenen Reproduktionstermine von reproduktiv fungierendem Kapital, die sich in Gestalt rein quantitativer Unterschiede (Zeitfristen) auf dem Geldkapitalmarkt reproduzieren. Beide Teilmärkte besitzen ihre spezifischen Zinssätze, die sich wiederum fächerartig aufreihen. Entscheidend ist jedoch, dass sich eine Hierarchie der Zinssätze herausbildet. Von zyklischen Bewegungen abgesehen, bestimmt der Kapitalmarktzins den Geldmarktzins. Insofern macht es Sinn, die Untersuchung auf die „Durchschnittszinsrate“ zu konzentrieren, die Marx so bestimmt: „Um die Durchschnittszinsrate zu finden, ist 1. der Durchschnitt des Zinsfußes während seiner Variation in den großen industriellen Zyklen zu berechnen; 2. der Zinsfuß in solchen Anlagen, wo Kapital für längere Zeit ausgeliehen wird.“ (MEW 25, S. 374)
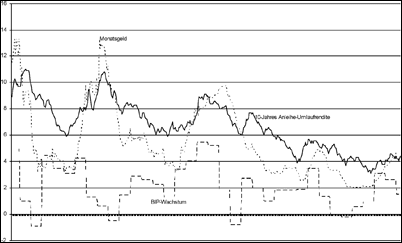
Abbildung 3: Vergleich langfristiger und kurzfristiger Zinsen mit dem Konjunkturverlauf – Deutschland 1973-2008
Abbildung 3 zeigt die unterschiedliche Bewegungsform eines Beispiels von langfristigen Zinsen (Umlaufrendite von Anleihen mit 10-Jahres-Restlaufzeit) und eines Beispiels von kurzfristigen Zinsen (Monatsgeld) in Beziehung zu den Wachstumsraten des BIP (12). Der gesetzmäßige Zusammenhang der Zinsbewegungen mit dem Konjunkturverlauf wird am Ende dieses Kapitels behandelt.
3.4. „Kapitalwert“ und Unternehmergewinn
Auch wenn der Zins also tatsächlich ein über den Eigentumstitel abgeleiteter Anspruch auf einen Teil des Profits ist, und der Unternehmergewinn damit der Rest des Profits, so erscheint letzterer in entwickelten kapitalistischen Verhältnissen umgekehrt als eigenständige Größe. Während die Zinserträge als „normaler“ Ertrag von angelegtem Kapital gelten, wird der darüber hinaus gehende Ertrag zu einer speziellen Leistung des unternehmerischen Kapitalisten. Seine Fähigkeiten zur Ausnutzung von Marktchancen, günstigen Profitbedingungen, besonderen Ausbeutungsmöglichkeiten etc. werden als Grundlage für eine besondere „Belohnung“. Die bloß quantitative Teilung des Profits wird so befestigt in eine qualitative, die von Zins und Unternehmergewinn.
Dabei berechnet der individuelle Kapitalist selbst dann den Zinsertrag, wenn er gar kein fremdes Kapital aufgenommen hat. Die befestigte Form der Teilung wird hier zur normalen Übung: der über den Zinsertrag hinaus gehende Gewinn, wird für den Kapitalisten zur eigentlichen Motivation einer Investition. Ansonsten, so das Kalkül, könnte ja das Kapital gleich mit normalem Zinssatz angelegt werden, statt sich der Mühe der Produktionsausführung zu unterziehen. So wird in der gängigen betriebswirtschaftlichen Investitionsrechnung, der Kapitalwert K einer Investition I, die über n Jahre den Ertrag Y liefert, berechnet auf der Grundlage einer Verzinsung von q (=1+i) nach:
K = Y (qn – 1)/(q-1) – Iqn
D.h. eine Investition wird mit dem Ertrag einer Rentenanlage zum Standardzinssatz verglichen. Nur bei einem positiven „Kapitalwert“, also höherem Ertrag als der Kapitalverrentung wird die Investition als „sinnvoll“ bewertet.
Was für den einzelnen Kapitalisten als Abwägungsgrund sinnvoll sein mag, ist natürlich als Gesamterklärung unsinnig: „Würde ein ungebührlich großer Teil der Kapitalisten sein Kapital in Geldkapital verwandeln, so wäre die Folge ungeheure Entwertung des Geldkapitals und ungeheurer Fall des Zinsfußes; viele würden sofort in die Unmöglichkeit versetzt, von ihren Zinsen zu leben, also gezwungen, sich in industrielle Kapitalisten zurück zu verwandeln. (…) Es steckt der noch größere Unsinn darin, dass auf Basis der kapitalistischen Produktionsweise das Kapital Zins abwerfen würde, ohne als produktives Kapital zu fungieren (…) dass die kapitalistische Produktionsweise ihren Gang gehen würde, ohne kapitalistische Produktion.“ (MEW 25, S. 391)
Nachdem sich nun die Teilung des Profits in den „Standard-Zins“ und die Leistung des Unternehmers qualitativ befestigt hat, verschiebt sich der Gegensatz Kapital/Lohnarbeit ideologisch zum Gegensatz von Kapitaleigentum und produktiv Tätigen. Dabei erscheint der Unternehmer nun in diesem Gegensatz selbst „Arbeitender“, gar „Ausgebeuteter“ zu sein. „Die Exploitation der produktiven Arbeit kostet Anstrengung, ob er sie selbst verrichte oder in seinem Namen von anderen verrichten lasse. Im Gegensatz zum Zins stellt sich ihm also sein Unternehmergewinn als unabhängig vom Kapitaleigentum, vielmehr als Resultat seiner Funktion als Nichteigentümer, als – Arbeiter.“ (MEW 25, S. 393)
Von daher entstehen die ideologischen Verzerrungen der „produktiven“, „schaffenden“ Industriekapitalisten, im Gegensatz zu den „unproduktiven“, „raffenden“ Finanzkapitalisten, wie sie nicht nur in faschistoiden „Kapitalismuskritiken“ verwendet werden.
Tatsächlich zeigt die Analyse klar, dass es sich nur um zwei unterschiedliche Charaktermasken für dasselbe Ausbeutungsverhältnis handelt. Da sich die Funktion des Finanzkapitals klar aus den Bedürfnissen der Reproduktion des Gesamtkapitals ergibt, stellt sich in der kapitalistischen Produktionsweise nicht die Frage, ob einer dieser Kapitaltypen nun moralisch besser oder schlechter sei: „Die Gerechtigkeit einer Transaktion, die zwischen Produktionsagenten vorgehen, beruht darauf, dass diese Transaktionen aus den Produktionsverhältnissen als natürliche Konsequenz entspringen. Die juristischen Formen, worin diese ökonomischen Transaktionen als Willenshandlungen der Beteiligten, als Äußerung ihres gemeinsamen Willens und als der Einzelpartei gegenüber von Staats wegen erzwingbare Kontrakte erscheinen, können als bloße Formen diesen Inhalt selbst nicht bestimmen.“ (ebd., S. 352)
Der Unternehmensgewinn muss daher nun zwangsläufig selbst wieder in verschiedene Formen zerfallen. Einerseits wird die Tätigkeit der unmittelbaren Leitung des produktiven Kapitals immer mehr zur Form von Lohnarbeit selbst, d.h. nimmt die Form von „Verwaltungsgehältern“, „Managergehältern“ an. Andererseits werden auch die Funktionen von Aufsichtsgremien der Eigentümer alimentiert (z.B. Aufsichtsrats-Tantiemen). Auch wenn ein Teil der Managertätigkeit aufgrund der Koordinationsfunktion tatsächlich auch produktive Elemente enthält, ist dies natürlich nur ein Bruchteil gegenüber der tatsächlich wesentlichen Beteiligung am Unternehmergewinn. Der eigentliche Unternehmergewinn erscheint nun aber (nachdem diese Posten als „Gehälter“ u.ä. abgezogen sind) nur noch als „Jahresüberschuss“, der z.B. teils in Dividenden ausgeschüttet wird, oder als Gewinnrücklage zur Aufstockung des Eigenkapitals verbucht wird.
„Indem aber einerseits dem bloßen Eigentümer des Kapitals, dem Geldkapitalisten der fungierende Kapitalist gegenübertritt und mit der Entwicklung des Kredits dies Geldkapital selbst einen gesellschaftlichen Charakter annimmt, in Banken konzentriert und von diesen, nicht mehr von seinen unmittelbaren Eigentümern ausgeliehen wird; indem andererseits aber der bloße Dirigent, der das Kapital unter keinerlei Titel besitzt, weder leihweise noch sonstwie, alle realen Funktionen versieht, die dem fungierenden Kapitalisten als solchem zukommen, bleibt nur der Funktionär und verschwindet der Kapitalist als überflüssige Person aus dem Produktionsprozess.“ (ebd., S. 401)
Ganz offensichtlich war Marx hier vor 140 Jahren sehr weitsichtig bezüglich der Entwicklungstendenzen des Kapitalismus. Es ist jedenfalls genauso unsinnig, Marx eine Kapitalinterpretation eines Konkurrenzkapitalismus von „Zigarre rauchenden“ Privatkapitalisten zu unterstellen, wie die Konstruktion eines „finanzmarktgetriebenen Kapitalismus“ unterstellt, die Dominanz der Finanzmärkte sei etwas ganz Neues im Kapitalismus.
Abbildung 4 zeigt, dass Vermögensentnahmen (Zinsen, Dividenden etc.) einen großen Teil des Profits (gemessen als „Betriebsüberschuss“) nicht-finanzieller Kapitalgesellschaften auffressen. Ohne die „empfangenen Vermögensleistungen“ aus eigenen Finanzanlagen würde der akkumulierbare Unternehmensgewinn oft ganz verschwinden (siehe Abbildung 5).
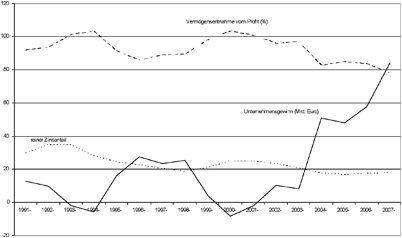
Abbildung 4: Aufteilung des Bruttoprofits in Vermögensentnahme, Zins und Unternehmensgewinn bei Nicht-finanziellen Kapitalgesellschaften – Deutschland 1991-2007
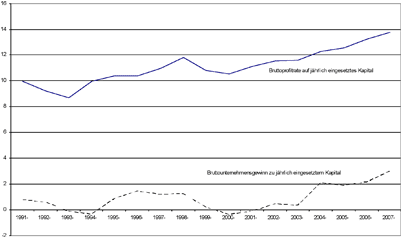
Abbildung 5: Entwicklung der Bruttoprofitrate im Gegensatz zur Gewinnprofitrate von Nicht-Finanziellen Kapitalgesellschaften – Deutschland 1991-2007
3.5. Akkumulation von zinstragendem Kapital und die Bildung von fiktivem Kapital
Die Verwandlung von Kapital in Ware durch das zinstragende Kapital, die Akkumulation von zinstragendem Kapital, wie sie sich in der Rentenformel ausdrückt, führt logisch zum nächsten Schritt: der Verwandlung von Kredit und Anlage selbst in eine Ware, gehandelt in „Wertpapieren“.
Die ursprünglichste Form dieser Verwandlung findet im Wechselgeschäft statt, dem Kauf einer Ware ohne Äquivalent, mit Vereinbarung einer späteren Zahlung. Diese Vereinbarung kann als Wertpapier verbrieft werden („Ziehen eines Wechsels“). Dieses Wertpapier kann als Geldäquivalent weitergereicht werden, oder aber bei einer Bank – noch vor Ablauf der Zahlungsfrist – in Geld (höherer Liquidität) umgewandelt werden („Diskontieren des Wechsels“). Hiermit wird eine zukünftige Zahlung zur Quelle von Geldkapital (Leihmittel), das selbst Geldform annimmt. „Wechselziehen ist Verwandlung von Ware in eine Form von Kreditgeld, wie Wechseldiskontierung Verwandlung dieses Kreditgelds in anderes, nämlich Banknoten.“ (ebd., S. 442). Speziell in Krisensituationen steigt die Tendenz, Wechsel noch vor ihrem Verfall in Geld umzuwandeln, weil die Unverkäuflichkeit der Ware zu befürchten ist.
Das Diskontieren von Wechseln ist ein erstes Beispiel, bei dem eine noch gar nicht reale („fiktive“) Einnahme mit der Verzinsung eines fiktiven Kapitals verglichen wird, um daraus einen „Preis“ für den Verkauf dieser Einnahmequelle zu bestimmen. „Die Bildung des fiktiven Kapitals nennt man kapitalisieren. Man kapitalisiert jede regelmäßig sich wiederholende Einnahme, indem man sie nach dem Durchschnittszinssatz berechnet, als Ertrag, den ein Kapital, zu diesem Zinssatz ausgeliehen, abwerfen würde.“ (ebd., S. 484)
So berechnet man im normalen Bankgeschäft den Wert eines vorzeitig diskontierten Wechsels, indem man das Kapital berechnet, das zum Diskontsatz verzinst, bis zum Verfallsdatum genau den Wechselwert ergeben würde.
Sei K der Wechselwert (Preis der ursprünglichen Ware), i der Diskontsatz und n die Anzahl der Tage, die der Wechsel vorzeitig eingelöst wird, so zahlt die Bank einen Diskontwert D (beim Wechseldiskont wird normalerweise lineare Verzinsung angewendet):
D = K (1 – i n/365)
Wenn zum Beispiel ein Wechsel über 8.000 Euro 2 Monate vor Fälligkeit zum Diskontsatz von 9% eingelöst wird, so zahlt die Bank 7.880 Euro; hat also 120 Euro als Zinsen abgezogen.
Dies wird noch deutlicher, bei der Kapitalisierung von Wertpapieren (13), mit denen längerfristig angelegte, z.B. verrentete Anlagen gehandelt werden. Der Preis eines Wertpapiers zu einem bestimmten Zeitpunkt (sein „Kurs“) wird allgemein berechnet durch den (mithilfe des Marktzinses ermittelten) Barwert aller in der Restlaufzeit noch ausstehenden Erträge des Wertpapiers. Im Gegensatz zum Wechselgeschäft wird hier aufgrund der längerfristigen Anlage mit Zinseszins gerechnet. Dann ergibt sich z.B. für ein festverzinsliches Wertpapier (z.B. Staatsanleihe), das eine jährliche „Kuponzahlung“ (dies heißt immer noch so, auch wenn keine Kupons mehr vom Wertpapier abgeschnitten werden) von R liefert und bei Fälligkeit des Wertpapiers eine Rückzahlung von C für einen Zeitpunkt t (vor Fälligkeit) bei gegebenen Marktzins i (q=1+i) ein finanzmathematischer Kurs Ct:
Ct = R ((qt -1)/(q-1)) 1/qt + C / qt
So ergibt sich z.B. für ein Wertpapier mit Nominalwert 100, das zum Kurs 98,5 emittiert wurde, mit jährlicher Zinszahlung zu 7,8 auf 15 Jahre: Soll das Wertpapier 10 Jahre vor Fälligkeit bei einem Marktzins von 8,2% verkauft werden, ergibt sich sein „fairer Preis“ zu 97,34. Bei höherem Zins ist der Wertpapierpreis entsprechend niedriger, z.B. bei 12% nur bei 76,27 (ein entsprechend angelegtes Kapital würde bei diesem hohen Zinssatz denselben Ertrag bringen wie das Wertpapier); dagegen würde der Kurs bei sinkenden Zinsen steigen: z.B. bei 5% sogar schon auf 121,62.
Wie auch schon aus der obigen Preisformel ersichtlich ergibt sich hier die alte „Börsenwahrheit“:
Steigendes Zinsniveau <-> fallende Kurse
Fallendes Zinsniveau <-> steigende Kurse
Dies wird noch deutlicher, wenn die Rente R oder der Ertrag eines Wertpapiers als „ewige Rente“ kapitalisiert wird. Hier wird der „Kapitalwert“ so berechnet, dass der Kaufpreis des Wertpapiers einer „ewigen“ z.B. jährlichen Rentenzahlung entspricht, die zum gängigen Zinssatz i jeweils angelegt werden kann. Durch Grenzübergang ergibt sich dann als Kapitalisierung der Geldanlage:
C∞ = R / i
So kapitalisiert sich eine Aktiengesellschaft, die jährlich aufgrund ihrer Gewinnsituation bzw. der Rücklagen mindestens1.000.000 Euro Dividenden ausschütten könnte („Gewinnerwartung“) bei einer Marktzinsrate von 5% (i=0,05) zu einem „Kapitalwert“ von 20.000.000 Euro. Dies wäre der zu erwartende Kaufpreis der Aktien des Unternehmens. „Börsianer“ halten ein „Kurs-Gewinnverhältnis“(kurz: KGV) für angemessen, das in etwa 1/i (also dem Inversen des Zinssatzes) entspricht. „Ewigkeit“ ist für den Aktienspekulanten letztlich schon ein Horizont von ein paar Börsenjahren.
Natürlich beißt sich die Fiktion eines „gerechten“ Preises für Wertpapiere wie die Katze in den Schwanz. Wie schon bei der Fiktion des Kapitalwerts mag es sich hier für den Einzelkapitalisten um eine reale Abwägung handeln. Von der Gesamtperspektive betrachtet, würde die unterstellte Alternative des Umsteigens auf Anlage zum Normalzins wiederum den Marktzinssatz beeinflussen und so das Bewertungskriterium zunichte machen.
Offensichtlich ist der Handel mit Wertpapieren nicht Handel mit wirklichen Werten, sondern mit Ansprüchen auf Mehrwertanteile. Tatsächlich erscheint das Wertpapier aber als eigenständig Wert repräsentierend, verdoppelt also scheinbar die zugrundeliegende Zahlungsverpflichtung in diese selbst und den handelbaren, kapitalisierten Titel darauf. „Auch da, wo der Schuldschein – das Wertpapier – nicht wie bei den Staatsschulden rein illusorisches Kapital vorstellt, ist der Kapitalwert dieses Papiers rein illusorisch (…) Die Aktien von Einsenbahn-, Bergwerks-, Schifffahrts- etc. Gesellschaften stellen wirkliches Kapital vor, nämlich das in diesen Unternehmungen angelegte oder fungierende Kapital oder die Geldsumme, welche von den Teilhabern vorgeschossen ist, um als Kapital in solchen Unternehmungen verausgabt zu werden. (…) Aber dieses Kapital existiert nicht doppelt, einmal als Kapitalwert der Eigentumstitel, der Aktien, und das andere Mal als das in jenen Unternehmungen wirklich ausgelegte oder anzulegende Kapital. Es existiert nur in jener letzteren Form, und die Aktie ist nichts als ein Eigentumstitel, pro rata, auf den durch jenes zu realisierenden Mehrwert. A mag diesen Titel an B, und B ihn an C verkaufen (…) A und B haben dann ihren Titel in Kapital, aber C sein Kapital in einen bloßen Eigentumstitel auf den von dem Aktienkapital zu erwartenden Mehrwert verwandelt.“ (ebd., S. 484f)
D.h. für die Händler von Wertpapieren stellen Kursgewinne oder -verluste im Ganzen gesehen ein Nullsummenspiel dar – was der eine Spekulant gewinnt ist der Verlust des anderen -, bis auf diejenigen in der Händlerkette, die die ursprüngliche Forderung realisieren müssen. Bei ihnen erweist sich, ob der erwartete Gesamtertrag, der bereits vorschüssig kapitalisiert wurde, auch den Erwartungen entspricht.
Auch wenn diese Papiere letztlich von den langfristigen Erträgen des zugrundeliegenden Kapitals abhängen, ergeben sich kurzfristige Schwankungen ihrer Kurse, die mit anderen Faktoren zusammenhängen. „In Zeiten der Klemme auf dem Geldmarkt werden diese Wertpapiere also doppelt im Preis fallen: erstens, weil der Zinsfuß steigt, und zweitens, weil sie massenhaft auf den Markt geworfen werden, um sie in Geld zu realisieren. Dieser Preisverfall findet statt unabhängig davon, ob der Ertrag, den die Papiere ihrem Besitzer sichern konstant ist (…) oder ob die Verwertung des wirklichen Kapitals, das sie repräsentieren, wie bei industriellen Unternehmungen, möglicherweise durch die Störung des Reproduktionsprozesses mit betroffen wird.“ (ebd., S. 485f)
Der Einbruch der Kurse an der Börse lässt daher keinen Rückschluss zu auf tatsächliche Probleme im Reproduktionsprozess zu, kann aber sehr wohl ein Indikator dafür sein. Er stellt einerseits eine Vernichtung von fiktivem Kapital dar, dem andererseits eine Vernichtung von tatsächlichem Kapital entsprechen mag oder auch nicht. Auf jeden Fall trägt dies durch den Umverteilungseffekt im Nullsummenspiel des fiktiven Kapitals dazu bei, dass Finanzkrisen „als kräftiges Mittel zur Zentralisation des Geldkapitals“ (ebd.) wirken.
Die Erträge aus der zeitweiligen Unabhängigkeit des Kapitalwerts (der Kurse) von den zugrundeliegenden Zahlungsverpflichtungen bzw. die aus dem Bedarf zur vorzeitigen Kapitalisierung derselben zu erzielen sind, mögen für kleine Geldsummen marginal und mit hohem Risiko behaftet sein. Für große, zentralisierte Geldkapitale sind sie eine stetige Quelle wachsender Akkumulation von Mehrwertansprüchen. „In allen Ländern kapitalistischer Produktion existiert eine ungeheure Masse des sog. zinstragenden Kapitals oder moneyed capital in dieser Form. Und unter Akkumulation des Geldkapitals ist zum großen Teil nichts zu verstehen als Akkumulation dieser Ansprüche auf die Produktion, Akkumulation des Marktpreises, des illusorischen Kapitalwerts dieser Ansprüche.“ (ebd., S. 486)
Marx weist zurecht darauf hin, dass damit auch ein Großteil der Bankreserven zu charakterisieren ist: „Der größte Teil des Bankierskapitals ist daher rein fiktiv und besteht aus Schuldforderungen (Wechseln), Staatspapieren (die vergangenes Kapital repräsentieren) und Aktien (Anweisungen auf künftige Erträge).“ (ebd.)
Der fiktive Charakter dieser Kapitale ergibt sich nicht daraus, dass sie keine Beziehung auf tatsächliche Erträge hätten, sondern aus ihrer scheinbar unabhängigen, selbstständigen Preisregulierung, die ihren Wert ungeheuer aufblasen kann.
3.6. Derivate
Im Unterschied zur Zeit von Marx spielen heute Wechsel im modernen Kreditsystem nur noch eine untergeordnete Rolle. Zu Zeiten, da noch Wechsel zwischen den Unternehmen das wichtigste Mittel zur Vermittlung von terminungleichen Zahlungseingängen in der Warenzirkulation W-G-W dienten, äußerten sich Krisen noch in geballten Zahlungs- und Diskontierungsproblemen in Bezug auf Wechsel. Der Zusammenbruch von W-G-W äußerte sich vor allem im Mangel an Zirkulationsmitteln in Form von Wechseln bzw. der Nicht-Einlösbarkeit von Wechseln, um akzeptierte Zirkulationsmittel zu erlangen.
Mit dem entwickelten Banksystem der imperialistischen Epoche sind diese Funktionen des kommerziellen Kredits weitgehend in den Bankkredit übernommen worden. Soweit es sich um kurzfristigen Zahlungsausgleich handelt, wird diese Funktion durch die Überziehungsrahmen von dafür geeigneten Konten ersetzt, bzw. die Funktion von Wechseln als Kreditgeld durch die Verbriefung der Schulden oder einfach Buchgeld der Banken in deren wechselseitigem Saldieren von Zahlungsvorgängen.
Eine zweite Funktion des Wechselgeschäfts hat jedoch eine vom Bankkredit stark verschiedene Form angenommen. Schon im traditionellen Wechselgeschäft war es üblich, die Abwicklung der Zahlung an einen angenommenen Preis zu binden, der nicht mit dem gerade gültigen, sondern mit einem für den Zeitpunkt der Zahlung geschätzten Preis übereinstimmte. W-G ist zum Zeitpunkt der Produktion von W oft mit dem Risiko unvorhersehbarer Preisschwankungen behaftet. Von daher ist es für das Kapital zur Risikominderung oft geraten, sich den Preis ihrer Waren zum Verkaufstermin schon zum Zeitpunkt der Geldanlage in der Produktion zu sichern. Diese Preissicherung nennt man „Termingeschäft“. Dies mag in der Form eines „Futures“, einer festen Vereinbarung zum Verkauf oder Kauf einer Ware zu einem zukünftigen Termin, oder in Form einer „Option“ auf Kauf oder Verkauf geschehen. Solche Termingeschäfte werden heute hochkonzentriert auf wenigen dafür spezialisierten Börsen (z.B. der CBOT in Chicago oder der EUREX in Zürich) abgewickelt. Gerade durch steigende Risiken durch Währungs- oder Rohstoffpreisschwankungen gewinnen solche Termingeschäfte für die weltweite Kapitalreproduktion eine immer wichtigere Rolle.
Wie bei Wechseln lassen sich nun auch Optionen und Futures in handelbare Güter umwandeln. Durch richtiges Spekulieren auf Preis-, Zins oder Währungsentwicklungen lassen sich dabei mit geringem Geldeinsatz hohe Differenzen zwischen Kauf- und Verkaufspreisen erzielen.
Wenn z.B. eine deutsche Firma in drei Monaten in den USA 4 Mill. $ zahlen muss, kann sie ihr Wechselkursrisiko durch einen Forward-Kontrakt bei einem Hedgefonds absichern, der einen 3-Monatskurs von 1,6 $/Euro anbietet. Dann muss die Firma in drei Monaten an den Fonds 2,5 Mill. Euro zahlen, um die 4 Mill. Dollar zu bekommen. Ist der Dollar tatsächlich aber auf 1,7 $/Euro gefallen, so hätte man eigentlich nur 2,35 Mill. Euro gebraucht. Der Hedgefonds macht bei geringem Gebührenaufwand einen Gewinn von etwa 160.000 Euro. Steigt der Kurs des Dollar dagegen auf 1,5 $/Euro, so macht er einen Verlust in etwa dieser Größe. Natürlich aber kann er auch zuvor, wenn er ungünstige Kursentwicklung vermutet, den Forward-Kontrakt an andere Fonds verkaufen, die noch günstige Kursentwicklung erwarten. Dabei würde er einen Preis erzielen, der dem zu diesem Zeitpunkt noch allgemein erwarteten Gewinn entspricht.
Tatsächlich ist auch bei Futures (Forwards) oder Optionen die Warenbildung mit der Illusion eines „Kapitalwerts“ verbunden. Auch hier lässt sich mit dem zu erwartenden Gewinn (als wahrscheinlichkeitstheoretische Größe) und dem bei gegebenem Marktzins angesetzten Kapitalertrag wiederum ein „fairer“ Options- oder Futurepreis berechnen. So z.B. das Optionsbewertungsmodell von Black-Scholes (14), das mit dem Erwartungswert und der Varianz einer als normalverteilt angenommenen Kursentwicklung der Ware rechnet, auf die die Option besteht.
Was dabei bedenklich stimmt, ist, dass Malvin Scholes, der für dieses Modell den Nobelpreis erhielt, wenige Jahre später Chefberater des Hedgefonds LCTM war, der 1998 während der Russlandkrise mit seinen Optionsgeschäften fast den Kollaps des internationalen Finanzsystems bewirkte. Der drohende russische Staatsbankrott machte alle Wertberechnungen auf Basis der angenommenen Zinsfunktionen obsolet. Dies ist die Grundtatsache, die kein finanzmathematisches Modell überwinden kann: dass die Wertberechnungen von fiktivem Kapital nur solange ihren begrenzten Sinn (d.h. Umverteilungsfunktionen innerhalb des Geldkapitals zu sein) besitzen, solange die zugrundeliegenden Schulden auch im Großen und Ganzen zur Fälligkeit beglichen werden. Ist dies nicht der Fall, so gehen nicht nur Gläubiger leer aus, sondern es werden auch die auf diesen Schulden aufbauenden fiktiven Kapitale entwertet.
Wie auch schon beim Wechselgeschäft, müssen die mit Derivaten (Kauf-/Verkauf-Optionen, Futures oder Kombinationen davon) handelnden Kapitalisten die zugrundeliegenden Waren (ob nun reale Waren oder Finanzprodukte) in der Regel zur Fälligkeit nicht wirklich kaufen oder verkaufen. Die Termingeschäftsbörsen agieren vielmehr als Clearingstellen, die (wie einst die Banken im Wechselgeschäft) die Terminpapiere gegeneinander saldieren. Z.B. kann ein Kauf- mit einem Verkaufs-Future gekoppelt werden, so dass hier einfach Anbieter und Nachfrager einer Ware zu einem bestimmten Termin gekoppelt werden – bei eventueller Handelsarbitrage des Börsenmaklers.
Insofern erfüllen Warenterminbörsen mehrere Zwecke. Sie sind einerseits wichtige Agenturen des globalen Warenzirkulationsprozesses. Bestimmte Rohstoffe oder Agrarprodukte werden heute, was den Großhandel betrifft, vornehmlich auf diesen Börsen gehandelt, während die „Spot-Märkte“ für die Verteilung auf niedriger Stufe sorgen. Insofern ist ein kleiner Teil der Gewinne aus dem Derivatenhandel auf den kommerziellen Profit zurück zu führen. Allerdings machen Derivate auf reale Waren nur einen kleinen Teil des Derivatenmarktes aus (im einstelligen Prozentbereich). Da die Hauptfunktion die der Vermittlung und Absicherung des Handels mit Geldkapital ist (Zinsen, Währungen, Wertpapiere), handelt es sich hier um eine Funktion, die analog wie der kommerzielle Profit die Durchschnittszinsrate und hier wiederum den Duchschnittszins senkt. D.h. das zinstragende Kapital ist bereit, vorweg einen geringeren Zins zu akzeptieren, um nicht von noch niedrigerem Zinsertrag überrascht zu werden. Ganz ähnlich beim Warenterminhandel mit realen Waren: stehen doch die Preisbewegungen der Waren mit dem Ausgleichsprozess zur Durchschnittsprofitrate in Beziehung. So ist das Kapital bereit, einen Preis, der einer niedrigeren Durchsnittsprofitrate entspricht, zu akzeptieren, um zumindest diese Rate garantiert zu erhalten.
Zwischenresümee
Hiermit haben wir überblicksweise die unterschiedlichen Erscheinungsformen von zinstragendem Kapital entwickelt. Wir haben gesehen, dass in einer Gesellschaft verallgemeinerter Warenproduktion wie sie der Kapitalismus darstellt, jedes Gut, das Warenform annimmt, letztlich auch eine Wertform erhält – ob in ihm Wert „verkörpert“ ist oder nicht. Wert ist letztlich nur im Gesamtprodukt des produktiven Kapitals verkörpert, das aber erst den gesellschaftlichen Ausdruck abstrakter Arbeit, d.h. die Geldform annehmen muss. Da dieser Prozess durch die Kapitalreproduktion vermittelt ist, verteilt sich der Wert derart auf die Produkte, dass jedem Kapital anteilig ein Durchschnittsprofit zufällt, d.h. Preis und Wert der Ware systematisch abweichen.
Dabei gehen in diese Preisbildung nicht nur die unterschiedlichen Verwertungsbedingungen der produktiven Kapitale ein, sondern auch spezifische „Kosten“ für Handel und kommerziellen Geldverkehr. Erst der so gebildete Durchschnittsprofit wird zur Quelle des zinstragenden Kapitals, das einen Teil des Durchschnittprofits in Form des Zinsertrags erhält. Darin drückt sich die Dopplung des Kapitals in Kapitaleigentum und fungierendes Kapital aus. Sowohl Kapitalkredit wie auch kommerzieller Kredit können jedoch wiederum Warenform annehmen, handelbare Titel auf Zahlungen der Schuldner und – in dieser Form vermittelt – den von den ursprünglichen Gläubigern beanspruchten Mehrwert auf das Geldkapital aufteilen und in schier unbegrenzt akkumulierbare Form zu bringen. Mit dieser Form ist auch der Unterschied zwischen kommerziellem Kredit und Kapitalkredit endgültig verwischt und erscheint nur noch quantitativ als Unterschied zwischen kurzfristigen Geldmarktzinsen und langfristigen Kapitalmarktzinsen.
In der neo-klassischen Theorie führt die Ineinssetzung der beiden Zinsarten zum „Walras’schen Gleichgewichtsgesetz“ (15), als Begründung von Says Theorem: überproduzierende Märkte werden durch steigende Zinsen leergeräumt, während zu große Spartendenz durch sinkende Zinsen gestoppt wird. Da jedoch Geldmarktzinsen durchaus unterschiedlichen Bewegungsgesetzen wie Kapitalmarktzinsen folgen, kann z.B. durchaus die Kombination niedriger Zinsen für die kommerziellen Operationen (kein Gegensteuern gegen Überproduktion) mit hohen Kapitalmarktzinsen (Einbremsen langfristiger Investitionen) vorkommen.
Die Unterschiede dieser beiden Kreditformen und ihrer Bewegungsgesetze werden im Folgenden entwickelt, um dann die Wirkung des Kreditsystems im Gesamtreproduktionsprozess des Kapitals, im industriellen Zyklus und schließlich der Überakkumulationskrise darzustellen.
3.7. Kommerzieller Kredit, Handelskredit
Die ursprüngliche Form des kommerziellen Kredits ist die Kombination der am Anfang dargestellten Form der „aufgeschobenen Zahlung mit der Verwandlung des Gläubigers in einen zinstragenden Kapitalisten. D.h. es wird nicht bloß spätere Zahlung für die gelieferte Ware vereinbart, sondern auch eine Verzinsung des geforderten Geldbetrags. „Leihkapital und Warenkapital sind hier identisch; die geliehenen Kapitale sind Waren.“ (MEW 25, S. 498)
Diese Form des Kredits entspringt unmittelbar der Notwendigkeit der raschestmöglichen Realisierung von Wert (W-G), genauso wie so schnell als möglich wieder Geld da sein muss, um erneut kaufen zu können (G-W), also aus den Notwendigkeiten der Warenmetamorphose unter Bedingungen beschleunigter Akkumulation.
Die „Natürlichkeit“ des kommerziellen Zinses ergibt sich, indem er in den gewöhnlichen Preis schon einberechnet wird, und punktgenaue Barzahlung mit einem eigenen Zins bedacht wird (Skonto). Daher auch die Notwendigkeit für das Kapital, für seine reguläre Zirkulation beständig gewisse Rücklagen einzuplanen (z.B. in den Bilanzen), um Zahlungsfälligkeiten bzw. Überziehungszinsen begleichen zu können.
Daher natürlich auch das ursprüngliche Bedürfnis nach Wechseln bzw. ihrer etwaigen Diskontierung. Das Wechselgeschäft erforderte noch hohe Rücklagenbildung von Bargeld bei den operierenden Kapitalisten selbst. Daher letztlich der Bedarf nach den über Banken und Börsen abgewickelten bargeldlosen Formen von Handelskrediten bzw. Termingeschäften.
Die bereits früher dargestellten Instrumente des kreditgestützten Zahlungs-verkehrs ermöglichen dem Kapital einen weitgehend bargeldlosen Warenverkehr, der Termine der eigenen Liquidität wie auch Risiken von Preisschwankungen mit dem Bedürfnis nach stetig beschleunigter Reproduktion des Kapitals vermittelt. Damit erfüllt das Finanzsystem in dieser Weise einen wichtigen Beitrag für die erweiterte Reproduktion des Kapitals:
„Beschleunigung durch den Kredit, der einzelnen Phasen der Zirkulation oder der Warenmetamorphose, weiter der Metamorphosen des Kapitals und damit Beschleunigung des Reproduktionsprozesses überhaupt (…) Kontraktion der Reservefonds, was doppelt betrachtet werden kann: einerseits Verminderung des zirkulierenden Mediums, andererseits Beschränkung des Teils des Kapitals, der stets in Geldform existieren muss.“ (MEW 25, S. 452)
Damit entlastet das Finanzsystem die Kapitalreproduktion von der Bürde, mit wachsendem Umschlag und Umfang immer gewaltigere Bargeldmassen für die Abwicklung seiner Geschäfte zu benötigen. Andererseits kann das Kapital Phasen lange brachliegenden Geldkapitals, das gänzlich ohne Anlage bleibt, minimieren.
Erkauft wird dies allerdings durch die Umwandlung des Großteils des zirkulierenden Geldes in Kreditgeld. Also in zirkulierbare, aber auch mit bestimmten Fälligkeiten und Verzinsungen behafteten Schuldtiteln. Damit wird der Bedarf nach reibungslosem Geldverkehr mit der wachsenden Reproduktion zugleich Basis für ein immer entwickelteres Kreditsystem, das sich immer mehr zum zinstragenden Kapital verselbständigt: „Es findet hier Wechselwirkung statt. Die Entwicklung des Produktionsprozesses erweitert den Kredit, und der Kredit führt zur Ausdehnung der industriellen und merkantilen Operationen.“ (ebd., S. 498)
In der Ausweitung der Kreditgeld-basierten Zirkulation drückt sich damit nichts anderes aus, als das Grundbedürfnis des Kapitals nach erweiterter Reproduktion, unabhängig von allen lästigen Begrenzungen derselben. Insbesondere kommt dies in der Verselbständigung der reproduktiven Akkumulation auf Basis des Kredits zum Ausdruck – unabhängig letztlich auch von solchen Beschränkungen, wie der konsumtiven Endnachfrage. „Ein gewaltsames Geltendmachen der gegeneinander verselbständigten Formen des Zirkulationsprozesses des gesellschaftlichen Gesamtkapitals wird damit bloß zeitlich hinausgeschoben, der Eklat jedoch prinzipiell nicht verhindert.“ (Krüger, S.608) Der Eklat muss sich also zuerst in den verselbständigten Gestalten des Finanzsystems zum Ausdruck bringen, um dann die bis dahin verdeckten Probleme im eigentlichen Reproduktionsprozess umso stärker zum Vorschein zu bringen.
Die Basis von kommerziellem und Handels-Kredit sind die Bedürfnisse der beständigen Warenzirkulation, also insbesondere der Reproduktion des zirkulierenden Kapitals. Dieser Kredit speist sich also letztlich aus den während einer Umschlagperiode gebildeten Reserven aus Warenverkäufen. Seine Bewegungs-gesetze, besonders die des Zinssatzes, sind daher von den kurzfristigen Absatzproblemen innerhalb der Umschlagszeiten des zirkulierenden Kapitals bestimmt. Wenn es sich nicht mehr um kurzfristige Absatzprobleme handelt, so kommt daher diese Kreditform schnell an ihre Grenzen.
3.8. Bankkapital und Kapitalkredit
Schon die Entwicklung des kommerziellen Kredits tendiert zur Konzentration der Reservefonds für die laufenden Zahlungen bei Banken. Dazu kommt, dass Geld, auch ohne unmittelbar für laufende Zahlungen gebraucht zu werden, bei Banken deponiert werden kann, um Zins abzuwerfen. Dies kann zuerst nicht-produktive Klassen mit ihren Revenuen betreffen oder die kleinen Ersparnisse der Arbeiterklasse. Dies mag die Reservefonds für die Verleihoperationen der Banken ausweiten. Entscheidend ist jedoch, dass die wirklich großen Operationen des produktiven Kapitals, die in längerer Frist notwendigen Investitionen in die Erneuerung des konstanten Kapitals, aber auch der Erweiterung des Kapitalstocks große Massen an aufbringbaren Geldkapital erfordern – und mit der erweiterten Reproduktion auch steigende Mengen an Zinsertrag für das Anlagekapital erbringen.
Hier werden natürlich die Geldakkumulationsfonds der produktiven Kapitale selbst zur entscheidenden Quelle des zusätzlichen Leihkapitals. Das betrifft sowohl die mit den Abschreibungen bestehender Anlagen gebildete Reservekapitale für zukünftige Ersatzinvestitionen, als auch die Bildung von Gewinnrücklagen zur Finanzierung künftiger Neuinvestitionen.
Damit können Investitionen auch vorgezogen werden, indem der Kapitalkredit praktisch das brachliegende Reservekapital eines anderen Kapitalisten für die Investition mobilisiert, sofern der Rückfluss des verliehenen Kapitals gewährleistet ist – sei es durch den Rückfluss der besagten Investition selbst, durch Rückflüsse vorhergehender Kredite, andernfalls durch das Reservekapital der Bank. Ohne Kreditsystem ist der erweiterten Reproduktion eines jeden Kapitals eine Schranke gesetzt in den jedesmal zu akkumulierenden Geldfonds, die für zusätzliche Anlage zu Verfügung stehen müssen. Diese Schranke ergibt sich aus den Teilen des Profits, der für Akkumulation übrig ist, sowie aus der Größe, die mindestens zu erreichen ist, um sinnvoll investiert zu werden.
Durch die Konzentration der akkumulierten Fonds steht eine Masse an gesellschaftlich verfügbarem Kapital bereit, das diese Schranken überwindet. Die Frist für mögliche große Investitionen kann wesentlich verkürzt werden, genauso wie die Mobilität des Kapitals zwischen Anlagesphären erhöht werden kann. Gerade in dieser Funktion, losgelöst von der unmittelbarer mit dem Warenkapital verknüpften Form des Handelskredits, erscheint hier im Kapitalkredit Kapital als Ware, das über Sicherheiten und Zinszusagen von den Kapitalvermittlern „zu kaufen“ ist. Der Kapitalkredit gibt dem „einzelnen Kapitalisten (…) eine innerhalb gewisser Schranken absolute Verfügung über fremdes Kapital und fremdes Eigentum und dadurch über fremde Arbeit. Verfügung über gesellschaftliches, nicht eigenes Kapital, gibt ihm Verfügung über gesellschaftliche Arbeit.“ (MEW 25, S. 455)
Die Bank selbst fungiert zunächst nur als Vermittler von Geldeigentümern und fungierenden Kapitalisten. Ihr Bankprofit ergibt sich aus der Differenz des Zinssatzes, zu dem die Bank Geld aufnimmt, und dem, zu dem es verleiht. Schließlich tritt das Bankkapital selbst als Kapitaleigentümer auf, sobald es genügend akkumuliert hat bzw. Geldkapitale konzentriert hat. Im entwickelten Kreditsystem findet es letztlich selbst seine Gestalt in Form von Gesellschaftskapital, so wie das produktive Kapital auch.
Die Rolle des Kredits in der kapitalistischen Produktion resümiert Marx (siehe MEW 25, S. 451f) wie folgt:
• Vermittlung des Ausgleichs der Profitraten zur Durchschnittsprofitrate – auch als Grundlage des Durchschnittszinses;
• Verringerung der Zirkulationskosten (Ersparung von Bargeld, Beschleunigung des Umschlags, Vermehrung der Zirkulationsmittel durch Geldzeichen);
• Beschleunigung und Zentralisation des akkumulierenden Kapitals, schließlich Bildung von Gesellschaftskapital (z.B. Aktienkapital), damit Ausdehnung der Stufenleiter der Produktion, Gesellschaftlichkeit des fungierenden Kapitals bei Beibehaltung der Privatheit des Kapitaleigentums, Umwandlung der fungierenden Kapitalisten in Funktionäre fremden Kapitals.
3.9. Staatsschuld, Notenbank und Kreditgeld
Mit der Umwandlung von Kapital in Ware im Kreditsystem und der kreditbasierten Beschleunigung der Warenzirkulation ergibt sich auch eine Verwandlung der Erscheinungsformen des Geldes. Geld als gesellschaftlicher Ausdruck abstrakter Arbeit und als solches als Maßstab der Werte muss auch als Zirkulationsmittel letztlich Ware sein bzw. Zeichen einer bestimmten Ware. Mit der Verbriefung von Schuldforderungen ergibt sich damit eine neue Fundierungsmöglichkeit von Geld, die über die Beschränkung von Geld als Goldware hinausgeht. Auch wenn der Preis von Kreditware eine abgeleitete, illusionäre Form ist, so entspricht er doch einem Anspruch auf Aneignung eines bestimmten Mehrwertanteils, in der Form der Zinszahlung. Kreditgeld wird daher im entwickelten Kapitalismus zur dominierenden Form des Geldes – ohne damit die grundsätzliche Geldbestimmung außer Kraft zu setzen.
„Die Banknote ist nichts als ein Wechsel auf den Bankier, zahlbar jederzeit an den Inhaber (…) Die letztere Form des Kredits erscheint dem Laien besonders frappant und wichtig, erstens weil diese Art Kreditgeld aus der bloßen Handelszirkulation heraus in die allgemeine Zirkulation tritt und hier als Geld fungiert; auch weil in den meisten Ländern die Hauptbanken, welche Noten ausgeben, als sonderbarer Mischmasch zwischen Nationalbank und Privatbank in der Tat den Nationalkredit hinter sich haben und ihre Noten mehr oder minder gesetzliches Zahlungsmittel sind; weil es hier sichtbar wird, dass das worin der Bankier handelt, der Kredit selbst ist, indem die Banknote nur ein zirkulierendes Kreditzeichen vorstellt (…) In der Tat ist die Banknote nur die Münze des Großhandels, und ist es stets das Depositum, was als Hauptsache bei den Banken ins Gewicht fällt.“ (MEW 25, S. 417)
Trotzdem hält sich das Gerücht, Marx habe eine „Golddeckungstheorie“ des Geldes vertreten (dass also alle Geldzeichen letztlich jederzeit in Gold eintauschbar sein müssten) – obwohl Marx in den Kapiteln über das zinstragende Kapital ausführlich die „Currency-Theorie“ kritisiert, die Mitte des 19. Jahrhunderts auch politisch einflussreich vertreten hat (im Gegensatz zur „Banking“-Theorie).
Wie Marx im obigen Zitat darlegt, ist die Staatsschuld eine wesentliche Quelle für Kreditgeld. Wie schon früher erwähnt, fällt auch die Kapitalisierung dieser Schuld unter die Kategorie des fiktiven Kapitals. Im Staat organisiert die Bourgeoisie gemeinschaftliche Aufgaben, die zwar für die Gesamtreproduktion des Kapitals wesentlich sind, sich aber nicht profitabel durch einzelkapitalistische Verwertung organisieren lassen. Dieses Funktionieren als „ideeller Gesamtkapitalist“ wird ermöglicht, indem die Staatsausgaben finanziert werden über Steuern auf Unternehmergewinn, Zinsertrag, Lohn und andere Revenueformen, durch Aufschlag auf Produktionspreise (Minderung des Durchschnittsprofits) und Abgaben (z.B. Zentralisierung bestimmter Reproduktionsprozesse der Ware Arbeitskraft in Sozialversicherungen).
Staatseinnahmen sind daher Aneignung eines Teils des gesellschaftlichen Mehrwerts wie auch Übernahme eines Teils des Reproduktionsfonds der Ware Arbeitskraft. Insofern ist mit erweiterter Reproduktion des Kapitals auch ein beständiges Wachstum der Staatsfunktion und seiner Einnahmen anzunehmen. Dieses Wachstum kann beschleunigt werden durch Aufnahme von Schulden, mit der Sicherung, dass die im Gesamtkapital (auch mit dieser staatlichen „Absicherung“) angelegte beschleunigte Akkumulation die Mehreinnahmen für den Staatshaushalt bringt, die dann auch die Schuldrückzahlung mit Verzinsung ermöglichen.
Die Staatsschuld wird zu einem gewissen Teil bei der jeweiligen Zentralbank aufgenommen, vornehmlich in Staatsanleihen. Die Zentralbank wiederum kann diese Schuldtitel in Form von Banknoten an Geschäftsbanken weiterleiten, indem diese eigene Werte (z.B. Wertpapiere) dagegen eintauschen oder von ihren Depositen bei der Zentralbank abheben. Andererseits kann die Zentralbank Umlaufmittel wieder zurückholen, indem sie die in ihrem Besitz befindlichen Anleihen bzw. Wertpapiere gegen Banknoten verkauft. Auf diese Weise ist heute die Staatsschuld die fast ausschließliche Deckung von Barumlaufmitteln. Den Dollarnoten im Wert von etwa 800 Milliarden, die 2004 im Umlauf bzw. von Geschäftsbanken bei der US-Zentralbank deponiert waren, waren mit 760 Milliarden durch US-Staatsanleihen im Besitz der FED, mit 40 Milliarden durch andere Wertpapiere (z.B. Schulden anderer Staaten) und nur zu 15 Milliarden durch Gold, Edelmetalle bzw. andere Währungen gedeckt (die Differenz stellt das Eigenkapital bzw. den Gewinn der Zentralbank dar). Die Golddeckung des Dollar beträgt nur noch 1,8% (beim Euro sind es etwas unter 10).
Dabei sind Banknoten nur ein kleiner Teil der insgesamt für die Warenzirkulation erforderlichen Umlaufmittel („die Münzen des Großhandels“). Für die Geldmenge M1 rechnet man zum (bei Nicht-Banken umlaufenden) Bargeld als jederzeit verfügbares Umlaufmittel noch die Sichteinlagen von Nichtbanken bei Banken hinzu (z.B. Girokonten). Da wesentliche Transaktionen gar kein Ein- und Auszahlen von den Konten erfordern, sondern über Saldieren von Kontooperationen (Buchgeld) abgewickelt werden, ist es vernünftig, dies zu den Umlaufmitteln hinzuzurechen. Dies ergibt z.B. für die USA 2004 eine M1 von 1.350 Mrd. Dollar.
Zur Geldmenge M2 zählen zusätzlich Termineinlagen mit Laufzeiten unter 2 Jahren bzw. mit Kündigungsfristen von bis zu drei Monaten. Aufgrund ihrer hohen Verfügbarkeit können auch diese Gelder zur Zahlungsbegleichung herangezogen werden. Rechnet man mit M2, so erhöht sich die Geldmenge in den USA 2004 schon sehr stark auf 6.340 Mrd. Dollar.
Zur Geldmenge M3 zählt schließlich zusätzlich vor allem das traditionell rasch diskontierbare Wechselgeschäft. Heutzutage wird dies jedoch wesentlich ersetzt durch Werberechnungen von Geldmarktfonds. D.h. der „Preise“ von Fondsanteilen, die Nichtbanken bei Fonds halten, die in kurzfristige Anlagen investieren. Da diese Fonds unmittelbar an Liquidität gebunden sind, können größere Zahlungen hierüber kostengünstig abgewickelt werden (kurzfristiger Kredit wird hier unmittelbar zum Geldmittel in Form eines Anteilsscheins).
Rechnet man mit M3, so kommt man in den USA 2004 sogar auf eine Geldmenge von 9.400 Mrd. Dollar – fast das 12fache der Bargeldmenge.
Ein Beispiel für Umlaufmittel aus Geldmarktfonds sind „asset backed commercial papers“ (ABCP). Dabei werden kurzfristige Schuldverschreibungen (bis zu 90 Tagen) von speziellen Fondsgesellschaften in Wertpapiere bestimmter Stückelung zusammengefasst und entsprechend den „Kapitalwertformeln“ verzinst. Im Stück können ABCPs als Zahlungsmittel von Schuldner zu Schuldner weitergeleitet werden. Würde die Rückzahlung der zugrundeliegenden kurzfristigen Schulden in Massen nicht erfolgen, würde natürlich eine klassische Geldkrise, wie beim Zusammenbruch des Wechselgeschäfts erfolgen. Daher müssen die Banken, die einen ABCP-Fonds letztlich verwalten, diese durch ihre Reservefonds absichern.
In der aktuellen Finanzkrise sind nicht nur Wertpapiere, die auf längerfristigen Immobilienkrediten basieren (asset backed securities), sondern auch die ABCPs, die auf kurzfristigen Krediten beruhen, massiv von Zahlungsproblemen betroffen. So war der Beinahe-Zusammenbruch der deutschen IKB-Bank vor allem der Tatsache geschuldet, dass diese Bank für die Zahlungsprobleme eines ABCP-Fonds einstehen musste. Somit ist das Finanzsystem in einer solchen Krise in den Zwiespalt zwischen den beiden Monstern Geldkrise und Bankenkrise geworfen.
War früher über das Diskontieren von Wechseln (Diskontsatz) bzw. das Beleihen davon (Lombardsatz) das wesentliche Mittel, über das Zentralbanken im Verkehr mit den Geschäftsbanken den Zinssatz mitbestimmt haben, so stehen heute Wertpapierge-schäfte im Vordergrund. So bestimmt sich der „Leitzins“ der europäischen Zentralbank in einem wöchentlichen Handelstermin, an dem die Geschäftsbanken der Zentralbank Wertpapiere (bestimmter vorgeschriebener „Sicherheit“) zum Kauf anbieten.
Wie oben dargelegt, bestimmt sich der Wertpapierpreis nach dem angenommenen Markzins. In diesem „Hauptrefinanzierungsgeschäft“ feilschen also Zentralbank und Geschäftsbanken unmittelbar um den Zins, der dann den Wertpapierpreis bestimmt. Dieser Zins wird dann Orientierung für alle anderen Zinsen, wie Zinsen für Über-die-Nacht-Einlage oder -Kredit, Beleihung von Wertpapieren, Verzinsung der Mindestreserve (derzeit müssen Geschäftsbanken mindestens 2% ihrer Depositen bei der Zentralbank einlegen).
Damit wird klar, dass der Spielraum von Zentralbanken wesentlich geringer ist, als dies in den Märchen a la „Greenspan und wie sein Geräusper zu verstehen ist“ aufgebauscht wird. Letztlich ist die Bestimmung der Marktzinsen durch die Verhältnisse von Angebot und Nachfrage nach Geldkapital in Relation zur vorhandenen Profitmasse determiniert. Dies wirkt letztlich auch auf die Aushandlung der Leitzinsen – keine Zentralbank kann unter so einem Regime Zinsbewegungen gegen den Markt durchsetzen.
Ein Umsteuern kann unter Umständen in bestimmten zyklischen Momenten möglich sein, wenn es eine entsprechende Einigkeit zwischen Zentralbank und den privaten Banken gibt. Die Vorstellung einer Beeinflussbarkeit des Zinsniveaus durch staatlich-politische Entscheidungen ist daher in einer kapitalistischen Ökonomie mit entwickeltem Finanzsystem im besten Fall naiv zu nennen. Die Zentralbank ist wesentlich ein Organ des Finanzkapitals, das dann wirksam ist, wenn dessen Hauptfraktionen in dieselbe Richtung zielen.
Dabei ist klar, dass die Bestimmung des Zinsniveaus wesentlich ist für die Größe der Geldmenge, in welcher Form auch immer sie gemessen wird. Ein niedriger Zinssatz wird aufgrund der höheren Erlöse im Wertpapierdiskontieren genauso wie in der Höherbewertung der Geldmarktfondspapiere zur Ausdehnung der Geldmenge führen, höhere Zinsen dagegen führen zur Verminderung der Geldmenge. Insofern kann bei gleichbleibender Umlaufgeschwindigkeit das Preisniveau durch diese Geldmarktzinsbewegungen bestimmt werden. Dies natürlich abgesehen von den realen Wertbewegungen (z.B. Verbilligung durch Produktivitätsfortschritte oder billigeren Import) bzw. Steigerung/Minderung von langfristiger Kapitalanlage.
Daher ist nicht die absolute Höhe der Geldmenge von Interesse, sondern die Geldmengenentwicklung im Verhältnis zur Entwicklung der Gesamtakkumulation. So zeigen die langfristigen Statistiken der FED z.B. für die Geldmenge M2 eine bemerkenswerte Parallelentwicklung zum langfristigen Akkumulationstrend. Also etwa eine stark steigende Geldmenge während der Boomjahre der 1950er und 60er. Dagegen in den 1970er und 80ern eine scharfe Geldmengenreduktion.
Dagegen zeigt die Geldmengenentwicklung seit 1990 eine sehr widersprüchliche Tendenz. Mit der Erholung von der Rezession Anfang der 1990er kommt es wieder zu einem Anstieg der Geldmenge. Allerdings sehr unterschiedlich, was die Geldmengenarten betrifft. Setzt man die Geldmenge ins Verhältnis zum Wachstum des preisbereinigten BSP, so blieb M1 bis heute konstant bei etwa bei 10% des BSP. Dagegen explodierten seit etwa 1997 geradezu die Geldmengen M2 und M3. Seit 1980 ist das Verhältnis von M2 zum BSP um 100% gestiegen, das von M3 sogar um 145% (wobei 1997-2003 die Hälfte dieses Anstiegs ausmachten). Insbesondere der Anstieg von M3 belegt eine enorme Ausdehnung kurzfristigen kommerziellen Kredits, der zur Basis einer sich verselbständigenden Geldspekulation geworden ist. Natürlich war dies wesentlich verbunden mit historisch niedrigen Leit- und Marktzinsen für kurzfristige Kredite/Anlagen, die über mehrere Zyklen aufrecht erhalten wurden. Die Geldmengenexpansion ist hier klar eine Funktion der Spekulationsblasen. Die US-Zentralbank hatte (anders als Bundesbank und EZB) kein Interesse, das monetaristische Dogma von der Geldmengenkontrolle umzusetzen. Das US-Finanzkapital – und in seinem Gefolge die FED – hatte offensichtlich kein Interesse, den sich ausweitenden Spekulationsblasen entgegen zu treten.
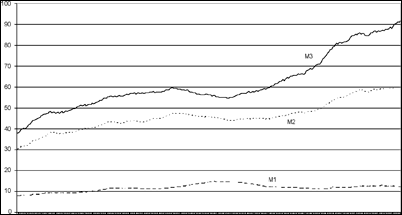
Abbildung 6: Entwicklung der Geldmengen M1-M3 im Verhältnis zum realen BIP – USA 1981-2006
Diese Ausdehnung des monetarisierten kommerziellen Kredits wird ergänzt durch eine entsprechende Volumenssteigerung des Handels an Terminbörsen. Eine Maßzahl hierbei ist die Summe der ausstehenden Forderungswerte, die in Derivaten gehandelt werden. Hierbei wurde 2007 die 500 Billionen Dollar-Grenze überschritten, im Vergleich zu 50 Bill. 1995, bzw. 100 Bill. 2001 (siehe Abbildung 7). Damit erreicht dieser Umsatz fast das 5fache des Weltsozialprodukts. Dies erklärt sich natürlich daraus, dass ein Großteil der Derivate mit Werten von fiktivem Kapital rechnet, also insbesondere „Wetten“ bzw. „Versicherungen“ auf Zins-, Wertpapierpreis-, Währungs- etc. Schwankungen darstellt. Die tatsächlichen Werte, i.e. Schuldforderungen erscheinen hier doppelt oder mehrfach in immer neuen Papieren, auf denen wiederum andere Papiere aufbauen. Während diese Expansion der Derivate auf der einen Seite eine reale Versicherung gegen Marktschwankungen sind – also das Zufriedengeben mit der Aneignung eines Durchschnittszinses oder -profits gegen Zahlung eines „Versicherungsabschlags“ – wird dieses Instrument (wie auch die Geldmarktpapiere) zu einem Spekulationsobjekt. Mit wenig Geldanlage kann in kurzer Zeit mit Termingeschäften großer Gewinn erzielt werden („Hebel-Effekt“, engl. „leverage“) – oder großer Verlust. Aufgrund großer Gewinnerwartung wird das leverage-Geschäft zumeist über Kredit finanziert, zumeist wieder über den Verkauf von Schuldtiteln. Die dabei zu zahlenden Zinsen sollen dabei niedriger sein als der zu erwartende Spekulationsgewinn. Gegenüber dem normalen Bankgeschäft ist die Reserve eines so handelnden Fonds generell sehr gering, oft 10mal kleiner als die großen Summen, die eigentlich über den „Hebel“ bewegt werden. Die Fonds sind daher von zwei Seiten verwundbar: einerseits von unerwarteten Verluste mit den Derivatenpapieren zu Problemen bei der Abwicklung des besicherten Basisgeschäftsführen (Zahlungsprobleme); andererseits können die von den Fonds zur Abwicklung ihrer Geschäfte benutzten Sicherheiten sich nicht mehr zur entsprechenden Kreditfinanzierung seiner Geschäfte eignen.
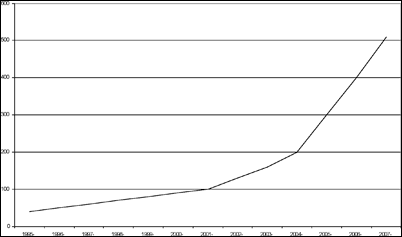
Abbildung 7: Entwicklung des Werts von ausstehenden Kontrakten auf den Derivatenmärkten (in Billiarden USD) – 1995-2007
Die Zahlungsprobleme oder Geschäftsunfähigkeit einer größeren Zahl solcher Fonds führt dann aber wieder dazu, dass die Versicherung der eigentlichen Geschäfte Probleme macht. Also die unmittelbaren industriellen und merkantilen Kapitale entweder versichert geglaubte Geschäfte abschreiben müssen oder für die neu abzuwickelnden Geschäfte Probleme mit der Risikoabsicherung und Kapitalaufbringung bekommen. Auf diese Weise schlägt dann die Geldmarktkrise und der Zusammenbruch von Hedgefonds unmittelbar zurück auf das „Realkapital“.
3.10. Spekulationsblasen
Gewöhnlich entwickelt sich die Geldmenge entlang der längerfristigen Tendenzen der Akkumulation. Andernfalls sind negative Auswirkungen auf die Preisentwicklung zu erwarten (Inflation oder Deflation). Diese können verzögert werden, wenn das überschüssige Geld, das keine profitable Anlage in der reproduktiven Akkumulation findet, andere Anlageformen zur Verfügung hat, die noch eine gewisse Verwertung zu erlauben scheinen. Dafür gibt es gerade in Betreff auf das fiktive Kapital Möglichkeiten. Mit dem Sinken der Profite und den damit fallenden Zinsen ist (wie die Kapitalwert-Fiktion gezeigt hat) ist die Möglichkeit der Steigerung von Wertpapiernotierungen gegeben, falls die Erwartungen auf die Erträge der zugrundeliegenden Schuldforderungen aufrecht erhalten werden können. D.h. wenn die Anleger von „überschüssigem“ Geld, das sich auch noch zu billigem Zins günstig leihen lässt, glauben, dass bestimmte Unternehmen in absehbarer Zeit wieder größere Gewinne machen, wird die Nachfrage nach Anlage in Aktien bzw. Anleihen dieses Unternehmens groß sein (der abgezinste Wert des erwarteten Kapitalertrags übersteigt die Anlagemöglichkeit zum geringen Marktzins). Das aber bedeutet stark steigende Kurse für die Titel des Unternehmens, was weitere Nachfrage erzeugt. Schon haben die Ersteinsteiger bei Verkauf ihrer Wertpapiere einen Gewinn erzielt, der die ersten Erwartungen bestätigt. Dies kann eine kreditgestützte Aktienblase (16) erzeugen, die solange dauert, bis die Erwartungen in solche diese Blase hauptsächlich befeuernden Unternehmen sich offenbar nicht erfüllt haben.
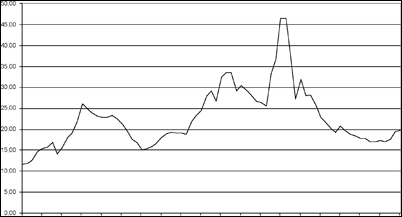
Abbildung 8: Entwicklung des Kurs-Gewinn-Verhältnisses der Aktien des S&P 500 – 1986-2007
Abbildung 8 zeigt die Entwicklung des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) bei Aktien des S&P-500-Index. Dabei wird deutlich, dass zur Zeit der New-Economy-Blase, sich die Kurse stark von den eigentlichen Gewinnsituationen der Unternehmen entfernt hatten. Ein „normales“ KGV um die 15 entspricht (nach der „Rentenformel“) etwa einer Zinsrate von 6%. Die in der Blase erreichten Werte entsprechen dagegen Zinsraten nahe bei 1%!
Dabei ist gerade bei Aktien heute noch eine weitere Erscheinung wichtig. Durch den Aktienrückkauf können gerade Großkonzerne ihre Gewinnsituation einschneidend „verbessern“. Da (besonders durch die heute üblichen Bilanztechniken) die Steigerung von Wertpapierpreisen zu einer positiven „Wertbereinigung“ im Anlagekapital des Unternehmens führt, wird der Eigenkapitalanteil in der Bilanz (noch dazu aufgrund der Einbehaltung eines Teils der Gewinnausschüttung) erhöht und der Gewinn des Unternehmens wird entsprechend „ausgedehnter“ dargestellt. Damit kann auch bei auch schon bröckelnden Gewinnen – meist auch wieder mit niedrig verzinstem Kredit – das Kurs-Gewinn-Verhältnis gehalten werden. Dies wiederum hält die Kurssteigerung aufrecht. Verstärkt wird diese Hauptzielrichtung der Unternehmenspolitik auf Steigerung des eigenen Aktienkurses noch durch die Umwandlung eines Teils des Unternehmergewinns in die Form der Aktienoptionen zur „Leistungsentlohnung“ der Manager.
Das nächste Beispiel des Aufbaus einer spekulativen Blase betrifft Immobilien. Marx hat die Möglichkeit der Revenue-Form der Grundrente daraus erklärt, dass das beschränkte Angebot der Waren, die aus der Kapitalnutzung des Bodens entstehen, gegenüber steigender Nachfrage einen Preis ermöglicht, der nicht in die Ausgleichung der Profitraten eingeht. Die Differenz zwischen Durchschnittsprofit und tatsächlichem Profit kann daher vom Grundbesitzer als Rente angeeignet werden. Analog zum Kapitalwert kann dann mithilfe des Zinses der „Kapitalwert“, d.h. der Grundpreis konstruiert werden.
D.h. mit sinkendem Durchschnittsprofit und sinkendem Zins ergibt sich auch hier bei entsprechender Nachfrage nach Immobilien durch das „überschüssige Geld“ eine Tendenz zum Steigen der Immobilienpreise. Ähnlich wie bei Aktien trägt sich die Spekulation nun selbst, da der steigende Immobilienpreis die Nachfrage weiter anheizt, der Weiterverkauf Spekulationsgewinn erzeugt – und sich wieder der Pyramidenspiel-Effekt einstellt. D.h. Verlierer sind eben die, die am Ende der Blase nicht mehr weiterverkaufen können, wenn der Preis ihres Spekulationsobjekts einbricht. Der Vermögenseffekt ist dann in der Summe Null, nur dass das Vermögen nun ziemlich anders zwischen Gewinnern und Verlierern aufgeteilt ist. Dabei ergibt sich bei Immobilienblasen das Abbrechen der Kette, sowohl wenn die Zinsen wieder zu steigen beginnen, als auch dann, wenn die der Bodennutzung entsprechenden Erträge offenbar durch die hohen Bodenpreise nicht mal mehr den Durchschnittsprofit abwerfen.
Natürlich spielt im gegenwärtigen Kreditsystem nun auch die spezielle Form der Nutzung zinsgünstiger Hypotheken-Kredite eine wesentliche Rolle. Die Steigerung der Immobilienpreise scheint als Sicherheit für zinsgünstige Kredite zu dienen, die nunmehr Kredite mit höheren Zinsen ablösen lassen. Ein „Vermögenseffekt“ tritt ein, der verschuldete Hausbesitzer plötzlich als kreditwürdig erscheinen lässt. Mit der Erwartung sicherer Erträge aus den Hypothekenkrediten werden nun wiederum Schuldforderungstitel auf diese Kredite zu Wertpapieren mit „hochbewerteter Güte“. So konnten in der Immobilienblase nach 2003 diese Schulden im großen Stil als „asset backed securities“ (ASB) von den kreditgebenden Banken als langfristige Anlagepapiere auf dem Kapitalmarkt platziert werden. Auf diese Weise war diese Immobilienblase nicht nur durch das explodierende Immobiliengeschäft gekennzeichnet, sondern auch dadurch, dass dieses eine weitere Anlagemöglichkeit für das vagabundierende Kapital auf den Kapitalmärkten schuf.
Mit der Herausbildung eines globalen, große Handelsvolumina umfassenden Derivatenmarktes ergibt sich ein weiteres Feld für Spekulationsblasen. Ist der Terminhandel in „normalen“ Zeiten eine Absicherung gegen unerwartete Schwankungen, schafft rechtzeitig Liquidität bzw. sendet frühzeitig Nachfragesignale an die Produktion, so kann dieses Instrument des Schutzes vor der Irrationalität des Marktes sich in Krisenzeiten verselbständigen und zum Instrument der Krisenverschärfung werden.
Überschusskapital auf kann sich auf der Suche nach Anlage auch auf diesen Markt stürzen. Nachdem die Preisbestimmung im Terminhandel als Erwartung künftig zu erzielender Preise auf die tatsächliche Preisentwicklung rückwirkt (z.B. durch Lagerbildung, Zurückhaltung bestehender Ware, um später besseren Preis zu erzielen), kann dies zu einer Preiserhöhungsspirale führen, besonders wenn es schon eine Tendenz Richtung Preiserhöhung gibt. Dies ist ganz deutlich in den letzten Monaten bei den Preisen von Öl, einigen Metallen und bestimmter Agrarprodukte zu sehen. Dabei werden die Futures und Optionen auf diese Waren zu Wertpapieren, deren Preis durch große Handelsvolumina (kurzfristige Arbitrage-Gewinne aufgrund ständiger Kurserhöhung) in die Höhe getrimmt wird. Im Unterschied zu Aktien- oder Immobilienblasen, die zu einer Ausdehnung von Kredit auf breiter Basis (was Kapital und mittlere Einkommen betrifft), führt diese Form von Spekulation allerdings dazu, dass für einen großen Teil des produktiven Kapitals (mit Ausnahme derjenigen, die mit diesen Rohstoffen handeln) und die Masse der KonsumentInnen die Kosten in die Höhe schnellen und die Inflation angeheizt wird.
Abbildung 9 zeigt, dass langfristig die Preis-Indizes für Rohstoffe an den Tagesmärkten („Spotmarkt“) sinken. Erst seit zwei Jahren gibt es eine leichte Trendumkehr. Dagegen steigen die Commodity-Future-Indizes kontinuierlich. Der Ausgleich von Marktrisiken, von extremen Preisschwankungen über die Absicherung durch Derivate führt also zu einem spekulativen Preisanstieg, der dem Wertverfall genau entgegen läuft. Dies heizt die Spekulationslust weiter an. In den letzten beiden Jahren hat sich so das Volumen im Handel mit Commodity-Futures fast verdoppelt.
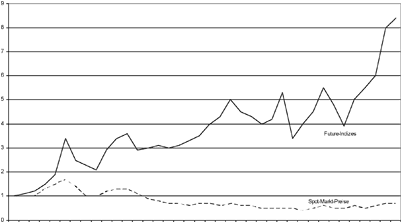
Abbildung 9: Relative Entwicklung der Preisindizes auf Spot-Märkten und derjenigen auf Commodity-Future-Märkten
3.11. Finanz- und Monopolkapital
Während Marx in der Bildung von Aktiengesellschaften noch eine dem Fall der Profitrate entgegenwirkende Ursache sah, da die Aktionäre sich mit einer Form des Zinses (Dividende) zufrieden geben, hat sich dies im Zeitalter konzentrierter Bankenkapitale und spekulationsgetriebener Finanzmärkte ins Gegenteil verkehrt. Dies hat als erster Rudolf Hilferding im 7. Kapitel seines „Finanzkapital“-Buches entwickelt. Hier zeigt er, dass für das moderne Finanzkapital nicht das gemächliche Dividende-Kassieren entscheidend ist, sondern die Schlacht um den Verkaufspreis des fiktiven Anteilskapitals. Dies wird den Banken oder ähnlichen Finanzinstituten möglich durch Vermitteln des Aufbringens von Kapital für Gründungen, Kapitalerweiterung, Übernahmen, Fusionen etc. Die Verwandlung von profittragendem Kapital in zinstrangendes (also die scheinbare Entlastung der Profitrate) wird dadurch erkauft, dass die Vermittler der Kapitalaufbringung immer mehr von der Differenz zwischen Profit und Zins einstreifen können.
Es werde z.B. eine bisher als Personengesellschaft geführte Firma mit einem Kapital von 1 Million Euro, die entsprechend der Durchschnittsprofitrate 15% im Jahr, also 150.000 Euro abwirft, nun in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Ist die Zinsrate 5%, so könnte nun an die Aktionäre eine Dividende von mindestens 50.000 Euro im Jahr ausgeschüttet werden (je nachdem, wie groß die Konkurrenz zwischen festverzinslichen Anlagen und Aktienmarkt ist). Rechnet man zu den Dividenden den fiktiven Unternehmensgewinn hinzu, könnten aber z.B. bis zu 100.000 Euro Anlage-Gewinn abgeworfen werden. Dann würde der „Kapitalwert“ der Gesellschaft jedoch (wie in der Formel der „ewigen Rente“ gezeigt wurde) auf 150.000/0,05 also auf 2.000.000 Euro angesetzt sein (fiktiver Kaufpreis bzw. Emissionswert aller Aktien). Dies übersteigt den tatsächlichen Kapitalbedarf des Unternehmens um eine Million. Wem es also gelingt, den Kapitalwert tatsächlich an der Börse zu realisieren – ob bei Gründung einer AG, bei Verkauf oder Übernahme etc. -, dem gelingt eine Vorabrealisation des noch nicht realisierten Unternehmensgewinns. Wer immer diese Differenz einstreicht, für das produktive Kapital bedeutet dies, dass es den 5%-Zinssatz jetzt nicht auf sein reales Kapital zu zahlen hat, sondern auf die fiktive Kapitalbewertung, die durch die Kapitalaufbringung in die Höhe gezwungen wurde. Es ist das produktive Kapital, das letztlich auch den „Gründungsgewinn“ an die Aktionäre abzustottern hat. Damit ist eine Form gefunden, in der das Finanzkapital auf lange Sicht über den Zins hinaus, sich auch einen Großteil der Profitmasse aneignen kann.
Im entwickelten Finanzmarkt sind Aktienbörsen der schnellste Weg, um rasch hohe Geldmittel für Neugründungen, Übernahmen etc. aufzutreiben. Den Anlegern verspricht das eine Verzinsung ihres Kapitals über Dividenden, die etwas höher als die marktüblichen, aber mit mehr Risiko behaftet sind. Für das produktive Kapital ergibt sich durch die Überbewertung seines fungierenden Kapitals, wie er mit Kapitalwert gegeben ist, eine de facto höhere Verzinsung, die den „Gründergewinn“ der Kapitalaufbringer finanziert.
Dieser Finanzierungsgewinn für Kapitalaufbringung ist – wenn auch in neuen Formen – immer noch eine wichtige Quelle für Profite des Finanzkapitals, wie in der Spekulationsblase der „New Economy“ wiederum der „Gründergewinn“ auf Kosten der von falschen Erwartungen getäuschten Anleger. So auch verstärkt in Aktivitäten von Hedgefonds, die Unternehmen aufkaufen, um ihren „Kapitalwert“ in die Höhe zu treiben. Auch dies kann zu Finanzierungsgewinnen führen, diesmal vor allem auf Kosten des produktiven Kapitals (bzw. der von den Restrukturierungen betroffenen ArbeiterInnen).
Der Finanzierungsgewinn wird neben dem Geschäft mit Spekulationsblasen zu einer Hauptquelle der steigenden Macht des modernen Finanzkapitals. Beides beschleunigt die Konzentration sowohl im Finanzbereich wie beim produktiven Kapital. Einerseits durch tatsächlich gesteigerte Profitaneignung, andererseits durch den finanziellen Ruin potentieller oder tatsächlicher Widersacher. Schließlich und vor allem dadurch, dass mit der marktbeherrschenden Stellung bestimmter Industriekapitale (der „Monopole“), im Monopolprofit eine gesteigerte Quelle der Mehrwertaneignung auch für das zinstragende Kapital entsteht. Durch die mangelnde Ausgleichung der Profitrate, die mit dem Monopolprofit gegeben ist, ergeben sich gesteigerte Möglichkeiten der Finanzierungsgewinne in Erwartung von Extra-Gewinnen durch Trust- oder Kartellbildungen. Letzteres wird daher vom Finanzkapital vorangetrieben.
Damit wächst auch der Kampf um die Kontrolle über die Gesamtakkumulation zwischen Finanzkapital und produktivem Kapital: „Je stärker die Bankenmacht, desto vollständiger gelingt die Reduktion der Dividende auf den Zins, desto vollständiger fällt der Gründergewinn der Bank zu. Umgekehrt wird es starken und gefestigten Unternehmen gelingen, bei Kapitalerhöhungen selbst einen Teil des Gründungsgewinns dem eigenen Unternehmen zu sichern. Es entspinnt sich dann eine Art Kampf um die Verteilung des Gründungsgewinns zwischen der Gesellschaft und der Bank und damit ein neues Motiv für die Bank, ihre Herrschaft über das Unternehmen zu sichern.“ (Hilferding, S. 157)
Hilferding ging davon aus, dass der Kampf um die Finanzierungsgewinne und die Sicherung von Monopolprofiten durch Marktaufteilung notwendig in die Verschmelzung von Banken- und Industriekapital in Form der Kontrolle bestimmter Banken über bestimmte Industriegruppen münden müsse.
Tatsächlich sind große Fondsgesellschaften auf unregulierten internationalen Finanzmärkten noch stärker in der Lage, durch ihre Verkaufs- und Übernahmedrohungen dafür zu sorgen, dass das Industriekapital seine Akkumulations- und Finanzierungsentscheidungen nach den Interessen des Finanzkapitals richtet.
Auch wenn also das „deutsche“ Modell des Finanzkapitals – Verschmelzung von Banken- und Industriekapital unter Hegemonie der Banken – letztlich durch das „US-amerikanische“ – indirekte Kontrolle des Industriekapitals durch die Finanzierungsmacht der Fondsgesellschaften – abgelöst wurde, gilt weiter fundamental: „ Das Finanzkapital, das in wenigen Händen konzentriert ist und faktisch eine Monopolstellung einnimmt, zieht kolossale und stets zunehmende Profite aus Gründungen, aus dem Emissionsgeschäft, aus Staatsanleihen usw., verankert die Herrschaft der Finanzoligarchie und legt der gesamten Gesellschaft einen Tribut zugunsten der Monopolisten auf (…) Der Kapitalismus, der seine Entwicklung als kleines Wucherkapital begann, beendet seine Entwicklung als riesiges Wucherkapital.“ (LW, S. 236f)
Es ist kein Wunder, dass die großen Fondsgesellschaften und Investmentbanken heute einen elitären Kreis bilden, der den Spitznamen „masters of the universe“ trägt. Dieses konzentrierte Wucherkapital bestimmt mit seinen täglichen Milliardengeschäften mit wenigen Tastenbewegungen oft das Schicksal von Millionen von Menschen. Um so größere Erschütterung bedeutet es, wenn einer dieser Sternenkreuzer, wie jüngst im Fall der Investmentbank „Bear Stearns“ geschehen (einer der „Großen 5“), in kürzester Zeit seine Milliarden praktisch in der Luft zerplatzen lässt.
3.12. Internationale Kapitalströme
Die Herausbildung des Kapitalverhältnisses erfolgt zunächst unter Vorraussetzung der Bildung von nationalen Zirkulationssphären, in deren Rahmen die Wertbildung genauso wie die Ausgleichungsprozesse von Profitraten- und Zinsbildung geschehen. Andererseits ist das Kapitalverhältnis von Anfang an auf den Weltmarkt (17) ausgerichtet und drängt in seiner Schrankenlosigkeit über diese Beschränkung der lokalen und nationalen Märkte hinaus. Auf dem Weltmarkt treffen Waren aufeinander, die Resultat unterschiedlicher wertbildender Arbeitsprozesse sind („nationaler Arbeitstag“).
Auch wenn es in gewissem Rahmen zu Ausgleichungsprozessen kommt, so gibt es Beschränkungen, insbesondere in Bezug auf den Arbeitsmarkt, aber auch, was die Struktur von Qualifikationen, Infrastruktur, Monopolbildung, Finanzkapital und staatlicher Organisation betrifft, die immer nur eine Tendenz Richtung Ausgleichung zulassen, und auch, was Wertbildung, Durchschnittsprofitrate als auch Zins- und Rentenstruktur betrifft. Auf dem Weltmarkt treffen also Waren aufeinander, die aus Sphären unterschiedlicher Preisbildungsprozesse und Preisniveaus stammen. Trotzdem gibt es auch auf dem Weltmarkt nur einen Preis für ein und dieselbe Ware – ein Preis, der sich in einem Geld, dem „Weltgeld“ ausdrücken muss. Diese Vermittlung kann nur geschehen, indem der Wechsel des Geldnamens von einer Zirkulationssphäre in die andere durch ein definiertes Wechselverhältnis der nationalen Geldwaren vermittelt ist. Dieses Wechselverhältnis drückt also das unterschiedliche Wertverhältnis der nationalen Arbeitstage aus, ist Maßzahl für die unterschiedlichen Preisniveaus: „Anders auf dem Weltmarkt, dessen integrierende Teile die einzelnen Länder sind. Die mittlere Intensität der Arbeit wechselt von Land zu Land; sie ist hier größer, dort kleiner. Diese nationalen Durchschnitte bilden also eine Stufenleiter, deren Maßeinheit die Durchschnittseinheit der universellen Arbeit ist. Verglichen mit der weniger intensiven, produziert also die intensivere nationale Arbeit in gleicher Zeit mehr Wert, der sich in mehr Geld ausdrückt.“ (MEW 23, S. 583)
Diese unterschiedlichen Gewichtungen nationaler Arbeitsquanta müssen sich also in Bewegungstendenzen der Wertflüsse zwischen den Zirkulationssphären auswirken. Dies kann sich in Handelsüberschüssen, wie auch im Werttransfer durch Einbehalten von Extraprofiten (nicht weitergegebene Preissenkung) vollziehen. Inwiefern sich dies in unterschiedlichen Wechselkursen auswirkt, hängt zwar damit zusammen, ist aber wesentlich bestimmt durch die Bestimmung des Preises der Geldware selbst. Die Wertflüsse im Waren- und Kapitalverkehr sind insofern wesentlich, als sie Angebot und Nachfrage nach der jeweiligen Währung festlegen. Dazu kommen jedoch die Bewegungen auf dem internationalen Geldmarkt. Denn einerseits ist ja der Wert des nationalen Geldes bestimmt durch die Reserven von Zentralbank und den Gläubigern des Geldmarktes. Abbau oder Aufbau dieser Reserven kann daher zum Ausgleich von Zahlungsbilanzungleichgewichten dienen und hat unmittelbarem Einfluss auf den nationalen Geldwert. In Zeiten des Goldstandards bedeutete dies ganz konkret die Bewegung von Gold zwischen Zentralbanken je nach Stand der Leistungsbilanzen. Je mehr sich aber Geld in Kapitalware – in den verschiedenen Gestalten des zinstragenden Kapitals – darstellt, desto mehr wird auch die Dynamik der Geldwertentwicklung durch den Zins bestimmt. Damit werden die für Zirkulationsmittel geltenden nationalen Zinssätze auch wesentlich für die Geldflüsse auf dem Devisenmarkt.
Während heute also im Austausch zwischen den Zentralbanken die Bildung von Währungsreserven wesentlich über das Geschäft mit Staatsschuldpapieren geschieht, so werden kurzfristige Währungsschwankungen stark von den Bewegungen der Geldmärkte bestimmt. Der internationale, nicht mehr über Börsen, sondern nicht-regulierte Netze des Interbankenhandels abgewickelte Devisenhandel, gehört heute zu dem bei weitem umsatzstärksten Tagesgeschäft (3 Bill. Dollar pro Tag; siehe Abbildung 10). Die Devisenreserven der Zentralbanken sind kaum mehr ausreichend, um starken Spekulationswellen gegen bestimmte Währungen entgegen zu wirken.
Abbildung 10 und 11 zeigen auch, dass der Handel an den deregulierten Devisenbörsen hauptsächlich von den imperialistischen Großbanken beherrscht wird (es ist geradezu ein „who is who“ der internationalen Hochfinanz), wobei sich bestimmte Finanzinstitute (wie die Deutsche Bank) auf diesen Markt spezialisiert haben.
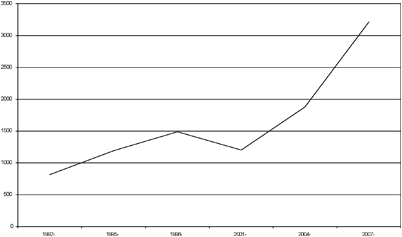
Abbildung 10: Volumen des Tagesumsatzes auf den Deveisen-Austausch-Börsen (in Millarden Dollar) 1992-2007 und Anteil der großen Banken am Devisenhandel (2007)
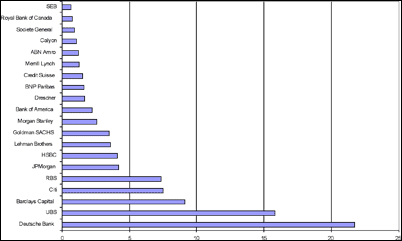
Abbildung 11: Verteilung des Devisenhandels auf Finanzinstitute
Natürlich sind Kreditverhältnisse auch für den internationalen Zirkulationsprozess und seine Erleichterung und Beschleunigung entscheidend. Exportgeschäfte verlangen sowohl stärkere Kreditsicherung als auch Risikoabschirmung. Dies führt natürlich zu einer Ausweitung von Finanzmärkten auf über-nationale Ebene. Mit der Ablösung des Goldstandards (endgültig nach dem Ende von Bretton-Woods Anfang der 1970er) wurde der Dollar als Weltgeld hierbei nicht mehr nur als in US-Konten oder Zentralbanken deponiertes Geld, sondern zunehmend auch in „offshore“-Konten gehorteten Reserven für international agierende Finanzkonzerne zur Basis großer Kreditoperationen.
Exportüberschüsse eines Landes A gegenüber einem Land B bedeuten in der Regel, dass in Land B ein Überschuss an Zahlungsverpflichtungen gegenüber A besteht. Dieser muss sich früher oder später in einem Geldabfluss von B nach A äußern. In der üblichen Zahlungsbilanzstatistik wird daher davon ausgegangen, dass sich Leistungsbilanzsaldo (Saldo von Warenhandel, Dienstleistungshandel und Vermögenstransfers) und Kapitalbilanzsaldo (Saldo von Kapitalexport/import) ausgleichen, sofern dem nicht die Devisenbilanz entgegenwirkt (i.e. Reserveabflüsse stattfinden, Wechselkursänderung). Es gilt daher grob:
Leistungsbilanzsaldo = Kapitalbilanzsaldo + Devisenbilanzsaldo
So wurde das steigende Leistungsbilanzdefizit der USA lange Zeit durch die positive Kapitalbilanz ausgeglichen. Die US-Anlagen im Ausland brachten weitaus höhere Renditen als die immer mickriger werdenden US-Anleihen, die aber z.B. von China und Japan zur Aufrechterhaltung ihres exportgestützten Wachstums weiter gehortet wurden. Seit etwa 2005 wirkt dieser Ausgleichmechanismus nicht mehr so stark, um den kontinuierlichen Sturz des Dollars aufzuhalten.
Während für die Veränderung der Leistungsbilanz z.B. Änderungen von Produktivität, Arbeitsintensität und allgemein des Verhältnisses von Kapital und Arbeit wesentlich sind, sich so also das grundsätzliche Verhältnis der Preisniveaus (bzw. der „Kaufkraftparitäten“) zwischen den Ländern verschieben mag, ist für Kapital- und Devisenbilanz allgemein die Frage der Profit- und Zinserwartungen entscheidend. Natürlich drücken sich auch hier grundlegende Veränderungen in den Kapitalverwertungsbedingungen aus sowie der allgemeine Trend der Kapitalakkumulation. Die Differenz von Zinsniveaus ist wesentlich, sowohl was die Tendenz betrifft, in welchem Land eher langfristig Kapital angelegt wird (z.B. in fremde Staatsschuldpapiere), als auch für die Richtung der Devisenspekulation. Die unterschiedlichen Durchschnittsprofitraten wieder sind wesentlich für die Richtung der produktiven Kapitalanlage (Investition), ob es sich nun um Portfolioinvestition (z.B. Ankauf von Aktienanteilen an Firmen im Ausland) oder um Direktinvestitionen im Ausland handelt.
Mit fallenden Profit- und Zinsraten in den imperialistischen Zentren wächst dort in bestimmten Phasen der Überakkumulation die Tendenz zum Kapitalexport, bei gleichzeitiger Zunahme der Bedeutung von Vermögenstransfers zurück ins Zentrum (als steigenden Posten in der Leistungsbilanz). Zugleich können Großkonzerne auf dem Weltmarkt mithilfe von Monopolpreisen Extraprofite realisieren, die ebenfalls zu einem Werttransfer in die Heimatländer der Konzerne führen. Letzteres erscheint über den höheren Geldausdruck der entsprechenden Ware als Handelsbilanzüberschuss.
Die Struktur der Kapitalströme (internationales Kredit-, Investitions- und Beteiligungssystem), verbunden mit dem entsprechenden Wechselkurs- und Zinsgefüge, vermittelt so eine entsprechende internationale Arbeitsteilung. Es sind letztlich die Bewegungsgesetze der internationalen Kapitalakkumulation, die auch die Waren- und Geldzirkulation auf dem Weltmarkt bestimmen. Mit der Etablierung riesiger Monopole und ihrer Beherrschung durch das Finanzkapital konzentriert in den nördlichen Metropolen und verbunden mit entsprechenden Staatsapparaten ergibt sich ein internationales Regime, das zurecht mit „imperialistisch“ genannt wird. Kapitalexport und Kreditvergabe werden zu Instrumenten der Beherrschung der übergroßen Mehrheit der den Weltmarkt konstituierenden Staaten und ihrer Ökonomien. Die etablierte internationale Arbeitsteilung dient der Sicherung einer möglichst hohen Monopolprofitrate für die Konzerne, entsprechender Zinserträge für das Finanzkapital und der sonstigen zusätzlichen Renten, die in den imperialistischen Staaten damit ermöglicht werden.
Dabei ist der Kapitalfluss zwischen imperialistischen Zentren und Peripherie keineswegs stetig und in beschaulicher Beständigkeit vorzustellen. Tatsächlich gibt es bestimmte, für ganze Phasen der Epoche bestimmende Zeitperioden, in denen eine heftige Welle von Kapitalexporten in ganz bestimmte mehr oder weniger große imperialisierte Regionen erfolgt, meist verbunden mit Spekulationsblasen. Dem folgt eine mehr oder weniger heftige Finanzkrise (z.B. „Schuldenkrise“), die eine ganze Periode einleitet, die v.a. durch Kapitalrückflüsse in die imperialistischen Zentren charakterisiert ist.
3.12.1. Die Periode des klassischen Imperialismus
Im letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts kamen die industriellen Zentren der Weltwirtschaft aus einer langjährigen Stagnation. In dieser Stagnationsperiode waren Monopolisierung und Konzentration des Bankenwesens weit entwickelt. Mit den technologischen Neuerungen in Schwerindustrie, Chemie, Transport- und Kommunikationswesen etc. gab es ein weites Feld für rasante Akkumulation. Gleichzeitig war genug Anlagekapital zu günstigen Zinsen verfügbar. Mit dem Aufschwung der Monopolindustrien ging eine „Explosion“ der Kapitalexporte einher. Wie Lenin ausführlich zeigt (LW 22, S.246), konzentrierte sich dieser Kapitalexport auf die Jahre 1900-1914. Vor dem 1. Weltkrieg wurde in England, Frankreich und Deutschland ein Niveau von Kapitalexport erreicht, das jenes der Mitte des 19. Jahrhunderts fast um das Hundertfache übertraf. Dabei wurde der Kapitalexport vor allem durch Staatsanleihen und Kredite organisiert, die über Regierungen und Bankenkonsortien vermittelt wurden. Dieser Kapitalfluss war mit Bedingungen verknüpft, Infrastruktur-Aufträge an große Industriemonopole der imperialistischen Staaten zu vergeben. Zur Sicherung dieser Kapitalbeziehungen wurde in bestimmten Regionen in ungekanntem Ausmaß zum Mittel des direkten Kolonialismus gegriffen, während anderswo die „Unabhängigkeit“ formal bestehen blieb, aber de facto das Verhältnis von „Halbkolonien“ entstand.
Die Aufteilung der Welt unter diesem imperialistischen Regime musste zu verschärfter Konkurrenz und schließlich zur militärischen Konfrontation führen. Die Krise dieses Regimes war mit dem Ersten Weltkrieg keineswegs gelöst, da die alte Hegemonialmacht Großbritannien nicht mehr eine ihrer politischen Rolle angemessene Kapitalakkumulation aufweisen konnte. Die Kolonialregime Britanniens und Frankreichs erwiesen sich vielmehr immer mehr als Bremse der Akkumulation des Weltkapitals.
3.12.2. Weltwirtschaftskrise und die Ära von Bretton-Woods
Die 1920er sahen einen enormen Anstieg von privaten Investitionen speziell in den USA in Anleihen an lateinamerikanische und osteuropäische Staaten und Deutschland, die durch US-Investmentbanken gebündelt und vermittelt wurden. Diese Anlagen wiederum dienten als Deckung für eine Kreditausdehnung auf Basis niedriger Zinsen. Mit dem Steigen der US-Zinsen Ende der 20er Jahre und den wachsenden Problemen mit der Schuldentilgung bei den Schuldnerstaaten, platzte die Spekulationsblase in der ausgedehnten Finanzkrise nach 1929. Die nächsten Jahre sahen einen gewaltigen Rückfluss an Schuldentilgung, Auflösung von Reserven, sinkenden Wechselkursen und stark ungünstige Terms-of-trade auf Seiten der betroffenen Länder. Insbesondere in Lateinamerika war „Import-Substitution“ eine logische Antwort auf diese Probleme. Ebenso wechselte damit die vorherrschende Form des Kapitalexports in die der Direktinvestition, insbesondere in Landesgsellschaften der US-Konzerne in Lateinamerika.
Doch erst nach dem 2. Weltkrieg und dem Überstehen der damit verbundenen revolutionären Situationen konnte der Imperialismus wieder ein einigermaßen stabiles weltweites Regime etablieren. Die USA waren der eindeutige Hegemon, der Dollar als Weltgeld durchgesetzt. Mit dem Abkommen von Bretton-Woods war ein System fester Wechselkurse gegenüber dem Dollar, seine Goldanbindung und ein Mechanismus des Gegensteuerns gegen Währungsungleichgewichte (IWF = Internationaler Währungsfonds) geschaffen. Die Struktur der Kapitalexporte im Nachkriegsboom war gekennzeichnet vor allem durch einen großen Anstieg von Kapitalexporten zwischen den imperialistischen Zentren USA, Deutschland und Japan, die gleichzeitig große Netze von Landesgesellschaften in den Halbkolonien aufbauten.
3.12.3. Zusammenbruch von Bretton-Woods, Petro-Dollars und die Verschuldungskrise
Anfang der 70er Jahre war die Goldbindung des Dollar längst Fiktion, ebenso das System fester Wechselkurse. Mit dem Zusammenbruch von Bretton-Woods verlor die US-Zentralbank die Kontrolle über einen Teil der weltweiten Dollarguthaben. Durch das Entstehen der großen offshore-Dollarguthaben („Petrodollars“ genannt, da ihre Quelle oft in ölexportierenden Ländern lag) in den 1970ern wurde mit dem Ende des Nachkriegsbooms eine neue Periode der Kreditvergabe in großem Stil an lateinamerikanische und asiatische Staaten eingeleitet. Diesmal waren es vor allem Geschäftsbanken in den imperialistischen Zentren, sofern sie über diese Dollarreserven verfügten, die diese Verschuldungswelle in Gang hielten. Wieder war die Richtungsänderung der US-Zinsen der Auslöser für eine massive „Schuldenkrise“ Anfang der 80er-Jahre. Das Resultat ist bekannt: die Interessen der betroffenen Gläubigerstaaten wurden kombiniert durch den IWF vertreten und führten zu mindestens einem Jahrzehnt eines harten „Entschuldungsregimes“ in Lateinamerika und Asien. Als Konsequenz des Endes von Bretton-Woods und der Verschuldungskrise müssen halbkoloniale Länder nun einerseits große Währungsreserven in Dollar, Yen oder Euro halten, andererseits restriktive Haushaltspolitik betrieben, um nicht Opfer massiver Spekulationswellen gegen ihre Währung oder ihren Anleihemarkt zu erleiden. Nach Stieglitz müssen so gerade die ärmsten Entwicklungsländer um die 2% ihres BIP zur Finanzierung ihrer Währungsreserven aufwenden. Das ist etwa das Vierfache der „Entwicklungshilfe“, das hier in nutzlose US-Staatsanleihen etc. auszulegen ist. Mit dem schwächelnden Dollar bedeutet das überdies, dass die eigene Währung noch viel stärker als der Dollar fallen wird.
3.12.4. Die Ära der deregulierten Finanzmärkte
Schließlich setzte mit der Erholung der US-Konjunktur Anfang der 1990er eine Welle sehr hoher Portfolio- und Direkt-Investitionen speziell in Asien, aber auch z.B. in Mexiko ein und eröffnete die „Globalisierung“. Diesmal waren es wieder vor allem Privat- bzw. institutionelle Anleger aus den internationalen Finanzzentren, die in Aktien, Wertpapiere bzw. Derivate von Basiswerten in den halbkolonialen Ländern investierten. Daher konnte mit den in der IWF-Periode einstudierten Maßnahmen das Platzen der Spekulationsblase 1995 in Mexiko („Tequilla-Krise“) und 1997 in Thailand (als Auslöser der „Asienkrise“) nicht verhindert werden.
In der Kapitalzuflussperiode 1990-94 spielten „offizielle“ Schulden (z.B. Staatsanleihen) kaum mehr eine Rolle (nur noch 11% des Kapitalzuflusses). Auch die Geschäftsbanken spielten eine weitaus geringere Rolle als in der Periode 1978-81. Entscheidend waren einerseits Deregulierungen in den Halbkolonien (z.B. Privatisierungen), die Direktinvestitionen in die Höhe schnellen ließen. Andererseits war es die wachsende Verbriefung internationaler Kapitalschulden (also die Deregulierung der internationalen Finanzmärkte), die es ermöglichte, offshore-Anlagen auch ohne staatliche Absicherung gegen Risiken abzuschirmen (z.B. Ausweitung des Derivaten- und Devisenmarktes).
Als die Phase der niedrigen Zinsen und des niedrigen Dollarkurses Mitte der 1990er zu Ende ging, ebbte der Kapitalzufluss ab, wie auch das exportorientierte Wachstum z.B. in Asien durch die Anbindung der Währungen an den Dollar in Schwierigkeiten geriet. Da half keine restriktive Haushalts- bzw. Hochzinspolitik mehr. Offshore-Banken, Investmentbanken, Hedgefonds, Derivaten- und Devisenhändler erzeugten eine massiven Spekulationsblase, die letztlich die betroffenen Währungen in die Knie zwangen und tief verschuldete Privat-Unternehmen in den Halbkolonien hinterließen. Der Kapitalfluss bewegte sich fortan massiv in Richtung USA, während in den von der Finanzkrise betroffenen Ländern eine neue Welle der Firmenübernahmen bzw. Kapitalvernichtung durch das imperialistisches Finanzkapital vor sich ging.
Spiegelbildlich zur Asienkrise und zur Entwicklung der Schuldenblase in den USA begann das chinesische „Exportwunder“. Voraussetzung dafür war die nur beschränkte, kontrollierte Öffnung für Direktinvestitionen, bei einem weiterhin stark regulierten chinesischen Finanzmarkt. Damit konnte lange Zeit sowohl eine Aufwertung der chinesischen Währung verhindert werden, als auch Exportüberschüsse in großen Dollarreserven in China gehalten werden. Mit dem Platzen der Immobilienblase in den USA, der massiven Dollarabwertung, den Preissteigerungen auf den Rohstoffmärkten sind diese für China günstigen Bedingungen inzwischen ins Gegenteil umgeschlagen.
3.13. Konjunkturzyklus und zinstragendes Kapital
Kapitalakkumulation vollzieht sich unter der Bedingung, dass sich der gesellschaftliche Gesamtzusammenhang der Produktionsakte in der Zirkulation nur zufällig, im Nachhinein ergibt. Die unterschiedlichen Kapitalumschlagszeiten, die Zufälligkeit der Erfüllung der Reproduktionsbedingungen, Lohnsteigerungen mit Überhitzung der Akkumulation, schließlich der tendenzielle Fall der Profitrate (sobald auch die Profitmasse nicht mehr wächst) führen zu regelmäßigen zyklischen Einbrüchen der Akkumulationsbewegung. Wie gezeigt, ermöglicht die Geldökonomie über ihre verschiedenen Kreditinstrumente, dass es nicht nur zu zeitweiligen Disproportionen, sondern zu allgemeiner Überproduktion kommt. Diese „mittelfristigen Konjunkturzyklen“ von 5-10 Jahren sind für die Kapitalakkumulation eien notwendige Bereinigung, in der sich die Wertgesetzlichkeit, bis hin zum Wegräumen der Hindernisse für den Profitratenausgleich, durchsetzt. Erneuerung des Kapitalstocks, Zentralisation der Kapitale wie auch Vernichtung von überschüssigem, weniger profitablen Kapitals sind wesentlich durch die Abfolge von Rezession und Aufschwung vermittelt. Insofern wirkt die zyklische Krise auch der allgemeinen Zusammenbruchstendenz der Akkumulationsbewegung entgegen.
Die Rolle des Kredits ist entscheidend für die Durchsetzungsform des Konjunkturzyklus (wenn sie auch nicht seine eigentliche Ursache ist). Erst durch ihn kann das ungleichgewichtige Wachstum trotz fallender Profite bis zu dem Punkt ausgedehnt werden, wo dies zu allgemeinen Zahlungsproblemen führt. Die Krise wird so zuerst auf den Geld- und Kapitalmärkten offenbar, um dann durch die Kontraktion des Kredits zu den entsprechenden Einbrüchen im produktiven Sektor zu führen. Mit der Vernichtung von Kapital, dem Drücken der Löhne und der Verbilligung des Kredits während des Abschwungs werden die Bedingungen dafür hergestellt, dass Investitionen wieder profitabel und finanzierbar werden. Damit entsteht auch wieder Nachfrage nicht nur im Investitionsgütersektor, sondern auch in der Konsumtion. Die Akkumulation setzt wieder voll ein, während die dabei vorausgesetzten Profitabilitätsbedingungen nur langsam erodieren. Mit dem Steigen der Löhne, dem wachsenden Kapitalbedarf für Kapitalersatz, Überfüllung der Märkte etc. beginnt dann der Konjunkturaufschwung sich abzuschwächen, bis er wieder in Überproduktion und Kreditklemme mündet.
Bevor das Banken- und Finanzsystem voll entwickelt war, brachte die Zahlungskrise am Ende des Zyklus jeweils eine bedrohliche Geldkrise hervor. Wechsel wurden massenhaft entwertet bzw. konnten nur mit Verlust diskontiert werden. Damit kam es zudem zu einem beträchtlichen Mangel an Zirkulationsmitteln und zum panikartigen Run auf „bares Geld“. Mit einem entwickelten Banken- und Finanzsystem werden Liquiditätsprobleme frühzeitiger durch Zinsbewegungen und Kursbewegungen bei Wertpapieren oder Derivaten spürbar. Die Reserven der Banken lassen eine Geldkrise vermeiden und führen die Situation schneller über in die Phase der Kreditklemme.
Insofern werden Zinsbewegungen auf den Geld- und Kapitalmärkten zu wesentlichen Momenten im Konjunkturzyklus. Im gewöhnlichen Konjunkturzyklus ist am Ende einer Krise das Angebot an Anlagekapital (Überhang der Ersparnisse) gegenüber der Nachfrage groß und der Zinssatz somit sowieso schon gegenüber einer sanierten Profitrate niedrig. Es sind also zuerst die Kapitalkredite, die mit einem Wiederanspringen der Investitionen verstärkt nachgefragt werden. Die langfristigen Zinssätze – sowohl was Kredite, als auch was Anlage betrifft – werden also gewöhnlich als erste wieder anziehen. Wird die Finanzierung mehr durch Kapitalaufnahme auf den Börsen bewerkstelligt (siehe „Gründergewinn“), so mag sich dies stattdessen auch in stark steigenden Kursen niederschlagen, weniger in Kapitalmarktzinsen.
Mit der Belebung der Konjunktur steigt die Nachfrage nach kommerziellem Kredit bzw. Geldmarktkredit. Dieser wiederum beschleunigt die Umschlagsgeschwindigkeit des zirkulierenden Kapitals und wirkt befördernd auf die Akkumulation. Zugleich spült die wachsende Akkumulation zu Rücklagezwecken immer mehr Kapital in die Geldmärkte. Erst mit dem Stocken der Konjunktur, dem verstärkten Abzug von Kapital für Ersatzinvestitionen, schließlich dem Aufrechterhalten von Nachfrage bzw. der Sicherung von Zahlungsfähigkeit über kurzfristige Kredite etc. wächst zwangsläufig auch der Druck auf kurzfristige Zinsen.
Die Zinsbewegung ist also nicht der Grund für den Konjunkturabschwung. Dieser liegt vielmehr in den fundamentalen Schranken der Kapitalakkumulation in Bezug auf Verwertung der Investitionsgüter und des Konsumtionsfonds der Lohnabhängigen. Diese Schranke vermittelt sich jetzt nur anders: in der wachsenden Verteuerung von Kapital- bzw. Konsumkrediten.
Es ist klar, dass sich der Zusammenbruch der Konjunktur zuerst und scharf im kurzfristigen Kredit äußern muss, dort nimmt er auch die Form des Eklats oder der Liquiditätsklemme an. Dies führt also einerseits zum Zwang, Geld „um jeden Preis“ zu leihen, um Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen, was die kurzfristigen Zinsen explosionsartig in die Höhe schießen lässt. Das aber verschärft die Krise noch. Gerade angesichts gesunkener Profite wirken gestiegene Zinsen erlahmend auf die Investitionstätigkeit und zwingen auch zum Verkauf der Lager um jeden Preis. Mit der Bereinigung der Krise – Zusammenbrüche, Entwertung von Kapital, Preisverfall etc. – bricht auch die Nachfrage nach Kredit ein, besonders was kommerziellen Kredit betrifft. Die kurzfristigen Zinssätze, die später gestiegen sind, werden also in der Umkehrbewegung schneller wieder fallen. Dies ist auch der einzige Moment, wo Zentralbankintervention (in Bezug auf Geldmarktpolitik) und staatliche Ausgabensteigerung einen beschleunigenden Effekt auf die Konjunkturerholung haben kann. Wie schon gezeigt, sind Zentralbanken jedoch wesentlich bloße Nachvollzieher von Zinsbewegungen der Kapitalmärkte. Genauso wie die Zinslasten der Staatsverschuldung – und damit das Finanzkapital – die „Konjunkturpolitik“ des bürgerlichen Staates entscheidend bestimmen.
Diese Verlaufsform von Konjunkturzyklus und Zinsbewegung kann empirisch für die Zyklen in der Periode des Nachkriegsaufschwungs gut nachvollzogen werden. Tatsächlich ändert sich dies jedoch mit der Krise 1973/74, d.h. mit dem Einsetzen der Periode der allgemeinen Überakkumulation.
3.14. Finanzkapital und die langfristigen Tendenzen der Kapitalakkumulation
Nicht nur bei der zyklischen Durchsetzung von Verwertungsbedingungen und Durchschnittsprofitrate spielt das Kreditsystem eine wesentliche Rolle. Über die Zyklen hinaus sind allgemeine Gesetzmäßigkeiten der Kapitalakkumulation wirksam, die durch ihre Verbindung mit der Akkumulation des zinstragenden Geldkapitals verstärkt werden. Steigende Wertzusammensetzung des produktiven Kapitals, wie die Methoden zur relativen Mehrwertsteigerung führen zum tendenziellen Fall der Durchschnittsprofitrate bei gleichzeitigem enormen Wachsen der absoluten Profitmassen. Diese doppelte Gesetzmäßigkeit bedingt zunächst eine Periode der sich über mehrere Zyklen immer mehr beschleunigenden Akkumulation. Zyklische Einbrüche ermöglichen jeweils das zeitweise Wirksamwerden von entgegenwirkenden Ursachen zum Profitratenfall.
In der Periode der langfristig beschleunigten Akkumulation wird auch die Beschleunigung des Kapitalumschlags auf immer höhere Stufenleiter gebracht. Dies umfasst die Verkürzung von Zirkulationsphasen z.B. durch die Ausweitung der entsprechenden Geldmarktkredite. Aber genauso auch die Aktivierung brachliegenden Reservekapitals für Erweiterungs- bzw. Ersatzinvestitionen mithilfe von Kapitalmarktkrediten.
Die Periode der beschleunigten Akkumulation ist immer auch eine Periode der Ausweitung des Kredit- und Bankensystems, letztlich einer enormen Verwandlung von disponiblen Reserven in zinstragendes Geldkapital. Damit einher geht – und dies umsomehr, als es zu Stockungen oder Wachstumspausen kommt -, dass der Anteil des zinstragenden Kapitals als Input in der Kapitalbewegung des reproduktiven Kapitals immer größer wird. Auch diese Wachstumsperioden des Kapitals sind Perioden, in denen sich die Verwandlung von selbstständigem fungierenden Kapital in ein solches unter Kontrolle von zinstragendem Kapital (Kapital als Eigentumstitel) weiter vollzieht. Dies wird in den Bilanzen der Unternehmen deutlich im Anwachsen der „Fremdmittel“ gegenüber dem „Eigenkapital“ bzw. auf der Seite der Aktiva durch das Anwachsen des „Forderungsvermögens“ gegenüber den Sachanlagen.
Das bedeutet, dass das zinstragende Kapital gegenüber dem fungierenden Kapital immer mehr an Gewicht zunimmt. Am deutlichsten muss sich dies darin äußern, dass die Zinsquote, der Anteil, den die reproduktiven Unternehmen von ihren Profiten als Zinsen abzuliefern haben, kontinuierlich steigt.
Neben dem tendenziellen Fall der Profitrate kann die Tendenz zur Steigerung der Zinsquote als weitere Gesetzmäßigkeit einer kombinierten Real- und Geldkapitalakkumulation festgestellt werden. Wie schon gesagt, muss dies nicht eine Tendenz zum Zinsratenanstieg bedeuten (solche Gesetzmäßigkeiten hat Marx für das zinstragende Kapital wie schon dargestellt abgelehnt); es heißt aber, dass die Zinslast relativ zur Profitmasse immer drückender wird.
Damit ist die widersprüchliche Bedeutung des zinstragenden Kapitals in der beschleunigten Akkumulation entwickelt. Einerseits verstärkt es die Akkumulationsbewegung durch Verkürzung von Umschlagszeiten, Beschleunigung der Zirkulation, Verstärkung der bereinigenden Wirkungen des Zyklus etc., andererseits verschärft es das Problem der Profitratenentwicklung durch die wachsende Last der Zinsquote, also ein schnelleres Sinken der Rate des Unternehmensgewinns gegenüber der Profitratenentwicklung.
Diese widersprüchliche Bewegungsform muss den zugrundeliegenden Widerspruch der Realkapitalakkumulation – Entwicklung der Produktivkräfte zur Beschleunigung der Kapitalakkumulation findet im Kapital und seiner Verwertbarkeit selbst seine Schranke – auf eine neue Ebene heben. Mit der wachsenden Beschränktheit der Realakkumulation und der damit verbundenen immens gestiegenen gesellschaftlichen Ausdehnung des zinstragenden Kapitals, wird das Kapital notwendigerweise versuchen, die Geldkapitalakkumulation von den Schranken der Realakkumulation zu befreien.
Dass der Finanzmarkt letztlich vom Gesamtreproduktionsprozess des produktiven Kapitals abgeleitet ist, hindert die Kapitalform nicht daran, auch fiktives Kapital zum Ausgangpunkt beschleunigter Akkumulation zu machen. Es heißt nur, dass am Ende das Produktivkapital die Rechnung zu bezahlen hat.
Damit werden die bereits dargestellten Formen von Spekulationsblasen zum Fortsetzungspunkt für die ins Stocken geratende Realakkumulation: spekulative Kapitalexporte, Devisenspekulationen, Immobilien- und Aktienblasen, Spekula-tionswellen auf den Terminbörsen etc. sind Folgen der Überakkumulation.
Die strukturelle Überakkumulation von Kapital bringt den Widerspruch zwischen Produktivkräften und Produktionsverhältnissen in einer dem Kapitalismus eigenen Form zum Eklat. Die Entwicklung der Produktivkräfte ist für die Kapitalverwertung zu groß geworden, das gesteigerte Produktivergebnis lässt sich nicht mehr in einer Weise realisieren, die zu einer profitablen Erweiterung der Produktion führen könnte, die Akkumulation erlahmt aufgrund eines Überflusses an produktivem Kapital, der zugleich als Mangel an investiertem Geldkapital erscheint. Das Einsetzen der Periode der strukturellen Überakkumulation bedeutet, dass mit dem Profitratenfall nun auch das Wachstum der Profitmassen zu stagnieren beginnt und die Akkumulationsrate zyklenübergreifend immer geringer wird.
Auf den Finanzmärkten erscheint diese Situation widersprüchlich: einerseits muss mit der lahmenden produktiven Investitionstätigkeit die Nachfrage nach langfristigen Krediten zurückgehen, andererseits steigt der Bedarf an Zahlungsmittelkrediten bzw. Entschuldungen. Weiter sinkt auch die Bereitschaft zur Bereitstellung von langfristigen Investitionskrediten, während die Kriterien für Geldmarktkredite restriktiver werden. Schließlich entsteht eine Masse an Überschuss-Kapital, das nach profitabler Anlage außerhalb der stockenden Akkumulationsbereiche sucht.
Das paradoxe Resultat ist also, dass sich einerseits das Angebot an Leihkapital insbesondere für das Produktivkapital verknappt und dessen Zahlungsprobleme verschärft. Dieser Mangel an Geldkapital ist gleichzeitig mit einem Überschuss von Geldkapital kombiniert, das in andere Anlageformen drängt.
Die Lösung dieses Widerspruchs hat sowohl eine prozessuale als auch eine strukturelle Komponente.
Was die Struktur des Überschuss-Kapitals betrifft: Schon in der beschleunigten Akkumulation entwickelt sich ein Unterschied im Gewicht des zinstragenden Kapitals für verschiedene Formen des Produktivkapitals, der sich mit Einsetzen der Überakkumulation wesentlich vertieft. Während die Fremdfinanzierung der Klein- und Mittelbetriebe noch gravierender wird, können die großen Kapitalgesellschaften – relativ – auf eine größere Eigenkapitaldeckung zurück greifen. Sie sind daher von der Verknappung des Leihkapitals weniger betroffen. Ihren Kapitalbedarf können sie dagegen verstärkt über Wertpapier-Emissionen decken, womit sie auch ihre Profitrate entlasten können. Dagegen steigt die Verschuldung der Klein- und Mittelbetriebe und die Spielräume für Akkumulation sinken. Vernichtung von Kapital in diesen Sektoren bzw. ihre Übernahme durch Kapitalgesellschaften setzt Geldkapital frei, das zu Massen in spekulative Anlagen, z.B. in die Wertpapieremissionen der Kapitalgesellschaften, fließt. „Die sog. Plethora des Kapitals bezieht sich immer wesentlich auf die Plethora von Kapital, für das der Fall der Profitrate nicht durch seine Masse aufgewogen wird (…) oder auf die Plethora, welche diese, für sich selbst zu eigener Aktion unfähigen Kapitale den Leitern der großen Geschäftszweige in der Form des Kredits zur Verfügung stellt.“ (MEW 25, S. 261)
Dabei verstärkt sich dieser Trend dadurch, dass sich die großen Kapitalgesellschaften immer mehr in reine Holdings mit hoher Eigenkapitaldeckung wandeln, die ihre risikoreichen oder mit hohen Beständen fixen Kapitals belasteten Bereiche in kleinere oder mittlere Betriebe ausgliedern. Diese haben dann nicht nur hohe Anforderungen, was Renditeablieferung an die Muttergesellschaft betrifft, sondern meist auch noch die Zinslasten hoher Fremdfinanzierung zu tragen. So wird die allgemeine Entwicklung der Profitrate durch märchenhafte Eigenkapitalrenditen der „blue chips“ vollkommen verschleiert und der Ausbeutungsdruck auf die betroffenen Beschäftigten in den Satellitenbetrieben extrem verschärft.
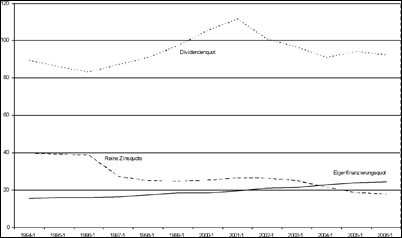
Abbildung 11: Entwicklung des Anteils von Fremd- und Eigenzinsen am Bruttoproft (ohne Berücksichtigung der eigenen Zinseinkommen) von Nicht-Finanziellen Kapitalgesellschaften – Deutschland 1991-2007
Abbildung 12 zeigt, wie in den letzten Jahren die Eigenfinanzierungsquote deutscher Konzerne gestiegen ist, allerdings von einer enorm hohen Zinsquote ausgehend. Diese Steigerung geht großteils zurück auf das obere Viertel der Kapitalgesellschaften. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um eine Umschichtung von klassischer Kreditfinanzierung auf Finanzierung über Kapitalemission, die die Eigenkapitalisierung der Unternehmen erhöht – bei unverminderter Abgabenlast an das Finanzkapital (über Dividenden und Vermögensentnahmen; siehe Abbildung 4).
Schließlich ist auch klar, dass die großen Monopole der Finanz- und Industriekonzerne weiterhin in den imperialistischen Metropolen konzentriert sind. Das strukturelle Ungleichgewicht, was Fremdfinanzierung betrifft, stellt sich daher auch als verstärkte Überschulung bzw. Abhängigkeit von Unternehmungen der halbkolonialen Welt gegenüber den Metropolenkonzernen dar, genauso wie auch hier größere Massen an Überschusskapital entstehen, die zur Anlage insbesondere in den Metropolen bereit sind.
Bezüglich der Bewegungsform nimmt mit dem Einsetzen der strukturellen Überakkumulation die Bedeutung des Konjunkturzyklus ab. Die zyklische Krise tritt zwar weiterhin auf, aber die Erholung ist bei weitem nicht mehr so ausgeprägt. Damit ist auch die Rolle des Kredits und der Zinsbewegung bei Ab- und Aufschwungperioden wesentlich modifiziert (siehe Abbildung 3). Weder bedeutet eine Rezession unbedingt scharf steigende Zinsen, noch die Aufschwungperiode ein starkes Absinken des Zinsniveaus. Vielmehr entstehen angesichts der Bewegungen des Überschusskapitals eigene Finanzmarktzyklen, die sich in spezifischer Weise mit den Konjunkturzyklen verbinden.
Das Einsetzen der Überakkumulationsperiode wird allgemein mit Mangel an Leihkapital, Starre der Zinsen nach unten (Zinsen steigen zwar im Konjunkturabschwung, fallen aber nicht wieder entsprechend im Aufschwung), verstärkter Anlage in Wertpapieren der großen Monopole, verstärktem Kapitalexport verbunden sein. Diese Phase ist mit starker Kapitalvernichtung, Nachfragerückgang und hohem Sparzwang der (Staats-)Haushalte verbunden. Mit der Entwicklung größerer Spekulationsblasen kann sich jedoch über längere Zeit auch eine niedrigere Zinsrate trotz schwacher Konjunktur halten. Zu deren Aufrechterhaltung müssen notwendigerweise nach dem Platzen einer Spekulationsblase rasch neue Felder für Anlagekapital gefunden werden. Ansonsten droht wieder das Absinken in Hochzinsphase und Kreditklemme, da sich ansonsten die konjunkturelle Stagnation mit einer die Vermögen auffressenden Inflation kombinieren muss.
Findet längerfristig keine Überwindung des Überakkumulationsproblems statt, bleibt also das anlagesuchende Kapital in Spekulationszyklen gefangen und das produktive Kapital ohne Aussicht auf beschleunigte Akkumulation, droht der Finanzmarktzyklus in den Crash zu münden und der Geschäftszyklus sich in der Depression ganz aufzulösen. Wie die 1930er Jahre zeigen, haben, ist dies nicht der Zusammenbruch des Kapitalismus, aber eine Form seiner Krise, die er nur mit furchtbaren Verlusten für die Menschheit überwinden kann.
4. Aktuelle Entwicklung und Struktur von Real- und Geldkapitalakkumulation
Die Periode der beschleunigten Akkumulation nach 1948 endete mit weltweit synchronisierten Rezessionen 73/74. Etwa zur selben Zeit brach das weltweite Währungssystem von Bretton-Woods zusammen. Mit dem Einsetzen der strukturellen Überakkumulation einher ging zunächst eine Steigerung des öffentlichen Kredits in den imperialistischen Zentren kombiniert mit einer ersten spekulativen Kapitalexport-Welle („Petro-Dollars“). Diese Mittel änderten letztlich nichts an den fundamentalen Problemen, sondern verschärften sie nur zur Stagflation und einer weiteren weltweit synchronisierten Rezession Anfang der 1980er.
Anders als in der Phase der beschleunigten Akkumulation ging nach überstandener Rezession das Zinsniveau nicht im erwarteten Ausmaß zurück (siehe Abbildung 3). Damit war die Phase von hohen Zinsen, Austeritätspolitik und massiver Kapital-vernichtung eingeleitet. Besonders in den Halbkolonien bedeutete dies das Massaker der „Verschuldungskrise.“ Durch konjunkturelle Differenzierung zwischen USA, Deutschland und Japan kam es zwischen diesen imperialistischen Zentren zu Kapitalflüssen, die die kapitalvernichtenden Tendenzen der Austeritätspolitik abmilderten. Tatsächlich führte z.B. die Konjunkturabschwächung Mitte der 1980er nicht zu einem entsprechenden weiteren Zinsanstieg (siehe wieder Abbildung 3). Dies war die Grundlage für eine erste Spekulationsblase auf den Aktienmärkten, gefolgt vom Börsensturz 1987. Damit war das Ende der regulierten Finanzmärkte eingeläutet, mitsamt der Wiederkehr von Finanzmarktzyklen und ihren Krisen. Die Überwindung dieser ersten Nachkriegs-Finanzkrise führte zu massiven Firmen- und Bankenzusammenbrüchen, kombiniert mit einer scharfen, bereinigenden Rezession in den USA Ende des Jahrzehnts.
Tatsächlich konnten die USA aus dieser Phase Anfang der 90er Jahre gestärkt hervorgehen. Allerdings war die Erholung der Profitrate von beschränkter Dauer und der Aufschwung dort war mit einem starken Niedergang in Japan (Jahrzehnt der Depression) und einer stagnativen Entwicklung in Deutschland (und Kontinental-europa) verbunden. Die Deregulierungen im Rahmen des Verschuldungsregimes der 1980er hatten gleichzeitig die Märkte in wichtigen asiatischen und lateinamerikanischen Ländern für einen enormen Aufschwung an Finanzinvestitionen geöffnet. Die US-Aufschwungsblase war also verknüpft mit einer neuen, speziell über US-Finanzmärkte vermittelten, Kapitalexportwelle nach Asien und Lateinamerika.
Mit dem Platzen dieser ersten großen „Globalisierungs“-Spekulationsblase in der „Asienkrise“ 1997 konnten die USA einen Großteil der frei werdenden Anlagemittel in der nächsten Spekulationsblase, dem Aktienboom der „New Economy“ an sich ziehen. Somit konnte trotz weltweiter konjunktureller Schwäche das Zinsniveau in den USA weiterhin niedrig gehalten werden, ohne eine Kapitalflucht befürchten zu müssen.
Wie in Abbildung 3 ablesbar (die Zahlen für die USA sind noch klarer), sehen wir seit Mitte der 90er Jahre – selbst durch Rezessionen kaum durchbrochen – eine klare Tendenz zum Sinken der Zinsraten. Wie wir schon in Abbildung 4 zur Entwicklung der Unternehmensgewinne dargestellt haben, hat diese Abnahme der Zinsbelastungen keineswegs zu einer Abnahme der Belastungen des produktiven Kapitals durch das Finanzkapital geführt. Hier zeigt sich vielmehr der Wechsel des Finanzkapitalregimes: weg von der „Fremdfinanzierung“ durch Kredite bei Geschäftsbanken, zugunsten der Kapitalaufbringung über Börsen, Fonds und Investmentbanken. Hinter der größeren „Eigenfinanzierung“ (siehe Abbildung 12) versteckt sich so tatsächlich eine größere Macht der Kapitalmärkte als „Anteilseigner“ (verstärkter Zwang zur Ausrichtung auf den „shareholder-value“).
Ende der 1990er konnte besonders China die Rolle der schwächelnden asiatischen Tiger bzw. lateinamerikanischen „Schwellenländer“ übernehmen und zum Billigimporteur des immer stärker kreditfinanzierten US-Marktes werden. Sowohl das Platzen der New-Economy-Blase 2000 als auch die Rezession 2001 konnten diese neue weltwirtschaftliche Achse USA-China nicht untergraben. Es war kein anderer Finanzmarkt als die USA in Sicht, in den das spekulative Anlagekapital in großer Quantität hätte fließen können; Japan, China und die EU-Kapitale stützten weiter nach Kräften den US-Finanzmarkt. Die Zinsen konnten niedrig bleiben und der nächste Spekulationsboom (diesmal die Immobilienblase) beginnen.
Außerdem wurde nun auch wieder auf erhöhte Staatsausgaben, insbesondere im Rahmen des „Kriegs gegen den Terror“, als Konjunkturbeschleuniger zurück gegriffen. Die inflationären Tendenzen hielten sich (siehe für Deutschland Abbildung 2) aufgrund der billigen China-Ware in Grenzen.
Kehrseite dieser 15 Jahre Scheinprosperität in den USA ist eine enorme Verschuldung bei Privathaushalten, Staat, Unternehmen usw. (Siehe Tabelle 12f Seite 73f in dieser Ausgabe), eine aufgeblasene Kreditgeldmenge (siehe Abbildung 6; mit riesigen Reserven, die vor allem in China und Japan gehalten werden) und eine weitere Zerstörung der produktiven Basis des US-Kapitals. Greenspans Hoffnung (19), dass Niedrig-Zinsen und „Vermögensinflation“ kombiniert mit billiger China-Arbeitskraft zu einem Investitionseffekt im produktiven US-Bereich, also zu Profitbedingungen für beschleunigtes Wachstum führen würden, haben sich nicht erfüllt.
Mit dem Platzen der Immobilienblase 2007 ist das Problem von Unterkapitalisierung der Realakkumulation und Überkapitalisierung der Geldkapitalakkumulation nun nicht mehr so einfach lösbar wie 2001. Die in der Folge eingetretenen Abschreibungen insbesondere von US-Finanztiteln haben die Attraktivität des US-Finanzmarktes geschwächt, der Dollar ist im freien Fall und die Spekulationswelle auf den Terminbörsen schwächt zusätzlich die Konjunktur. Zusätzliche Kreditspritzen über Zinssenkungen und Staatshilfen sind auf den Finanzmärkten verpufft. Tatsächlich gibt es in den imperialistischen Zentren allenthalben steigende Zinsen, kombiniert mit weiterhin steigender Inflation.
Gleichzeitig ist China zur Währungsaufwertung (Inflation, Rohstoffpreise, fallender Dollar) gezwungen. Damit fallen wesentliche Bedingungen für eine weitere US-Aufschwungblase weg. Die USA könnten sich vor einem Absturz, wie ihn Japan in den 90ern erlebt hat, nur durch eine neue Aufschwungswelle im produktiven Sektor retten, der angesichts des niedrigen Dollars die USA wieder zu einem starken produktiven Exporteur machen würde. Dies verschärft sicherlich den Konkurrenzkampf mit China, aber auch mit Kontinentaleuropa und dem wieder erholten Japan. Dollarentwertung und steigende Rohstoffpreise sind dabei offensichtlich auch scharfe Waffen gegen die Konkurrenz, erstere ist auch ein günstiges Entschuldungsprogramm. Dazu kommt, dass die Verbriefung von Verschuldungstiteln sowieso die Risiken der hohen US-Verschuldung weltweit gestreut haben. Zum Teil ist Finanzkapital außerhalb der USA genauso stark von Abschreibungen betroffen wie einheimisches.
Leidtragende dieser Entwicklung sind insbesondere ärmere Halbkolonien, deren Währungsreserven entwertet werden (und damit unter Abwertungsdruck stehen), die voll von den steigenden Rohstoffpreisen getroffen werden und in der verschärften internationalen Konkurrenz auf sich verengende Absatzmärkte treffen.
Insgesamt haben die 15 Jahre der US-Schuldenökonomie zu einer massiven Stärkung des monopolistischen Finanzkapitals geführt. Konzentration und Zentralisation des Finanz- und Monopolkapitals haben nochmals eine neue Qualität erreicht. Damit ist auch die Zinsquote (ob nun unmittelbar als Zinsen oder als Finanzierungsaufwand gegenüber den Kapitalmärkten), die auf dem produktivem Kapital lastet, weiter gestiegen. Angesichts der stagnierenden Realakkumulation bedeutet dies einen starken Druck auf Lohn- und Sozialbedingungen genauso wie auf die Einnahmenseite des Staates (zur Aufrechterhaltung von Profitbedingungen bei steigender Zinslast bzw. Renditeanforderungen zur Aktienkursstabilisierung). Die so erzeugten „Sachzwänge“ in Bezug auf Tarif- und Sozialpolitik werden noch ergänzt durch den allgemeinen Deregulierungsdruck. Dieser betrifft sowohl Privatisierungen und die Aufhebung von Handels- und Investitionsbeschränkungen, als auch die Umwandlung der beträchtlichen Sozialversicherungsgelder in zinstragendes Kapital unter Kontrolle der Finanzmärkte.
Nachdem die Arbeiterklasse weltweit die Kosten der Überwindung der Inflation als dem ersten Ausdruck der Überakkumulationsperiode zu schultern hatte, sind sämtliche Effekte dieser Sanierungspolitik in den Spekulationsblasen der letzen 20 Jahre wieder begraben worden. Das Gespenst der Inflation verbindet sich nun mit dem unsicherer Arbeitsverhältnisse und einer noch einmal verstärkten „Sanierungspolitik.“ Es ist offenbar: Die strukturellen Krisenprobleme des Kapitalismus lassen sich in ihren Auswirkungen auch für die Massen in den imperialistischen Kernländern nicht mehr abmildern und beschönigen.
5. Finanzkapital und Sozialismus
Die schon immer eingeschränkten Handlungsmöglichkeiten staatlicher Politik gegenüber den Finanzmärkten sind nochmals geschrumpft: Währungsverschie-bungen, Zinsentwicklungen, Kapitalströme, Geldmengen, Inflationstendenzen etc. werden heute im wesentlichen von den internationalen Finanzmärkten bestimmt. Dabei ist der Begriff „internationale Finanzmärkte“ eine versachlichte Umschreibung von Entscheidungsträgern, die durchaus Name und Adresse haben. Gerade mit der starken Konzentration des Finanz- und Monopolkapitals sind es die großen Investmentbanken, die mit den mit ihnen eng verknüpften Fonds (die die Interessen der Finanzinvestoren bündeln) und die immer mehr als Finanzholdings agierenden Großkonzerne, die diese Fundamentalgrößen der Real- und Geldakkumulation bestimmen. Die Rolle von Zentralbanken oder solcher Institutionen wie IWF oder Weltbank ist darauf geschrumpft, die Interessen dieser eigentlichen Akteure zu artikulieren und zu koordinieren – also möglichst als ideeller Gesamt-Finanzkapitalist aufzutreten. Besteht diese Einigkeit zwischen den Finanzzentren nicht, so sind auch die Maßnahmen dieser Institutionen im unwirksam.
Insofern sind auch alle Maßnahmen, die zur Reform dieser Institutionen gefordert werden illusorisch. Eine politische Kontrolle der Zentralbanken wird genauso wenig eine andere Zins- und Währungspolitik durchsetzen können, wie der IWF als Instrument für Kapitaltransferbeschränkungen wirksam werden kann. Genauso utopisch ist angesichts der Interessenlage der Finanzzentren die Forderung (z.B. von J. Stiglitz (20)) nach einem neuen globalen Finanzregime a la Bretton-Woods angesichts der gegenwärtigen Dollarkrise. Die Forderung, bestimmte Handelsobjekte dem spekulativen Zugriff von Börsen zu entziehen (die schon Keynes erhoben hatte), scheitert an der Internationalisierung und Virtualisierung der heutigen Börsengeschäfte – sie kann auf jeden Fall nicht in einem einzelnen Land umgesetzt werden. Ähnliches kann von vielen anderen Forderungen nach Re-Regulierung der Finanzmärkte und ihrer Beziehung zu den reproduktiven und staatlichen Sektoren gesagt werden.
Schon Lenin warnte in seiner Imperialismus-Broschüre vor der „kleinbürgerlich-demokratischen Opposition“ gegen den Imperialismus, die der eigenen Arbeiterklasse einen reformierten, befriedeten Imperialismus verspricht – ganz gleich, welche Auswirkungen dies insbesondere in den imperialisierten Regionen hat. Dies ist letztlich eine verkappte Verteidigung des Imperialismus, „indem sie die völlige Herrschaft des Imperialismus und seine Wurzeln vertuschen, dafür aber Einzelheiten und nebensächliche Details in den Vordergrund zu rücken versuchen, um durch ganz unernste ‚Reform’projekte von der Art einer Polizeiaufsicht über die Trusts oder Banken u.a. die Aufmerksamkeit vom Wesentlichen abzulenken.“ (LW 22, S. 291)
Das Wesentliche ist auch nicht die Frage der Zentralbankzinssätze, der Regulierung der Börse oder der Einführung von Kapitaltransfersteuern etc. Die gegenwärtigen Rahmenbedingungen für Lohnkämpfe und Sozialpolitik sind nicht Resultat mangelnder politischer „Eindämmung“ der Finanzmärkte. Wir befinden uns keineswegs in einem neuen „finanzmarktgetriebenen Akkumulationsregime,“ d.h. in einer Phase der beschleunigten Akkumulation, die durch parasitäres Verhalten des Finanzkapitals am „Abheben“ bzw. an einer „gerechteren Verteilung“ gehindert wäre. Wir befinden uns weiterhin und verstärkt in der Epoche des Finanz- und Monopolkapitals, in der Perioden der beschleunigten Akkumulation wie der Boom nach dem 2. Weltkrieg die Ausnahme darstellen.
Dagegen ist die heutige Situation weiter bestimmt durch die Grundprobleme einer strukturellen Überakkumulation von Kapital, was zu tendenzieller Stagnation und Verschärfung der Konkurrenz auf den Weltmärkten führt. Die Rolle des Finanzkapitals in dieser Situation ist die des kapitalistischen Krisenmanagements. Es schafft Umorganisationen, Zentralisierungen und zeitweise Anlagemöglichkeiten für kurzzeitige enorme Scheinblüten, die dem Kapital – zu welchen Kosten für die Werktätigen der Welt auch immer – das Überleben in bestimmten Zeitfristen ermöglicht. Dies wird von Zyklus zu Zyklus prekärer, schließt aber letztlich nicht eine mögliche Erholung nach einer gravierenden Crash-Phase (siehe 30er/40er Jahre) aus.
Das Finanzkapital ist also nicht einfach ein parasitärer Pfropf auf einer ansonsten „gesunden“ Realökonomie („Heuschreck“). Es ist vielmehr als ein den kapitalistischen Zusammenbruchstendenzen entgegenwirkender Faktor ein Mittel des Krisenmanagements, das aber in wichtigen Momenten selbst zum Krisenverstärker wird. Als Krisenmanager entwickelt das Finanzkapital die dem Kapital selbst innewohnenden Kräfte der (internationalen) Vergesellschaftung auf immer höherer Stufenleiter. Insofern haben sowohl Lenin als auch Hilferding die progressive Rolle der fortgeschrittenen Vergesellschaftung im Finanz- und Monopolkapital als Moment des Übergangs zum Sozialismus betont.
Das gesellschaftliche Dasein des Reichtums in der kapitalistischen Produktions-weise erscheint in ihr als ein Ding, eine Sache, eine Ware etc. außerhalb der wirklichen, produktiven Elemente des gesellschaftlichen Reichtums. Wie sich dies zunächst im Geld manifestiert, so später in den verschiedenen Formen des Kredits. „Der Kredit, als ebenfalls gesellschaftliche Form des Reichtums verdrängt das Geld und usurpiert seine Stelle. Es ist das Vertrauen in den gesellschaftlichen Charakter der Produktion, welches die Geldform der Produkte als etwas nur Verschwindendes und Ideales, als bloße Vorstellung erscheinen lässt.“ (MEW 25, S. 588) Genauso unvermeidlich muss in der Krise die dingliche Form, die Geldform des gesellschaftlichen Reichtums wieder manifest werden. Hiermit „tritt also der Umstand, dass die Produktion nicht wirklich als gesellschaftliche Produktion der gesellschaftlichen Kontrolle unterworfen ist, schlagend hervor in der Form, dass die gesellschaftliche Form des Reichtums als ein Ding außer ihm existiert.“ (ebd., S. 589)
Mit dem entwickelten Finanzsystem, seinem weltumspannenden Informations- und Planungssystem, das heute in Sekundenschnelle Millionen von wirtschaftlichen Entscheidungen trifft, ist tatsächlich ein enormes Ausmaß an Vergesellschaftung von Produktionskontrolle erreicht. Dass diese gleichzeitig weiterhin durch die Form des Privateigentums bestimmt ist, muss sich darin äußern, dass diese Vergesellschaftung zugleich verbunden ist mit der privaten Aneignung des kontrollierten Reichtums in dinglicher Form – was sich im Finanzsystem gerade in Krisenzeiten wieder in massiver Entgesellschaftung äußern muss. Es zeigt sich, dass „mit der Entwicklung des Kreditsystems die kapitalistische Produktion diese … dingliche und phantastische Schranke des Reichtums und seiner Bewegung beständig aufzuheben strebt, sich aber immer wieder den Kopf an dieser Schranke einstößt.“ (ebd., S. 589)
Erst die tatsächliche Vergesellschaftung des Finanzsystems befreit es von dieser dinglichen Schranke, von seiner Rückbindung an die Geldform. Seine Funktionen der ökonomischen Informationsverarbeitung, der zentralen Allokation von ökonomischen Ressourcen, der gesellschaftlichen Buchführung etc. müssen von einer selbstorganisierten Assoziation der ProduzentInnen mit mindestens demselben Grad der Vergesellschaftung in einem System der bewussten gesellschaftlichen Planung fortgeführt werden. Angesichts des heute immer stärker verflochtenen und komplex zusammenhängenden Produktions- und Zirkulationssystems ist die Vorstellung eines „Sozialismus in einem Lande“ eine reaktionäre Utopie – genauso wie das Predigen der kleinen Kommunen-Netze mit ihren zinslosen Krediten. Sozialismus wird nur international und mit dem umfassenden Ausmaß von Vergesellschaftung des modernen Finanzkapitals sein – oder er wird gar nicht sein!
Literaturreferenzen
(Brenner) – Robert Brenner, „Boom & Bubble“, Hamburg, 2002.
(Busch) – Klaus Busch, „Die multinationalen Konzerne. Zur Analyse der Weltmarkt-bewegung des Kapitals“, Frankfurt, 1974.
(Grossmann) – Henrik Grossmann, „Das Akkumulations und Zusammenbruchs-gesetz des kapitalistischen Systems“, Leipzig, 1929.
(Hein) – Eckhard Hein, „Geld, effektive Nachrage und Kapitalakkumulation“; Ber-lin,1997.
(Heinrich) – Michael Heinrich, „Die Wissenschaft vom Wert“, Münster, 2003.
(Hilferding) – Rudolf Hilferding, „Das Finanzkapital“, Berlin, 1947 (Nachdruck von 1910).
(Krüger) – Stephan Krüger, „Allgemeine Theorie der Kapitalakkumulation“, Ham-burg, 1986.
(LW22) – Wladimir Illich Lenin, „Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapita-lismus“, Lenin Werke Band 22, Berlin 1981 (Nachdruck von 1916).
(MEW23) – Karl Marx, “Das Kapital. Band 1“, Marx Engels Werke Band 23, Berlin, 1989.
(MEW24) – Karl Marx u. Friedrich Engels, “Das Kapital. Band 2“, Werke Band 24.
(MEW25) – Karl Marx u. Friedrich Engels, “Das Kapital. Band 3“, Werke Band 25.
(MEW26) – Karl Marx, “Theorien über den Mehrwert”, Werke Band 26.
(Rubin) – Isaak Illich Rubin, „Studien zur Marxschen Werttheorie“, Frankfurt 1974 (Nachdruck von 1924)
(Wolf) – Dieter Wolf, „Der dialektische Widerspruch im ‚Kapital’“, Hamburg 2002.
Fußnoten
(1) siehe genauer dazu: G.Lukacs, „Der junge Hegel“, S.375f..
(2) siehe dazu insbesondere den Überblick über Hilferdings Schriften in der Einleitung zu (Hilferding, „Das Finanzkapital“, Berlin 1947) von F. Oelssner.
(3) Zu I.I.Rubin: siehe vor allem Isaak Illich Rubin, „Studien zur Marxschen Werttheorie“, Frankfurt 1974 (ursprünglich erschienen 1924 in russischer Sprache); inwiefern Rubin zurecht von den „monetären Werttheoretikern“ als ihr „Urahn“ herangezogen wird, soll hier nicht weiter besprochen werden; ebenso müssen die Kontroversen um die „abstrakte Arbeit“ (insbesondere, ob dieser Begriff nur in der kapitalistischen Epoche Sinn macht) auf folgende Artikel verschoben werden. Siehe zu dieser Diskussion insbesondere: Dieter Wolf, „Der dialektische Widerspruch im ‚Kapital’“, Hamburg 2002.
(4) siehe Michael Heinrich, „Die Wissenschaft vom Wert“, Münster 2003.
(5) siehe Eckahard Hein, „Geld, effektive Nachfrage und Kapitalakkumulation“, Berlin 1997.
(6) W.I.Lenin, „Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus. Gemein-verständlicher Abriss“, Lenin Werke Band 22, Berlin 1960.
(7) zitiert aus: J.M. Keynes, „Collected Works“, Band 29, S.81f; London, 1979.
(8) Die Definition der Geldmenge M3 wird später, im Kapitel über das Kreditgeld, näher erläutert. Sie umfasst stark zirkulierendes Bargeld ebenso, wie bereitgestelltes Geldmarktkapital, das für größere Zahlungen an wenigen Tagen im Jahr verwendet wird. Die Geldmengenstatistik ist der Web-Seite der deutschen Bundesbank entnommen (von 1995-1999: Umrechnung der DM-Menge in Euro; danach: deutscher Beitrag zur Euro-M3-Menge): www.bundesbank.de.
(9) Verbraucher- und Erzeugerpreisindex (letzteres für das produzierende Gewerbe) und Sparquote sind der GENESIS-Onlinedatenbank des deutschen Statistischen Bundesamtes entnommen (www.destatis.de). Das Geldmengenwachstum der „Langen Reihe“ Rubrik von www.bundesbank.de. Die grafische Aufbereitung erfolgte mit Microsoft Excel™.
(10) Dieses Kapitel ist eine Zusammenfassung der allgemeinen Tendenzen der Kapitalakkumulation. Es ist insbesondere wegen der Bedeutung der Durchschnittsprofitrate, des Gesetztes vom tendenziellen Fall der Profitrate und der Monopolisierungstendenzen für die folgenden Kapitel als Voraussetzung notwendig. Unsere aktuelle Analyse des Imperialismus und seiner Entwicklungstendenzen findet sich im Artikel „Imperialismus, Globalisierung und der Niedergang des Kapitalismus“. Auf empirisches Material wird daher in diesem Kapitel verzichtet.
(11) Henryk Grossmann, „Das Akkumulations- und Zusammenbruchsgesetz des kapitalistischen Systems“, Leipzig 1929. Grossmanns Krisentheorie entwickelt einen klaren Zusammenhang von Marxscher Krisentheorie und der grundlegenden Zusammenbruchstendenz. Von Revisionisten wird er gern als „Fundamentalist“ verteufelt.
(12) die Zinssatzreihen sind der „Langen Reihe“ Rubrik von www.bundesbank.de. Die grafische Aufbereitung erfolgte mit Microsoft Excel™. Die BIP-Wachstumsraten sind der GENESIS-Onlinedatenbank des deutschen Statistischen Bundesamtes entnommen (www.destatis.de)
(13) Zu den in diesem Artikel angeführten finanzmathematischen Zusammenhängen und Formeln, siehe genauer: Jürgen Tietze, „Einführung in die Finanzmathematik“, Wiesbaden, 2006.
(14)siehe ebd., S.381f..
(15) siehe dazu gängige Volkswirtschaftslehrbücher wie: Dennis Paschke, „Grundlagen der Volkswirtschaftslehre“, Heidenau, 2000; S.267f..
(16) siehe zum Beispiel die Beschreibung der „New Economy“-Spekulationsblase in (Brenner, S.163f.).
(17) zur Diskussion um das werttheoretische Verständnis der Weltmarktbewegung des Kapitals, siehe: Klaus Busch, „Die multinationalen Konzerne“, Frankfurt, 1974
(18) siehe: Joseph Stieglitz, „Die Chancen der Globalisierung“, Hamburg, 2006; S.311.
(19) siehe: Allen Greenspan, „Mein Leben für die Wirtschaft“, Frankfurt, 2007 (englisch: „The Age of Turbulence“); insbesondere: Kapitel 20: „Das Rätsel“.
(20) siehe: Joseph Stieglitz, „Die Chancen der Globalisierung“, Hamburg, 2006; insbesondere S.324f.: „Ein neues System der Weltwährungsreserven“.






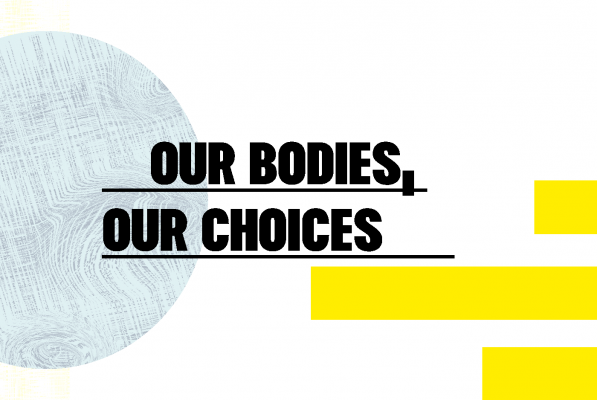



2 thoughts on “Finanzkapital, Imperialismus und die langfristigen Tendenzen der Kapitalakkumulation”