Zur “Revolutionären Realpolitik” der Linkspartei: Revolution oder Transformation?

Martin Suchanek, Neue Internationale 279, Dezember 2023 / Januar 2024 ursprünglich veröffentlich im Dezember 2016
Die Berliner LINKE koaliert mit dem Segen der Parteispitze, Bodo Ramelow führt eine Rot-Rot-Grüne Koalition in Thüringen an.
In der Luxemburgstiftung, dem hauseigenen Think Tank, wollen sich deren Vordenker:innen mit der platten Rechtfertigung dieser Politik oder gar den unvermeidlichen Verrätereien durch Teilnahme an den Regierungen allein nicht zufriedengeben. An etlichen Stellen kritisieren sie sogar die allzu euphorischen Anhänger:innen rot-roter oder rot-rot-grüner Koalitionen offen, zu viele Zugeständnisse an die „Partner:innen“ zu machen.
Das ist nicht nur selbstgefälliger, entschuldigender Gestus linker Theoretiker:innen angesichts der unvermeidlichen Niederungen reformistischer Regierungspolitik. Es geht ihnen auch darum, der Partei eine höhere strategische Ausrichtung zu verleihen. Dazu prägen sie seit Jahren Begriffe wie „Transformationsstrategie“, „revolutionäre“ oder „radikale Realpolitik“, um die Programmatik der Linkspartei als eine moderne Version einer „sozialistischen Partei“ zu präsentieren.
Es ist immerhin ein Verdienst dieser politisch-ideologischen Richtung, dass sie in den Veröffentlichungen der Stiftung ihre Anschauungen darlegt; so z. B. in der Broschüre „Klasse verbinden“, herausgegeben im April 2016 vom US-amerikanischen Magazin Jacobin und der Luxemburg-Stiftung, oder im Aufsatz „Rückkehr der Hoffnung. Für eine offensive Betrachtungsweise“ von Michael Brie und Mario Candeias.
Revolutionäre „Realpolitik“
Seit Jahren wird neben Antonio Gramsci ausgerechnet Rosa Luxemburg als Patin für die „Transformationsstrategie“ der Linkspartei ins Feld geführt.
Sie selbst verwendet den Begriff „revolutionäre Realpolitik“ unter anderem in der Schrift „Karl Marx“, die anlässlich seines 20. Todestags verfasst wurde:
„Es gab vor Marx eine von Arbeitern geführte bürgerliche Politik, und es gab revolutionären Sozialismus. Es gibt erst mit Marx und durch Marx sozialistische Arbeiterpolitik, die zugleich und im vollsten Sinne beider Worte revolutionäre Realpolitik ist.
Wenn wir nämlich als Realpolitik eine Politik erkennen, die sich nur erreichbare Ziele steckt und sie mit wirksamsten Mitteln auf dem kürzesten Wege zu verfolgen weiß, so unterscheidet sich die proletarische Klassenpolitik im Marxschen Geiste darin von der bürgerlichen Politik, dass bürgerliche Politik vom Standpunkt der materiellen Tageserfolge real ist, während die sozialistische Politik es vom Standpunkt der geschichtlichen Entwicklungstendenz ist.“ (Luxemburg, Werke, Band 1/2, S. 375)
Und weiter: „Die proletarische Realpolitik ist aber auch revolutionär, indem sie durch alle ihre Teilbestrebungen in ihrer Gesamtheit über den Rahmen der bestehenden Ordnung, in der sie arbeitet, hinausgeht, indem sie sich bewusst nur als das Vorstadium des Aktes betrachtet, der sie zur Politik des herrschenden und umwälzenden Proletariats machen wird.“ (Ebenda, S. 376)
Luxemburg betont zwar, dass Reform und Revolution nicht als ausschließende Momente einander entgegengestellt werden dürfen, hält aber zugleich fest, dass die Revolution das entscheidende Moment dieses Verhältnisses darstellt. Nur in Bezug auf diesen Zweck kann eine revolutionäre (Real-)Politik bestimmt werden.
Sie grenzt sich daher gegen zwei politische Fehler innerhalb der Arbeiter:innenbewegung ab: einerseits den utopischen Sozialismus, andererseits die bürgerliche Realpolitik. Der Revisionismus oder Reformismus des 20. und 21. Jahrhunderts stellen letztlich Spielarten dieser bürgerlichen Realpolitik dar.
Das Revolutionäre an Luxemburgs „Realpolitik“ besteht genau darin, dass sie den Kampf für Reformen als Moment des Kampfes um die revolutionäre Machtergreifung des Proletariats bestimmt.
„Real“politik ist revolutionäre Politik in dem Sinne und Maß, wie eine Partei ihre Taktik auf einem wissenschaftlichen Verständnis der inneren Widersprüche des Kapitalismus und deren Entwicklungslogik aufbaut. Daraus ergibt sich, dass die Revolution nicht „jederzeit“ als reiner Willensakt „gemacht“ werden kann, sondern eine tiefe Krise des Gesamtsystems voraussetzt, eine Zuspitzung der inneren Widersprüche, die zu ihrer Auflösung drängen.
Innere Widersprüche
Für Luxemburg (und generell für den Marxismus) zeigt die Analyse der inneren Widersprüche des Kapitalismus zweitens, dass die Arbeiter:innenklasse in der bürgerlichen Gesellschaft noch keine neue, eigene Produktionsweise vorfindet, die sie mehr und mehr ausbauen könnte, sondern dass vielmehr die gegenteilige Entwicklung prägend ist. Der innere Widerspruch zwischen zunehmend gesellschaftlicher Produktion und privater Aneignung spitzt sich zu in der Konzentration des Reichtums in den Händen einer immer kleineren Schicht von Kapitalbesitzer:innen.
Genau deshalb greift Luxemburg auch Bernsteins Idee an, dass Genossenschaften, selbstverwaltete Betriebe und der zunehmende Kampf der Gewerkschaften für soziale Verbesserungen Schritt für Schritt zum Sozialismus führen könnten. Allenfalls stellen sie begrenzte Hilfsmittel zur Verbesserung der Lage der Klasse dar und können, im Fall der Gewerkschaften, Mittel zur Selbstorganisation und für die Entstehung von Klassenbewusstsein werden. Für sich genommen sprengt der gewerkschaftliche Kampf jedoch nicht den Rahmen des bestehenden Systems der Lohnarbeit (und erst recht nicht tun dies selbstverwaltete Betriebe).
Schließlich greift sie die darauf aufbauende, korrespondierende Vorstellung des Revisionismus an, dass der Parlamentarismus, die Sammlung einer numerischen Mehrheit bei Wahlen, Mittel zur erfolgreichen „Transformation“ der Gesellschaft sein könnten. Im Gegenteil: Luxemburg erblickt in der Integrationskraft des bürgerlichen Parlamentarismus auch eine Basis für das Vordringen der bürgerlichen „Realpolitik“ in der Arbeiter:innenbewegung, über „sozialistische“ Regierungen auf dem Boden der bürgerlichen Gesellschaft mehr und mehr den „Sozialismus“ einführen zu können.
Für sie hingegen zielt „revolutionäre Realpolitik“ wesentlich auf den Übergang der politischen Macht von einer Klasse auf die andere, durch das Zerbrechen der bürgerlichen Staatsmaschinerie, den Übergang der Macht an die Arbeiter:innenräte, auf die Diktatur des Proletariats.
Was die Luxemburg-Stiftung aus Luxemburg macht
Die Theoretiker:innen der Linkspartei rekurrieren zwar gern auf Luxemburgs Begrifflichkeit und präsentieren ihre Strategie so, als würde sie ihr Verständnis von Reform und Revolution aufgreifen.
Dieser Schein wird nicht nur durch Entstellungen ermöglicht, sondern auch durch einen anderen Ausgangspunkt der Theorie Bernsteins und der aktuellen Theoretiker:innen der Luxemburg-Stiftung untermauert. Bernstein behauptete, dass sich Marx und Engels in ihrer Analyse der inneren Widersprüche des Kapitalismus geirrt hätten, dass diese nicht nur ihr Tempo überschätzt, sondern auch ihre grundlegende Entwicklungsrichtung verkannt hätten. Demgegenüber hält Luxemburg mit Marx und Engels an der grundlegenden Krisenhaftigkeit des kapitalistischen Systems und der ihm innewohnenden Tendenz zum Zusammenbruch fest.
Zu Recht weist sie darauf hin, dass die Leugnung dieser Schlussfolgerungen aus der Marxschen Analyse des Kapitals einer Preisgabe des wissenschaftlichen Sozialismus gleichkommt. Die Überwindung des Kapitalismus stellt dann keine gesellschaftliche Notwendigkeit mehr dar, sondern kann nur moralisch begründet werden.
Anders als Bernstein geht die Luxemburg-Stiftung von einer Systemkrise des Kapitalismus aus.
„Die strukturelle Krise ist nicht gelöst und sie lässt sich im alten Rahmen auch nicht lösen. Die Versuche, den Finanzmarkt-Kapitalismus zu stabilisieren, verlängern nur die Agonie und zerreißen die Europäische Union und unsere Gesellschaften. Die Situation ist jedoch nicht durch Aufbruch gekennzeichnet, vielmehr gilt ein altes Zitat von Gramsci: ‚Das Alte stirbt, das neue kann nicht zur Welt kommen. Es ist die Zeit der Monster.’“ (Brie/Candeias)
Das obige Zitat zeigt aber auch eine Differenz zur marxistischen Analyse. Aus den Fugen geraten ist nicht der Kapitalismus als System, sondern nur der „Finanzmarktkapitalismus“. Bei aller verbalen Radikalität wird so ein theoretisches „Hintertürchen“ für eine reformistisch gewendete „revolutionäre Realpolitik“ geöffnet.
Hinzu kommt, dass der Kapitalismus zwar in einer historischen Krise stecken mag, eine sozialistische Revolution jedoch der Partei auch ausgeschlossen erscheint. Was bleibt also? Eine „Transformationsstrategie“. Was steckt aber hinter diesem unschuldigen Wort? Sind nicht auch revolutionäre Marxist:innen dafür, erkennen sie nicht auch an, dass der revolutionäre Bruch mit dem Kapitalismus eine ganze Periode des Übergangs einschließt, dass nicht alle überkommenen gesellschaftlichen Verhältnisse und vor allem nicht die tradierte grundlegende Arbeitsteilung der alten Gesellschaft mit einem Schlag „abgeschafft“ werden können? Standen nicht die frühe Kommunistische Internationale und der Trotzkismus auf dem Boden eines Programms von Übergangsforderungen, das den Kampf für Reformen in eine Strategie zur Machtergreifung einbettet?
Genau diese Ausrichtung ist bei der Luxemburg-Stiftung nicht gemeint.
Da die sozialistische Revolution, die revolutionäre Machtergreifung der Arbeiter:innenklasse als unmöglich, fragwürdig erscheint, bezieht sich das Ziel der Transformation nicht auf das der „revolutionären Realpolitik“ einer Rosa-Luxemburg, sondern darauf, dass die „Linke“ sich auf einen „Macht“wechsel auf dem Boden des Parlamentarismus vorbereiten müsse.
„In einer offenen Krisensituation entsteht eine radikal neue Situation, in der sich die Eliten spalten, ein Richtungswechsel möglich wird – hin zu einem autoritären Festungskapitalismus wie aber auch hin zu einer solidarischen Umgestaltung. Die Linke muss sich jetzt vorbereiten, daran arbeiten, dass sie fähig wird, in eine solche Situation überzeugend einzugreifen. Darauf ist sie nicht eingestellt.“ (Brie/Candeias)
Wir möchten nicht widersprechen, dass die Linke auf diese Situation nicht vorbereitet ist. Entscheidend ist jedoch, dass die TheoretikerInnen der Linkspartei die eigentliche Alternative, die in einer solchen Phase aufgeworfen wird, verkennen – es geht um Revolution oder Konterrevolution, um Sozialismus oder Barbarei.
Für die Ideolog:nnen der Linkspartei stellt sie sich jedoch anders dar – „autoritärer Festungskapitalismus“ (womit Regierungen wie jene von Trump gemeint sind) oder „solidarische Umgestaltung“.
Hier wird die sozialistische Revolution aus der „revolutionären Realpolitik“ verabschiedet.
Regierung als Ziel
Daher ist es kein Wunder, dass die Strategie in eine Regierungsbeteiligung münden muss. Natürlich ist auch das Zeil einer jeden kommunistischen Strategie, eine revolutionäre Arbeiter:innenregierung zu schaffen. Diese ist aber letztlich nur als Mittel zum Übergang zur Herrschaft der Arbeiter:innenklasse oder, in ihrer eigentlichen Form, als „Diktatur des Proletariats“, möglich. Die „Realpolitik“ der Arbeiter:innenklasse kann nämlich nur vom Standpunkt ihrer zukünftigen Herrschaft und deren Vorbereitung richtig verstanden werden.
Diese grundlegende Schlussfolgerung Rosa Luxemburgs verschwindet bei der Luxemburg-Stiftung gänzlich, wird sogar in ihr Gegenteil verkehrt. Zur strategischen Zielsetzung wird die „realistische“, „grundlegende“ Reform, die „solidarische Umgestaltung“.
Den Vordenker:innen der Linkspartei ist jedoch klar, dass eine solche „Umgestaltung“ keine Chance hat, wenn sie sich nur auf parlamentarische Mehrheiten stützt. Daher beurteilen sie das Regierungshandeln in Thüringen durchaus skeptisch, weil dieses keinem nennenswerten Druck von außen oder aus der Partei ausgesetzt ist. Sie halten eine Regierung auf Bundesebene erst recht für „verfrüht“ und erkennen, dass eine „Reformregierung“, die den Kurs der Großen Koalition fortsetzt, letztlich einer weiteren Stärkung der Rechten, v. a. der AfD, den Weg bereitet. Wie soll dieses Problem gelöst werden?
„Und schließlich muss die Linke an einer politischen Machtperspektive arbeiten. Dies darf nicht auf Wahlen verengt werden… Die punktuelle, aber konzentrierte Mobilisierung kann durchaus Erfolge zeitigen, sie ist aber immer prekär, wenn die Mobilisierung nicht mit einer nachhaltigen Verankerung und Organisierung verbunden wird. Eine politische Linke in den Vertretungsorganen ohne eine starke, eigenständige, kritische gesellschaftliche Linke, die in den Nachbarschaften, in Betrieben, in Initiativen und Bewegungen verankert ist, muss scheitern.“ (Brie/Candeias)
Die Linkspartei müsse einen „Spagat“ vollziehen zwischen „Bewegungspartei“ („Netzwerkpartei“) und „strategischer Partei“, die die verschiedenen Bewegungen, zusammenführt, Klassenfragen und Fragen der sozialen Unterdrückung vereint und ihnen eine Ausrichtung gibt.
Solcherart könne eine Umgestaltung vollzogen werden, die parlamentarische und institutionelle Mittel des Staates nutzt, den Kampf gewissermaßen „um den Staat und im Staat“ führt und gleichzeitig auch Gesamtstratege der heterogenen Widerstandsmilieus wäre.
Im Gegensatz zu naiven Bewegungslinken sehen sie ein, dass sich aus der Addition der spontanen Initiativen „von unten“, von Bewegungen, sozialen Kämpfen, Platzbesetzungen, Streiks, Betriebsbesetzungen, Selbstverwaltung oder „Produktion unter Arbeiter:innenkontrolle“, wie manche Projekte übertrieben genannt werden, keine gemeinsame Strategie ergibt. Eine „verbindende“ Partei reicht dazu nicht aus, es braucht eine strategische.
Es erhebt sich aber die Frage, warum Parteien wie Syriza diesen Spagat nicht durchzuhalten vermochten. In der Broschüre „Klasse verbinden“ wird lediglich festgehalten, dass sie die „Bewegungswurzeln“ nicht beibehalten konnte, dass eine solche Entwicklung auch dem Linksblock in Portugal drohe oder auch die Bilanz der „linken“ Stadtverwaltung in Barcelona diskussionswürdig sei.
Strategische Partei und Staat
Die Lösung liege in einer „strategischen Partei“, die Elemente der „verbindenden Partei“ (Partei der Bewegungen) aufnimmt. Das sei notwendig, damit sie im Zuge der gesellschaftlichen Transformation eine doppelte Aufgabe erfüllen könne. Als Partei müsse sie den Staatsapparat transformieren, in dessen Institutionen eindringen. Dies könne aber nur gelingen, wenn sich ihr Handeln nicht auf den Staatsapparat, Parlament und Regierung konzentriert, wenn sie sich zugleich auf Massenbewegungen außerhalb stützt bzw. von diesen unter Druck gesetzt werden kann.
„Als Linke in die Institutionen zu gehen, ob in Athen, Barcelona oder Madrid, führt in einen politischen Limbo, sofern es nicht gelingt, diese Institutionen zu öffnen für die Initiative der Bewegungen, Nachbarschaftsgruppen und Solidaritätsstrukturen aus der Zivilgesellschaft und damit eine weiterreichende Partizipation aller populären Klassen zu verankern.“ (Candeias, Gedanken zu Porcaros „strategischer Partei“, in: Klasse verbinden, S. 20)
Dazu bedürfe es „eigener ‚stabiler Institutionen‘ jenseits des Staates, die heute zur strategischen Partei und morgen zum sozialistischen Staat einen dialektischen Gegenpol bilden können.“ (Ebenda, S. 20)
Reformismus reloaded
Diese „Institutionen“ sind einerseits politische und gesellschaftliche Bewegungen, andererseits wären es aber auch „Institutionen“, die „schon heute eine ‚materielle Macht‘ ausbilden, die eine Art unabhängige soziale Infrastruktur und produktive Ressourcen einer solidarischen Ökonomie entwickelt, um den Attacken des transnationalen Machtblocks standzuhalten – der oft zitierte Plan C.“ (Ebenda, S. 20). Dieser Plan ist nur eine Reformulierung des alten Revisionismus und der Sozialstaatspläne der Nachkriegssozialdemokratie auf niedrigem Niveau.
Die aktuelle Periode engt den „Spielraum“ für solche Pläne ein, verurteilt sie rasch dazu, zum reinen Reparaturbetrieb zu werden. Daran ändert auch die Verklärung von selbstverwalteten Betrieben, besetzten Häusern, Nachbarschaftshilfe oder Beteiligungshaushalten zu Institutionen gesellschaftlicher „Gegenmacht“ nichts.
Die Strateg:innen der Linkspartei kommen hier bei Bernstein an – allerdings in einer widersprüchlicheren Form. Der „alte“ Revisionismus oder auch die Politik der Sozialdemokratie der 60er und frühen 70er Jahre versuchten ihre Politik durch angebliche Wandlungen des Kapitalismus zu begründen, die den Boden für eine schrittweise Verbesserung der Lage der Arbeiter:innenklasse und eine immer größere Demokratisierung des Systems abgeben würden.
Die mit Entstellungen der Arbeiten von Luxemburg oder Gramsci getränkte strategische Ausrichtung der Luxemburg-Stiftung akzeptiert hingegen, dass wir in einer Krisenperiode leben. Sie will aber nichts davon wissen, dass diese eine Strategie der revolutionären Machtergreifung der Arbeiter:innenklasse erfordert.
Syriza ist in Griechenland nicht daran gescheitert, dass der Spagat zwischen „Regierung“ und „Bewegung“ nicht funktionierte. Sie ist vielmehr an den inneren Widersprüchen einer reformistischen Realpolitik gescheitert – einerseits die Lage der Massen verbessern zu wollen und andererseits die gesellschaftlichen Grundlagen ihrer Verelendung, also den Kapitalismus selbst, nicht anzugreifen, sondern „mitzuverwalten“.
Klassencharakter des Staates
Die „Transformation“ des griechischen Staates ist nicht an einzelnen Fehlern von Syriza-Politiker:innen und am mangelnden Druck der Bewegung gescheitert. Sie wurde vielmehr unvermeidliches Opfer dieser Institutionen, weil der bürgerliche Staat selbst nicht zu einem Mittel der sozialistischen Umwandlung der Gesellschaft „transformiert“ werden kann. Genau das vertreten aber der „alte“ wie moderne Revisionismus, indem sie den Klassencharakter des bürgerlichen Staates negieren. Mit Luxemburg werden so auch gleich Marx‘ Lehren aus der Pariser Commune oder Lenins „Staat und Revolution“ entsorgt.
Die „revolutionäre Realpolitik“ entpuppt sich letztlich als bürgerliche, die bei allem Beschwören von „Bewegungen“ und „Gegenmacht“ letztlich auf einen friedlichen, graduellen, parlamentarischen Übergang zum Sozialismus, also auf den Sankt-Nimmerleinstag orientiert.
Für die Strateg:innen der Linkspartei ist der bestehende, wenn auch zu transformierende Staat, das entscheidende politische Instrument. Abgestützt werden müsse dieses durch Eroberung ideologischer Positionen und Vorherrschaft („Hegemonie“) in der Zivilgesellschaft und den Aufbau von „Gegenmacht“. Solcherart wäre eine schrittweise Transformation möglich. Dabei wird die Revolution zu einer Reihe von Reformen. Auch hier befindet sich die Linkspartei in Gesellschaft von Bernstein, nicht von Luxemburg:
„Es ist grundfalsch und ganz ungeschichtlich, sich die gesetzliche Reformarbeit bloß als die ins Breite gezogene Revolution und die Revolution als die kondensierte Reform vorzustellen. Eine soziale Umwälzung und eine gesetzliche Reform sind nicht durch die Zeitdauer, sondern durch das Wesen verschiedene Momente. Das ganze Geheimnis der geschichtlichen Umwälzungen durch den Gebrauch der politischen Macht liegt ja gerade in dem Umschlagen der bloßen quantitativen Veränderungen in eine neue Qualität, konkret gesprochen: in dem Übergange einer Geschichtsperiode, einer Gesellschaftsordnung in eine andere.“ (Rosa Luxemburg, Sozialreform oder Revolution?, Werke, Band 1, S. 428)






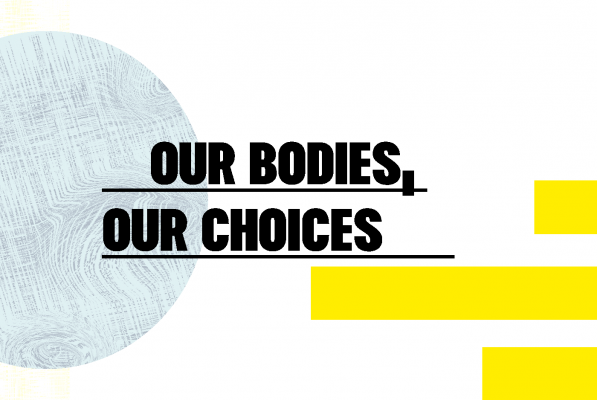



One thought on “Zur “Revolutionären Realpolitik” der Linkspartei: Revolution oder Transformation?”