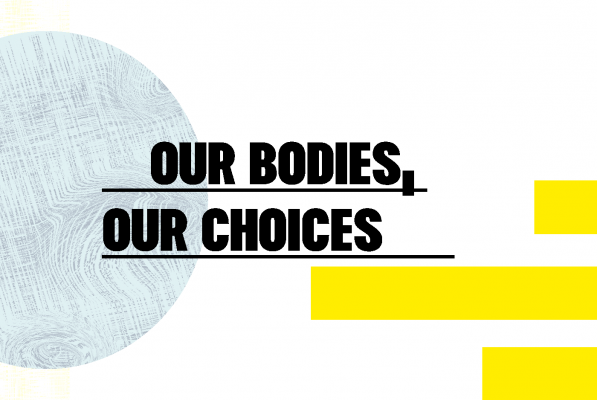DKP – Kommunismus oder Stalinismus?

Tobi Hansen, Revolutionärer Marxismus 43, Oktober 2011
Einleitung
Auf dem 19. Parteitag im Oktober 2010 verabschiedete die DKP das „Aktionsorientierte Forderungsprogramm – Politikwechsel erkämpfen“ (1) und eine politische Resolution (2) als Analyse der Weltlage. In unserem folgenden Beitrag werden wir uns hauptsächlich auf diese Dokumente beziehen. Mit welchem Programm tritt die größte Organisation links von der Linkspartei an? Welche Taktiken und Forderungen schlägt sie für den Klassenkampf vor und welche Perspektiven weist die DKP?
In den letzten Jahren pflegte die DKP eine „kritische“ Nähe zur LINKEN. Es gab Kandidaturen auf den Listen der Linkspartei, aber keinen Eintritt. Nach der Niedersachsenwahl 2009 und einem Disput mit einer DKP-Landtagsabgeordneten machte der Bundesvorstand der LINKEN jedoch Front gegen die DKP.
Die Berichte vom Parteitag zeigen, dass es eine gegensätzliche Diskussion zweier Lager in der DKP um den künftigen Kurs gab. Dies spiegeln auch einige sehr knappe Abstimmungsergebnisse wider. So ging es einer „Gruppe 84“ um die Stärkung des öffentlichen Profils der DKP und eine schärfere Auseinandersetzung mit der LINKEN, während ein anderer Flügel mit dem Systemziel „Wirtschaftsdemokratie“ um das „Institut für sozial-ökologische Wirtschaftsforschung“ (ISW) in München die DKP programmatisch weiter Richtung LINKE schieben will.
Eine weitere wichtige Differenz beider Flügel besteht darin, dass der rechte Parteiflügel eine neo-kautskyanische Ultra-Imperialismustheorie vertritt, der zufolge die Globalisierung zu einer nachhaltigen Neuformierung des globalen Kapitals geführt hätte. Dieser wäre heute durch „transnationale Konzerne“ bestimmt, die nicht nur global agierten, sondern auch ihrer national-staatlichen Bindung z.B. an US-Imperialismus oder den deutschen Imperialismus entwachsen seinen.
Der linkere Minderheitsflügel der Partei, der sich u.a. um die Berliner DKP formiert, in der SDAJ relativ stark sein dürfte und in einigen Fragen am Parteitag Achtungserfolge erringen konnte, gibt sich „orthodoxer“ und hält daran fest, dass es nicht nur eine imperialistische Weltordnung, sondern auch verschiedene imperialistische Mächte gibt, die miteinander in einen verschärften Konkurrenzkampf getreten sind.
Die folgende Passage aus dem Forderungsprogramm verdeutlicht diese Konfrontation. Der Vorstand kommt zu dem Schluss:
„Innerparteiliche Demokratie verlangt auch die Fähigkeit, neue Entwicklungen zu erkennen, darzustellen, zu diskutieren, Korrekturen vorzunehmen, notwendige Kritik und Selbstkritik zu berücksichtigen.“ (3)
Dies wird auch bei den Augenzeugenberichten von Delegierten auf dem Parteitag deutlich. So werden Versuche, „die Meinungsverschiedenheiten in der Partei begrifflich auf zwei Strömungen zu reduzieren und womöglich strömungsmäßige Organisierung zu fördern“ (4), zurückgewiesen. Die allgemeinen Anträge – etwa zur Gewerkschaftsarbeit – konnten leider nicht behandelt werden. Bedauerlich ist die „geringe Anzahl von ArbeiterInnen unter den Delegierten. Sorgen macht mir das deutlich gestörte Verhältnis zwischen DKP und SDAJ“ (5).
Diese innere Auseinandersetzung soll jedoch wieder in „Einheit“ umgesetzt werden. Daher wurde auch eine Kompromisskandidatin, Bettina Jörgensen, zur neuen Parteivorsitzenden gewählt. Keine der beiden „Strömungen“ will sich als wirkliche, offen deklarierte politische Fraktion mit eigener Plattform deklarieren. Das wird zwar nicht zum Verschwinden der Differenzen führen – wohl aber dazu, dass sie nicht politisch klar bestimmt werden.
Bei allen Unterschieden, die im Vorfeld und beim Parteitag sichtbar wurden, darf freilich nicht übersehen werden, was allen Strömungen in der DKP gemeinsam ist. Das kommt programmatisch in den beiden vom Parteitag verabschiedeten Dokumenten zum Ausdruck, das zeigt sich darin, dass beide Flügel wieder einmal einem reformistischen Programm zugestimmt haben, einem Forderungsprogramm, das die Partei wieder vereinen soll. Im Programm finden wir dann verschiedene Aktionsfelder und Zielvorgaben für die lokalen Parteigliederungen.
Im folgenden werden wir uns daher mit besonders mit diesen Beschlüssen beschäftigen, weil sie die grundlegenden Schwächen der DKP verdeutlichen. Wir werden dabei auch zeigen, dass der linke Flügel im Grund nur eine etwas linkere reformistische Strömung ist, die mit der grundsätzlichen Methode der DKP in keinster Weise gebrochen hat.
Als Arbeitermacht haben wir die DKP bislang als „links-reformistische“ Kraft eingeordnet, deren Hauptfelder „volksfrontartige“ Projekte wie die Friedensbewegung, Sozialforen und Attac darstellen, in denen die DKP sich pazifistischen und kleinbürgerlichen Führungen anpasst bzw. unterstellt. Die DKP ist Teil der Europäischen Linken (Beobachterstatus) und kooperiert oft mit der LINKEN in Deutschland.
Für uns als revolutionäre KommunistInnen muss die Auseinandersetzung mit dem Reformismus einen zentralen Platz einnehmen. Besonders in der BRD ist es der Reformismus in SPD, Gewerkschaften und der Linkspartei, der große Teile der organisierten Klasse bestimmt und somit den „Hauptfeind“ in den eigenen Reihen darstellt. Wenn es „richtungsweisende“ Diskussionen in der DKP gibt, wäre es sicher interessant, wie die eigene Politik gegenüber dem Reformismus reflektiert wird und wie die DKP sich vorstellt, dessen Herrschaft zu brechen.
Programm und Resolution
In „Aktionsorientierte Forderungsprogramm – Politikwechsel erkämpfen“ und in der „politischen Resolution“ gibt es zunächst eine Beschreibung/Analyse verschiedener Politikfelder. Die Angriffe von Kapital und Staat werden benannt und auch die derzeitig wichtigsten Gegenbewegungen. Oft wird der Aufbau breiter Allianzen und Bündnisse über alle sozialen und politischen Grenzen hinweg propagiert und dass die DKP die ArbeiterInnenklasse darin vertreten soll. Nach der Beschreibung der Situation folgt meist ein Forderungsmix, der Minimal- und Maximalforderungen kombiniert.
Klassenkampf und Reformismus
Richtigerweise erkennt die DKP an, dass während der Wirtschaftskrise das Kapital reaktionäre Lösungen wählt. Also steht die Frage, wie sich die Klasse und ihre Organisationen wehren sollen. Zu den Gewerkschaften stellt die DKP fest:
„Es wird viel davon abhängen, ob sich die Gewerkschaften in dieser Situation von Illusionen über Sozialpartnerschaft und Komanagement verabschieden, und stattdessen energischere Aktionen für ihre eigenen Forderungen nach Rücknahme der Rente mit 67, einem existenzsichernden Mindestlohn von mindestens 10 Euro/Stunde (…) entwickeln“. (6)
Natürlich betreiben die Gewerkschaftsführungen eine Politik der Sozialpartnerschaft und des Co-Managements. Es stellt sich aber die Frage, ob die Spitze darüber wirklich bloß Illusionen hegt? Vielmehr ist es doch so, dass die Spitze diese Illusionen in die Mitgliedschaft trägt. Diese Politik der Gewerkschaftsführungen hat ihre soziale Basis in der ins System integrierten Gewerkschaftsbürokratie, die sich ihrerseits auf die Arbeiteraristokratie stützt. Diese Klassenlage ist die Basis für eine Politik, die durchgehend seit 1914 in Deutschland und international für Klassenverrat verantwortlich ist. Die Tatsache, dass die Sozialdemokratie die Gewerkschaften bestimmt, wird so beschrieben:
„Ausdrücklich unterstützen wir das Prinzip Einheitsgewerkschaft auch gegen die nach wie vor anhaltenden Tendenzen zu einer sozialdemokratischen Richtungsgewerkschaft. Wir setzen uns für die einheitliche betriebliche Interessenvertretung ein, die auf einer demokratisch erarbeiteten Grundlage wirkt. Um den großen Herausforderungen im Kampf für den Erhalt sozialer Rechte und Leistungen wirksam zu entsprechen, ist es zwingend, breite Bündnisse zu schaffen, ohne jedwede Ausgrenzung.“ (7)
Während die schon 100 Jahre andauernde Herrschaft der Sozialdemokratie nur als „anhaltende Tendenz“ beschrieben wird, beschwört die DKP die Einheit auf demokratischer Grundlage im betrieblichen Kampf. „Einheit“ bedeutet hier die Akzeptanz der reformistischen Führung, eine Ablehnung jedes politischen Richtungskampfes in den Gewerkschaften. Dies ist klassische reformistische und stalinistische Schule. Der Begriff „Tendenz“ lässt darauf schließen, dass eigentlich mit den betrieblich-gewerkschaftlichen Kämpfen alles in Ordnung ist und nur etwas Verknüpfung mit den „sozialen Bewegungen“ nötig wäre, um die „sozialdemokratische Tendenz“ abzuschwächen. Indem die Klassenanalyse von reformistischen Führungen abgelehnt wird, verzichtet die DKP auch auf den programmatischen Kampf gegen die „Illusionen“.
Die abstrakte Gegenüberstellung zur „Einheit“ der Gewerkschaften ist politisch hohl. Gegen den Reformismus werden keine prinzipiellen Taktiken zu dessen Überwindung formuliert. Schließlich befindet sich die DKP ja am Ende auf gleicher programmatischer Grundlage.
Hier wird allein eine „Verteidigungsperspektive“ auf demokratischer Grundlage erörtert, keine Perspektive, wie in die Offensive zu kommen sei.
Es fehlt jede Analyse, warum die DGB-Gewerkschaften nichts getan haben, wie ihre direkte Funktion als Co-Manager aussieht und wie von der Basis dagegen angekämpft werden kann. Im Kern bedeutet die Einheits-Vorstellung der DKP, Verzicht auf Protest und Widerstand gegen den Reformismus und „demokratische“ Unterordnung unter die Führung. Vor allem lehnt die DKP seit Jahrzehnten die Formierung einer organisierten, anti-bürokratischen Opposition, eine klassenkämpferische Basisbewegung ab, die die Gewerkschaften der Bürokratie entreißen soll; die nicht nur für eine andere, klassenkämpferische Führung eintritt, sondern die auch die Gewerkschaften umgestalten soll, dass die Bürokratie als abgehobene Kaste von „Gewerkschaftsbeamten“ zerbrochen wird. Eine solche Strömung würde für alle Funktionäre Rechenschaftspflicht und jederzeitige Wähl- und Abwählbarkeit durch ihre Mitgliederbasis einführen; sie würde für alle hauptamtliche Funktionäre verlangen, dass ihr Entgelt auf einen durchschnittlichen Facharbeiterlohn begrenzt wird.
All diese arbeiterdemokratischen Forderungen sind der DKP fremd. Sie fordert solche Maßnahmen nicht und kein einziger ihrer Funktionäre im Apparat hat je solche Prinzipien für sich anwenden wollen. Vielmehr verteidigt sie ihre politische Unterordnung unter die Gewerkschafts- und Betriebsratsbürokratie.
Dafür gibt es bei der DKP auch praktische Beispiele wie z.B. bei Daimler Berlin-Marienfelde, als ein DKP-Vertrauenskörperleiter den Ausschluss der oppositionellen „Alternative“-KollegInnen forderte. So kämpfen Teile der DKP für die „Einheit“, indem sie praktisch die Kritik am reformistischen Kurs der IG Metall im Betrieb blockieren und damit letztlich dem Daimler-Management in die Hände spielen. Dieser Fall zeigte aber auch Risse auf. So forderte der DKP-Landesverband Berlin den Parteiausschluss des DKP-Betriebsrats. Eine richtige Forderung, die von der Gesamtpartei freilich scharf kritisiert wird. In dem gegen die Gruppe Arbeitermacht und den Artikel „Nach den Betriebratswahlen“ aus dem Jahr 2010 gerichteten Beitrag wettert die DKP-Zeitung UZ:
„In diesem Artikel, der sich mit den oppositionellen Betriebsratslisten beschäftigt, sie zu ‚zum Sammel- und Ausgangspunkt für eine klassenkämpferische Basisbewegung in den Betrieben und Gewerkschaften‘ hochstilisiert und die Produktionsarbeiter zu den Opfern des Ausverkaufs des ‚IG-Metall-Apparats‘ erklärt, heißt es unter anderem: ‚Hier verliert also der IG-Metall-Apparat die Kontrolle über einen – vorerst kleinen – Teil ihrer Kerntruppen. Diese AktivistInnen sind ein wichtiges Potential für eine oppositionelle Basisbewegung. Um dieses Potential zu nutzen, sind mehrere Dinge nötig: Die KollegInnen und Kollegen müssen gegen den Apparat verteidigt werden. Hier ist die Gewerkschaftslinke gefordert. Linke Apparatschiks, wie der VK-Leiter von Daimler-Marienfelde, der als DKP-Mitglied die Repression vorantreibt, müssen in der Linken geächtet werden!‘
In diesem Zusammenhang veröffentlichen wir den Beschluss der 10. Tagung des Parteivorstands der DKP vom 27./28. März 2010 in Essen, die sich mit diesem Thema beschäftigt hat: Der Parteivorstand der DKP bekräftigt die Aussagen der Erklärung des Sekretariats in der UZ vom 19. März 2010 ‚für starke und kämpferische Betriebs- und Personalräte‘, die sowohl auf historischen und aktuellen Erfahrungen sowie dem Parteiprogramm beruht.
Das Bekenntnis der DKP und ihrer Mitglieder zur Einheitsgewerkschaft ist Ergebnis der Lehren aus der Geschichte der Weimarer Republik, an deren Ende die Machtübertragung an die Faschisten auch wegen der Spaltung der Gewerkschaftsbewegung nicht verhindert werden konnte. Es ist auch Konsequenz aus politischen Fehlern in der Frühzeit der BRD. Es ist keine Frage politischer Konjunktur und auch nicht davon abhängig, ob andere gegen das Prinzip der Einheitsgewerkschaft verstoßen oder nicht. Starke und einheitlich handelnde Betriebs- und Personalräte sind eine der Voraussetzungen für die Abwehr der Absichten von Kapital und Kabinett, die Lasten der Krise auf die Arbeitenden, die Rentner und die Jugend abzuwälzen. Als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter setzen sich die Mitglieder der DKP für die Stärkung der Listen der Einheitsgewerkschaften und für Persönlichkeitswahlen ein.
Das auch dort, wo in Belegschaften, Vertrauenskörpern und Betriebsräten sozialpartnerschaftliche und standortegoistische Positionen noch dominierend sind. In der Diskussion mit den Kolleginnen und Kollegen, auf Gewerkschafts- und Betriebsversammlungen führen sie einen konstruktiven Streit zur Durchsetzung klassenkämpferischer Positionen. Die Unterstützer einer zur IG Metall konkurrierenden Liste zu den Betriebsratswahlen bei Daimler in Berlin Marienfelde durch den Landesvorsitzenden und Teile des Landesvorstandes der DKP Berlin sowie im ‚Berliner Anstoß‘, die Zeitung der DKP-Landesorganisation Berlin, verstößt gegen Tradition und beschlossene Politik der DKP.“ (8)
Zustimmen können wir DKP-Führung nur beim letzten Halbsatz – die Verteidigung einer klassenkämpferischen Opposition – und sei es auch nur eine Keimform davon, gehört nicht zur Tradition der DKP, die selbst den IG-Metall-Apparat nur in Spiegelstrichen als solchen bezeichnen will. In Verteidigung des „Berliner Anstoß“ hält demgegenüber Rainer Perschewski fest:
„Faktisch haben wir heute bürgerlich-sozialdemokratisch geführte Richtungsgewerkschaf-ten mit einer Praxis, die tägliche Kleinarbeit verabsolutiert und objektive Interessen der Arbeiterklasse außer Acht lässt“. (9)
Neben diesem Zitat, das klar im Widerspruch zur „Tendenz“ weiter oben steht, finden wir noch manches Richtige, wie z.B. „dass die Einheit schon längst von der Betriebsratsmehrheit“ und deren Kollaboration mit der Geschäftsführung gebrochen wurde und nicht durch die „Alternative“-KollegInnen bei Daimler Berlin-Marienfelde.
Allerdings bleibt Perschewskis Kritik auch auf halbem Wege stehen. Eine grundsätzliche Umkehr von der tradierten DKP-Politik fordert auch er nicht. Das würe nämlich bedeuten, dass nicht die „Einheit“ der Gewerkschaften den Ausgangspunkt kommunistischer Gewerkschaftspolitik bilden kann, sondern die Umwandlung zu Instrumenten des Klassenkampfes. Das heißt aber, Kurs zu nehmen auf ihre Eroberung durch eine klassenkämpferische Führung. Dazu ist der Aufbau einer klassenkämpferischen Opposition heute, in einer Situation, da revolutionäre KommunistInnen eine verschwindende Minderheit in den Gewerkschaften sind, ein entscheidende politische Taktik.
Die Frage, ob wir eine eigen Kandidatur oder eine Kandidatur als oppositionelle Liste gegenüber der Kandidatur auf der Gewerkschaftsliste vorziehen, ist eine taktische Frage, eine Frage des Kräfteverhältnisses. Generell sind wir dafür, dass in den Gewerkschaften des DGB politische Fraktionen offen auftreten können – und nicht so wie heute die verlogene „politische Neutralität“ gilt, die nur eine Mittel ist zur Sicherung des politischen Monopols der nicht deklarierten sozialdemokratischen Mehrheitsfraktion in den Gewerkschaften.
Die grundsätzliche Ablehnung eines Fraktionsrechts, des Aufbaus einer organisierten bundesweiten Opposition bedeutet im Grunde nur die stillschweigende oder offene Akzeptanz der sozialdemokratischen Führung – eine Position, die auch die Linken in der DKP letztlich teilen, auch wenn sie, wie im Falle Marienfelde, bereit sind, „Ausnahmen“ zu machen.
Die DKP-Führung fühlt sich daher mit ihrer Politik in der DKP auf sicherem Grund, weil auch die Opposition ihren Prämissen nichts entgegenzusetzen weiß.
In dieser Diskussion im Vorfeld des 19. Parteitages finden wir vom Parteivorstand meist nur Phrasen über Einheitsgewerkschaft und die Ablehnung der „RGO“-Politik durch die ultra-linken Periode der DKP. Sicher ist es richtig, die sektiererische KPD-Politik in der Weimarer Republik zu verurteilen, doch die DKP „überwindet“ diesen Fehler der stalinisierten KPD, indem sie ihn durch einen neuen ersetzt.
Die RGO-Politik bedeutete im Kern, eigene „rote“ Gewerkschaften zu gründen, d.h. dem politischen Kampf gegen den Reformismus auszuweichen, indem man sich von den reformistischen Massengewerkschaften, also auch von der Masse der ArbeiterInnen selbst, isolierte.
Die DKP will demgegenüber richtigerweise in der Massengewerkschaft DGB verbleiben, lehnt es jedoch ab, darin einen politischen Kampf gegen den Reformismus zu führen.
Die von der Komintern unter Führung von Lenin und Trotzki erarbeitete Politik zeichnete sich dadurch aus, dass sie den politischen Kampf um die Massen bei den Massen führen wollte. Die RGO-Politik entfernte sich von den Massen, die DKP entfernt sich vom politischen Kampf.
Über das Programm der Gewerkschaft finden wir dann bei der DKP auch wenig. Oft werden die objektiven Verhältnisse als Grundlage erwähnt, als wenn sich daraus schon ein Programm ergeben würde – Ökonomismus als Lösung?
Wenn die DKP nicht darauf zurück fallen will, muss sie schonungslos die politische Ausrichtung der herrschenden politischen Kräfte analysieren und daraus ableiten, inwieweit die Gewerkschaften derzeit eine klassenkämpferische Taktik anwenden – und wenn nicht, wie das geändert werden kann. Beschwören der „Einheit“ oder falsche „Lehren aus der Weimarer Republik“ helfen uns nicht bei der Analyse der größten ArbeiterInnenorganisation 2011 – des DGB.
Warum wohl haben die Einheitsgewerkschaften den Kampf gegen die Agenda 2010, die Rente mit 67, die Bankenrettung usw. nur halbherzig betrieben? Nicht wegen der Illusionen, sondern weil „ihre SPD-Genossen“ ja regierten!
2003 war die DKP Teil der Novemberdemo gegen die Agenda 2010-Pläne, welche dann vom DGB mit einer Großdemo im April 2004 wieder beerdigt wurde. Seitdem hat die DKP sich fast vollständig aus der Gewerkschaftslinken zurückgezogen und marschiert brav neben der LINKEN-Fraktion. Beide zusammen ordnen sich der SPD-Herrschaft unter, dürfen gegebenenfalls auch mal den linken Flügel einnehmen (zusammen mit Antifa und Zentristen). Solange sie dem Vorstand folgen, dürfen sie weiterhin als nützliche Idioten dabei sein. Nur Teile der gewerkschaftlichen Linken verhalten sich solidarisch zu oppositionellen Gruppen oder Listen. Nur wenige arbeiten aktiv an einer strategischen Opposition zur SPD – die DKP tut zumindest beides nicht.
Obwohl die DKP richtigerweise allen Ortsgruppen und Gliederungen die Empfehlung gibt, sich aktiver an der Betriebsarbeit zu beteiligen, um die Betriebe herum soziale Bündnisse/Foren aufzubauen, so fehlt doch komplett mit welcher Taktik gegen den „Hauptfeind“, die organisierte Sozialdemokratie, gekämpft werden muss.
Dies war schon die Politik der stalinistischen Satellitenparteien: im Titel den Kommunismus und im Programm Kollaboration mit dem Reformismus und dem Kleinbürgertum. 2006 von der „Rifundazione“ in Italien unter Ministerpräsident Prodi sogar in der Regierung eines imperialistischen Staates exekutiert, so wie zuvor schon die PCF in den 80er Jahren in Frankreich. Davon ist die DKP zwar weit entfernt, aber in der Praxis des Kampfes gegen die Agenda 2010-Politik der SPD hatte die DKP keine Opposition in den Gewerkschaften entgegen zu setzen.
Über die Aktivität und den Widerstand sozialer Bewegungen gegen die Krisenpolitik von Kapital und Staat schreibt die DKP:
„Anders als es manche zunächst erwartet hatten, hält sich der Widerstand dagegen und der Kampf für einen demokratischen Ausweg, für gesellschaftliche, wirtschaftliche, soziale und politische Alternativen jedoch nicht nur in der Bundesrepublik, sondern auch in anderen Ländern bislang in Grenzen“. (10)
Hier stellt sich die Frage, von wem sich die DKP konkret mehr erwartet hatte – von der mit Abwrackprämie, Kurzarbeit und Standortsicherung? Und wenn ja, wurden mehr betriebliche Kämpfe erwartet oder von der DKP genutzt? Fakt bleibt, dass die offiziellen Bemühungen um einen „Abwehrkampf“ derzeit ungenügend sind. Doch was schlägt die DKP für die Gewerkschaften und sozialen Bewegungen zur Überwindung dieses Zustands vor?
„In den Gewerkschaften ist dafür zu wirken, dass sie sich zum Kern einer solchen außerparlamentarischen Bewegung entwickeln. Das Eintreten der Gewerkschaften gegen die Aushöhlung und für eine Einlösung des ‚Sozialstaatsprinzips‘ des Grundgesetzes muss unterstützt werden“. (11)
Die DKP schlägt somit vor, das System der Klassenkollaboration, das nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden war – den westdeutschen Sozialstaat – zu verteidigen. Nur dass selbst dafür die reformistischen Führungen bekämpft werden müssen, ist ihr nicht klar. Schließlich haben die Gewerkschaften gegen die Agenda 2010, gegen die Rente mit 67 usw. außer wenigen formalen Protesten nichts getan. Sie haben ihre Vorstellung vom „Sozialstaat“ immer mehr den Vorstellungen des Kapitals angeglichen.
Stellt sich noch die Frage, welches Verhältnis die deutschen Gewerkschaften eigentlich zur außerparlamentarischen, zur „linken“ Bewegung haben? Derzeit sind die Gewerkschaften sehr weit davon entfernt, so etwas wie ein Kern der außerparlamentarischen Bewegung zu sein. Im Gegenteil: die Gewerkschaften sind fester Bestandteil der parlamentarischen Ordnung. Etliche führende Mitglieder sitzen für die SPD im Parlamente, ein paar auch für die Linkspartei, die Grünen und die Union. Wenn die DKP dafür wirken will, dass die Gewerkschaften das ändern, muss sie auch hier einen Kampf aufnehmen – gegen die parlamentarische Hörigkeit der DGB-Gewerkschaften.
Wie gemeinsam kämpfen?
Wie jede linke Organisation stellt sich auch die DKP die Frage, wie mehr Menschen mobilisiert werden können, wie dem faulenden Kapitalismus eine Alternative entgegen gestellt und wie er überwunden werden kann.
„Ein Politikwechsel ist nur möglich, wenn sich dafür Bündnisse, Allianzen verschiedener sozialer und gesellschaftlicher Kräfte, in denen die Arbeiterklasse die entscheidende Kraft sein muss, formieren, die zudem über den einzelnen Anlass hinaus mittel- bzw. langfristig arbeiten und für eine soziale und demokratische Wende in der Entwicklung der BRD und EU-Europas eintreten“. (12)
Abgesehen davon, dass hier eine Perspektive nur für Europa entwickelt wird, finden wir hier die Bündnisvorstellungen und können diese auch anhand der konkreten Politik der DKP bewerten.
Mit „verschiedenen sozialen Kräften“ sind tatsächlich klassenübergreifende Bündnisse gemeint. Als „anti-monopolistische“ Partei integriert dieser Volksfrontansatz das Kleinbürgertum und auch Teile des Kapitals, die „Nicht-Monopolisten“.
Für uns KommunistInnen sollen Bündnisse – Aktionseinheiten und Einheitsfronten – der Einigung der Arbeiterklasse gegen das Kapital dienen. Daher richtet sich die Einheit nicht an irgendeine „soziale Breite“, sondern an Organisationen der Arbeiterbewegung. Wir richten sie an Gewerkschaften, Organisationen und Parteien der Arbeiterklasse (auch die reformistischen!), Erwerbslosenorganisationen u.a. Organisationen der Arbeiterklasse.
Natürlich heißt das nicht, dass wir nicht-proletarischen Organisationen dabei verwehren zu mobilisieren, aber das Ziel der Einheitsfront ist primär die Herstellung der Klasseneinheit, nicht eine klassenübergreifenden Allianz.
Zweitens geht es bei der Einheitsfront darum, in der Aktion, um die Festlegung gemeinsamer Ziele und Kampfmethoden, ohne dabei die politischen Differenzen zu verwischen oder auf die Kritik an reformistischen „Partnern“ zu verzichten. Daneben sollen Bündnisse aber auch durch innere Propagandafreiheit gekennzeichnet sein, damit auch der politische Feind in den eigenen Reihen bekämpft werden kann.
Die Methode Lenins bezüglich der Einheitsfront zielte genau auf die Einheit der Klasse, der verschiedenen Sektoren und Schichten in der Aktion. Dies bedeutet aber bei Lenin nicht, dass die KommunistInnen dann die politische Herrschaft des Reformismus akzeptieren, im Gegenteil: sie müssen die Einheitsfront nutzen, um den Reformismus vor seiner Basis zu entlarven und für ein revolutionäres kommunistisches Programm zu kämpfen.
So gehen KommunistInnen in Bündnisse und bieten ihre Zusammenarbeit auch an, um ihr Programm und ihre Forderungen zu verbreiten. Erst wenn dies erfolgreich war, wenn die Avantgarde der Klasse und der sozialen Bewegungen ein revolutionäres Programm erarbeitet hat, dann kann sie auch anderen sozialen Kräften – wie dem Kleinbürgertum – ein Angebot zur Zusammenarbeit machen, wobei diese anderen Kräfte das revolutionäre Programm und die Führung der Arbeiterklasse akzeptieren müssen.
Die bundesdeutsche Realität in punkto Einheitsfronten ist allerdings oft ein Hohn auf Lenins Vorstellung. In fast allen Bündnissen, Aktionseinheiten und Mobilisierungen ist die Herrschaft des Reformismus und der kleinbürgerlichen Ideologien ungebrochen, u.a. weil sie von den diversen Linken oft gar nicht bekämpft wird.
Die Bündnispraxis der DKP
Aktuell sind für die DKP die Friedens- und Sozialforen-Bewegung sowie Attac die Hauptinterventionsfelder ihrer Bündnisarbeit. Allen gemeinsam ist die Ferne zu einem revolutionären Programm oder einer kämpferischen Praxis. Ebenso ist die organisierte Arbeiterklasse dabei nicht die bestimmende Kraft. Bei den Sozialforen erlebten wir in den letzten Jahren eine immer schärfere Wendung nach rechts. Gewerkschaftsbürokratie, Linkspartei und Kleinbürgerliche bestimmen das Bild. Es ist lange her, als ein Sozialforum aktiv gegen Hartz IV mobilisierte (ein Sternmarsch 2005 in Erfurt). Diese Bewegung ist in Deutschland weder wirklich angekommen, noch hat dies die sozialen Bewegungen befördert. 2009 wurde beim Sozialforum in Hitzacker (nur 500 TeilnehmerInnen!) aktiv für einen „new green deal“ eingetreten und der ehemalige DKP-Grande Hugo Braun (heute attac ko-kreis) versprach sich davon einen „Weg zum Sozialismus“. Bei den Sozialforen ist der aktive soziale Widerstand verebbt. Nur einzelne Erwerbsloseninitiaven werben für das „Bedingungslose Grundeinkommen“, andere für die „Zivilgesellschaft“, für Vernunft und Gerechtigkeit. Die Gewerkschaftsführung schickt stets einen „linken“ Bürokraten zur Finanzierung und zum Abnicken zum Forum. Die Basis wurde eigentlich fast nie gesichtet. Die „Gesandten“ werben dann noch für ein, zwei gewerkschaftliche Aktionen und reisen dann meist zum nächsten Termin.
Gegen diese Politik fällt nicht nur der DKP nichts ein. Auch verschiedene zentristische Organisationen hängen sich entweder an die Bürokraten und Kleinbürger oder verzichten ganz auf eine Intervention oder Vorschläge fürs Sozialforum.
Die Friedensbewegung
Ähnliches kann auch über die Friedensbewegung gesagt werden. Neben einem plakativen Pazifismus und einer völkerrechtlichen Moral gibt es dort keine Methoden und Taktiken gegen Militarismus und Imperialismus. Hier ist die DKP eine führende programmatische Kraft. Das drückt sich darin aus, dass die DKP das pazifistische Programm übernommen hat. Zum Thema Krieg gibt es folgende Passagen aus dem Parteiprogramm und den Dokumenten vom letzten Parteitag:
„Der von ihnen (die USA, d. Verf) dominierte aggressive Militärpakt NATO setzt sich rigoros über das Völkerrecht hinweg, souveräne Staaten, die sich nicht seinem Diktat beugen, werden bombardiert oder okkupiert.“ (13)
„Unser Ziel ist die völlige Auflösung der NATO, die Entmilitarisierung Deutschlands und der Europäischen Union. Weder Deutschland, weder die USA, noch die EU-Staaten werden von irgendeinem Land der Welt militärisch bedroht.“ (14)
Entscheidend ist aber, dass der Imperialismus andere Staaten bedroht, wie im ersten Zitat erwähnt. Dabei muss auch klar sein, warum der Imperialismus das tut. Der bekannte Ausspruch von Karl Liebknecht „Der Hauptfeind steht im eigenen Land“ und der revolutionäre Defätismus der Bolschewiki und der frühen KPD hat auch heute noch Bestand – die Frage ist nur, ob als Programm oder nur als Phrase.
Imperialistische Staaten, die auf Grundlage der kapitalistischen Ausbeutung über die Arbeiterklasse und unterworfene Völker herrschen, brauchen das Militär, um diese Herrschaft zu sichern und auszubauen. Dafür brauchte es nie eine sonderliche Bedrohung. Das stehende Heer ist Erfindung des bürgerlichen Staates zur Umsetzung direkter Klasseninteressen und -herrschaft gegen das Proletariat. Das Gewaltmonopol, die bewaffneten „Arme“ des Staates, all dies dient letztlich dazu, um die Klassenherrschaft durchzusetzen. Was die Hauptbedrohung für die Imperialisten ist, dürfte auch klar sein: ein revolutionäres und militantes Proletariat.
Diese Zusammenhänge finden in der Friedensbewegung zwar Erwähnung, aber wenig Umsetzung in konkrete Politik. Stattdessen beruft sich die Friedensbewegung, quasi als letzter Apostel der bürgerlichen Rechte auf das Völkerrecht und die Beschaffenheit der UNO, die anscheinend für den Schutz und für den Frieden Verantwortung tragen soll. Somit ist dann auch das Bündnis geschaffen für diejenigen, die einen „gerechten“ Krieg unter UN-Mandat propagieren wie Grüne, SPD und die Linkspartei. Ihnen wird zumindest nicht offen widersprochen. Diese tw. krude Mischung innerhalb der Bewegung ist dann für Kundgebungen verantwortlich, bei denen die kirchlichen Pazifisten als radikalste KriegsgegnerInnen auftreten können und die akademische Intelligenz sich beklagt, dass die von der Bundeswehr ausgebildeten afghanischen Soldaten danach ja gegen die Besatzung kämpfen würden.
Als ein weiteres Beispiel zitieren wir hier aus dem „Aktionsprogramm Friedenspolitik“ des Bundesausschusses „Friedensratschlag“:
„Die privatwirtschaftlich organisierte Rüstungsindustrie ist am Gewinn interessiert und kennt weder Moral noch politische Verantwortung. Die hoch gefährliche Rüstungsindustrie muss verstaatlicht und gezielt auf die Produktion nützlicher ziviler Güter umgestellt werden (Konversion). Der Staat als 100-prozentiger Abnehmer der produzierten Waffen und militärischen Geräte trägt auch die Verantwortung für die Umstellung der Rüstungsproduktion bei Erhalt der Arbeitsplätze.“ (15)
Wären wir besonders spitzfindig, würden wir die Frage stellen, wie denn eine „moralische“ und „politisch verantwortungsvolle“ Rüstungsindustrie im Kapitalismus aussehen könnte, oder warum es denn mit der Moral bei einer kapitalistischen Profitwirtschaft nicht so hinhaut. Noch interessanter ist aber, wie denn eine Verstaatlichung konkret aussehen, durch wen sie durchgesetzt würde. Dazu finden wir nichts.
Ebenfalls ist unklar, welcher Staat denn 100%-Abnehmer der produzierten Waffen sein würde – ist es ein imperialistischer Staat. Dann unterstützt diese Forderung implizit eine Aufrüstung, bis dieser Staat dann „freiwillig“ auf zivile Produktion umstellt? Solche Fragen nicht zu beantworten oder sie offen zu lassen, heißt, den Klassencharakter des Staates nicht zu erkennen und diesen – bewusst oder unbewusst – als „neutralen“ Verwalter darzustellen, der nur „bessere, vernünftigere“ Ziele benötigt. Warum auch ausgerechnet dieser Staat die Produktion neu ordnen soll, erscheint schleierhaft. Schließlich ist dieser Staat auch Organisator von Niedriglohn und Arbeitslosigkeit. Mit keinem Wort wird die Arbeiterklasse benannt, die eine solche Neuordnung organisieren könnte. Weitere Ziele sind die „Delegitimierung der NATO“ sowie der Austritt Deutschlands aus der NATO. Mit dieser – an sich richtigen – Forderung wird allerdings suggeriert, dass der deutsche Imperialismus ohne NATO-Mitgliedschaft friedlicher wäre. Doch der Klassencharakter und die Klasseninteressen ändern sich nicht in Abhängigkeit von Mitgliedschaften in Bündnissen.
Mit dieser Aushöhlung jeglichen marxistischen Staatsverständnisses integriert die Friedensbewegung Teile des Kleinbürgertums, pazifistische Gruppen und besonders Teile der Grünen.
Damit wird die Illusion aufrecht erhalten, dass der „demokratische Staat“ neutral wäre und es nur an der politischen Ausrichtung der Exekutive läge, ob ein kapitalistischer Staat auch mal die Rüstungsindustrie verstaatlichen würde. Doch unterstellen wir, er würde dies unter dem Druck einer Bewegung tun – was durchaus möglich wäre -, so würde sich daraus sofort die Frage ergeben, wer den bürgerlichen Staat zur Konversion, zum Umstellung von Rüstungsproduktion o.ä. zwingt? Unsere Antwort darauf ist, dass die Forderung nach Verstaatlichung dieser Industrien mit dem Kampf um Arbeiterkontrolle verbunden werden muss. Doch genau davon will die DKP nichts wissen.
Wer Illusionen in den bürgerlichen Nationalstaat hegt, der hegt sie folgerichtig auch gegenüber auf internationaler Ebene. Das Völkerrecht und die UNO gelten als moralische, demokratische Instanzen, welche globale Friedenspolitik gewährleisten könnten. Wenn also DKP, SPD, Grüne und die Linkspartei Militäreinsätze nur mit UN-Mandat fordern, ordnen sie sich der bürgerlichen Grundorientierung der Bewegung und damit den Klasseninteressen der Bourgeoisie unter.
Die lange Geschichte des Sozialchauvinismus von SPD und Grünen aufzuzählen, ist hier müßig, bei der LINKEN lohnt ein Blick darauf. Aus dem „Nein“ zum Afghanistan-Krieg wurde eine teilweise Enthaltung zu Einsätzen im Sudan. Ein „Ja“ zu UNO-Einsätzen wurde noch nicht gefordert, aber vielleicht gibt die Situation in Nordafrika und Arabien die Möglichkeit für die LINKE, endlich für einen „guten“ Krieg zu stimmen.
Dies alles ist integrierbar in die jetzige Friedensbewegung. Außer Pazifismus und Zustimmung zu UN/NATO-Kriegen zu frönen, hat dieses Sammelsurium nie eine aktivistische antimilitaristische Praxis bedeutet. Stattdessen wurde die Bewegung zum Wahlhelfer für Reformisten und Kleinbürgerliche (zuletzt 2002 vor dem Irakkrieg) und die Ferne zur Arbeiterklasse oder zur Jugend wird bei jedem Ostermarsch deutlich.
Als akademisches Vehikel dient dabei attac ebenso wie als Bindeglied zwischen verschiedenen sozialen Bewegungen. Dort ist auch die DKP gut integriert, teils durch ehemalige AktivistInnen oder über Sozialforen und die Friedensbewegung. Wie in den anderen Bündnissen ist die DKP auch bei attac weit davon entfernt, dort revolutionäre Positionen zu vertreten. Stattdessen wird auch bei attac eine kleinbürgerliche und reformistische Führung akzeptiert und gestützt.
Die „antimonopolistische“ Bewegung
Die Methode hinter der Überschrift und die daraus resultierende Taktik stellen eine der entscheidenden Deformationen des wissenschaftlichen Sozialismus durch den Stalinismus dar. Zu dieser Methode (der Volksfront) schreibt die DKP:
„Im Parteiprogramm der DKP haben wir hervorgehoben, dass der Weg, antimonopolistische Forderungen durchzusetzen, antikapitalistische Positionen mehrheitsfähig und durchsetzungsfähig zu gestalten, nicht einfach und geradlinig ist, sondern einen langen Arbeits- und Kampfprozess erfordert.“ (16)
Und weiter: „Aktionseinheits- und Bündnispolitik, die Schaffung von gesellschaftlichen Allianzen verlangt von uns die kreative politische Anwendung der Erkenntnisse des wissenschaftlichen Sozialismus, die Fähigkeit des Zuhörens und das Auseinandersetzen mit anderen Positionen, aber auch die Fähigkeit von anderen zu lernen.“ (17)
Wenn wir die Volksfront-Taktik als klassenübergreifend bezeichnen, so wird das hier besonders im Begriff „antimonopolistisch“ deutlich. Dadurch sollen möglichst breite Teile des Kleinbürgertums wie auch nicht-monopolistische Kapitale für die antikapitalistische Bewegung gewonnen werden. Schließlich presst das Monopolkapital auch aus diesen Schichten Profit, so dass nach stalinistischer Vorstellung diese Schichten auch ein gemeinsames Interessen am „anti-monopolistischen“ Kampf gegen das Proletariat teilen würden.
Dieser Taktik folgend, erlitt die Arbeiterklasse weltweit stets große Niederlagen, welche hier darzustellen zu viel Raum einnehmen würde. Aber beispielhaft soll hier an den gescheiterten Kampf gegen den Faschismus in den 1930ern erinnert werden, insbesondere an die Ergebnisse der Volksfrontpolitik in Frankreich und Spanien.
Natürlich wird es für das Proletariat in einer revolutionären Situation wichtig, wie das Kleinbürgertum, die Mittelschichten reagieren. Deswegen sollte die revolutionäre Partei auch stets ein Programm entwickeln, welches möglichst breite Teile des Kleinbürgertums integrieren kann.
Doch das Angebot der Volksfront à la DKP ist gleichzusetzen mit der Preisgabe des politischen Kampfes in einem Bündnis – des Kampfes um die politisch-revolutionäre Führung, während die persönliche, postenbezogene Führung durchaus erreicht werden mag. Die DKP sucht stets das „Einende“. Diesem „Minimal-Konsens“ wird dann fast jede politische Kritik geopfert – mehr noch: die gesamte Ausrichtung und die Aktionsmethoden werden auf eine harmlose und für den Klassengegner letztlich ungefährliche Richtung justiert.
Statt Blockaden, Streiks u.a. wirksamen Aktionen gibt es nur Demonstrationen und symbolische Aktionen. Statt der Orientierung auf die Arbeiterklasse, die zu gewinnen unumgänglich ist, um eine quantitativ starke Bewegung zu formieren, die auch die Kraft hat, Streiks und Blockaden überhaupt durchzuführen, passt man sich dem Kleinbürgertum und den Mittelschichten an. Das Fatale dabei ist, dass selbst dort, wo die DKP eine führende Rolle in der Bewegung spielt, sie auch keine andere Politik vorschlägt oder umsetzt als attac oder die Grünen.
In der Praxis ist die DKP in diesen Bewegungen nicht bemerkbar. Die GenossenInnen treten allein im Namen der Bewegung auf, schützen kleinbürgerliche und reformistische Positionen und agieren als deren Anhängsel.
Zuletzt war dies auch bei den Protesten gegen S21 sichtbar. Als „antikapitalistische Plattform“ (zusammen mit autonomen, libertären Kräften) wollten sie nicht nach außen auftreten. Stattdessen waren sie brav im K21-Bündnis unter ihrem ehemaligen Genossen und nun-mehrigen Sprecher der GegnerInnen von Stuttgart 21, Stocker, aktiv und traten nicht in Opposition zu den Grünen, welche die Bewegung mit der Schlichtung demobilisierten.
Ihre Praxis und ihr Programm verdeutlichen, wie weit die DKP von einer kommunistischen Politik entfernt ist, wie dominant reformistische und kleinbürgerliche Vorstellungen sind. Wie und warum KommunistInnen in Bündnisse gehen und welche Politik sie dort verfolgen sollten, wollen wir hier kurz anhand von Zitaten aus Beschlüssen der Komintern zwischen dem 3. und 4. Weltkongress darlegen:
„Das Problem der Einheitsfront ergibt sich aus der Notwendigkeit, ungeachtet der aktuell unvermeidlichen Spaltung der politischen Organisationen, die sich auf die Arbeiterklasse stützen, dieser die Möglichkeit der Einheitsfront im Kampfe gegen die Kapitalisten zu sichern. Wer diese Aufgabe nicht begreift, für den ist die Partei eine Propagandagesellschaft und nicht eine Organisation der Massenaktionen (…)
Hätte die Kommunistische Partei nicht radikal und unwiderruflich mit der Sozialdemokratie gebrochen, so wäre sie niemals zur Partei der proletarischen Revolution geworden. Würde die Kommunistische Partei nicht nach organisatorischen Wegen suchen, um in jeder Situation aufeinander abgestimmte, gemeinsame Aktionen der kommunistischen und nichtkommunistischen (darunter auch sozialdemokratischen) Arbeitermassen zu ermöglichen, so würde sie damit nur ihre Unfähigkeit offenbaren, auf Grund von Massenaktionen die Mehrheit der Arbeiterklasse zu erobern.“ (18)
Und weiter: „Wir haben, abgesehen von allen anderen Erwägungen, das Interesse, die Reformisten aus ihren Zufluchtsstätten herauszuholen und sie neben uns vor der kämpfenden Masse aufzustellen. Bei richtiger Taktik können wir dabei nur gewinnen. Der Kommunist, der davor zaudert oder sich fürchtet, ähnelt einem Schwimmer, der Thesen über die beste Schwimmtechnik akzeptiert, aber nicht riskiert, sich ins Wasser zu stürzen. Indem wir mit den übrigen Organisationen ein Abkommen treffen, erlegen wir uns selbstverständlich eine gewisse Aktionsdisziplin auf. Doch kann es hier keine absolute Disziplin geben. In dem Augenblick, da die Reformisten den Kampf zum Schaden der Bewegung oder im Gegensatz zur Lage und zur Stimmung der Massen zu bremsen beginnen, wahren wir uns als unabhängige Organisation stets das Recht, den Kampf bis zum Ende und ohne unsere zeitweiligen Halbverbündeten zu führen.“ (19).
Wenn wir beim letzten Bild verweilen, so müssen wir heute feststellen, dass die Volksfront-Methode es geschafft hat, den Schwimmer in die Wüste zu stellen. Diese leninistische Begründung der Einheitsfront zeigt nochmals deutlich auf, was eine kommunistische Partei zu tun hat – den politischen Gegner innerhalb der Klasse zu schlagen und die Masse für ein revolutionäres Programm zu gewinnen – wozu sonst wäre sie auch da?!
Programm und Perspektiven der DKP
Damit wären wir beim Hauptproblem angekommen: Das „Aktionsorientierte Forderungsprogramm“ als Ergänzung zum Programm von 2006 ist kein revolutionäres Programm. Es ist ein links-reformistisches Minimal-Maximal-Programm mit einigen zivilgesellschaftlichen und kleinbürgerlichen Fallen und einer Volksfront-Methode.
So sind diese Dokumente auch nicht geeignet, eine konkrete Perspektive zu weisen – weder zur Zerschlagung des Kapitalismus noch zur Organisierung der Klasse oder für den Kampf gegen die Angriffe von Kapital und Staat. Am Ende der „Politischen Resolution“ heißt es:
„Ohne eine grundlegende Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse wird es keine Demokratie, keinen Frieden, keine Zukunftslösungen im Sinne der übergroßen Mehrheit der Bevölkerung in unserem Land und international geben. Der Kapitalismus muss überwunden werden!“ (20)
Wenn am Ende auf Demokratie und Frieden verwiesen wird, kommt dies schon Grünen-Programmen der 80er nahe. Mit dem Überwinden des Kapitalismus ist die DKP zwischen attac (Eine andere Welt ist möglich) und den Autonomen (Kapitalismus abschaffen) angekommen. Einige Absätze zuvor wird erwähnt, dass die DKP mit der Arbeiterklasse für eine sozialistische Gesellschaft kämpfen will. Zumindest wird auf vergesellschaftete Produktionsmittel verwiesen – allerdings auch auf eine „öffentliche“ Kontrolle, bei der unklar bleibt, welche Rolle die Arbeiterklasse dabei einnimmt. Keine Rede ist vom Aufbau von Arbeiterräten, von der Organisierung der Massen in Räten und Komitees in Betrieben, Stadtteilen und Schulen. Stattdessen wird von einem anzustrebenden „revolutionären Prozess“ gesprochen, um ein System „jenseits der kapitalistischen Profitwirtschaft“ aufzubauen. Zunächst, sozusagen als „mittelfristiges Ziel“, reicht aber ein „Politikwechsel“.
Wir finden in der Resolution auch ein Beispiel dafür, wie die DKP sich das Eintreten für den Marxismus vorstellt. Danach gehört es zu den eigenen Aufgaben, „für einen stärkeren Einfluss des Marxismus und die Entwicklung von Klassenpositionen in Bewegungen und Gesellschaft zu wirken. Dazu wird die DKP besonders die sozialen Menschenrechte wie das von der UN-Vollversammlung 1948 in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte beschlossene Recht auf Arbeit propagieren.“ (21)
Ob und vor allem für welche Klassenpositionen die DKP wirkt, lässt sich in der Praxis ihres Eingreifens in der Friedensbewegung, in attac usw. sehen. Die DKP vertritt dort reformistische und versöhnlerische Positionen gegenüber Bürokratie und Kleinbürgertum. Welche Form von „Marxismus“ das ist, hatte schon Rosa Luxemburg erkannt. Bei ihr hieß das „Revisionismus“. Der Marxismus ist keine Wissenschaft der Menschenrechte, sondern des revolutionären Kampfes des Proletariats. Der Marxismus will kein abstraktes „Recht auf Arbeit“, er zielt auf die Aneignung der Produktionsmittel und die Selbstverwaltung der Arbeit durch die ProduzentInnen und KonsumentInnen – das ist die historische Klassenposition, die von keiner UN-Vollversammlung umgesetzt werden wird.
Dieses Programm lässt nur zwei Perspektiven für die DKP offen: entweder die Unterordnung unter die Politik der LINKEN oder als „linkes“ Anhängsel in den sozialen Bewegungen und in den Gewerkschaften. Als kommunistische Partei ist diese DKP nicht wahrnehmbar.
In den Bewegungen ist die LINKE inzwischen stärker präsent. Gemeinsame Wahlantritte waren nicht zum Vorteil der DKP, sondern fügten ihr Niederlagen bei Kommunalwahlen zu (speziell in NRW). Vor allem verfügt die DKP über keine Taktik gegenüber der LINKEN. Eine Ursache für dieses Manko ist eine oberflächliche, ja falsche Einschätzung der LINKEN:
„Noch ist offen, wohin sich „Die Linke“ entwickeln wird; dies wird auch davon abhängen, wie sich die linken Kräfte außerhalb dieser Partei entwickeln und organisieren“. (22)
Die LINKE hat auch 5 Jahre nach ihrer Gründung noch immer kein Parteiprogramm – dies ist das Einzige, was in gewissem Sinne „offen“ ist. Klar ist aber, wohin die Reise gehen wird. In Berlin und Brandenburg exekutiert(e) die LINKE bürgerliche Regierungspolitik an der Seite der SPD. Auch in NRW stimmten manche Abgeordnete mit der rot/grünen Minderheitsregierung, obwohl sie nachher nicht wissen wollten, worum es ging. Insgesamt soll die neue Führung Lötzsch/Ernst den angestrebten Kurs von Gysi/Lafontaine weiterführen – die LINKE soll regierungstauglich sein. Neben den ostdeutschen Landesverbänden sind es v.a. die Gewerkschaftsfunktionäre, Ex-SPDler und Grüne, die diesen Weg eingeschlagen haben. Die innerparteiliche Opposition ist schwach und versucht, mit den Phrasen Lafontaines Abstimmungen zu gewinnen. Dünner könnte das Eis für die „Linken“ in der Linkspartei gar nicht sein. Die verschiedenen linken Strömungen, ob Kommunistische Plattform (KPF), die AKL, die sozialistische Linke etc. dienen zum Teil zentristischen Organisationen, um in der LINKEN anzukommen oder stellen einfach nur innerparteiliche Seilschaften dar (KPF). So schaffen es sogar die Ex-LinksrucklerInnen (heute Marx21) in den Bundestag. Eines haben alle diese Strömungen gemeinsam: sie nehmen nicht den politischen und programmatischen Kampf gegen den traditionell reformistischen Flügel auf, der heute die Partei führt. Es gibt kein Verständnis, als gemeinsame Fraktion zu kämpfen wie es auch keine Bewegung von „außen“ in die Partei hinein gibt, welche die linkeren Kräfte nutzen könnten.
Inzwischen ist auch klar, dass die Bewegung von 2004/05 um die Fusion und die Gründung der WASG im Westen merklich abgenommen hat. Während dieser Zeit gelang es durchaus, AktivistInnen aus dem Erwerbslosenbereich, den „Globalisierungsgegnern“ und der „radikalen Linken“ für die WASG und die Formierung der Linkspartei zu gewinnen. So war die Frage der Regierungsbeteiligung stets ein umkämpftes Thema in dieser Phase. Aber keine Partei oder Organisation war willens oder in der Lage (bei manchen auch beides), eine innerparteiliche sozialistische und klassenkämpferische Strömung/Fraktion aufzubauen. Die meisten Organisationen versuchten nur, ihr Schäfchen ins Trockene zu bekommen. Dazu ordneten sie sich dem Linksreformismus von Ernst und Co. unter.
Das Netzwerk Linke Opposition (NLO) war zu dieser Zeit eine der wenigen Strukturen, welche versuchten, die Fusion auf einem reformistischen Programm zu bekämpfen und eine klassenkämpferische und sozialistische Perspektive zu weisen. Die meisten Linken, darunter die SAV, lehnten das ab und verschwanden nach einiger Zeit in die Linkspartei.
An diesen Prozessen nahm und nimmt die DKP erst gar nicht teil. Stattdessen gibt es für die DKP „keine Alternative“ zur Zusammenarbeit mit der Linkspartei, auch aufgrund einer weiteren „Rechtsentwicklung“ in der Gesellschaft, welche wiederum eine stärkere Einheit aller „Linken“ erfordere. Wenn wir das zu Ende denken, können wir nur hoffen, dass Deutschland von rechtspopulistischen/extremen Wahlerfolgen wie in den Niederlanden, Belgien, Ungarn, Schweden etc. verschont bleibt. Nach der DKP-Methode würden wir dann wahrscheinlich keine Alternative zur Zusammenarbeit mit allen „Demokraten“ haben – auch hier schlägt wieder die stalinistische Volksfront durch.
Natürlich haben wir einen zunehmenden Rassismus in Deutschland. Eine antifaschistische Gegenwehr lässt sich aber nicht durch eine Unterwerfung gegenüber dem Reformismus erkämpfen, sondern allein durch die aktive Mobilisierung in der Arbeiterklasse gegen Standortnationalismus und für damit die einhergehende Überwindung der Spaltung entlang ethnischer, rassischer und nationaler Linien in der Klasse.
Da die DKP sich in der Erbfolge der KPD sieht, wäre gerade aus dem Kampf gegen den Faschismus einiges zu lernen gewesen. Allerdings hat die „Reflektion“ der Politik der KPD mal gerade zum Gegenteil ihrer Taktik geführt. Vertrat die KPD in ihrer ultra-linken Periode die These vom „Sozialfaschismus“ gegenüber der SPD und betrieb offen eine sektiererische Spaltung der Gewerkschaften, so hat die DKP diese Methode aus der ultralinken „3. Periode“ des bürokratisch-zentristischen Stalinismus zwar abgelehnt, sie aber nur durch eine reformistische ersetzt. Indem die DKP weder in den Gewerkschaften noch gegenüber der LINKEN offen den Reformismus und Standortnationalismus bekämpft, orientiert sie nicht auf eine „antifaschistische Einheitsfront“, sondern vielmehr auf eine „Zivilgesellschaft gegen rechts“.
Eine solche Politik muss auch Risse in der eigenen Partei zur Folge haben. Wie wir in der Einleitung lesen konnten, war der 19. Parteitag wohl ein umkämpfter mit zwei fast gleich großen Lagern. Während beiden gemeinsam ist, dass sie die DKP und die „linke Bewegung“ allgemein in einer Krise sehen, gibt es Widersprüchliches zur Frage der Gewerkschaften und wohl auch zum Wirken als DKP nach außen. Neben diesen Widersprüchen scheint es auch auf anderen Ebenen Probleme in der politischen Arbeit und Analyse zu geben. Dazu finden wir im Forderungsprogramm:
„In der DKP müssen wir unsere Organisationsstrukturen überprüfen, inwieweit sie auf Landes- bzw. Bezirksebene den politischen Anforderungen entsprechen. Das heißt, wir müssen mindestens sichern, dass auf der Ebene der Bundesländer oder Regionen in den Bundesländern politisch-analytisch gearbeitet wird“. (23)
Wenn die analytische und programmatische Arbeit vor Ort, also in den Bundesländern, Regionen und Kommunen schon angemahnt werden muss, dann lassen sich daraus schon einige Schlüsse ziehen. Es ist diese grundlegende Debatte, die gegenüber stalinistischen und ex-stalinistischen Parteien immer wieder geführt werden muss: Was bedeutet eigentlich demokratischer Zentralismus?
In der Tradition der bolschewistischen Partei hatte der demokratische Zentralismus zwei entscheidende Elemente. Dazu gehörte das Verständnis als „Organisation der Berufsrevolutionäre“ sowie die Einheit der Hauptbegriffe Demokratie und Zentralismus. Das erste Element, die Notwendigkeit einer politischen Organisation mit gemeinsamem Programm und gemeinsamer Praxis, ist auch bei der DKP entwickelt. Allerdings ist der Weg dorthin problematisch.
Wenn in dem Zitat anscheinend der Mangel an regionaler und kommunaler Analyse beklagt wird, dann wäre doch interessant, wie die DKP vor Ort zu ihrer Politik findet. Dabei dürften wir uns wohl dem Schreckgespenst der stalinistischen Partei nähern, in der die Führung ohne Rückkopplung, ohne Transparenz oder Diskussion mit der Basis bestimmt und ausführen lässt. Diese Führung betont auch stets, wie wichtig die „Einheit“ der Partei ist, v.a. um möglichem Widerspruch von unten den Wind aus den Segeln zu nehmen.
Ein grundlegender Anspruch jeder politischen Organisation müsste sein, dass die Mitglieder vor Ort die dortige politische Situation analysieren können und Perspektiven für die Praxis entwickeln. Natürlich können das nicht sofort alle Mitglieder. Besonders neuere GenossInnen brauchen auch eine „Eingewöhnungszeit“ – aber dies ist wohl nicht das Problem der DKP. Hier scheint es vielmehr so zu sein, dass die lokalen und regionalen Strukturen diese Arbeit immer weiter eingestellt haben, es kaum einen analytischen Austausch gab. Vielleicht ist dem Vorstand der DKP aber auch bei der Diskussion mit der Berliner DKP um den Sachverhalt bei Daimler-Marienfelde aufgefallen, dass vorherige Diskussionen wichtig wären.
Bei der Einheit von Demokratie und Zentralismus geht es v.a. um die volle demokratische Diskussion nach innen und um die geschlossene Einheit nach außen. (Demokratischer) Zentralismus bedeutet dabei die demokratische Wahl der Führungen und das gemeinsame Vertreten der Mehrheitsbeschlüsse nach außen, wie Demokratie (im Zentralismus) auch Wähl- und Abwählbarkeit aller Führungen und Strukturen gewährleisten muss. Der leninistische demokratische Zentralismus sicherte den Mitgliedern der Partei auch Rechte, sich innerhalb der Partei zu organisieren. Tendenzen und Fraktionen haben das volle Recht auf die politische Agitation innerhalb der Partei, solange sie sich unter die Disziplin der Partei stellen. Solange diese Tendenzen und Fraktionen allein um die politische Mehrheit in der Organisation kämpfen, ohne die Organisation zu schädigen, muss dies ein demokratisches Recht aller RevolutionärInnen sein – nicht so in der DKP o.a. Parteien aus stalinistischer Tradition.
Die Bolschewiki beschlossen 1922 ein – als außerordentlich und zeitweilig verstandenes – Fraktionsverbot. Daraus machte Stalin später ein „leninistisches“ Prinzip, ein organisatorisches Dogma der Partei. Nach dieser Methode „Fraktionsverbot“ agieren noch heute alle Parteien dieser Tradition, mit der Folge, dass keine wirkliche Diskussion über Programm, Methode und Taktik stattfindet und politische Differenzen notwendig als undurchsichtiges Gekungel an der Spitze ausgetragen werden oder von vornherein zu Spaltung oder Ausschluss führen. Dies war nie die Tradition der Bolschewiki. Dies entstellt aber bis heute den Begriff der kommunistischen Partei.
Dabei gäbe es viel zu diskutieren in der DKP. Hier einige Möglichkeiten: Wie stehen die KommunistInnen zu den sozialdemokratischen Führungen der Gewerkschaften und v.a., sehen sie diese überhaupt als politische Gegner? Welche Forderungen entwickeln KommunistInnen gegen die Auswirkungen der Wirtschaftskrise? Reicht eine „Wirtschaftsdemokratie“ mit „öffentlicher“ (d.h. des bürgerlichen Staates), „demokratischer“ Kontrolle oder geht es beim Kampf gegen Entlassungen um Betriebsbesetzungen, Generalstreik und Arbeiterkontrolle? Wie entsteht umfassender Frieden in der Welt? Brauchen KriegsgegnerInnen einen akademischen Pazifismus mit Forderungen an die UNO und an das Völkerrecht? Oder machen wir uns Liebknechts Ausspruch „Der Hauptfeind steht im eigenen Land“ und die Methode der anti-imperialistischen Einheitsfront zur Grundlage unseres Kampfes gegen Militarismus und Imperialismus? Wie stehen wir zur Linkspartei? Ist das eine Option für eine klassenkämpferische Linke oder nicht? Ist ihre Entwicklung offen für eine Transformation in Richtung Antikapitalismus? Kann dieses Ziel durch eine Dauermitgliedschaft der „revolutionären“ Linken (strategischer Entrismus) von innen erwirkt werden? Oder durch eine strategische Orientierung auf sie von außen durch die DKP? Wann und wie unterstützen wir diese Partei und wann nicht?
Wie lange wollen KommunistInnen noch die reaktionären Regime von Gaddafi, Assad oder Ahmadinedschad rechtfertigen? Die Demonstrationen in Syrien, die bewaffneten Aufstände des libyschen Volkes richten sich gegen die reaktionären kapitalistischen Machthaber. Ob diese nur Handlanger des Imperialismus oder zumindest formell „Anti-Imperialisten“ waren, ist eine Sache – doch die Unterstützung eines demokratischen und revolutionären Kampfes muss von proletarischen InternationalistInnen sicher gestellt sein, ohne dass diese ein Jota von ihrer Warnung vor den pro-imperialistischen Elementen innerhalb der Kräfte einer wirklichen Volksrevolution, die als politische, demokratisch-bürgerliche begonnen und einstweilen den sozialen Rahmen des halbkolonialen Kapitalismus noch nicht gesprengt hat, abstreichen dürfen.
Apropos Internationalismus – auch dort wäre eine Diskussion angemessen. Werden das Europäische Sozialforum (ESF), die Europäische Linkspartei, der linke Flügel der Gewerkschaftsbürokratie, sowie attac und andere NGOs als die internationalistische Perspektive für KommunistInnen bewertet oder nicht? Und wenn wir schon dabei sind: Brauchen wir nicht eine kämpfende Internationale gegen Imperialismus, (halb-)koloniale und stalinistische DespotInnen? Dazu finden wir nämlich auch nichts in den Dokumenten.
Stalinismus
Das trifft letztlich die gesamte Partei. Auch wenn die DKP heute eine „kritische“ Haltung zu den „Fehlern“ der Sowjetunion unter Stalin einnimmt und nur wenige aus der Partei jeden Schwenk der „Generallinie“ diverser Politbüros verteidigen, so hält die Partei an entscheidenden Grundlagen des stalinistischen Reformismus fest: Konzept des Aufbaus des Sozialismus in einem Land – und damit entschiedene Ablehnung der Notwendigkeit, die sozialistische Revolution zu internationalisieren; Möglichkeit des friedlichen Übergangs zum Sozialismus und damit Ablehnung der Notwendigkeit der Zerschlagung des bürgerlichen Staatsapparates und dessen Ersetzung durch einen qualitativ anderen, proletarischen Rätestaat, der im Zuge der Entwicklung zur klassenlosen Gesellschaft tatsächlich absterben kann; Beibehaltung eines bürokratischen inneren Parteiregimes ohne Fraktionsrechte, wenn auch in einer „milderen“, eher sozialdemokratischen Form. Es zeigt sich dabei auch, dass der Übergang von einer „traditionellen“ stalinistischen Partei zu einer sozialdemokratisierten DKP ein fließender ist – nicht zuletzt, weil es keinen qualitativen Unterschied zwischen Stalinismus und Sozialdemokratismus gibt. Beide sind letztlich Spielarten des Reformismus, bürgerlicher Arbeiterpolitik. Auch ideengeschichtlich stellt der Stalinismus keine Kontinuität des Leninismus dar, sondern einen entschiedenen Bruch, eine Wiederaufnahme von Grundkonzepten des Menschewismus, wie Trotzki unter anderem in dem hervorragenden Artikel „Bolschewismus und Stalinismus“ zeigte (24).
Es ist daher kein Wunder, dass die DKP insgesamt jeden klaren Bruch mit ihrer stalinistischen Vergangenheit ablehnt. Das müsste nämlich zur Erkenntnis führen, dass die Bürokratie und die Parteien der Bürokratie in den degenerierten Arbeiterstaaten Osteuropas, der Sowjetunion, Chinas oder auch Kubas Parteien der politischen Herrschaft einer Bürokratenkaste waren und sind. Diese Parteien waren keine kommunistischen, sondern konterrevolutionäre Parteien, deren Herrschaft es zu stürzen galt oder in Kuba und Nord-Korea zu stürzen gilt, soll die Arbeiterklasse zur bewussten politischen herrschenden Klasse werden. Ansonsten werden die Bürokratien dieser Länder letztlich den Weg ihrer Schwesterparteien in Osteuropa und Asien beschreiten: die Arbeiterklasse noch mehr von „ihrem Staat“ entfremden (so weit das in Nordkorea überhaupt noch möglich ist), die Restauration des Kapitalismus vorbereiten oder sie wie in China gar selbst politisch anführen.
Natürlich ist eine Solidarität mit diesen Ländern nötig gegen den Imperialismus – sei es gegen die Blockade Kubas, sei es gegen Kriegsdrohungen wie im Falle Nordkoreas. Doch das muss Hand in Hand gehen, mit einer unversöhnlichen Feindschaft zur herrschenden Bürokratie und einer revolutionären Opposition gegen diese.
Von all dem ist bei der DKP nichts, aber auch gar nichts zu bemerken. Kuba gilt allen Flügeln der Partei umstandslos als sozialistisch, so wie früher die DDR als großes Vorbild hingestellt wurde. Teile der DKP sehen selbst in China heute noch einen „sozialistischen Staat“, keinen neuen, aufstrebenden Imperialismus.
Gerade an China zeigt sich übrigens auch, dass die Frage des Stalinismus und seiner Charakterisierung eine brandaktuelle Frage ist. Es zeigt letztlich, welche Vorstellung von „Sozialismus“, von „Befreiung“ in der DKP tief verankert ist.
Der „linke Flügel“ der Partei ist gerade bei dieser Frage alles andere als „links“, sondern versucht vielmehr seine Kritik am rechten Parteiflügel durch eine Heroisierung bestimmter, vorgeblich „revolutionärer“ Phasen des Stalinismus, der DKP oder auch der KPD nach 45 zu untermauern. Daher fällt gerade dieser unangenehm durch die offene Verteidigung der stalinistischen Bürokratie und ihrer Verbrechen an der Arbeiterklasse auf – sei es die Niederschlagung des Arbeiteraufstandes 1953 oder die Glorifizierung der Berliner Mauer als „anti-faschistischen Schutzwall“.
Wir laden alle GenossenInnen der DKP dazu ein, mit uns diese Diskussionen zu führen. Gerade Diskussionen über Programm, Methode und Taktik sind heute wichtiger denn je im internationalen Kampf für den Sozialismus. Wir wollen aber vorweg schicken – ohne einen vollständigen theoretischen, programmatischen, strategischen und taktischen Bruch mit dem Stalinismus kann es keine Neubegründung revolutionärer Arbeiterpolitik geben.
Exkurs: Die SDAJ, die Jugendorganisation der DKP
Die „Sozialistische Deutsche Arbeiterjugend“ (SDAJ) ist die Jugendorganisation der DKP, obwohl zumindest auf der Webseite der SDAJ zum Verhältnis beider Organisationen wenig zu finden ist. Lediglich Hinweise auf gemeinsame Aufrufe und Aktionen stehen dort. Auch warum eine Artikel der „Geschichtskommission“ der DKP auf dieser Seite veröffentlicht ist, wird zumindest nicht begründet. Das stalinistische Verständnis vom Verhältnis Partei und Jugend ähnelt durchaus dem sozialdemokratischen, welches, z.B. bei den Jusos zu finden ist, in extremer Form auch beim MLPD-Jugendverband Rebell. Hier bestimmt die Partei die Jugendorganisation organisatorisch und politisch. Ähnlich der Situation in der Erwachsenenpartei ist hier wenig Raum für Diskussion oder Analyse. Stattdessen bestimmt die Partei, wo und wie die Jugendorganisation zu arbeiten hat.
Beim Bericht vom UZ-Pressefest finden wir bei der SDAJ zumindest den Programmpunkt „Warum in die DKP eintreten?“ Dies lässt darauf schließen, dass beide Organisationen wohl ein enges Verhältnis haben dürften.
Diese Art von Jugendorganisation ist meist nur in einzelnen Bereichen aktiv. Darauf fokussiert nämlich die Partei die Jugendarbeit. Natürlich treten auch wir für ein politisch enges Verhältnis der revolutionären Partei zur Jugendorganisation ein, bei allerdings organisatorischer Unabhängigkeit der Jugend – siehe dazu z.B. auch Lenin aus dem Jahr 1916:
„Es kommt oft vor, dass Vertreter der Generation der Erwachsenen und Alten es nicht verstehen, in richtiger Weise an die Jugend heranzutreten, die sich zwangsläufig auf anderen Wegen dem Sozialismus nähert, nicht auf dem Wege, nicht in der Form, nicht in der Situation wie ihre Väter. Das ist einer der Gründe, warum wir unbedingt für die organisatorische Selbständigkeit des Jugendverbandes eintreten, nicht nur deshalb, weil die Opportunisten diese Selbständigkeit fürchten, sondern auch dem Wesen der Sache nach. Denn ohne vollständige Selbständigkeit wird die Jugend nicht imstande sein, sich zu Sozialisten zu entwickeln und sich darauf vorzubereiten, den Sozialismus vorwärts zu führen.“ (25)
Derzeit ist die SDAJ an die reformistische Programmatik der DKP gebunden, ebenso an ihre Volksfront – Methode gegenüber Reformisten und kleinbürgerlichen Kräften. Dementsprechend muss die SDAJ in den Gewerkschaften, den Friedensbündnissen oder den sozialen Bewegungen die gleiche Taktik umsetzen wie die DKP – sicher ein grundlegendes Hindernis für eine sozialistische Organisation. In der Praxis bedeutet das: keine Kritik am in der Elternpartei herrschenden Reformismus, stattdessen Unterordnung unter kleinbürgerliche Ideologien und Strömungen, im Jugendbereich besonders gegenüber Autonomen bzw. dem Antifa-Spektrum. Für die SDAJ wäre daher die Forderung nach einer organisatorischen Unabhängigkeit ein erster wichtiger Schritt, um wieder eine revolutionäre Theorie und Praxis entwickeln zu können.
Das Programm der SDAJ
In ihrem „Zukunftspapier“ aus dem Jahr 2000 legt die SDAJ ihre programmatischen Analysen und Schwerpunkte fest. Hier wollen wir v.a. darauf hinweisen, was fehlt bzw. bewusst ausgeklammert wird. Sicher richtig sind verschiedene Beschreibungen über die Lage der Jugend und ihre Probleme im Kapitalismus.
Für eine Jugendorganisation ist es natürlich wichtig, wie sie heute über Sozialismus und Revolution mit Jugendlichen spricht oder wie sie z.B. den Kampf gegen den Faschismus zu einem revolutionären antikapitalistischen Kampf machen kann. Ebenfalls sollte es Pflicht jeglicher Organisation sein, darüber zu sprechen, was der „real existierende Sozialismus“ war und wie heutige SozialistInnen sich dazu verhalten.
Im „Zukunftspapier“ finden wir dazu gar nichts, was natürlich nicht heißt, dass die SDAJ dazu keine Position hat. Dabei ist diese Frage, wie der „real existierenden Sozialismus“ und die stalinistische Bürokratie charakterisiert werden, eine sehr wichtige, wenn wir für den Sozialismus in der Zukunft kämpfen wollen. Weitere Fragen wären u.a.: Wie richtig ist z.B. die Theorie vom „Sozialismus in einem Land“? Warum wurde die Komintern aufgelöst? War der Ostblock sozialistisch?
Dies sind legitime und gerechtfertigte Fragen, die viele Jugendlichen auch stellen, wenn sie sich mit Sozialismus, Kommunismus und Revolution beschäftigten. Natürlich gibt es dazu Positionen der SDAJ – es sind die Positionen der DKP. Damit aber stellt sich auch die SDAJ ohne eigene Begründung in den Chor derer, die z.B. die Kampagne der Jungen Welt zum Mauerbau unterstützen.
Bei der Begründung des Sozialismus gibt es dann Kapitel unter der Überschrift „Materielle Voraussetzungen“ oder „Der Weg zum Sozialismus führt nur über den Klassenkampf“. Die materiellen Voraussetzungen für den Sozialismus sind gegeben – immerhin, aber ob aus diesem Kapitel zu schlussfolgern ist, dass nur entwickelte imperialistische Staaten zum Sozialismus gelangen können oder auch andere, bleibt schleierhaft. Ohne Klärung dessen würde die SDAJ-Programmatik gerade bei Kautsky nach dem 1. Weltkrieg aufhören. Schließlich wurde aufgrund der „mangelnden“ materiellen Voraussetzungen in Russland die Oktoberrevolution durch diesen Cheftheoretiker der 2. Internationale als Abenteurertum abgelehnt. Das hinderte freilich jene, welche die Kautsky-These unterstützten, später oft nicht daran, den Aufbau des „Sozialismus in einem Land“, wie ihn Stalin verkündete, trotz der mangelhaften Grundlagen zu unterstützen!
Beim Klassenkampf-Kapitel wird auch nicht erwähnt, dass es für den Erfolg der Revolution schon einer revolutionären Massenpartei bedarf, die sich in der Revolution auf die Räte und Organe der Arbeiterklasse stützen muss, wie auch der Begriff „Räte“ nirgends zu finden ist. Ist die Antwort der SDAJ auf die Frage einer Räterepublik diejenige, dass die Volkskammer schon der Ausdruck der proletarischen Herrschaft war?
Die SDAJ bleibt nebulös. Hier wird „klar“, wie sich die SDAJ zum Stalinismus verhält oder was für sie heute revolutionäre Politik wäre – alles ist sehr allgemein gehalten. Wenn jemand etwas Konkretes wissen möchte, kann man ja bei der DKP nachfragen.
In ihrer Praxis agiert die SDAJ sehr nah am autonomen Antifa-Milieu. Dies tut sie nach ähnlicher Methode wie die DKP gegenüber den kleinbürgerlichen Führungen in der Friedensbewegung – ohne jegliche Kritik. Speziell mit Antifa-Gruppen wird gern die „Einheit“ gesucht. Solange sich die Partner in solchen Bündnissen gegenseitig den „revolutionären“ und „klassenkämpferischen“ Stempel aufdrücken, sind alle zufrieden. Dabei unterschreibt die SDAJ zur Not auch jeden libertären Unsinn – Hauptsache, sie darf mitmachen. So entstehen dann auch seltsame volksfrontartige Projekte, in denen alle dabei sein dürfen, solange es einen verschwommenen Minimalkonsens gibt. Natürlich ist es richtig, gerade im Jugendbereich Angebote zu machen, welche auf Aktion und Politisierung zielen, ohne die Jugendlichen mit all zu viel Politik-Kauderwelsch zu nerven. Das heißt aber, dass man als politische Organisation auch nicht verheimlichen sollte, wer man ist, für welches Programm man steht oder warum die eine Forderung aufgestellt wird und die andere nicht.
So ist die SDAJ-Berlin in der KIDZ-Plattform (Kinder des Zorns) gemeinsam mit autonomen Gruppen aktiv. Einmal im Monat können dort linke Jugendliche Infos über aktuelle oder historische Themen bekommen, ebenso über Mobilisierungen etc. So weit, so gut. Dies betreiben die SDAJ und die autonomen Gruppen aber anstelle des Aufbaus einer antikapitalistischen Plattform in der Bildungsbewegung, welche zwar schon irgendwie für richtig gehalten wird, aber aktuell – seit zwei Jahren (!) – abgelehnt wird. Stattdessen wird eine Plattform wie KIDZ betrieben. Dies wollten die beteiligten Gruppen sogar anstelle der Arbeit im Bildungsbündnis „Bildungsblockaden einreißen“ (BBE) machen, für dessen Auflösung – als „Pause“ bezeichnet – sie im Frühjahr 2011 in Berlin eintraten. Der Intervention von REVOLUTION war es geschuldet, dass BBE nicht nur den Protest der GEW in Berlin unterstützte, sondern sich auch für eine bundesweite Wiederbelebung der Proteste und Bündnisse einsetzte, wie z.B. auf der Konferenz in Köln (16./17.7.11) geschehen.
Ähnlich der Politik der DKP scheut auch die SDAJ den Konflikt mit dem Reformismus. Entweder, es wird – wie von KIDZ – möglichst vermieden, überhaupt in Kontakt mit reformistischen Gruppen zu kommen oder auf Bildungsstreik-Konferenzen nicht offen gegen diese gekämpft.
Ausblick
Schließlich versucht die SDAJ, ihre Politik natürlich in eine revolutionäre Tradition zu stellen: manch Slogan über Kommunismus, viele Che-Motive oder Solidarität mit Kuba sind Beispiele dafür. Revolutionäre Phraseologie gehört zum Handwerk. Bei der SDAJ ersetzt sie aber häufig auch Programm und Taktik. Während Kuba und die DDR bzw. der Ostblock als Sozialismus gefeiert werden und sie sich gern in die Tradition der antifaschistischen WiderstandskämpferInnen stellt, ist zugleich kein revolutionäres Programm zur Machtergreifung des Proletariats vorhanden. Es gibt keine Vorstellung von der Bedeutung und die Forderung nach Räten für den revolutionären Kampf. Anstelle von Räten und Arbeiterkontrolle finden wir Phrasen à la demokratischer, gesellschaftlicher Kontrolle. Ebenso wenig gibt es Parolen zur Verteidigung von Streiks und für Streikposten im besonderen wie Arbeiterselbstschutzorgane/-milizen im allgemeinen. Doch was bringt das Schwelgen von der französischen „Resistance“, wenn heute noch nicht mal für Selbstverteidigungsstrukturen der AntifaschistInnen agitiert wird?!
Eines der wesentlichen Merkmale des Reformismus und speziell dessen linkerer Spielarten besteht darin, die Verantwortung für die eigene Weigerung, für revolutionäre oder militante Forderungen einzutreten, auf das rückständige Bewusstsein der Klasse und der unterdrückten Schichten zu schieben – getreu dem Motto „Die sind noch nicht so weit.“ oder „Die verstehen das noch nicht.“
Die SDAJ, im Gefolge der DKP, betreibt eine links-reformistische Politik. Sie hat keine Perspektive gegenüber dem Reformismus, d.h. kein Programm und keine Taktik für den Kampf um die Führung der Klasse bzw. der Jugend. Auch die SDAJ hat einen Minimal-Maximal-Forderungsmix statt eines Übergangsprogramms. Damit versucht sie, möglichst „anschlussfähig“ an andere, nichtproletarische Kräfte zu sein. So passiert es schon mal, dass beim Kampf gegen den Militarismus der Ausstieg der BRD aus der NATO die radikalste Forderung ist. Wie denn die Jugend und die Arbeiterklasse heute die Rüstungskonzerne enteignen und zerschlagen könnten, warum Krieg mit dem Generalstreik beantwortet werden sollte und wieso KommunistInnen immer für die Niederlage ihres imperialistischen „Heimatlandes“ kämpfen sollten – dies alles spielt keine Rolle.
Trotz manch „traditionell kommunistischen“ Anspruchs beweist die SDAJ wie die DKP, dass sie keine leninistische Methode verwenden, weder in der Programmatik noch in der Funktionsweise der kommunistischen Jugendorganisation und der Partei.
Historischer Exkurs: Fragmente des KPD-Programms bis 1956
Dabei scheuen sich weder SDAJ noch DKP, sich in die Tradition der deutschen KPD zu stellen – quasi als Bewahrer des Kommunismus in der BRD. Wir wollen hier nicht auf die stalinistische Tradition mit dem Höhepunkt Anfang der 30er Jahre eingehen, sondern auf die Programmatik der KPD bis zu ihrem Verbot 1956. In dieser Erbfolge sieht sich die DKP und mit Ihr die SDAJ. Dies verdeutlicht auch, wo ihre links-reformistischen und kleinbürgerlichen Taktiken und Methoden herkommen.
Die folgenden Zitate stammen aus der Sammlung „KPD 1945-1968 Dokumente“ der „Edition Marxistische Blätter“ von 1989. Am 11.6.46 erschien ein Aufruf der KPD an das „schaffende Volk in Stadt und Land“. Darin wird beschrieben, was die nächsten Aufgaben sind und was diese mit Sozialismus zu tun haben könnten.
„Mit der Vernichtung des Hitlerfaschismus gilt es gleichzeitig, die Sache der Demokratisierung Deutschlands, die Sache der bürgerlich-demokratischen Umbildung, die 1848 begonnen wurde, zu Ende zu führen, die feudalen Überreste völlig zu beseitigen und den reaktionären altpreußischen Militarismus mit allen seinen ökonomischen und politischen Ablegern zu vernichten. Wir sind der Auffassung, dass der Weg, Deutschland das Sowjetsystem aufzuzwingen, falsch wäre, denn dieser Weg entspricht nicht den gegenwärtigen Entwicklungsbedingungen in Deutschland.“ (26)
Wenn die „Kommunistische“ Partei schon der Meinung ist, dass besser niemand für den Sozialismus kämpfen soll, dann braucht sich auch keiner zu wundern, wenn der Partei nicht die Massen und Herzen zuströmen. Interessant ist weiterhin, dass sich die KPD quasi als Vollender der gescheiterten bürgerlichen Revolution von 1848 in Position bringt, völlig ungeachtet der Tatsache, dass dieses 1848 von der preußischen Monarchie gezähmte und ab 1914 gegen imperialistische Konkurrenten und das eigene organisierte Proletariat wild gewordene Bürgertum grade seinen zweiten imperialistischen Weltkrieg hinter sich gebracht hatte.
Mit dieser Analyse fungierte die KPD als Statthalter des Kreml in Deutschland, wie auch viele andere „kommunistische“ Parteien nur als Verhandlungsmasse mit der jeweiligen bürgerlichen Regierung dienten. Die KPD stellte viele zehntausende Mitglieder (1956: 85.000) und mehr als ein Drittel der Betriebsräte in der BRD, ebenso die Jugendorganisation FDJ. Doch diese Partei hatte 1933 eine schwere Niederlage erlitten – und es gab keine ausreichende Analyse, sie zog keine Lehren daraus, schon gar keine revolutionären. Stattdessen gab es nur eine weitere schroffe – diesmal opportunistische – Wendung in der Taktik. Wie auch die stalinistischen Manöver davor waren aber auch diese nur zum Schaden der Partei.
In ihrem Bundestagswahlprogramm von 1953 steht folgendes über die „Regierungsabsichten“ und Vorschläge der KPD:
„Für eine Koalitionsregierung deutscher Patrioten
Zur Rettung des Friedens und zur friedlichen Wiedervereinigung Deutschlands müssen die Adenauer-Parteien geschlagen und die Adenauer Regierung gestürzt werden. In Wahrnehmung der berechtigten Interessen der Bevölkerung fordert die KPD die Bildung einer Koalitionsregierung deutscher Patrioten, die im Auftrag des deutschen Volkes handelt, die eine deutsche Politik der Verständigung und der Wiedervereinigung Deutschlands, des Friedens, der Demokratie (betreibt)
Die KPD erklärt, dass sie jede Regierung unterstützt und an jeder Regierung teilzunehmen bereit ist, die diese Grundforderungen des Volkes vertritt.“ (27)
Wer denn unter diesen „Patrioten“ zu verstehen ist, wird in Band 1 erklärt: „Deshalb schließen sich dem Bündnis der Arbeiterklasse mit der Bauernschaft die Angestellten und Beamten, die Freischaffenden, die Handwerker und Kleinhändler, die kleineren und mittleren Unternehmer sowie ein bedeutender Teil der westdeutschen Industriellen und Kaufleute an, das heißt, die Mehrheit der nicht am Krieg und an der Kriegsproduktion interessierten Menschen, deren Existenz durch die Maßnahmen der westlichen Besatzungsmächte und Adenauers und durch die Politik der Kriegsvorbereitung bedroht ist.“ (27)
Prägnanter wurde das Konzept der Volksfront, die Unterordnung unter andere Klasseninteressen selten formuliert. Nach einem imperialistischen Krieg das Bündnis mit dem Industriekapital zu suchen, spottet jeglichem „Kommunismus“! Da werden Koalitionen der „Patrioten“ angeboten und natürlich dient sich die KPD jeglicher Regierung an – in Anlehnung an die Volksfront-Regierungen in Spanien und Frankreich in den 1930ern, die gescheitert waren und die revolutionären Möglichkeiten vergeben haben.
Es ist daher kein kommunistisches Erbe, dessen sich DKP und SDAJ rühmen. Es ist ein Teil der reformistischen und stalinistischen Hinterlassenschaften der Geschichte. Es ist die Unterordnung des Proletariats unter die Interessen des Bürgertums, es ist die Liquidation revolutionärer Analyse und Methode. „Gestern Patrioten, heute Pazifisten“, könnte ein flapsiger Slogan für diese Orientierung heißen.
Die KPD hatte zwar das „K“ im Namen und war sogar eine Massenpartei. Doch weder die KPD noch im Nachtrab die DKP oder auch die MLPD haben ein revolutionäres Erbe vertreten oder selbst hinterlassen, auf das sich KommunistInnen heute stützen könnten. Am ehesten können wir noch aus den Anfangsjahren der KPD Rückschlüsse ziehen – einer Partei mit Flügeln und Auseinandersetzungen und ständiger Diskussion mit der zu dieser Zeit, also bis Mitte der 1920er, noch revolutionären Komintern.
Für unsere Periode müssen wir den Aufbau einer revolutionären, kommunistischen Partei und Internationale voran bringen – dies ist objektiv die wichtigste Aufgabe für die nächsten Jahre. In Deutschland besteht die Möglichkeit, mit dem Erbe der DKP oder MLPD zu brechen nur, wenn diese reformistischen und sektiererischen Hindernisse aus dem Weg geräumt werden. Erst dann kann der Begriff „kommunistische Partei“ tatsächlich mit dem wissenschaftlichen und politischen Erbe von Marx und Engels, von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg wieder belebt werden.
Fußnoten
(1) Aktionspolitisches Forderungsprogramm: „Politikwechsel erkämpfen!,
http://www.dkp-online.de/Parteitage/19pt/
(2) Politische Revolution, http://www.dkp-online.de/Parteitage/19pt/
(3) Aktionspolitisches Forderungsprogramm, Seite 5
(4) Wie weiter nach dem Parteitag?, Stimmen von Delegierten, Dietrich Lohse, Kiel, http://www.dkp-online.de/Parteitage/19pt/
(5) Ebenda
(6) Politische Resolution, Seite 6
(7) Forderungsprogramm Seite 2
(8) Verteidigt die Einheitsgewerkschaft – es gibt keine vernünftige Alternative zu ihr
Zu den Betriebsratswahlen und Grundsätzen kommunistischer Gewerkschaftsarbeit, http://www.dkp-online.de/wsg/
(9) „Im Grundsatz für Einheitslisten“, R. Perschewkski
(10) Politische Resolution, 1. Absatz von „Gemeinsame Gegenwehr ist nötig“
(11) Politische Resolution, „Gemeinsamer Widerstand ist nötig“, 6. Absatz
(12) Pol. Resolution, „Widerstand entwickeln – Kräfte zusammenführen“, 2. Absatz
(13) Programm 2006, „Tendenz zur Aggression“, 3. Absatz
(14) Forderungsprogramm „Militarisierung und Kriegspolitik beenden“, 1.Absatz
(15) www.ag-friedensforschung.de/bewegung/schwerpunkte2011.html
(16) Forderungsprogramm, 1. und 2. Absatz
(17) Ebenda
(18) Trotzki: 5 Jahre Komintern
(19) Ebenda
(20) Politische Resolution
(21) Politische Resolution, „Aufgaben und Orientierungen der DKP“
(22) Politische Resolution, „Krise des Parlamentarismus – Gefahren und Chancen“
(23) Forderungsprogramm, „Kommune-Stadtteile-Kreise-Bundesländer“
(24) Trotzki, Bolschewismus und Stalinismus, in: Aufstieg und Fall des Stalinismus, Broschüre der Gruppe Arbeitermacht, Berlin, Oktober 2009
(25) JUGEND¬INTERNATIONALE [Notiz], in: LW 23, 1. Auflage, Berlin/O., 1957, S. 164
(26) KPD 1945-1968 Dokumente, Band 1, Seite 139
(27) KPD 1945-1968 Dokumente, Band 2, Seite 16
(28) KPD 1945-1968 Dokumente, Band 1