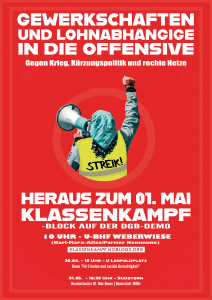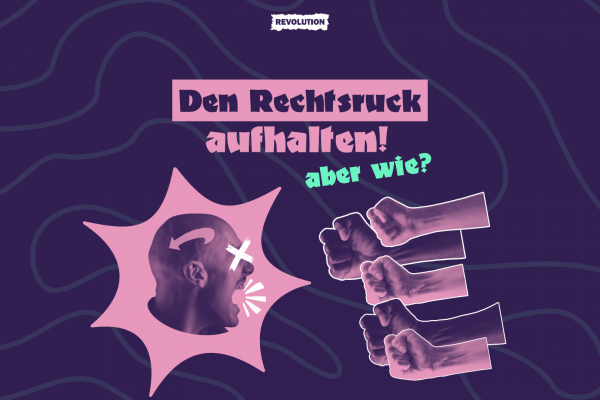Stress an der Schule – ohne Prüfungen geht es nicht?
Lukas Resch, Neue Internationale 247, Juni 2020
Im Einklang mit den allgemeinen Lockerungen werden seit Anfang Mai schrittweise die Schulen wieder geöffnet. Den Anfang machten dabei die Jahrgangsstufen 9, 10 und 12 bzw. 13, die Abschlussklassen also. Gab es am Anfang noch lauten Protest, wie zum Beispiel durch einen Schulstreik in NRW, werden die Gegenstimmen seit Beginn der Prüfungen kaum noch gehört und die nahenden Sommerferien geben Anlass, weitere Einwände für unnötig zu erklären, da nur noch ein bis zwei Monate Unterricht stattfinden.
Da sich aber die aktuelle Gesundheitsgefahr durch das Corona-Virus auf absehbare Zeit nicht lösen wird, lohnt sich ein Blick auf die Hintergründe und die Hürden die SchülerInnen aktuell und auch in Zukunft überwinden müssen. Schon vor der Pandemie sorgten die maroden Zustände an Schulen für Schlagzeilen, doch was früher „einfach nur“ eklig oder schlecht für die Unterrichtsqualität war, wird heute zu Gefahr für Leib und Leben.
Mängel treten deutlich zutage
Grund dafür sind die nach wie vor mangelnden Investitionen in den öffentlichen Bildungssektor, deren Auswirkungen jetzt noch krasser zutage treten. Da oft Klassen auf verschiedene Räume aufgeteilt wurden und viele LehrerInnen, um ein gesundheitliches Risiko zu vermeiden, nicht persönlich unterrichten können, hat sich der Betreuungsschlüssel seit der Wiedereröffnung sprunghaft verschlechtert. Faktisch bedeutet das oft auch, dass SchülerInnen nur an wenigen Tagen und für wenige Stunden zur Schule gehen, ein „normaler“ Unterricht nicht stattfindet.
Dieses ist nicht nur schlecht für die Qualität des Unterrichts, sondern auch für die Gesundheit aller Beteiligten. Dass dabei nicht den ganzen Tag Mundschutz getragen wird, ist zwar irgendwo nachvollziehbar, macht das Ganze aber nicht besser.
Ein weiterer dauerhafter Mangel im Zustand der Schulen sind die Instandhaltung und die Beschäftigung von Personal außerhalb des Lehrkörpers. Tagelang leere Seifen- und Papierspender, dreckige oder kaputte Toiletten, sind schon seit Jahren fester Bestandteil der meisten Schulen. Die Idee, dass nun aus dem Stegreif die zusätzlichen Ansprüche, die ein Schulbetrieb während einer Pandemie bedeutet, erfüllt werden können, scheint nicht nur unwahrscheinlich, sondern erweist sich seit Anfang Mai als durchgehend falsch.
Soziale Selektion
Doch nicht nur in der Schule mangelt es an finanziellen Mitteln. Schon immer haben die sozialen und finanziellen Unterschiede, also letztlich die Klassenherkunft, bestimmenden Einfluss auf die Chancen und Leistungen der SchülerInnen ausgeübt. Durch das E-Learning schlagen diese aber noch stärker zu Buche. Gerade in finanziell schwächeren Familien fehlt oft ein eigenes Gerät für SchülerInnen oder ein Internetanschluss, weil z. B. die Eltern den notwendigen Netzbetrieb über das Handy tätigen. Auch einen eigenen Raum zum Lernen hat nicht jedes Kind zur Verfügung, schon gar nicht wenn die Eltern, wegen Home-Office, Kurzarbeit oder Jobverlust vermehrt oder ganz daheim sind. Gerade die letzten beiden Punkte üben zusätzlichen Druck auf die Jugendlichen aus. Wer kann sich schon auf Algebra oder die Abschlussarbeit in Geschichte konzentrieren, wenn gleichzeitig die Existenzgrundlage der Eltern verschwindet.
Gerade die soziale Ungleichheit wurde vehement als Argument für die Wiedereröffnung der Schulen angeführt, vor allem von Seiten, die bisher blind für diese Thematik schienen. Auch wenn es für einige einen Teil dieses Problems zu lösen scheint, bleiben die bisher bestehenden Probleme unangetastet, unausgesprochen und das eben auch nur für die Abschlussklassen.
Statt für dieses Schuljahr allen SchülerInnen einen Abschluss anzuerkennen, den Numerus Clausus und andere Zugangshürden unbürokratisch abzuschaffen, wird auf einen vorgeblich „echten“ Abschluss und „Leistungsgerechtigkeit“ gepocht.
Erstens haben alle jene SchülerInnen, die es bis kurz vor den Abschluss geschafft haben, in Wirklichkeit längst die notwendigen Leistungen über Jahre erbracht. Zweitens erhöht sich der Druck auf die SchülerInnen angesichts von Pandemie und Wirtschaftskrise ohnedies dramatisch. Das Insistieren auf einen „echten“ Abschluss entpuppt sich als zusätzlich Schikane.
Düstere Aussichten
Hinzu kommt außerdem, dass Jugendliche mit Abschluss in der Tasche keinesfalls eine rosige Zukunft erwartet. Die Aussichten sind vielmehr sehr düster. Zwar gibt es seit 2019 mehr Ausbildungsplätze als BewerberInnen. Diese konzentrieren sich jedoch sehr ungleich, im Wunschberuf kommt auch 2019 nur ein Teil der 525.100 Azubis unter. Dass in bestimmten Branchen (Gastronomie, Reinigung, Baugewerbe) Lehrstellen unbesetzt blieben, hat offenkundig mit geringeren Ausbildungsvergütungen, beschissenen Arbeitszeiten und extrem harten Arbeitsbedingungen zu tun.
Für 2020 ist aber in allen Branchen mit einer massiven Verschlechterung der Lage zu rechnen. Der wirtschaftliche Einbruch wird in allen Bereichen, insbesondere auch bei mittleren und kleinen Betrieben einen Rückgang der Ausbildungsplätze mit sich bringen. Aktuell werden um 8 % weniger erwartet, das dürfte aber eine sehr optimistische Schätzung sein. Hinzu kommt, dass drohende Schließungen und Insolvenzen auch die Ausbildungsplätze und jede Chance auf Übernahme in Frage stellen.
SchülerInnen, die eine Hochschulreife abschließen oder Azubis mit Abitur, die nicht übernommen werden, werden außerdem an die Unis drängen, was die Konkurrenz um die Studienplätze erhöhen wird. Dass sich an ein Studium oft die Frage eines Umzugs knüpft, stellt erneut vor allem finanziell schwächere Familien vor ein Problem, denn die Mietpreise haben sich in den letzten Jahren gerade in den Universitätsstädten erhört.
Andererseits sind durch Corona viele typische StudentInnenjobs verloren gegangen, was angehende und bereits Studierende gleichermaßen in Schwierigkeiten bringt und schlussendlich auch wieder Rückwirkungen auf den Ausbildungsmarkt haben wird. Auch wer ein abgeschlossenes Studium oder eine Ausbildung in der Tasche hat, wird es in der kommenden Zeit schwer haben. Mit der Wirtschaftskrise wird sich auch die Lage am Arbeitsmarkt verschlechtern.
Was tun?
Dieser Trend wird sich weiter verstärken und so werden auch die Chance auf Übernahme und Neueinstellung insgesamt sinken. Der DGB wirbt bereits um eine staatliche Prämie für die Übernahme von Auszubildenden, um von der Insolvenz bedrohte Betriebe zu retten und gleichzeitig einen Crash am Ausbildungsmarkt zu verhindern.
Das wird aber eher nur einen Plazebo-Effekt haben. Die Lage am Ausbildungs- und Bildungssektor insgesamt wird sich nicht durch staatliche Subventionen für krisengeschüttete Unternehmen und die Übernahme von Ausbildungskosten lösen lassen. Außerdem ist auch nicht einzusehen, warum die Masse der steuerzahlenden Lohnabhängigen die Ausbildungskosten für die Betriebe übernehmen soll.
Früher galt in der DGB-Jugend noch der Slogan „Wer nicht ausbildet, muss zahlen“, also Kosten für die Ausbildung in anderen Betrieben übernehmen – heute verschwindet im Zeichen der sozialpartnerschaftlichen Politik der Gewerkschaften selbst diese Reformforderung im Hintergrund. Im Angesicht der Krise braucht es an all diesen Punkten mehr denn je einen Bruch mit der aktuellen Politik. Wir fordern daher:
- Nein zur überhasteten Schulwiedereröffnung. Die Gewerkschaft GEW, VertreterInnen der LehrerInnen, SchülerInnen und Eltern – nicht Schulbehörden, Staat oder sog. „ExpertInnen“ müssen darüber entscheiden, wann die Schule eröffnet wird oder nicht.
- Dies bedeutet auch die Erarbeitung eines Umbauplans der Schulen, um sie für eine „andere Schule“ in Zeiten von Corona fit zu machen: Ausbau von Klassenzimmern, um kleinere Klassengruppen zu ermöglichen, Einrichtung von Teststationen, um die SchülerInnen und LehrerInnen und Verwaltungsangestellte in den Schulen regelmäßig testen zu können. Ein solcher Umbauplan und Restrukturierungsmaßnahmen machen es notwendig, über eine längere Schulschließung nachzudenken.
- Für die Ausstattung aller SchülerInnen mit kostenlosen digitalen Endgeräten um die individuelle Teilnahme an den E-Learning-Angeboten zu gewährleisten.
- Die Versetzung aller SchülerInnen in die nächsthöhere Klassenstufe.
- Absage aller Abschlussprüfungen an allen Schultypen und Anerkennung des Abschusses für alle SchulabgängerInnen (Abitur, andere Abschlussprüfungen). Abschaffung des Numerus Clausus (NC) an den Universitäten und freier Zugang zur Uni für alle AbgängerInnen.
- Sicherung der Ausbildung für alle SchulabgängerInnen. Sollten die Unternehmen Azubis nicht einstellen, müssen sie für deren Ausbildung zahlen (Umlage) und soll sie durch den Staat bei voller Vergütung gesichert werden.
- Übernahme aller Azubis in ihren Lehrbetrieb. Sollte die Übernahme aufgrund von Schließungen nicht möglich sein, sollen diese Betriebe entschädigungslos enteignet, die Azubis bei vollen Tariflöhnen übernommen werden. Sie sollen für gesellschaftlich nützliche Arbeit (z. B. im Gesundheitswesen, für die Wiedereröffnung der Schulen im Herbst, für ökologische Erneuerung) etc. beschäftigt werden.
- Für die Neueinstellung zusätzlicher Lehrkräfte, die Verringerung der Klassenteiler und der Deputatsstunden. Die Schulen werden sich im kommenden Schuljahr mit einer inhomogeneren SchülerInnenschaft auseinandersetzen müssen. Hierfür müssen Bedingungen geschaffen werden, um es den Schulen zu ermöglichen, mit dieser umzugehen.
- Für eine massive Ausweitung der Bildungsbudgets, Ausbau von Schulen und Kitas. Schluss mit der Privatisierung der Schulen, Privatschulen in öffentliche Hand. Für eine gemeinsame Schule aller unter Kontrolle von LehrerInnen, SchülerInnen und VertreterInnen der Lohnabhängigen.
Wir werden diese Forderungen aber nicht geschenkt bekommen. Die DGB-Gewerkschaften müssen mit ihrer Burgfriedenspolitik brechen. Die GEW muss nicht nur kritisieren, sondern vor allem mobilisieren. Anstatt Politik zusammen mit den Unternehmen zu gestalten, sollte sie eher eine Bewegung für die Durchsetzung ihrer Forderungen aufbauen.