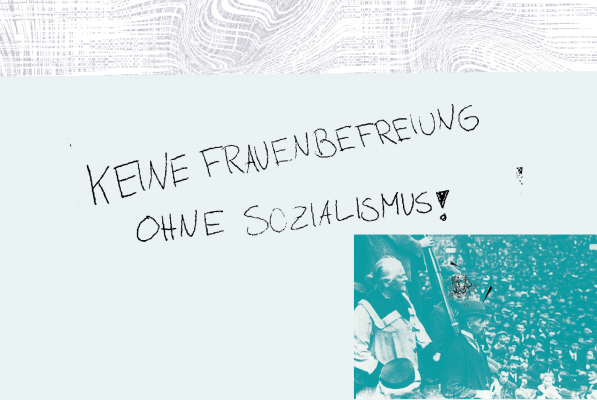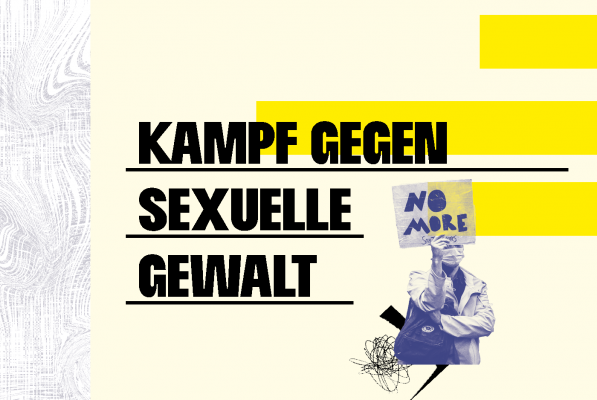Krise auf dem Rücken der Unterdrückten: Frauen zahlen den doppelten Preis

Lina Lorenz, Gruppe Arbeiter:innenmacht, Fight! Revolutionäre Frauenzeitung 13, März 2025
Der Klimawandel manifestiert sich im heißesten Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen, begleitet von extremen Wetterereignissen wie Hurrikan Helene, Taifun Gaemi und verheerenden Überschwemmungen in Valencia. Die weltweite Militarisierung setzte sich fort, mit zerstörerischen Kriegen – dem Ukrainekrieg in Europa, dem israelischen Völkermord in Gaza und den Bombardierungen der Nachbarländer, dem blutigen Bürgerkrieg im Sudan und der brutalen Repression der Militärregierung gegen die eigene Bevölkerung in Myanmar. Die Zahl der Menschen, die weltweit vor Krieg, Konflikten und Verfolgung fliehen mussten, ist auf einem Rekordhoch. Gleichzeitig zeigte sich der zunehmende Rechtsruck und trieb den Aufstieg rechter und populistischer Parteien voran, die in einer Reihe von Wahlen triumphierten. Damit einhergehend nimmt nicht nur Rassismus massiv zu, sondern wir sehen auch massive Kürzungen wie in Argentinien oder den USA, die die Lebensbedingungen von Millionen Menschen verschlechtern. Kurzum: Die weltweite Krisenhaftigkeit verstärkt sich zunehmend.
Multiple Krisen?
Wir befinden uns aktuell in einer Krise, die sich auf verschiedenste Bereiche des Lebens auswirkt und alle Dimensionen der Gesellschaft betrifft – also eine ökonomische, politische, soziale und ökologische Krise ist. Dabei wird häufig der Begriff der „multiplen Krise“ oder „Polykrise“ verwendet, um die Vielschichtigkeit zu betonen. Dies verschleiert jedoch die gemeinsame materielle Ursache und suggeriert, dass verschiedene Krisen parallel existieren würden.
Denn die zunehmende Krisenhaftigkeit in all ihren Facetten ist kein bedauerlicher Zufall oder unerklärlich, sondern hat System. Sie ist Ausdruck der Widersprüche unserer kapitalistischen Produktionsweise, welche nach der Logik der Profitmaximierung funktioniert, statt sich an den Bedürfnissen der Menschheit zu orientieren. In ihrer zugespitzten Form hat sie ein System geschaffen, das von zunehmender Konkurrenz auf globaler Ebene geprägt ist und in welchem die dominierenden imperialistischen Mächte um die Ausweitung ihrer Einflusssphären kämpfen. Krieg, Armut, Ausbeutung menschlicher und natürlicher Ressourcen, Klimawandel und Verelendung sind die Folge.
Wir müssen uns also der gemeinsamen Grundlage der Krisenhaftigkeit bewusst werden und die Arbeiter:innenklasse als das universelle Subjekt zu ihrer Auflösung begreifen. Nur sie hat die Werkzeuge in der Hand, die kapitalistische Produktionsweise aus den Angeln zu heben. Es braucht also einen gemeinsamen Kampf gegen die Grundlagen der Krisenhaftigkeit, statt die verschiedenen Facetten einzeln zu betrachten und lösen zu wollen.
Überakkumulation als Ursache der Krisenhaftigkeit
Die zunehmende Krisenhaftigkeit des kapitalistischen Systems hat dabei ihre Wurzeln in der Krise der Rentabilität. In den letzten Jahrzehnten ist weltweit ein tendenzieller Rückgang der Profitraten zu beobachten. Dies führt dazu, dass Kapital zunehmend unrentabel wird und nicht mehr gewinnbringend investiert werden kann, was früher oder später unweigerlich zu einer ökonomischen Krise führen muss.
Ein Teil des überakkumulierten Kapitals flieht in Sektoren, die außerhalb der inzwischen unrentabel gewordenen Industrie liegen, wie etwa den Immobilienmarkt. Dort kommt es zu fiktiven Wertsteigerungen von unproduktivem Kapital. Auch Lohndrückerei und Intensivierung der Arbeit sowie verschärfte Ausbeutung und ökonomische Unterwerfung der Halbkolonien sind Folge dieser Entwicklung, können die Profitrate aber nur kurzfristig stabilisieren.
Die weltweite Finanzkrise 2007/8 ist Ausdruck dieser Entwicklung. Doch statt einer Vernichtung des überschüssigen Kapitals kam es zu einer Rettung großer Unternehmen durch expansive Geldpolitik – gemäß dem Prinzip „too big to fail“. Ein großer Teil des überakkumulierten Kapitals wurde aufrechterhalten, das nach wie vor nicht in ausreichendem Maße gewinnbringend investiert werden konnte. Die Ursache der Krise, die Überakkumulation von Kapital, konnte also nicht beseitigt werden und führte zu deren Verschleppung. Der Ausbruch der Corona-Pandemie 2020 brachte die Krise erneut ins Rollen und wurde zum Beschleuniger der schon zuvor tiefsitzenden Krisenmomente. Es kam zu einem dramatischen Einbruch der Produktion und massiven wirtschaftlichen Störungen. Auch hier wurde ein großer Teil der bedrohten Unternehmen durch staatliche Hilfen vor dem Zusammenbruch bewahrt, sodass Kapital weiterhin in sogenannten Zombieunternehmen feststeckt.
Aktuell finden wir uns also in einer Situation wieder, in welcher über mehrere Zyklen hinweg überakkumuliertes Kapital vor der Zerstörung bewahrt wurde und der Fall der Profitraten stetig voranschreitet. So verbleiben wir nach wie vor in einer Phase der Instabilität und Krise, die an Schärfe zunimmt. Die Konkurrenz zwischen verschiedenen Kapitalgruppen, die um ihr Überleben kämpfen, nimmt zu. Auf globaler Ebene schafft diese Entwicklung eine zunehmend explosive Situation, in der Kapitale und mit ihnen verstrickte imperialistische Mächte versuchen, ihre Einflusssphären auszuweiten und, da es keine neuen Gebiete mehr zu unterwerfen gibt, sich in einem beschleunigten Kampf um die Neuordnung der Welt befinden. Der Hauptantagonismus findet dabei zwischen den USA und China statt.
Auswirkungen auf Frauen
Als Resultat der globalen Entwicklung kehren reaktionäre Ideologien verstärkt zurück. In sozialen Medien romantisieren Trends wie „Tradwife“ das Hausfrauenleben – ein unerreichbares, rückschrittliches Ideal für die meisten Frauen der Arbeiter:innenklasse. Dies geschieht im Kontext eines erstarkenden Rechtsrucks, der nicht nur ideologische Verschiebungen mit sich bringt, sondern auch reale Angriffe auf soziale Rechte.
Während in Zeiten des Wirtschaftswachstums Zugeständnisse möglich sind, führt die Krise zu Sparmaßnahmen, Autoritarismus und der Einschränkung von Rechten, was ideologisch untermauert wird. Rechtspopulistische Kräfte wie die AfD in Deutschland oder Meloni in Italien mobilisieren gegen antirassistische, feministische und queere Bewegungen, spalten die Arbeiter:innenklasse und festigen bürgerliche Ideale. Queere Personen werden verstärkt als Bedrohung wahrgenommen, was Gewalt und Diskriminierung verschärft. 2024 war das bisher tödlichste Jahr für trans Personen, Straftaten gegen queere Menschen haben sich seit 2010 verzehnfacht. In Deutschland gab es Angriffe auf CSDs, in Bayern, Sachsen und Sachsen-Anhalt wurde Gendern an Schulen und/oder in anderen öffentlichen Einrichtungen verboten. In den USA setzen Anti-Drag-Gesetze (gegen Transvestismus z. B. in öffentlichen Drag-Shows) und Angriffe auf das Abtreibungsrecht Rückschritte durch. Doch auch auf anderen Ebenen sieht die Situation nicht gut aus:
1. Beschäftigungsverhältnisse und Gender Pay Gap
Im Jahr 2024 betrug die weltweite Beschäftigungsquote für Frauen 45,6 %, während sie für Männer bei 69,2 % lag. Das heißt, dass ein Viertel mehr Männer als Frauen einer bezahlten Arbeit nachgingen. Der Hauptgrund ist dabei die Rolle der Care-Arbeit. Im Jahr 2023 waren weltweit 748 Millionen Menschen aufgrund von Betreuungsaufgaben nicht erwerbstätig, davon waren 708 Millionen Frauen und 40 Millionen Männer. Dies ist ein leichter Anstieg im Vergleich zur Situation vor der Pandemie. Denn 2018 zeigten die Daten, dass dies weltweit 606 Millionen Frauen und 41 Millionen Männer betraf. Insgesamt geht aus dem ILO-Bericht „World Employment and Social Outlook: Trends 2024“ jedoch hervor, dass die Frauenerwerbsquote nach der Pandemie sich schneller als gedacht erholt hat, aber ungleichmäßig verläuft. Das heißt, dass nicht alle Arbeitsmarktgruppen in gleicher Weise profitieren. Besonders junge Frauen in Halbkolonien sind benachteiligt.
Dabei wird immer wieder herausgestrichen, dass „totale Geschlechtergleichheit” in mehr als 100 Jahren erreicht werden würde. Dies klammert aber aus, dass sich durch politische Angriffe, die aktuell stattfinden, die Situation massiv verschlechtern wird. Schließen Krankenhäuser oder Kitas aufgrund von Sparmaßnahmen, müssen Frauen oft Pflege und Erziehung übernehmen. Gleiches gilt, wenn größere Angriffe gefahren werden, wie die geplante Streichung von Obamacare durch Trump in den USA. Denn auch wenn dies nicht damit gleichzusetzen ist, dass man Frauen verbietet zu arbeiten, so stellt sich häufig die pragmatische Frage: Wer passt auf Kinder auf und pflegt kranke oder ältere Angehörige? Die Antwort dabei ist einfach: Frauen.
Denn die verdienen im Schnitt weniger, weswegen sie dann eher zu Hause bleiben. Das ist ein globales Phänomen. Für den Dollar, den ein Mann verdient, bekommt eine Frau im Durchschnitt 51,8 Cent, also fast die Hälfte weniger als Männer – selbst wenn sie ähnliche Arbeit leistet. In Deutschland liegt der unbereinigte Gender Pay Gap aktuell bei 18 %, was einerseits an Lohnunterschieden bei gleicher Arbeit liegt, andererseits an vermehrter Teilzeitarbeit und Beschäftigung im Niedriglohnsektor. So liegt der Gender Care Gap in Deutschland aktuell bei 44,3 %, was bedeutet, dass Frauen durchschnittlich 79 Minuten mehr pro Tag, also etwa 9 Stunden mehr pro Woche, unbezahlte Care-Arbeit leisten als Männer.
2. Gewalt gegen Frauen: die doppelte Bürde von Krieg und Krise
Massiv zugenommen hat jedoch die Gewalt, die Frauen erleben. Das hat mehrere Gründe: Zum einen ist die Zahl weltweiter Konflikte gestiegen. Dabei werden Feminizide und sexualisierte Gewalt oftmals gezielt als Kriegswaffe eingesetzt oder entstehen als Folge von Verarmung und Flucht. So sind im Sudan laut UN Women (Organisation der Vereinten Nationen für die Gleichstellung der Geschlechter und die Ermächtigung von Frauen) mehr als 6,7 Millionen Menschen von geschlechtsspezifischer Gewalt bedroht. Berichte über Gewalt in Paarbeziehungen, sexuelle Ausbeutung, Missbrauch sowie Menschenhandel haben seit dem Beginn des Bürgerkrieges massiv zugenommen. Ein anderes Beispiel, wie Zivilist:innen ins Fadenkreuz kommen, ist Gaza. Hier sind 70 % der ermordeten Frauen und Kinder, also mehr als 32.000. Bei dem Genozid an den Palästinenser:innen in Gaza kann man zudem beobachten, wie gezielt öffentliche Infrastruktur angegriffen und zerstört wurde – Wohnhäuser, Schulen, Krankenhäuser, Universitäten. Das hat dazu geführt, dass sich die gesamte Versorgungsqualität aller Bewohner:innen verschlechtert hat, Frauen und Queers leiden darunter aber nochmal besonders.
Ein anderer Grund ist der Faktor häusliche Gewalt. Während es bisher keine aktuellen Zahlen gibt, wie sehr die Zahl nach der Corona-Pandemie gestiegen oder gesunken ist, veröffentlichte die UN 2024, dass schätzungsweise 736 Millionen Frauen – fast jede dritte – mindestens einmal in ihrem Leben körperlicher und/oder sexueller Gewalt durch einen Partner, Nicht-Partner oder beidem ausgesetzt (30 Prozent der Frauen ab 15 Jahren) waren. Laut Bericht von Amnesty International wurden im vergangenen Jahr weltweit fast 89.000 Frauen und Mädchen ermordet. Mehr als die Hälfte aller Tötungsdelikte wird dem Bericht zufolge von Familienmitgliedern oder Intimpartnern begangen. Fast jeden Tag stirbt in Deutschland eine Frau durch einen Femizid. Hinzu kommt eine Zunahme häuslicher Gewalt und geschlechtsspezifischer Übergriffe, deren Dunkelziffer enorm ist.
Werden Frauen dann vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen, verstärkt dies die Zurückdrängung in die Familie und geht mit einer wachsenden Abhängigkeit von Männern einher, wodurch sie stärker der Gewalt ausgesetzt sind.
Was tun?
Es sind besonders Frauen der Arbeiter:innenklasse, die von der Krise betroffen sind, da sie am stärksten unter ökonomischen und sozialen Krisen leiden und sich in prekären Lohnarbeitsverhältnissen befinden. Sparmaßnahmen, das Wegfallen von Kitas oder Pflegeeinrichtungen treffen sie besonders hart und bürden ihnen zusätzlich zur prekären ökonomischen Situation die Last der Care-Arbeit auf. Zwar richten sich Misogynie und Gewalt auch gegen Frauen des Kleinbürger:innentums und der Kapitalist:innenklasse, doch können diese die Folgen der Krise oft finanziell kompensieren, Reproduktionsarbeit auslagern und sich leichter aus Abhängigkeitsverhältnissen lösen.
Die derzeitige Krise spitzt sich weiter zu, was die Lage der Frauen weiter verschlechtert. Daher muss sich die gesamte Arbeiter:innenklasse in Stellung bringen und für ein revolutionäres Programm gegen die Krise kämpfen. Innerhalb der Arbeiter:innenbewegung braucht es eigene Strukturen für Frauen, da sie einer doppelten Unterdrückung und spezifischen Formen sexistischer Diskriminierung unterliegen. Zudem treten wir ein für den Aufbau von Selbstverteidigungsstrukturen von Frauen, damit sie sich gegenseitig vor sexualisierten und gewalttätigen Angriffen schützen und diese abwehren können, und fordern den Ausbau von Schutz- und Zufluchtsräumen. Zugleich müssen wir für die Vergesellschaftung der Haus- und Sorgearbeit, die Beendigung der geschlechtlichen Arbeitsteilung und die ökonomische Unabhängigkeit von Frauen kämpfen.