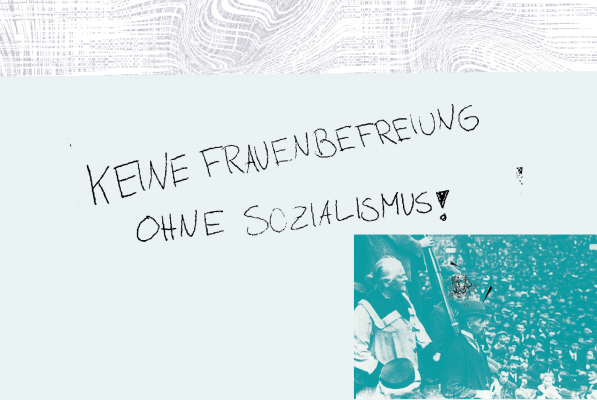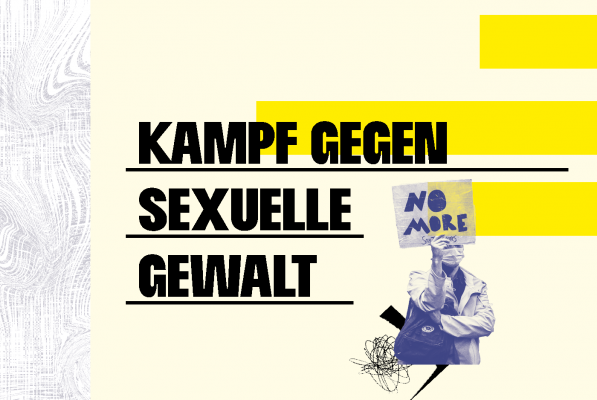Frankreich: Generalstreik und Blockaden gegen Sparhaushalt

Quelle: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tours_-_Graffiti_Gr%C3%A8ve.jpg
KD Tait, Infomail 1295, 21. Oktober 2025
Am 18. September kam es in Frankreich zu einer der stärksten Ausdrucksformen des Widerstands der Arbeiter:innenklasse in den letzten Jahren: einem landesweiten Generalstreik und Massendemonstrationen gegen das Regime von Emmanuel Macron und die drohenden Ausgabenkürzungen.
Von Paris bis Marseille folgten Lehrer:innen, Krankenhausangestellte, Verkehrsbeschäftigte, Apotheker:innen, Student:innen und Beschäftigte des öffentlichen Dienstes dem Aufruf der Gewerkschaften zu koordinierten Streiks.
Schätzungen gingen von bis zu einer Million Teilnehmer:innen aus, obwohl die Behörden die Zahl eher auf die Hälfte bezifferten. Die Störungen waren weit verbreitet. Schulen wurden geschlossen oder blockiert, Regionalzüge standen still, öffentliche Dienste waren lahmgelegt.
In Paris, Nantes, Lyon und darüber hinaus füllten Demonstrationszüge die Straßen. Es wurde eine große Zahl von Polizist:innen eingesetzt, und an einigen Orten kam es zu Zusammenstößen, obwohl die Gewalt insgesamt unter Kontrolle blieb.
Was die Demonstrant:innen vereinte, war ihre Wut auf ein System, das von den arbeitenden Menschen Opfer verlangt, um die Schulden zu bedienen und die besitzenden Klassen zu retten. Die unter der abgewählten Regierung Bayrou vorgeschlagenen Haushaltskürzungen – eine drastische Einsparung von 44 Milliarden Euro bei den öffentlichen Ausgaben – sind äußerst unpopulär.
Die Parolen der Gewerkschaften waren klar: „Besteuert die Reichen“, „Keine Sparpolitik mehr“ und „Die Straßen schreiben den Haushalt“.
Bei dieser Massenmobilisierung konnten wir sehen, was ein eintägiger Generalstreik noch bewirken kann: eine Demonstration der Macht der Arbeiter:innenklasse außerhalb der parlamentarischen Käfige, eine Untergrabung der Legitimität der herrschenden Ordnung und eine Generalprobe für weitere Eskalationen.
Neuer Premierminister
Kaum eine Woche zuvor hatte Präsident Macron Sébastien Lecornu zu seinem neuen Premierminister ernannt, nachdem die Regierung Bayrou nach einem gescheiterten Vertrauensvotum zusammengebrochen war.
Lecornu, ein loyaler Anhänger Macrons, ist seit langem ein politischer Insider: ehemaliger Verteidigungsminister, bekannte Persönlichkeit im inneren Kreis Macrons, nun in der Hoffnung auf Stabilität im Chaos befördert.
Nach seiner Ernennung machte Lecornu bescheidene symbolische Gesten. Er zog den Plan zur Streichung von zwei Feiertagen (eine äußerst unpopuläre Maßnahme von Bayrou) zurück und versprach, die „lebenslangen Vergünstigungen” für ehemalige Premierminister und Minister ab Januar 2026 zu beenden.
Aber man darf sich keinen Illusionen hingeben: Dies waren marginale Zugeständnisse, die darauf abzielten, die öffentliche Wut zu besänftigen, nicht aber, den Kurs der neoliberalen Sparpolitik umzukehren.
Lecornus erster Anlauf zur Regierungsbildung scheiterte jedoch. Im zweiten Anlauf konnte schließlich ein „neues“ Kabinett gebildet werden, nachdem Lecornue die Umsetzung der sog. Rentenreform aussetze, sodass die Sozialistische Partei der neuen Regierung ihr Vertrauen aussprach. Ob es ihr gelingt, in einem zersplitterten Parlament einen Kurs festzulegen, bleibt fraglich.
Darüber hinaus hat er erklärt, dass er einen Haushalt vorlegen wird, der darauf abzielt, das Defizit bis 2026 auf 4,7 % des BIP zu senken, was eher auf Kontinuität als auf Veränderung hindeutet.
Aus Sicht der herrschenden Klasse ist Lecornu ein sicherer Kandidat – ein technokratischer, loyaler Funktionär, der das Schiff in unruhigen Gewässern stabilisieren soll. Aber in den Augen der Arbeiter:innenklasse, der linken Parteien und der radikalen Kräfte erbt er eine Legitimitätskrise, die auf der Straße und nicht in den Korridoren der Macht entstanden ist.
Widersprüche
Der Streik vom 18. September und die Amtseinführung von Lecornu offenbaren einen krassen Widerspruch. Einerseits ist die herrschende Klasse durch institutionelle Lähmung und das Fehlen einer Mehrheit eingeschränkt. Andererseits übt die Arbeiter:innenklasse von unten mit echter Kraft Druck aus.
Das Regime kann keine aggressive neoliberale Agenda vorantreiben, ohne massiven Widerstand zu provozieren. Dennoch kann es nicht vollständig zurückweichen, da seine Legitimität auf Haushaltsdisziplin, Schuldendienst und dem Vertrauen globaler Investor:innen beruht.
Dieser Moment birgt Potenzial. Das Terrain ist offen. Der Massenstreik hat den Bann der parlamentarischen Normalität gebrochen, und Lecornu muss sich auf Repression, Manöver und fragile Koalitionen stützen, um zu regieren. Die einzige Möglichkeit für die Arbeiter:innenklasse, diese Krise zu ihren Gunsten zu nutzen, besteht darin, sich zu weigern, ihre Forderungen auf Verhandlungen innerhalb des Parlaments zu beschränken.
Die Gewerkschaften müssen mit rollierenden Arbeitsniederlegungen, allgemeinen Sektorstreiks, Fabrik- und Bürobesetzungen, lokalen Arbeiter:innenräten und der Zusammenarbeit mit radikalen Jugend- und sozialistischen Organisationen eskalieren. Jeder Protest muss zu einem organisatorischen Bruch mit den bürgerlichen Parteien führen.
Das Regime von Lecornu versucht, wie seine Vorgänger, den Konflikt in den „Bereich der Verhandlungen” zu verlagern. Aber Verhandlungen sind kein sicherer Hafen; die Zugeständnisse von gestern geraten zum Verrat von morgen. Die Lehre aus dem 18. September ist, dass die Arbeiter:innenklasse die Mittel der Macht ergreifen, nicht einen Platz am Verhandlungstisch fordern, sondern ihn umwerfen muss.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der 18. September ein Weckruf war. Lecornu ist kein neuer Anfang – er ist der jüngste Verwalter eines Systems in der Krise. Die wirklich wichtige Antwort ist die Selbstorganisation und Mobiliserung der Arbeiter:innenklasse. Wenn die Bewegung das nicht begreift, wird das Regime überleben, indem es die Wut durch Reformen besänftigt, die seinen wesentlichen Charakter unverändert bewahren.