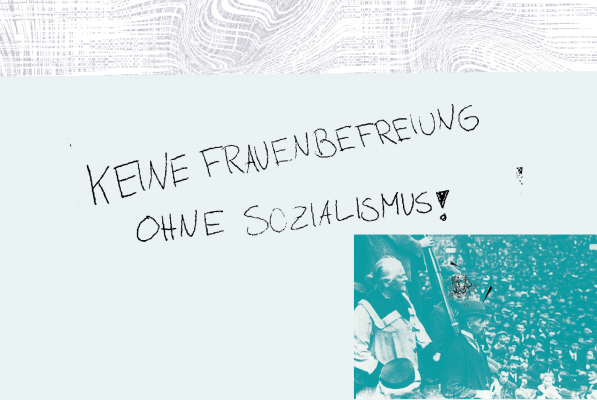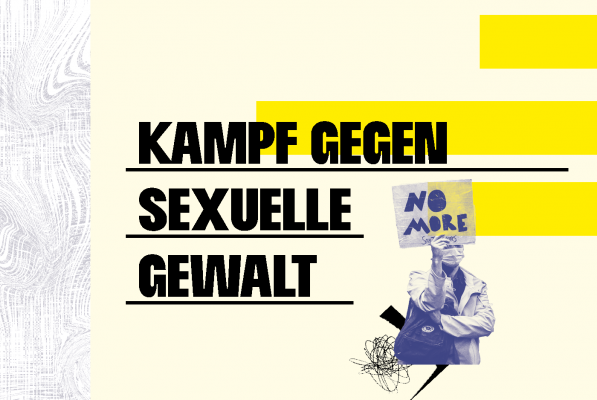Fitnesswahn und Abnehmspritzen: Wie Krise und Kapitalismus unsere Körper formen wollen

Cara Fuchs, Revolution Österreich, Fight! Revolutionärer Frauenzeitung 13, März 2025
Schönheitsideale wandeln sich wieder einmal: In den letzten Jahren dominierten die Body-Positivity-Bewegung und BBLs (Brazilian Butt Lift; Fettverpflanzung an den Po), nun kehrt der Trend zum Dünn-Sein zurück. Kim Kardashian entfernt sich ihre Implantate, Klamottenläden wie Primark sowie H&M nehmen Klamotten in „Übergröße“ aus den Läden, Shirin David landet mit ihrem Motivationssong „Bauch, Beine, Po“ den Sommerhit 2024 in Deutschland und rät uns, ins Fitnessstudio zu gehen, um im Bikini „hot“ auszusehen. Dass jene, denen wir nacheifern sollen, ein unerschöpfliches Repertoire an Ressourcen haben, bleibt oft unerwähnt – auch um uns den Konsum schmackhaft zu machen. Zum Beispiel kann Fitness-Influencerin Pamela Reif den ganzen Tag trainieren und gesund kochen – ein Luxus, den die meisten von uns nicht haben. Dennoch wird suggeriert, dass wir mit genug Einsatz genauso aussehen könnten. Dabei bräuchten wir angeblich keine Zeit, sondern nur die richtigen Produkte, gesundes Essen und das perfekte Workout (Körpertraining) – neben Vollzeitjob, Ausbildung und Care-Arbeit.
Für alle ohne Zeit gibt es dann noch andere Mittel und Wege. Ozempic (Internationaler Freiname: Semaglutid), ein Medikament, ursprünglich für Diabetes Typ 2 entwickelt, machte letztes Jahr Schlagzeilen. Die Nebenwirkung, ein länger anhaltendes Gefühl der Sättigung zu haben und somit in kurzer Zeit vergleichsweise viel abzunehmen, machte es populär, auch in Hollywood. Doch es ist nicht ungefährlich, es gibt auch Nebenwirkungen. So stieg die Nachfrage nach dem verschreibungspflichtigen Medikament so sehr an, dass es 2024 in den USA zeitweise zu Engpässen kam, was fatale Folgen für Diabetiker:innen hatte, und das trotz Nebenwirkungen wie Bauchspeicheldrüsenentzündungen.
Der Druck hat also Konsequenzen. Eine Befragung des Unternehmens DOVE zeigt, dass jede fünfte Frau bereit wäre, fünf Jahre eher zu sterben (!), wenn sie stattdessen sofort den gesellschaftlichen Schönheitsidealen entsprechen würde. Eine andere Befragung der Krankenkasse Pronova BKK ergab, dass ein Drittel der deutschen Bevölkerung Strandurlaube meidet, da es sich nicht in Badebekleidung zeigen will. Auch der Hass gegenüber übergewichtigen Personen steigt wieder: 43 Prozent der unter 30-Jährigen dieser Studie sind der Meinung, übergewichtige Menschen sollten sich nicht in Bikini, Badeanzug oder Badehose zeigen. Die neue Ära des Fit-Seins und der Selbstoptimierung ist also angebrochen. Oder war sie nie weg?
Schön ist das, was du nicht haben kannst
Dass es Trends gibt, wir ihnen folgen und dafür einiges auf uns nehmen, ist nichts Neues. Das zeigt uns die Geschichte: Im 15. und 16. Jahrhundert zupften sich Frauen Augenbrauen und Haaransatz, um eine möglichst hohe Stirn wie Königin Elisabeth I. zu bekommen, oder Menschen – überwiegend Frauen – schwärzten sich in Japan ab dem 18. Jahrhundert die Zähne (Ohaguro). Ob heute oder früher: Schönheitsideale sind immer geprägt durch eine herrschende Klasse und reproduzieren bestimmte Attribute dieser (oder Dinge, die für sie nützlich sind), weshalb sie auch immer ausgrenzend sein müssen.
Gab es dabei in der Vergangenheit noch große regionale Unterschiede, so hat sich das in einer globalisierten Welt mit einer imperialistischen, westlichen Vormachtstellung weitestgehend geändert. Die Ideale, denen wir nacheifern sollen, sind oft weiße Körper, auf ein binäres Geschlechtssystem zugeschnitten und somit absolut rassistisch und unerreichbar für einen großen Teil der Menschheit. Selbst wenn dann mal Menschen mit anderen Hautfarben erfolgreich sind, so verkörpern auch sie oftmals nur eine andere Variante des westlichen Schönheitsideals, wie z. B. Naomi Campbell (Supermodel der 1990er Jahre während der Heroin-Chic-Ära; Look, der Anfang der 1990er Jahre populär wurde und durch blasse Haut, dunkle Augenringe, ausgemergelte Gesichtszüge, Androgynität und strähniges Haar gekennzeichnet war – alles Merkmale, die mit dem Missbrauch von Heroin oder anderen Drogen in Verbindung gebracht wurden) oder Alia Bhatt (Bollywood-Schauspielerin).
Warum der Schlankheitswahn gerade jetzt wieder zunimmt
Dass sich gerade jetzt ein neuer Körpertrend abzeichnet, ist kein Zufall. Gerade in Zeiten der Krise muss der Konsum angekurbelt werden und das funktioniert nun mal gut mit einem neuen Schönheitsideal. Das Ausspielen verschiedener Körpertypen gegeneinander und ein Nacheifern unerreichbarer Ideale bringt nicht nur der Modeindustrie Geld ein, sondern auch der Fitness-, Kosmetikindustrie, Schönheitschirurgie und vielen mehr. Abmagerungsmittel gelten aktuell als neuer Börsen-Hype neben der KI-Blase: Der Aktienkurs von Wegovy (Semaglutid)-Hersteller Novo Nordisk hat sich mehr als verdoppelt, der dänische Konzern ist zum wertvollsten Unternehmen Europas aufgestiegen. Der Pharmariese Eli Lilly aus den USA hat ebenfalls eine Abmagerungsspritze auf den Markt gebracht, die Lilly-Titel gewannen im selben Zeitraum sogar fast 250 Prozent.
Diesem Selbstoptimierungszwang wohnt noch ein anderes, zerstreuendes Element inne: Wer ständig Kalorien zählt und am eigenen Körper zweifelt, hat weniger Kapazität, sich gegen soziale Angriffe zu wehren. Gleichzeitig werden Menschen, die vom Ideal abweichen, herabgewürdigt, was die Spaltung der Arbeiter:innenklasse verstärkt. Ein zusätzlicher Aspekt ist die Disziplinierung. Schlanke Körper sollen besonders dafür stehen, dass man sich beim Essen zurückhält und beim Sport alles gibt. So ist auch die Erfindung der Maßeinheit Kalorien im 19. Jahrhundert ein Produkt des Klassenkampfes von oben. Die Historikerin Nina Mackert erklärt, dass erst mit deren Einführung die Vorstellung aufkam, dass man seinen Körper selbst gestalten könne, woraufhin Dicksein mit Faulheit gleichgesetzt werden konnte. Ebenso wurden Lohnkürzungen damit begründet, dass Arbeiter:innen, um ihre Familie zu ernähren, für das gleiche Geld, statt Wurst ja auch günstigere, kalorienreichere Lebensmittel wie Haferflocken hätten kaufen können. Auch zeigten sich bei der Einführung der Kalorie rassistische und sexistische Tendenzen. Schwarze Arbeiter:innen erhielten beim Bau des Panamakanals weniger Rationen, weil sie weniger verbrauchen würden. Der Kalorienverbrauch von Frauen wurde bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts lediglich geschätzt. Auch heute sehen wir diese Gleichsetzung von Disziplin und Schlankheit: Arbeitslosen in Großbritannien, die übergewichtig sind, solle Ozempic kostenlos zur Verfügung gestellt werden, damit sie bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben.
Wie wehren wir uns dagegen?
Genauso wie Schönheitsideale ist die Unterdrückung der Frau keine Erfindung des Kapitalismus, das zeigt die Geschichte. Doch was tun? Schließlich durchdringen Beauty-Wahn, Sexismus und sexuelle Unterdrückung unsere ganze Gesellschaft.
Die Antwort ist klar: Wir müssen das Problem an der Wurzel packen: den Kapitalismus. Es braucht eine klassenlose Gesellschaft. Dabei müssen wir den Kampf dagegen mit Forderungen verbinden, die aufzeigen, um was für eine Gesellschaft es gehen soll: Das bedeutet, uns gegen veraltete Rollenbilder einzusetzen und jene, die sie verbreiten. Ob bei Film, Fernsehen, Spiel oder Theater: Kulturschaffende, große Medienhäuser und Werbeagenturen müssen enteignet und von Arbeiter:innen kontrolliert werden. An Orten, wo sich Arbeiter:innen aufhalten, wie Gewerkschaften, braucht es ein Recht für Unterdrückte auf gesonderte Treffen unter ihresgleichen (Caucuses), wo z. B. Frauen sich ungestört über Erfahrungen mit Sexismus austauschen können. Und klar ist:Antisexistische Arbeit ist nicht alleine Frauensache. Männer müssen ebenfalls dazu verpflichtet werden, ihr Verhalten zu reflektieren. Ein Kampf gegen unterdrückerische Rollenbilder ist ein Kampf gegen Sexismus, gegen sexualisierte Gewalt, ungleiche Bezahlung und schlussendlich gegen den Kapitalismus.
Wenngleich wir uns gegen den Schlankheitswahn und unterdrückerische Schönheitsideale stellen, so erkennen wir an, dass es ein Bedürfnis danach gibt, fit und gesund zu sein. Da uns als Arbeiter:innen und Jugendlichen Geld und Zeit dafür fehlen, setzen wir uns für kostenfreie Ernährungsberatung und Fitnessstudios sowie für Zugang zu günstigem, leckerem und gesundem Essen ein, beispielsweise ermöglicht durch staatliche kostenlose Mensen oder ein Mindesteinkommen für alle, angepasst an die Inflation! Denn Gesundheit darf keine Klassenfrage sein! Dennoch ist Gesundheit natürlich nicht mit einem dünnen Körper gleichzusetzen. Womit wir uns wohlfühlen, muss für jede/n von uns die eigene Entscheidung bleiben!
Bezüglich fehlender Plus-Size-Mode („Übergrößen“) wollen wir wieder mehr Diversität in den Größen. Die Möglichkeit, uns in unserer Kleidung wohlzufühlen, darf nicht von unserem Gewicht abhängen. Des Weiteren müssen Kleidungsgrößen über alle Produktionsstätten hinweg einem einheitlichen Standard unterliegen, damit ein M in einem anderen Geschäft nicht ein XL ist! Um das umzusetzen, sind jedoch die Enteignung unter Arbeiter:innenkontrolle und eine Planwirtschaft vonnöten, um den realen Bedarf zu ermitteln.
Außerdem fordern wir:
- Gegen unterdrückerische Schönheitsideale in Werbung und Medien! Enteignet die großen Medienhäuser und die „Kultur schaffende“ Industrie (Gameentwickler:innen, Filmproduktionen …) genauso wie Google, Instagram und Co.!
- Für organisierte Medienarbeit durch Räte aus Zuschauer:innen, Arbeiter:innen und Kreativen ohne die Reproduktion von Unterdrückung!
- Für einen selbstbestimmten, offenen Umgang mit dem weiblichen Körper, auch erkämpft durch eine breite Kampagne gegen Sexismus und Schönheitsideale, organisiert durch die Gewerkschaften!
- Für eine internationale, proletarische, antisexistische Bewegung!