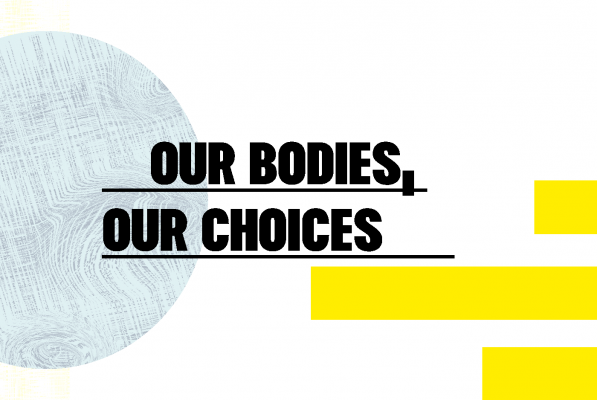Entstehung, Programm, Praxis – zum Charakter der Linkspartei

DIE LINKE, CC BY 2.0 , via Wikimedia Commons
Martin Suchanek, Neue Internationale 279, Dezember 2023 / Januar 2024
Die Gründung der Partei DIE LINKE 2007 geht auf die Fusion von „Wahlalternative Arbeit und soziale Gerechtigkeit“ (WASG) und der „Partei des demokratischen Sozialismus“ (PDS) zurück. Sie bildete eine Antwort auf die Agenda 2010, auf die sozialdemokratische Dominanz und den Verrat der SPD an der Arbeiter:innenklasse, der auch im Verhältnis zwischen dieser und Lohnarbeiter:innen eine nachhaltige Zäsur bedeutete.
Das Positive daran war sicherlich eine Erschütterung des SPD-Monopols auch in den Gewerkschaften, die – anders als bei den Grünen in den 1980er Jahren – nicht zur Bildung einer „radikalen“ kleinbürgerlichen, später offen bürgerlichen Alternative zur SPD führte, sondern zur Entstehung einer zweiten reformistischen Partei.
Mit Gründung der Linkspartei ist eine zweite, im Grunde linkssozialdemokratische Partei entstanden. Andererseits war DIE LINKE selbst nie mehr als eine Partei zur Reform und Bändigung des Kapitalismus – und wollte auch nicht mehr sein.
Entstehung
Das verdeutlichte bereits ihre Entstehung. Die PDS war trotz ihres parlamentarischen Überlebens eine schrumpfende Partei, die nur in den neuen Bundesländern und Berlin über einen Massenanhang verfügte. Die Mitgliedschaft betrug 1990 noch 285.000 Mitglieder, 1991 172.579 und im Jahr 2006, also vor Fusion mit der WASG, 60.338.
Die ehemalige PDS-Mitgliedschaft wies bei der Fusion einige Besonderheiten in der Sozialstruktur auf, die davon herrühren, dass sie aus der Partei der ehemals herrschenden Bürokratie der DDR hervorging und die dort politisch absolut dominierende gewesen war.
Mehr als 60 Prozent der PDS-Mitglieder waren 2006 älter als 65 Jahre, also Rentner:innen. Die jüngeren sind es jedoch, die im Apparat der Partei, in den Stiftungen, Landtagen, Kommunen usw. als Funktionär:innen tätig sind. Zweitens lag der Anteil der Gewerkschaftsmitglieder an der Parteimitgliedschaft in der PDS mit 37 Prozent deutlich unter jenem der SPD (57 Prozent). Drittens verfügten 54 % der PDS-Mitglieder über einen Hochschulabschluss gegenüber 33 Prozent bei der SPD, während umgekehrt nur 30 % die Schule mit einem Hauptschulabschluss oder ohne Schulabschluss absolviert hatten – ein extrem geringer Prozentsatz für eine Massenpartei, die sich sozial auf das Proletariat stützt, 2006 auch extrem gering gegenüber 40 Prozent bei der SPD und 50 Prozent in der Gesamtbevölkerung.
Die PDS war zwar auch immer eine reformistische, bürgerliche Arbeiter:innenpartei. Aber anders als die SPD stützte sich ihre organische Verankerung kaum auf die Gewerkschaften. Diese wurde vielmehr über den Einfluss in anderen Massenorganisationen wie der Volkssolidarität, Mieter:innenvereinigungen, lokalen Verbänden sowie eine historisch gewachsene Verbindung zu den akademisch gebildeten Schichten der ostdeutschen Lohnabhängigen gebildet. Dazu kam ein Massenanhang auch unter sozial schlechter gestellten Teilen der Arbeiter:innenklasse, insbesondere auch Arbeitslosen im Osten.
Das wirkliche neue politische Phänomen bei der Fusion stellte die WASG dar. Diese war ein Resultat der Massenproteste und Mobilisierungen gegen die Angriffe der rot-grünen Regierung – Agenda 2010 und Hartz-Gesetze – und der damit verbundenen Krise der SPD.
Auch beim Blick auf die WASG ist jede nachträgliche Idealisierung fehl am Platz. Schon der Name „Wahlalternative“ war instruktiv dafür, worin die Praxis der zukünftigen Partei bestehen sollte. Zweitens war die WASG von Beginn an von einem „traditionalistischen“ Flügel der reformistischen Gewerkschaftsbürokratie, ihren akademischen Wasserträger:innen und ehemaligen SPD-Funktionär:innen um Lafontaine dominiert und geführt.
Für diese, die WASG von Beginn an prägende und dominierende Strömung war immer auch klar, wie eine zukünftige neue Partei der „sozialen Gerechtigkeit“ aussehen müsste. Sie sollte eine Wahlpartei sein, die im Zusammenspiel mit den Gewerkschaften und deren Führungen sowie anderen, vom Reformismus dominierten sozialen Bewegungen (z. B. attac, Friedensbewegung) v. a. an der Wahlurne einen „Politikwechsel“ erzwingt, eine Partei, deren Ziel die Verteidigung oder Wiedererrichtung des „Sozialstaates“ war.
Die WASG litt jedoch an einem inneren Widerspruch, der die reformistische Führung umtrieb und beunruhigte und zugleich das klassenkämpferische Potenzial der neuen Partei zum Ausdruck brachte. Die WASG zog nämlich als Mitglieder nur wenige Bürokrat:innen an, sondern vor allem Arbeitslose und Aktive aus den sozialen Bewegungen. Sie war eine Partei der Hartz-IV-Bezieher:innen; von Arbeitslosen, die damals mit 345 (West) bzw. 331 (Ost) Euro plus Wohngeld über die Runden kommen mussten. In vielen Städten machten diese die Hälfte der Mitgliedschaft oder mehr aus.
Auch wenn diese Schicht der Mitgliedschaft viele der Illusionen in den „Sozialstaat“, den Parlamentarismus und die Möglichkeit einer „Reformpolitik“ teilte, so wollte sie eine aktive Partei bilden, die für die Belange der Arbeitslosen und anderer Unterdrückter und Ausgebeuteter kämpft.
Die WASG war zwar von Beginn an eine bürgerliche Arbeiter:innenpartei. Doch die vorherrschende Bürokrat:innenclique verfügte noch nicht über einen starken, verlässlichen Apparat. Noch hatte sich in ihr kein stabiles Verhältnis zwischen Führung und Basis herausgebildet, das in langjährig etablierten reformistischen Parteien fast automatisch die Gefolgschaft der, meist passiven, Mitglieder sicherstellt. Die WASG hingegen war eine reformistische Partei mit einer außergewöhnlich aktiven Mitgliedschaft, was aus ihrer Verbindung zur Arbeitslosenbewegung herrührt.
Für die PDS und heute DIE LINKE oder die SPD war und ist es normal, dass die überwältigende Mehrheit der Mitglieder außer der Beitragszahlung nichts oder wenig tut, zu keinen Versammlungen erscheint oder, wo sie es tut, dort mehr oder weniger passiv agiert und die Vorgaben von oben abnickt. Das stärkt die Führung und das ist im Grunde auch so gewollt. Die aktiven Mitglieder reformistischer Parteien sind in der Regel die Funktionär:innen der Partei bzw. Funktionsträger:innen des bürgerlichen Staates oder korporatistischer Gremien wie Betriebsräten, von Sozialverbänden oder ähnlichem. Und genau diesen „Normalzustand“ einer bürgerlichen Partei – und eine solche, wenn auch besondere Form ist auch eine bürgerliche Arbeiter:innenpartei – wollten die Spitzen von WASG und PDS mit der Fusion zur Linkspartei bewusst herbeiführen.
Das haben sie mit der Fusion mit der PDS auch geschafft. Von den 12.000 WASG-Mitgliedern machte nur etwas mehr als die Hälfte die Fusion mit. Viele widersetzten sich der bürokratischen Fusion und der Regierungspolitik der PDS, die vor allem in Berlin katastrophal war. Den Höhepunkt erlebte diese Rebellion der Bewegungsbasis in der Kandidatur der Berliner WASG gegen die PDS 2006, wo die PDS 9,2 % der Stimmen verlor und auf 13,4 % absackte. Die Berliner WASG konnte einen Achtungserfolg mit 3,8 % der Erststimmen und 2,9 % der Zweitstimmen (40.504) verbuchen.
Dieser Erfolg der WASG und die Formierung des Netzwerks Linke Opposition (NLO) brachten das Potential eines Bruchs und einer weiteren Radikalisierung zum Ausdruck, der jedoch auch daran scheiterte, dass ein Teil der Linken, die den Wahltritt in Berlin unterstützt hatten, vor dieser Perspektive zurückschreckte und, allen voran die SAV, in den Schoß der Linkspartei zurückkehrte. Neben linken Fusionsgegner:innern blieben v. a. die Arbeitslosen, die unteren Schichten der Arbeiter:innenklasse, der neuen Partei fern.
Die Entstehung 2007 verdeutlicht auch das reale Verhältnis der Partei zu sozialen Bewegungen. Diese sind solange willkommen, als sie der Partei Mitglieder und Wähler:innen zutragen – nicht jedoch als eigenständiger Faktor, der der Spitze gefährlich werden und die Partei real zu einem Instrument von Klassenbewegungen von unten machen könnte.
Außerdem konnte DIE LINKE diese Verluste durch ein scheinbar stetes Wachstum und Wahlerfolge von 2007 – 2010 leicht kompensieren. Abgesehen von Bayern überwand sie in diesem Zeitraum bei allen westdeutschen Landtagswahlen die 5 %-Hürde. Auch im Osten fuhr DIE LINKE Rekordergebnisse ein, so 2009 in Thüringen (27,4 %) und Brandenburg (27,2 %). Bei den Bundestagswahlen 2009 brachte sie es auf 11,5 % (gegenüber 8,7 % 2005) und 76 Abgeordnete.
Bei ihrer Gründung 2007 hatte DIE LINKE insgesamt 71.711 Mitglieder in 16 Landesverbänden. In den Folgejahren stieg die Zahl auf 75.968 (2008) und 78.046 (2009). 2010 schrumpfte die Mitgliedschaft jedoch um fast 5.000 auf 73.658. Seither ist die Mitgliederzahl der Partei, wenn auch mit einzelnen Ausnahmen, stetig rückläufig. 2023 beträgt sie nur noch 55.000.
Programm und Strategie
Dem reformistischen Charakter der Partei entsprachen von Beginn an ihre programmatischen, strategischen Vorstellungen.
Das Programm der Partei DIE LINKE (Programmatische Eckpunkte, angenommen 24./25. März 2007) trug von Beginn an die Handschrift des keynesianischen, auf die Gewerkschaftsbürokratie und die Arbeiter:innenaristokratie orientierten Mehrheitsflügels der Partei. Als strategisches Ziel der Partei verortet es einen „Politikwechsel“, gestützt auf das Erringen einer „antineoliberalen gesellschaftlichen Hegemonie“.
DIE LINKE bekennt sich in den programmatischen Eckpunkten ihres Gründungsparteitages 2007 ausdrücklich zum freien Unternehmer:innentum. Dort heißt es: „Gewinnorientiertes unternehmerisches Handeln ist wichtig für Innovation und betriebswirtschaftliche Leistungsfähigkeit.“ (S. 3) Der Staat habe nur dafür zu sorgen, dass dieses im kreativen Überschwang nicht über die Stränge schlage und gegen das Gemeinwohl verstoße.
Dahinter steht die alte reformistische Mär, dass der Gegensatz von Kapital und Arbeit im Rahmen der kapitalistischen Verhältnisse durch die Intervention von Staat und Politik, wenn schon nicht überwunden, so erfolgreich abgemildert werden könne – was wiederum impliziert, dass „der Staat“ kein Instrument zur Sicherung zur Herrschaft der Bourgeoisie wäre, sondern über dem Klassengegensatz stünde.
Dabei ist den Strateg:innen der LINKEN durchaus klar, dass eine einfach Mehrheit im Parlament, ein Parteienbündnis von LINKEN und SPD (und evtl. den Grünen) nicht ausreicht, um die Sabotage jeder fortschrittlichen Maßnahme durch die herrschende Klasse, die Manipulation der öffentlichen Meinung durch die monopolisierten bürgerlichen Medien usw. abzuwehren.
Marx, Lenin und alle anderen revolutionären Marxist:innen haben daraus und aus der Aufarbeitung der Klassenkämpfe und Revolutionen seit Beginn der bürgerlichen Epoche den Schluss gezogen, dass das Proletariat – will es sich befreien, will es dem kapitalistischen Ausbeutungssystem ein Ende setzen – den bürgerlichen Staat nicht einfach übernehmen, nicht auf eine „Regulierung“ des Kapitalmonopols an den Produktionsmitteln hoffen darf, sondern die herrschende Klasse enteignen, den bürgerlichen Staatsapparat zerschlagen und durch die Herrschaft der in Räten organisierten bewaffneten Arbeiter:innenklasse ersetzten muss.
DIE LINKE schlägt hier einen ganz anderen, wenn auch nicht gerade originellen Weg vor. Eine „Reformregierung“ müsse sich auf die „gesellschaftliche Hegemonie“ stützen – sprich darauf, dass auch die „weitsichtigen“ und „sozialen“ Teile der herrschenden Klasse für eine Politik des Klassenausgleichs gewonnen werden müssen.
Eine solche Politik bedeutet notwendigerweise eine Unterordnung der LINKEN unter einen Flügel der herrschenden Klasse, eine Garantie für das Privateigentum an den Produktionsmitteln. Es bedeutet notwendig eine staatstragende Politik der „Opposition“.
Der Partei schwebt eine Marktwirtschaft ohne große Monopole und Konzerne vor, ein Sozialismus auf Basis von Warenproduktion und pluralen Eigentumsverhältnissen.
DIE LINKE erkennt zwar die Existenz von Klassen und auch des Klassenkampfes an – aber nicht dessen Zuspitzung. Der Kampf für Sozialismus oder eine andere Gesellschaft durch die Linkspartei ist für die Alltagspraxis allerdings weitgehend fiktiv, eine Worthülse. Das drückt sich auch im Sozialismusbegriff aus. Dieser wird nicht als bestimmte Produktionsweise, sondern vor allem als Wertegemeinschaft verstanden. So heißt es im Grundsatzprogramm von 2011:
„Wir wollen eine Gesellschaft des demokratischen Sozialismus aufbauen, in der die wechselseitige Anerkennung der Freiheit und Gleichheit jeder und jedes Einzelnen zur Bedingung der solidarischen Entwicklung aller wird.“
Dieser Anklang an Marx ist allerdings auch schon alles, was mit dessen Vorstellung von Sozialismus/Kommunismus und dem Weg dahin zu tun hat. Anstatt einer Revolution als Vorbedingung zur Entwicklung gen Kommunismus sieht der Programmentwurf einen „längere(n) emanzipatorische(n) Prozess (vor), in dem die Vorherrschaft des Kapitals durch demokratische, soziale und ökologische Kräfte überwunden wird und die Gesellschaft des demokratischen Sozialismus entsteht.“ Der Boden des bürgerlich-demokratischen Systems ist ihr als politisches Terrain heilig, die sozialistische Revolution lehnt sie ab.
Das bedeutet aber auch, dass sie die Maßnahmen zur Verwirklichung ihrer Ziele und Version dieses Sozialismus durch Regierungsbeteiligungen herbeiführen muss. Wo die Linkspartei an der Regierung ist, gestaltet sie die bestehenden Verhältnisse mehr oder minder sozial mit. Dabei akzeptiert sie die Institutionen des bürgerlichen Systems als unüberschreitbaren Rahmen linker Politik, der allenfalls durch einzelne Reformen zu erweitern wäre.
Das entscheidende Problem dieser Konzeption liegt im Verständnis von Klassenkampf und Staat. Der bürgerliche Staat wird als Mittel zur Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse begriffen, als Terrain des Klassenkampfes, nicht als Staat des Kapitals, als Herrschaftsinstrument der Bourgeoisie.
Der Unterschied zum Marxismus besteht dabei nicht darin, dass der Kampf um Reformen und für demokratische Rechte abzulehnen wäre. Er besteht auch nicht darin, dass nicht auch Kämpfe auf staatlichem Terrain ausgetragen werden können und müssen, sondern in der Annahme, dass diese den Klassencharakter des bürgerlichen Staats aufheben könnten. Die Transformationsstrategie begreift ihn als ein ein zu reformierendes Instrument gesellschaftlicher Veränderung hin zum Sozialismus.
Das findet sich auch im noch heute gültigen Grundsatzprogramm von 2011, dem angeblich linken „Erfurter Programm“ wieder:
„DIE LINKE kämpft in einem großen transformatorischen Prozess gesellschaftlicher Umgestaltung für den demokratischen Sozialismus des 21. Jahrhunderts. Dieser Prozess wird von vielen kleinen und großen Reformschritten, von Brüchen und Umwälzungen mit revolutionärer Tiefe gekennzeichnet sein.“
Auch wenn hier nebulös von Brüchen und Umwälzungen mit revolutionärer Tiefe gesprochen wird, so bleibt folgendes Kernproblem: Die Transformationsstrategie löst die Dialektik von Reform und Revolution so auf, dass die Revolution als eine in die Breite gezogene, bloß tiefer gehende, grundlegendere und langwierige Reform verstanden wird. Die Revolution bildet dann im Grunde nur eine Fortsetzung ewiger Reform- und Transformationsbemühungen.
Kommunistische Politik betrachtet die Frage gerade umgekehrt. Die Revolution stellt einen Bruch dar, ein qualitativ neues Moment, eine grundlegende Veränderung der Machtverhältnisse. So wichtig einzelne Reformen auch sein mögen, so zeichnet sich eine revolutionäre Veränderung durch die Machteroberung einer bisher ausgebeuteten Arbeiter:innenklasse aus. Dabei ist aber nicht die Transformation des bürgerlichen Staates kennzeichnend, sondern vielmehr umgekehrt das Zerbrechen oder Zerschlagen dieses Apparates. Die Herrschaftsinstrumente des Kapitals werden ersetzt durch qualitativ neue vorübergehende Formen politischer Herrschaft, die Räteherrschaft der Arbeiter:innenklasse, also die Diktatur des Proletariats anstelle der des Kapitals.
Vor diesem Hintergrund wird auch die Begrenztheit einer in der Linkspartei gern geführten Debatte zwischen linkem und rechtem Flügel ersichtlich, zwischen kommunaler/parlamentarischer Regierungsarbeit und Bewegungslinker/Parteiapparat. Die gesamte Transformationsstrategie verspricht zwar eine Verbindung dieser, stößt aber unwillkürlich selbst auf das Problem, dass eine bürgerliche Regierung auch mit der Linkspartei eine solche bleibt. D. h., die Partei muss dann notwendigerweise an der Regierung gegen die Interesse der Arbeiter:innenklasse und Unterdrückten handeln und jene der herrschenden Klasse vertreten – oder sie müsste mit ihrem gesamten Konzept brechen. Die Transformationsstrategie, die in der realen Regierungspraxis ohnedies keine Rolle spielt, erfüllt im realen Leben im Grunde nur die Aufgabe einer Rechtfertigungsideologie für die bestehende Praxis.
Wohin das Konzept der Linkspartei führt, zeigt sich an den Regierungen selbst, wenn sie teilweise aktiv in Bewegungen ist. Auch dort nimmt es eine zwiespältige Haltung an, z. B. in der Wohnungspolitik Berlins. Dort wird DWE unterstützt, aber die rot-roten Regierungen hatten mehr Wohnungen privatisiert als jede andere. Wo DIE LINKE regiert, erfüllt sie auch alle repressiven Aufgaben des Staates – z. B. regelmäßige Abschiebungen von Geflüchteten auch in Berlin oder Thüringen etc. Über diese Leichen im Keller spricht die Linkspartei nicht gerne. Dabei bilden sie das notwendige Resultat ihrer Realpolitik.
Selbst wo die Partei noch längst nicht Regierungsfunktionen ausübt, präsentiert sie sich allzu oft als staatstragend. So z. B. der Spitzenkandidat Bartsch, als er an einer Solidaritätskundgebung mit Israel während der Bombardierung von Gaza teilnahm.
Diese alles andere als sozialistischen Politiken sind keine Warzen im demokratisch-sozialistischen Gesicht der Linkspartei, sondern notwendige Folgen ihrer politischen Konzeption. Sie liegen in der Logik einer Partei, die den Kapitalismus nicht überwinden, die Herrschaft der Bourgeoisie nicht brechen, den bürgerlichen Staat nicht zerschlagen, sondern mit verwalten und transformieren will.
Programmatische Methode
Dies erfordert jedoch nicht nur eine Ablehnung, sondern auch eine Kritik der Methode des Programms. Allgemein fällt bei diesem auf, dass es zwar viele Forderungen inkludiert, aber vollkommen unklar ist, welchen Stellenwert sie für die Praxis und Strategie der Partei haben. Dieses Manko ist jedoch durchaus typisch für reformistische Organisationen. Schließlich will die Parteiführung nicht gern an den eigenen Versprechen gemessen werden. Sie will freie Hand haben und sich nicht mit Forderungen ihrer Mitglieder und Anhänger:innen konfrontiert sehen, welche die Erfüllung der Versprechen einfordern und Rechenschaft verlangen könnten.
Insgesamt offenbart der Entwurf ein Programmverständnis, das methodisch im Reformismus und Stalinismus wurzelt. Es ist vom Programmtyp her ein Minimal-Maximal-Programm, d. h. der Sozialismus als „historisches Endziel“ steht – trotz der scheinbaren Verbindung durch einen längeren „transformatorischen Prozess“ – unverbunden neben (oft durchaus richtigen) Alltagsforderungen. Die Kämpfe um höhere Löhne, gegen Sozialabbau, Hartz IV, Krieg, Aufrüstung usw. sind aber nicht mit dem Ringen um den Sozialismus verwoben. Der Sozialismus ist als Losung im Grunde hier nichts anderes als das Amen in der Sonntagspredigt.
Anstelle eines Minimal-Maximal-Programms bräuchte es ein Programm von Übergangsforderungen. Ein solches müsste soziale, gewerkschaftliche und demokratische Kämpfe gegen Krise, Krieg und Rassismus mit der Perspektive der Machtergreifung der Arbeiter:innenklasse verbinden. Diese käme allerdings nicht etwa dadurch zustande, dass Forderungen wie „Gegen Entlassungen! Für Verstaatlichung!“ usw. einfach mit der Losung „Für Sozialismus!“ ergänzt werden. Dazu wäre es nötig, dass die Selbstorganisation der Klasse gefördert wird, dass sie sich eigene Machtpositionen und -organe im Betrieb, im Stadtteil und letztlich in der Gesellschaft erkämpft. Solche Forderungen sind z. B. jene nach Arbeiter:innenkontrolle über Produktion, Verteilung, Verstaatlichung, Sicherheitsstandards usw. Es sind Forderungen nach Streikkomitees, die von der Basis direkt gewählt und ihr verantwortlich sind; zur Schaffung von Streikposten, Selbstverteidigungsorganen, Preiskontrollkomitees usw. bis hin zu Räten, Arbeiter:innenmilizen und einer Arbeiter:innenregierung, die sich auf die Mobilisierungen und Kampforgane der Klasse stützt.
Diese – und nur diese – Übergangsmethodik würde programmatisch das repräsentieren, was Marx über den Sozialismus sagte: dass er die „wirkliche Bewegung“ ist und nicht etwa nur eine „Vision“ oder „Utopie“, wie es DIE LINKE gern formuliert. Diese Elemente fehlen in deren Programm völlig.
Dieser sicher nicht nur für diese Partei typische Mangel bedeutet konkret, dass die Arbeiter:innenklasse in ihrem Kampf über das, was sie als Führungen und Strukturen vorfindet, nie bewusst und gezielt hinauskommt. Es bedeutet, dass das Proletariat letztlich den reformistischen Parteien, Gewerkschaftsapparaten, Betriebsräten, dem Parlamentarismus oder, noch schlimmer, den spontan vorherrschenden bürgerlichen Ideologien dieser Gesellschaft ausgeliefert bleibt.
Das Fehlen von Übergangsforderungen bedeutet, dass die Klasse sich in ihrem Kampf bürgerlichen Strukturen und Ideen unterordnet. Gemäß der LINKEN soll also die gesellschaftliche Dynamik zur Überwindung des Kapitalismus in den Bahnen der alten Gesellschaft, also zu den Bedingungen der Bourgeoisie erfolgen. Daran ändern auch ein paar Volksentscheide oder ein bisschen mehr „Mitbestimmung“ nichts.
Methodisch wurzelt all das letztlich in einer undialektischen Sichtweise von Geschichte und Klassenkampf. Das Prinzip des Minimal-Maximal-Programmes entspricht der Vorstellung von gesonderten, nicht miteinander verbundenen Etappen der Revolution bzw. des historischen Prozesses allgemein. Wie im Stalinismus, der die Revolution auf die demokratische Phase beschränkte, geht es auch der LINKEN um begrenzte Reformen. Dass selbst diese objektiv oft eine Dynamik Richtung Sozialismus annehmen, selbst die Umsetzung grundlegender bürgerlich-demokratischer Aufgaben im imperialistischen Zeitalter nur durch das Proletariat und unter dessen Führung errungen und durch den Sturz der Bourgeoisie gesichert werden kann, bleibt der LINKEN ein Buch mit sieben Siegeln.
Das marxistische Programmverständnis hingegen geht vom aktuellen Stand des internationalen Klassenkampfes aus und unterbreitet Vorschläge, wie dieser – also Aktion, Bewusstsein und Organisierung – vorangebracht werden kann. Das impliziert auch, konkret zu benennen, welche Kampfformen, Konzepte, Organisationen und Führungen den Kampf behindern, schwächen oder falsch orientieren und wie die Klasse den Einfluss dieser Faktoren überwinden kann.
Das Programm der Linkspartei entspricht deren reformistischem Charakter. Es entspricht den politischen Zielen der zentralen Teile des Apparates und des Funktionärskörpers, der sie dominiert, entspricht der tagtäglichen realen parlamentarischen Praxis, ob nun als Regierung oder Opposition, und auch den gelegentlichen Ausflügen und Interventionen in Bewegungen und linke Gewerkschaftsmilieus, als deren Vertretung sich DIE LINKE betätigt. Das alles sollte niemanden überraschen, zumal die Spitzen der Linkspartei aus ihrem Reformismus auch nie ein Geheimnis gemacht haben.
Umso erstaunlicher und beschämender ist jedoch, dass große Teil der Linken in der Linkspartei jahrelang diese Tatsachen schönredeten. So verkannten sie die Annahme des Erfurter Programm 2011 als „Erfolg“ der Linken in der Partei, weil es den Regierungssozialist:innen angeblich „rote Haltelinien“ bei der Regierungsbeteiligung auferlegt hätte. Christine Buchholz (damals marx21, heute Sozialismus von unten) und Sahra Wagenknecht freuten sich damals noch gemeinsam über das Programm. Gegenüber der Jungen Welt erklärte Buchholz: „Die Art und Weise, wie die Debatte gelaufen ist, stimmt mich da sehr zuversichtlich: Wir haben am Wochenende eine konstruktive Diskussion gehabt, nach der es weder Sieger noch Besiegte gibt. Ich persönlich bedaure z. B., dass unsere ‚Haltelinien‘ geschwächt sind, andere kritisieren andere Punkte – aber die Richtung stimmt.“
Wer solche „Siege“ erringt, braucht keine Niederlagen. Auch die AKL gab sich damals „insgesamt zufrieden“. Am kritischsten äußerte sich noch die SAV. Sie bemängelte zwar „Aufweichungen“ des Programms, lobte aber dessen grundsätzlich richtige „antikapitalistische Stoßrichtung“.
Stagnation, Krisen und Niedergang
Nach den Wahlerfolgen der Anfangsjahre trat freilich Ernüchterung ein, die sich in stagnierenden und fallenden Mitgliederzahlen und Wahlniederlagen widerspiegelte, in Flügelkämpfen und seit 2022 in einer existenziellen Krise.
Dabei formierten sich auch die politischen Flügel teilweise neu. Lange Zeit bildeten die ostdeutschen Realos den sog. Hufeisenflügel mit den angeblichen linken Wagenknecht-Anhänger:innen. Demgegenüber formierte sich die sog. Bewegungslinke, die ihrerseits ein strategisches Bündnis mit den Regierungssozialist:innen gegen Wagenknecht einging – natürlich alles zum Wohl der Partei und ihres Überlebens. Doch dürfen bei diesem allgemeinen Niedergang wichtige Veränderungen der Parteizusammensetzung und Wähler:innenbasis nicht übersehen werden.
Rund 60 % ihrer Mitglieder sind erst nach 2011 eingetreten, die ehemaligen PDS-Genoss:innen sind längst zu einer kleinen Gruppierung geworden. 15 % der Mitglieder sind unter 35. Dies ist mehr als bei jeder anderen Bundestagspartei und stellt auch einen Zuwachs seit Parteigründung dar. Zugleich stellen die Altersgruppen der 50- – 64-Jährigen und der 65- – 79-Jährigen je 27 % der Mitglieder. Die Linkspartei ist vergleichsweise schwach unter der Altersgruppe von 36 – 49 vertreten.
Die Linkspartei hat wichtige Schichten und die Bindekraft zu Arbeitslosen, ärmeren Teilen der Klasse und auch des Kleinbürger:innentums im Osten an die AfD verloren. Dies ist zweifellos Resultat von Regierungspolitik und Anpassung, aber auch eines Rechtsrucks und einer Demoralisierung von Teilen der Lohnabhängigen selbst.
DIE LINKE hat massiv Mitglieder, Verankerung und Wähler:innen in der Fläche im Osten verloren. Ihre, wenn auch oft geschwächte Mitglieder- und Wähler:innenbasis kommt aus Großstädten sowie Städten und Ortschaften zwischen 5.000 und 20.000 Einwohner:innen. In Kleinstädten und auf dem Dorf ist sie wenig bis gar nicht vorhanden. Zugleich hat sie im Westen eine stärkere Verankerung in der Arbeiter:innenklasse und der Jugend (und somit über längere Zeit auch bei jüngeren Lohnabhängigen) gewonnen. So entspricht der Anteil von „Arbeiter:innen“ unter den Berufstätigen 17 %, der von Angestellten 67 % (darunter 35 % im öffentlichen Dienst). Gleichzeitig dominiert noch immer ein überdurchschnittlich hoher Schulabschluss und Bildungsniveau unter den Mitgliedern, während der Anteil von Arbeitslosen und Auszubildenden geringer als in anderen Parteien ist. Das drückt sich auch in veränderten Größen der Landesverbände und einem stärkeren Gewicht im Westen aus.
Diese Verschiebungen verweisen auch darauf, dass die Linkspartei in den Gewerkschaften und Betrieben, also in der organisierten Arbeiter:innenklasse stärker geworden ist, und zwar deutlich mehr, als dies bei Wahlen zum Ausdruck kommt. Von den Mitgliedern her stützt sich die Partei vor allem auf die mittleren und bessergestellten urbanen Schichten der Lohnabhängigen. Sie verfügt also über eine für eine reformistische Partei eher typische stärkere Verankerung in der Arbeiter:innenaristokratie als unter der Masse des Proletariats.
Die betrieblichen und unteren gewerkschaftlichen Funktionsträger:innen betreiben zwar nicht einfach dieselbe Politik wie der sozialdemokratisch dominierte Apparat, aber sie fordern diesen nicht heraus, zumal ihre reformistische Politik natürlich auch im Rahmen tarifvertraglicher und sozialpartnerschaftlicher Regulierung bleibt. Die Linkspartei betreibt z. B. eine aktive Politik, ihre jüngeren AnhängerInnen aus den Unis in den Gewerkschaftsapparat zu schicken (z. B. über Organizing- und Trainee-Programme) und so ihre Verankerung zu stärken. Auch die Konferenz zur gewerkschaftlichen Erneuerung, die DIE LINKE zuletzt im Mai 2023 in Bochum mit 1.550 Teilnehmer:innen organisierte, belegt einen gewachsene Verankerung im Gewerkschaftsapparat und unter betrieblichen Funktionär:innen.
Sie hat in den letzten Jahren an Verankerung in sozialen Bewegungen gewonnen, wenn auch nicht ohne Rückschläge und eher indirekt, also über die Zusammenarbeit, informelle Bündnisse mit Teilen der radikalen Linken (IL, Antifa) und Migrant:innenorganisationen (einige kurdische Vereine, Teile von Migrantifa). Der Beitritt von etlichen hundert Menschen aus dem „linksradikalen“ Milieu im November 2023 belegt diesen Trend.
Grundsätzlich kann aber gesagt werden, dass in den letzten 4 – 5 Jahren die Zuwächse im Westen die Verluste im Osten nicht mehr ausgleichen. Die Partei stagniert oder verliert fast überall. Das bildet letztlich auch den Boden für die innere Krise einer parlamentarisch fixierten reformistischen Partei, die um ihr Überleben als solche kämpft.
Dominanz der Funktionär:innenschicht
Über der sozialen Basis und den Mitgliedern und Wähler:innen erhebt sich ein Funktionär:innenapparat, der die Partei führt und prägt. Die Tätigkeit der aktiven Mitglieder ist wesentlich auf Vertretung in kommunalen, regionalen Strukturen, Ländern, Bund vertreten. DIE LINKE verfügt über 6.500 kommunale und sonstige Abgeordnete, über 200 Parlamentarier:innen und hauptberufliche Mitarbeiter:innen. Allein die Zahl der Kommunalpolitiker:innen, darunter hunderte Bürgermeister:innen, beläuft sich auf über 5.000 und diese sind vor allem im Osten tätig.
Der Stiftung der Partei beschäftigt natürlich auch vom Staat gesponsorte hauptamtliche Funktionär:innen – und diese bald in jedem Bundesland. Hinzu kommt noch ein Parteiapparat im Bund und allen Ländern. Wenn man all dies addiert, so kommt die LINKE auf mehrere hundert, wenn nicht tausend hauptamtliche Funktionär:innen, die Einkommen direkt aus dem Parteiapparat oder staatlichen Vertretungsorganen beziehen. Andere erhalten bloß Aufwandsentschädigungen. Hier sind noch gar nicht jene Abteilungen der Arbeiter:innenbürokratie in der LINKEN mitgezählt, die ihre Einkünfte aus anderen Quellen – dem Gewerkschaftsapparat oder als freigestellte Betriebsräte – beziehen.
All diese machen einen selbst für eine bürgerliche Partei untypisch hohen Anteil der Funktionär:innen an der aktiven Mitgliedschaft aus – von Funktionär:innen, die fest in die Tagesgeschäfte des bürgerlichen Systems eingebunden sind, und zwar nicht nur oder nicht einmal in erste Linie in Landesregierungen, sondern vor allem auf der kommunalen Ebene, wo die parteiübergreifende Zusammenarbeit noch viel pragmatischer geregelt wird, wo Klassenzusammenarbeit tägliches Brot darstellt und somit auch eine feste Basis für den Reformismus auf „höheren“ Ebenen abgibt. Diese Funktionär:innen machen insgesamt über 10 % der Mitgliedschaft aus. Ziehen wir in Betracht, dass die Mehrheit der Mitglieder passiv ist, am regelmäßigen Parteigeschehen nicht teilnimmt, so dominiert diese Schicht im Grunde alle größeren Strömungen der Partei. Der Unterschied besteht dann eher darin, mit welchen Milieus (Kommunalpolitik, gewerkschaftliches Organizing, soziale Bewegungen und NGO-artige Kampagnen) sie verbunden sind.
Selbst wo die Partei noch längst nicht Regierungsfunktionen ausübt, präsentiert sie sich allzu oft staatstragend. So z. B. bei der Solidaritätskundgebung mit Israel im Bundestag.
Taktik
Angesichts der aktuellen Angriffe und des gesellschaftlichen Rechtsrucks stellt DIE LINKE weiter eine organisierte Kraft der Arbeiter:innenklasse dar, die zur gemeinsamen Aktion aufgefordert, der gegenüber auf verschiedenen Ebenen (bis hin zur kritischen Wahlunterstützung) die Taktik der Einheitsfront angewandt werden muss. Aber wir dürfen uns dabei keine Illusionen über den Charakter der Partei machen und müssen uns vergegenwärtigen, dass sie nicht nur eine aktive Minderheit der organisierten Arbeiter:innenklasse vertritt, sondern zugleich auch ein Hindernis für den Aufbau einer wirklichen Alternative, einer revolutionären Arbeiter:innenpartei darstellt.
Daher muss die Anwendung einer Einheitsfronttaktik Hand in Hand mit einer marxistischen Kritik und dem Kampf für eine revolutionäre Alternative zur Linkspartei einhergehen.
Natürlich ist es unter den gegebenen Bedingungen notwendig, z. B. in DWE oder den Gewerkschaften gemeinsam zu kämpfen. Es ist auch notwendig, den gemeinsamen Kampf gegen laufende und kommende Angriffe zu intensivieren, von der Linkspartei dies einzufordern.
Heute geht es aber nicht primär darum, gemeinsame Handlungsfelder auszuloten, sondern darum, was die Linkspartei ist und was Sozialist:innen oder Kommunist:innen daraus folgern sollen: Sie sollten sich keinen Illusionen in die Partei hingeben, sondern selbst eine linke Kritik entwickeln und am Aufbau einer revolutionären Alternative zur Linkspartei mitwirken, den Aufbau einer revolutionären Arbeiter:innenpartei vorantreiben!
Eine solche Partei wird sicherlich nicht einfach durch lineares Wachstum aus einer der bestehenden kommunistischen oder sozialistischen Kleingruppen oder deren bloßer Vereinigung entstehen können. Es braucht eine Kombination aus gemeinsamem Kampf und gemeinsamer Bewegung mit einer programmatischen Klärung. Das heißt aber auch Überwindung der reformistischen Begrenztheit und Schwächen der Linkspartei, nicht nur des Wagenknecht-Flügels und der Regierungssozialist:innen, sondern auch der sog. Transformationsstrategie.