Systematisches zum Ukrainekrieg
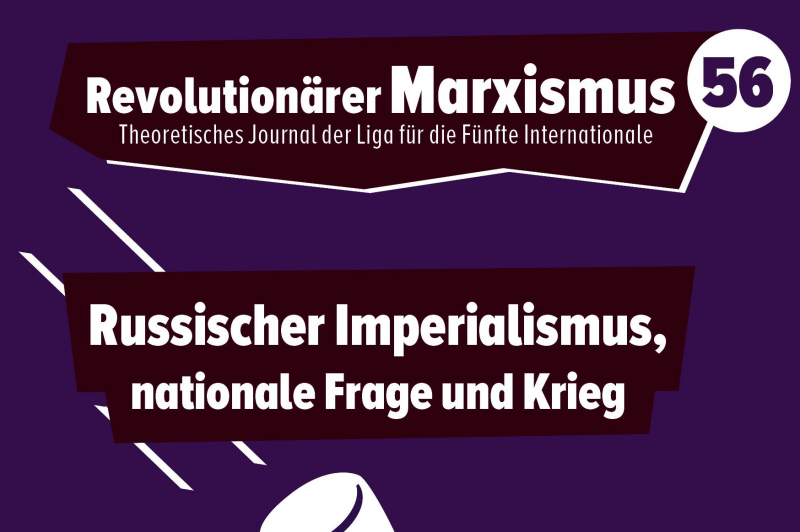
Markus Lehner, Martin Suchanek, Revolutionärer Marxismus 56, August 2025
Allgemeine Kennzeichen
Der Ukrainekrieg muss auf mehreren Ebenen („5 Kriege in einem“) analysiert werden. Er ist (1) ein imperialistischer Eroberungskrieg Russlands gegen die Ukraine, (2) insofern auch ein nationaler Verteidigungskrieg von Seiten Letzterer, (3) seit mehreren Jahren aber auch schon ein dortiger Bürgerkrieg, bei dem es (4) auch um Fragen von Minderheitenrechten bis hin zu denen auf Abtrennung bestimmter Regionen geht (Ostukraine, Krim). Er wird (5) auch bestimmt durch die Auseinandersetzung der imperialistischen Weltmächte um die Neuaufteilung der Welt und den Kampf um Einflusssphären. Insofern existiert eine massive Intervention der westlichen imperialistischen Mächte, die nicht nur in einem Wirtschaftskrieg gegenüber Russland mündet, sondern auch in einer neuen Qualität von Hochrüstung und militärischer Unterstützung der Ukraine als zu verteidigender Halbkolonie der USA/UK/EU-Imperialismen. Der Ukrainekrieg nimmt damit Merkmale eines Stellvertreter:innenkrieges an. Die Möglichkeit einer Eskalation zu einem direkten imperialistischen Krieg zwischen Russland und der NATO steht immer im Raum (mit der Gefahr einer nuklearen Katastrophe).
Diese Ebenen sind natürlich miteinander verknüpft. So ist etwa die Gefahr der Eskalation zum NATO/Russland-Krieg sicher ein wichtiger Faktor, warum die Unterstützung der Ukraine eine besondere Qualität angenommen hat, wie auch der langwierige innerukrainische Konflikt zur Vorgeschichte der russischen Invasion gehört. Zu diesen unmittelbar politisch-militärischen Ebenen kommt noch die ideologische Auseinandersetzung: Von Seiten der westlichen Imperialist:innen und der ukrainischen Führung wird der Verteidigungskampf der Ukraine zum Kampf von „Demokratie/Freiheit gegen Autoritarismus/Faschismus“ hochgejubelt, während das russische Regime und dessen nationalistische Basis ihre Invasion als „Selbstverteidigung“ gegen den die „nationale Souveränität“ (Russlands, Chinas …) missachtenden „liberalen Globalismus“ verklären. In der Ukraine selbst sind die unterschiedlichen politischen und sozialen Differenzen, die es vor der Invasion gegeben hat, sicherlich derzeit in den Hintergrund getreten gegenüber den Notwendigkeiten, ihre Existenz selbst gegenüber einer Okkupationsarmee zu sichern (auch wenn es in Teilen der Ostukraine und noch viel mehr auf der Krim sicherlich weiterhin beträchtliche prorussische Unterstützung gibt). Dieser Wille zur Verteidigung des eigenen Landes gegenüber einem autokratischen Russland, das bereits seit Jahrhunderten als Unterdrückungsmacht gegenüber jeglicher ukrainischer Selbstbestimmung bekannt ist, führt sicherlich auch dazu, dass die Mehrheit der ukrainischen Arbeiter:innen und Bäuer:innen für die Verteidigung ihres Landes eintritt – und dabei auch Illusionen in „den Westen“ und die politisch-militärische Führung der Ukraine hegt, dass nur diese die Verteidigung erfolgreich bis zur Vertreibung der russischen Armee vom ukrainischen Territorium anführen könnten bzw. dies deren einziges Ziel in diesem Krieg sei.
Es ist unstrittig, dass ein nationaler Selbstverteidigungskrieg von Seiten der Ukraine als berechtigtes Kriegsziel die Wiederherstellung der Grenzen von 2014 beinhalten würde, unter der Bedingung, dass in den Gebieten mit starken nationalen Minderheiten (russisch oder russischsprachig) dann ein demokratischer Prozess die weitere staatliche Zugehörigkeit, Autonomie, Minderheitenrechte etc. in den umstrittenen Regionen regeln müsste. Dies ist der Kern des „demokratischen Rechtes“ auf nationale Selbstbestimmung, für das Arbeiter:innen in der Ukraine, den umstrittenen Gebieten und in Russland selbst eintreten bzw. eintreten sollten (und auch der Kern einer „demokratischen Lösung“ des Konflikts, noch unabhängig davon, wer diese letztlich durchsetzen kann). Andererseits ist die Frage des nationalen Selbstbestimmungsrechtes in der Ukraine nicht losgelöst davon zu betrachten, dass der westliche Imperialismus selbst dabei ist, das Land in eine überaus ausgebeutete Halbkolonie umzuwandeln, die für ihn als hochgerüsteter Vorposten gegenüber dem russischen Imperialismus dient (ob als NATO-Mitglied oder mit besonderen „NATO-Sicherheitsgarantien“, bleibt abzuwarten). Während die ukrainischen Arbeiter:innen und Bäuer:innen dabei als Ausbeutungsmaterial und Kanonenfutter enden werden, wird dies für einen Teil der ukrainischen Bourgeoisie/Mittelschichten und der damit verbundenen politischen Clique durchaus ein sehr lohnendes Geschäft sein (eine gesellschaftliche Spaltung, die man dann wieder mal als „Sieg der Freiheit“ verkaufen wird können).
Der zusammengesetzte Charakter des Krieges bewirkt also auch, dass der Kampf um nationale Selbstbestimmung hier überlagert wird von der Ausnutzung des Krieges durch den Westen als Stellvertreter:innenkrieg bzw. zur Unterjochung der Ukraine als ökonomisch-militärische Halbkolonie von NATO/USA/UK/EU. Der Slogan „Sieg der Ukraine“ kann und wird daher auch als Sieg für letzteres imperialistisches Projekt verstanden werden, das auch von der gegenwärtigen ukrainischen Führung betrieben wird (sogar mit der expliziten Forderung nach Ausdehnung der NATO bis an die russischen Grenzen).
Hieraus geht deutlich hervor, dass sich unsere Verteidigung der Ukraine auch in den Zielen von jener der ukrainischen Regierung und Nationalist:innen unterscheidet. Das ist eigentlich nichts Ungewöhnliches, auch nicht bei „lupenreinen” nationalen Verteidigungskriegen. Allerdings überschneiden sich die Kriegsziele der ukrainischen herrschenden Klasse und der Regierung auch mit jenen ihrer westlichen Geberländer, ja sind teilweise identisch.
Demgegenüber impliziert „Sieg einer von Russland UND dem Westen unabhängigen Ukraine“, dass das Kriegsziel der Wiederherstellung der Souveränität der Ukraine nicht nur die Niederlage der russischen militärischen Invasion beinhalten müsste, sondern auch die des Projekts des westlichen Imperialismus und der politischen Führung der Ukraine. Dies wäre dann die Perspektive der permanenten Revolution, die den Kampf um das demokratische Recht auf nationale Selbstbestimmung zum Ausgangspunkt für die soziale Revolution nimmt, die die einzige Möglichkeit ist, eine solche Halbkolonialisierung durch die westlichen Imperialist:innen zu bekämpfen.
Für die Positionierung stellt sich also die Frage, welche von diesen Elementen in der jeweiligen Phase „übergeordnet“ sind, was „Unterordnung“ heißt, wie sich ein Wechsel von Über- und Unterordnung ergeben könnte, inwiefern bestimmte Positionierungen „kombiniert“ werden und welche Unterschiede regional und international sich in ihnen niederschlagen müssen.
Eine wichtige Orientierung dabei bieten bisherige Kriege in der imperialistischen Epoche und die Erfahrungen und Positionierungen revolutionärer Marxist:innen dazu, nicht nur von Lenin und Trotzki: Balkankriege, Erster Weltkrieg, Chinesisch-Japanische Kriege, Ukraine 1938, Frankreich im Zweiten Weltkrieg, die Positionierung zu den Annexionen durch Nazideutschland (Österreich, Tschechoslowakei) und zum Sowjetisch-Finnischen Krieg. Die Eckpfeiler, dass in imperialistischen Kriegen Sozialist:innen eine defaitistische Position vertreten (Inkaufnahme der Niederlage des eigenen Landes), in einem Krieg zwischen Imperialismus und einer Halbkolonie dagegen eine defensistische Position (Sieg des eigenen Landes) verknüpft mit der Strategie der permanenten Revolution, sind als allgemeine Prinzipien klar. Es wurde auch einiges präzisiert in Bezug auf die Bedeutung von „Defaitismus“ (z. B. was Bedingungen für eine mehr oder weniger starke „Inkaufnahme der Niederlage“ sind, z. B. GB 1940), wie sich die Situation z. B. mit der Niederlage des eigenen Imperialismus ändert (z. B. Frankreich unter Naziokkupation), was die Kombinationen zwischen imperialistischem Krieg und antikolonialen Kämpfen bedeuten (z. B. während des Ersten und Zweiten Weltkrieges). Das entscheidende Moment am Defaitismus, der von Lenin und Trotzki durchaus unterschiedlich akzentuiert wird, besteht darin, dass der Klassenkampf gegen die eigene Bourgeoisie nie untergeordnet werden darf und der Krieg dazu benutzt werden muss, deren Sturz vorzubereiten und letztlich herbeizuführen (Umwandlung in den Bürgerkrieg zum Sturz der herrschenden Klasse). Die eigene Bourgeoisie stellt die Hauptfeindin dar, weil deren Kriegsziele reaktionär sind, indem es ihr darum geht, sich im Kampf um die Neuaufteilung der Welt durchzusetzen.
Andererseits impliziert der „Defensismus“ für eine Halbkolonie gegenüber einem imperialistischen Angriff die bedingungslose Unterstützung der Verteidiger:innen unabhängig davon, ob (klein-)bürgerliche Kräfte den Kampf anführen oder nicht, wie reif oder unreif das Klassenbewusstsein des Proletariats ist. Die „Bedingungslosigkeit“ bedeutet also nur, dass wir einen bestimmten Stand des Bewusstseins oder eine bestimmte Führung nicht zur Vorbedingung machen, einen Kampf gegen nationale Unterdrückung zu unterstützen.
Allerdings gibt es dann auch eine Bandbreite von abgestuften Formen der politischen Kritik und Auseinandersetzung mit diesen Führungen (z. B. Hamas, Taliban), die den notwendigen Kampf gegen sie nach dem Sieg über den Imperialismus vorbereiten (militärische Zusammenarbeit und Absprachen, soweit wie nötig und möglich). Selbst in diesem Fall wäre der Kampf gegen die Intervention des Imperialismus bedingungslos und wir würden für dessen Niederlage eintreten. Die Kriegstaktik im halbkolonialen Land muss das in Rechnung stellen. Innerhalb des imperialistischen Weltsystems herrscht letztlich die imperialistische Bourgeoisie (eines Staates oder einer Reihe von Staaten) in der Halbkolonie. Die halbkoloniale Bourgeoisie herrscht, wie es Trotzki zu Lateinamerika formuliert, gewissermaßen nur halb. Daher kann die Losung „Der Hauptfeind steht im eigenen Land“ auch nicht mechanisch auf die Halbkolonien übertragen werden.
Das Spezifische des Ukrainekrieges
Ein wesentliches Element der Debatte bildet die Frage des neuen Charakters des Ukrainekriegs, der auch manchmal als „Weltordnungskrieg“ bezeichnet wird. Im Unterschied zu z. B. den Kriegen der USA gegen den Irak gibt es auf Seiten der angegriffenen Halbkolonie eine enorme Unterstützung durch rivalisierende imperialistische Mächte. Die massiven wirtschaftlichen Sanktionen gegen Russland und die Drohungen gegen „Verbündete“, die sich nicht daran halten, sind ein Ausmaß an Konfrontation von Großmächten, wie es sonst eher in Zusammenhängen mit langwierigen militärischen Großkonflikten vorkommt (z. B. die „Kontinentalsperre“ während der Napoleonischen Kriege). Die Menge an Waffen- und Munitionslieferungen an die Ukraine, die inzwischen deren BIP übersteigt, zeigt klar, dass deren Verteidigungsfähigkeit inzwischen vollständig vom weiteren Fluss dieser Lieferungen abhängt. Auch hat sich die Waffentechnologie seit dem Zweiten Weltkrieg wesentlich verändert: Heute kommt Kommunikations- und Informationstechnologien in Kombination mit den verschiedenen Waffengattungen eine entscheidende Bedeutung zu – die Nutzung der Satellitennetze der USA, der Internetsteuerung von Hochpräzisionswaffen, der raschen Informationsweiterleitung in Bezug auf Feindbewegungen etc. macht es gar nicht mehr notwendig, militärisches Personal unmittelbar vor Ort auf dem Boden zu stationieren, um dieses trotzdem im Krieg einzusetzen. Direkte Truppenstellungen oder ein „Luftschutzschirm“ bergen auch das Risiko, dass es zu einer direkten kriegerischen Auseinandersetzung bis hin zur nuklearen Konfrontation kommt. Auch daher ist von den westlichen Imperialist:innen eine stufenweise Eskalation vorgesehen: von Artillerie mit niedrigerer Reichweite zu immer weiteren, immer präziseren Luftabwehrsystemen und Drohnen, zu Panzerlieferungen, immer weiter ausufernden „Ausbildungsprogrammen“, Kampfjetlieferungen etc. Konkrete Auswirkung davon ist derzeit vor allem, dass der Krieg auf einem relativ hohen Niveau von Abnutzung und Gleichgewicht des Schreckens gehalten wird, mit einer Möglichkeit zumindest begrenzter Offensiverfolge auch für die Ukraine.
Was diesen Krieg zu einem „Weltordnungskrieg“ macht, ist, dass der Westen hier offensichtlich sehr viel investiert und riskiert, um in der Konkurrenz zu den aufstrebenden, neuen Großmächten Russland und China seine eindeutige Hegemonie durchzusetzen. Die Wirtschaftssanktionen haben nicht nur Russland, sondern auch die westlichen Ökonomien, vor allem in der EU, getroffen, z. B. in Bezug auf Energie- und Rohstoffpreise. Die Dauer des Krieges bedeutet auch, dass die bereits enorm verschuldeten westlichen Imperialist:innen inzwischen beträchtliche Mehrausgaben im Rüstungsbereich tätigen müssen (Stichwort „Munitionskrise“), was die Bekämpfung der Inflation weiter erschweren wird. Schließlich erzeugt die Wer-nicht-für-uns-ist-ist-gegen-uns-Politik auf den Weltmärkten einen weiteren Druck auf die Umorientierung der Lieferketten- und Exportmärkte (z. B. alles, was mit China zu tun hat), was weitere wirtschaftliche Probleme aufwirft. Zu diesen ökonomischen Risiken kommen politische Entfremdungen zu vielen Ländern in Lateinamerika, Asien und Afrika. Zuletzt gibt es auch militärische Risiken, nicht nur in Bezug auf die Eskalation mit Russland und eventuell auch China (Taiwan), sondern auch, dass einiges an hochtechnischen Waffen über die Ukraine auch in andere Kanäle gerät. All diese Risiken zeigen, wie stark die westlichen Imperialist:innen in diesen Krieg verwickelt und bereit sind, sich verwickeln zu lassen. Man kann sie daher zu Recht als Kriegspartei in der Ukraine ansehen – auch ohne direkt Soldat:innen auf dem Boden zu haben.
Die Mischung aus einem Krieg um nationale Selbstverteidigung gegen einen imperialistischen Aggressor und einem Stellvertreter:innenkrieg mit Elementen eines innerimperialistischen Krieges bedeutet, dass sein Charakter durch diese beiden Elemente überdeterminiert, d. h., widersprüchlich ist – was eine sehr differenzierte Positionierung erfordert. Die zum „reinen Defensismus“ tendierenden Position in der internationalen Linken betont das Überwiegen des Kampfes um nationale Selbstbestimmung gegenüber den Elementen des globalen zwischenimperialistischen Konflikts (dieser wird zwar als „Kontext“ anerkannt, aber würde so lange nicht dominieren, bis es nicht zur direkten Konfrontation gekommen ist).
Die zum „Defaitismus“ tendierende Position sieht den Charakter des Weltordnungskrieges und die damit zusammenhängende neue Qualität der Beteiligung des westlichen Imperialismus am Krieg als dominant gegenüber dem des Verteidigungskrieges der Ukraine an. In der Ukraine bleibt das Element der Selbstverteidigung jedoch dominierend, allerdings global gesehen untergeordnet dem des innerimperialistischen Konflikts. Wenn wir auch generell gegen die mörderischen Kriegsmaschinerien und die globale Aufrüstung/Konfrontation auf beiden Seiten des Konflikts protestieren und agitieren, so müssen wir die spezielle Situation der Arbeiter:innen und Bäuer:innen in der Ukraine anerkennen. In dem Verteidigungskrieg gegen die unmittelbare militärische Aktion des russischen Imperialismus ist es für diese nicht egal, ob sie den Krieg verliert. Dies hätte sicherlich gravierende Konsequenzen für ihre demokratischen und zukünftigen Kampfbedingungen um soziale Rechte. Daher müssen die bestehenden Verteidigungskräfte (auch unter ihren derzeitigen Führungen) genauso genutzt werden wie alle Waffen, die erhalten werden können, um den russischen Angriff zurückzuschlagen. Andererseits können wir unter den gegenwärtigen Bedingungen nicht unqualifiziert (bedingungslos) für den „Sieg der Ukraine“ eintreten, da die Einflussnahme des westlichen Imperialismus so stark ist, dass ein solcher Sieg heute konkret nicht nur zu einer sofortigen westlichen Halbkolonialisierung der Ukraine führen würde, sondern auch zu einem De-facto-Vorrücken der NATO an die russischen Grenzen. Deshalb müssen wir den Slogan der „Niederlage der russischen Invasion“ mit dem des bedingungslosen Kampfes um die Unabhängigkeit der Ukraine auch vom westlichen Imperialismus verbinden – also „Sieg der von Russland und dem Westen unabhängigen Ukraine“.
Hier noch eine Anmerkung zur Bestimmung des „Weltordnungskrieges“, den der Kampf um die Ukraine auch darstellt. Lenin verweist darauf, dass ein wesentlicher Unterschied zwischen imperialistischem und nationalem Krieg darin besteht, dass beim Kampf einer unterdrückten Nation das Eingreifen der konkurrierenden imperialistischen Mächtegruppen nur einen zufälligen, untergeordneten Aspekt ausmacht. Im imperialistischen Krieg gerät letztlich das nationale Moment der gerechtfertigten Landesverteidigung zu einem solchen (wie z. B. im Falle Serbiens im Ersten Weltkrieg).
In den meisten Kriegen von Halbkolonien mit imperialistischen Mächten nach 1945 stellt das Eingreifen einer konkurrierenden imperialistischen Macht auf Seiten der Halbkolonie ein eindeutig untergeordnetes Moment dar. Das trifft letztlich auf den Bürger:innenkrieg in Syrien und die Intervention des Westens zu.
Dies steht in einem engen Zusammenhang mit der geostrategischen Bedeutung des Krieges. Zwar wirkt sich jeder Ausgang eines Kriegs zwischen einer Halbkolonie und einer imperialistischen Macht ganz allgemein auch auf das globale Kräfteverhältnis zwischen den imperialistischen Mächten aus. Aber es ist ein grundlegender Unterschied, ob dieser nur eine Verschiebung im Rahmen einer bestehenden Ordnung darstellt oder die Ordnung selbst über diesen nationalen Krieg verändert und neu bestimmt wird.
Das heißt, der nationale Verteidigungskrieg (in unserem Fall jener der Ukraine) nimmt unwillkürlich auch Züge eines Stellvertreter:innenkrieges an. Dies stellt aber nur ein Element der Charakterisierung, nicht die einzige und damit auch keineswegs die entscheidende Bestimmung dar.
Im imperialistischen Krieg determiniert der internationale Charakter des Krieges in der Regel (wenn auch keineswegs immer, wie im Falle nationaler, antikolonialer Erhebungen während der Weltkriege). Wo er dominiert, wird die nationale Frage untergeordnet, und zwar im höheren Gesamtinteresse des internationalen Proletariats. Dies ist aber keineswegs unproblematisch, sondern ein Übel, weil es natürlich beinhaltet, dass die Arbeiter:innenklasse zeitweilig den Kampf gegen eine bestimmte Unterdrückungsform hintanstellt. Es liefert aber das geringere Übel im Vergleich zur Instrumentalisierung der Lösung der nationalen Selbstbestimmung für einen imperialistischen Krieg.
In der Ukraine heute haben wir es aber noch nicht mit einem imperialistischen Krieg zu tun (auch wenn er sich dahin entwickeln und damit seinen Charakter ändern kann). Der Richtungswechsel des US-Imperialismus unter Trump und das Ziel der USA, sich mit Russland neu zu arrangieren, bedeutet sogar, dass der reaktionäre Charakter des russischen Angriffs deutlicher hervortritt. Natürlich kann sich das ändern, wie die USA einen weiteren Schwenk durchführen sollten.
Das bedeutet, dass der nationalen Verteidigung in der Ukraine ein progressiver Charakter zukommt (wie wir als Liga auch immer anerkannt haben). Auf den ersten Blick erscheint es vielen Linken so, dass das Moment der nationalen Verteidigung negiert werden müsse, weil das Moment des Stellvertreter:innenkrieges im Krieg offen hervortritt und auch tendenziell stärker wird.
Dies ist jedoch eine kurzsichtige Herangehensweise. Gerade damit nicht nur die russische Invasion bekämpft, sondern auch die halbkoloniale und militärische Eingliederung als NATO/EU-Frontstaat verhindert wird, muss die ukrainische Arbeiter:innenklasse zur hegemonialen Kraft werden, was letztlich in der Errichtung einer revolutionären Arbeiter:innenregierung münden muss. Wie aber kann sie zu einer solchen Kraft werden? Nur, indem sie den Kampf für die nationale Selbstverteidigung mit dem gegen die bürgerliche Regierung und imperialistische Dominanz kombiniert.
Im Westen hingegen steht der Kampf gegen die Verfolgung der Ziele des westlichen Imperialismus im Vordergrund, das heißt, die Mobilisierung und zuerst vor allem Aufklärung über dessen eigentliche Kriegsziele. Das heißt nicht, die berechtigten Seiten des ukrainischen Selbstverteidigungskampfs zu negieren. Im Gegenteil. Wenn diese auch in Rechnung gestellt werden, wird es letztlich leichter sein, die Arbeiter:innenklasse im Westen von ihren Illusionen in die Politik der NATO, EU und anderen westlichen imperialistischen Staaten loszubrechen. Grundsätzlich aber stellt sich der Krieg im Westen vor allem als eine Konfrontation mit Russland (und indirekt mit China) dar. Und gegen diesen Kalten Krieg der eigenen herrschenden Klasse, der selbst eine Vorbereitung auf einen imperialistischen Krieg mit beinhaltet, muss die Hauptstoßrichtung hier geführt werden.
Die auf den ersten Blick „widersprüchliche“ Position bezüglich des globalen Charakters des Krieges einerseits und des Aspekts der berechtigten Selbstverteidigung der Ukraine erweist sich keineswegs als solche, wenn wir die spezifische Verknüpfung, die Durchdringung der verschiedenen Ebenen des Krieges betrachten.
Der „Weltordnungskrieg“ stellt selbst eine Übergangsform zwischen einem „reinen“ nationalen und einem „vollen“ imperialistischen Krieg dar. Dass wir aktuell einer solchen Form begegnen, ist kein Zufall, sondern entspricht vielmehr der aktuellen Periode, einer der Austragung, Vorbereitung und Zuspitzung des Kampfes um die Neuaufteilung der Welt. Es kann daher durchaus sein, dass der Krieg um die Ukraine nicht der einzige oder letzte solche bleiben wird. Ob das der Fall ist, hängt aber auch wesentlich vom Ausgang des Kampfes ab.
Wenn eine oder beide der imperialistischen Parteien siegreich hervorgehen, wird ein solcher Krieg auch in Zukunft wahrscheinlicher – inklusive der in ihm angelegten Logik, sich von einer Übergangsform zu einem imperialistischen Krieg zu entwickeln (auch ein „begrenzter“ imperialistischer Krieg wäre dann nur ein weiterer Zwischenschritt).
Stellen wir nationalen und imperialistischen Krieg gegenüber, so lassen sich dominante Elemente („Defensismus“ oder „Defaitismus“) relativ leicht bestimmen. Natürlich finden wir auch hier Elemente des jeweils anderen, es lassen sich allerdings in der Regel für alle Ebenen des Konflikts gleiche Momente bestimmen, die einen auf allen Ebenen vorherrschenden Charakter zum Ausdruck bringen.
Es macht hingegen das Wesen von Übergangsformen aus, dass nicht zu jedem Zeitpunkt und in jedem Land dasselbe Moment vorherrschen muss. Auch wenn es insgesamt richtig ist, dass bei einem dialektischen Widerspruch eine Seite dominiert, so trifft das nicht auf jedes Moment der Entfaltung des Widerspruchs, auf jeden Schritt der Entwicklung zu.
Exkurs zur Frage des logischen Widerspruchs
Diese differenzierte Position, die Elemente von Defensismus und Defaitismus verbindet, führt natürlich in konkreten Fragen zu scheinbar schwer miteinander vereinbaren Forderungen/Slogans. Dies ist z. B. bei der Frage der westlichen Waffenlieferungen der Fall. In Zusammenfassung unserer Position haben wir festgestellt, dass wir (a) für die Niederlage der russischen Invasion eintreten, (b) dafür, dass die Ukraine die Waffen bekommt, die sie für die Verteidigung benötigt, (c) wir in den westlichen imperialistischen Ländern die Ziele der eigenen Imperialist:innen aufzeigen und damit auch die Art und Weise kritisieren, mittels der mit Waffenlieferungen die Ukraine für einen Stellvertreter:innenkrieg missbraucht wird, (d) wir zwar diese kritisieren und auch z. B. in Parlamenten nicht dafür stimmen, aber sie derzeit nicht behindern würden (z. B. durch Lieferboykott).
Die „Defaitist:innen“ werfen uns vor, dass (c) und (d) sich widersprechen, da wir den imperialistischen Charakter der Art der Unterstützung durch den Westen kritisieren, aber die Konsequenz der aktiven Verhinderung (z. B. durch Blockaden) der Waffenlieferungen nicht zögen. Die „Defensist:innen“ werfen uns vor, dass sich (b) und (c) widersprechen, da wir dafür sind, dass die Ukraine die Waffen bekommt, die sie zur Verteidigung braucht, aber gleichzeitig im Westen gegen diese Waffenlieferungen Position bezögen.
Inwiefern kann man bei beiden Behauptungen davon sprechen, dass es sich um logische Widersprüche handelt? Die angebliche Widersprüchlichkeit wird ja dazu gebraucht, dass dann die Grundlage, die Prämissen, aus denen wir zu diesen angeblich widersprüchlichen Schlussfolgerungen kommen, in Frage gestellt werden – d. h. der überdeterminierte Charakter des Krieges. Stattdessen müsste man dann zu der Schlussfolgerung gelangen, dass entweder der innerimperialistische Charakter des Konflikts überwiegt oder eben der der nationalen Selbstverteidigung.
Dazu zunächst etwas zur Logik. Die hier dargestellte Argumentation mit dem Widerspruch ist in der Mathematik bekannt als „reductio ad absurdum“. Z. B. wird beim Beweis dafür, dass es unendlich viele Primzahlen gibt, zunächst angenommen, dass es eine größte Primzahl p gibt. Dann wird eine Zahl q gebildet, die aus dem Produkt aller Primzahlen bis inklusive p besteht, auf die 1 addiert wird. Dann wird auf der Grundlage von Teilbarkeitssätzen abgeleitet, dass q eine Primzahl sein muss, aber da p die größte Primzahl ist, dies zugleich falsch sein muss. Dass q keine Primzahl ist, ist ein eindeutiger logischer Widerspruch („A ist wahr und Nicht-A ist wahr“ ist absurd). Daher muss die Voraussetzung, dass es eine größte Primzahl gibt, falsch sein.
Die Frage ist also: Sind die Aussagen (c) ist wahr und (d) ist wahr bzw. (b) ist wahr und (c) ist wahr tatsächlich Widersprüche, wie es beim Primzahlbeispiel der Fall ist? Bei (c) wird festgestellt, dass wir die Art und Weise bestehender Waffenlieferungen kritisieren, bei (d) jedoch gesagt, dass wir diese Lieferungen tatsächlich nicht blockieren würden. Offensichtlich ist dies noch kein logischer Widerspruch. Dies wäre erst der Fall, wenn man eine weitere Voraussetzung einführt, die eigentlich eine Handlungsmaxime ist: Wenn wir A kritisieren, dann müssen wir auch die Umsetzung von A verhindern. Damit würde natürlich tatsächlich der Widerspruch abgeleitet werden, dass wir Waffenlieferungen blockieren und nicht blockieren müssen.
Ähnlich bei (b) und (c): Hier würde mit (b) vertreten, dass die Ukraine alle Waffen bekommen soll, die sie braucht. Mit (c) kritisieren wir aber gerade die Art und Weise der Waffenlieferungen des Westens an die Ukraine. Auch hier ergibt sich ein Widerspruch erst, wenn eine Handlungsmaxime eingeführt wird: Wenn das Anliegen A berechtigt ist, dann ist auch jede Handlung, die A umsetzt, zu unterstützen oder zu fordern. Damit würden dann (c) und (d) dazu führen, dass wir Waffenlieferungen unserer Regierung fordern und zugleich kritisieren.
Der Knackpunkt ist also die Frage nach der Berechtigung der impliziten Handlungsmaximen bzw. eines alternativen Systems aus solchen, falls diese nicht gelten sollten. Das Problem ist in der Philosophie altbekannt und wird gewöhnlich als das von „ethischen Dilemmata“ bezeichnet. So etwa bei Platon im Dialog „Der Staat“, wo die Handlungsmaxime „Du sollst Geliehenes stets zurückgeben“ mit der Maxime „Du sollst Blutvergießen verhindern“ in Konflikt kommt in einem Fall, wo ein/e inzwischen wahnsinnig Gewordene/r einem/r eine Waffe geliehen hat. In der Philosophie führt dies zu der Frage, ob es sich bei den Dilemmata um tatsächliche moralische Widersprüche handelt oder jeweils ein Mehr oder Weniger an konkretem Wissen zu einem Überwiegen des einen oder anderen Prinzips führt – ob es sich also um reale Widersprüche oder um ein Erkenntnisproblem handelt.
Eine bekannte systematische Herangehensweise an die Frage der Gültigkeit von Handlungsmaximen ist die Bestimmung des „freien, aber moralischen Subjekts“ alias der „praktischen Vernunft“ durch Immanuel Kant. Im „kategorischen Imperativ“ ist es für ein selbstbestimmtes Subjekt vernünftig, sich an solche Maximen zu halten, von denen man selbst wollen kann, dass sie allgemeines Gesetz werden. Unzulängliche Maximen wie zum Beispiel „Zur Not kann man auch die Unwahrheit sagen“ würden dagegen als allgemeine Gesetze zu widersprüchlichen Handlungsanweisungen führen. Ganz angelehnt an die „reductio ad absurdum“ versucht Kant also, den freien Willen von der Willkür zu unterscheiden, indem er willkürliche Maximen als allgemeine Gesetze zu Widersprüchen führen lässt, woraus dann die Schlussfolgerung zu ziehen ist, dass für ein selbstbestimmtes Subjekt diese Maxime ungültig ist.
Interessant in unserem Zusammenhang ist die grundlegende Kritik Hegels an Kants Methode. In seinem Artikel „Über die wissenschaftlichen Behandlungen des Naturrechts“ (Kritisches Journal der Philosophie, Jena 1803, HW2, S. 462 f.) zeigt er die Grenzen von Kants Herangehensweise anhand eines von diesem selbst gegebenen Beispiels für den kategorischen Imperativ (das Problem des „Depositums“). Der Fall ist, dass eine Person A einer Person B etwas geliehen hat – ein Fakt, von dem außer den beiden niemand etwas weiß. Jetzt stirbt aber A. Kann jetzt B das Ausgeliehene einfach behalten, weil er/sie und ihre/seine Familie es sehr viel mehr brauchen als die reiche Familie von A, die das Geliehene erben würde? Kant führt das allgemeine Prinzip, dass man das Geliehene dann behalten kann, zur Schlussfolgerung, dass dann niemand mehr etwas ausleihen würde, was dann in logischem Widerspruch dazu steht, dass man in dem Prinzip voraussetzt, dass man etwas geliehen bekommt. Hegel sagt dazu in einfachen Worten: Wenn man die Voraussetzungen von Kant trifft, dann führt das in abstrakt-allgemeinen Überlegungen zu einem Widerspruch – aber in der konkreten Situation ist eine solche inhaltslose Logik nicht hilfreich: „Dass es kein Ausleihen gibt, welcher Widerspruch liegt darin?“ Kants Logik reduziert sich auf die inhaltslose Tautologie „Das Eigentum, wenn Eigentum ist, muss Eigentum sein“. In konkreten Situationen geht es aber nicht nur um eine Bestimmung (z. B. die Frage, ob Ausgeliehenes immer zurückgegeben werden muss), sondern die Entscheidungsperson wird von mehreren sich möglicherweise widersprechenden Maximen umgeben sein – etwa der/die Darlehensempfänger:in, der/die notleidende Personen vor dem Verhungern retten sollte. Hegel wirft Kant vor, dass er die Frage der „Selbstbestimmung“ in ein abstraktes, von allen gesellschaftlichen Bedingungen losgelöstes Subjekt verlagert (eine Art „Subjekt an sich“). In Hegels Rechtsphilosophie muss sich ein solches Subjekt der Selbstbestimmung erst im Gang durch die realen gesellschaftlichen und geschichtlichen Beschränkungen und Widersprüche herausbilden, etwas, was sich dann in den Bewegungsformen des Rechts und der gesellschaftlichen Verhältnisse in Entwicklungsstufen ausdrücken muss. Marx erweist sich in seinen Artikeln über die Gesetzgebung zum Holzdiebstahl als Schüler von Hegels Rechtsphilosophie. Hier hatte der preußische Gesetzgeber ganz im Sinne von Kants Konsequenz entschieden, dass der Besitz des Waldes ausschließt, dass arme Nicht-Besitzer:innen dort einfach abgefallenes Holz, Beeren oder Fallobst einsammeln können – und dies entsprechend zu bestrafen sei. Marx weist nach, dass die bisherige Gesetzgebung das Gewohnheitsrecht der um ihr Überleben kämpfenden Armen zu dieser Nutzung des Waldes anerkannt hatte – und es gar nicht um ein allgemeines Rechtsprinzip geht, sondern um die gesellschaftlichen Interessen der Kapitalist:innen, die zu Waldbesitzer:innen wurden und die Armen zur Arbeit in den Fabriken zwingen wollten.
Vom Standpunkt des entwickelten Marxismus (und seiner Überwindung der Hegel’schen Rechtsphilosophie) ist klar, dass es bei der Bestimmung von Maximen nicht um das vereinzelte selbstbestimmte Subjekt und die Widerspruchsfreiheit seiner Handlungsmaximen geht, sondern dass die handelnden Subjekte von einem Klassenstandpunkt aus bestimmen, was ihren Interessen am besten nützt, also erst in einer klassenlosen Gesellschaft so etwas wie eine widerspruchsfreie Selbstbestimmung möglich ist. Wie Trotzki in „Ihre Moral und unsere“ darlegt, geht es in der Auseinandersetzung mit den Herrschenden nicht darum, allgemein-menschliche Prinzipien zu heiligen, sondern die Handlungen erweisen sich als richtig, die im Klassenkrieg zum Erfolg führen und zur Überwindung der Klassenherrschaft geeignet sind. Gerade die Herrschenden, die viel mehr Machtmittel zur Verfügung haben, setzen die „großen Moralprinzipien“ ein, um die geeigneten Kampfformen der Unterdrückten für „amoralisch“ zu erklären.
Zurück zum Krieg um die Ukraine
Wie können wir also vom Klassenstandpunkt des internationalen und ukrainischen Proletariats aus die Konflikte um die Handlungsmaximen in der Frage der Waffenlieferungen beantworten?
Es ist erstmal dabei klar, dass wir nicht vom bestehenden Bewusstsein der jeweiligen Klassen sprechen, sondern vom „zugerechneten Klassenbewusstsein“ (Lukács), also von dem Standpunkt, den ein sich seiner historischen Aufgaben bewusstes Proletariat einnehmen würde – bzw. mit der Orientierung, dass in den Kämpfen genau ein solches Bewusstsein entstehen kann. Vom Klassenstandpunkt des Proletariats sind weder „Verteidigung der nationalen Souveränität“ noch „Verteidigung der bürgerlichen Demokratie“ Werte an sich. Wie Lenin aber richtig festgestellt hat, hat beides in der imperialistischen Epoche eine enorme Sprengkraft für das internationale Monopolkapital, das sowohl das Bedürfnis danach ständig steigert, aber zugleich seine Realisierung (nicht nur in Halb-)Kolonien) beständig unterminiert.
Insbesondere für den autoritären russischen Imperialismus liegt diese Sprengkraft auf der Hand – und dies nicht nur in der Ukraine, sondern in seinem ganzen Einflussbereich von Zentralasien und dem Kaukasus bis nach Syrien. Gerade die Schwäche des russischen Imperialismus gegenüber seiner Konkurrenz drängt zu Autoritarismus und militärischer Gewalt. Daher liegt im Widerstand gegen die imperialistische russische Politik die Chance, vom demokratischen zum Kampf um eine wirkliche Revolution, eine soziale weiterzugehen, wenn dieser unter Führung des revolutionären Proletariats gelangt. Genau dieser letzte Punkt wird bei Verkürzungen der Dynamik der permanenten Revolution von der demokratischen zur sozialen Revolution gerne vergessen. Und hier haben wir auch das Problem in der Ukraine. Denn derzeit sind nicht nur proletarische und sozialistische Kräfte im Widerstand äußerst schwach – das ukrainische Proletariat folgt ohne unabhängige Organisierung großteils ohne Zweifel der bürgerlichen Führung. Und dies ist nicht nur eine proimperialistische „dem Geiste nach“, sondern eine, die eng verknüpft ist mit der Strategie eines Stellvertreter:innenkrieges für die „demokratischen“ Imperialist:innen.
Die Frage der Beteiligung an einem erfolgreichen ukrainischen Verteidigungskrieg muss daher kombiniert werden mit:
- der Aufgabe, das Proletariat zu einer unabhängigen Kraft zu gestalten (zumindest das Entstehen einer solchen nach dem Krieg zu befördern),
- den Bruch mit der proimperialistischen Führung voranzutreiben (zumindest für die Nachkriegszeit vorzubereiten),
- der Aufstellung eigener bewaffneter proletarischer Kräfte,
- der Fortführung des Kampfes um demokratische und antiimperialistische Forderungen, um ihn auch gegen den westlichen Imperialismus vorzubereiten.
Hier ist es klar, dass ein Beiseitestehen der fortgeschrittenen Arbeiter:innen in der gegenwärtigen Verteidigungssituation gegen die russische Aggression die Revolutionär:innen vollständig isolieren und diskreditieren würde. Auch Vorstellungen wie „Wir würden uns ja am Kampf beteiligen, wenn es denn unabhängige proletarische Kampfverbände gäbe“, helfen wenig – auch dies wäre nicht mehr als eine Ausrede, sich nicht an den realen Kämpfen zu beteiligen. Ebenso wäre die Forderung, mit den bestehenden Waffen zu kämpfen und jegliche Waffenlieferungen, die man aus dem Westen bekommt, als imperialistische Einmischung abzulehnen, nicht anders zu verstehen, als dass man eigentlich den Sieg der russischen Invasion in Kauf nimmt. Die Beteiligung an den Verteidigungskämpfen mit den bestmöglichen Waffen, die man dafür bekommen kann, muss aber andererseits mit einem politischen Kampf verbunden werden:
- Der arbeiter:innenfeindliche, ausbeuterische Charakter der gegenwärtigen Führung muss aufgezeigt werden (z. B. anhand der Arbeitsgesetzgebung).
- Die gewerkschaftliche Organisierung und auch ökonomische Klassenkämpfe müssen gegen diese Regierung trotz des Krieges fortgesetzt werden, da das Kapital offenbar auch dabei keine Pause macht.
- Die Offenlegung aller Verpflichtungen, die die Regierung gegenüber ihren westlichen Geld- und Waffengeber:innen eingegangen ist, muss verlangt werden.
- Die Verschuldung, die die Ukraine rund um die westlichen Waffenlieferungen eingeht, muss beendet werden (Schuldenstreichung!).
- Es muss ein Kampf darum geführt werden, wer die Kontrolle darüber erhält, wie die Waffen, die an die Ukraine geliefert werden, verteilt und was die Kriegsziele sind, für die diese eingesetzt werden.
- Es muss dafür gekämpft werden, dass weder die westlichen Imperialist:innen noch die Oligarch:innen oder die bürgerliche Regierung über das Schicksal von Donbass und Krim entscheiden, sondern die Bewohner:innen selbst und die Arbeiter:innenbewegung deren Rechte aktiv und ggfs. militärisch verteidigen.
Eine solche Politik kann zur Herausbildung eigenständiger proletarischer Organe und bewaffneter Verbände führen, die dann auch dazu in der Lage sind, für eine tatsächlich (d. h. auch vom westlichen Imperialismus) unabhängige Ukraine zu kämpfen.
Geht also auch die proletarische Position in der Ukraine nicht kritiklos daran vorbei, dass die Waffenlieferungen aus dem Westen von dessen Seite her ein Element einer eigenen imperialistischen Strategie gegenüber der Ukraine verkörpern, so gilt das umso mehr für den proletarischen Klassenstandpunkt im Westen. Hier finden wir ein Proletariat vor, das in weiten Teilen von reformistischen oder linksbürgerlichen Kräften beherrscht wird, die entweder voll das eigene imperialistische Geschäft verkleidet als „Kampf gegen Autoritarismus und Eroberungskriege“ betreiben oder pazifistische Illusionen à la „friedliche Koexistenz“ der imperialistischen Blöcke besingen. Hier ist es Aufgabe, den revolutionären Klassenstandpunkt zu entwickeln durch:
- Aufzeigen der imperialistischen Politik des eigenen Imperialismus, seiner Politik des Stellvertreter:innenkrieges;
- der Unmöglichkeit eines „gerechten Ausgleichs“ zwischen den imperialistischen Blöcken und der Auswirkung, die der auf eine imperialistische Aufteilung der Ukraine hätte;
- der Berechtigung des Kampfes um nationale Selbstbestimmung der Ukraine und der darin enthaltenen Möglichkeiten für einen ausgeweiteten Befreiungskampf gegen den Imperialismus in einer großen Zahl von Regionen;
- Entlarvung der reaktionären Ziele der ukrainischen Regierung;
- Aufzeigen der Funktion der Waffenlieferungen als Mittel zur massiven Aufrüstung des westlichen Imperialismus und Unterordnung der Ukraine unter seine eigenen globalen Herrschaftsansprüche.
Hier ist klar, dass man einerseits einem starken Druck ausgesetzt ist, den Illusionen in die selbstlose, nur den Interessen von Freiheit und Demokratie dienende Unterstützung der Ukraine durch die westlichen Regierungen entgegenzutreten. Die Massivität der wirtschaftlichen und sozialen Folgen der westlichen Aufrüstungs- und Kriegspolitik ist aber ein Anknüpfungspunkt zum Vorantreiben des Bruchs mit diesen. Dabei liegt ein wichtiges Element darin, in der Umsetzung der angeblich selbstlosen Unterstützung sein eigentliches Wesen zu entlarven:
- indem der Umfang der Waffenlieferungen mit verstärktem Schaffen völliger Abhängigkeit der Ukraine vom Westen deutlich wird (auch wieder die Frage der Schuldenstreichung);
- die Wirtschaftssanktionen als Mittel aufgezeigt werden, die eigene Einflusssphäre gegenüber Russland und China zu behaupten – koste es, was es wolle (Hungerkrisen im globalen Süden, Energiekrise in Europa …);
- gegen die Aufrüstungspolitik im Windschatten des Ukrainekrieges Stellung bezogen wird;
- aber auch die „Frieden mit Russland um jeden Preis“-Politik bekämpft wird, der das Schicksal der Ukraine und des ukrainischen Proletariats völlig egal ist, bzw. auch die Möglichkeit bei entsprechendem Kriegsverlauf, dass gegen einen Ausverkaufsfrieden, den die westlichen Imperialist:innen der Ukraine aufdrücken, protestiert wird.
Dies bedeutet konkret in Bezug auf die derzeitigen Waffenlieferungen:
- Wir kritisieren, wie diese zur Instrumentalisierung der Ukraine zwecks Führung eines Stellvertreter:innenkrieges benutzt werden;
- wie sie z. B. in Ringtäuschen zur Erneuerung des eigenen Waffenarsenals und dessen der abhängigen Halbkolonien (Polen, Baltikum) (also zur Aufrüstung) benutzt werden;
- wie diese als „Hilfslieferungen“ über Verschuldung und Verpflichtungen bei der Aufteilung der ukrainischen Ökonomie „nach dem Sieg“ zu ihrer Kolonialisierung missbraucht werden;
- dass die vor Ort kämpfenden, den unmittelbaren Interessen der lokalen Gemeinden verpflichteten Einheiten keine Kontrolle über Art und Verteilung dieser Waffen erhalten.
Wir kämpfen mit anderen Worten letztlich dafür, dass die Waffen, die zur Verteidigung gegen die russische Aggression notwendig sind, von den westlichen Produktionsstätten bis zu den Kampfeinheiten in der Ukraine unter proletarische Kontrolle kommen – im Rahmen einer Strategie, den imperialistischen Stellvertreter:innenkrieg in einen internationalen revolutionären Bürgerkrieg zu verwandeln.
Die Blockade von Waffenlieferungen in Russland ist Teil eines direkten Kampfes gegen die imperialistische Aggression und in jeder Hinsicht zu unterstützen bzw. zu verteidigen. In den NATO-Ländern bekämpfen wir jede Form der Aufrüstung der NATO-Kräfte, während die Arbeiter:innen Waffen an die Ukraine durchlassen sollten. Dies inkludiert auch den Kampf um die Kontrolle über Transporte. Um dies durchzusetzen, können auch Transportstopps und Blockaden nötig sein, um festzustellen, wohin die Waffen gehen sollen und was genau transportiert wird.
Aus dieser langfristigen Perspektive heraus wird auch deutlich, dass sich die unterschiedlichen Haltungen zu Waffenlieferungen im Westen und in der Ukraine nicht widersprechen. Sie laufen sogar in langfristiger Perspektive auf eine einheitliche Position zum Kampf um proletarische Kontrolle über die in diesem Krieg eingesetzten Waffen auf ukrainischer Seite hinaus. Wir bekämpfen zwar (zunächst vor allem propagandistisch), wie der Westen die Waffenlieferungen benützt, hindern aber auch nicht die ukrainischen Arbeiter:innen daran, die zur Verteidigung nötigen zu bekommen bzw. darum zu kämpfen, diese auf lange Sicht unabhängig von der bürgerlichen, proimperialistischen Führung kontrollieren zu können. Etwas, was bei einer mechanischen (kantianischen) „Konsequenz“ in der Anwendung allgemeiner Handlungsmaximen zu „inkonsistenten“ Haltungen gegenüber Waffenlieferungen zu führen scheint, ist also in der langfristigen Perspektive logisch mit der einzig möglichen revolutionären Perspektive der Umwandlung des bestehenden Stellvertreter:innenkrieges in einen revolutionären Bürgerkrieg verbunden.
Die Fragen von Krieg und Frieden in der Mitte der Zuspitzung des Konflikts zwischen den imperialistischen Großmächten müssen ausgehen von folgender prinzipiellen Orientierung Lenins gelöst werden: „Unser ‚Friedensprogramm‘ muss schließlich darin bestehen, klarzumachen, daß die imperialistischen Mächte und die imperialistische Bourgeoisie keinen demokratischen Frieden bieten können. Man muß ihn suchen und erstreben, aber nicht in der Vergangenheit, in der reaktionären Utopie eines nichtimperialistischen Kapitalismus oder eines Bundes gleichberechtigter Nationen unter dem Kapitalismus, sondern in der Zukunft, in der sozialistischen Revolution des Proletariats. Keine einzige demokratische Grundforderung ist in den fortgeschrittenen imperialistischen Staaten auch nur halbwegs umfassend und dauerhaft zu verwirklichen außer durch revolutionäre Kämpfe unter dem Banner des Sozialismus“ (LW 22, S. 171, „Über das ,Friedensprogramm’“).
Jede gegenwärtige Positionierung in der zugespitzten Situation imperialistischer Großkonflikte muss also von der einzigen progressiven Lösung her („der Zukunft“), der globalen sozialistischen Revolution aus gedacht werden – inwiefern diese oder jene Forderung, Aktion, Organisierung etc. das Proletariat an diese näher rückt oder von ihr entfernt.
Als Beispiel hierzu vor und im Ersten Weltkrieg sind wir ja ausführlich auf die Zuspitzung der imperialistischen Gegensätze auf dem Balkan und letztlich die Rolle Serbiens eingegangen. Ähnlich der seit einigen Jahren aufgeladenen Situation in der „Peripherie“ Russlands war vor dem Ersten Weltkrieg, nach dem Zerfall des Osmanischen Reiches auf dem Balkan, ein fragiles Gleichgewicht von Staaten entstanden, die jeweils mit unterschiedlichen europäischen Großmächten verbunden waren. Dies führte zu mehreren politischen, ökonomischen und militärischen Auseinandersetzungen – Letztere zunächst als Stellvertreter:innenkriege zwischen den Balkanstaaten. In dieser Situation wurde Serbien vom russischen Imperialismus als „Gegengewicht“ zu Österreich-Ungarn aufgebaut, das seinerseits seine innenpolitische Stabilität durch das Entstehen einer südslawischen Großmacht in Gefahr sah. Durch sein Bündnis mit Russland war es in den Jahren vor 1914 der französische Imperialismus, der daraufhin Serbien massiv militärisch aufrüstete – woraufhin Österreich-Ungarn bereits mit einem Wirtschaftskrieg gegen Letzteres reagierte. Diese Entwicklung fand in den Aktivitäten der wohl vom russischen Geheimdienst unterstützten „Schwarzen Hand“ und ihren Aktionen in Bosnien die Lunte am Pulverfass. Serbien wurde also wie die Ukraine heute von einem der imperialistischen Blöcke benutzt, um den anderen Block herauszufordern. Der reagierte prompt mit der Invasion Serbiens durch die österreichisch-ungarische Armee.
Der führende serbische Sozialdemokrat Dušan Popović schrieb dazu in einem Brief an Rakowski 1915 im Rückblick: „Für uns war es klar, dass in dem Konflikt zwischen Serbien und Österreich-Ungarn Serbien in einer Verteidigungsposition war. Österreich war schon lange in einem Eroberungsmodus gegenüber Serbien, sogar bevor es unabhängig wurde. Serbien kämpft um sein Leben und seine Unabhängigkeit, die von Österreich andauernd in Frage gestellt wurde, schon lange vor Sarajevo. Wenn eine Sozialdemokratie das Recht gehabt hätte, für die Aufrüstung zu stimmen, dann die serbische.“
Auch Lenin bemerkte in der Schrift „Der Zusammenbruch der II. Internationale“, dass die Frage der nationalen Selbstbestimmung und Verteidigung in Serbien durchaus im Vordergrund stand: „Das nationale Element im jetzigen Krieg ist nur durch den Krieg Serbiens gegen Österreich vertreten […] Nur in Serbien und unter den Serben haben wir seit vielen Jahren eine nationale Befreiungsbewegung, die Millionen ‚Volksmassen’ umfasst und deren ‚Fortsetzung’ der Krieg Serbiens gegen Österreich ist.“ (LW 21, S. 230) Dieser Feststellung folgt aber sogleich die methodische Anmerkung, dass die Dialektik keine isolierten Betrachtungen von Einzelkonflikten zulässt und so etwas wie „reine Fälle“ (nationaler Verteidigungskrieg/imperialistischer Krieg) kaum zu erwarten sind. Daher: „Wäre dieser Krieg isoliert, d. h., wäre er nicht mit dem gesamteuropäischen Krieg, mit den eigensüchtigen und räuberischen Zielen Englands, Rußlands usw. verknüpft, so wären alle Sozialisten verpflichtet, der serbischen Bourgeoisie den Sieg zu wünschen […] Das nationale Moment des serbisch-österreichischen Krieges hat im gesamteuropäischen Krieg keine ernsthafte Bedeutung [… ] Die Tripelentente, die Serbien ,befreit’, verkauft die Interessen der serbischen Freiheit an den italienischen Imperialismus für die Hilfe bei der Ausplünderung Österreichs.“ (ebd.).
Dieser prinzipiellen Orientierung folgten auch die serbischen Sozialist:innen, unabhängig von der Analyse des berechtigten Verteidigungskrieges gegen Österreich, als sie gegen die Kriegskredite im serbischen Parlament auftraten. Wieder Dušan Popović: „Für uns war jedoch die entscheidende Tatsache, dass der Krieg zwischen Serbien und Österreich nur ein kleiner Teil einer Totalität war, lediglich der Prolog zu einem universellen, europäischen Krieg, und dieser konnte – davon waren wir zutiefst überzeugt – nicht umhin, einen deutlich ausgeprägten imperialistischen Charakter zu haben. Daher hielten wir es als Teil der großen sozialistischen, proletarischen Internationale für unsere Pflicht, uns diesem Krieg entschieden entgegenzustellen.“
Diese klare internationalistische Haltung und Anerkennung der imperialistischen Totalität, in deren Rahmen der Konflikt stattfand, änderte nichts daran, dass sich die serbischen Sozialist:innen trotzdem mit voller Wucht (und vielen Opfern) an der Verteidigung Serbiens gegen die Invasion beteiligten und auch zu dieser aufriefen – verbunden mit dem Aufruf an die Arbeiter:innen des Balkans, diesen Kampf in den für eine sozialistische Balkanföderation zu überführen. Mit ihrer klaren unabhängigen Position, die den nationalen Verteidigungskrieg nicht leugnete, ihn aber auch in den Kampf gegen den Imperialismus aller Seiten einband, blieben die serbischen Sozialist:innen letztlich überhaupt nicht isoliert von den am Ende vom Nationalismus desillusionierten Arbeiter:innen in der Region. Nach dem Krieg war die neugegründete Kommunistische Partei Jugoslawiens eine derjenigen in Südosteuropa mit der größten Gefolgschaft.
Wie Lenin richtigerweise (auch in der Kritik der Junius-Broschüre) feststellte, ist es wichtig, die Vermischung unterschiedlicher Momente im Charakter eines Krieges (nationale Verteidigung, imperialistischer Krieg) festzustellen und in der jeweiligen Situation/Gelegenheit das überwiegende zu erkennen: „… daß es keine einzige Erscheinung gibt, die nicht […] in ihr Gegenteil umschlagen könnte. Ein nationaler Krieg kann in einen imperialistischen Krieg umschlagen und umgekehrt.“ (LW 22, S. 314, „Über die Junius-Broschüre“). Das Entscheidende bei der Berücksichtigung der unterschiedlichen Bestimmungen bleibt die Frage, inwiefern das Proletariat dabei seine Position zum Fernziel entweder der Führung eines antiimperialistischen Kampfes oder der Umwandlung in den revolutionären Bürgerkrieg verstärken kann. In diesem Zusammenhang ist auch die Frage der Waffenlieferungen oder der Stellung zur Aufrüstung des eigenen Staates zu sehen. So nahmen die serbischen Sozialist:innen zwar gegen die Aufrüstung ihres Staates vor allem durch Waffen- und Munitionslieferungen aus Frankreich z. B. im Parlament Stellung – andererseits waren sie natürlich nicht dagegen, diese für den Verteidigungskrieg gegen Österreich einzusetzen. Ebenso hätten französische Sozialist:innen natürlich gegen die Waffenlieferungen an Serbien im Parlament stimmen müssen (wie auch gegen die Aufrüstung Frankreichs insgesamt), da sie klar ein Element der imperialistischen Kriegsstrategie Frankreichs bildeten. In ähnlicher Weise war Lenin dafür, dass die irischen Aufständischen 1916 die Waffen, die sie kriegen konnten, nehmen sollten – auch wenn sie vom deutschen Imperialismus geliefert wurden, in seinem Bestreben, den britischen Imperialismus zu schwächen. Sowohl auf dem Balkan wie in Irland gab es offensichtlich Kräfte, die in der Lage waren, die von den imperialistischen Mächten gelieferten Waffen letztlich in ihrem eigenen Interesse, unabhängig von den Lieferant:innen, zu nutzen.
Es sei auch noch einmal betont, dass es sich natürlich im Unterschied zu Serbien im Ersten Weltkrieg heute noch nicht um einen direkten imperialistischen Krieg handelt. Abgesehen davon, dass der Ukrainekrieg, wie dargestellt, aber auch schon tatsächlich viele Elemente eines solchen Krieges birgt („Krieg neuen Typs“), ist das entscheidende Moment bei der Argumentation hier, dass in den nationalen Selbstverteidigungskrieg der Ukraine trotzdem über das Element des Stellvertreter:innenkrieges sehr viele Bestimmungen des imperialistischen Krieges eingehen (und ab einem bestimmten Moment schlägt Quantität bekanntlich in Qualität um).
Deswegen geht es bei der Frage der Waffenlieferungen nicht um allgemeine Prinzipien (bedingungslose Unterstützung versus keine Unterstützung imperialistischer Kriegsziele), sondern um die Einbettung in eine revolutionäre Perspektive zur Lösung der Kriegsfrage. Die Waffen sind zurzeit erforderlich, um den Sieg des russischen Imperialismus zu verhindern. Es muss aber andererseits jetzt auch unmöglich gemacht werden, dass der westliche Imperialismus den Konflikt für die eigene Aufrüstung und eventuell sogar für einen imperialistischen Krieg nützt. Daher müssen wir also auch den imperialistischen Charakter dieser Waffenlieferungen, die in diese Aufrüstungspolitik eingebunden sind, entlarven und dagegen Stellung beziehen. Auflösen lässt sich diese scheinbare Widersprüchlichkeit nur, sobald sich das Proletariat in der Ukraine, im Westen bzw. in Russland gegen die imperialistischen Kriegstreiber:innen auf allen Seiten erhebt.




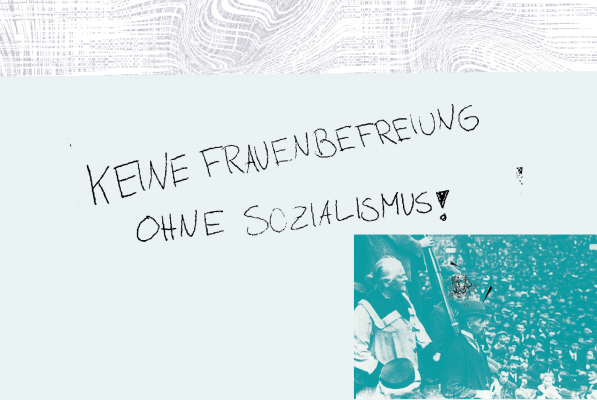

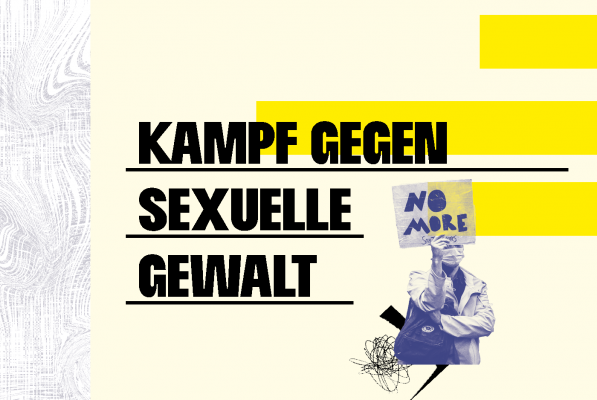


One thought on “Systematisches zum Ukrainekrieg”