Rechtsruck in Japan
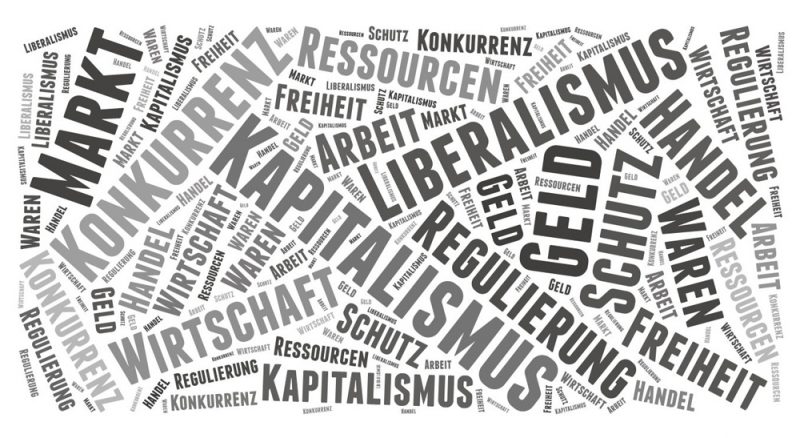
Bruno Tesch, Neue Internationale 296, November 2026
Sanae Takaichi, die am 21. Oktober gewählte neue Regierungschefin Japans, steht für Rechtsruck, Rassismus, Militarismus. Vorausgegangen ist ihrer Wahl eine politische Krise, die auch die regierende Liberaldemokratische Partei (LDP) erfasst hatte. Nachdem sie ihre absolute Mehrheit im Parlament verloren hatte, trat der bisherige Premier Shigenu Ishiba von seinen Posten als Regierungs- und Parteichef im September 2025 zurück und fungierte nur noch als Übergangspremier, bis eine Nachfolgerin gefunden wurde.
Anfang Oktober war es so weit. Takaichi errang den Vorsitz der LDP, was ihr den Weg zur Regierungschefin ebnete. Sie steht am äußersten rechten Flügel der Regierungspartei, schloss ein Bündnis mit der rechten JIP (Erneuerungspartei) und steht für „Japaner:innen zuerst“ – gegen Migration, gegen Tourismus, für Aufrüstung und verspricht einmal mehr, die Wirtschaft in Schwung zu bringen.
Natürlich bildet der globale Rechtsruck den Hintergrund für den Aufstieg Takaichis. Der Regierungswechsel muss aber auch im umfassenderen Kontext des Niedergangs des japanischen Imperialismus seit den 1990er Jahren verstanden werden.
Japans Aufstieg
Japan gehörte zu den Verlierernationen des 2. Weltkriegs. In seiner Nachkriegsentwicklung drängen sich Parallelen zum Werdegang der westdeutschen Bundesrepublik auf. Beide wurden massiv mit Injektionen von US-Kapital wieder aufgebaut. Zugleich bot sich ihre exponierte Frontstellung an verschiedenen Angelpunkten des Globus an, um gegen die sich als Block formierenden degenerierten Arbeiter:innenstaaten (Osteuropa, Sowjetunion, China, Nordkorea) als geostrategischer Stützpunkt des westlichen Imperialismus zu fungieren. Beide waren in militärische Pakte eingebunden (NATO und SEATO), durften jedoch über keine Nuklearwaffen verfügen. Japan wurde komplett entwaffnet und musste sogar auf eigenständige Operativkräfte verzichten. Nach wie vor sind dort 55. 000 US-Soldat:innen fest stationiert. Die Kosten dafür werden dem japanischen Staatshaushalt aufgehalst.
Japan entfaltete, ähnlich wie die BRD, dank niedriger Einstiegslöhne und hochinvestivem exportorientiertem Bedarf v. a. über die Automobilindustrie und moderne Technologien einen exorbitanten Boom und verschaffte sich durch die Akkumulation von nationalem Kapital einen führenden Platz unter den imperialistischen Mächten. In den 1970er und 1980er Jahren entwickelte sich das Land zum ökonomisch stärksten Herausforderer der USA.
Die anhaltende „japanische Krise“
Aufgrund der großen Außenhandelsüberschüsse Japans drängte die Regierung der USA damals darauf, dass die traditionellen Handelshemmnisse abgebaut wurden. Erfolgreich konnten sie gegenüber Japan und Deutschland eine Abwertung des Dollar durchsetzen, die ihre wichtigsten imperialistischen Rivalen benachteiligte. Die 1985 folgende Aufwertung des Yen, der Landeswährung, verschärfte die Situation, da nun massiv Kapital in den japanischen Immobilien- und Aktienmarkt floss und die Preise nach oben trieb. Der Yen wertete von 1985 bis 1988 um 73 % auf.
Die Abriegelung des eigenen Marktes gegenüber Importen zur Subventionierung von Exporten bedingte zusätzlich einen unverhältnismäßigen Anstieg der Konsumgüterpreise Ende der 1980er Jahre. Gemäß dem weltweiten Trend hatte auch Japan in den 1980er Jahren den Finanzmarkt dereguliert. Die lockere Handhabung der Kreditvergabe blähte den Finanzsektor künstlich auf. Daneben drohte auch die aufgepumpte Immobilienblase zu platzen.
1990 betrug der börsennotierte Gesamtwert aller Aktien japanischer Unternehmen das Dreifache der Marktkapitalisierung der an amerikanischen Börsen gelisteten Unternehmen, obwohl das Bruttoinlandsprodukt der USA mehr als doppelt so hoch war. 1990 erhöhte die japanische Zentralbank die Zinsen, damit die Ökonomieblase nicht weiter anschwoll. Damit begann die Deflation, die praktisch bis heute anhält.
Der Verbraucherpreisindex stand 2010 auf demselben Niveau wie 1992. Der BIP-Index fiel in dieser Zeit um 14 %. Die Immobilienpreise lagen auch 2014 noch unter ihren Höchstwerten von 1990.
Auch machte sich zunächst die Nachbarkonkurrenz der sogenannten südostasiatischen Tigerstaaten (Taiwan, Malaysia, Südkorea) bemerkbar, die aber bald selber in einen Krisenmodus trudelten. Vor allem aber erwuchs mit dem mächtigen Emporkömmling China ein überlegender Kontrahent im asiatisch-pazifischen Raum.
In Japan ist zu beobachten, dass die seit den 1990er Jahren anhaltende Stagnation auf einen starken Rückgang der Rentabilität produktiver Investitionen zurückzuführen ist – stärker als in jedem anderen G7-Land. Aufeinanderfolgende Regierungen haben die Sozialleistungen für Senioren seit 1995 real um 30 % gekürzt, und die Pro-Kopf-Ausgaben für die Gesundheitsversorgung von über 65-Jährigen wurden in drei Jahrzehnten um fast 20 % reduziert. Gleichzeitig wurden die Körperschaftsteuersätze von 50 % auf 15 % gesenkt. Während die Gewinne von 8 % auf 16 % des BIP gestiegen sind, sind die Steuereinnahmen von 4 % auf 2,5 % gesunken. Anstatt produktive Investitionen anzukurbeln, horteten die Unternehmen Kapital oder lenkten es in Staatsanleihen und Aktienmärkte um.
Die japanische Wirtschaft steckt in einer chronischen Stagnation
Japan zehrte lange von einem Vorsprung mittels innovativer Unterhaltungselektronik und Robotik. Dieser Vorsprung ist inzwischen aufgebraucht. Zwar hat sich mit Toyota der weltgrößte Autobauer etabliert und der Sony-Konzern hat eine beherrschende Stellung im Musikrechtemarkt erlangt, doch besetzen US-Mediengiganten mittlerweile die Schaltstellen des Kommunikationswesens.
Von Haus aus verfügt der Inselstaat über eine beschränkte Binnenwirt (im Vergleich zu den USA, China, aber auch der EU) und ist darum vom Export abhängig, v. a. in die USA. Die von dort aktuell verhängten Zölle treffen das Wirtschaftsfundament zusätzlich hart, da anderweitige Expansionsmöglichkeiten durch den wachsenden Einfluss Chinas noch deutlich eingeschränkt werden.
Die Bilanz Japans fällt für seine ökonomischen Ambitionen verheerend aus: Nach einem jährlichen Wachstum von 8 bis 10 % bis 1973 hat die Wirtschaft seit 2008 kaum noch ein Anwachsen über Null erreicht.
Im ersten Quartal 2025 schrumpfte sie, und die Handelszahlen deuten auf einen weiteren Rückgang im zweiten Quartal hin, was eine technische Rezession bedeutet. Im besten Fall wird Japan in diesem Jahr nur um 0,7 % und im nächsten Jahr um 0,4 % wachsen. Japan bildet das Schlusslicht unter den Imperialismen bei den Wachstumsprognosen für 2026, die laut IWF vom ohnehin niedrigsten Sockel von 0,7 % noch einmal um zwei Zehntel auf 0,5 % absteigen werden.
Japan wird, auch nach Einschätzung des IWF, zwei Jahrzehnte der Sparpolitik benötigen, um die Verluste der 2020er Jahre wieder auszugleichen. Es plagt sich zudem wie alle übrigen imperialistischen Länder mit enorm gewachsenen Schuldenlasten, deren zinsträchtige Bedienung einen Großteil des öffentlichen Etats frisst.
Politischer Wandel
Scheinbar unbeeindruckt von den ökonomischen Verwerfungen schien die politische Landschaft länger in harmonischer Kirschblüten-Stabilität zu verharren.
Das politische System wirkt erstarrt durch die seit den 50er Jahren ungebrochene Dominanz einer einzigen Partei, der Liberaldemokratischen Partei (LDP), die zumeist allein oder in wechselnden Koalitionen mit wenigen Ausnahmen (1993–1994, 2009–2012) auch den Regierungschef stellte. In den Ausnahmezeiten musste die LDP hauptsächlich wegen Korruptionsaffären führender Politiker:innen aussetzen.
Prägend für die Partei ist ihre Verflechtung mit dem bürokratischen Apparat in Wirtschaft und Staat. In der politischen Ausrichtung ist sie auf deutsche Verhältnisse gemünzt am ehesten mit der FDP vergleichbar. Zwar kann sie mit angeblich 1,1 Millionen Mitgliedern in Anspruch nehmen, Massenpartei zu sein, jedoch nicht als „Volkspartei“ bezeichnet werden, da sie nicht verschiedene gesellschaftliche Kräfte repräsentiert, sondern einen nationalistischen Flügel unter ihren Fittichen hat und zu einem Großteil aus Karrierist:innen besteht. Die LDP ist eine konservative, erzbürgerliche Partei.
Doch die Zeitenwende mit ihren verschiedenartigen krisenhaften Herausforderungen klopft auch an Japans politische Türen. Haben seine Regierungen mehr schlecht als recht auf wirtschaftliche Defizite reagieren müssen, so stellen sich mit dem Kampf um die Neuaufteilung der Welt Aufgaben, Mittel für massive Erhöhungen der Ausgaben in den Militärhaushalt umzuschichten. Das ist kein leichtes Amtieren. Auch Japan wird nicht umhin können, mit alten Gewohnheiten zu brechen.
Schon 2022 vollzog das Land eine entscheidende Richtungsänderung, durch die die verfassungsmäßigen Grundsätze, wonach Japan nur im Verteidigungsfall Krieg führen darf, ausgehebelt worden sind. Die Regierung entwarf eine neue nationale Sicherheitsstrategie, in deren Mittelpunkt die Akquise sogenannter Gegenschlagfähigkeiten, d. h. Rüstung mit Offensivwaffen, steht.
Für diese Neuausrichtung scheint Sanae Takaichi als just gewählte Premierministerin nun die Richtige, um einen geänderten Kurs zu fahren, der die Großmachtambitionen im interimperialistischen Konkurrenzkampf frisch befeuert. Sie kommt aus den rechten nationalistischen Reihen der Partei. Sie bezeichnet sich selber als „eiserne Lady Japans“ nach ihrem Vorbild Margret Thatcher, der britischen Premierministerin der 1980er Jahre. Takaichi hat sich mit der rechtspopulistischen Partei Nippon Ishin no Kai (Japanische Erneuerungspartei) eine passende Partnerin gesucht, die ihr politische Handlungsfreiheiten zusichert. Die Frau drischt dröhnend auf Migrant:innen ein und will den Zuzug von ausländischen Arbeitskräften sowie von Tourist:innen stark beschränken, um vorgebliche Kriminalität einzudämmen, und fordert eine Obergrenze, obwohl Japan an Überalterung der arbeitenden Bevölkerung leidet.
Im Punkt Aufrüstung will die neue Chefin sogar noch einen Schritt über die Vorschläge im Strategiepapier zur Sicherheit hinausgehen und befürwortet eine Ausweitung des Operationsfeldes für die Marine. Schon unter ihren Vorgängern wurde der Rüstungshaushalt auf erhöht. 2027 soll er 66 Milliarden US-Dollar betragen, eine Steigerung von 65 % gegenüber 2022.
Die Gleichstellung von Frauen will sie z. B. beim Namensrecht zurückschrauben und spricht sich für die Festschreibung der patrilinearen Erbfolge der japanischen Monarchie aus.
Die Verbraucher:innenpreise wiederum möchte sie eindämmen; mit welchem Mittel, ließ sie offen. All diese Absichten, insbesondere die Erhöhung des Militärbudgets auf über 2 % des BIP, erfordern, die Sozialausgaben und Einkommen der Arbeiter:innenklasse weiter drastisch zu kürzen.
Arbeiter:innenbewegung
Der gewerkschaftliche Organisierungsgrad der Lohnabhängigen liegt bei vergleichsweise niedrigen 16,1 %. Traditionell gliedert sie sich nicht nach Branchen oder Tätigkeiten, sondern nach Betriebszugehörigkeit, was deren Handlungsfähigkeit und Reichweite ungemein erschwert. Zwar wird im Frühjahr eine landesweit koordinierte Kampagne zu Lohnverhandlungen durchgeführt, doch die Verhandlungen werden wieder auf die Betriebsebene zurückverwiesen, was deren solidarischen Charakter und Konsequenzen entwertet.
Die Zahl der Streiks in Japan ist auf ganze 33 im Jahr 2022 zurückgegangen. Die rückläufige Tendenz kann nicht nur mit der Pandemie begründet werden. Auf eine organisierte Kraft, die auf Streiks gegen arbeiter:innenfeindliche Regierungsmaßnahmen abzielt, kann in dieser Verfasstheit nicht gebaut werden. Das Gewerkschaftswesen müsste dringend reorganisiert werden nach dem Prinzip starker Industrieverbände.
Die reformistische Sozialistische Partei, die ursprünglich nach dem 2. Weltkrieg auch starke Verbindungen zu Gewerkschaftsverbänden hatte, spaltete sich 1996, nachdem sie im Murayama-Kabinett kurzfristig den Premierministerposten innehatte, und benannte sich in Sozialdemokratische Partei um. Dabei verlor sie einen großen Teil ihrer Abgeordneten an die heutige, offen ins bürgerliche Lager gerückte Demokratische Partei. Das linkere Spaltprodukt Neue Sozialistische Partei – Friedensliga verfügt seit 1998 über keine gesamtparlamentarische Präsenz mehr und hat außerparlamentarisch keine nennenswerten Initiativen vorzuweisen. Im Kern ihrer Programmatik stehen das Bekenntnis zur demilitarisierten Neutralität und Offenheit für ökologische Fragen. Von dieser Seite ist also kein Impuls für Opposition gegen die Rechtsentwicklung zu erwarten.
Dabei gäbe es genug Themen, zu denen die Revolutionär:innen Kampagnen entfachen könnten. Die aktuelle Frage der Militarisierung der Gesellschaft hat in der Vergangenheit schon einmal Teile insbesondere der Jugend aufgerührt. Im Vorfeld der Olympischen Spiele in Tokio 1964 fanden gegen die Einfahrt eines US-Atom-U-Bootes landesweite Massenproteste statt, die gewaltsam niedergeschlagen wurden.
Aus der jüngeren Zeit hat die bis heute von Regierung und Betreiberfirma ungesühnte Nuklearkatastrophe von Fukushima 2011 zu Demonstrationen in Japan und anderen Ländern geführt.
Der Kampf gegen den Rassismus gegen Migrant:innen und gegen Sexismus müsste mit dem für die sozialen Interessen der gesamten Arbeiter:innenklasse verbunden werden.
Doch dazu braucht es eine politische Kraft, die diese Fragen im Rahmen einer Gesamtstrategie verbindet – eine neue Arbeiter:innenpartei, in die revolutionäre Kräfte intervenieren und dort für eine revolutionäre Ausrichtung kämpfen müssen.





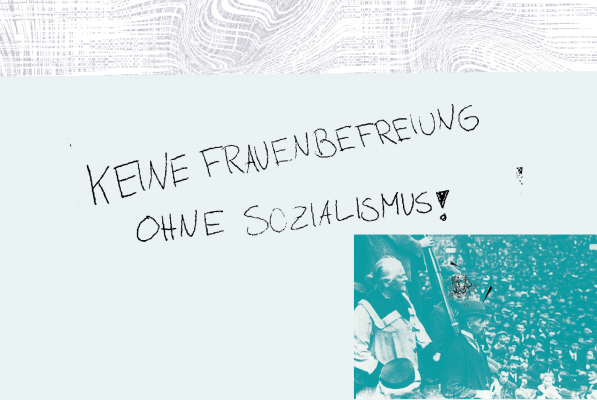

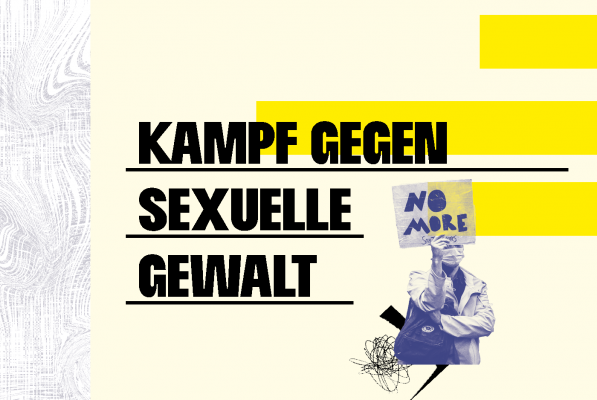


One thought on “Rechtsruck in Japan”