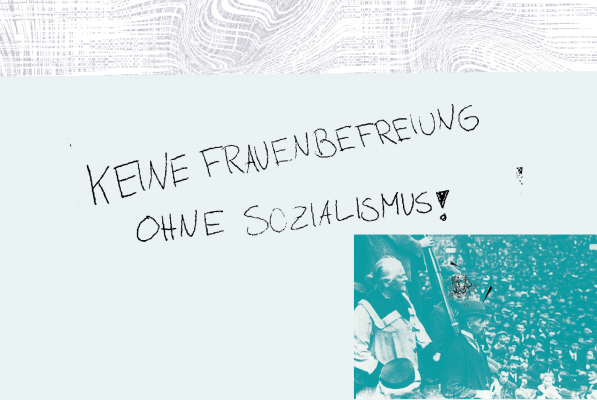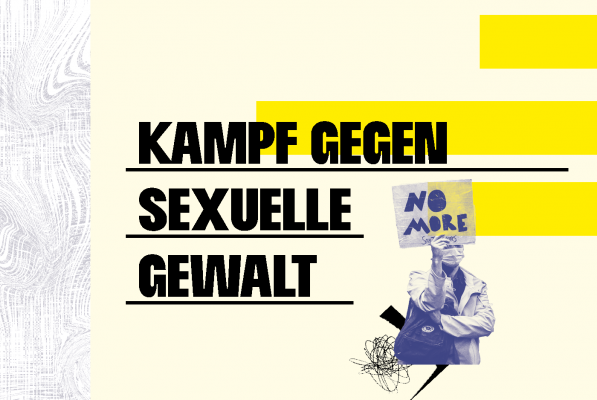Von der Sowjetunion zum Russischen Imperialismus
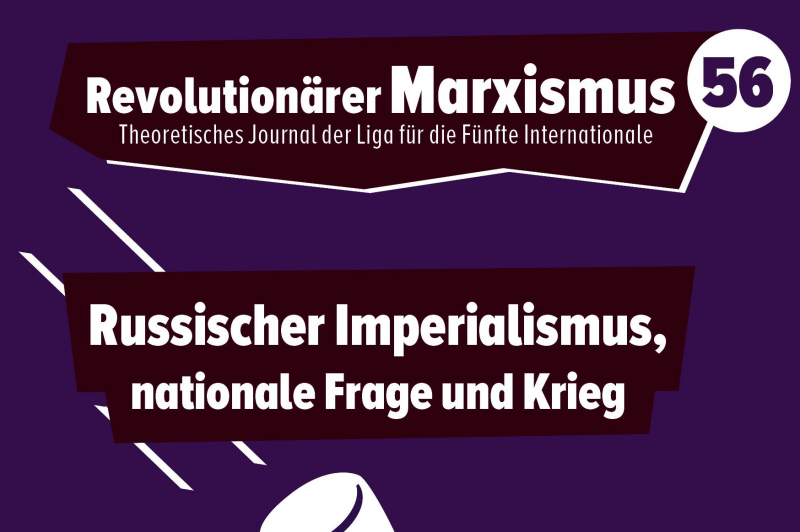
Markus Lehner, Revolutionärer Marxismus 56, August 2025
Inhalt
Vorbemerkung
1. Die Krise der Sowjetökonomie
1.1 Grundprobleme nachkapitalistischer Gesellschaften
1.2 Bürokratische Planwirtschaft in der Sowjetunion
1.3 Grundmerkmale der Krise der bürokratischen Planung
2. Die finale Krise entwickelt sich
2.1 Die bürgerlich-restaurationistische Regierung
2.2 Krise der Planwirtschaft – Restauration des Kapitalismus – kapitalistische Krise
3. Schocktherapie und „Washington Consensus“
3.1 Die Durchführung der Schocktherapie
3.2 Umgestaltung der Arbeiter:innenklasse und Herausbildung eines Arbeitsmarktes
3.3 Die Schaffung einer russischen Kapitalist:innenklasse
3.4 Die Schaffung eines Kapitalsmarktes
3.5 Wer waren also die entstehenden neuen Kapitalgruppen
4. Freiheit – Marktwirtschaft – Demokratie oder: der Weg in die Diktatur des Kapitals
4.1 Tschetschenien – das Imperium erhebt sich
4.2 Die russische Rüstungsindustrie – der industrielle Kern des russischen Kapitals
4.3 Russischer Nationalismus und die Macht in den Regionen
4.4 Das Verhältnis Zentrum – Regionen als innerer Kolonialismus
4.5 Privatisierung von Grund und Boden – Sonderrolle der Landwirtschaft
5. Das Verhältnis zu den ehemaligen Sowjetrepubliken und die internationale Stellung Russlands
6. Die Präsidentschaftswahl 1996 und der weitere Verlauf der Privatisierungen
7. Die Russlandkrise 1998 und der zweite Tschetschenienkrieg als Wendepunkt
7.1 Die Primakow-Doktrin
7.2 Der Aufstieg Putins
8. Stabilisierung des neuen Akkumulationsmodells unter Putin – Charakter der russischen Ökonomie
8.1 Von der Wirtschaftskrise 2008 bis zur nationalkapitalistischen Wende
8.2 Wirtschaftspolitische Wende nach 2015
9. Neue Großmachtpolitik Russlands
9.1 Georgien
9.2 Russland als Atommacht
9.3 Naher Osten und Afrika
9.4 Zentralasien und Kaukasus
9.5 Republik Moldau
9.6 Ukraine
10. Hauptmerkmale russischer Großmachtpolitik
11. Der imperialistische Charakter Russlands
11.1 Die Imperialismustheorie
11.2 Das heutige Russland als imperialistische Ökonomie
11.3 Andere Positionen zum imperialistischen Charakter Russlands
11.4 Der besondere Weg Russlands vom degenerierten Arbeiter:innenstaat zum Imperialismus
12. Russland im Krieg
12.1 Politisch-ideologische Vorbereitung
12.2 Die Minsk-II-Etappe
12.3 Die Ukrainrede Putins
12.4 Kriegsverlauf
13. Auf dem Weg zu einem neuen Jalta-Abkommen?
Endnoten
Vorbemerkung
Im 19. Jahrhundert hat sich das Russische Zarenreich redlich die Zuschreibung verdient, das Zentrum des reaktionären Despotismus in Europa und Asien zu sein, das eine Vielzahl von Völkern unterdrückt oder kolonisiert. Heute schickt sich die Russische Föderation an, voll und ganz in diese Fußstapfen zu treten. In einem jüngst erschienenen Buch des Russischen Journalisten Vladimir Esipov wird im Untertitel die Frage formuliert: „Wie meine Heimat zum Feind der Freiheit wurde“.[i] Wenn man derzeit in Buchhandlungen in den Regalen zum aktuellen Zeitgeschehen stöbert, so findet man überhaupt jede Menge Neuerscheinungen, die uns „Putins Russland“ erklären wollen. Zumeist von Autor:innen, die immer schon gewusst haben wollen, wie „gefährlich“ Putin ist, auf die aber schon damals niemand gehört habe. Andere gehen tief in die Vergangenheit des despotischen Russlands zurück, dessen Traditionen und „Denkweisen“ eben immer noch weiterwirken würden. Wieder andere entdecken dort eine „toxische Gesellschaft“ , wobei auch tatsächlich einige wichtige Informationen über extrem rechtsnationalistische Kreise und deren (von Putin ganz unabhängig) wachsendem Einfluss auf die Russische Politik bekannter werden. Esipovs Buch sticht zumindest als konkreter Erlebnisbericht zu den Umbrüchen nach 1990 hervor.
Was den meisten dieser Analysen gemeinsam ist, ist die Grundannahme, dass Kapitalismus und „Freiheit“/„Demokratie“ irgendwie natürlich zusammengehören würden und nur irgendwelche irrationalen Phänomene oder national-geschichtliche Besonderheiten eine Abweichung von dieser Symbiose erklären könnten. Hier wollen wir erläutern, dass nicht trotz, sondern gerade wegen der Restauration des Kapitalismus in Russland dieser Staat autoritäre und imperialistische Züge annehmen musste und daher auch nur eine neuerliche Überwindung des Kapitalismus Russland als „Hort der Unfreiheit“ wird überwinden können. Dabei muss nicht nur der emanzipatorische Gehalt beider Revolutionen von 1917 wieder angeeignet werden, sondern auch die Traditionen des antistalinistischen Widerstands. Die Oktoberrevolution hat zwar eine nachkapitalistische Transformation eingeleitet, wurde aber schon nach einem Jahrzehnt von einer bürokratischen Despotie umgeworfen, die einen Großteil der alten Unterdrückungsapparate in gesteigerter Form wieder einführte, um jegliche Demokratie von unten unmöglich zu machen. Die demokratisch-revolutionären Ansätze der 1990er Jahre, die z. B. im heroischen Widerstand gegen den Janajew-Putsch im August 1991 zum Ausdruck kamen, hätten zu einer demokratischen Wiederbelebung einer sozialistischen Transformation führen können. Tatsächlich dienten sie der Funktionär:innenclique um Jelzin und deren „Kapitalist:innen in spe“ in den Wirtschaftsbetrieben dazu, die Bühne frei zu machen für eine möglichst rasche Wiedereinführung des Kapitalismus.
Die schwere soziale und ökonomische Krise der 1990er Jahre im Gefolge von „Schocktherapie“ und ungezügelten Privatisierungswellen legte die Basis für die Besonderheiten der sich danach entwickelnden „Putin-Ära“. Bei der überraschenden ökonomischen Wende zwischen den Zerfallsprozessen der 1990er Jahre und der Aufschwungsperiode Anfang der 2000er Jahre zeigten sich tatsächlich tiefgreifende Veränderungen, die sich in den 1990er Jahren vorbereitet hatten.
Esipovs Beschreibung der ökonomischen Wende um 2000 herum ist durchaus typisch für die oberflächliche Standarderklärung: Einerseits wird auf den glücklichen Umstand verwiesen, dass in der Aufschwungsphase der Globalisierung die Rohstoff- und Energiepreise konstant stark anstiegen, was den stabilisierten Russischen Rohstoffkonzernen und dem russischen Staat mit Hilfe einer strikteren Steuerpolitik enorme Einnahmen bescherte. Andererseits, als wäre das ein ganz gesondertes Phänomen, wird von den eklatanten sozialen Unterschieden zwischen einer kleinen sich bereichernden Spitze der Gesellschaft samt konsumfreudiger Mittelschicht und der Masse der Abgehängten in Russland erzählt, die z. B. kaum auf Arbeitszeitbeschränkungen oder soziale Absicherungen hoffen konnte. Zusätzlich wird dann auf die äußerst geringe Sparquote (im Vergleich zu westlichen Ländern) als „Mentalitätsproblem“ verwiesen, die Anfang der 2000er Jahre durch rasch steigenden Konsum als Konjunkturverstärker gewirkt habe. Verkannt wird in dieser Erzählung, dass sich hinter diesen Phänomenen die Wiederherstellung des Kapitals als gesellschaftliches Verhältnis verbirgt. Ein Verhältnis zwischen Klassen, das wesentlich auf Ausbeutung, der Aneignung unbezahlter Arbeit in Form von Mehrwert, beruht. Das wesentliche Resultat der Wirren der 1990er Jahre war also die Transformation einer Arbeiter:innenklasse, deren Mehrwertproduktion vom Kapital in Profit verwandelt werden konnte, der zur erweiterten Reproduktion unter Kapitalkontrolle eingesetzt werden kann. Die besonderen Bedingungen der geschrumpften industriellen Sektoren und der Konzentration auf den Rohstoff-/Energiesektor mussten dazu führen, dass diese erweiterte Reproduktion unter offener Weltmarktkonkurrenz nur mit einem besonders extensiven und ausbeuterischen Arbeitsregime erfolgreich sein konnte. Wie wir sehen werden, ist der russische Arbeitsmarkt seit 2000 geprägt von einer hohen Beschäftigungsrate bei extensivem Stundenvolumen einerseits und dagegen zurückbleibenden Löhnen und Arbeitsproduktivität andererseits. Dieses Akkumulations- kann nur mit einem stark repressiven Arbeitsregime, ausgedehnter Kontrolle und geringen Rechten in Bezug auf Interessenvertretung oder gar Widerstand funktionieren. Andererseits konnten sich so auch keine breiten Mittelschichten oder eine gehobene Facharbeiter:innenschicht entwickeln, die für die intensiven Akkumulationsregime des „Westens“ typisch sind – daher auch die weiterhin geringe Sparquote. Die sehr viel schärfere gesellschaftliche Polarisierung in Russland samt repressiver Verhältnisse im Alltag bilden daher an sich schon starke Grundlagen für die Tendenz zum Bonapartismus – der „starken Hand“, die „die unten“ vor allzu unmäßigen Übergriffen der „Reichen“ schützt, andererseits „zum Wohle aller“ für die Disziplin der Unterschichten und den Kampf gegen „kriminelle Elemente“ sorgt. Kurz, der Weg wurde bereitet für den Bonaparte, der „über den Klassen“ steht und die „ganze Nation“ wieder stark macht. Dazu kommt, dass schon die Wiedereinführung des Kapitalismus nur mit extrem bonapartistischen Maßnahmen vonstattengehen konnte. Wir werden daher zeigen, dass bereits seit 1993 in Russland von einem autoritären Bonapartismus gesprochen werden muss. Tatsächlich drückt sich darin eine dem Neoliberalismus innewohnende Tendenz zum Autoritarismus aus, die es beileibe nicht nur in Russland gab und gibt.
Die „Wiederauferstehung Russlands“ ist der zweite Faktor für die Entstehung eines autoritären russischen Imperialismus. Die ökonomische Stabilisierung Russlands konnte nicht gelingen ohne eine gleichzeitige Wiederbelebung seiner Großmachtpolitik. Esipov hat durchaus recht, dass im Westen die Illusion vorherrschte, dass die Sowjetunion doch einfach in 15 Estlands zerfallen könne. Die baltischen Republiken sind von überschaubarer Größe und ließen sich leicht ökonomisch und politisch dem Westen unterordnen. Aber Russland blieb auch nach der Auflösung der Sowjetunion das mit Abstand größte Land der Welt (mit über 17 Millionen Quadratkilometern etwa doppelt so groß an Landmasse wie die nächstfolgenden Länder wie z. B. Kanada, USA, Brasilien), mit strategisch wichtigen Zugängen zu Ostsee, Nordatlantik, Arktis, Pazifik, Schwarzem und Kaspischem Meer. Neben dieser rein geografischen Größe zählt es weiterhin auch von der Bevölkerungszahl her zu den großen Ländern der Welt – und ist nicht nur selbst weiterhin ein Vielvölkerstaat, sondern russische Minderheiten gab und gibt es in mehr oder weniger großer Zahl in allen ehemaligen Sowjetrepubliken. Dazu kamen starke wirtschaftliche Verflechtungen, die nur in den baltischen Staaten rasch gekappt wurden. Und dann war da noch eine der größten Armeen weltweit mitsamt gewaltigem Atomwaffenarsenal. In einer Reihe von Regionalkonflikten schon in den 1990er Jahren (insbesondere im Kaukasus) wurde klar, dass sich das Gros der ehemaligen Sowjetrepubliken nicht „estnisieren“ ließ und Russland weiterhin eine wichtige Rolle spielen würde. Obamas Rede von Russland als „Regionalmacht“ war hier eine weitere Illusion; als ob sich die Russische Föderation als „Ordnungsfaktor“ in die zweite Reihe als eine Art Untersheriffin des Westens einreihen ließe! Dazu kommt, dass seit den 2000er Jahren mit China eine weitere neue kapitalistische Macht den schwächer werdenden US-Hegemon zur Neuaufteilung der Welt herausfordert. Damit sahen die Herrschenden in der Russischen Föderation die Gelegenheit gekommen, sich endgültig von der seit den 1990er Jahren betriebenen Westannäherung abzuwenden, sich von dessen Einflussnahme zu befreien und in diesen Kampf um die Neuaufteilung der Einflusssphären unter den Großmächten einzusteigen.
Boris Kagarlizki[ii] hat versucht, die widersprüchliche Position Russlands unter dem Begriff „peripheres Imperium“ zu fassen. Damit soll die paradoxe historische Tendenz Russlands seit dem 16. Jahrhundert ausgedrückt werden, einerseits von Elementen der Rückständigkeit, der Eingliederung in das Weltsystem als „Peripherie“ (z. B. Rohstofflieferant) und wechselnden Phasen der nachholenden Entwicklung geprägt zu sein, andererseits aufgrund seiner Größe und Militärmacht in diesem System doch auch als Großmacht zu wirken. Lenins Zuordnung auch des zaristischen Russlands als „imperialistische Großmacht“ drückt dagegen eine dynamischere Begrifflichkeit aus, nach der der russische Kapitalismus trotz seiner peripheren Elemente bereits Tendenzen der Herausbildung einer Kapitalstruktur enthielt, die seiner Großmachtrolle entsprachen. Die Sowjetökonomie kann aus der Sichtweise der „peripheren Wirtschaftsentwicklung“ sicher unter dem Gesichtspunkt der „importsubstituierenden nachholenden Entwicklung“ gesehen werden. Gerade die damit verbundenen eigenständigen Industrien, vor allem im Produktionsmittelsektor, seien es aber, die in der „Restaurationsära“ der 1990er Jahre in großem Ausmaß zerstört wurden. Daher gehen Autoren, wie z. B. Felix Jaitner[iii] im Anschluss an Kagarlizki, davon aus, dass Russland wieder auf ein „Ressourcen extrahierendes Entwicklungsmodell“ zurückgefallen sei. Wir dagegen meinen, dass die russische Ökonomie in der „disruptiven Phase“ der 1990er Jahre tatsächlich eine sehr eigenständige und von großen Konzernen geprägte kapitalistische Dynamik entfaltet hat, mit Eigenheiten, wie sie jeder entwickelte Kapitalismus aufweist. Dies betrifft nicht nur die Industrie (um den militärisch-industriellen Komplex und die Informations- und Telekommunikationsbranche), sondern auch die Landwirtschaft. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten ist Russland nicht mehr auf die Einfuhr von Lebensmitteln angewiesen, sondern hat sich zum Netto-Exporteur entwickelt. Diese neue Tendenz zur Eigenständigkeit wird durch die Sanktionen rund um den Ukrainekrieg einerseits bestärkt. Andererseits haben die große Erschütterung des Ukrainekrieges, die stärkere Abhängigkeit von China, die widersprüchliche Entwicklung des Verhältnisses zu den USA wie auch die großen ökonomischen und militärischen Probleme während des Krieges die Stellung Russlands als imperialistische Macht stark verändert.
Dies umreißt die Themen, die in diesem Artikel behandelt werden: (1) Verlauf der Wiedereinführung des Kapitalismus in Russland im Anschluss an die Krise der Sowjetökonomie; (2) Konsequenzen für die nach 2000 erfolgte Entwicklung von russischer Ökonomie und Politik; (3) Entwicklung Russlands zu einer schwächelnden, militärisch-aggressiven imperialistischen Großmacht; (4) Ausblick auf die möglichen Entwicklungsszenarien; (5) Konsequenzen für die russische Arbeiter:innenklasse.
Ruslan Dsarassow[iv] bemerkt in seinem Buch über die Entwicklung des neuen russischen Kapitalismus zurecht, dass die chaotische und brutale Wiedereinführung des Kapitalismus in den 1990er Jahren nicht zu begreifen sei, ohne die finale Krise von Sowjetökonomie und -gesellschaft zu verstehen.[v] Daher auch hier einige grundlegende Bemerkungen dazu.
1. Die Krise der Sowjetökonomie
1.1 Grundprobleme nachkapitalistischer Gesellschaften
In den Jahren nach der Oktoberrevolution wurden durch Verstaatlichung, Preiskontrolle, Kollektivierung der Landwirtschaft, Außenhandelsmonopol und vor allem durch die Einführung der Planwirtschaft grundlegende Gesetzmäßigkeiten des Kapitalismus außer Kraft gesetzt. Dies führte zwar zu einer nachkapitalistischen Übergangsgesellschaft, die jedoch von ihrer weiteren Entwicklung hin zu sozialistischen Prinzipien der Umgestaltung von (Re‑)Produktion und Verteilung weit entfernt war. Die politische Konterrevolution der späten 1920er Jahre etablierte eine despotische Kontrolle der bürokratischen Kaste über die Sowjetökonomie, die die wichtigste Produktivkraftentwicklung der Übergangsgesellschaft nicht zur Entfaltung kommen ließ, nämlich die sich demokratisch selbst organisierende Arbeiter:innenschaft.
Den Charakter als nachkapitalistische Gesellschaft kann man marxistisch kurz zusammenfassen durch die Zurückdrängung der Wirkung des Wertgesetzes. Im „Wert der Ware“ spiegelt sich unter kapitalistischen Bedingungen die „gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit“ zu ihrer Produktion. Darin drücken sich sowohl die Durchsetzung von Produktivitätsstandards auf den jeweiligen Warenmärkten als auch die Verteilung der Produktionsfaktoren auf die einzelnen Wirtschaftssektoren gemäß der „kaufkräftigen Nachfrage“ aus. Dies wird im Kapitalkreislauf der erweiterten Reproduktion vermittelt durch die Ausgleichsbewegung der Durchschnittsprofitrate, durch die sich Wert in Preis transformiert. Dies setzt nicht nur die Konkurrenz der Kapitale auf den unterschiedlichen Märkten, sondern vor allem das Kapital-/Lohnarbeitverhältnis voraus, das in diesem Kreislauf beständig auf höherer Stufenleiter reproduziert wird und dort die Verwandlung von Mehrwert in Profit ermöglicht. Letztlich kann dieser nur funktionieren, wenn Letzterer von den Eigentümer:innen der Produktionsmittel dann gemäß der Entwicklung der Profitrate des jeweiligen Sektors in die erweiterte Reproduktion investiert wird. Der Kreislaufprozess selbst schafft damit die „kaufkräftige Nachfrage“ im Sinn von erweiterter Reproduktion von variablem und konstantem Kapital.
Die „Zurückdrängung des Wertgesetzes“ betrifft daher alle diese Aspekte: Die Verteilung der Produktionsfaktoren und die „Investitionen“ werden im Wesentlichen durch politische Entscheidungen, nicht durch „Profitabilitätskriterien“ gesteuert. Sofern Güter noch mit Preisen versehen sind, verlieren diese ihre Steuerungswirkung („Preissignale“), da sie entweder eher Buchgeldpreise darstellen oder politisch bestimmt sind (z. B. Lebensmittel, öffentlicher Transport). Produktionsmittel und Arbeitskräfte sind für die Betriebe nicht über entsprechende Märkte zu erwerben, sondern werden zugeteilt. Von Betrieben erwirtschaftete „Überschüsse“ können nicht als Gewinne realisiert und wieder investiert werden, Produktivitätssteigerungen und technologische Neuerungen nicht über Preisvorteile, sondern nur über politische Entscheidungen zur Umgestaltung des Gesamtwirtschaftsprozesses führen. Der Ausfall des Wertgesetzes als Steuerungsprinzip für Verteilung und Produktivkraftentwicklung muss daher durch einen gesamtgesellschaftlichen, bewussten Lenkungsmechanismus ersetzt werden. Für eine postkapitalistische Wirtschaft genügt die Kontrolle und Selbstverwaltung der Arbeitenden im Einzelbetrieb nicht – ansonsten stellt das Wertgesetz auf gesamtgesellschaftlicher Ebene zwangsläufig kapitalistische Ausbeutungsverhältnisse wieder her. Dieser gesamtgesellschaftliche Lenkungsmechanismus in der Sowjetunion war der staatliche Planungsprozess, der allerdings unter dem Stalinismus die betriebliche Selbstverwaltung extrem zurückdrängte und nur einer geringen Kontrolle durch die Arbeiter:innen auf gesamtgesellschaftlicher Ebene unterworfen war, im Wesentlichen vermittelt durch „die Partei“. Letztere setzte der Wirtschaftsbürokratie, von den Betriebsdirektor:innen bis zu den Planungsbehörden, enge politische Grenzen.
1.2 Bürokratische Planwirtschaft in der SU
Zur Bewältigung der Entwicklungs- und Verteilungsaufgaben wurde in der Sowjetunion ein ausgefeiltes System von Planinstitutionen geschaffen. Der (Re‑)Produktionskreislauf begann mit einer Vorgabe von grundlegenden wirtschaftlichen Zielen für den 5-Jahresplan im Politbüro. Diese wurden vom Planministerium (Gosplan) auf die verschiedenen Sektoren heruntergebrochen, indem 400–500 Variablen in einer Gesamtrechnung herangezogen wurden, die eine Proportionalität des Gesamtprozesses ergeben sollten. In den einzelnen Sektoren wurden diese Vorgaben bis hin zu den Einzelbetrieben in Teilplänen ausgearbeitet. Diese wurden zur Abgleichung der Hierarchie wieder nach oben gemeldet, um nach Ausgleichung der unterschiedlichen Aspekte zu einem endgültigen 5-Jahresplan zu kommen. Entsprechend diesem Plan gab es das Komitee für Beschaffung und Versorgung (Gosnab), das den einzelnen Sektoren Produktionsmittel und Arbeitskräfte zuwies. Dem folgten Festsetzungen von Preisen (Goskomtsen) und Löhnen (Goskomtrud) für die einzelnen Bereiche und Beschäftigtengruppen. Ein gewaltiger Apparat an Institutionen und Partei- und Gewerkschaftsgremien sorgte für eine letztlich nicht „vom Markt“, sondern „gesamtgesellschaftlich“ bestimmte wirtschaftliche Entwicklung.
Anders als dies von der krisenhaften Spätzeit der Sowjetunion her erscheint, war die Planwirtschaft über viele Jahrzehnte durchaus erfolgreich. Gegenüber der sehr disproportionalen und krisenhaften Entwicklung des Kapitalismus unter dem Zarismus konnte eine nachholende Industrialisierung aller modernen Wirtschaftsbereiche erzielt werden, mit beachtlichen Wachstumsraten bis in die 1970er Jahre. Von einer zum Großteil rückständigen Agrargesellschaft, in der 82 % der Bevölkerung im Dorf beschäftigt waren und in der die Agrarproduktion die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) dominierte, entwickelte sich die Sowjetunion durch die Planökonomie zum modernen Industriestaat, mit 78 % urbaner Bevölkerung und 40–45 % der Wertschöpfung im Fertigungssektor und der damit verbundenen Industrien. In den 1950er und 1960er Jahren überstiegen die jährlichen BIP-Wachstumsraten jährlich jeweils die 5 %-Marke und insgesamt hat sich das BIP pro Kopf in der Ära der Planökonomie etwa verfünffacht. Es ist kein Wunder, dass die um auch ökonomische Unabhängigkeit ringenden postkolonialen Regime in vielen Teilen Asiens, Afrikas und des Nahen/Mittleren Ostens während der Entkolonialisierung die sowjetische Planökonomie als Vorbild für nachholende Industrialisierungspolitik ansahen.
In der zweiten Hälfte der 1970er Jahre fielen die Wachstumsraten der Sowjetunion auf 2,7 % und 1982 lag z. B. die Wachstumsrate der Industrie nach den offiziellen Veröffentlichungen um 33,4 % unter derjenigen des vorherigen 5-Jahresplans. Und dies sind nur Symptome einer weitergehenden und viele Sektoren erfassenden Krisenentwicklung. Wie ist diese Wende zu erklären bzw. welche Gesetzmäßigkeiten bestimmen die Krisendynamik der Planökonomie?
1.3 Grundmerkmale der Krise der bürokratischen Planwirtschaft
In der Theorie von Tony Cliff[vi], nach der die Planökonomie der Sowjetunion eine spezielle Form von Kapitalismus darstellt, den Staatskapitalismus, gibt es eine relativ einfache Herleitung dieser Krisenhaftigkeit als einer Spielart der kapitalistischen Krise. Nachdem diese Theorie zwar zugesteht, dass mit Einführung der Planwirtschaft, der Kollektivierung der Landwirtschaft und der Durchsetzung des Außenhandelsmonopols tatsächlich die Wirkung des Wertgesetzes im Inneren wesentlich zurückgedrängt wurde, habe sich aber der kapitalistische Charakter der Sowjetökonomie von außen her durch die Systemkonkurrenz mit dem westlichen Imperialismus durchgesetzt. Durch die Planökonomie habe die Sowjetunion wie ein großes Unternehmen (auch kapitalistische Unternehmen hätten ja im Inneren Planstrukturen) mit dem Imperialismus auf Weltmarktebene konkurriert. Dieser Druck sei vor allem in der Rüstungskonkurrenz als Sachzwang wirksam, der z. B. zur Unterordnung der Konsumgüter unter die Produktionsmittelindustrien, allgemein zur Unterordnung der Arbeitenden unter einen fremdbestimmten Produktionsprozess führe.
Natürlich ist diese Verkennung der Bedeutung der Aushebelung des Wertgesetzes in der Binnenökonomie und deren Reduktion auf eine Art Megastaatskonzern zutiefst unmarxistisch und kann in keiner Weise die Widersprüche einer blockierten Transformationsgesellschaft erfassen. Trotzdem haben Cliff und seine Nachfolger auf wichtige Elemente einer Krisenhaftigkeit der Sowjetökonomie hingewiesen – mehr als andere linke Ökonom:innen, die mehr oder weniger starke Illusionen in Teile der Bürokratie und ihre „Reformen“ gehegt haben.
1.3.1 Das Produktivitäts- und Demokratieproblem
Erstens ist die politische Entmachtung der Arbeiter:innenklasse durch das bürokratische Regime wirksam, auch im plangesteuerten Produktionsprozess, als eine dem kapitalistischen Arbeitsprozess vergleichbare Form der Entfremdung, von der Bestimmung der Ziele bis zur Gestaltung der eigenen Arbeit. Wie „im Westen“ wurden Industrie- und Büroarbeit durch die fordistische Zerstückelung des Gesamtarbeitsprozesses geprägt. Im Gegensatz zum „Westen“ genossen die Beschäftigten jedoch ein sehr viel höheres Maß an sozialer Sicherheit: Vollbeschäftigung, staatlich subventioniertes Wohnen und öffentlichen Transport, kostenlose Bildung, günstigen Zugang zu Gesundheitsversorgung etc. Entfremdete Arbeitsverhältnisse an sich sind zudem kein Beweis für kapitalistische Produktionsverhältnisse, vielmehr Anzeichen der Probleme einer Übergangsgesellschaft: Die ursprüngliche Prägung der Arbeitswelt durch die unmittelbare Subsumption des Produktionsprozesses unter das Kapital erfordert in der Übergangsgesellschaft eine längere Phase der kreativen Neuerfindung des Arbeitsprozesses in kollektiverer, kommunikativerer und selbstbestimmterer Form. Sofern dies nicht geschieht – und gerade im despotischen System bürokratischer Kontrolle passiert dies notwendigerweise (trotz einzelner erfolgreicher Erfahrungen) – ist der Übergang blockiert, und es werden entfremdete kapitalistische Arbeitsweisen reproduziert. Dies führt dann nicht nur zu einer innovationsfeindlichen und demotivierten Arbeiter:innenschaft. Die Kombination mit sozialer Sicherheit führt auch, anders als im Kapitalismus, dazu, dass der Druck oder die Anreize zur Verbesserung der Produktivität oder Einführung neuer Techniken und Arbeitsweisen gering sind. Die sowjetische Industrie war daher insgesamt durch sehr geringes Produktivitätswachstum gekennzeichnet, sodass Wachstum vor allem extensiv durch quantitative Steigerungen auf sich wenig ändernder technischer Grundlage erfolgte – und damit notwendig an Grenzen des Arbeitskräftevolumens und der natürlichen Ressourcen stoßen musste.
1.3.2 Das Problem der sowjetischen Landwirtschaft
Zweitens betraf das Problem der geringen Produktivität insbesondere die sowjetische Landwirtschaft. Es war klar, dass die nachholende Entwicklung vor allem zu dramatischen Veränderungen im Agrarsektor führen musste. Auch Trotzki und Preobraschenski sprachen vor der Einführung der Planwirtschaft von der Notwendigkeit einer „ursprünglichen sozialistischen Akkumulation“, einer Analogie zur Umwälzung der „ursprünglichen kapitalistischen Akkumulation“, die in Westeuropa im 17. und 18. Jahrhundert zu einer radikalen Veränderung des Verhältnisses von Industrie und Landwirtschaft geführt hat. Damals, wie in den 1920er/1930er Jahren in der Sowjetunion, musste die Masse der Arbeitenden von ihrer Existenzweise auf dem Land weggebrochen, um als Arbeitskräfte in den urbanen und industriellen Zentren eingesetzt werden zu können. Gleichzeitig musste es zu einem Austausch zwischen Landwirtschaft und Industrie kommen, indem einerseits billigere landwirtschaftliche Produkte die wachsende Zahl der Industriebeschäftigten ernähren konnten. Andererseits konnte diese Verbilligung gerade nur durch eine Modernisierung der Landwirtschaft aufgrund günstiger und einfach erhältlicher, industriell hergestellter landwirtschaftlicher Produktionsmittel gelingen. Die sich in den 1920er Jahren entwickelnde „Scherenkrise“ (von wachsender Industrie und steigenden Agrarpreisen) wollten Trotzki und Preobraschenski durch ein System von Anreizen zu selbstorganisierter Kollektivierung und Mechanisierung der Landwirtschaft bei gleichzeitiger entsprechender Ausrichtung der Industrie erreichen. Tatsächlich wurde von der stalinistischen Bürokratie die Krise zunächst ausgesessen, um dann mit Zwangskollektivierungen von oben die Krise gewaltsam und mit Millionen von Opfern zu lösen. Durch die Schaffung großer landwirtschaftlicher Betriebe, die staatlich organisierten Maschinen- und Traktoren-Zentren und die Etablierung von Handelsmonopolen für Saatgut, Düngemittel und Agrarprodukte konnte der für die Industrialisierung notwendige billige Preis für Agrarprodukte durchgesetzt und große Teile der Landbevölkerung konnten in die Industriezentren gelenkt werden. Diese Form der Transformation hinterließ tiefe Spuren in der sowjetischen Landwirtschaft. Unattraktive Entlohnung, harte Arbeitsbedingungen, geringe Qualität der eingesetzten technischen Hilfsmittel und niedrige Preisfestsetzungen führten zu Arbeitskräftemangel, schlechter Produktivität und geringen Erträgen. Anfang der 1950er Jahre lag so z. B. die russische Getreideproduktion um nur etwa 13 % höher als Anfang der 1910er Jahre, bei einer um 30 % größeren Bevölkerung. Die Produktivität der Landwirtschaft zu diesem Zeitpunkt lag bei einem Fünftel derjenigen der USA. Es ist kein Wunder, dass die Landwirtschaft das Feld zahlreicher „Reformen“ (und gescheiterter Parteikarrieren) war. Zumeist wurde versucht, über Preisfreigaben oder beschränkte Zulassung von privater Bewirtschaftung die Produktivität zu beleben, jedoch wurde dadurch zumeist nur der Schwarzmarkt ausgebaut. Die letzte Landwirtschaftsreform Ende der 1980er Jahre führte schließlich zu einem weitgehenden Zusammenbruch der Versorgung und zu extremen Rationierungsmaßnahmen, die letztlich das politische Ende der Sowjetunion einleiteten.
1.3.3 Das Problem des Gewichts des Militärs
Der dritte Faktor ist das Gewicht von Militär und Rüstung. Natürlich hat Cliff recht, dass dieser Mühlstein an der Sowjetökonomie das Resultat der verfehlten politischen Orientierung der stalinistischen Bürokratie auf das Programm des „Aufbaus des Sozialismus in einem Land“ geschuldet ist. Statt sich an der permanenten Revolution und der Integration in eine sozialistische Entwicklung, auch in fortgeschrittenen Ökonomien, zu orientieren, wurde eine nachholende Industrialisierungspolitik unter dem Primat der Hochrüstung im Gefolge des eingefrorenen „Systemkonflikts“ betrieben. In der Periode des Kalten Krieges lag der Anteil der Rüstungsausgaben am BIP durchschnittlich bei 10–20 %. Insbesondere während der atomaren Hochrüstung in den 1960er Jahren stieg dieser Anteil auf über 15 % und Anfang der 1980er in der frühen Reagan-Ära noch mal auf an die 20 %. In der US-Wirtschaft betrug dieser Anteil aufgrund der höheren Produktivität der Rüstungsindustrie nur etwa 5–10 %.
Dies bedeutete nicht nur an sich schon eine hohe ökonomische Belastung für eine Ökonomie mit nachholender Entwicklung. Das Wettrüsten induzierte auch eine inhärente Disproportionalität in der Planökonomie. Um gegen die hoch technisierte und produktive US-Rüstungsproduktion standhalten zu können, mussten die Hochqualitäts-Ressourcen für das Militär reserviert werden: technisch-wissenschaftliche Spezialist:innen, Facharbeiter:innen, Hochtechnologie, Rohstoffe entsprechender Qualität etc. Die fehlenden im zivilen Sektor Ressourcen mussten dort durch niedrigere Qualität ersetzt werden. Dies war ein weiterer Grund dafür, dass in den zivilen Industrien, insbesondere in der Konsumgüterindustrie, die Produktivität nur sehr langsam wachsen konnte.
Zusammengenommen führten geringe Produktivität, Mangel an Ressourcen und das anfänglich recht große Reservoir an mäßig qualifizierten Arbeitskräften dazu, dass die Zivilproduktion vor allem nur extensiv wachsen konnte. Billige, nicht besonders qualitätsvolle Produkte konnten in immer größerer Zahl durch einfach größere Fertigungsstätten mit mehr Arbeitskräften auf mehr oder weniger gleichem technologischen Stand produziert werden. Aufgrund der Schranken der Landwirtschaft und der (auch aufgrund des militärischen Bedarfs gegebenen) Grenze an Ressourcen (Arbeitskräften, Rohstoffen) funktionierte dieses expansive Wachstumsmodell nur etwa bis Mitte der 1970er Jahre. Danach wurde der Plan durch mangelnde Inputs in allen wesentlichen Sektoren eingeschränkt, und die Disproportionalitäten konnten nicht weiter verborgen werden. In einer Marktökonomie würden diese Probleme auf der Angebotsseite zu Preissteigerungen führen, während sie in der Planökonomie als Mangelwirtschaft und Rationierung erscheinen, kombiniert mit einer schleichenden Inflation auf den Schattenmärkten.
Am Ende der Sowjetunion war es neben dem erneuten Wettrüsten vor allem der Afghanistankrieg, der zu enormen ökonomischen und gesellschaftlichen Kosten führte. Dieser Krieg 1979–1989 kostete wohl über Zehntausende Gefallene, eine Unmenge Verwundete und brachte der Endzeit der Sowjetunion eine Masse an unzufriedenen, oft traumatisierten Veteran:innen. Viele der in dieser Zeit entstehenden kriminellen Banden oder nationalistischen Guerillas rekrutierten sich aus Afghanistanveteran:innen bzw. konnten sich leicht mit entsprechenden Waffen versorgen. Insbesondere im Kaukasus begannen militärisch-politische Auseinandersetzungen, so 1988 in Bergkarabach. Ende der 1980er Jahre musste die Armee verstärkt in „Unruhegebiete“ versendet werden (Baku, Duschanbe, Bergkarabach, Abchasien etc.). Hinzu kam, dass insbesondere der Afghanistankrieg durch entsprechende Sanktionen des Westens auch die Versorgungsprobleme durch ausbleibende Agrarimporte verschärfte. Darüber hinaus zeitigte der unpopuläre und grausame Afghanistankrieg eine Art „Vietnamkrieg“-Effekt in der sowjetischen Gesellschaft: Die positive (Selbst-)Sicht auf die „Rote Armee“ ging stark zurück, die Wahrheiten über den Krieg befeuerten die Glasnost-Enthüllungen über die Realitäten in der Sowjetunion, und schließlich kam es zu einer wachsenden Entfremdung zwischen KPdSU und Armee, insbesondere in den nicht russischen Unionsrepubliken. Letzteres machte auch den militärischen Einsatz gegen Unabhängigkeitsbestrebungen, ob in Osteuropa oder in der Sowjetunion, immer unvorstellbarer.
1.3.4 Devisen und das Problem der zunehmenden Abhängigkeit vom Weltmarkt
Viertens entdeckte die Sowjetunion bereits seit den 1960er Jahren das Potenzial ihres Rohstoffreichtums. Nach den schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts erschlossenen Ölfeldern von Baku/Grosny waren um den Zweiten Weltkrieg herum die Reservoirs im Wolga-/Uralgebiet erschlossen worden. Aber mit den Ölfeldern in Westsibirien ergaben sich ab den 1960er Jahren ganz andere Dimensionen. Es wurde schnell klar, dass die sowjetische Ölindustrie (Erdgas kam später dazu) weitaus mehr produzieren konnte, als im Inland benötigt wurde. Schon in den 1960er Jahren begannen daher politische Führung und die Ölindustrie, Abkommen mit westlichen Konzernen über Liefermengen abzuschließen, die auch den Import westlicher Technologie zur Modernisierung der Ölindustrie beinhalteten. Immer mehr wurde aus diesen Abkommen eine entscheidende Devisenquelle für die Sowjetunion. In den letzten Jahrzehnten der Sowjetunion entwickelten sich damit wieder immer mehr Züge eines Ressourcen ausbeutenden Peripherielands, in Abhängigkeit vom imperialistisch strukturierten kapitalistischen Weltmarkt. Mit den Öl- und Gasexporten konnten Importe von Gütern gegenfinanziert werden, die die schwächelnden Sektoren im Agrar- und Konsumgüter-/Produktionsmittelbereich immer weniger bereitstellen konnten. Dies führte andererseits aber zu einer wachsenden Abhängigkeit von diesen Importen und einer weiteren Verringerung von Bereitstellungen für diese inländischen Produktionssektoren, die dann ihrerseits wieder von Importgütern abhängig wurden. Da dies alles durch entsprechenden Öl-/Gas-Export finanziert werden musste, fraßen diese extraktiven Industrien immer mehr Ressourcen (Arbeitskräfte, Technologie), die an anderer Stelle fehlten. Zudem wurde in dem öl-/gasreichen Land die Energieversorgung nicht profitabler Sektoren teuer, da Öl/Gas ja vor allem exportiert werden mussten. Stattdessen wurde die ökologische Krise durch gesteigerten Gebrauch von Kohle verschärft (ganz zu schweigen von Atomkraft, die nach dem Desaster von Tschernobyl auch ökonomisch zu einem Problem wurde). Insbesondere mit fallenden Ölpreisen Anfang der 1980er Jahre, kombiniert mit Förderproblemen der russischen Ölindustrie, wurde die Wunderwaffe aus der Wachstumskrise der 1970er Jahre für die Sowjetökonomie zum Bumerang. Jetzt kamen Stagnation der eigenen Industrie, Importabhängigkeit bei geringer werdenden eigenen Außenhandelswaren und Kosten der Hochrüstung zu einem tödlichen Krisenmix zusammen. Somit ist es richtig, dass die kapitalistische Weltmarktkrise der 1970er/1980er Jahre ihre Fortsetzung in der Krise der Sowjetökonomie fand – eben gerade durch diese seit den 1960er Jahren sich entwickelnde Abhängigkeit vom Weltmarkt. Die politische Führung war nicht in der Lage, auf diese Krise zu reagieren. Dynamische Reformer wie Kossygin (dessen Reformen Mitte der 1960er Jahre noch zu einer letzten Belebung der Industrie geführt hatten) waren in den späten Breschnew-Jahren längst entmachtet. Das Wiederaufgreifen von Kossygins Ideen zur Krisenbewältigung durch Gorbatschow ab Mitte der 1980er Jahre kam viel zu spät. Die Perestroika war dann keineswegs der „Grund“ für den Zusammenbruch der Sowjetökonomie. Sie konnte nur ein bereits dysfunktional gewordenes System nicht mehr reparieren und initiierte dagegen nur noch weiteres Chaos.
1.3.5 Das Problem der Arbeitsteilung zwischen den Unionsstaaten
Fünftens war die Sowjetökonomie auf eine ausgeprägte Arbeitsteilung zwischen den einzelnen Unionsstaaten ausgelegt. Während 60 % des industriellen Outputs aus der russischen Teilrepublik kamen, machte deren Bevölkerung am Ende der Sowjetunion nur mehr etwa 51 % aus. Die Russische Föderative Sowjetrepublik war das Zentrum der Ökonomie, und insbesondere die Rüstungsindustrie und wichtige Teile der wissenschaftlich-technischen Institutionen waren dort konzentriert. Allerdings kam auch der ukrainischen Teilrepublik eine hohe Bedeutung zu: Sie war der wichtigste Lieferant von Agrarprodukten (vor allem Getreide und Zucker), aber auch von Kohle, Stahl und Chemieprodukten. In Belarus wurden vor allem Traktoren und Maschinerie für die Landwirtschaft produziert, aber auch einfachere Konsumgüter und Elektronik. Die baltischen Staaten konzentrierten bei sich die Leichtindustrie, insbesondere hochwertigere elektrische Geräte und Elektronik. Aus Georgien und Armenien wurden Lebensmittel wie Südfrüchte und Wein bezogen. Aserbaidschan und Kasachstan waren wesentliche Rohstofflieferanten, Ersteres vor allem für Öl, Letzteres auch für Uran. Andere zentralasiatische Republiken waren wichtig für landwirtschaftliche Produkte wie z. B. Baumwolle und die Textilindustrie. Insgesamt beruhte der Gesamtplan auf einer komplexen Spezialisierung und zentral vorgegebenen Austauschrelationen zwischen den Republiken.
Mit der fortschreitenden Krise der Gesamtökonomie, die sich über die Republiken ungleichzeitig entwickelte, musste es zu Spannungen in diesen ökonomischen Relationen kommen, die ihrerseits zu den Krisentendenzen beitrugen. Auch hier spielte wieder russisches Öl und Gas eine wichtige Rolle: Einerseits finanzierte die russische Teilrepublik durch niedrige Energiepreise (unter Weltmarktpreisen) die immer unproduktiver werdenden Industrien z. B. in der Ukraine oder Belarus mit. Andererseits wurden die Öl-/Gaseinnahmen immer wichtiger, um die aus diesen Teilrepubliken zurückgehenden Produktionsmengen zu ersetzen. Insbesondere die Krise der ukrainischen Landwirtschaft, nochmals extrem verschärft durch die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl, trug wesentlich zu den wachsenden Versorgungsproblemen in der gesamten Sowjetunion bei. Die Entwicklungsunterschiede zwischen den Teilrepubliken sieht man etwa daran, dass in den baltischen Staaten das Pro-Kopfeinkommen zwischen 1980 und 1988 um etwa 30 % wuchs, während es im selben Zeitraum in einigen zentralasiatischen Republiken sogar schrumpfte.
Bis in die 1980er Jahre hinein war das Ministerium für Außenhandel dem Gosplan unterstellt. Diesem Ministerium wiederum waren in allen Teilrepubliken die Außenhandelsgesellschaften unterstellt, die allein Handelsbeziehungen mit dem Ausland unterhalten konnten. Schon mit der Sonderrolle der Öl- und Gasverträge wurden immer mehr „Spezialverhältnisse“ begründet, die den Teilrepubliken zumindest auf politischer Ebene immer mehr Eigenständigkeit einräumten. Mit der Perestroika wurden solche Sonderrechte auf Unternehmensebene ausgedehnt, die seit 1986 nur mehr Genehmigungen beim Außenhandelsministerium einholen mussten. 1988 wurde mit dem „Gesetz zur Eigenständigkeit der Teilrepubliken im Außenhandel“ den Teilrepubliken sehr viel mehr Rechte im Außenhandel zugestanden, die mit ebenfalls größeren Rechten für eigene Industriepolitik einhergingen. Ähnlich wie zuvor schon im ehemaligen Jugoslawien beförderte dies in der Krisensituation die Versuche der einzelnen nationalen Bürokratien, ihre jeweiligen Republiken besserzustellen, und im Zuge des Zusammenbruchs der bisherigen Arbeitsteilung im Gosplanrahmen konnte dies nur durch Hinwendung zum Weltmarkt bzw. zu internationalen Kreditgeber:innen gelingen.
Ähnlich wie in Jugoslawien mit Slowenien waren es in der Sowjetunion die am weitesten entwickelten baltischen Teilrepubliken, die diese Bedingungen am schnellsten nutzten. Schon Mitte der 1980er Jahre entstanden Kooperativen und halbprivate Gesellschaften, die Handelsnetzwerke mit dem Westen, insbesondere in skandinavischen Ländern, aufbauten. Aufgrund der Deviseneinnahmen wurde dies auch gefördert – führte aber zu Protesten wegen bürokratischer Gängelung und hoher Abgaben. Ende der 1980er Jahre war damit ökonomisch die Unabhängigkeit der drei baltischen Sowjetrepubliken vorbereitet, die sich dann 1990 auch politisch realisierte.
Viel schwieriger gestaltete sich die Perestroika in der Ukraine und in Belarus. Beide standen im Zentrum der Krise der Planökonomie, und ihre konservativen Bürokratien widersetzten sich mehr oder weniger den Anforderungen nach „mehr wirtschaftlicher Eigeninitiative“ oder gar „Transparenz“ (der Umgang mit der Tschernobyl-Katastrophe war kein Beispiel für „Glasnost“). Andererseits fachte die ökonomische Krise Proteste an, die sich unter anderem in nationalistischen Bewegungen zum Ausdruck brachten (z. B. Narodnij Ruch [dt.: Volksbewegung] in der Ukraine). Hier sah dann der Mehrheitsflügel der Bürokratie nur noch die Rettung, indem er sich an die Spitze der Bewegung setzte und das „Ende der Fremdbestimmung aus Moskau“ forderte (so wurde z. B. der ehemalige KP-Chefideologe Leonid Krawtschuk erster Präsident der unabhängigen Ukraine). Nachdem sich im Frühjahr 1990 die baltischen Staaten, Georgien und Armenien für unabhängig erklärt hatten und auch in den anderen Sowjetrepubliken die Kräfte für Unabhängigkeit stärker wurden, stellte sich die Frage nach einem Überleben der Sowjetunion in neuerer, kleinerer Form. Entsprechende 9+1-Gespräche wurden noch 1990 in Nowo-Ogarjowo begonnen, mit dem Ziel eines neuen Unionsvertrags, der auch eine weitere wirtschaftliche Einheit gewährleisten sollte. Eine erste Majdan-Bewegung in der Ukraine zeigte eine starke Opposition gegen eine solcherart modifizierte Union, doch erreichte das Referendum zum Erhalt der Sowjetunion im März 1991 in der Restunion über 70 % Zustimmung, und auch in der Ukraine war eine Mehrheit für eine erneuerte Union (aber schon damals deutete sich die Spaltung zwischen West-/Ostukraine/Krim an). Durch den Augustputsch 1991 wurde die Position des gerade erst gewählten Präsidenten der Rest-Union, Gorbatschow, jedoch weiter beschädigt, und die Führungen der Bürokratie in Russland, Ukraine und Belarus sahen die Union nur noch als Hindernis für ihre eigenen Bestrebungen. Ganz abgesehen von den anderen Unionsmitgliedern einigten sich die drei Präsidenten Jelzin, Krawtschuk und Schuschkewitsch (Belarus) bei Wiskuli in der Belowescher Heide (Grenzgebiet zwischen Polen und Belarus) am 8. Dezember 1991 auf die Auflösung der Sowjetunion und die Gründung des losen Staatenbündnisses GUS. In rascher Folge akzeptierten die restlichen Teilrepubliken dieses Ergebnis.
Damit war auch auf einen Schlag der planwirtschaftliche Zusammenhang zwischen den Teilrepubliken aufgelöst. Das Ende der bisherigen planfixierten Arbeitsteilung bedeutete jedoch für alle diese neu entstandenen Eigenstaaten zunächst ein eklatantes Versorgungsproblem. Dies brachte nicht nur in der neu entstehenden Russischen Föderation eine Verschärfung der Engpässe auf dem Lebensmittel- und Konsumgütermarkt. Die wirtschaftlichen Probleme z. B. in der Ukraine und in Belarus waren zum Teil noch dramatischer. Viele der neuen Staaten vollzogen daher zumeist bis 1994 die Wende zum Autoritarismus oligarchischer Prägung (1994 in Belarus: Lukaschenka, 1994 in der Ukraine: Kutschma, ganz zu schweigen von den diversen Dynastien in Zentralasien).
1.3.6 Das Problem der zunehmenden Bürokratisierung – die Frage der „Reformen“
Sechstens wuchsen mit der nachholenden Entwicklung und der wachsenden Urbanisierung auch die Herausforderungen an Verwaltung, staatlichen und privaten Konsum sowie die Probleme des Staatshaushalts. Schon das Zarenreich war von einer ungemein zentralisierten Verwaltung geprägt, die ergänzt wurde von untergeordneten lokalen Selbstverwaltungen (Semstwos; Landstand oder Landschaftsvertretung auf Kreis- und Gouvernementsebene). Die Sowjetunion führte eine umfassende Gebietsreform durch, die Zentralismus mit Elementen des Föderalismus verband (Unionsrepubliken, Teilrepubliken, autonome Kreise und Gebiete etc.). Letzteres führte dazu, dass die „Gouvernements“, mit denen der zaristische Staat die unteren Verwaltungsebenen kontrollierte, abgeschafft werden konnten. Stattdessen wurden kleinere lokale Ebenen (Rayons; Landkreise bzw. Bezirke) eingeführt, die jeweils zu Oblasts als Zwischenebene unterhalb der Republiken zusammengefasst wurden. Auf allen diesen Ebenen spielten die Sowjets eine zentrale Rolle als Widerhall eines wirklichen Arbeiter:innenstaates: Statt wie kapitalistische Kommunalvertretungen oder Parlamente über abgehobene Rahmenbedingungen weit jenseits der unmittelbaren Probleme der Betroffenen und strikt getrennt von den ausführenden Organen zu agieren, stellten die Sowjets eine viel direktere Mischung aus Vertretung unmittelbarer Interessen und Umsetzung dar, allerdings nun entfremdet durch eine bürokratische Herrschaft, die sich in der Dominanz des zentralistischen Parteiapparates über sie auf allen Ebenen zeigte. Die ökonomische Steuerung des Alltagslebens in der Sowjetunion war „vor Ort“ geprägt durch das Fünfeck: Sowjets, lokale Betriebe, Handelsgesellschaften/Genossenschaften, Gosplan, Zentralstaat. Die Sowjets als Vertretung vor Ort kontrollierten die Umsetzung des zentralen Plans in den Betrieben und Handelsgesellschaften bzw. meldeten die lokalen Bedarfe, Probleme etc. Sie waren gemeinsam mit den Betrieben verantwortlich für den lokalen Wohnungsbau (größere Betriebe waren auch für den Bau von Wohnungen für ihre Arbeiter:innen verantwortlich und planten diese zusammen mit den lokalen Sowjets). Die Bestellung von Direktor:innen der Betriebe erfolgte zwar zentral, aber mit Einflussnahme der lokalen Sowjets, während kulturelle Aktivitäten bzw. Freizeit- und Erholungsaktivitäten in Zusammenarbeit mit den Gewerkschaftsvertreter:innen in den Betrieben organisiert wurden. Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen waren unmittelbare Agenden der Sowjets. Ebenso wie die Betriebe wurden auch die Handelsgesellschaften und -genossenschaften (unter dem Dach des Zentrosojus) von den Sowjets kontrolliert, die die Güter des täglichen Bedarfs gemäß den Mengen- und Preisfestsetzungen des Gosplans in den Läden vor Ort zur Verteilung brachten. Der Zentralstaat stellte den lokalen Einheiten wiederum gemäß dem zentralen Haushaltsplan die finanziellen Mittel zur Verfügung – dies betraf nicht nur die Verwaltungs- und Dienstleistungsaktivitäten, sondern auch die Weitergabe von finanziellen Mitteln, z. B. an Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen. Die Rayons-/Oblast-Verwaltungen/Sowjets selbst verfügten über fast keine eigenen Mitteleinnahmen. Sie liefen fast nur über den zentralen Staatshaushalt (Ausnahme waren gewisse lokale Abgaben). Dieser wiederum wurde finanziert aus Unternehmensteuern (ein Großteil der „Gewinne“, die nicht wieder im Gosplan landeten, wurde als „Steuer“ an den Staatshaushalt abgeliefert) und zu einem geringen Teil über Umsatzsteuern (Einkommensteuern waren marginal). Cliff[vii] sieht insbesondere die Beibehaltung von indirekten Steuern als Merkmal einer kapitalistischen Ökonomie in der Sowjetunion und extrapoliert dies von einer höheren Bedeutung der Umsatzsteuer in der frühen Sowjetunion. Tatsächlich war der Anteil von nicht betrieblich erhobenen Steuern in der Sowjetunion seit den 1950er Jahren nicht höher als 10 %, und tatsächlich war dann auch die Umsatzsteuer vor allem bei „Luxusgütern“ wirksam, um die niedrigen Preise für z. B. Grundnahrungsmittel zu subventionieren. Aufgrund der erwähnten hohen Wachstumsraten blieb (aufgrund der konstant steigenden betrieblichen Abgaben) der sowjetische Staatshaushalt bis in die späten 1970er Jahre trotzdem weitgehend ausgeglichen. Mit Beginn der Stagnationsphase mussten damit notwendigerweise Haushaltsprobleme auftreten, die zunächst durch die steigenden Rohstoffexporte mithilfe von Besteuerung auf deren Erträge ausgeglichen werden konnten. Ab Mitte der 1980er Jahre half auch das nicht mehr.
Dieses komplexe Zusammenspiel von zentralem Plan und Finanzen mit lokaler Feinsteuerung und Verteilung wies von Anfang an eine Masse Sand im Getriebe auf, nämlich durch das Eigengewicht und -interesse der bürokratischen Kaste. Wie Trotzki bemerkte: Wo Mangel herrscht, wird der/die diesen Mangel verwaltende Bürokrat:in zur Macht, sobald ihre/seine Absetzung immer schwerer wird. In der Aufbauzeit der Sowjetunion herrschte großer Mangel, und bald machte die stalinisierte Partei eine demokratische Kontrolle der Sowjetbürokratie immer unmöglicher. Aufdecken von Wahlbetrug, Amtsmissbrauch, Abzweigung von Gütern oder Korruption führte weniger zum Einschreiten der Staatsmacht gegen die entsprechenden Bürokrat:innen als gegen diejenigen, die den Missbrauch aufdeckten. So konnte sich in allen genannten Ebenen (Gebietssowjets, Fabrikleitungen, Handelsgesellschaften, Planbehörden, zentrale Verwaltungen) zunehmend eine bürokratische Kaste festsetzen, die sich reproduzierte und ihre Reihen gegen allzu viel Kontrolle von unten geschlossen hielt. Natürlich gab es Möglichkeiten der Einflussnahme auf untere Sowjets, Gewerkschaften, Genossenschaftsvertretungen etc., und allzu unfähiges, korruptes Missmanagement im oben genannten Fünfeck führte zu Konsequenzen. Aber ein so ausgebremstes Kontrollsystem konnte nicht effektiv funktionieren: Fehlplanungen wurden vertuscht, überhöhte Erfolgsmeldungen abgegeben, Probleme eher ausgesessen, Neuerungen und Verbesserungen als Bedrohung der eingespielten Machtverhältnisse abgelehnt etc. Aus ihren Positionen in Partei, Sowjets, Handelsgesellschaften, Betriebsleitungen etc. zogen die Bürokrat:innen materielle Vorteile und entwickelten Macht über andere. Dass das bürokratisierte Plansystem für die Masse der Bevölkerung, insbesondere in Bezug auf den Konsum, ineffektiv funktionierte, war diesen Funktionär:innen egal, da sie ja für sich selbst sorgen konnten und die „Untergebenen“ stattdessen ruhig in den berüchtigten langen Schlangen der Versorgungsstellen warten konnten. Wenn Letztere sich unterwürfig genug zeigten, konnten ja schnellere Wege für bestimmte Waren, Wohnungen etc. für diese gefunden werden.
Oder wie es Trotzki formulierte: „Grundlage des bürokratischen Kommandos ist die Armut der Gesellschaft an Konsumgütern mit dem daraus entstehenden Kampf aller gegen alle. Wenn genug Waren im Laden sind, können die Käufer kommen, wann sie wollen. Wenn die Waren knapp sind, müssen die Käufer Schlange stehen. Wird die Schlange sehr lang, muss ein Polizist für Ordnung sorgen. Das ist der Augenblick für die Macht der Sowjetbürokratie. Sie ‚weiß‘, wem sie zu geben und wer zu warten hat.“[viii]
Das Gespür der bürokratischen Kaste, wie sehr ihre Position in der Mangelverwaltung mit ihrer Machtposition verbunden ist, kam z. B. deutlich im Schicksal der Kossygin-Reformen von 1965 zum Ausdruck. Diese waren von Teilen der zentralen Planbürokratie (Ministerpräsident Kossygin war zuvor Leiter des Gosplans gewesen) angestoßen worden, die vor allem die Effizienz der Konsumgüterproduktion und -verteilung wesentlich verbessern wollten. Die Reformen waren Resultat einer längeren grundsätzlichen Diskussion über die Weiterentwicklung des Gosplans. Unter anderem wurden im neugegründeten Zentralen Ökonomisch-Mathematischen Institut ausführliche Konzepte für eine „Computerisierung“ des Plans, für genaue dezentrale Datenerhebung und flexible Rechenmodelle mit rascher Anpassung an wechselnde Bedarfe entwickelt. Dies wurde kombiniert mit Effizienzkennzahlen der Betriebe („Profitabilitätsbestimmungen“) und erweiterten Mitspracherechten der Beschäftigten in ihnen zur Verbesserung von Qualität und Produktivität. Dem Rest der Bürokratie, um den Parteivorsitzenden Breschnew, ging diese „Transparenz“, „Mitsprache“ und Kontrolle durch die Gosplan-Expert:innen viel zu weit. Vor allem sah Breschnew nicht ein, wozu man so viele Ressourcen in Konsumversorgung statt in die Schwerindustrie investieren solle. Mit dem Prager Frühling 1968 wurde Kossygin für die ausufernden Forderungen nach Mitbestimmung und besserer Versorgung, die sich in solchen Reformbewegungen zeigten, verantwortlich gemacht – und die Gesamtreform abgewürgt. In langfristiger Folge führte dies auch zu negativen Konsequenzen für den wirtschaftlichen Einsatz der Computertechnologie, bei deren Entwicklung man dann seit den 1970er Jahren massiv hinter die USA zurückfiel. Davor war es von den wissenschaftlichen Kapazitäten und technischen Möglichkeiten der Weltraumnation Sowjetunion her durchaus möglich, dass es zu einer fortschrittlichen Entwicklung der Computerisierung in den verschiedenen Sektoren der Planökonomie hätte kommen können. In den 1970er/1980er Jahren versuchte man dann sehr beschwerlich, die technologischen Erfolge des Westens auf diesem Gebiet nachzuvollziehen – ohne entsprechende organische Beziehung zur eigenen Wirtschaftsstruktur.
Einige Elemente der Kossygin-Reformen wurden Mitte der 1980er Jahre von Gorbatschow wieder aufgegriffen. Aber einerseits waren die ökonomischen Bedingungen bereits sehr ungünstig und die Effizienz von Betrieben, Konsumversorgung und Gosplan noch weiter geschwächt. Andererseits waren die Teile der Bürokratie, die die Reformen wirklich vorantreiben wollten, noch schwächer geworden. Und außerdem waren es jetzt nicht mehr nur konservative Teile der Bürokratie, die Neuerungen möglichst im Sand verlaufen lassen wollten, sondern auch die Fraktion der Bürokratie, die überhaupt die Planwirtschaft loswerden wollte, war inzwischen sehr stark gewachsen (siehe nächstes Unterkapitel). Heraus kamen nicht nur die schon besprochene Schwächung von Handelsmonopolen der Zentrale, sondern auch die weitere Übertragung von „Eigenverantwortung“ an Betriebe und lokale Bürokratien. Insbesondere die Möglichkeit der Betriebe, ihre Gewinne großenteils nicht mehr abführen zu müssen, sondern für Investitionen nutzen zu können, führte dazu, dass der Staatshaushalt der Sowjetunion in sehr kurzer Zeit seine Haupteinnahmequelle verlor und zur Inflation nun auch ein wachsendes Haushaltsdefizit kam. Damit mussten auch die Finanzmittel für die lokalen Verwaltungen und ihre Aufgaben z. B. im Gesundheits- und Bildungsbereich gekürzt werden. Ende der 1980er Jahre brachen deshalb wesentliche Teile der Versorgung der Bevölkerung vor Ort, von Lebensmitteln bis zum Gesundheitswesen, mehr und mehr zusammen.
Es muss aber hier betont werden, dass der Weg von Planwirtschaft und Räteherrschaft (Sowjets) nicht zwangsläufig in die bürokratische Diktatur einer Mangelwirtschaft hätte führen müssen. Die sozialistische Revolution in Russland hatte den Weg in eine nachkapitalistische Entwicklung geöffnet, die tatsächlich zu kollektivem und planvollem Wirtschaften führte. Vor allem die Isolierung, d. h., die Nicht-Ausbreitung der Revolution nach 1917 auch auf ökonomisch entwickeltere Länder, warf den so entstandenen Arbeiter:innenstaat jedoch auf die Situation einer nachholenden Entwicklung unter sehr ungünstigen materiellen Umständen und äußeren wie inneren Bedrohungen zurück. Von Beginn an konnte diese Entwicklung nur mit einem starken Ausbau von Staat und Bürokratie, bei Übernahme einer Vielzahl bürgerlicher Verteilungs- und Arbeitsorganisationsprinzipien, gelingen. Diese sich entwickelnde Megabürokratie wurde Anfang der 1920er Jahre noch konterkariert durch eine Partei, die dies nur als zeitweise „Deformation“ anerkannte, die es langfristig zu überwinden galt. Doch der politische Sieg der Stalin-Fraktion in den inneren Auseinandersetzungen der Partei war dann entscheidend für die Degeneration der Sowjets und die spätere Entwicklungsweise der Planwirtschaft in der beschriebenen bürokratisch-ineffizienten Form, von den politischen Implikationen ganz zu schweigen.
Dass sich Stalin in den Fraktionskämpfen durchsetzte, lag vor allem daran, dass er für die groß und mächtig gewordene Bürokratie die ideale Figur zur Umwandlung der Partei in ihr Herrschaftsinstrument war: „Er stieß auf gute Resonanz bei der neuen herrschenden Schicht, die sich von den alten Grundsätzen und von der Massenkontrolle zu befreien trachtete und für ihre internen Angelegenheiten einen verläßlichen Schiedsrichter brauchte.“[ix] Dieser politische Sieg brachte eine besondere Form des Bonapartismus hervor: Der Arbeiter:innenstaat basierte weiterhin auf nachkapitalistischen Eigentumsverhältnissen, und die herrschende und heterogene Bürokrat:innenschicht war nicht unmittelbar Eigentümer:in der Produktionsmittel. Sie war für den Erhalt ihrer Privilegien auf den Ausbau und die Verteidigung dieser nachkapitalistischen Eigentumsverhältnisse angewiesen. Daher war sie letztlich auch gezwungen, diese durch die Einführung der bürokratischen Planwirtschaft und ihre zentrale Verteilungslogik zu befestigen. Deshalb musste aber auch die Spitze der Bürokratie, insbesondere in der Partei, zwischen den divergierenden Interessen der Arbeiter:innen- und Bäuer:innenmassen und den verschiedenen Teilen der Bürokratie vermitteln. So gab es in der Bürokratie z. B. immer die Teile, die sich mehr materiellen Wohlstand durch „etwas Kapitalismus“ versprachen, andere, die mehr Zentralismus und Planung wollten. Vor allem anfangs gab es sowohl in der Partei als auch in der Bevölkerung eine starke linke Opposition gegen die Auflösung von Arbeiter:innendemokratie und Bürokratisierung der Partei. Daher musste die bonapartistische Spitze des Machtapparates sich auf einen enormen Sicherheitsapparat und die „bewaffneten Organe“ des Staates stützen, um eine Gesamtlinie durchzusetzen.
Trotzki charakterisierte das entstandene System als „Stalinismus“, das seiner Charakteristik nach auch jegliche bürokratische „Entstalinisierung“ nach Stalins Tod im Kern überleben musste: „Der Caesarismus oder seine bürgerliche Form, der Bonapartismus, betritt die Bühne der Geschichte immer dann, wenn der scharfe Kampf zweier Lager die Staatsmacht gleichsam über die Nation erhebt und sie scheinbar von den Klassen völlig unabhängig macht, ihr aber in Wirklichkeit nur die notwendige Freiheit für die Verteidigung der Privilegierten gibt. Das Stalin-Regime, das die politisch atomisierte Gesellschaft überragt, sich auf die Polizei und das Offizierskorps stützt und keinerlei Kontrolle über sich duldet, ist deutlich eine Art Bonapartismus neuen Typs […]. Der Stalinismus ist eine Abart desselben Systems, doch auf dem Fundament des vom Gegensatz zwischen der organisierten und bewaffneten Sowjetaristokratie und der waffenlosen werktätigen Massen zerrissenen Arbeiterstaats.“[x]
Kein Bonapartismus kann lange überdauern: Früher oder später muss der ihm zugrunde liegende Widerspruch zu einer Lösung kommen, die er nicht mehr aufhalten kann. Entweder hätte die Arbeiter:innenklasse in einer politischen Revolution sich der Sowjet- und Planinstitutionen bemächtigen können und die Macht von Partei- und Sowjetbürokratie brechen müssen. Diesen Weg deuteten die Aufstände 1956 in Ungarn und Polen an. Eine andere Möglichkeit sah Trotzki bereits in den 1930er Jahren drohen:
„Die bürgerliche Gesellschaft hat in ihrer Entwicklung oft das politische Regime und die bürokratischen Kasten gewechselt, ohne ihre sozialen Grundlagen zu ändern. […] Die Staatsmacht konnte die kapitalistische Entwicklung fördern oder hemmen, doch im allgemeinen verrichteten die Produktivkräfte auf der Grundlage des Privateigentums und der freien Konkurrenz ihr Werk selbständig. Hingegen sind die aus der sozialistischen Revolution hervorgegangenen Besitzverhältnisse unlösbar an den neuen Staat, ihren Träger, gebunden. Die Vorherrschaft sozialistischer Tendenzen über die kleinbürgerlichen ist keineswegs durch den Automatismus der Wirtschaft gesichert […], sondern durch politische Maßnahmen der Diktatur. Der Charakter der Wirtschaft hängt daher völlig von dem der Staatsmacht ab. Ein Zusammenbruch des Sowjetregimes würde unweigerlich einen Zusammenbruch der Planwirtschaft und damit die Abschaffung des staatlichen Eigentums nach sich ziehen. […] Der Sturz der heutigen bürokratischen Diktatur wäre also, wenn keine neue sozialistische Macht diese ersetzt, gleichbedeutend mit einer Rückkehr zu kapitalistischen Verhältnissen bei katastrophalem Rückgang von Wirtschaft und Kultur.“[xi]
55 Jahre nachdem diese Worte geschrieben wurden, erwiesen sie sich als Blaupause für die Rückkehr zu kapitalistischen Verhältnissen in Russland. Die verschränkte Krise von Planökonomie und Parteidiktatur öffnete den Weg dazu, auch wenn in den Arbeiter:innenprotesten Ende der 1980er Jahre durchaus die Perspektive der politischen Revolution angedeutet wurde. Die Frage, die nur noch blieb, war, wie sich die bürgerliche Klasse bilden konnte, die in dieser Krise mitsamt dem Zusammenbruch von Plan und Partei die Wiedereinführung kapitalistischer Verhältnisse organisieren würde. Damit kommen wir zum letzten Aspekt der Krise der Sowjetökonomie, der Verschärfung der sozialen Ungleichheiten.
1.3.7 Wachsende soziale Widersprüche
Siebtens wuchs mit der Entwicklung der bürokratischen Planwirtschaft die soziale Differenzierung und auf ihr die Grundlagen für diejenigen Schichten, die die Restauration des Kapitalismus umsetzten und aus denen sich die neue Bourgeoisie bildete. Trotzki beschrieb in seiner Analyse der Sowjetgesellschaft die Grenzen der gesellschaftlichen Verteilung des Sozialprodukts in der bürokratischen Planwirtschaft in ihrer Entwicklung: Zunächst hatte der Fünfjahresplan die Prinzipien der unmittelbaren „sozialistischen Verteilung“ aus dem Kriegskommunismus (die in der „Neuen Ökonomischen Politik“ aufgegeben wurden) in strukturierterer und systematischerer Form wiederaufgenommen. Mit den Anforderungen durch „Anreize“ für Mehrleistungen und Berücksichtigung der Eigeninteressen der Bürokratie wurde ab 1935 wieder vor allem auf die Form der Entlohnung in Geld für den Erwerb der Konsumgüter auf Warenmärkten umgestellt. Dies erlaubte eine politisch bestimmte Differenzierung der Einkommen und insbesondere den privilegierten Zugang zu bestimmten Gütern für ausgewählte Schichten der Gesellschaft, insbesondere der herrschenden Bürokratie selbst.
Es ist wichtig, die Unterschiede der Sowjetbürokratie sowohl zu einer „herrschenden Klasse“ als auch zu einer Staatsbürokratie, wie sie in kapitalistischen Ländern üblich ist, zu verstehen.
Im Unterschied z. B. zur Bourgeoisie, die in kapitalistischen Ländern zahlenmäßig eine kleine Minderheit darstellt (zumeist unter 1 % der Gesellschaft), repräsentierte die Sowjetbürokratie einen sehr großen Teil der Bevölkerung. Trotzki zählte aufgrund der in den 1930er Jahren verfügbaren Statistiken etwa 10 % davon zur Bürokratie. Darin kommt zum Ausdruck, dass es sich hier um eine sehr ausufernde, kastenartige Hierarchie handelt, in der hochprivilegierte Schichten genauso vorhanden waren wie kleine Funktionär:innen auf unteren Ebenen. Durch die große Rolle des Staates in Wirtschaft und Warenverteilung gab es eine viel größere Durchdringung des gesellschaftlichen Lebens mit bürokratischen Funktionen. Dazu kam deren Dopplung durch das bonapartistisch-totalitäre Regime, mit Partei- und Sowjetbürokratie, ergänzt durch Sicherheitsapparate und Militär. Auch die Betriebe selbst boten vielen Bürokrat:innen vom Direktorat bis hinunter zu Gewerkschafts- und Vorarbeiter:innenposten Arbeit und „Macht“. An der Spitze der Bürokratie stand bekanntlich die „Nomenklatura“, die Führungen in Partei und Staat, sowohl zentral als auch in den einzelnen Unionsrepubliken oder besonders wichtigen Regionen. Darunter die Leitungen von wichtigen Ministerien, dem Gosplan und die Direktor:innen großer Betriebe. Militär- und Sicherheitsapparat boten noch mal eine eigene Möglichkeit der hierarchischen Privilegienverteilung. Lokale Partei- und Sowjetführungen sowie deren unterstellte Verwaltungs- und Handelsgesellschaftsleitungen boten weitere Hierarchiestufen. Auch der Bildungs- und Wissenschaftsbereich hatte seine eigene bürokratische Stufenleiter. Insgesamt also eine umfangreiche Gesellschaftsschicht, die im Übrigen mit dem Ende der Sowjetunion nicht einfach verschwand, wobei allerdings ihr altes Personal sehr unterschiedliche Chancen hatte, wiederum in herrschende und privilegierte Funktionen zu gelangen.
Die nachholende Entwicklung durch die Sowjetökonomie führte zu zwei wesentlichen sozialen Veränderungen: Einerseits wurde bis in die 1960er Jahre hinein eine wesentlich auf dem Land bzw. von der Landwirtschaft lebende Gesellschaft in eine mehrheitlich in Städten und von der Industrie lebende Bevölkerung umgewandelt. Heute liegt die Urbanisierungsrate Russlands (75 %) knapp unter derjenigen Deutschlands. Andererseits stieg seit den 1960er Jahren der Anteil an „nicht manueller“ Arbeit, also von Angestellten im Dienstleistungsbereich, in den Bildungsinstitutionen und technisch-wissenschaftlichen Beschäftigungen etc. Der Anteil Letzterer stieg von etwa einem Sechstel in den 1930er Jahren auf etwa ein Drittel in den 1980er Jahren. Diese Bevölkerungsgruppe war sehr heterogen und umfasste sowohl Teile der Bürokratie als auch dem Regime fernstehende Teile der „Intelligenzija“. Daneben gab es natürlich gerade im Dienstleistungsbereich auch eine große Zahl nicht besonders qualifizierter Beschäftigter. Das bürokratische Regime sah aber in den manuellen Arbeiter:innen in den klassischen Industrien weiterhin die „Klasse“, auf die sich das Wohl und Wehe der eigenen Herrschaft begründete. Daher bestand während der gesamten Zeit der Sowjetunion ein bestimmter Ausgleich zwischen der Bürokratie und der Fabrikarbeiter:innenschaft: Für die politische Entmachtung gab es soziale Sicherheit, alle möglichen Freizeitaktivitäten und ein Versprechen auf konstante Lohnerhöhungen – insbesondere für die manuell Arbeitenden. Dies wird in der Statistik XII der Lohnentwicklung von manuell gegenüber den nicht manuell Arbeitenden sehr deutlich. Während 1940 die Löhne von Bildungsarbeiter:innen bei 97 % der Industriearbeiter:innen lagen, waren sie 1960 bei 79 % und 1985 gar nur mehr bei 63 %.
Diese Entwicklung stellte zwar die manuellen Arbeiter:innen in der Industrie ruhig, musste aber wachsende Schichten der „Intelligenzija“ dem Regime entfremden, die sowieso schon aufgrund der demokratischen Einschränkungen und mangelnden Wahlmöglichkeiten für eigenständige Berufs- und Lebensentwicklung unzufrieden waren.[xii] Weiterhin wurden seit dem Abbrechen der Kossygin-Reformen wichtige technische Neuerungen in der folgenden Stagnationsphase versäumt, die z. B. in der Computerisierung sehr viel mehr Eigeninitiative und technische Intelligenz erfordert hätten. Das Potenzial der riesigen, gebildeten urbanen Bevölkerungsschichten in der Sowjetunion wurde nicht nur nicht genutzt, sondern sogar unterdrückt und zur Fortsetzung des „Überkommenen“ gezwungen.
Aus Teilen der Manager:innenbürokratie (insbesondere in den Betrieben) und solchen v. a. der technischen Intelligenz entstand somit eine Schicht, die die Stagnation und das technische Zurückbleiben der Planwirtschaft der nachkapitalistischen Wirtschaftsweise und der Planwirtschaft selbst anlastete. Diese Schicht wurde in den 1980er Jahren immer bedeutender, auch was ihre Repräsentanz in den politischen Instanzen betraf, wenn auch zuerst vermengt mit denjenigen Teilen der Bürokratie, die die Planwirtschaft durch Einführung bestimmter „marktwirtschaftlicher Elemente“ wieder effizienter gestalten wollten, also den „Reformer:innen“. In den 1980er Jahren verbreitete sich dieser gegenüber der „Planwirtschaft“ skeptische Teil der Intelligenzija insbesondere unter den „Ökonom:innen“ – also gerade denjenigen Akademiker:innen und Wirtschaftsbürokrat:innen, die für die Umsetzung der Wirtschaftsreformen verantwortlich waren. Die bekannteste Vereinigung war der „Klub Perestroika“, der 1986 an der Universität Leningrad gegründet wurde. Ein weiterer, einflussreicher Kreis nannte sich „Sintez“.[xiii] Aus ersterem Kreis entstammten die späteren Chefrestaurationisten Jegor Gaidar und Anatoli Tschubais, aus Letzterem z. B. der langjährige (bis 2011!) Finanzminister Alexei Kudrin.
Bezeichnenderweise für die sogenannte „marxistische“ Grundausrichtung der akademischen Welt der Sowjetbürokratie wurden zwar „linksextreme“ Kritiker:innen wie Boris Kagarlizki aus ihren Reihen wegen „antisowjetischer Aktivitäten“ entfernt, während gleichzeitig gerade in den Wirtschaftswissenschaften ein enger Austausch mit neoliberalen Vertreter:innen der Neoklassik im Westen gefördert wurde – nicht nur virtuell, sondern sogar physisch auf entsprechenden internationalen Kongressen. Die berechtigte Kritik an der mangelnden Innovationsfähigkeit, dem technologischen Hinterherhinken und der Verknüpfung der Parteidiktatur mit allumfassender staatlicher Wirtschaftslenkung führte in diesen Kreisen zu der Auffassung, dass Planwirtschaft nur zur Stagnation führen könne und mit Demokratie an sich unvereinbar wäre. Das Nichtvorhandensein einer linken Perspektive, einer Befreiung der Planwirtschaft von der bürokratischen Diktatur durch die sich demokratisch selbstorganisierende Arbeiter:innenklasse, führte dazu, dass gemäß ihren Vorstellungen nur eine vollständige „Befreiung“ der Wirtschaft von staatlicher Einflussnahme und „der Markt“ zu einer effektiven Modernisierung der russischen Wirtschaft und zu wirklicher Demokratie führen könnten. So entwickelte sich in diesen Kreisen ein Programm der Totalprivatisierung, des Abbaus von sozialstaatlicher Beschränkung „des Marktes“ in Verbund mit der Durchsetzung einer „parlamentarischen Demokratie“ nach westlichem Vorbild. Dieses Programm wurde sogar in besonders naiver Weise schon 1990 in Konferenzen mit „westlichen Berater:innen“ besprochen. Bezeichnend ist hier das Zitat eines einflussreichen Mitglieds dieser Kreise: „Wir erhielten von ihnen [den westlichen Ökonomie,expert:innen‘; M. L.] sehr viel. Viel im Sinne einer Vielzahl praktischer, klarer Ratschläge. Sie hatten die Erfahrungen aus verschiedenen Ländern. Das waren nicht nur Polen und die Tschechoslowakei, sondern auch Brasilien, Malaysia und Indonesien. Für unsere Diskussionen war das sehr wichtig“.[xiv] Von hier war es nicht weit bis dahin, dass etwa das Wirtschaftsprogramm von Pinochet in Chile zum Vorbild wurde.[xv]
Während der Perestroika standen ab 1986 zunächst noch die Debatten um „mehr marktwirtschaftliche“ Elemente bzw. größere Selbstverwaltung der wirtschaftlichen Einheiten und allgemein „Dezentralisierung“ im Vordergrund. Auch Gorbatschow sah einen Zusammenhang zwischen ineffizienter Staatswirtschaft und undemokratischen Strukturen, die auf der einen Seite in einen Teufelskreis von Innovationsfeindlichkeit, Mangel an Eigeninitiative und Einschüchterung führen würden. Daher förderte das Reformlager um Gorbatschow die „jungen Liberalen“ und brachte sie in entsprechend einflussreiche Stellen im Wirtschaftsapparat. In anderen Staaten wie Jugoslawien oder Ungarn waren marktliberale Reformen über lange Zeiträume mit den Strukturen der bürokratischen Herrschaft verbunden worden (und hatten dort auch zu entsprechenden finalen Krisen geführt). In Russland waren die zentralstaatlichen Institutionen (Gosplan, Handelsgesellschaften, Außenhandelsmonopol etc.) aber noch weitgehend lebenswichtig für eine halbwegs funktionierende Verteilung von Gütern, Versorgung und finanzielle Stabilität. Mit den teilweise erratischen Reformversuchen und der erwartbaren Blockade durch die alten Apparate erreichte man damit vor allem eines: Bis Ende der 1980er Jahre wurde die wirtschaftliche Krise verschärft, und es machten sich allenthalben Versorgungsprobleme bemerkbar. Die „Radikalreformer:innen“ zogen daraus vor allem zwei Schlüsse: erstens, dass die Sowjetökonomie nicht reformierbar wäre, und zweitens, dass eine Radikalreform jedenfalls nicht in der Union der Sowjetrepubliken gelingen könne. Die durchaus vorhandene Unzufriedenheit der russischen Bürokratie, dass sie durch billige Rohstoff- und Energieexporte den „Rest“ der Union wesentlich unterstützte, dafür aber mangelhafte Fertigwaren erhielt, führte insbesondere im Reformlager in der russischen Teilföderation zu der Überzeugung, dass ihre Reform nur mit der Auflösung der Union gelingen könne (im Perestroika-Kreis in Leningrad soll dies schon 1987 zu einem Plan für eine eigenständige Russische Föderation geführt haben).
In der Bürokratie spiegelten sich diese gesellschaftlichen und ökonomischen Widersprüche in einer wachsenden politischen Fraktionierung wider. Auf der einen Seite die „Konservativen“, z. B. Politbüromitglied Ligatschow, die entweder keinen Reformbedarf sahen oder denen alles zu schnell ging. Auf der anderen Seite fanden die Radikalreformer:innen in Boris Jelzin einen Verbündeten in der oberen Parteihierarchie. Der Bauingenieur aus Swerdlowsk (heute: Jekaterinburg) hatte eine typische Parteikarriere hinter sich, die ihn bis ins Politbüro und zum KP-Chef von Moskau geführt hatte. Ursprünglich ein Verbündeter Gorbatschows, erkannte er immer mehr seine Chance als Sprachrohr der „Radikalreformer:innen“. Seine Entmachtung 1988 konnte seinen Rückhalt in der Masse der unzufriedenen Funktionärslager nicht brechen und stärkte ihn daher letztlich als „von der Parteiführung unabhängigen“ Politiker. Durch Liberalisierungen in der Wahl zum Obersten Sowjet und dann Mitte 1989 der Wahl zum Volksdeputiertenkongress (als einer Art verfassunggebender Versammlung) konnte Jelzin dort erstmals eine von der eigentlichen Parteiführung unabhängige Fraktion anführen. Gorbatschow wurde so immer mehr aus der Rolle des Reformers in die des Zentrums und vor allem in die des Bewahrers einer reformierten Sowjetunion getrieben. Jelzin und die Radikalreformer:innen begannen, die Organe der Russischen Föderation zu dominieren, womit Gorbatschow nur noch über den Erhalt der Sowjetunion und die neu auszuhandelnden Unionsverträge seine Macht bewahren konnte. Damit war die Auflösung der Sowjetunion auch der entscheidende Schritt, um den Marktradikalen in der Russischen Föderation alle Macht zur Wiedereinführung des Kapitalismus an die Hand zu geben.
Auf der anderen Seite der Bürokratie stand, wie Dsarassow[xvi] sicherlich zu Recht anmerkt, eine Masse kleiner Funktionär:innen, die ihre Arbeit gewissenhaft zu machen versuchte oder sich sogar eng mit der Sowjetunion und ihren sozialistischen Ansprüchen verbunden fühlte. Diese breite Schicht unterer Bürokrat:innen stellte eine gewisse Schranke gegen den Machtmissbrauch der Nomenklatura dar, aber auch den Eifer der verschiedenen Flügel der „Reformer:innen“. Die radikalen Reformer:innen sahen daher auch die unteren Ränge der Bürokratie als „Problem“ bzw. warfen sie mit dem üblichen neoliberalen Kampfeifer in eins mit „sonstigen Sozialschmarotzer:innen“. So der „populäre“ Reformpapst und spätere Petersburger Bürgermeister Anatoli Sobtschak: „Bekanntlich beinhalten die in unserem Land geltenden Gesetze unzählige Vergünstigungen und Privilegien: für Veteranen, für Mitglieder der KPdSU, für Mitarbeiter verschiedener Einrichtungen usw. Je zügiger diese Vergünstigungen und Privilegien abgeschafft werden, umso vollständiger werden wir das Prinzip der sozialen Gerechtigkeit realisieren.“[xvii] Gaidar[xviii] und Tschubais sollten dieses „Abschaffen von Privilegien“ später sehr weit fassen – im neoliberalen Duktus werden Sozialleistungen gern als ungerechtfertigte Privilegien verunglimpft. Auch viele Rentner:innen sollte die volle Härte dieser Form von „sozialer Gerechtigkeit“ treffen. Letztlich blieben diese Schichten während der Umwälzungen allerdings ohne politisches Konzept oder sehnten sich nach einer Art Wiederkehr Stalins (siehe der berühmte Andrejewa-Leserbrief. Nina Andrejewa, russische Chemikerin, wandte sich mit einem Leserbrief am 13. März 1988 an die Zeitschrift Sowjetskaja Rossija, in dem sie ihr Festhalten an den alten Prinzipien bekräftigte). Diese Schichten fanden später in der KP der Russischen Föderation ihre „politische Heimat“ – ein Schatten der KPdSU, eher ein strukturkonservativ-nationalistischer Sozialverband als eine Partei, die tatsächlich eine Machtoption verfolgt.
Die verschiedenen „Dissident:innen“-Gruppierungen in der UdSSR hatten sich schon in den 1980er Jahren immer mehr ausdifferenziert. Sie speisten sich weiterhin insbesondere aus der unzufriedenen „Intelligenzija“. Tatsächlich wurden im Rahmen der Auflösung der Sowjetunion nationalistische Oppositionsgruppen immer einflussreicher, nicht nur in den nicht russischen Unionsrepubliken. In Russland hatte sich z. B. Pamjat (dt.: Erinnerung, Gedenken) als extrem nationalistische Gruppierung gegründet, aus der sich in den 1990er Jahren immer wieder neue Gruppierungen der russischen Rechten bildeten. Auch Alexander Solschenizyn stellte sich letztlich als rechtsnationalistischer und antisemitischer Politiker heraus, der gleichzeitig zu einem öffentlichen Unterstützer von Wladimir Putin wurde. Dagegen wurde in den 1980er Jahren eine streng davon zu trennende liberal-demokratische Opposition einflussreicher, die etwa 1987 durch die Entstehung der Menschenrechtsorganisation „Memorial“ bekannt wurde und zu deren bekanntesten Vertreter:innen Andrei Sacharow zählte. Die Gruppierung um Sacharow ging ein politisches Bündnis mit den Radikalreformer:innen um Jelzin ein und dies auch praktisch in einer gemeinsamen Fraktion im Volksdeputiertenkongress 1989. Diese Verbindung, auch mit den radikalen Marktreformen in der Folge, hat die russischen Liberalen westlicher Prägung letztlich gesellschaftlich in eine marginale Rolle gebracht. Zuletzt gab es auch linke Dissident:innengruppen oder linke Strömungen in der KPdSU, die in der Wendezeit z. B. die Sozialistische Partei bzw. die Partei der Arbeit gründeten (z. B. Boris Kagarlizki bzw. Mitglieder der Marxistischen Plattform in der KPdSU, wie Alexander Busgalin und Andrej Kolganow). Es fehlten ihnen jedoch sowohl die gesellschaftliche Verankerung als auch das Programm, um eine entscheidende Rolle im Widerstand gegen die Restauration zu spielen. Dabei hatte z. B. Busgalin 1979 in seiner Dissertation mit dem Titel „Widersprüche der planmäßigen Organisation in der sozialistischen Produktion“ wichtige Grundlagen zumindest für eine wirtschaftspolitische Alternative gelegt.
2. Die finale Krise entwickelt sich
Letztlich trat Ende der 1980er Jahre auch die Arbeiter:innenschaft massiv auf die Bühne des sozialen Protests. Die allgemeine Versorgungskrise verbreitete sich um diese Zeit auch in die Industriebezirke, zuerst vor allem in die Kohlebergbaugebiete. Im April 1989 kam es im Industrierevier des Kusznezker Beckens („Kusbass“) zu einer Serie kleinerer Streiks. Im Juni erklärten Delegierte aus dem Kusbass auf dem Volksdeputiertenkongress, dass die Stimmung dort am Explodieren sei und die „Entwicklung der sozialen Grundversorgung“ endlich ins Zentrum der Perestroika rücken müsste. Die Forderungen der Arbeiter:innen waren ganz konkret: Sie bezogen sich auf die Zuteilung ausreichender Mengen an Grundnahrungsmitteln, Zucker, Waschmittel, Seife, Milch, Tee etc. und auf die Einhaltung von Zusagen in Bezug auf Urlaub und Erholungsplätze in den dafür vorgesehenen Einrichtungen. Die „Reformer:innen“ in Moskau und Leningrad hatten aber damals andere Schwerpunkte und soziale Zielgruppen als die Kohlearbeiter:innen im fernen Sibirien. Nachdem die Forderungen der Kumpel wochenlang ignoriert worden waren, traten im Juli 120.000 Arbeiter:innen im Kusbass in den unbefristeten Streik. Wenig später folgten 100.000 ukrainische Kumpel im Donbass und danach praktisch alle Bergbaugebiete von Workuta im hohen Norden bis Karaganda (auch: Qaraghandy) in Kasachstan. Die meisten an den Bergbau angeschlossenen Stahlwerke begannen ebenso zu streiken, und in allen Industrieregionen begannen die Arbeiter:innen mit täglichen Manifestationen und der Organisierung von Selbstschutzeinheiten (gegen Marodeur:innen und Provokateur:innen). Die staatlichen Gewerkschaftsorgane meldeten, dass die Situation nicht mehr steuerbar sei. Längst ging es den Streikenden nicht mehr nur um „mehr Fleisch“, sondern um die „Befreiung vom Bergbauministerium“ – was so viel hieß wie ein Ende der bürokratischen Fehlplanung.
Doch damit war auch die Grenze einer spontanen Arbeiter:innenerhebung erreicht. Ohne eine die gesamte Sowjetunion umfassende politische Arbeiter:innenpartei mit einem Programm der politischen Revolution blieb die Bewegung auf dem Niveau der Forderung nach „Selbstverwaltung“. Das hieß unter den damaligen Bedingungen, dass nicht nur unter eigener Kontrolle produziert werden sollte, sondern dass die Kumpel auch das Recht haben wollten, ihre Kohle dann selbst auf dem Weltmarkt zu verkaufen, um mit den Devisen dann die Lebensmittel etc. kaufen zu können, von denen sie nicht mehr glaubten, dass sie ihnen die Planökonomie liefern würde. Kurz: Aus dem antibürokratischen Aufstand der Arbeiter:innen konnten die „Reformer:innen“ buchstäblich Kapital schlagen für ihr Programm der Zerschlagung von Planinstitutionen und Außenhandelsmonopol. Dazu kam, dass insbesondere Kohle- und Stahlindustrie eine besondere Rolle in der Sowjetökonomie spielten: Seit den 1930er Jahren war dieser Sektor quantitativ so stark ausgebaut, dass eigentlich chronische Überproduktion herrschte. Statt dort jedoch durch Produktivitätssteigerungen und entsprechende technische Investitionen Arbeitskräfte und Ressourcen zu sparen bzw. die Qualität zu steigern, wurde eine Unmasse schlecht bezahlter Arbeiter:innen unter miesesten Arbeitsbedingungen und in einer ökologischen Hölle weiter „verheizt“. Während sich andere Industrien in der Sowjetunion durchaus entwickelten, blieb die Grundstoffindustrie eine Art Industriemuseum mit Überkapazität. Der berechtigte Protest der Arbeiter:innen dieser Sektoren hätte daher zu einer grundlegenden Umstrukturierung mit entsprechenden großen Investitionen führen müssen. Zu einer solchen wirklich planwirtschaftlichen Revolution waren die verschiedenen Reformfraktionen aber weder willens noch fähig – sie hätte auch an den Grundfesten der bürokratischen Herrschaft rütteln müssen.
So waren die Arbeiter:innenproteste vom Sommer 1989 für die verschiedenen Fraktionen der Bürokratie die Bestätigung, dass die Planwirtschaft politisch nicht mehr zu halten war und mehr oder weniger radikale Marktreformen durchgeführt werden müssten. Hier kommt jetzt wieder Trotzkis weiter oben zitierte Vorhersage ins Spiel: Der Sturz von bürokratischer Diktatur und Planwirtschaft musste notwendigerweise zur Wiedereinführung kapitalistischer Verhältnisse führen. Die Frage war nur, ob Marktreformen, Umwandlung der politischen Institutionen und wirtschaftlich-soziale Krise rasch zur Etablierung einer bürgerlichen Klassenherrschaft führen würden – immer vor dem Hintergrund, dass Abläufe wie die 1989er Arbeiter:innenproteste auch zu einer anderen Lösung der Krise drängen könnten.
2.1 Die bürgerlich-restaurationistische Regierung
In unserem Buch „The Degenerated Revolution: The Rise and Fall of the Stalinist States“[xix] haben wir sowohl eine detaillierte historische Darstellung des Endes der Herrschaft der Bürokratie geliefert wie auch die marxistischen Grundlagen für das Verständnis der dabei ablaufenden Restauration des Kapitalismus dargelegt. Aufbauend auf der Analyse Trotzkis von der bürokratischen Herrschaft in der Sowjetunion wird dabei von zweierlei ausgegangen:
Erstens: Die Grundlagen dieser bildeten die oben beschriebenen gesellschaftlichen und ökonomischen Bedingungen einer nachkapitalistischen Gesellschaftsformation. Aber die diese Gesellschaftsformation eigentlich tragende Klasse, die Arbeiter:innenklasse, war durch die stalinistische Konterrevolution Ende der 1920er Jahre politisch entmachtet und diktatorisch unterdrückt, so dass dieser Formation die vorwärtstreibende, dynamische Kraft fehlte und stattdessen Stagnation und Krise der planwirtschaftlichen Entwicklung die gesellschaftlichen Grundlagen dieser Formation langfristig untergraben mussten.
Zweitens: Der Ausdruck der stalinistischen Konterrevolution, die diese politische Entmachtung der Arbeiter:innenklasse realisierte, war die Ersetzung des in der Oktoberrevolution geschaffenen Rätestaates durch einen der Form nach wiederhergestellten bürgerlichen Staatsapparat (auch wenn der Name „Sowjet“ weiter für nun pseudoparlamentarische Gremien weiterverwendet wurde). Die Koordination der Bürokratie erfolgte über einen sogar gegenüber bürgerlichen Staaten noch aufgeblähteren bürokratischen und polizeistaatlichen Staatsapparat mit sämtlichen Erscheinungsformen abgehobener parlamentsähnlicher Gremien – organisiert in einem Einparteienstaat und einer Vielzahl von Vorfeldorganisationen der Staatspartei.
Diese „Verbürgerlichung“ der Revolution, diese bereits durchgeführte Wiedereinführung abgehobener und zentralistischer Parlaments- und Regierungsgremien, erleichterte auch die Restauration des Kapitalismus ungemein. Nachdem sich in der Bürokratie eine dominante Fraktion gebildet hatte, für die die Wiedereinführung des Kapitalismus die einzige „Krisenlösung“ darstellte, brauchte sie nur eine Regierung zu bilden, die eine Mehrzahl der entscheidenden Gremien der bürokratischen Herrschaft hinter sich versammelte, um die Restauration des Kapitalismus auch tatsächlich einzuleiten. Die Arbeiter:innen und ihre Räte waren ja längst entmachtet, atomisiert, und hatten in ihren Teilkämpfen zu wenig eigenständige Organisierung hervorgebracht, um gegen eine solche Wende entscheidenden Widerstand leisten zu können – die stalinistische Konterrevolution der 1920er Jahre wurde Anfang der 1990er Jahre nur konsequent zu Ende geführt. Die Auflösung der Planbehörden, die Überführung der Staatsbetriebe in eine von der Regierung verwaltete Behörde zu ihrer letztlichen Privatisierung und die Einleitung der „Schocktherapie“ waren damit die letztlich entscheidenden Schritte zur Restauration des Kapitalismus.
Auch wenn als entscheidendes Ergebnis der Turbulenzen der 1990er Jahre eine neue bürgerliche Klasse erst entstehen sollte, war ein entschlossener Teil der Bürokratie bereit, anstelle dieser Bourgeoisie in spe zu handeln – mit der Aussicht, dass ein gewisser Teil von ihr auch Element der neuen Bourgeoisie werden sollte (bzw. in ihrem Windschatten reich werden würde). Wir bezeichneten damals die so ausgerichteten Regierungen als „bürgerlich-restauratorische Regierungen“, auch wenn sie sich sozial noch vor allem auf Teile der Staatsbürokratie stützten. Die nach dem Zusammenbruch des Janajewputsches im Herbst 1991 gebildete Regierung der Russischen Föderation unter Führung Jelzins und seiner Koalition im Volksdeputiertenkongress war eine solche Regierung. Sie leitete auf Grundlage der Verfolgung der Putschist:innen sofort eine Reihe von Säuberungen, insbesondere im Sicherheitsapparat, ein (die tausende Bürokrat:innen, Militärs und Sicherheitsbeamt:innen ihren Job kostete), verbot die KPdSU und begann im Oktober 1991 mit der Planung zur „Schocktherapie“ in der RF. Wie schon gesagt war der letztlich entscheidende Hebel die Auflösung der Sowjetunion im Dezember 1991, mit der die Auflösung der Planbehörden und die Einzelmaßnahmen des Wirtschaftsprogramms tatsächlich in Kraft traten – womit dies den Wendepunkt hin zur Einleitung der Restauration des Kapitalismus in der russischen Föderation darstellt.
Nach der marxistischen Staatstheorie wird ein Staat nicht aufgrund einer bestimmten Regierungsform oder gemäß seiner ideologischen Selbsteinschätzung charakterisiert, sondern auf der Grundlage seines Klassencharakters. Dieser Klassencharakter wird im Allgemeinen determiniert durch die Eigentumsverhältnisse, die dieser Staat objektiv verteidigt. Auch noch so „progressive“ und „sozialreformerische“ Regierungen, die das Eigentum der Bourgeoisie am Kern der Produktionsmittel im Namen des „Rechts“ verteidigen, stellen Elemente der Herrschaft in einem bürgerlichen Staat dar. Ebenso war die stalinistische Bürokratie, so sehr sie auch die Arbeiter:innenklasse in ihrer Selbstbestimmung unterdrückte, objektiv Verteidigerin der nachkapitalistischen Eigentumsverhältnisse in der Sowjetunion – diese also objektiv gesehen ein Arbeiter:innenstaat. Diese widersprüchliche Erscheinung eines der Regierungsform nach die Arbeiter:innen unterdrückenden, dem Inhalt nach aber ihre Eigentumsverhältnisse sichernden Systems bezeichnete Trotzki daher als „degenerierten Arbeiter:innenstaat“ – also ein auf der proletarischen Revolution beruhendes System, in dem auf politischer Ebene eine partielle Konterrevolution stattgefunden hatte. In dieser wurden zwar die bürgerlichen Eigentumsverhältnisse nicht wieder eingeführt, aber die politische Herrschaft der demokratisch organisierten Arbeiter:innenklasse durch die einer privilegierten bürokratischen Kaste ersetzt.
Die Krise der Planökonomie brachte, wie gesehen, sowohl in der bürokratischen Kaste wie auch im Rest der Gesellschaft soziale Schichten hervor, die ihre Perspektive in der Wiederherstellung bürgerlicher Eigentumsverhältnisse sahen – und die ihre Zukunft insbesondere als Teil einer zukünftigen russischen Bourgeoisie sahen. Die beschriebenen Fraktionskämpfe und die Herausbildung des Blocks der „Radikalreformer:innen“ im russischen Volksdeputiertenkongress drückten bereits aus, dass dieser Teil der Gesellschaft im bürokratischen Herrschaftsapparat seit etwa 1988 um die Macht zu kämpfen bereit war – auf allen Ebenen der politischen Gremien der Bürokratie (lokale, regionale Sowjets, Teilregierungen, Parteiorganisationen etc.). Die anderen Fraktionen der Bürokratie hatten sich mit dem Janajewputsch entweder gegenseitig selbst ausgeschaltet oder waren seitdem dem Block der Radikalreformer:innen zumindest in der Russischen Föderation unterlegen. Normalerweise erfordert eine Konterrevolution die blutige Machtergreifung der bürgerlich-reaktionären Kräfte gegen die der organisierten Werktätigen (wie z. B. im spanischen Bürgerkrieg). Im Fall der degenerierten Arbeiter:innenstaaten waren die „bewaffneten Organe der Werktätigen“ nur noch formell tatsächlich Ausdrücke von Arbeiter:innenmacht und dem Willen der Werktätigen, ihre sozialen Rechte zu verteidigen. Tatsächlich waren auch diese bewaffneten Organe nur noch Teile eines bürokratischen Apparats, der durch die Krise der bürokratischen Herrschaft vollständig zerrüttet war. Der Regierungsantritt einer restaurationistischen Regierung als Repräsentantin der Mehrheit der Bürokratie rief daher keinen nennenswerten Widerstand mehr hervor, ebenso die damit einsetzende Säuberung des bürokratischen und sicherheitspolitischen Apparats von den Bürokrat:innen, die auf der schwarzen Liste der Jelzin-Leute standen. Mit der Etablierung der bürgerlich-restaurationistischen Regierung und der Durchsetzung ihres Programms (Auflösung der Sowjetunion, Einleitung der Wirtschaftsliberalisierungen) wurde daher die bürgerliche Konterrevolution vollzogen. Der russische Staat war damit zu einem geworden, der die entstehenden bürgerlichen Eigentumsverhältnisse verteidigte und alle Elemente nachkapitalistischer Eigentumsverhältnisse bekämpfte, und war natürlich ein bürgerlicher Staat. Der degenerierte Arbeiter:innenstaat hatte in der Russischen Föderation mit Auflösung der Sowjetunion aufgehört zu existieren. Auch nach einer proletarischen Revolution im damit entstandenen Arbeiter:innenstaat müssen sich die proletarischen Eigentumsverhältnisse erst gegenüber den noch weiterhin bestehenden Elementen des Kapitalismus durchsetzen – wobei es den Arbeiter:innenstaat auszeichnet, dass er gerade dieses Durchsetzen aktiv befördert. Genau deswegen muss in der proletarischen Revolution der bürgerliche Staat zerschlagen werden, da er mit seinen Verbindungen zwischen Bürokratie und Bourgeoisie die Herausbildung einer von den Arbeiter:innen demokratisch selbstbestimmten Ökonomie verhindert. Diese Zerschlagung des Staatsapparates ist im Fall der Restauration in einem degenerierten Arbeiter:innenstaat nicht mehr notwendig – die stalinistische Konterrevolution hatte die Elemente der Arbeiter:innendemokratie bereits durch einen der Form nach bürgerlichen Staat ersetzt. Auf der Grundlage der politischen Wende im Staatsapparat betrieb der neu ausgerichtete bürgerliche Staat in der Russischen Föderation seit Anfang 1991 die Zurückdrängung der noch bestehenden planwirtschaftlichen und sozialstaatlichen Elemente aus der Zeit der Sowjetunion – unter der Erschwernis, dass eine Kapitalakkumulation ohne nennenswertes Privatkapital kaum in Gang kommen konnte. Der bürgerlich-restaurationistische Staat in der Russischen Föderation war daher einer, der einerseits ein lebensgefährliches Werk der Zerstörung eines bereits krisengeschüttelten Wirtschaftsorganismus betrieb, andererseits den berüchtigten Prozess der „ursprünglichen Akkumulation des Kapitals“ in Gang setzte. Beides bedeutete, dass die Restauration des Kapitalismus in der Russischen Föderation zugleich eine Verschärfung der wirtschaftlichen Krise bewirkte – die Transformation der Krise der Planwirtschaft in den krisenhaften Prozess einer zügellosen ursprünglichen Akkumulation von Privatkapital. Tatsächlich sahen wohl weder die „Radikalreformer:innen“ noch ihre zahlreiche Anhängerschaft die Schwierigkeit und Brutalität der Ingangsetzung des Prozesses der Kapitalakkumulation. In der bürgerlichen Ideologie geht es ja nicht um Kapital und seine Verwertung, sondern um die fast magisch verklärte, aus himmlischen Höhen herabsteigende Macht des „freien Marktes“. Nicht die Frage der Aneignung des Produktivkapitals durch eine neu sich konstituierende russische Bourgeoisie stand daher im Vordergrund des Regierungsdiskurses, sondern die „Befreiung der Marktkräfte“ von Staat und „planwirtschaftlichem Zwang“. Am Ende der Sowjetunion hatten die verantwortlichen Ökonom:innen Marx und seine Analyse des Kapitalismus gänzlich durch diejenige von Hayeks ersetzt.
2.2 Krise der Planwirtschaft – Restauration des Kapitalismus – kapitalistische Krise
Es ist eine Ironie der Geschichte, dass mit der Machtübernahme der Jelzin-Fraktion ausgerechnet Anhänger der Wirtschaftstheorien von Mises und Hayek, wie Gaidar und Tschubais, an die Schalthebel der krisengeschüttelten Planökonomie kamen. Späteren Kritiken an den verheerenden Folgen ihrer Politik entgegnete etwa Gaidar, dass die „Reformen“ nicht zu marktradikal gewesen seien, sondern im Gegenteil, dass „der Markt“ zu wenig sein Werk verrichten konnte. Bei aller berechtigten Zurückweisung des später unter Putin geförderten Mythos, dass ein an sich gut funktionierendes System plötzlich durch „verrückte“ (durch den Gorbatschow’schen Liberalismus zu Tage geförderte) Reformer:innen wie Gaidar an die Wand gefahren wurde, zeigt diese Form der Rechtfertigung, dass sich auch der Liberalismus letztlich gegen jegliche grundlegende Kritik immunisiert: Wenn eine behauptete Gesetzmäßigkeit nicht funktioniert, ist dies keine Widerlegung, sondern zeigt nur, dass die Gesetzmäßigkeit nicht „radikal genug“ funktionieren konnte.
Was waren nun die behaupteten Gesetzmäßigkeiten, auf denen die „Schocktherapie“ der 1990er Jahre basierte? Friedrich Hayeks Argumente in einer historisch zentralen Schrift zu Marktwirtschaft versus Planwirtschaft[xx] kreisten um die Rolle der Preise für die Findung ökonomisch rationaler Entscheidungen. In der neoklassischen Wirtschaftstheorie dreht sich die Ökonomie um die gesamtgesellschaftliche Optimierung des Einsatzes „knapper produktiver Ressourcen“. Dabei werde die rationale Auswahl zwischen alternativen Verwendungen dieser Ressourcen dadurch entschieden, ob eine marginale Steigerung ihres Einsatzes noch auf entsprechendes Nachfragewachstum stoße („Grenznutzen“). Wenn daher jeder nach einer optimalen Minimierung seiner Kosten bzw. Maximierung seiner Gewinne strebe, komme dabei eine ökonomisch sinnvolle gesamtgesellschaftliche Verteilung der knappen produktiven Ressourcen heraus. Dies sei die Erklärung für die „unsichtbare Hand des Marktes“, die Adam Smith einst gepriesen hatte. Grenznutzenoptimierung und ein funktionierender Preismechanismus seien daher, so die Argumentation von Hayek, wechselseitig voneinander abhängig. Preise würden die entscheidenden Signale für rationale ökonomische Entscheidungen liefern, während rationale Kosten-Nutzen-Optimierungen ihrerseits wieder zu „rationalen Preisen“ führen. Ohne Markt und Privateigentum funktioniere aber der Preismechanismus nicht und damit würde auch die mit dem Markt gegebene automatische Berechnung der richtigen Relationen des Einsatzes ökonomisch knapper Güter nicht funktionieren. Implizit in der Argumentation Hayeks ist, dass kein bewusster Plan der Verteilung der Ressourcen je die mit dem Markt gegebenen Optimierungsfähigkeiten erreichen könnte. Da Marktwirtschaft und liberale Preispolitik (keine Einmischung des Staates) ohne Kapitalismus nicht möglich seien, gebe es daher keine Alternative zu ihm („There is no alternative“).
Auch wenn dieser Ansatz sich aus marxistischer Sicht werttheoretisch kritisieren lässt, gab es im „sozialistischen Lager“ eine Reihe von Ökonom:innen, die ihn tatsächlich beim Wort nahmen. Mit dem berechtigten Ansatz, dass für „rationale Preise“ eine Marktwirtschaft zwar hinreichend, aber nicht notwendig ist, gingen sie der Frage nach, ob nicht auch in einer Planwirtschaft die Kosten-/Nutzen-Optimierung effizient durchführbar sei. Insbesondere ein Kreis um den polnischen Ökonomen Oskar Lange entwickelte in den 1930er Jahren (ausgehend von Arbeiten von Pareto)[xxi] eine Theorie, nach der der Marktmechanismus durch exakte mathematische Berechnungen ersetzt werden kann. Aufbauend auf den neoklassischen Gleichungen zeigte er, dass ein rationaler Preis auch durch eine Planbehörde gefunden werden könne: Ausgehend von Berechnungen alternativer Angebotsmodelle könne dann durch Versuch und Irrtum im Austesten der tatsächlichen Nachfragebedingungen ein „Gleichgewichtspreis“ bestimmt werden. Als Leiter der Planungsbehörde in der Volksrepublik Polen (1957–1963) wurde Lange so zum Vorbild sowohl für die kurzzeitige „kybernetische Wende“ als auch für die verschiedensten „marktsozialistischen Reformen“. Historisch wichtig hierbei ist aber auch, dass diese Art der Plan-/Markt-Diskussion auf der Grundlage der Adaption der Neoklassik dazu führte, dass die neoklassische Wirtschaftstheorie zu einem festen Bestandteil der Ökonomielehre und -forschung auch in der Sowjetunion wurde. Mit den wachsenden Problemen der Reformpolitiken wuchs damit auch dort die Zahl der Ökonom:innen, die diese Theorie nicht nur „sozialistisch“ adaptieren wollten, sondern sie auch schlicht für die richtige hielten.
Sicherlich ist richtig, dass der Glaube Hayeks, die Berechnungen des Marktes könnten nicht durch Algorithmen nachgebildet und dargestellt werden, an sich eine Form des Mystizismus ist. In der Folge wandelte sich auch der Glaube an den Markt als „Ort der Wahrheit“ in eine Art neoliberale Religion. Ironischer Weise hat der Kapitalismus jedoch inzwischen selbst sehr viele Algorithmen der Marktsimulation hervorgebracht, etwa wenn Amazon aufgrund von Nachfragemodellen Warenpakete schon lange vor den konkreten Warenbestellungen der Kund:innen versendet („anticipatory package shipping“-Algorithmus). Mit den generativen selbstlernenden KI-Systemen könnten heute längst Kosten-/Nutzen-Optimierungen vorgenommen werden, die weitaus schneller als der traditionelle Markt sind. Das Problem der „kybernetischen Wende“ in den bürokratischen Planwirtschaften in den 1960er Jahren war allerdings, dass die technischen Voraussetzungen für die Umsetzung solcher computerisierten Verteilungsalgorithmen als Alternative zum Markt noch in weiter Ferne lagen. Zugleich aber auch, dass sowohl die Umstrukturierung der Planbehörden als auch die Einbeziehung der Arbeitenden und Konsument:innen in die „Feedback-Schleifen“ an der Macht der Bürokratie gerüttelt hätte, was an sich schon schnell zum Abbruch dieser Wende geführt hätte. Schließlich war selbst der mathematische Ansatz von Lange illusorisch: Die Algorithmen, die den Optimierungsvorgängen zugrunde liegen, sind hochgradig nichtlinear und führen zu Problemen, die seit einigen Jahren von der Chaostheorie her bekannt sind. D. h., die Berechnungen können gar nicht zu exakten Lösungen führen, sondern nur zu Annäherungen, die der beständigen Überprüfung und Korrektur bedürfen. Das Bestreben, gerade mit beschränkter Rechenkapazität exakte Lösungen statt Annäherungen mit berechenbaren Fehlerbereichen und Alternativmöglichkeiten zu finden, musste scheitern. Eine Planrechnung von komplexen wirtschaftlichen Regelkreisen muss mit Werkzeugen von Wahrscheinlichkeitstheorie und numerischer Approximation[xxii] arbeiten, die großenteils erst in den letzten Jahrzehnten entwickelt wurden.
Noch grundlegender ist aber der Ansatz der „rationalen Preise“ und ihrer Steuerungswirkung hinsichtlich ihrer historischen und gesellschaftlichen Voraussetzungen zu kritisieren. Wie Marx im „Kapital“ herausarbeitet, ist die allgemeine Vergleichbarkeit von Waren auf dem Markt an sich schon eine langwierige historische Abstraktionsleistung. Sie setzt voraus, dass nicht mehr unmittelbar Gebrauchswerte für den eigenen Bedarf oder den eines/r Herr:in produziert werden, sondern Waren für den verallgemeinerten Tausch. Sie setzt aber auch voraus, dass die Arbeit, die in diesen Waren verkörpert wird, unter allgemeinen gesellschaftlichen und damit vergleichbaren Bedingungen geleistet wird. Damit erst kann sich diese Vergleichbarkeit in einem Äquivalent, dem Geld, ausdrücken. Die Dopplung von Tauschwert in Wert und Wertform und die Verselbstständigung der Letzteren im Kapital ist keine eigentümliche „dialektische Darstellungsweise“ bei Marx, sondern drückt die einer verallgemeinerten Warenproduktion innewohnende Tendenz zur Herrschaft des Verwertungszwangs (Geld, das zu mehr Geld werden muss) aus. Die Realisierung dieser Verselbstständigung erfordert allerdings die Teilung der Gesellschaft in eine Klasse der Privateigentümer:innen an Produktionsmitteln und die Klasse derer, die vor allem Besitzer:innen nur ihrer Arbeitskraft sind, denn diese spezielle Ware (Arbeitskraft) ist es, die im Produktionsprozess die Verwertung des Werts, die Reproduktion des bestehenden Werts plus die Produktion des Mehrwerts ermöglicht.
Stattdessen agieren in der Neoklassik isolierte Individuen, deren gesellschaftlicher Zusammenhang allein durch einen abstrakten Ort, genannt „Markt“, hergestellt wird. Wie sich dort eine Vergleichbarkeit von Angeboten ergibt, wird ausgeblendet. Einzig die rationale Wahl der Besitzer:innen von knappen Ressourcen zwischen alternativen Einsätzen dieser führt zum Austausch. Ob mit oder ohne Geld, ist dabei angeblich egal. Auf diese Weise wird Ökonomie zu einer rein mathematischen Optimierungsfrage ohne gesellschaftliche oder historische Voraussetzungen, außer derjenigen, dass Individuen zweckrational über ihre Ressourcen und Alternativen entscheiden. Die „einzige“ politische Konsequenz ist, dass der Markt perfekt ungehindert wirken können muss und die Individuen im legalen Rahmen ihre „freie Wahl“ treffen können. Dass diese neoliberale Ersatzreligion in der bürgerlichen Welt den Rang einer „Wissenschaft“ einnimmt, ist schlimm genug. Dass aber dieses idealistische Verständnis von Markt in den bürokratischen Planwirtschaften als etwas galt, das es in der Planökonomie nachzubilden galt, zeigt den Grad der Degeneration des Verständnisses im Hinblick auf die Aufgaben in einer nachkapitalistischen Übergangsgesellschaft. Kein Wunder, wenn man das Ausmaß an entfremdeter Arbeit, an repressiven Hierarchien und des Fortbestehens aller möglichen Formen von Warenfetischismus und Verselbstständigungen der Wertform in den degenerierten Planökonomien feststellen muss – hier war von Anfang an jeder Gedanke an Befreiung von der Herrschaft der abstrakten Arbeit über die lebendige, kollektiv und demokratisch bestimmte Arbeit grundlegend blockiert. Dies auch noch durch einen Einbau von Marktmechanismen (ob computerisiert simuliert oder real in dafür angeblich geeigneten Sektoren) reformieren zu wollen, musste letztlich zu einer Aufgabe des Plans zugunsten des Marktes führen.
Die Fiktion des perfekten Marktes, in dem die „Preissignale“ den Weg zu rationalen ökonomischen Entscheidungen weisen, hat mit den realen Märkten im Kapitalismus wenig zu tun. Marx’ Analyse von Wert und Wertform zeigt dagegen in der Transformation von Wert zu Preis eine institutionelle Hierarchie von Märkten, die jeweils bestimmte Elemente der Preisformation bestimmen und dabei aber auch immer von gesellschaftlichen Bedingungen und Auseinandersetzungen mitbestimmt sind. Diese institutionelle Analyse der Marktarchitektur im Kapitalismus muss hier dargestellt werden, da sie zum Verständnis des Restaurationsprozesses des Kapitalismus wesentlich ist. Es wird im Anschluss auf die Probleme der Restauration des Kapitalismus in Russland auf den jeweiligen Teilmärkten eingegangen.
2.3 Herausbildung eines Arbeitsmarktes
Der für den Kapitalismus grundlegendste Markt ist der Arbeitsmarkt, da hier die Wertform das zentrale Ausbeutungsverhältnis dieser Gesellschaftsformation verdeckt. Die Bestimmung des Preises der Ware Arbeitskraft, des Lohnes, hat zwar auch etwas mit Angebot und Nachfrage zu tun. Aber zugrunde liegt das Klassenverhältnis von Lohnarbeit und Kapital, also ein gewaltiges Machtgefälle zwischen den Eigentümer:innen an Produktionsmitteln und denjenigen, die ihre Arbeitskraft beständig verkaufen müssen, um durch Arbeit mit diesen Produktionsmitteln ihr Leben finanzieren zu können. Die beständige Bedrohung durch Kündigung und Arbeitslosigkeit und die vorteilhafte „Marktposition“ der Kapitaleigner:innen führen zur Notwendigkeit der gesellschaftlichen Organisierung der Lohnarbeit und Auseinandersetzung um die Grenzen der Ausbeutung durch Arbeitsrecht (z. B. Kündigungsschutz), Begrenzung der Arbeitszeit, Tarifierung unterschiedlich qualifizierter Arbeit, Schranken der Arbeitsintensität, Arbeitssicherheit etc. Dies alles bestimmt die Höhe der Stundenlöhne mit und begrenzt somit den möglichen Profit pro Arbeitsergebnis. Für den Neoliberalismus sind dies Störfaktoren für den „perfekten Markt“ – und sie wurden auch von den russischen „Reformer:innen“ als zu überwindende „Privilegien“ bzw. bürokratische Hemmnisse angesehen.
2.4 Etablierung der Warenzirkulation
Die zweite Ebene stellt die Organisierung des Warenumsatzes selbst dar. Der „Markt“ ist nicht ein abstrakter Ort, sondern erfordert Arbeit und Infrastruktur. Die Kosten dafür müssen letztlich aus dem Mehrwert erbracht werden, der den Waren in der produktiven Arbeit zugefügt wurde. In der Preisrechnung erscheint dies zwar als „Preisaufschlag“ (Handelsspanne), im Gesamtkreislauf des Kapitals ist es jedoch ein Abzug vom möglichen Profit des produktiven Kapitals. Insbesondere bei landwirtschaftlichen Produkten oder einfachen Konsumgütern kann die Macht großer Handelskonzerne zu Preisdiktaten für die Erzeuger:innen oder großen Handelsspannen führen. Außerdem werden in den meisten kapitalistischen Ländern viele Preise durch Subventionen, Preislimits, Sonder- und nicht zuletzt Umsatzsteuern stark beeinflusst. Das berühmteste Beispiel ist der Brotpreis, bei dem z. B. zwei Drittel auf Handel, Energie, Transport und Steuern zurückgehen. Preisregulierungen, insbesondere in bestimmten Krisenmomenten, wie z. B. jüngst bei Energiepreisen in Europa oder bei Brotpreisen in Nordafrika, gehören zum Standardrepertoire kapitalistischer Krisenpolitik. Dagegen sind Subventionen, z. B. in der Bauwirtschaft und im Agrarbereich, ein Mittel indirekter Preispolitik, das über sehr lange Zeiträume eingesetzt wird. Die Idee, dass gerade in Krisenzeiten die Abschaffung von Preisregulierungen und staatlicher Einflussnahme auf den Markt hilfreich sei, führt zu den bekannten neoliberalen Kettensägenmassakern (um einen bekannten aktuellen Protagonisten dieser Politik in Erinnerung zu rufen), das enorme soziale Konsequenzen hat. Doch auch diese Idee hatten die russischen Reformer:innen.
2.5 Herausbildung eines Kapitalmarktes
Die dritte Ebene betrifft die Investitionen im Verhältnis zum erwarteten Gewinn: Im Kapitalismus ist das stärkste „Preissignal“ tatsächlich die Profiterwartung, die an ein Geschäft geknüpft wird. Im Gesamtkreislauf der Kapitalverwertung über alle Sektoren hinweg betrachtet ergibt sich ein Ausgleich der verschiedenen Branchenprofitraten hin zu einer allgemeinen Durchschnittsprofitrate. Diese von Marx im dritten Band des Kapitals beschriebene Gesetzmäßigkeit entspricht der Optimierungsleistung des Marktes in der Neoklassik: Die produktiveren, kapitalintensiveren Sektoren haben höheren Grenznutzen als die unproduktiveren, personalintensiveren Sektoren. Daher können Erstere höhere Preise als Letztere in Bezug auf den Produktionswert erzielen und damit die höheren Kapitalkosten durch entsprechend höheren Profit ausgleichen. Damit ergibt sich eine Preisbildung, die sich für alle Branchen aus Produktionskosten plus allgemeinem Durchschnittsprofit zusammensetzt. Dieser Durchschnittsprofit erscheint dann als momentan gegebener „Preis“ des Kapitals selbst („Kapitalkosten“). Erst Unternehmen, die über den Durchschnittsprofit hinausgehen, gelten als „gewinnbringend“. D. h., dass für Investitionen aufzubringende Kapital wird von vornherein nicht nur mit den eigentlichen Kosten, sondern mit dem üblichen Durchschnittsprofit „bewertet“. Auch wenn ein Unternehmen oder eine Investition an Anteilseigner:innen oder andere Kapitalgeber:innen verkauft werden, wird so ein Kapitalwert für diese Verkaufsoperation berechnet. Der Kapitalmarkt, der entscheidend für alle größeren Investitionen ist, basiert also im Wesentlichen auf einer fiktiven Preisbildung. Er ist also noch weiter entfernt von einem „perfekten Markt“, da sich die Grundlagen der Preisbildung hier sehr schnell und wenig berechenbar verändern können. Börsen, Investitionsbanken, Hedgefonds, Derivatehandel u. ä. sind die üblichen Marktorte für den Kapitalmarkt. Da die grundlegende Tendenz der kapitalistischen Entwicklung (Fall der Durchschnittsprofitrate, ausgeglichen durch umso schnelleres Wachstum der Produktion und damit der Profitmasse) zur Überakkumulation von Kapital führt, haben diese Kapitalmärkte die Tendenz, den Wachstumseinbruch der Realakkumulation durch eine Akkumulation fiktiver Kapitalwerte fortzuführen. Dies führt dann periodisch zu schweren Zusammenbrüchen wie 2008/2009. Solche Krisen wiederum führen dann ihrerseits zu Regulierungen dieser Kapitalmärkte, die das Gesamtwachstum stark bremsen und daher früher oder später wiederum als „bürokratische Hürde“ angegriffen werden. Die Art und Weise der Hervorbringung solcher Kapitalmärkte ist jeweils eine der kniffligsten Aufgaben jeder Restaurationsökonomie gewesen (wenn nicht einfach nur eine Öffnung für die internationalen Kapitalmärkte stattfindet, wie z. B. damals in Osteuropa).
2.6 Herausbildung des zinstragenden Kapitals
Die vierte Ebene ist das zinstragende Kapital. Es entspringt der Dreifachnatur des Geldes als Wertmaßstab, Zirkulationsmittel und Zahlungsmittel (in der Neoklassik wird es faktisch auf Zweiteres reduziert). Die Rolle als Wertmaßstab, ausgehend von der Preisform, und die Umkehrung des W-G-W-Prozesses lassen Geld als „gehorteten Wert“ zum Ausgangspunkt der Kapitalform G-W-G‘ werden bzw. zum Zahlungsmittel bei eingegangenen Zahlungsverpflichtungen, wenn die Reihenfolge von Verkauf (W-G) und Kauf (G-W) zeitlich vertauscht wird. Viele größere Investitionen im entwickelten Kapitalismus bringen zunächst nur Kosten und realisieren erst später die Rückflüsse, die diese decken bzw. den Profit bringen. Umgekehrt sammeln Banken nicht einfach nur Spareinlagen, sondern vor allem große Vermögenswerte aus nicht wieder investierten Profiten. Das reine Kreditgeschäft (unterhalb der Anlage dieser Einlagen auf dem Kapitalmarkt) muss mit dem Zins „bepreist“ werden. Der Zins wird im Gesamtreproduktionsprozess des Kapitals letztlich aus der Profitrate gespeist, womit sich gewöhnlich die Zinsrate unterhalb der Durchschnittsprofitrate bewegt. Durch die beständige Notwendigkeit der Kreditfinanzierung während der Produktionszyklen erscheint der Zins als „Finanzierungskosten“, als konstanter Bestandteil der Preise und damit der Unternehmensgewinn als Residuum des Profits nach Abzug von Zins (und Steuern). Da Schulden immer mehr selbst zu handelbaren Waren werden, deren Wert durch die Zinserträge berechnet wird, dienen sie selbst als Geldäquivalent – bzw. sind (besonders in Form der Staatsschuldenpapiere) das zentrale Mittel für Geldschöpfung der Zentralbanken geworden. Unter anderem daher kommt die große Rolle der Zinsentwicklung für die Geldwertstabilität. Das Verschwimmen von Kredit- und Kapitalmarktgeschäft sowie eine lockere Vergabe von Zentralbankkrediten an Banken, die sowohl Investment- wie Geschäftsbanken sind, zeichnen spekulative Phasen der Kapitalakkumulation aus, wie z. B. während der Restauration des Kapitalismus in Russland in den 1990er Jahren.
2.7 Monopolrenten
Die fünfte Ebene sind bestimmte Sektoren der Ökonomie, die durch ihre monopolistische Struktur bzw. rechtliche Stellung einen Extraanteil am Mehrwert der Gesamtökonomie erhalten, ohne dass dies auf eigener produktiver Arbeit beruhen würde. Dies betrifft insbesondere den reinen Besitz an Grund und Boden oder die reinen Verfügungsrechte über Abbaugebiete von Bodenschätzen. Diese Besitzrechte werden anteilig bei ihrer Nutzung durch andere in Rentenform vergütet und erscheinen somit als Bestandteile der Preisgenese (z. B. als Mietkosten). Auch hier ergibt sich aus der Aufzinsung der Rentenerträge ein eigener „Preis“ für den Verkauf dieser Besitztitel (z. B. der Bodenpreis). Märkte wie die für Grund und Immobilien sind in hohem Maße abgeleitete, abhängig von der Entwicklung der Profit- und Zinsraten und dem Zu- und Abfluss von Anlage suchendem Kapital und stehen damit zumeist im Zentrum von Spekulationsbewegungen. In der Restauration des Kapitalismus in Russland stellte sich insbesondere die Frage, was mit dem großenteils im Staatsbesitz befindlichen Boden und den riesigen Rohstoffquellen passieren sollte.
2.8 Der Staat im Kapitalismus
Die sechste Ebene ist die des Staates. Der bürgerliche Nationalstaat ist zwar nicht der zentrale Akteur im Kapitalismus, wie er es in der bürokratischen Planwirtschaft war, aber wesentlicher Bestandteil der Gesamtreproduktion des Kapitals. Die Durchsetzung einheitlicher Standards und Marktregeln für die vorher genannten Ebenen, insbesondere auch die einheitliche Währung mitsamt Zentralbank sowie nicht vom Privatkapital produzierte notwendige Infrastruktur (z. B. für den Transport), machen den Staat für das Kapital unabdingbar. Damit wird auch die Staatsfinanzierung über Steuern und Abgaben für das Kapital unvermeidlich und führt damit zu einem weiteren Abzug vom Gesamtprofit. Die vorher dargestellten gesellschaftlichen Auseinandersetzungen um die Reproduktionskosten der Ware Arbeitskraft führen auch dazu, dass ein beträchtlicher Teil des „Soziallohns“ über den Staat als politische Form des Ergebnisses von Klassenauseinandersetzungen organisiert wird (Renten-, Arbeitslosen-, Krankenversicherungen, Grundsicherung etc.). Auch ist das Kapital für die Bereitstellung entsprechend qualifizierter Arbeitskräfte auf ein zumeist staatliches Bildungssystem angewiesen. Um alle diese Bereiche gibt es mit dem Kapital natürlich beträchtliche Auseinandersetzungen, da z. B. bei den Renten- und Krankenkassenbeiträgen sehr große Geldmengen bewegt werden, die auch gern von Kapitalmarktakteur:innen verwertet werden würden. Auch sonst ist der Kampf um die Finanzierung der Staatsleistungen im Rahmen der Steuerpolitik natürlich Kerngebiet des Klassenkampfes der Bourgeoisie. Phasen von Verstaatlichung (insbesondere krisengeschüttelter essenzieller Unternehmen) und Privatisierung staatlicher Sektoren gehören auch zum gewöhnlichen Betrieb des bürgerlichen Staates, aber die Privatisierung einer praktisch vollverstaatlichten Ökonomie wie die der ehemaligen Sowjetunion war natürlich eine besondere Situation.
2.9 Anschluss an den kapitalistischen Weltmarkt
Die siebte und letzte Ebene ist die des kapitalistischen Weltmarktes. Die Wertbildung wird hier modifiziert durch Schranken des Arbeitsmarktes (z. B. Migrationsbeschränkungen), der Zoll- und Währungsgrenzen und der unterschiedlichen Entwicklung der verschiedenen bisher dargestellten Ebenen (z. B. Produktivität, Marktregulierung, Besteuerung). Insbesondere die unterschiedliche Verteilung des Kapitals (z. B. Vermögenskonzentration) führt dazu, dass im globalen Kapitalkreislauf diese Unterschiede für die Realisierung von Extraprofiten genutzt werden können. Daher ergibt sich auf globaler Ebene kein Ausgleich der Profitraten zur Durchschnittsprofitrate, oder nur in bestimmten Regionen (z. B. zwischen den imperialistischen Zentren) oder Sektoren. Die sich dadurch ergebende internationale Arbeitsteilung führt zu ungünstigen „Terms of Trade“ für die Ökonomien, die vor allem Rohstoffe oder Produkte mit arbeitsintensiver, geringqualifizierter Arbeit exportieren, zum Vorteil für diejenigen Länder, die kapitalintensive Wirtschaftssektoren (z. B. Technologiemonopole) beheimaten. „Weltmarktpreise“ bedeuten am Ende einen Werttransfer in diejenigen Ökonomien, die im Zentrum der globalen Kapitalakkumulation stehen. Auch wenn sie nur für bestimmte Waren und Dienstleistungen gegenüber lokaler Preisbildung dominieren, so dehnen sich diese Bereiche in der Entwicklung des globalen Kapitalismus immer mehr aus. Eine besondere Form der Weltmarktorientierung stellt der „Extraktivismus“ dar. Dies bedeutet eine große Bedeutung der Erschließung bestimmter Rohstoffquellen für die Handelsbilanz, die Abhängigkeit von den Bewegungen des Weltmarktpreises dieser Rohstoffe und der beständigen (nicht nachhaltigen) Ausdehnung der Abbaugebiete. Insbesondere wenn für diese Erschließung große Kapitalmengen von den „internationalen Kapitalmärkten“ benötigt werden, entsteht eine Abhängigkeitsspirale, die zur Verschuldung führt, sobald die Wachstumsrate der Abbaumengen schwächer – und dieser Abbau kapitalintensiver – wird (siehe Lateinamerika und das Ende des Rohstoffbooms). Dies ist für die Entwicklung der russischen Ökonomie von besonderer Bedeutung, da es seit der Restauration des Kapitalismus einige Indizien für die Wende zu einem „extraktivistischen Akkumulationsmodell“ gibt – allerdings, wie wir sehen werden, mit entscheidenden Unterschieden zum klassischen Extraktivismus des lateinamerikanischen Modells.
3. Schocktherapie und „Washington Consensus“
Die imperialistischen Zentren sind vor allem auch die Hauptakteure auf den internationalen Kapitalmärkten und bei den Kreditinstitutionen. Zu ihrem Kerngeschäft gehört, verschuldete Nationalökonomien zur Durchführung bestimmter wirtschaftspolitischer Maßnahmen zu zwingen und im Gegenzug Kreditpakete zur Verfügung zu stellen. Nach einer berüchtigten Tagung 1990 zur „Entschuldung“ Lateinamerikas wurden die Prinzipien solcher Maßnahmenpakete fortan „Washington Consensus“ genannt, da sie den allgemeinen Konsens von „Wirtschaftsexpert:innen“, IWF und Weltbank in Bezug auf Maßnahmen für „Krisenländer“ bezeichnen. Der „Washington Consensus“ basiert im Wesentlichen auf der neoklassischen Ideologie, nach der Liberalisierung der Märkte, Zurückdrängung des Staates, Privatisierung, restriktive Haushalts- und harte Geldpolitik die „Selbstheilungskräfte des Marktes“ freisetzen würden. Zumeist waren die Resultate dieser Politik aber vor allem ein Ausverkauf der wertvollsten Sektoren der jeweiligen Ökonomien an die großen globalen Konzerne, die Einordnung dieser Ökonomien in die unteren Ebenen der globalen Wertschöpfungsketten und die Absicherung der bestehenden Investments der imperialistischen Zentren. Die „geretteten“ Ökonomien funktionierten dann zwar wieder vor allem im Sinn der imperialistischen Zentren stabil, aber ohne Perspektive auf Verbesserung der sozialen Lage für den Großteil der Bevölkerung, meist sogar mit gravierenden Verschlechterungen. Der „Washington Consensus“ ist insofern bedeutsam, als die „Reformer:innen“ der frühen 1990er Jahre in der Russischen Föderation eben dessen Politik zum Vorbild nahmen. Und eine Reihe der Berater:innen der Jelzin-Regierung gehörte zu den bekannten „Spezialist:innen“ dieser Art von „Heilmittel“: Jeffrey Sachs, Andrei Shleifer u. a. wirkten unmittelbar an den Gesetzgebungsprojekten von Gaidar und Tschubais mit oder überließen die Detailarbeit den dafür extra eingeflogenen Top-Angestellten internationaler Banken. Dass die Aufgaben beim Übergang von einer Planwirtschaft in eine stabile kapitalistische Ökonomie sehr viel komplexer waren, kam ihnen offenbar nicht in den Sinn. Die üblichen Mittel des „Washington Consensus“ führten Russland in eine Katastrophe, die auch letztlich für die versuchte westliche Einflussnahme auf seine weitere Entwicklung negativ verlief.
Wie bereits dargestellt, war für die russischen Radikalreformer:innen die Auflösung der Sowjetunion unumgänglich, um die Einführung einer kapitalistischen Marktwirtschaft in der Russischen Föderation durchzusetzen. So geschah es auch, dass kurz nach der Unterzeichnung der Auflösungserklärung von Belowesch im Dezember 1991 in erstaunlich kurzer Zeit ein Liberalisierungsdekret nach dem anderen implementiert wurde. Jelzin selbst rechnete mit starken Widerständen aus dem „alten Apparat“ und bezeichnete später seine Vorgehensweise mit den Worten: „Die Reformen unumkehrbar zu machen, dieses Ziel setzte ich mir“.[xxiii] Dies paarte sich mit der Grundannahme der „Washington-Consensus“-Berater:innen, dass halbherzige Maßnahmen die Wirksamkeit der „Befreiung der Marktkräfte“ zunichtemachen würden. Heraus kam dabei das, was man später „Schocktherapie“ bezeichnete – sich also keine Zeit für die Marktreformen zu geben oder gar gewisse Abfederungen und Teilschritte vorzusehen, sondern möglichst alles auf einmal umzusetzen. Jelzin erkannte offenbar am klarsten, worum es im Kern bei dieser wahnsinnigen Geschwindigkeit ging: „Die Reformen garantierten den makroökonomischen Umschwung.“[xxiv] Das heißt: die Zerstörung der alten Ökonomie. Die zerstörerische Wirkung dieser Art von „Therapie“ war schon bald zu erkennen – und keineswegs alternativlos, wie die Herangehensweise in China zeigt. Das Problem Jelzins im Unterschied zu China war jedoch, dass die demokratischen Reformen am Ende der Sowjetunion tatsächlich (im Unterschied zu China nach den Ereignissen auf dem „Platz des Himmlischen Friedens“) im Parlament (Volksdeputiertenkongress und „Oberster Sowjet“) breitere Repräsentation verschiedenster politischer Strömungen hervorgebracht hatten. Auch wenn die Mehrheit dieser Strömungen radikale „Marktreformen“ wollte, war ebenso eine breite Opposition gegen soziale Härten solcher Reformen zu erwarten. Tatsächlich wandelten sich ursprünglich engste Mitstreiter:innen Jelzins, wie der Ökonom und Parlamentspräsident Ruslan Chasbulatow, rasch in scharfe Kritiker:innen der Maßnahmen von Gaidar, Tschubais und ihrer westlichen Berater:innen. Chasbulatow, der eine langsame, staatlich regulierte Einführung der Marktwirtschaft vertrat, nannte schon bald nach Beginn der Schocktherapie Gaidar und seine Gefolgschaft „verwirrte Jungs“ und „nicht nur erfolglos, sondern unqualifiziert“.[xxv] Auch wenn Chasbulatow Recht behalten sollte, so setzte sich bekanntlich letztlich die Kamikazestrategie durch und prägte damit die Besonderheiten der Restauration des Kapitalismus in Russland. Die Konsequenzen des Machtkampfes zwischen Jelzin und dem Parlament werden wir weiter unten besprechen. Zunächst geht es also um die Einzelheiten der 1992 auf den Weg gebrachten „Schocktherapie“.
3.1 Die Durchführung der Schocktherapie
Der Plan für „Liberalisierung und Stabilisierung“ wurde bereits bald nach dem Augustputsch durch eine von Jelzin eingesetzte Kommission zur Ausarbeitung einer „Wirtschaftsreformstrategie“ angegangen. Leiter dieser Kommission war Jegor Gaidar, der dabei die schon benannten „internationalen Expert:innen“ zu Rate zog. Auf dem Plenum des Volksdeputiertenkongresses Ende Oktober 1991 stellte Jelzin den Plan vor, der die einzige Chance für wirtschaftliches Überleben sei, zwar am Anfang „Opfer erfordere“, aber schon Ende 1992 käme die Trendwende zum Guten. Der Volksdeputiertenkongress, auch mit Chasbulatow, segnete den Plan ab. Entscheidend aber war, dass Jelzin auf dem Kongress zusätzlich weitreichende Kompetenzen für die Umsetzung des Plans erhielt, sodass die „Radikalreformer:innen“ ohne parlamentarische Kontrolle losstarten konnten. Die meisten ihrer Vorhaben brauchten nur Dekrete des Präsidenten, genauso wie der Präsident praktisch frei war, alle nötigen Posten mit Anhänger:innen der Radikalreform zu besetzen.
Die Überschriften der einzelnen Maßnahmen lesen sich zunächst wie ein übliches Maßnahmenpaket eines Programms im Rahmen des „Washington Consensus“:
- Privatisierung von Staatsbetrieben,
- Preisliberalisierung,
- Reduktion der Staatsausgaben,
- Restriktive Geldpolitik,
- Liberalisierung des Außenhandels.
Das Problem dabei war natürlich, dass nicht wie z. B. in Lateinamerika einige Betriebe zur Privatisierung anstanden oder einzelne Beschränkungen des Außenhandels fallen sollten. Es handelte sich vielmehr um eine Ökonomie, in der fast alle Betriebe in Staatshand lagen und ihre Beziehungen untereinander vom Staat organisiert wurden und auch der Außenhandel über staatliche Institutionen ablief. Hier enthüllt sich auch der ökonomische Sinn der Auflösung der Sowjetunion: Mit ihr wurden auch endgültig die Planbehörde Gosplan (eine Institution der Sowjetunion, nicht der Teilrepubliken) bzw. deren Überreste aufgelöst. Die Betriebe wurden unter die Verwaltung des „Komitees für Staatseigentumsmanagement der Russischen Föderation“ unter Vorsitz von Tschubais gestellt, dessen Aufgabe nicht mehr die Umsetzung des 13. Fünfjahresplans von 1990 war, sondern die Privatisierung der Staatsbetriebe. Ein plötzlicher Rückzug des Staates aus den Aufgaben der Organisierung der zwischenbetrieblichen und Außenbeziehungen musste zu Chaos und Koordinationsproblemen führen. Auch wenn es in der Krisenphase der Planwirtschaft verstärkt zu informellen Marktbeziehungen zwischen einigen Betrieben und auch in den Außenbeziehungen gekommen war, reichte dies bei weitem nicht aus, um den plötzlichen Wegfall der Planbehörden zu ersetzen. Dazu kam, dass die weiter unten dargestellte Schaffung eines neuen Bankensystems und die Geldpolitik der Zentralbank dazu führten, dass die Betriebe nicht über die nötigen Geldmittel oder Bankeinlagen verfügten, um ihre nunmehr zu Waren gewordenen Inputprodukte (Maschinen, Rohstoffe, Halbfertigwaren etc.) und Arbeitskräfte bezahlen zu können. Der plötzliche Wegfall der zentralen Verteilungsmechanismen („Rückzug des Staates zugunsten des Marktes“) führte zu Beginn des Jahres 1992 dazu, dass Betriebe und Konsumhandel ohne Versorgung dastanden und extrem improvisieren mussten (zumeist über direkten Produkthandel oder „anschreiben Lassen“), um einen völligen Zusammenbruch und eine Hungerkatastrophe zu vermeiden.
Insbesondere führten die Preisliberalisierungen nicht dazu, dass „der Markt“ endlich die Anreize setzte, um die Angebotskurve nach oben zu treiben. Die Probleme der Umstellung der Betriebe und das mangelnde Vertrauen in die Zahlungsfähigkeit der Käufer:innen führten im Gegenteil zu einer weiteren Verknappung des Warenangebots und damit zu einer Explosion der Inflation. Bereits am 2.12.1991, am zweiten Tag nach der Auflösung der Sowjetunion, wurden die Verbraucherpreise freigegeben. Nur einige wenige, wie die für Brot, Milch und öffentliche Verkehrsmittel, wurden vorläufig davon ausgenommen. Im Jahr 1992 stiegen sie daraufhin um 2.610 %, die Preise für Industrieprodukte um 3.380 %, Transporttarife um 3.560 %, Baukosten um 1.610 % und die Preise für Agrarprodukte um 940 %.[xxvi] Dies drückt nicht nur einen gewaltigen Einbruch in der Wirtschaftstätigkeit aus, sondern hatte auch eine Umverteilung zugunsten derer zur Folge, die noch etwas zu verkaufen hatten. Insbesondere die nunmehr Lohnabhängigen konnten von ihren Nominallöhnen kaum noch leben, verloren ihre Ersparnisse und mussten sich zumeist um Zusatzeinkünfte bemühen. Zusätzlich begannen die Betriebe sofort, die bisher bestehenden sozialen Einrichtungen (z. B. Betriebskindergärten, Urlaubsorganisation etc.) zu kürzen, so wie auch der Staat Sozialleistungen zurückfuhr. Letzteres traf besonders die Rentner:innen und das entstehende Arbeitslosenheer. Ebenso wurden Ausgaben für das staatliche Bildungs- und Gesundheitssystem drastisch zurückgefahren. Im Januar 1992 wurden zwar die Renten, Stipendien und andere Sozialleistungen pauschal um 60 % erhöht, angesichts der Höhe der Inflation war dies real jedoch eine gewaltige Kürzung. Denn nach diesem Akt wurden die Sozialleistungen an die Regionen ausgegliedert, die sich künftig um die Finanzierung kümmern sollten. Allerdings waren deren Finanzquellen äußerst ungewiss. So sollten etwa künftige Umsatzsteuern und Privatisierungserlöse dafür verwendet werden. Der Umbau des Staates führte zur Entlassung von Staatsbediensteten im Bereich der Unions- und Planbürokratie, aber auch der regionalen Sowjetbürokratien. Viele davon fanden aber auch wieder Anstellung in neuen Regierungsbehörden und Regionalverwaltungen. Außerdem wurde von der Regierung ein Programm zur „Optimierung“ der angeblich geringen Produktivität in Bildungs-, Gesundheits- und Kulturinstitutionen aufgelegt. In Wirklichkeit war dies ein Programm von drastischen Einsparungen und Entlassungen.
3.2 Umgestaltung der Arbeiter:innenklasse und Herausbildung eines Arbeitsmarktes
Auch wenn einige dieser Maßnahmen durch die politischen Auseinandersetzungen mit dem Parlament etwas abgemildert wurden, blieben die Auswirkungen der Phase von Hyperinflation und Wirtschaftsstagnation auf die unteren Schichten der Bevölkerung verheerend. Was auch immer die Absicht der Radikalreformer:innen gewesen sein mag, das Resultat war nicht „Wohlstand für alle, die Eigeninitiative ergreifen“, sondern die Schaffung einer Masse ausbeutbarer Lohnabhängiger, ein typisches Element der „ursprünglichen Akkumulation“ des Kapitals. Der weitere Krisenverlauf der 1990er Jahre schuf eine Sozialstruktur, die bis heute im Wesentlichen in Russland erhalten ist: Etwa 20 % der russischen Bevölkerung (immerhin 30 Millionen) lebten unter extremer Armut. Auf der anderen Seite der Skala waren es etwa auch nur 20 % der Bevölkerung, die von der Veränderung tatsächlich profitiert haben: eine im Vergleich zum westlichen Kapitalismus kleine Mittelschicht und eine extrem reiche Oberschicht, auf deren Entstehung wir gleich kommen werden. Die spürbaren, aber vergleichsweise geringen sozialen Unterschiede zwischen der arbeitenden Bevölkerung und den Top-Leveln der Bürokratie wurden also in wenigen Jahren der „Reform“ in eine kapitalismustypische Klassenspaltung umgewandelt. Auffällig nur, dass die Unterschiede zwischen Arm und Reich noch drastischer und die Mittelschichten kleiner als „im Westen“ sind. Am deutlichsten wird dies beim Gini-Koeffizienten, der heute in Russland in Bezug auf die Einkommensverteilung bei 36 % liegt, etwa zwischen Deutschland mit 31 % und den besonders inegalitären USA mit 39,7 %. Dabei verdienen die oberen 10 % in Russland 10-mal mehr als die unteren 10 % (in Deutschland ist die Verhältniszahl 7), während die folgenden 10 % offenbar in Russland weniger gut verdienen als die z. B. in Deutschland.
Parallel zur Schaffung von Unterschichten, Unsicherheit an den Arbeitsplätzen und Reallohnverlusten wurde auch das Arbeitsrecht „reformiert“. Auch wenn die Betriebe zunächst überraschenderweise ihre Beschäftigten behielten, so wirkte die Drohung des Arbeitsplatzverlustes und das damit verbundene sichere soziale Elend stark genug, dass die Beschäftigten Verschlechterungen ihrer allgemeinen Arbeitssituation und der Rechte am Arbeitsplatz hinnahmen. Die aus der Reformperiode 1990/1991 stammenden Arbeitsgesetzgebungen hatten allerdings noch starke Elemente einer Orientierung an der „sozialen Marktwirtschaft“ und entsprechende soziale Komponenten (Kündigungsschutz, Mindestlohn, allgemeine Höchstgrenze 40-Stundenwoche, Entgeltfortzahlung etc.). Auch gab es die damals oft genutzte Möglichkeit, den Arbeitsplatz zu behalten, aber die Stunden stark zu reduzieren (allerdings ohne Kurzarbeiter:innengeld).
Dies setzte den Radikalreformer:innen 1992 gewisse Grenzen der betrieblichen Umgestaltung. Im September 1992 wurde schließlich ein neues Arbeitsgesetzbuch verabschiedet, das zwar im Sinne des Kapitals bestimmte Erleichterungen brachte, aber die Beschäftigten nicht rechtlos ließ. So gab es ein Recht mit Kündigungsfristen, das Kündigungen nur aus bestimmten Gründen zuließ, unter anderem aber auch betriebsbedingte ermöglichte. Aber Beschränkungen der Arbeitszeit, der Befristung von Arbeitsverträgen, Unterwerfung der individuellen Arbeitsverträge unter Kollektivverträge, Schranken für Lohndrückerei durch Mindestlöhne etc. wurden in das seither geltende Arbeitsrecht eingeführt. Hier wurde der Einfluss des noch demokratisch bestimmten Parlaments gegenüber den Radikalreformer:innen deutlich.
Die Folgen der Reformen führten auch zu einer sofortigen Zunahme von Streiks und Demonstrationen während der Arbeitszeit. 1992 betraf dies besonders den Bildungs- und Gesundheitsbereich. Im Oktober nahmen etwa eine Million Beschäftigte an Demonstrationen gegen die Reformen teil. im Gesundheitsbereich gab es Hungerstreiks, im Schul- und Hochschulbereich landesweite Warnstreiks etc. Insgesamt kam es in mehr als 6 Millionen Betrieben zu Streikaktionen.[xxvii] In den folgenden Jahren breiteten sich die Streiks auf alle Wirtschaftssektoren aus und nahmen an Dauer zu. Lag die durchschnittliche Streikdauer 1993 noch bei zwei Tagen, so war sie 1997 auf 6,8 Tage je Beschäftigten gestiegen. Die Kampfaktionen richteten sich auch immer wieder gegen die oft viele Monate zählenden Lohnrückstände. Es beteiligten sich praktisch alle Industriebranchen, Dienstleistungsbereiche und auch die Verwaltung. Die lange zögernden Metallarbeiter:innen verloren 1996 die Geduld. Innerhalb eines Jahres verdreifachte sich die Zahl der Streikenden. Es ist richtig, dass während der Stabilisierung ab 2000 die Streikzahlen zurückgingen. Entscheidend war aber die neoliberale Arbeitsrechtreform, die erst unter Putin 2002 umgesetzt wurde. Durch sie wurden derartige Bedingungen an Streiks gestellt und auch rechtlich/polizeilich durchgesetzt, dass danach die Streikzahlen fast auf null sanken. D. h., das neoliberale Marktparadies, das in der Phase Gaidar & Co. noch auf gewisse Grenzen des Widerstands von unten traf, wurde erst so richtig unter Putin Realität.
Eine wichtige Rolle bei dieser Transformation spielten natürlich die Gewerkschaften. Der größte Dachverband, die FNPR („Föderation der unabhängigen Gewerkschaften“) ist letztlich aus den Staatsgewerkschaften hervorgegangen, die sich in den Betrieben hauptsächlich um soziale Angelegenheiten und Konfliktschlichtung mit dem Management gekümmert hatten. Mit den heftigen Konflikten der Marktreformen waren sie schlicht überfordert, aber kümmerten sich rasch um neuerliche „Zusammenarbeit“ mit den nunmehrigen Machthaber:innen in Politik und Wirtschaft. Es ist kein Wunder, dass die meisten führenden Funktionär:innen der FNPR heute auch Mitglieder der Putin-Partei sind, so wie sie sich schon vorher in die politischen Unterstützungsorgane Jelzins gedrängt hatten. Dem widerspricht nicht, dass sie sich an die Spitze der Streiks und Demonstrationen setzten, um sich als „Verhandler:innen“ anzubieten. Das hatte vor allem damit zu tun, dass die Mitglieder oder Basisorganisationen regelmäßig in Konflikt mit der Führung kamen und sie zu weitergehenden Stellungnahmen zwangen, was sich insbesondere im Konflikt Jelzins mit dem Parlament zuspitzte. Insofern bekamen auch von der FNPR unabhängige Dachverbände wie die VKT (Allrussische Konföderation der Arbeit) breiteren Zulauf. Dessen Mitgliedergewerkschaften entstanden insbesondere in den oben geschilderten Protesten der Bergarbeiter:innen Ende der 1980er Jahre. Durch den antibürokratischen Kampf und den letztlichen Mangel an einer politischen Alternativkonzeption waren diese Gewerkschaften Anfang der 1990er Jahre stark antikommunistisch orientiert und verbanden sich politisch mit den Parteien der Radikalreformer:innen wie der „Demokratischen Wahl Russlands“. Deren tatsächliche Privatisierungspolitik führte allerdings rasch zum Bruch dieses widersinnigen Bündnisses. Seitdem sind die Gewerkschaften der VKT eher radikaler als die FNPR, bereit zur Zusammenarbeit mit sozialen Bewegungen, aber aufgrund ihrer Geschichte kritisch gegenüber jeglicher Verbindung mit politischen Parteien. 2010 ging die VKT in die „Konföderation der Arbeit in Russland“ (KTR) auf, um dem wachsenden Druck des neoliberalen Putin-Regimes besser widerstehen zu können. Offiziell sind die russischen Gewerkschaften mit 27 (FNPR) und 2 (KTR) Millionen Mitgliedern starke Organisationen. Durch die Begrenzungen insbesondere des Streikrechts und oftmalige Aktionen des Staates (z. B. Verbot bestimmter Teilgewerkschaften) sind sie jedoch spätestens seit 2002 stark in ihrer Wirkung eingeschränkt.
Dennoch entwickelten sich noch weitere kämpferische Gewerkschaften. Ein Beispiel: Eine der Mitgliedsgewerkschaften der KTR ist die MPRA (Internationale Gewerkschaft Arbeiter:innen-Allianz,[xxviii] die als kämpferische Organisation in der transnationalen Automobilindustrie (Ford, VW, Benteler) aktiv ist. Seit ihrer Gründung im Jahr 2006 hat sie sich durch militante Streiks ihren Platz erkämpft. Ihre Führer:innen sind immer wieder der Repression durch Staatsorgane, lokale Verwaltung, Securitytrupps und nicht identifizierbare Schläger:innen ausgesetzt. Einige der Anführer:innen haben sozialistische und kommunistische Einstellungen.
Im Jahr 2018 wurde der MPRA von einem Petersburger Gericht die Anerkennung entzogen, mit der Begründung, sie habe Gelder aus dem Ausland bezogen, was nach dem russischen NGO-Gesetz strafbar ist. Damit erweist sich dieses als genau die Handhabe, die zahlreiche Kritiker:innen im eigenen Land als Gefahr sahen: als Möglichkeit, jedwede politische und soziale Aktivität als eine Art Agent:innentätigkeit zu denunzieren – und zu verbieten.
Weitere kämpferische Gewerkschaften waren neben der MPRA bis in die 2010er Jahre hinein die Interregionale Gewerkschaft der Pädagog:innen, die Interregionale Gewerkschaft Nowoprof und die Interregionale Gewerkschaft von Gesundheitsarbeiter:innen Dejstwije (Aktion).[xxix]
Ferner gab es Versuche, eine Gewerkschaft der Arbeitsmigrant:innen aufzubauen, die sich besonders gegen die Rechtlosigkeit der Migrant:innen aus Zentralasien wandte. Von allen genannten Gewerkschaften ist nur noch die Seite der Pädagog:innen erreichbar: www.pedagog-prof.org.
Das Resultat dieser Veränderungen der Arbeitsbedingungen, der Preisliberalisierung und der Regulierung der Arbeitskonflikte war nach der Stabilisierung etwa um 2000, dass ein für das Kapital sehr günstiger interner Arbeitsmarkt von etwa 73 Millionen herausgebildet worden war (der 8-größte Arbeitsmarkt der Welt). Der durchschnittliche Lohn reichte nach Erhebungen[xxx] aus dem Jahre 2006 für etwa 90 % der im Produktionsbereich Beschäftigten gerade mal dafür, die grundsätzlichen Bedürfnisse in Bezug auf Lebensmittel und Kleidung zu befriedigen. Dabei liegen die Löhne für Frauen wiederum um 40 % unterhalb derjenigen der Männer. Ebenso gibt es starke regionale Gefälle. Nur in bestimmten Bereichen wie dem Energie- oder IT-Sektor gibt es eine „Arbeiter:innenaristokratie“, die deutlich besser bezahlt ist. Der Masse der Produktionsarbeiter:innen ging es schlechter als zu Sowjetzeiten, und daran hat sich seit 2006 nichts geändert.
Für das Jahr 2000 wurde der Durchschnittsmonatslohn mit Kaufkraftparität und versteckten Lohnbestandteilen (Subventionen, betriebliche Leistungen, Sozialversicherungszahlungen durch Arbeit„geber“:innen etc.) auf US-Dollarbasis umgerechnet mit 320 bis 420 US-Dollar berechnet. Dies lag zu diesem Zeitpunkt etwas höher als der Verdienst in Mexiko oder Polen.[xxxi] Zusammen mit einer Lohnquote von 47 % zeigt sich, dass die Ausbeutung der Arbeiter:innen in Russland zwar hoch, aber in den meisten Halbkolonien noch stärker ausgeprägt ist. Wichtig für den russischen Arbeitsmarkt ist noch dazu ein relativ hohes Ausbildungsniveau. So ist die berufliche Ausbildung sicher nicht viel schlechter als in Deutschland, während die Hochschulen eine große Zahl Spezialist:innen hervorbringen. Die Migrationsstatistiken zeigen allerdings, dass gerade in den höheren Qualifikationskategorien seit den 1990er Jahren ein Nettoverlust durch Auswanderung stattfand (der nur teilweise durch Rückwanderung vieler Russischsprachiger aus ehemaligen Sowjetrepubliken kompensiert wurde). Im Niedriglohnbereich fand dagegen ein Nettozuzug, insbesondere aus asiatischen ehemaligen Sowjetrepubliken, statt. Insgesamt ist das Qualifikationsniveau im Arbeitskräfteangebot für das russische Kapital jedenfalls vorteilhaft (das hat sich erst mit dem Beginn des Ukrainekrieges durch starke Abwanderung von Fachkräften verändert).
3.3 Die Schaffung der russischen Kapitalist:innenklasse
Die Schaffung dieses großen Reservoirs an Lohnabhängigen mit günstigen Ausbeutungsbedingungen für das Kapital ist die eine Seite der Restauration des Kapitalismus. Ebenso wie dies ein mehr oder weniger unbewusstes Resultat der Reformpolitik war, gab es von dieser auch keinen konkreten Plan für die andere entscheidende Seite der Restauration des Kapitalismus: die Schaffung der Kapitalist:innenklasse selbst und die Hervorbringung großer verwertungsfähiger Kapitale aus den kriselnden Elementen der Planökonomie. Nach der neoklassischen „Lehre“ gibt es ja gar keine Kapitalist:innen, sondern nur besonders unternehmerische und initiativreiche Marktteilnehmer:innen bzw. Eigentümer:innen von Anteilen am „knappen Gut“ Kapital, die für dessen Einsatz ihre entsprechende Entlohnung bekämen. Der wohl deutlichste Ausdruck für den Glauben an diese unsinnige Ideologie des Liberalismus war in Russland die sogenannte „Voucherprivatisierung“. Danach sollte sich praktisch jede/r Bürger:in der Russischen Föderation in eine/n Shareholder:in am bisherigen Staatseigentum umwandeln.
In der ersten Privatisierungswelle 1992 wurden tatsächlich 20.000-25.000 Groß- und Mittelbetriebe aus dem Staatseigentum unter dem Titel „Voucherprivatisierung“ verkauft. Tatsächlich wurden jedoch jeweils nur 40 % der Anteile an die jeweiligen Belegschaften vergeben. Davon wiederum waren 25 % nicht handelbar und nur eine Art Beteiligung an den (zumeist nicht vorhandenen) Gewinnen (Dividenden) der Unternehmen. 60 % verblieben entweder bei der staatlichen Treuhandverwaltung oder wurden direkt an „Investor:innen“ verkauft. Da die Belegschaften wenig mit den Vouchern anfangen konnten, landeten auch diese (sofern verkaufbar) letztlich bei den „Investor:innen“. Von der berühmten „Umwandlung der Sowjetarbeiter:innen in Voucherkapitalist:innen“-Masche blieb also außer dem ideologischen Klimbim und kleinen Konsumerlebnissen aus dem Voucherverkauf nicht viel übrig.
Woher kamen also die „Investor:innen“? Viele Untersuchungen[xxxii] der ersten Privatisierungswelle 1992–1994 bezeichneten die Resultate dieser Eigentumswechsel als „Insiderprivatisierung“. D. h., viele der betroffenen Betriebe standen danach de facto unter Kontrolle der ehemaligen Betriebsleiter:innen oder Spitzen der alten Planungsbürokratie.
Das bekannteste Beispiel ist sicher Wagit Alegperow: Als ehemaliger Vizeminister für die Öl- und Gasindustrie wurde er langjähriger Vorsitzender des größten russischen Privatkonzerns Lukoil (bis heute einer der größten Ölkonzerne der Welt). Nach dem Vorbild von BP strukturierte der ehemalige Sowjetbürokrat mehrere Betriebe im Öl- und Gasbereich so um, dass ein integrierter Konzern für Erschließung, Verarbeitung und Vertrieb herauskam (in der Sowjetunion waren diese Bereiche streng getrennt), der mit ExxonMobil oder Shell auf Augenhöhe konkurrieren konnte. Lukoil wurde 1993 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt (die Schaffung des Konzerns geschah noch unter dem Minister Alegperow), an der Alegperow 2002 über 10,4 % der Anteile besaß (die er später auf über 20 % ausbaute). Das Unternehmen ist zwar mehrheitlich in Streubesitz, das Management besitzt jedoch genug Anteile, um den Konzern als Ganzes zu kontrollieren.
Auf ähnliche Weise entstand auch der Yukos-Konzern – auch sein „Hauptakteur“ Michail Chodorkowski kam aus dem Öl- und Energieministerium (wenn auch erst in der Jelzin-Ära). Es waren also nur bestimmte Anteile notwendig, aber vor allem wichtig war das Insiderwissen über die internen Entscheidungsstrukturen in den Betrieben und Ministerien sowie über die Beziehungen zwischen den Betrieben. In der Umbruchsituation waren darüber hinaus Beziehungen zu den Reformer:innen wichtig, vor allem um zu wissen, welche Regeln und Bestimmungen gerade abgeschafft oder neu geschaffen wurden. Wie Dsarassow beschreibt, ging das Netzwerk informeller Kontrolle eines Teils der managerialen Bürokratie ziemlich nahtlos in die Schaffung der russischen Kapitalist:innen über. Wie schon erwähnt, entwickelte sich dieses Netzwerk in Absprachen zwischen den Betrieben außerhalb des Gosplans. Hier kam den verwirrenden Strukturen der Planbürokratie eine wichtige Rolle für ihre eigene Aushöhlung zu: Als Vermittlungsorgan zwischen zentralem Plan und den Einzelbetrieben spielten die Spezialministerien, wie z. B. das für Öl und Energie, eine immer wichtigere Rolle. Diese übernahmen für viele Betriebe die Rolle der Bestimmung des Inputbedarfs und der möglichen Zusammenarbeit mit anderen Betrieben. Zwischen Betriebsleitungen und Ministerien entwickelten sich „nützliche“ Verbindungen in mehrfacher Hinsicht (auch unter Einschluss der Korruption). In den Ministerien war auch das Wissen über die tatsächliche Lage in den Betrieben, über ihre optimale Zusammenfassung zu auch marktwirtschaftlich konkurrenzfähigen Konzernen und über die vor Ort wichtigen Akteur:innen konzentriert. Was noch fehlte, war insbesondere das Kapital, das für den Erwerb der Anteile notwendig war. Allerdings reichen für eine Insiderprivatisierung ein paar Prozentpunkte an den Anteilen aus, wenn der Rest sich dann in Streubesitz befindet.
Dazu kommt, dass nachträgliche Untersuchungen der Anteilsverkäufe aus dieser Zeit zeigen, dass die offensichtlich gezielt ausgewählten Käufer:innen der Anteile unglaublich günstige Bedingungen bekamen. D. h., die mehr oder weniger fingierten Auktionen führten dazu, dass die Marktkapitalisierung der betroffenen Unternehmen lächerlich gering veranschlagt wurde und auf diese Weise die ausgewählten Bieter:innen die Anteile weit unter Marktwert erwerben konnten (wie z. B. Abramowitsch später zugab, waren die Bestechungsgelder, die hier flossen, fasst das Teuerste). Ein Beispiel dafür ist die „Eastern Oil Company“, ein Konglomerat um die sehr ertragreichen Öl- und Gasfelder von Tomsk bis Tjumen. Als der Verkaufspreis der Tjumen-Ölgesellschaft (heute Teil von Rosneft) bestimmt wurde, wurden die Öl- und Gasreserven schlicht „vergessen“ (im Wert von 920 Millionen US-Dollar). Die etwa 8 % der Anteile, die dann verkauft wurden, wurden für etwa 48 Millionen US-Dollar verkauft, während der wirkliche Preis bei 358 Millionen gelegen hätte. 1997 wurde sie dann in Yukos eingegliedert – womit eine lange Geschichte der Aufspaltungen und Übernahmen begann.
Ein anderer typischer Zug der Insiderprivatisierung war, dass Direktor:innen von Betrieben, die zur Privatisierung ausgeschrieben waren, die wertvollsten Produktionsmittel in eigene, neu geschaffene Unternehmen transferierten. Die neuen Eigentümer:innen erhielten dann besseren Schrott. Nach der Abwicklung und Ausschlachtung dieses Altbetriebs konnte dann der/die vormalige Direktor:in das geschrumpfte und profitabel gemachte Unternehmen, mitsamt der alten Geschäftsbeziehungen, fortführen. Eine 5-stellige Zahl von solchen „Regelverstößen“ wurde angezeigt – die meisten Klagen blieben jedoch ohne Folgen.
Eines ist deutlich: Bei der Schaffung eines der wichtigsten Märkte für eine kapitalistische Marktwirtschaft, des Kapitalmarktes, verabsäumten die Radikalreformer:innen die Schaffung notwendiger Regularien und unabhängiger Instanzen. So musste die ursprüngliche Kapitalbildung vornehmlich durch Regelbruch und kriminelle Energie vonstattengehen. Wie Marx im Kapitel „Die ursprüngliche Akkumulation“ in „Das Kapital“ feststellt, pflegt die bürgerliche Wirtschaftsgeschichte zur Erklärung der Anfangsbedingungen der Kapitalakkumulation zumeist das idyllische Märchen zu erzählen von den fleißigen, nur mit guten Ideen ausgestatteten Freiheitsaposteln des Unternehmertums, die sich ihre „erste Million“ durch harte, entbehrungsreiche Arbeit verdienen: „In der wirklichen Geschichte spielen bekanntlich Eroberung, Unterjochung, Raubmord, kurz Gewalt die große Rolle“.[xxxiii] Wie Chodorkowski später bemerkte, waren er und seine erfolgreichen Co-Kapitalist:innen „alles Räuberhauptleute“.
3.4 Die Schaffung des Kapitalmarkts
Auch wenn die Privatisierung zu sehr günstigen Preisen vonstattenging – woher kam dann das trotzdem noch notwendige Geld?
Dies ist eine Frage, die für Zeiten der Hyperinflation gar nicht so leicht zu beantworten ist –, irgendwelche vorhandenen Vermögen in Rubel waren ja innerhalb kurzer Zeit sehr viel weniger wert. Ein ganz wichtiger Faktor für die ursprüngliche Geldbeschaffung war daher die Liberalisierung des Außenhandels. Gleich zu ihrem Beginn wurden Lizenzen vergeben für „spezialisierte Firmen“ des Im- und Exports, die beträchtliche Devisenreserven anlegen konnten, um ihre Geschäfte zu finanzieren. Auch hier wieder waren die Regeln für die Vergabe dieser Lizenzen undurchsichtig, ebenso wie die Aufsicht über das Geschäftsgebaren dieser „Spezialfirmen“ eher wenig ausgeprägt war. Ein bekanntes Beispiel ist Pjotr Awen, bis heute einer der großen „Oligarchen“. Als Studienfreund von Gaidar hatte er kein Problem, zusammen mit seinem Partner Michail Fridman eine Lizenz für den Erdölexport zu bekommen. Im Gegenzug wurde eine große Masse westlicher Konsumgüter importiert. Dies war der Beginn eines der bis heute größten privaten Industrie- und Finanzkonzerne Russlands, der „Alfa Group“. Ein anderes Beispiel sind die beiden Oligarchen Witali Malkin und Bidsina Iwanischwili (der heute in den Ereignissen in Georgien eine zentrale Rolle spielt): Sie machten ihre „erste Million“ (US-Dollar) mit dem Handel von Computern, Videorekordern und Telefonen (gegen Agrargüter). Während der ersten Privatisierungswelle stieg ihre Gruppe dann ins Rohstoffgeschäft (vor allem Metalle) ein.
Auch im Außenhandel bereicherten sich Teile von Bürokratie und neu entstehender Bourgeoisie auf kriminelle Weise. Verschiedenen Schätzungen zufolge wurden im Zeitraum von 1992–1994 etwa 20 % der russischen Erdöl- und ein Drittel der Metallvorräte außer Landes geschmuggelt. Zur Drehscheibe des Schmuggels entwickelte sich dabei das Baltikum, das aufgrund seiner offenen Grenzen zu Russland und der EU eine ideale Drehscheibe darstellte. So wurde etwa Estland, ein Land vollkommen ohne eigene Metallvorkommen, im Jahr 1992 zum 5-größten Kupferexporteur auf dem Weltmarkt.[xxxiv]
Außer diesen Segmenten der unmittelbaren Bereicherung muss noch die Frage der Schattenwirtschaft behandelt werden. Schon zu Sowjetzeiten wurde eine Vielzahl von Geschäften und Dienstleistungen jenseits der offiziellen Wege abgewickelt. Nicht zuletzt Warenmangel, Fehlen bestimmter Luxusgüter und schlecht bezahlte bürokratische Machtpositionen waren eine Verlockung für das Wechselspiel aus Korruption und Schwarzmarkt. Es wird geschätzt, dass der Anteil der Beschäftigten in der Schattenwirtschaft von 1960 von weniger als 10 % bis 1989 auf etwa 25 % stieg. Zusammen mit den neuen Handelsgesellschaften erschlossen sich dann Anfang der 1990er Jahre natürlich neue Möglichkeiten.
Hierzu kam, dass auch der kriminelle Sektor wuchs, der in verschiedensten „Geschäftsbereichen“ aktiv wurde. Der illegale Waffenhandel war dabei das lukrativste Geschäft. Mit der zeitweisen Schwäche des Staates wuchsen aber auch Schutzgelderpressung, Prostitution, illegales Glückspiel etc. Ein bekanntes Beispiel ist die Solnzewo-Bruderschaft, benannt nach einem Moskauer Stadtteil, gegründet um den Hotelkellner Sergei Michailow. Er begann mit Fitnessklubs, in denen er seine Schlägertrupps rekrutierte, um später mit Schutzgelderpressung, Kontrolle über Taxiunternehmen, die Moskauer Casinos etc. Millionen zu verdienen. Michailow wurde mehrfach von russischen und internationalen Anti-Mafia-Staatsanwaltschaften verfolgt und saß in mehreren Gefängnissen, um am Ende immer freigesprochen zu werden. 2017 hat sich auch Nawalny mit ihm angelegt, viele der „Unfälle“ und Giftanschläge auf dem gegenwärtigen Regime unliebsame Personen werden wohl von Teilen der Mafia verübt. Auch gibt es zwischen dem Staats- und Sicherheitsapparat und der Mafia wohl diverse Verbindungen und wechselseitige „Geschäfte“.
Die Geschäftemacherei mit der Verscherbelung von Staatseigentum und Spekulationsgewinnen im Außenhandel, angesichts der Inflation im eigenen Land, erklärt das Zustandekommen größerer Vermögen innerhalb relativ kurzer Zeit. Um diese in den Privatisierungswellen zur Unternehmensübernahme einzusetzen, fehlte noch ein Baustein, der kriminellste von allen: die Banken. Die Entstehung von Privatbanken und ihre „speziellen“ Eigentümer:innen waren der berühmte „Finanzhebel“, um mit in Bezug auf die Größe der Unternehmen geringen Mitteln große Kapitalgruppen aufzubauen.
In der Sowjetunion gab es eigentlich nur drei große Banken: die Zentralbank (Gosbank), eine Geschäftsbank für private Ersparnisse (Sberbank; Teil des staatlichen Sparkassensystems) und eine Außenhandelsbank (VTB; auch als Vneschtorgbank bekannt). In den 1980er Jahren kamen noch „Spezialbanken“ für Industrie und Bauwesen (Promstroj), Agrarwirtschaft (Agroprom) und Wohnungsbau, kommunale Dienstleistungen und Entwicklung (Zhilsots) hinzu. Auch einige große Industriebetriebe gründeten eigene Banken. Besonders langfristig wirksam: die Gazprombank. Alle dieser Banken wurden mit dem Beginn der Radikalreformen sofort in Aktiengesellschaften umgewandelt. Aus Banken wie der Promstroj oder VTB kamen einige Manager:innen, die sofort zu zentralen Playern in den folgenden Gründungen von Kapitalgesellschaften wurden. Denn genauso intransparent und chaotisch wie die Vergabe von Lizenzen für den Außenhandel wurden schon ab 1992 die Rechte für die Gründung privater Banken vergeben. Bis 1995 entstanden auf diese Weise bis zu 2.500 neue Banken.
Eine Bank zu besitzen, verschaffte natürlich den Vorteil, relativ einfachen Zugang zu Krediten der Zentralbank zu erhalten. Noch dazu, da diese durch die Wirtschaftsreformpläne dazu gezwungen war, diese mit Zinsraten unterhalb der Inflationsrate zu vergeben, was also an sich für diese Banken schon Spekulationsgewinne versprach. Um dann aber die Inflation zu bekämpfen und ihr Defizit zu verringern, gab die Regierung kurzfristige Anleihen (GKO) mit sehr hohen Zinsen aus: ein weiterer Spekulationsgewinn für die neuen Banken. Zusätzlich führte das aber auch zu der schon besprochenen Geldknappheit bei denjenigen Unternehmen, die sich noch nicht im Umfeld der sich neu bildenden Kapitalgruppen befanden, denn diese kamen praktisch kaum an Kredite für die Finanzierung ihrer Geschäfte heran. 1993 fiel das Verhältnis von Geldmenge zum Umfang des Warenhandels auf unter 1:20 (zum Vergleich: Für Volkswirtschaften wie die USA wird ein Verhältnis von Umlaufgeldmenge (M1) zu BIP von 1:2 für normal gehalten). Dies war ein wesentlicher Grund dafür, dass 1994 zwar die Inflation zurückging, gleichzeitig aber der Output der Unternehmen katastrophal einbrach. Damit war die Grundlage dafür gelegt, dass viele dieser Betriebe praktisch vor dem Bankrott standen und reif für die Übernahme durch die in den Banken organisierten größeren Kapitale waren. Dies ist der Hintergrund für die eigentlich entscheidende zweite Privatisierungswelle 1995–1997.
3.5 Wer waren also die entstehenden neuen Kapitalgruppen?
Der schon erwähnte Michail Chodorkowski war auch einer der Gründer der Menatep-Bank. Durch Spekulationsgewinne, Geldwäsche und Organisierung von Steuerbetrug konnte Chodorkowskis Menateb-Beteiligungsgruppe genug Kapital sammeln, um 1995 bei der Auktion des staatlichen Yukoskonzerns (bei dessen Zustandekommen Chodorkowski ja im Öl- und Energieministerium noch selbst mitgewirkt hatte) dessen entscheidender Anteilseigner zu werden.
Wladimir Winogradow war als Chefökonom der staatlichen Promstroj-Bank in einer günstigen Position, um schon 1990 die Moskauer Inkombank zu gründen. Sie sollte in den 1990er Jahren in allen großen Deals eine Rolle spielen und Winogradow zu einem der wichtigsten Unterstützer Jelzins machen. Neben den üblichen gewinnbringenden Aktivitäten der Reformjahre gelang es Winogradow als einem der wenigen russischen Banker auch, größere Mengen „westlichen“ Risikokapitals anzuziehen und so seinen Spielraum noch um einiges auszudehnen. Doch dies und die Tatsache, dass er zu viele GKOs zu lange behielt, führte letztlich zum Bankrott in der 1998er Krise und damit auch zum Ende seines Aufstiegs. Bis dahin konnte er aber wichtige Anteile nicht nur im Ölgeschäft, sondern vor allem im militärisch-industriellen Komplex erwerben (z. B. den Flugzeugbauer Suchoi).
Die schon erwähnte Alfa-Gruppe um Fridman und Awen basierte nicht nur auf der beschriebenen Außenhandelsgesellschaft, sondern gründete schon 1990 die Alfa-Bank, bis heute die größte private Geschäftsbank in Russland. Auch die Alfa Group, mit dieser Bank als Plattform, erlangte ein beachtliches Beteiligungsportfolio in der Ölindustrie (TNK; Tjumenskaja Neftjanaja Kompanija oder Tjumen Oil Company), in der Telekommunikation und in internationalen Beteiligungen (z. B. E.ON). 1998 hatte die Alpha-Bank interessanterweise rechtzeitig die GKOs verkauft und konnte die Bankenkrise durch den Wert ihrer Beteiligungen im Ölgeschäft überleben. Awen ist bis heute ein wichtiger „Berater“ Putins. Trotzdem hat der EU-Gerichtshof bezeichnenderweise erst kürzlich Awen und Fridman von der EU-Sanktionsliste gestrichen (eine Verbindung zum Angriffskrieg gegen die Ukraine könne nicht nachgewiesen werden).
Wladimir Potanin ist auch ein ehemaliger Staatsbanker, der in den 1990er Jahren mit Außenhandels- und Devisengeschäften genug Geld gesammelt hatte, um die Interros-Holding zu gründen, zu der eine Bank für Import-/Export-Geschäfte (ONEKSIM-Bank) gehörte. Potanin ist auch heute noch einer der reichsten Menschen in Russland. Die Beteiligungen der Interros reichen von Telekommunikation bis hin zu einem der profitabelsten russischen Rohstoffkonzerne: Norilsk Nickel (Nornickel). Dies ist der weltgrößte Produzent von aufbereitetem Nickel (die Gewinnung aus den Erzen ist sehr aufwendig und macht es auf dem Weltmarkt sehr teuer), der elftgrößte Kupferproduzent und weltweit führend in einer Reihe weiterer seltenerer Metalle aus den Weiten Sibiriens. Das Unternehmen konnte von Interros aufgrund eines Schulden-gegen-Anteile-Deals kontrollierend übernommen werden, wurde „umstrukturiert“ und ist seit 1997 ein hochprofitabler Konzern. Außerdem versteht sich Potanin offenbar auf Umgehung von Sanktionen (Irangeschäfte) und Deals mit China. Er nimmt diese herausragende Rolle im russischen Kapitalismus ein, obwohl er zentral an einer der wohl größten Raubaktionen in den turbulenten 1990er Jahren beteiligt war: dem Shares-for-loans-Deal im Jahr 1995 zwischen dem russischen Staat und einer Bankengruppe. Dabei wurden für einen Kredit an den Staat Anteile an den wertvollsten verbliebenen Staatsunternehmen als Sicherheiten hinterlegt, und der Staat konnte dann „überraschenderweise“ die Kreditforderungen nicht erfüllen. Damit war die Etablierung der „Oligarch;innenen“-Kapitalgruppen endgültig Realität. Zu allem Hohn war Potanin, „Chef der Räuberbande“, 1996–1997 auch noch stellvertretender Ministerpräsident der Russischen Föderation!
Im Unterschied zu den bisher Genannten kam Wladimir Gussinski aus dem sich in den 1980er Jahren entwickelnden unabhängigen Genossenschaftswesen, aktiv vor allem im Kultur- und Medienbereich. Mit seiner Most-Bank baute Gussinski in den 1990er Jahren ein riesiges Medienimperium (Media-Most) auf, das politisch eng mit Jelzin verbunden war. Unter Putin wurden die meisten Fernsehsender und Presseorgane Gussinskis von der Staatsführung als zu „kritisch“ gesehen, und er wurde mehr und mehr enteignet. Gussinski selbst setzte sich nach Israel ab. Er hinterließ Putin eine gut geölte moderne Medienmaschinerie. Allerdings finanziert er weiterhin den wohl größten Putin-kritischen russischsprachigen Sender RTVi (Russian Television International), der sicher nicht nur von Russ:innen außerhalb der RF konsumiert wird.
Der wohl bekannteste Großinvestor der 1990er Jahre war Boris Beresowski. Pjotr Awen bezeichnete später sogar die 1990er Jahre als „die Ära Beresowski“. Beresowski arbeitete Ende der 1980er Jahre im staatlichen Automobilkonzern AwtoWAS (bekannt durch die Marke Lada). Dies nutzte er Anfang der 1990er Jahre zu einem Millionengeschäft im Automobilhandel (insbesondere mit deutschen Fabrikaten). Mit diesem Geld, Sammlung von Anlagegeldern „für eine russische Autoproduktion“ und dem Umweg über eine scheinbar neue Firma gelang ihm noch in der ersten Privatisierungswelle die Übernahme bedeutender Anteile an AwtoWAS. In dem schon erwähnten Shares-for-loan-Coup wurde Beresowski dann zu einem Hauptprofiteur: Zusammen mit Roman Abramowitsch sicherte er sich die Kontrolle über den Ölkonzern Sibneft (ab 2006 Gazprom Neft), und außerdem erlangte er wichtige Anteile an der russischen Luftfahrtindustrie. Besonders bekannt wurde er aber durch seine politische Einflussnahme unter Präsident Jelzin (dazu später mehr). Unter Putin fiel er zusammen mit Chodorkowski in Ungnade, flüchtete aber rechtzeitig bereits Ende 2000 ins Exil. 2013 kam er unter dubiosen Umständen in seiner Wohnung in London ums Leben.
Eine wichtige Rolle während der Privatisierungsperiode spielte auch die überwiegend in Staatsbesitz gebliebene VTB. Sie war in den 1990er Jahren aus der vormaligen Außenhandelsbank der Sowjetunion entstanden. Ihr wohl bekanntester Manager war Andrei Akimow, der an verschiedenen Außenstandorten des SU-Handels seit den 1970er Jahren aktiv war, insbesondere in Wien und Zürich. Die Kredit- und Geldgeschäfte im Ausland waren ursprünglich eine Domäne des Auslandsgeheimdienstes des KGB, weshalb die glaubwürdige Vermutung besteht, dass Akimow ein hochrangiger KGB-Offizier war. Dies gilt wohl auch für andere der VTB-Manager wie Alexander Medwedew (nicht verwandt mit Putins Vize), Chef der „Donau Bank“ zur Wendezeit. In den frühen 1990er Jahren aquirierten sie große Mengen von Venture-Kapital und Krediten aus dem „Westen“ und investierten diese in verschiedene Projekte in der RF. Bemerkenswert insbesondere im Gas- und Ölliefergeschäft in den Westen (man kann davon ausgehen, dass der KGB schon zu Sowjetzeiten in viele verdeckte und halb-kriminelle Offshoregeschäfte verwickelt war und dass das mit dem Ende der SU nicht weniger kriminell wurde). Einer der Profiteure dieser Projekte war Wladimir Putin, damals noch beschäftigt mit der Belebung der Ökonomie der Region St. Petersburg. Über die Etablierung einer Gastransitgesellschaft landete ein großer Teil von Akimows Seilschaft Ende der 1990er Jahre bei der Gazprombank (deren Chef Akimow wurde) oder direkt bei Gazprom (Medwedew wurde Mitglied des Vorstands). Dies geschah gerade rechtzeitig, bevor um 2002 die Wiederverstaatlichungspolitik im Öl- und Gasgeschäft begann. Auch im halbstaatlichen Ölkonzern Rosneft wurde mit Igor Setschin ein ehemaliger KGB-Chef als Vorstandsvorsitzender etabliert. Das auch nach dem Ende der Sowjetunion weiter bestehende Netz der „Sicherheitsleute“ (russisch: Silowiki; dt.: Kraft, Stärke; umgangssprachlich für Leute des Militär- und Geheimdinestes) brachte in der Ökonomie in den 1990er Jahren eine eigene Form von „Oligarch:innen“ hervor. Im Unterschied zu den zuvor Genannten war ihr Netzwerk auf die Stärkung des russischen Staates und seiner Führung ausgerichtet – um dabei aber fast so gut zu verdienen wie Erstere. Man kann sie also getrost Silowiki-Oligarch:innen nennen.
4. Freiheit – Marktwirtschaft – Demokratie oder: der Weg in die Diktatur des Kapitals
In Russland wie in Osteuropa war Anfang der 1990er Jahre die Ideologie der engen Verknüpfung von freier, unregulierter Marktwirtschaft und der damit aufs Engste verbundenen Durchsetzung von Demokratie „nach westlichem Muster“ weit verbreitet und sehr wirkmächtig. Der Nachhall davon ist noch Jahrzehnte später in immer neuen Generationen der „liberalen Intelligenz“ zu spüren. In den diversen „Farbenrevolutionen“ (oder ähnlich blumig bezeichneten Events) verbindet sich diese liberale Ideologie mit politologischer Pseudowissenschaft, z. B. von der unaufhaltsamen Wirkung des gewaltlosen Aufstehens der „Zivilgesellschaft“ durch aufrüttelnde phantasievolle Protestformen und das Schwingen von EU-Flaggen. Irgendwie hat es die EU geschafft, das Symbol des grenzenlosen freien Marktes einer demokratischen Staatengemeinschaft zu werden (trotz gigantischen Agrarprotektionismus’, menschenverachtender Grenzregime, bürokratischer Erstickung demokratischer Mitsprache …).
Möglich war dies erstens durch die Unterdrückung in den bürokratischen Arbeiter:innenstaaten, die den Westen in rosigem Licht erscheinen ließ. Zweitens durch die verbale und später aktive Unterstützung unterdrückter Aktivist:innen sowohl vor als auch nach dem Zerfall der SU, also von Menschen, die an sich sehr glaubwürdig waren. Drittens durch die unterschiedliche Erscheinungsform von Korruption, die im globalen Kapitalismus zwar letztlich von den Metropolen ausgeht, aber in den Halbkolonien andere Formen annimmt. In den westlichen imperialistischen Ländern ist Korruption weitgehend in legale Erscheinungsformen umgewandelt worden: Beratungsverträge, Lobbyismus, Parteispenden etc. Ja, sogar Gelder, die westliche Konzerne zur Korruption in anderen Ländern einsetzen, können von den Steuern abgesetzt werden. All dies trifft aber die Bevölkerung nicht in ihrem konkreten Leben. In den Halbkolonien führt die Ausbeutung der Länder durch die Imperialist:innen hingegen dazu, dass Sozialsysteme unterfinanziert sind, also z. B. medizinische Leistungen zusätzlich „schwarz“ vergütet werden müssen; dass sich die heimische Bourgeoisie direkt an staatlichen Geldern vergreift, weil die wirklichen Fleischtöpfe in ausländischer Hand sind; dass Infrastruktur und Sicherheit in viel stärkerer Weise vernachlässigt werden etc. All dies trifft die Bevölkerung in ihrem Alltag, die Korruption ist somit präsenter, während sich die eigentlichen Profiteure:innen anmaßen, diesen Ländern noch Programme zur „Korruptionsbekämpfung“ aufzuerlegen. Dies alles gilt heute noch für fast alle Länder Osteuropas. Russland in der Transformationsphase allerdings erlebte die Korruption von ganz oben bis unten, wie wir ausführlich beschrieben haben. Für die betroffene Bevölkerung erscheint die Korruption, die sie persönlich trifft, zugleich als „undemokratisch“, als Machtmissbrauch. Das lässt die EU oder die USA, die ihr inhärent korruptes System viel besser verkleiden können, als demokratisch erscheinen.
Vertreter:innen einer ultraimperialistischen Verschwörungstheorie versuchen bei jeglicher Art von Farbenprotesten sofort, riesige Aktivitäten von CIA & Co. aufzudecken. Dabei ist nicht viel mehr nötig, als die sowieso verbreitete liberale Ideologie durch Politikseminare, entsprechende Literatur- und Medienaktivitäten zu verstärken. Entscheidend ist dann, ob solche Bewegungen der liberalen Intelligenz mit den Interessen bestimmter Kapitalgruppen zusammenfallen oder nicht. Fest steht, dass nur eine Minderheit der jungen Intelligenz oder der Student:innen bereit war, die tatsächlichen Auswirkungen der „Marktwirtschaft“ auf die Masse der arbeitenden Bevölkerung wahrzunehmen oder diese gar zum Ausgangspunkt ihres Protestes zu machen.
Der Glaube Hayeks von „Marktwirtschaft = Demokratie“ und „Planwirtschaft = Diktatur“ war in den 1990er Jahren so fest verankert, dass die Auswirkungen der Marktreformen als notwendige Zwischenerscheinungen hingenommen wurden. Jeglicher Widerstand gegen die Reformen wurde daher als „reaktionär“, als „Versuch der alten Kräfte“, wieder zu planwirtschaftlicher Diktatur zurückzukehren, dargestellt. Später wurden die Veränderungen der Putin-Ära als „Sieg der alten Kräfte“, teilweiser Rückzug zu staatlichem Illiberalismus etc. gedeutet, und die liberale Intelligenz sah die Zeit für „Farbenproteste“ wiederkommen und wunderte sich, dass sie kaum auf Resonanz traf.
Tatsächlich schufen die wirtschaftsliberalen Reformen eine ungeheuerliche Bereicherung einer ganz kleinen Zahl geschickter Akteur:innen aus der Manager:innen-Elite, die sich durch Verscherbelung von Staatseigentum, Spekulation und Raub unter Ausnutzung der Hyperinflation riesige Konzerne aneigneten. Die neoklassische Wissenschaftsideologie von den chancengleichen Subjekten für zweckrationale Auswahl auf dem freien Markt der Möglichkeiten verschleiert die tatsächlichen Klassenverhältnisse hinter der kapitalistischen Marktwirtschaft. Insbesondere die Schaffung von Arbeits- und Kapitalmarkt führte zu eindeutig asymmetrischen Verhältnissen zwischen denen, die vor allem ihre Arbeitskraft zu verkaufen haben, und denjenigen, die die wichtigsten Produktionsressourcen kontrollieren. Gerade nach dem Ende der Sowjetunion mussten die gewaltige soziale Schere und die kriminelle Energie, die jeder Kapitalist:innenklasse eigen ist, Widerstände hervorrufen. Die liberale Ideologie in der Intelligenz und die Interessen der neuen Reichen gingen in den 1990er Jahren noch eine Allianz ein. Allerdings setzten Letztere vor allem darauf, dass das politische Zentrum der Reformen um Jelzin sie mit aller Macht unterstützte. Die politischen Probleme der Jelzin-Herrschaft ließen damit auch die Repräsentant:innen der großen Kapitalgruppen politisch aktiv werden. Die politische Krise des Jelzinismus ließ die besondere Kombination von Autoritarismus und oligarchischem Kapitalismus entstehen, die für Russland schon lange vor Putin charakteristisch wurde. Man sollte aber betonen, dass autoritäre Tendenzen und oligarchische Strukturen nicht nur im Neoliberalismus aufs Tiefste mit der kapitalistischen Marktwirtschaft verknüpft sind.
Jedenfalls begann schon 1993 der politische Widerstand gegen die Auswirkungen der Radikalreformen. Insbesondere das noch demokratisch gewählte Parlament nutzte seine noch bestehenden Machtbefugnisse, um Änderungen an den Reformen zu verlangen: Preiskontrollen, Erhalt von Sozialleistungen, Verlangsamung von Privatisierungsprozessen, Einführung von Regeln für diesen Privatisierungsprozess usw. usf. Sicherlich gab es einige politische Kräfte im Parlament, die eher auf eine kapitalistische Transformation wie in China setzten – offenbar vor allem um den Parlamentspräsidenten Chasbulatow und Jelzins Stellvertreter Ruzkoi. Diese lagen insbesondere durch die sozialen Proteste und die Gewerkschaften im Aufwind. Im Westen wurden sie als antidemokratische Altapparatschiks verunglimpft, obwohl sie gegenüber den angeblichen „Demokrat:innen“ die Regeln einhielten und gemäß den demokratisch legitimierten Rechten des Parlaments agierten. Bereits Mitte 1992 wurde durch die Mehrheit des Volksdeputiertenkongresses gegen den Willen Jelzins der Chefreformer Gaidar als Ministerpräsident abgesetzt und durch den Gazprommanager Tschernomyrdin ersetzt. Dadurch wurde zumindest klar, dass es für bestimmte Betriebe im Grundstoffbereich Grenzen der Privatisierung geben würde. Nunmehr wurde Tschubais zum Zentrum der Wirtschaftsreformen, während Tschernomyrdin mit den Aufräumarbeiten beschäftigt war. Sein bekanntester Beitrag war seine Zusammenfassung zur Wirkung der Reformpolitik: „Gut gemeint – aber heraus kam das Übliche“.
Nunmehr spielte Jelzin die bonapartistische Karte „Plebiszit“. Da er im Parlament auf Widerstand für die Wirtschaftsreformen traf, setzte er im April 1993 eine Volksabstimmung unter dem Motto „demokratische Marktwirtschaft“ oder „diktatorische Planwirtschaft“ an, für das er die damals noch starken Illusionen in den Liberalismus instrumentalisierte. Die 58 % Zustimmung für den „Reformkurs“ nutzte er sodann, um zu behaupten, dies zeige die Notwendigkeit einer neuen Verfassung, die den Kurs auf Demokratie und Marktwirtschaft gegen die konservativen Vorstellungen, die noch im Parlament vertreten seien, durchsetzen solle. Im Westen wurde dies als „entschiedener Kampf für Demokratie“ gefeiert. Tatsächlich legte Jelzin einen Verfassungsentwurf vor, der Russland in eine autoritäre präsidentielle Republik umwandeln sollte, d. h. weitgehende Macht- und Gesetzgebungsbefugnisse der/s Präsident:in, geringe Kontrollrechte des Parlaments. Nachdem das Parlament die Entwürfe Jelzins abgelehnt hatte, löste er es im Herbst 1993 auf und setzte Neuwahlen an. Das Parlament leitete sofort ein Amtsenthebungsverfahren ein und setzte gemäß der Verfassung den Vizepräsidenten Ruzkoi interimistisch als Präsidenten ein. Dies wurde ab dem 28. September von Protesten gegen die bisherige Regierung begleitet. Jelzin schickte daraufhin Militäreinheiten zur „Aufstandsbekämpfung“. Da die Armeeführung loyal zu ihm blieb und er auch die volle Unterstützung „des Westens“ hatte, kam es zu keiner Befehlsverweigerung in den beteiligten Truppen. Das Parlament wurde wiederum von rasch gebildeten, leicht bewaffneten Unterstützer:innengruppen verteidigt. Es kam 10 Tage zu bewaffneten Auseinandersetzungen, bei denen mehrere Hundert Menschen starben oder verletzt wurden und das Parlamentsgebäude zusammengeschossen wurde. Nachdem die Parlamentsführung kapitulierte, wurde sie sofort verhaftet. Aber auch bei der folgenden Wahl bekamen die Jelzin-Unterstützer:innen im Parlament keine Mehrheit, und so wurde die alte Parlamentsführung sofort wieder begnadigt. Allerdings wichtiger: 1994 setzte Jelzin seine Präsidialverfassung durch. Insgesamt liefern seither diese Verfassung wie auch der antidemokratische Putsch vom Oktober 1993 die Grundsteinlegung für das autoritäre, oligarchische System in Russland. Und Putin ist schlicht der Erbe des vom Westen gefeierten „Demokraten“ Jelzin, der 1993 begriffen hatte, dass Kapitalismus eine besondere Form der Diktatur ist, die sich nach außen als „Demokratie“ verkauft. Oder wie es Arbatow sehr gut zusammenfasste: „Gaidars ‚Reformen‘ hatten nichts mit Demokratie oder demokratischen Veränderungen zu tun. Ganz im Gegenteil. Eine Politik, die Armut und Kriminalität hervorbringt, die unverantwortliches Handeln der Regierung auf Kosten der Bevölkerung fördert, kann nur überleben, indem sie die Demokratie unterdrückt“.[xxxv]
Der zweite wesentliche Schritt des Jelzin-Regimes Richtung Autoritarismus in Russland war der erste Tschetschenienkrieg.
4.1 Tschetschenien – das Imperium erhebt sich
Eine der größten Fehleinschätzungen „des Westens“ im Hinblick auf Russland lag in dessen Einschätzung, dass mit dem Auseinanderbrechen der Sowjetunion 16 homogene „Nationalstaaten“ entstanden seien, endlich frei von „imperialer Zwangsvereinigung“. Tatsächlich sind alle Nachfolgestaaten der Sowjetunion Vielvölkerstaaten mit zahlenmäßig beträchtlichen ethnischen Minderheiten. Zumindest gab es fast überall bedeutende russischsprachige. Insbesondere die Russische Föderation beinhaltet, wie der Name schon sagt, vor allem im Kaukasus und Teilen Sibiriens über 100 nicht russische Minderheiten, oft in eigenen Autonomiegebieten organisiert: 21 autonome Teilrepubliken (z. B. Dagestan, Inguschetsien, Tschetschenien …), vier autonome Kreise (z. B. der der Nenzen), neun Kraj (Sonderregionen, die nicht rein aus „russischen“ Kreisen, genannt Oblast, bestehen, sondern aus einer Mischung von Autonomiegebieten und normalen Oblasts, z. B. die Region Kamtschatka, bestehend aus dem autonomen Kreis der Korjak:innen und der Oblast Kamtschatka). Diese Struktur geht im Wesentlichen auf die Nationalitätenpolitik der frühen Sowjetunion zurück, als man tatsächlich versuchte, das Nationalitätenproblem demokratisch zu lösen und den großrussischen Zentralstaat als Völkergefängnis durch einen freiwilligen föderativen Zusammenschluss zu überwinden. Später, unter Stalin, wurden der Form nach die Föderationsbegrifflichkeiten beibehalten, in Wirklichkeit aber jegliche Selbstbestimmung oder gar Austrittsbestrebungen aufs schärfste bekämpft. Wo es Probleme gab, wie z. B. in Tschetschenien, wurde massenhaft in andere Regionen deportiert (1944 wurde fast eine halbe Millionen Tschetschen:innen wegen angeblicher Kollaboration mit den Nazis nach Kasachstan deportiert, so dass Ende der 1950er Jahre fort mehr Russ:innen als Tschetschen:innen in der Republik lebten. Dies verschob sich erst gegen Ende der Sowjetunion, als eine große Zahl zurückmigrierte).
Mit dem Ende der Sowjetunion erfolgte weder in der RF noch in den anderen ehemaligen Sowjetrepubliken eine ernsthafte Diskussion über die demokratische und sozialpolitische Frage der Minderheiten, eventuelle Autonomiestatuten, mögliche Unabhängigkeitsrechte, den rechtlichen und politischen Status von Minderheiten etc. In den baltischen Staaten oder der Ukraine wurden von Anfang an, unter Beifall der sonst so auf Minderheitenschutz pochenden EU, die Rechte der russischsprachigen Minderheiten im besten Fall ignoriert, zumeist jedoch als zu überwindendes „Erbe der russischen Fremdherrschaft“ abgetan. Statt die Ansätze der 1920er Jahre zu Autonomie und Selbstbestimmung wieder aufzugreifen, fiel man auf die Ideen des homogenen Nationalstaats des 19. Jahrhunderts zurück.
In Russland konnte angesichts der entwickelteren Autonomiestrukturen so nicht verfahren werden. Die vielfältigen Minderheiten mussten weiterhin in einer föderativen Regionalstruktur abgebildet werden. Doch begann man Anfang der 1990er Jahre keineswegs einen demokratischen Diskurs über Autonomie und Selbstbestimmung in den Regionen. Die Wirtschaftsreformen wurden klar von Petersburg und Moskau aus bestimmt, und dort saßen auch deren Profiteur:innen. Auch wenn ein großer Teil des neu angeeigneten Reichtums eigentlich aus Sibirien bzw. dem Kaukasus stammte (was die Rohstoffquellen betrifft), so waren die Regionen dort eher von den negativen sozialen Konsequenzen und dem Zusammenbruch der bisherigen zentralen Planmechanismen betroffen. Dies musste zu regionaler Unzufriedenheit, Selbstbestimmungs- und auch Lostrennungsbewegungen führen. Die „Demokrat:innen“ im Zentrum erkannten diese Gefahr an der „Peripherie“ sehr wohl und waren von Anfang an entschlossen, solche zentrifugalen Tendenzen mit allen Mitteln zu bekämpfen. So sagte Jelzin schon kurz vor der Auflösung der Sowjetunion zu aufkommenden Autonomieforderungen: „Wir können es nicht zulassen und werden es auf keinen Fall zulassen, dass Russland zerfällt …“.[xxxvi]
An solchen und ähnlichen Äußerungen Jelzins wird deutlich, dass er und seine „demokratischen“ Freund:inne die Russische Föderation keineswegs wirklich als Vielvölkerstaat verstanden, sonndern, dass, wie er es an anderer Stelle ausdrückte, die Rückständigkeit der russischen Geschichte eben darin bestünde, dass die bisherigen Regime es nicht fertiggebracht hätten, aus Russland „einen Nationalstaat zu formen“, der die unterschiedlichen ethnischen und kulturellen Eigenheiten in sich aufnehmen würde.[xxxvii] Auch hier wieder das universelle Schema des bürgerlichen Nationalstaates, bei dem verkannt wird, dass diese Region als Ganzes (nicht nur die Russische Föderation) durch den brutalen inneren Kolonialismus des großrussischen Zarismus geschaffen wurde, wodurch sowohl Regionalgrenzen entsprechend dessen Willkür gezogen als auch Völkerschaften wild durcheinandergeworfen wurden. Nur in den Ideengebilden einiger Nationalist:innen im 19. Jahrhundert waren hier „seit Jahrhunderten“ irgendwelche Staatsvölker in irgendwelchen angeblich historischen Grenzen zu finden. Natürlich ist die Überwindung der Narben einer solchen Geschichte nur durch föderative, freiwillige Zusammenschlüsse und eine Vielfalt an Autonomie- und Selbstbestimmungsregelungen möglich. Alles andere muss zu heftigen Nationalitätenkonflikten, Kriegen oder brutalen nationalen Unterdrückungsaktionen führen. In Russland selbst führte es zur Wiedererstarkung imperialer Strukturen.
Der Vollständigkeit halber seien hier die wichtigsten Nationalitätenkonflikte angeführt, die nach dem Ende der Sowjetunion aufbrachen und zumeist bis heute ungelöst sind: Nagorny Karabach (dt.: Bergkarabach; Armenien/Aserbaidschan), Ferghanatal (Kirgisistan, Usbekistan, Tadschikistan), Georgien (Adscharien, Südossetien, Abchasien), Ukraine (Krim, Ostukraine), Republik Moldau (früher: Moldawien) (Transnistrien). Dazu kommen die Probleme der russischen Minderheiten im Baltikum und verschiedene Konflikte in den kaukasischen Teilrepubliken der RF, insbesondere rund um Tschetschenien.
Tschetschenien rückte insbesondere in den 1990er Jahren in den Fokus, da dies die Teilrepublik der RF war, die mit der Auflösung der Sowjetunion sogleich ihre Unabhängigkeit von Russland proklamierte. Das Regime des tschetschenischen Präsidenten Dudajew war dabei ein besonders nationalistisches, das sofort auf Rückkehr der deportierten Tschetschen:innen und seinerseits auf Vertreibung der russischen Bevölkerungsteile setzte. Wirtschaftlich gab es keine Grundlage für Eigenständigkeit, so dass die antirussische Politik vollends in den ökonomischen Ruin führte und somit die Abhängigkeit Tschetscheniens von der russischen Volkswirtschaft sogar noch stieg. Vertreibung, Wirtschaftskrise und Ausstrahlung der Unruhen auf die Nachbarrepubliken Inguschetsien und Dagestan konnten die Zentralregierung nicht auf Dauer ruhig bleiben lassen. Offenbar erkannte die Jelzin-Administration nach dem Niederringen des Parlaments, dass mithilfe der neuen Verfassung ein Exempel der Macht des Präsidenten gegenüber Tschetschenien zu exekutieren sei. Insbesondere war dies der Moment zu zeigen, dass über Krieg und Frieden nunmehr nicht das Parlament entscheidet, sondern der „Nationale Sicherheitsrat“ des Präsidenten. Dieses Gremium war 1993 mit der neuen Verfassung geschaffen worden und wird in seiner Macht heute mit dem ehemaligen Politbüro verglichen. Es besteht aus 13 ständigen Mitgliedern (den Minister:innen für Verteidigung, Inneres, Außen, den Vorsitzenden von Duma und Föderationsrat, den Geheimdienstchef:innen) und 18 nicht ständigen Berater:innen, die der/die Präsident:in selbst ernennt – im Großen und Ganzen also die Repräsentanz der berüchtigten Silowiki. Die erste große Entscheidung dieses Gremiums hieß Ende 1994, in Tschetschenien für „Ruhe und Ordnung“ zu sorgen.
Zunächst versuchte man es mit der Bewaffnung der tschetschenischen Opposition, die aufgrund der wirtschaftlichen Unzufriedenheit mit Dudajew sogar die Mehrheit im Parlament innehatte, und der Errichtung einer Gegenregierung, die ihn stürzen würde. Nachdem die Dudajew-treuen Truppen jedoch im internen Bürgerkrieg erfolgreich waren, entschied sich der Sicherheitsrat für die direkte Intervention. Am 11.12.1994 rückten Truppen und Panzer der Russischen Föderation in Grosny ein, und man erwartete, dass der Konflikt innerhalb weniger Tage beendet, d. h. Tschetschenien wieder ein normaler Teil der RF sein würde. Tatsächlich entwickelte sich die Intervention jedoch zu einem grauenvollen Desaster. Die tschetschenischen Separatist:innen begannen eine sehr erfolgreiche Guerillaaktivität und weiteten ihre Aktionen mit Anschlägen und Geiselnahmen in benachbarte Regionen aus. Am Ende eroberten die Rebell:innen sogar Grosny von den russischen Truppen zurück. 1996 mussten sich die Truppen der RF aus Tschetschenien mit schweren Verlusten zurückziehen und ein demütigendes Waffenstillstandsabkommen abschließen.
In Tschetschenien führten die Verwüstungen, das brutale Vorgehen und die vielen Toten zu einer weiteren Radikalisierung, insbesondere in Richtung politischer Islam (Wahhabit:innen). Ein neuer, radikalerer Präsident (Maschadow) wurde gewählt, aber bald durch den radikal-islamistischen Warlord Bassajew ersetzt. Dieser drohte mit einem Gesamtaufstand im Kaukasus, der ein neues Afghanistan für Russland bedeutet hätte. Der 1999 in Dagestan angezettelte Aufstand und eine große Zahl von Anschlägen, zunehmend im Zentrum der Föderation, führten zu einer allgemeinen Stimmungslage der Unsicherheit. Kombiniert mit den Aktivitäten der organisierten Kriminalität spitzte sich seit dem ersten Tschetschenienkrieg dieses Unsicherheitsgefühl in der russischen Mehrheitsgesellschaft in einen wachsenden Rassismus gegen insbesondere muslimische Minderheiten in der RF zu.
Ob gewollt oder nicht – das Desaster des Tschetschenienkriegs führte auch zu einer völligen Kehrtwende im Verhältnis der „Reformregierung“ zu Armee und Sicherheitskräften. Bis Mitte der 1990er Jahre wurde wie bei allen Staatsausgaben so auch hier kräftig eingespart – auch mit Konsequenzen für das Prunkstück der Sowjetökonomie, die Rüstungsindustrie.
4.2 Die russische Rüstungsindustrie – der industrielle Kern des russischen Kapitals
Eine der falschen Vorstellungen in Bezug auf Russland ist, dass mit den Radikalreformen der 1990er Jahre eine Art Deindustrialisierung eingesetzt habe, die Russland ökonomisch auf das Niveau des Zarenreiches zurückgeworfen habe. Dies ist ganz weit von der Realität entfernt. Tatsächlich war die „Schocktherapie“ etwas, das man heute als „disruptive Wirtschaftspolitik“ bezeichnet. Sie hat zu einem schweren Einbruch der Wirtschaftsleistung geführt (Stagflation), aber es wurden gleichzeitig wenige Betriebe wirklich komplett „vernichtet“. Dies hat eben damit zu tun, dass es noch gar kein Kapital gab, das in der Krise als Geldkapital verschwinden konnte. Das Produktiv„kapital“ war zumeist noch im staatlichen Besitz, und die Teile, die privatisiert wurden, waren eher die „Perlen“, die sowieso auch nicht gleich wieder pleitegingen (es sei denn, es handelte sich um kriminelle Umfirmierungen in den schon beschriebenen Managerprivatisierungen). Die meisten Betriebe bestanden einfach fort – auch unter extremem Auftragsmangel und fehlender staatlicher Unterstützung. In der Folge gab es auch kaum Entlassungen, stattdessen das massenhafte Ausbleiben von Lohnzahlungen.
Ein wichtiger Bereich für diese Form von Betrieben in Schockstarre war der Rüstungssektor. Zwischen 1991 und 1994 gingen die staatlichen Rüstungsaufträge um 80 % zurück, und die Ausrüstung der Armee war eines der vielen Felder, in dem die Radikalreformer:innen „Staatsabbau“ betreiben wollten. Die Betriebe der Rüstungsindustrie froren ihre Produktion ein bzw. kompensierten in kleinerem Umfang durch wachsende Exporte, insbesondere nach China, Indien und in den arabischen Raum. Mitte der 1990er Jahre erwachte dann, wie schon gesagt, wieder das staatliche Interesse an einer konsolidierten Rüstungsindustrie. Teilweise wurden jetzt Technologieperlen als Aktiengesellschaften ausgegründet und Kapitalgruppen, wie die von Beresowski, Abramowitsch und Potanin stiegen ins Rüstungsgeschäft mit ein, insbesondere nachdem Ersterer 1996 selbst zum Mitglied des Nationalen Sicherheitsrates aufgestiegen war. Vor allem aber waren es Manager:innen der Rüstungsindustrie selbst, im Verbund mit den Silowiki in Regierung und Bankenbereich, die eine Modernisierung und Neustrukturierung in einer staatskapitalistischen Form vorantrieben. Die wesentlichen Konzerne, die dabei entstanden, sind:
- erstens die Almas-Antei Holding, die aus Fusionen mehrerer Elektronikfirmen hervorging und vor allem durch Raketen-, Flugabwehrsysteme, Luftraumüberwachung, heute auch Drohnen bekannt sind. Mit ca. 90.000 Beschäftigten ist diese die Nummer 23 der weltgrößten Rüstungskonzerne;
- zweitens der Flugzeugbauer Suchoi. Die SU-27 zählt im Ukrainekrieg auf beiden Seiten weiterhin zum „Standard“. Suchoi produziert aber auch zivil genutzte Flugzeuge in großer Stückzahl, inzwischen auch Drohnen (SU-70). Suchoi wurde in den 1990er Jahren zu einem begehrten Anlageobjekt. Auch der italienische Rüstungsgigant Leonardo stieg ein (und beendete sein Engagement erst im Ukrainekrieg);
- drittens der Luftfahrtkonzern OAK (Vereinigte Luftfahrtkorporation). Er entstand aus der Fusion mehrerer bekannter Flugzeugbauer wie Mikojan-Gurewitsch (Russische Flugzeugbaugesellschaft MiG) und Tupolew. Später wurde auch Suchoi eingegliedert. Auch wenn der Konzern erst 2006 entstand, waren die Strukturen schon seit den 1990er Jahren zusammengewachsen. Der Konzern war vor dem Ukrainekrieg auf dem Weg, hinter Boeing und Airbus zum weltweit drittgrößten Flugzeughersteller aufzusteigen und deren Duopol auf dem Weltmarkt zu brechen. In Zukunft wird sich zeigen, inwiefern hier eine größere Zusammenarbeit, z. B. mit der chinesischen COMAC (Commercial Aircraft Corporation of China), entstehen wird;
- viertens der Panzerproduzent Uralwagonaswod (Uralwaggonwerk). Ursprünglich aus dem Eisenbahnwaggonproduzenten nahe Jekaterinburg entstanden, wurde daraus im Zweiten Weltkrieg die berühmte Panzerschmiede für die T-34. Nach Mitte der 1990er Jahre wurde das Werk mit anderen zu einer Holding umgebaut. Heute werden T-72, T-90 und T-14 produziert, aber für den Kriegseinsatz auch noch ältere Modelle repariert. Das Unternehmen ist ein wichtiger Exportbetrieb für Russland;
- fünftens wurde 2007 die Staatsholding Rostec gegründet, die einen Großteil der Rüstungsindustrie, aber auch viele Zulieferbereiche durch entsprechende Beteiligungen kontrolliert (auch OAK und Uralwagonaswod). Sie umfasst zusätzlich zu den genannten Bereichen nicht nur elektronische und optische Bauelemente, sondern auch viele Bereiche der IT-Technologien (z. B. der Konzern Awtomatika, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich von Cybersicherheit und Internetkommunikation).
Mit dem Desaster des ersten Tschetschenienkrieges geschah insofern eine Trendwende, als der weitere Abbau im militärisch-industriellen Komplex gestoppt wurde und das Level von 3–4 % Militärausgaben im Verhältnis zum BIP gehalten wurde. Das lag wesentlich unterhalb des Niveaus der Sowjetunion, aber noch stark über den meisten anderen europäischen Ökonomien. Die Militärreformen der zweiten Hälfte der 1990er Jahre betrafen vor allem die Armeestrukturen und die Verbesserung der materiellen Lage der Armeeangehörigen. Die Rüstungsindustrie erholte sich insbesondere durch eine stärkere Unterstützung in Gestalt staatlich gesicherten Waffenexports, Zufluss an Privatkapital und die erwähnte Neustrukturierung als staatskapitalistische Konzerne. Damit wurden damals die Grundlagen für die Wiederaufrüstung in den 2000er Jahren unter Putin gelegt. Insbesondere der zweite Tschetschenienkrieg (ab 1999) geriet dann zur Machtdemonstration des neuerstarkten russischen Militarismus.
4.3 Russischer Nationalismus und die Macht in den Regionen
Der drohende Zerfall der Russischen Föderation, das mahnende Beispiel Jugoslawien (insbesondere das Schicksal des „serbischen Brudervolkes“), der wachsende antimuslimische Rassismus und die vielen Vertreibungen von Russ:innen aus anderen ehemaligen Sowjetrepubliken – all dies machte „Tschetschenien“ zum Katalysator eines neu entstehenden russischen Nationalismus’. Die Radikalreformer:innen (und auch die Perestroika zuvor) wurden nicht nur für die soziale Misere, sondern auch den Zerfall des „ewigen Russlands“ verantwortlich gemacht. Es entstanden eine Reihe politischer Organisationen, die sich auf zunehmenden Nationalismus stützten, und auch bestehende Gruppierungen wie die KP der RF schwenkten voll auf diese Linie ein. Auch unter den neuen Kapitalist:innen wuchs die Fraktion derer, die auf einen starken Staat setzten, insbesondere, was die Sicherung des eigenen Ausbeutungsgebietes betraf. Selbst Jelzin schwenkte völlig auf die Linie ein, dass man sich vom Westen das geeinte Russland nicht zerstören lassen werde. Ein deutliches Zeichen in diese Richtung war die volle Unterstützung Serbiens in der Kosovofrage. Nach innen wurde klar, dass „Demokratie“ für die Regionen und autonomen Gebiete nicht im Zentrum stand, und die finanzielle Abhängigkeit von der Zentrale der RF wurde genutzt, um überall in den Regionen getreue Anhänger:innen der Präsidentenpartei an die Macht zu hieven. Insbesondere wurde auf die Marginalisierung von Opposition gedrängt, denn man wollte ja kein nächstes Tschetschenien. Nebenbei wandelte sich so auch der Föderationsrat zu einer mächtigen Stütze für die präsidentielle Autokratie, und die parlamentarische Opposition in der Duma wurde noch mehr an den Rand gedrängt.
Jelzin stützte sich im Parlament zunächst vor allem auf die Apparatpartei „Unser Haus Russland“, eine Koalition verschiedenster Kräfte, die für Privatisierung und Rettung der Einheit Russlands stand. Später wurden sowohl Staatskonzerne wie Gazprom als auch Oligarchen wie Beresowski zu den Hauptfinanziers dieser „Partei“. Bei den Dumawahlen 1995 erzielte sie nur noch etwas über 10 % der Stimmen – ein deutliches Zeichen für die wachsende Unbeliebtheit der Regierung und des Präsidenten. 1999 landete man dann nur noch knapp über 1 %. Daraufhin wechselten ihre Regionalfürst:innen und Akteur:innen weitgehend zur von Putin neugegründeten Partei „Einiges Russland“, die nach dieser Dumawahl aus der Fusion von zwei für die Wahl gegründeten Ersatz-Nomenklatura-Parteien hervorgegangen war. Sie gewann infolge des zweiten Tschetschenienkrieges und der wirtschaftlichen Stabilisierung bei der nächsten Wahl (2003) über 37 % und wurde damit stärkste Partei in der Duma – vor allem durch die Dominanz dieser Partei in den Regionen. Mit dieser Wahl hatten sich das Zentrum und seine regionalen Ableger endgültig stabilisiert.
4.4. Das Verhältnis Zentrum – Regionen als innerer Kolonialismus
Ein weiteres grundlegendes Missverständnis betrifft den Begriff des „Extraktivismus“. Das Paradigma Lateinamerika lässt das falsche Bild entstehen, dass Ökonomien, die stark auf die Lieferung von Rohstoffen auf den Weltmarkt ausgerichtet sind, einem grundlegenden Werttransfer gegenüber Ländern mit höherer Produktionstiefe unterliegen. Tatsächlich funktioniert imperialistische Weltmarktumverteilung so nicht. Die berühmte, sich beständig verschlechternde Terms-of-Trade-Beziehung für rohstoffexportierende Ökonomien besteht nur mit Ausnahme bestimmter, für die Gesamtakkumulation sehr knapper und quasi monopolisierter Rohstoffe. Dies trifft nicht nur auf Öl und Gas, sondern auch auf bestimmte, stark nachgefragte Metalle (z. B. Nickel, Titan, Platin, Seltene Erden …) zu. Dies führt dazu, dass die Weltmarktpreise dieser Rohstoffe eine der Grundrente vergleichbare Rohstoffrente abwerfen. Extraktivismus als imperiale Organisationsform bedeutet im Wesentlichen, dass in den rohstoffliefernden Ländern die herrschenden Schichten von dieser Rohstoffrente profitieren und ihre Herrschaft reproduzieren können, während die Kontrolle über Extraktion, Aufbereitung, Vertrieb etc. über Konzerne der imperialistischen Zentren erfolgt, wo dann auch die eigentlichen Profite mit diesen Rohstoffen gemacht werden. Im russischen Kapitalismus ist das offensichtlich anders: Die Konzerne der Extraktion, Aufarbeitung und Verteilung der Rohstoffe bzw. von Öl und Gas stammen allesamt aus dem Zentrum der russischen Föderation selbst. Insofern ist die RF kein Beispiel für den Extraktivismus, und die Rohstofflastigkeit ist hier auch kein Beleg für „Rückständigkeit“. Im Gegenteil, sie bildet eine starke Basis für einen autarken, eigenständigen Kapitalismus – und einen nach innen gerichteten Kolonialismus!
Tatsächlich ist die russische Ökonomie gegenüber den internen Regionen extraktivistisch, in denen ausschließlich Förderung und Abbau der Rohstoffe stattfinden. Das sind großenteils auch noch Regionen mit starken nicht russischen Minderheiten. Hier kann man tatsächlich von einer Fortsetzung des inneren Kolonialismus der russischen Geschichte sprechen, insbesondere was viele Gebiete Sibiriens betrifft. Die Steuern und Abgaben der Öl- und Gasindustrie, aber auch die Dividenden für die Staatsbeteiligungen landen im Föderationshaushalt, bis auf Grundrenten und Steuern der dortigen Arbeiter:innen (also ein verschwindend geringer Teil). Die Steuereinnahmen aus dem Rohstoffgeschäft machen im Durchschnitt 30–50 % der Höhe des Föderationshaushaltes aus. Dazu zählen insbesondere die Mineralgewinnsteuer und Exportzölle (lange Zeit die größte Einnahmequelle des Staates). Die Regionalhaushalte erhalten dann ihre Mittel aus den zentralen Haushalten zugewiesen, wobei etwa 10–15 % der staatlichen Einnahmen aus der Öl- und Gasindustrie wieder an die Regionen zurückfließen. Die eigentlichen Förderregionen sind damit stark abhängig von der Zentrale, und insbesondere die Regionalführungen reproduzieren sich durch diese Art Rohstoffrente per Haushaltszuweisung. Als Belohnung für gute Beziehungen zum Zentrum winken dann noch größere Projekte der Großkonzerne, die in der Region „Arbeitsplätze schaffen“ und Schmiergelder fließen lassen. Es muss aber gesagt werden, dass es zwischen den Regionen starke Unterschiede gibt. Gewisse Fördergebiete profitieren tatsächlich direkt von Abgaben der Unternehmen und konnten sich in einem bestimmten Ausmaß unabhängig entwickeln. So liegt z. B. Tjumen zwar nicht selbst im Fördergebiet, aber als Verwaltungszentrum für dieses westlich und nördlich davon stark an deren Erträgen beteiligt – was ihre Einwohner:innenzahl und den lokalen Standard bemerkenswert erhöht hat.
Ein deutlicher Indikator der nicht peripheren Natur der Rolle der russischen Öl- und Gasindustrie ist die Einrichtung des Staatsfonds – vergleichbar mit demjenigen Norwegens. 2004 errichtete die Regierung der RF einen damals „Stabilitätsfonds“ genannten Anlagefonds, in den insbesondere staatliche Einnahmen aus der Öl- und Gasindustrie über einem bestimmten „Schwellenpreis“ (für das Barrel Öl) einflossen. Mit Einnahmen aus diesem Fonds (und seinen Finanzierungsgewinnen) konnte die RF noch in den 2010er Jahren ihre gesamten Auslandsschulden begleichen. Trotzdem umfasste dieser Fonds 2008 etwa 157 Milliarden US-Dollar oder 9 % des BIP. Mithilfe des Fonds konnte die RF die Finanzmarktkrise relativ gut bewältigen. Er liefert auch die Grundlage für die an anderer Stelle besprochene Förderung importsubstituierender Sektorentwicklung. Mit dem Staatsfonds besitzt das russische Finanzkapital ein Flaggschiff, um das herum auch strategische Direktinvestitionen im Ausland organisiert werden – was die an anderer Stelle dargestellte nachhaltig positive Kapitalbilanz der russischen Volkswirtschaft erklärt. Die günstige Exportsituation insgesamt und die daraus folgende fast durchgängig positive Handels- zusammen mit der erwähnten positiven Kapitalbilanz führen damit insgesamt zum beständigen Aufbau von Währungsreserven. Mit 600 Milliarden US-Dollarreserven vor dem Ukrainekrieg war Russland nach China und Japan das Land mit den drittgrößten Devisenreserven der Welt. Mit dem Krieg wurden allerdings 300 Milliarden davon „eingefroren“ – mit bisher ungewissem Ausgang.
4.5 Privatisierung von Grund und Boden – Sonderrolle der Landwirtschaft
Die Privatisierung von Grund und Boden lief ungefähr so chaotisch und intransparent ab wie der gesamte Privatisierungsprozess. Landwirtschaftlich nutzbare Flächen wurden ähnlich dem Voucher-System in der Industrie als Parzelleneigentum an die Beschäftigten von Kolchosen und Sowchosen verteilt, ebenso Anteile an deren Geräteparks. Großteils konnten die neuen „Eigentümer:innen“ mit diesen Gaben wenig anfangen. Bis auf eine Vergrößerung der Flächen für Subsistenz- und Datschenwirtschaft zur Selbstversorgung der Bevölkerung brachte das wenig. Die landwirtschaftliche Produktion brach bis 1995 um 40 % ein, insbesondere Fleisch und Getreide. Der Lebensmittelimport musste 40–50 % des Bedarfs decken. Die neuen Eigner:innen konnten zumeist auch mit den bestehenden Geräten wenig anfangen, die oft auch noch veraltet und reparaturbedürftig waren, und auch für Reparaturen brach die Infrastruktur weg.
Allerdings stellte sich bald heraus, dass die brachliegenden Flächen leicht zu erwerben waren, und die Masse der Kleineigentümer:innen war froh, dass es einige „Spezialist:innen“ gab, die die Einzelparzellen zu Spottpreisen abkauften und daraus bald riesige Flächen für neue Agrobetriebe machten. Dabei ging es vordringlich um fruchtbares Schwarzerdeland, während schlechtere Böden oft bis heute in kommunaler Hand z. B. für Auszahlung von Rente in Naturalien aus dem übriggebliebenen Genossenschaftsbetrieb verblieben.
Die Spezialist:innen waren ehemalige Manager:innen aus der Landwirtschaft, die nunmehr ins Agrobusiness einstiegen. Bis Anfang der 2000er Jahre entstanden so riesige Agrarholdings, die jeweils auch große, modernisierte Geräteparks anlegten. Für das Zustandekommen dieser Großbetriebe sorgten auch entsprechende zentrale und regionale Förderungen und günstige Kredite der Banken, die das Potenzial des Agrobusiness’ rasch erkannten. Bis heute bleibt die Grundrente in diesem Land mit riesigen Agrarflächen ein geringer Kostenfaktor.
So gründete der heutige Oligarch Yozhikov 1995 die Agroholding Miratorg, die heute einer der weltgrößten Fleischproduzenten ist und ihre Weltmarktposition durch Joint Ventures z. B. mit brasilianischen Konzernen ausbaut. 1995 startete auch die Rusagro (ebenfalls in Privatbesitz), einer der weltgrößten Lieferanten von Zucker- und Fettprodukten. Tscherkisowo ist eine weitere Agroholding, die eine wichtige Rolle in Bezug auf Hühner- und Schweinefleischprodukte auf dem Weltmarkt spielt.
Insbesondere was den Getreideanbau betrifft, wurden die Kollektive weitgehend durch Großbetriebe ersetzt und nur zu einem kleinen Teil durch bäuerliche Kleinbetriebe. Letztere dominieren beim Kartoffel- und Gemüseanbau, wo es sich zumeist um Selbstversorgung der Bevölkerung und Vorratshaltung für die nächste Krise handelt. Über 80 % der Getreideproduktion kommen aus landwirtschaftlichen Großbetrieben. Nach dem Modernisierungsschub dieser Betriebe in den 2000er Jahren stieg Russland in den 2010er Jahren zum weltweit größten Getreideproduzenten auf.
Insgesamt entwickelte sich die russische Landwirtschaft von einem Krisenfaktor seit den 2000er Jahren zu einem Exportschlager. Insbesondere in den Bereichen Getreide, Ölsaaten, Tierfutter, Geflügel, Fleisch und Fischerei steht Russland heute an der Spitze des Weltmarktes. Wenn von seiner Rolle in der Welt die Rede ist, sollte nicht vergessen werden, dass die Russische Föderation, was die Energie- und Lebensmittelversorgung betrifft, heute vollständig autark ist und im Hinblick auf diese Grundversorgung einen sehr langen Atem hat. Umgekehrt merken inzwischen viele Länder, die Probleme beim Zugang zu billiger Energie und zu preiswerten Lebensmitteln haben, wenn es als Lieferant ausfällt.
5. Das Verhältnis zu anderen ehemaligen Sowjetrepubliken und die internationale Stellung Russlands
In vielen ehemaligen Sowjetrepubliken, insbesondere in Zentralasien, bestand nach 1992 die Hoffnung, die GUS als eine Art gemeinsamen Wirtschaftsraum weiterzuführen und mit dem Rubel immer noch eine Art Gemeinschaftswährung zu besitzen. Doch die Radikalreformer:innen und der IWF hatten andere Ideen. Der IWF drängte die russische Regierung und Zentralbank in einem Abkommen schon 1992 auf eine restriktive Kreditvergabe in der Rubelzone. Vor allem aber sah die Russische Föderationsregierung in den Gas- und Ölreserven des eigenen Machtbereiches das wesentliche Finanzierungsmittel für die eigenen Reformen. Anders als zu Sowjetzeiten stellte man die besonders günstigen Konditionen für Öl- und Gaslieferungen an die GUS-Partner:innen sofort ein, und man erwartete Zahlung in harten US-Dollar. Bedeutende Ausnahmen stellten Belarus und noch sehr lange auch die Ukraine dar.
Die Einschränkung der Kreditlinien in Rubel für die GUS-Handelspartner:innen führte sofort zu einem Problem in den Abläufen der Zahlungsabwicklung im republikübergreifenden Handel, und dies führte tatsächlich auch für viele russische Betriebe zu Problemen im Zuliefer- und Exportbereich. Mitte 1993 wurden dann sämtliche Rubelkredite an die Partnerländer in Auslandsschulden umgewandelt. Handelskredite konnten nicht mehr über die russische Zentralbank finanziert, sondern mussten in US-Dollar beglichen werden. Damit hörte die Rubelzone praktisch auf zu existieren, und die übrigen GUS-Staaten mussten ihre eigene Währungspolitik auf die Beine stellen.
Auch wenn diese Politik wie so vieles an der „Reform“ disruptiv wirkte, stellte dies nicht das Ende der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den ehemaligen Sowjetrepubliken dar. Im Wesentlichen wurden unter Weltmarktbedingungen die alten Handelsbeziehungen wieder fortgesetzt. Dabei konnte im Prinzip außer den baltischen und bis zu einem gewissen Grad Aserbaidschan (mit türkischer Hilfe) keine dieser Ökonomien die besondere Abhängigkeit von der russischen überwinden.
In fast allen Nachfolgestaaten der SU gibt es weiterhin eine große Abhängigkeit von russischen Öl- und Gaslieferungen. Dies gilt nur nicht für Aserbaidschan, doch selbst die baltischen Staaten blieben lange am Tropf Russlands, und für die Ukraine galt es sogar noch lange Zeit nach 2014. Bis auf die baltischen Staaten und seit 2014 die Ukraine gilt auch, dass die wichtigsten Banken von russischen (VTB, Sber) kontrolliert werden. In Georgien hat das russische Agrobusiness große Investitionen getätigt, und das Land ist stark vom Im- und Export von Agrarprodukten mit Russland abhängig.
Besonders wichtig ist jedoch, dass die meisten der zentralasiatischen Staaten zwar selbst große Bodenschätze besitzen. Aber sowohl Bergbau (z. B. Uran) als auch Öl- und Gasförderungen in diesen Staaten sind wesentlich von russischen Konzernen und Institutionen wie Rosatom, Gazprom, Lukoil & Co. abhängig, insbesondere was Aufbereitung und Vertrieb (z. B. Pipelinebau) betrifft. Auf diese Weise kontrolliert die Russische Föderation heute z. B. direkt oder indirekt etwa die Hälfte der weltweiten Uranvorkommen. Auch in anderen Bereichen, z. B. der Baumwollproduktion in Usbekistan, ist der Handel mit der russischen Textilindustrie weiter wichtig. Insgesamt laufen auch viele Infrastrukturprojekte (Straßenbau, Kraftwerke …) und IT-Investitionen über Joint Ventures mit russischem Kapital.
Dazu kommen die schon erwähnten russischsprachigen Minderheiten, aus denen sich in vielen dieser Staaten auch Fachkräfte und qualifizierte Arbeiter:innen rekrutieren. Auch wenn es einige Vertreibungen und nationalistische Angriffe gab, ist diese Minderheit überall noch sichtbar und trägt zu den Verbindungen mit Russland bei. Umgekehrt ist Russland seit Jahren nunmehr das Ziel vieler Arbeitsmigrant:innen aus diesen Ländern. Die Devisen, die diese zurückliefern, sind sehr wichtig für die dortigen Wirtschaften und auch ein politisches Druckmittel Russlands gegenüber den Regierungen. Ökonomische Probleme und nationale Konflikte führen immer wieder zu politischen Erschütterungen der zumeist autoritären Regime. Im Sinne des beschriebenen Extraktivismus verhalten sich die herrschenden Schichten in den meisten ehemaligen zentralasiatischen Sowjetrepubliken wie beschrieben: Sie kassieren die Rohstoffrente, überlassen die dicken Profite den russischen Konzernen und sorgen im Hinblick auf die Abwicklung dieser Geschäfte für Ruhe in der Bevölkerung. Daher haben auch die meisten seit den 1990er Jahren besondere Abkommen mit der RF abgeschlossen. Die wichtigsten davon sind die Eurasische Wirtschaftsunion (EAWU) (seit 2015; Nachfolgerin der Eurasischen Wirtschaftsgemeinschaft, EAWG, aus Belarus, Kasachstan, Kirgisistan, Russland, Tadschikistan, bis 2008 Usbekistan, und Armenien, Moldau und der Ukraine als Beobachter:innen), zu der die Russische Föderation, Kasachstan, Kirgisistan, Belarus, Armenien und Kuba, Moldawien, Usbekistan als Beobachter:innen gehören. Zweck ist die Schaffung einer Zollunion und auch die „Liberalisierung“ des Kapitalflusses (also „Investitionssicherheit“, insbesondere für russisches Kapital).
In Bezug auf eine gemeinsame „Sicherheitspolitik“ gibt es bereits seit 1992 die Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (OVKS; Mitglieder: Belarus, Kasachstan, Kirgisistan, Russland, Tadschistan; Armeniens Mitgliedschaft ruht derzeit). Zwar sind seit deren Gründung einige Mitglieder ausgetreten oder lassen die Mitgliedschaft ruhen. Vollmitglieder sind weiterhin, neben der RF, Belarus, Kasachstan, Kirgisistan und Tadschikistan. Armenien ist seit der mangelnden Unterstützung im Bergkarabach-Konflikt 2024 aus dem OVKS ausgetreten. Die Organisation soll militärische Hilfestellung bei inneren und äußeren Konflikten der Vertragspartner:innen leisten (wie dies z. B. bei den Unruhen in Kasachstan 2022 geschehen ist). Unter anderem geschieht dies durch eine schnelle Einsatztruppe CRRF (Collective Rapid Reaction Forces) mit Sitz in Moskau.
Offensichtlich schwebt der russischen Führung eine Ausweitung dieser Ansätze zu einer Wiederbelebung der Union auf kapitalistischer Grundlage vor. Der deutlichste Ansatz dazu ist der Unionsvertrag zwischen der RF und Belarus. Dieser besteht zwar schon seit 1999, wurde aber erst in den letzten Jahren mit konkreten Maßnahmen gefüllt. Anscheinend als Gegengewicht zur EU gedacht, soll der Unionsvertrag natürlich mehr Mitglieder als nur die beiden bisherigen ansprechen. Relevante Beitrittskandidat:innen waren bisher aber nur Kasachstan und die von Georgien abgetrennten Gebiete Abchasien/Südossetien.
6. Die Präsidentschaftswahl 1996 und der weitere Verlauf der Privatisierungen
Die Dynamik der Radikalreformen ab 1992 führte zur Herausbildung der Grundlagen von Kapitalakkumulation, insbesondere, was den Arbeitsmarkt und den Beginn der Herausbildung von großen Kapitalen betrifft, aber auch, was die zunehmende Funktion des Staates als autoritäre Absicherung der Profitmacherei anbelangt. Zwischen 1995 und 1997 wurde dieser Prozess entscheidend beschleunigt. Erst in dieser zweiten Phase der Privatisierungen bildeten die erwähnten Kapitalgruppen ihre großen Finanz- und Anlagegesellschaften, genauso wie sich die Verflechtungen zwischen Kapital und Politik auf eine neue Ebene hoben.
In der ersten Privatisierungswelle hatten sich zunächst vor allem die Netzwerke von „neuen Reichen“ und ihre Instrumente (wie z. B. die neu gegründeten Banken) gebildet. Es blieben aber noch eine Reihe kleinerer Anleger:innen bzw. eine Masse an großen Betrieben oder Teilen davon, die die großen Kapitalist:innen jetzt einsammeln wollten. Gleichzeitig stand der Staat aufgrund von Verschuldung, stagnierender Wirtschaft und wegbrechenden Steuereinnahmen vor einem ernsten Finanzierungsproblem. Der IWF war zwar zur Unterstützung bereit, verlangte aber wie üblich eine Beschleunigung des Privatisierungsprozesses. Lösung waren die schon erwähnten „Shares for Loans“-Abkommen, also die Bildung von Bankenkonsortien zur Kreditierung des Staates mit Verpfändung von Anteilen an bisher staatlichen Betrieben an diese Bankenkonsortien. Die Abwicklung dieser etwa 17 Abkommen wurde dabei unter äußerst fragwürdigen Bedingungen durchgeführt: Die verantwortliche staatliche Treuhandgesellschaft für die Staatsanteile hatte ziemlich offene Verbindungen zu den involvierten Banken. Die Auswahl der Banken, die an den Bieterprozessen teilnahmen, war sehr willkürlich und von der Zahl her gering genug, um für die staatliche Verhandlungsposition ungünstig zu sein. Die Bewertung der Kapitalisierung der betroffenen Betriebe war, wie schon erwähnt, lächerlich gering. Auf diese Weise konnten sich die erwähnten Kapitale zu Spottpreisen die Perlen der russischen Industrie aneignen. Nur die Gas- und Rüstungsindustrie blieben weitgehend unter staatlicher Kontrolle.
Mit dieser endgültigen Konsolidierung der kapitalistischen Klasse in Russland begann auch die klare Verflechtung dieser mit dem Staatsapparat. Zwischen dem Management von Konzernen, Regierungsposten in der Föderation und den Regionen gab es einen regen Tauschreigen. Verbunden damit sorgte die Regierung immer mehr für die Absicherung von Geschäften aller Art, auch ins Ausland. Das betraf nicht nur z. B. die Vermittlung und Organisierung von Rüstungsprojekten, sondern auch die Förderung von Investitionen, d. h., den Kapitalexport. Zunächst waren dies besonders Übernahmen bzw. Anteilskäufe von Firmen im Öl- und Gasgeschäft in ehemaligen Sowjetrepubliken (vor allem durch Gazprom und Lukoil).
Am offensichtlichsten aber wurde die neue Verbindung von Politik und Geschäft bei der Präsidentschaftswahl 1996. Noch wenige Monate vorher waren die Umfragewerte von Jelzin auf einstellige Prozentzahlen gefallen. Es drohte tatsächlich die Wahl des KPRF-Vorsitzenden Sjuganow zu seinem Nachfolger. Dies wurde vor allem von den sozialen Protesten getragen, denen Sjuganow die Abmilderung der Reformen, Verbesserungen der gewerkschaftlichen Rechte und eine Überprüfung des Privatisierungsprozesses versprach. All dies musste natürlich die neuen Kapitaleigner:innen in Alarmstimmung versetzen. Sofort schlossen sich die wichtigsten kapitalistischen Akteur:innen zur Unterstützung Jelzins zusammen. Insbesondere wurde die berühmt-berüchtigte „Gruppe der 7 Banken“ um Beresowski, Gussinski, Chodorkowski, Fridman, Potanin, Smolenski und Winogradow gebildet. Diese setzten ihre riesigen Medienkonzerne für eine erdrückend einseitige Wahlbeeinflussung ein. Ein Wahlsieg Sjuganows wurde als Rückkehr zu düstersten Zeiten dargestellt und natürlich ergriffen sämtliche westlichen Staatschef:innen von Clinton bis Kohl mit dramatischen Aufrufen zur „Rettung der Demokratie“ ein. Entscheidend erwies sich letztlich dann auch das schon dargestellte Machtgeflecht in den Regionen. Eine Fortsetzung der Jelzin-Herrschaft wurde hier als absolut notwendig für die eigene Machterhaltung gesehen. Hier wurden nicht nur oppositionelle Kandidaturen behindert, sondern auch deren Wahlkampf. Die Maschinerie der Wahlmanipulationen in den Regionen begann also schon lange vor Putin.
Der auf diese undemokratische Weise durchgesetzte Sieg Jelzins 1996 begründete so auch die besondere Rolle von Superreichen und ihren Netzwerken in der russischen Politik, also das, was man heute den „oligarchischen Charakter“ des russischen Kapitalismus nennt. Alle beteiligten Akteure der 7-Banken-Bande bekamen wichtige politische Posten. Potanin wurde in der russischen Regierung praktisch für die Wirtschaftspolitik verantwortlich und trieb dort, wie schon gesagt, die Shares-for-Loan-Deals ungebremst weiter auf die Spitze. Beresowski wurde Mitglied des Nationalen Sicherheitsrates sowie zentraler „Berater“ des Präsidenten und großer „Deal Maker“, was Firmenfusionen, Rüstungsgeschäfte, Auslandsinvestitionen etc. betrifft. Eine mafiaartige „Familie“ um Jelzin herum besetzte immer mehr Schalthebel in Politik und Wirtschaft.
Gleichzeitig setzten natürlich in der neuen „Elite“ die Diskussionen um die weitere Entwicklung der Russischen Föderation ein. Der wachsende Nationalismus bot einerseits eine Möglichkeit für die Kanalisierung der sozialen und politischen Proteste. Andererseits waren die Probleme rund um die russischen Minderheiten in den ehemaligen Sowjetrepubliken, deren wirtschaftliche Schwächen und die Wiedererstarkung bestimmter russischer Wirtschaftsunternehmen gute Voraussetzungen für das erneute Aufkommen russischer Großmachtpolitik. Für Letzteres erwies sich aber der schwächelnde Altpräsident Jelzin samt seiner korrupten Clique als immer weniger geeignet. Weder gegenüber der Ostexpansion der NATO noch dem Eingreifen derselben in Serbien noch der wachsenden Sicherheitsproblematik in Tschetschenien & Co. wirkte Jelzin noch als jemand, der Russlands Stellung in der Welt voranbringen könnte. Die Finanzkrise 1998 und die neuerliche Zuspitzung in Tschetschenien sollten hier eine Wende bringen.
7. Die Russlandkrise 1998 und der zweite Tschetschenienkrieg als Wendepunkte
Die Finanzkrise 1998 war ein Klassiker der kapitalistischen Krisen. Sie basierte auf den astronomischen Gewinnen der russischen Banken, hinter denen im Wesentlichen die Expansion von fiktivem Kapital und dessen Profiten stand. Dabei ist wichtig, dass diese, die in großer Zahl mit den Radikalreformen der frühen 1990er Jahre entstanden, vornehmlich Investmentbanken waren, also vor allem durch Kapitalmarkt- und Staatsschuldengeschäfte ihre Gewinne tätigten. Wie üblich ist bei Investmentbanken der „Hebel“ von geringer (oft nur im einstelligen Prozentbereich liegender) Eigenkapitalquote im Verhältnis zu riesigen Mengen an erwartungsvollem Fremdkapital charakteristisch. Dieser Hebel kann gegenüber dem eingesetzten Kapital enorme Gewinne ermöglichen, aber auch leicht zum Bumerang für dessen Nutzer:innen werden. Leider hatten einige der Investmentbanken auch Geschäftsbanken übernommen, beispielsweise Smolenskis Stolicnyi Bank die Agroprom, so dass der folgenden Bankenpleite auch Tausende von Kleinsparer:innen zum Opfer fielen.
Die großen Gewinne dieser Investmentbanken zwischen 1995 und 1997 beruhten, wie oben gesehen, auf der Ausplünderung des russischen Staates. Schätzungen zufolge bekam dieser durch die Auktionen von Staatseigentum gerade einmal 17 % der geplanten bzw. gerechtfertigten Einnahmen. Durch Geldabfluss ins Ausland und sonstige Steuerhinterziehung sanken die Staatseinnahmen bis 1998 auf ein Rekordminimum von unter 25 % am BIP. Die wachsenden Staatsschulden wurden letztlich durch ein System sehr riskanter Staatsanleihegeschäfte gedämpft. Dies waren insbesondere die GKOs, Anleihen mit kurzer Laufzeit mit überraschend hohen Zinsen. Für die russischen Investmentbanken ergab sich daraus ein sehr lukratives Geschäft: Man lieh sich zu niedrigen Zinsen Fremdwährung (insbesondere US-Dollar), um damit GKOs zu kaufen und an der Zinsdifferenz kräftig zu verdienen. Voraussetzung des Geschäftes war natürlich die Aufrechterhaltung eines möglichst hohen Rubelkurses – schlecht für den eigenen Export, aber günstig für die russische Finanzwelt. Der Finanzhebel führte dazu, dass diese Anlagen immer mehr Fremdkapital anlockten, auch ausländisches Kapital, das zu etwa 20 % an diesen Spekulationsgeschäften beteiligt war. Die Gewinne wurden dann hauptsächlich über von russischen Banken beherrschte Offshore-Institute in Zypern steuerfrei recycelt (entweder von dort global angelegt oder nach Russland „reinvestiert“). Umgekehrt konnte das GKO-Geschäft zur Deckung der Staatsschulden nur funktionieren, wenn der Staat immer neue Anleihen zur Refinanzierung der bestehenden Forderungen aufnahm. Am Schluss überstiegen die aufgelaufenen Verbindlichkeiten die Deckung durch tatsächliches Eigenkapital bereits um ein Vielfaches. Eine massenhafte Rückforderung würde also schnell das gesamte Kapital derjenigen auffressen, die nicht schnell genug ihre GKOs losgeworden waren.
Den Stein ins Rollen brachte die Asienkrise von 1997. Die 1990er Jahre waren ja auch die der Liberalisierung der globalen Finanzmärkte, die zunächst in ein „grenzenloses Wachstum“ der „asiatischen Tigerstaaten“ (Südkorea, Indonesien, Singapur, Taiwan etc.) investierten. Russland blieb ein Randgeschäft für eher risikofreudiges Restkapital. Als die Wachstumsraten in den Tigerstaaten aufgrund von Überakkumulation schwächelten, setzte sofort ein panikartiger Abzug von Portfoliokapital ein, die Währungen gerieten unter Druck und es kam zu einem globalen wirtschaftlichen Einbruch. Diese etwas schwächer werdende Weltkonjunktur führte auch zu einem Rückgang der Rohstoffpreise, auch der für russisches Öl und Gas. Die russischen Exporte gingen im ersten Halbjahr 1998 um 13 % zurück, während aber die Importe in gleicher Größenordnung weiterstiegen. Dieses Leistungsbilanzdefizit setzte den Rubelkurs enorm unter Druck, so dass auch Stützungskäufe und IWF-Kredite nicht mehr halfen. Dies machte sofort die GKO-Geschäfte zum Hochrisiko und führte zur allgemeinen Flucht aus russischen Anlagewerten bzw. zum Bankrott einiger Banken (wie der von Smolenski). Damit konnte der russische Staat aber zugleich sofort seine Verbindlichkeiten nicht mehr bedienen. Am 17. August 1998 musste die RF den Staatsbankrott verkünden.
Die Folge war nicht nur eine Bereinigung des Finanzsektors und somit ein rasches Ende des Engagements ausländischen Kapitals in Russland. Zwar wurde die politische Wende durch die Schockstarre des Präsidenten noch verzögert, aber im September 1998 wurde die „Reformregierung“ entlassen und mit Jewgeni Primakow kam ein Vertreter des Staatsinterventionismus an die Regierungsspitze (Ministerpräsident). Die bisherige Reformpolitik wurde grundlegend in Frage gestellt und das Ziel eines staatlich regulierten Kapitalismus wurde ausgegeben. Zunächst wurde ein 90-tägiges Schuldenmoratorium mit den Banken vereinbart, ausländisches Kapital wurde vom Markt kurzfristiger Staatsanleihen ausgeschlossen und die Laufzeit der GKOs wurde wesentlich verlängert. Dazu wurde der Rubelkurs kontrolliert zurückgefahren. Einige der bankrotten Unternehmen wurden wieder verstaatlicht. Innerhalb relativ kurzer Zeit wurde die Situation so stabilisiert und der Export, vor allem durch den niedrigen Rubelkurs, wieder angekurbelt. Schon 1999 wuchs das BIP wieder um fünf Prozent und die Einkommenssituation der Bevölkerung stabilisierte sich. Trotz der enormen Verluste während der Krise konnten die überlebenden Oligarch:innen ihre Einkommensbasis sogar erweitern und ihre Vermögen absichern.
Allerdings bedeutete die Politik Primakows eine wiedererstarkte Rolle des Staates gegenüber den großen Kapitalgruppen. Banken wurden durch verstärkte Aufsicht, Eigenkapitalquoten, Bilanzpflichten und das Verbot bestimmter Geschäftspraktiken reguliert. Privatisierungen wurden einem transparenteren Regelwerk unterworfen, Bilanz- und Wertberechnungen der Willkür entzogen und vor allem Steuerschlupflöcher geschlossen. All dies machte Primakow bei den Neureichen nicht gerade beliebt, noch dazu, da es drohte, dass er Jelzin als Staatspräsidenten beerben könnte. In dieser Situation kam es zusätzlich zur Zuspitzung der Sicherheitslage und zum Wiederaufflammen der Kämpfe im Kaukasus, diesmal nicht nur in Tschetschenien.
7.1 Die Primakow-Doktrin
Primakow war zwar ausgebildeter Wirtschaftswissenschaftler, machte aber in der Sowjetunion Karriere im KGB und in der Außenpolitik. In den 1990er Jahren wechselte er ins Reformlager und wurde 1996 Außenminister. Sein Aufstieg in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre ist ein Zeichen des wachsenden Einflusses der Silowiki, insbesondere der alten KGB-Netzwerke. Dabei konkurrierten sie nicht nur mit den neuen mächtigen Kapitalmagnat:innen, sondern es ergaben sich vielfältige Bündnisse und Fraktionierungen in der herrschenden Klasse, aus denen sich der jeweils herrschende Block zusammenschloss. Hierbei ist Primakow insbesondere deswegen interessant, da er auch eine Perspektive neuer russischer Großmachtpolitik entwickelte. Der heutige Außenminister Lawrow spricht von einer Wende der russischen Außenpolitik 1996 und der Entwicklung einer „Primakow-Doktrin“. Tatsächlich sprach Primakow von der Notwendigkeit, die „einseitige Westorientierung“ zu beenden und eine „multipolare Weltordnung“ anzustreben (lange bevor dies zum Standardvokabular der KP Chinas wurde). In den „Shanghai“-Verträgen strebte er ein „Dreieck China-Indien-Russland“ an, dem sich immer mehr Staaten mit „eurasischer Orientierung“ anschließen würden. Wichtig war hier insbesondere die sehr frühe Einbeziehung des Irans in das neue Bündnissystem. Dieses sollte ein Gegengewicht zur von den USA unipolar geführten Weltordnung sein. Russland wiederum sollte eine wichtige Rolle bei der Eindämmung der Übermacht der westlichen Bündnisse wie NATO, EU etc. erhalten. Die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ; Belarus, VR China, Indien, Iran, Kasachstan, Kirgisistan, Pakistan, Russland, Tadschikistan, Usbekistan) und die BRICS-Kooperation sind letztlich stark von dieser Primakow-Doktrin beeinflusst worden (BRICS: seit 2006 Brasilien, Indien, VR China; seit 2010 Südafrika; seit 2024 BRICS plus mit Ägypten, Äthiopien, Iran, den Vereinigten Arabischen Emiraten; seit 2025 mit Indonesien).
Schon als Außenminister begann Primakow stark an dieser Umorientierung der russischen Außenpolitik zu arbeiten, insbesondere was die Opposition gegenüber der NATO-Osterweiterung und einer möglichen Westorientierung vor allem der Ukraine, Belarus’, Moldawiens und Georgiens betraf. Vollends deutlich wurde der neue Wind aus Moskau unter Primakow als Ministerpräsident während des Kosovokrieges 1998/99.
Das Eingreifen der USA in den Kosovokrieg wurde von Primakow und mit ihm wohl von einem Großteil des herrschenden Blocks in Russland als warnendes Beispiel für die Zukunft der Russischen Föderation (siehe Tschetschenien) und für die Gefahren einer „unipolaren“ Weltordnung gesehen. Seit 1996 spitzte sich im Kosovo die Auseinandersetzung zwischen der UCK und serbischer Sonderpolizei beständig zu, um im Jahr 1998 zu eskalieren. Die RF stimmte zunächst mehreren UN-Resolutionen mit der Aufforderung zu Waffenruhe und Aufnahme von Verhandlungen zu bzw. beteiligte sich an der Balkan-Kontaktgruppe. Dabei wurde die RF immer wieder übergangen und von den USA im Wesentlichen als Botin gegenüber der serbischen Führung benutzt (z. B. um den Abzug der serbischen Sonderpolizei zu fordern). Die USA versuchten, Restjugoslawien zu einem Prozess der Befriedung des Konfliktes zu bewegen, der unter Kontrolle einer kaum verhüllten NATO-Truppenpräsenz im Kosovo vonstattengehen sollte (bei Entwaffnung von UCK und Abzug serbischer Sicherheitskräfte). Nach der Ablehnung dieses Plans durch die restjugoslawische Regierung wurden Vorbereitungen der serbischen Kräfte zur Durchführung ethnischer Säuberungen im Kosovo kolportiert. Daraufhin begann die NATO im März 1999 mit Luftangriffen auf Restjugoslawien. Wichtig hierbei ist, dass die RF mit der NATO-Intervention von Anfang an nicht einverstanden war – daher konnte diese Operation auch nicht als UN-Aktion verkauft werden. Die NATO handelte also weder auf der Grundlage von UN-Resolutionen noch im Rahmen ihres Bündnisvertrages. Die Begründung „Verhinderung einer humanitären Katastrophe“ verdeckte, dass es sich um eine vom Völkerrecht nicht gedeckte Militäroperation handelte, was von der Russischen Föderation als offene Großmachtpolitik bezeichnet wurde. In den Folgejahren sah man sich in der RF daher auch im Recht, ebenso vorzugehen. Primakow brach sofort einen USA-Besuch aus Protest ab, und die RF begann mit Waffenlieferungen an Restjugoslawien. Dies wurde durch Flugverbote für russische Transportflugzeuge über den Territorien Rumäniens und Bulgariens unterbunden. Auch am Ende des Kosovokrieges im Juni 1999 kam es nochmals zu einer Konfrontation mit der RF: Im Zuge des Friedensabkommens von Kumanovo (im heutigen Nordmazedonien) und jetzt abgesichert durch ein UN-Mandat sollten die NATO-„geführten“ KFOR-Truppen das Kosovo besetzen. Als deren erste Truppen beim Flughafen Pristina ankamen, lagen dort bereits mehrere hundert schwer bewaffnete russische Fallschirmjäger:innen in Stellung, die den Flughafen blockierten. Das US-Oberkommando befahl den Angriff, aber die Truppen vor Ort nahmen davon Abstand, nachdem der russische Kommandeur angekündigt hatte, dass dann die RF Westeuropa angreifen würde. Nach Verhandlungen von EU-Regierungen mit der russischen Regierung wurde, sehr zum Unwillen der USA, ein russisches Kontingent in die KFOR-Truppen eingegliedert.
Das Zerwürfnis mit der RF im Kosovokrieg hat die Grenzen ihrer „Westannäherung“ sehr deutlich gemacht. Die Aktionen und Stellungnahmen Russlands zeigten, dass ein anderer Wind wehte. Das Zugeständnis nach der Pristina-Affäre mag nichtig erscheinen, es war aber ein erster Schritt zur Anerkennung einer neu entstehenden Multipolarität in der „Globalisierung“. Dazu passte dann, dass die EU im Jahr 2000 ihre „Lissabon-Agenda“ verabschiedete, in der sich die EU explizit zumindest ökonomisch in Konkurrenz zu den USA setzte (Entwicklung der EU zum „dynamischsten Wettbewerbsraum“ der Welt). Vor allem für die deutsche Wirtschaft und Politik wurde Russland, speziell als Rohstoff- und Energielieferant, ein wesentlicher Faktor für eine wechselseitige ökonomische Aufschwungphase.
Die Konfliktlinien zwischen „dem Westen“ und der RF zeigten sich aber nicht erst in den Jugoslawienkriegen. Tatsächlich gab es seit den frühen 1990er Jahren die beständige internationale Diskussion um den Beitritt von osteuropäischen, ehemaligen Warschauer-Pakt-Staaten zur NATO. Dies betraf explizit vor allem Polen, Tschechien und die baltischen Staaten, deren politische Führungen dies selbst stark betrieben. Nicht erst Putin oder Primakow, sondern schon Jelzin selbst brachte zum Ausdruck, dass eine solche „Beitrittswelle“ von Russland als „Osterweiterung“ und „Neo-Isolierung“ Russlands gesehen werde. Als Kompromiss wurden ständige Konsultationen über „Partnerschaft für den Frieden“ (1997) bis zur Gründung des NATO-Russland-Rates (2002) betrieben. Hierdurch sollten, selbst im Fall von Beitritten, Beschränkungen eingehalten werden, was Stationierung von bestimmten Waffensystemen, Errichtung von Luftwaffenbasen, Truppenverlegungen etc. betraf. Unter diesen Voraussetzungen musste Russland 1999 den Beitritt von Polen, Tschechien und Ungarn zur NATO hinnehmen. In seiner berühmten Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2007 sollte Putin diese Osterweiterung der NATO als Beginn einer neuen Systemauseinandersetzung zwischen unipolarer und multipolarer Weltordnung darstellen. Dazu später mehr.
Ein Nebeneffekt der Kosovo-Episode war eine weitere Vertiefung der russisch-serbischen Achse. Serbien wurde wiederum zu einem starken Importeur russischer Waffen. Gazprom übernahm seinen größten Öl- und Energiekonzern. Ein langfristiger Liefervertrag von russischem Erdgas wurde abgeschlossen. Nach Problemen mit einem Pipelineprojekt durch Bulgarien wird russisches Erdgas heute über TurkStream, d. h. über das Schwarze Meer und die Türkei, nach Serbien geliefert. Da das Öl nun aus der Türkei kommt, darf es Bulgarien trotz Russlandsanktionen an den Rest Europas weiterleiten. Außerdem ist Serbien beobachtendes Mitglied der OVKS. Dass es gleichzeitig EU-Beitrittskandidat ist, ist ein bekanntes Doppelspiel. Serbien ist sicherlich der engste „Partner“ Russlands im weiteren EU-Raum. Inzwischen nehmen bekanntlich auch Ungarn und die Slowakei „besondere Beziehungen“ zur RF ein.
7.2 Der Aufstieg Putins
Die erwähnten außenpolitischen Kehrtwenden fanden bereits alle unter der Präsidentschaft Jelzins statt. Die von Primakow vertretene Außenpolitik der multipolaren Weltordnung, mit Russland als einem Machtzentrum, wurde auch von Putin im Grunde eins zu eins übernommen. Daher war der Sturz von Primakow im Mai 1999 durch Jelzin sicher nicht dessen zu „schroffer“ antiwestlichen Außenpolitik zuzuschreiben, wie es manche Kommentartor:innen behaupteten. Dies hatte vielmehr mit Primakows innenpolitischen Positionen zu tun.
Die allgemeine Verunsicherung in Russland 1998 trug ein vielfältiges Gesicht: Die Finanzkrise brachte die Gespenster von Inflation, Währungskrise und Warenknappheit zurück, gepaart mit Angst vor Jobverlust und fehlenden Lohnzahlungen. Kriminalität und Terroranschläge verbreiteten ein allgemeines Klima der Unsicherheit. Die Spitzen von Politik und Wirtschaft erschienen als riesiger Sumpf aus Korruption und Vetternwirtschaft, in dessen Zentrum die „Jelzin-Familie“ hauste. Die politische Führung offenbarte Agonie in Form des dauerbetrunkenen Präsidenten und machtlosen Parlaments. Außenpolitisch schien Russland ein Spielball der USA zu sein, bald auch dem Verfall preisgegeben wie Jugoslawien. All dies wirkte in einer Gesellschaft, in der der Kapitalismus und seine herrschende Klasse noch wenig gefestigt waren, wie ein einziger Ruf nach einem Bonaparte oder, wie viele es in der Zeit eher benannten: Ein Pinochet steht vor der Tür. Daher mussten die neuen politischen Repräsentant:innen aus der Schicht der Silowiki, der Personen aus dem „Sicherheitsapparat“, stammen. Schließlich kam Primakow ja auch ursprünglich aus dem KGB. Auch sein Kurzzeit-Nachfolger Stepaschin war Silowiki. Er war Generaloberst von Spezialtruppen, der den Vorteil hatte, dass er sowohl während des Augustputsches wie 1993 auf der Seite Jelzins stand und danach den Umbau des Ex-KGB zum FSB leitete. Allerdings erwiesen sich weder Primakow noch Stepaschin in der Öffentlichkeit als markige Haudraufpolitiker. Im Gegenteil: Sie waren im Grunde seriös und, soweit bekannt, unbestechlich und schlugen auch auf Probleme ein, die den neuen Herrschenden gar nicht recht waren. Die Regulierung der kriminellen Praktiken in den Geflechten der oligarchischen Kapitale ist schon erwähnt worden. Besonders unangenehm wurde es jedoch, als Untersuchungen zu Steuerhinterziehungen, Geldwäsche und anderen illegalen Geschäften von Oligarchenfirmen und der Jelzin-Familie begannen. Hier kommt nun die Entwicklung der postsowjetischen Justiz ins Spiel: Sie wurde mit der Verfassung von 1993 theoretisch als von der Exekutive unabhängige Gewalt begründet. Tatsächlich erwies sich 1993 das Verfassungsgericht zur Überraschung Jelzins als unabhängig und erklärte dessen Auflösung des Parlaments für verfassungswidrig. Das war dem „Demokraten“ Jelzin dann zu unabhängig – das Verfassungsgericht wurde auch gleich suspendiert. Von da an wurden seine Richter:innen wie die aller anderen föderalen Gerichte direkt vom Präsidenten auf Zeit ernannt und mussten bei zu viel „Unabhängigkeit“ um ihren Posten fürchten. Mitte der 1990er Jahre gab es trotzdem noch einige für die Mächtigen unangenehme Justizeingriffe, insbesondere was Machtmissbräuche in den Regionen betraf – auch hier wurde noch in den 1990er Jahren für die Ernennung stromlinienförmiger Richter:innen gesorgt. Dann kam aber 1999 der Generalstaatsanwalt Juri Skuratow. Offenbar mit politischer Rückendeckung begann er mit einer tiefgreifenden Untersuchung im Gefolge der Finanzkrise von Korruptionsfällen, kriminellen GKO-Spekulationen und Insider-Geschäften in 780 Fällen. Unter den Verdächtigen befanden sich Tschubais und die Jelzin-Töchter. Akribisch wurde auch in Zusammenarbeit mit den Schweizer Behörden dem Abfluss von Milliarden US-Dollar über dortige Konten nachgeforscht. Anfang 1999 drohte Jelzin durch diese Anschuldigungen das Amtsenthebungsverfahren. Da tauchte zufällig in den Oligarchen-Medien ein Video auf, das Skuratow mit zwei Prostituierten zeigte und dazu Behauptungen über Bestechung im Zusammenhang mit Mafiaprozessen. Das Video soll als klare Fälschung zu erkennen gewesen sein, und es heißt, dass es von Wladimir Putin selbst (damals Chef des Inlandsgeheimdienstes FSB) in Auftrag gegeben wurde. Skuratow wehrte sich gegen seine Entlassung und bekam Unterstützung vom Föderationsrat, den Jelzin angesichts des drohenden Amtsenthebungsverfahrens nicht auflösen konnte. Nach einigem Hin- und Her einigte man sich gütlich mit Skuratow: Er wurde abgelöst und die Verfahren verliefen weitgehend im Sand. Damit war ein Muster festgelegt, mit dem künftig niemand in der Judikative mehr ohne Absprache mit der Exekutive, also auch dem Präsidenten, wichtige Prozesse durchführen konnte. Es wurde aus Skuratows Untersuchungen aber auch klar, wie die Staatsführung bei Bedarf mithilfe der Justiz gegen über die Stränge schlagende Oligarch:innen vorgehen kann.
In der Zwischenzeit spitzte sich die Lage im Kaukasus zu – und der amtierende Ministerpräsident Stepaschin erwies sich nicht als der Law-and-Order-Mann, den man erwartet hatte. Überraschend für viele entließ ihn Jelzin am 9. August 1999 und ernannte den damals nicht sehr bekannten 47-jährigen Putin zum Ministerpräsidenten. Dabei saß Putin als Chef des FSB und Sekretär des Nationalen Sicherheitsrates bereits an sehr mächtigen Hebeln im Staat. Auch er ein Kind des KGB, verstand er es aber besser als seine beiden Vorgänger, sich als der gesuchte Mann für „Ordnung und Sicherheit“ zu präsentieren. Auf die Anschläge in den russischen Städten und die neuerlichen Aktivitäten der tschetschenischen Guerilla reagierte er mit markigen Auftritten und dem Versprechen, „mit harter Hand“ das „Tschetschenienproblem“ zu beseitigen. Tatsächlich marschierte im Oktober 1999 die russische Armee wiederum in Tschetschenien ein – diesmal mit äußerster Brutalität und mit einer an Genozid erinnernden Zerstörung sämtlicher Rückzugsgebiete der Rebell:innen. Spezialkommandos jagten die bekannten Anführer:innen des tschetschenischen Widerstands und liquidierten sie eine/n nach dem/r anderen, egal, wo sie sich befanden, es sei denn, sie wechselten rechtzeitig die Seiten, wie Achmat Kadyrow, der Vater des heutigen Putinstatthalters in Tschetschenien, Ramsan Kadyrow.
Mit der „Befriedung“ des Kaukasus wurde Putin schlagartig populär und überholte in den Umfragen den bisher aussichtsreichsten Nachfolgekandidaten für Jelzin, Primakow, der zusammen mit dem Moskauer Oberbürgermeister Luschkow ein bis zum Tschetschenienkrieg sehr aussichtsreiches Gegenprojekt angeführt hatte. Für die Parlamentswahlen im Dezember hatte man die neue Partei „Einheit Russlands“ zusammengeschustert, die einerseits von Putins Popularität und andererseits von der Unterstützung durch das Medienimperium von Beresowski profitierte. Beresowski hielt Putin damals für den Silowiki, den man am besten im Interesse der liberalen Oligarch:innen kontrollieren könne. Nachdem die Partei bei den Parlamentswahlen erfolgreich war, trat Jelzin Ende 1999 als Präsident zurück, und Putin führte interimistisch die Amtsgeschäfte des Präsidenten weiter. Im folgenden dreimonatigen Präsidentschaftswahlkampf waren die Konkurrent:innen Putins chancenlos, und er gewann mit 52 % bereits im ersten Wahlgang. Damit waren bekanntlich die politischen Schwankungen an der Staatsspitze vorbei, und es begann eine Periode der Konsolidierung und Stabilisierung.
8. Die Stabilisierung des neuen Akkumulationsmodells unter Putin – Charakter der russischen Ökonomie
Nach den chaotischen Jahren bis 1998 wuchs das russische BIP in den Jahren von 1999 bis 2008 um beachtliche 6,9 % im Durchschnitt. Dies hat natürlich mit Konsolidierungen zu tun, die durch Stabilisierung der zentralen Märkte zu einer längeren Akkumulationsperiode der Realwirtschaft geführt haben. Dazu kam das insgesamt günstige Umfeld der Aufschwungsphase der Globalisierungsperiode.
Die Konsolidierungen betrafen, wie schon dargestellt, die Etablierung eines im Sinne der Kapitalverwertung funktionalen Arbeitsmarktes – eines der größten und ausbeuterischsten der kapitalistischen Welt, vor allem durch die gewerkschaftsfeindlichen Arbeitsgesetze der frühen Putin-Jahre. Sie betrafen die Bereinigungen des aufgeblähten Kapitalmarktes durch den Abbau einer Masse privater Schulden, wofür in den 2000er Jahren allerdings noch viel Regulierung und Kapitalvernichtung notwendig waren. Das Bankensystem wandelte sich in einen „normalen“ Mix aus Geschäfts- und Investmentbanken, so dass es für Unternehmen leichter zugängliche Finanzierungen für Investitionen gab. Das Produktivkapital war in wichtigen Teilen erhalten geblieben und in einigen Bereichen sogar modernisiert worden. Der Staatshaushalt wurde auf eine tragfähige Basis aus Steuern und Abgaben gestellt. Während der durch den Rohstoffboom der frühen 2000er Jahre expandierende Öl- und Gassektor mit 37 % Steuerlast belegt wurde, ging diese für sonstige Unternehmen auf international sehr geringe 28 % zurück. Bedingung war aber, dass die Unternehmen jetzt tatsächlich ihre Steuern zahlen mussten oder anderenfalls große Probleme bekamen. Durch die Expansion der Einnahmen aus dem Öl- und Gasgeschäft war der russische Staat in den 2000er Jahren tatsächlich in der Lage, seine Staatsschuld abzubauen und durch Leistungsbilanzüberschüsse beachtliche US-Dollarreserven anzuhäufen.
All dies schuf günstige Bedingungen dafür, dass eine über mehrere Zyklen sich aufbauende Kapitalakkumulation ansprang. Die Investitionen in produktive Sektoren wie Öl- und Gasindustrie, Maschinen- und Anlagebau, Rüstungsindustrie, Landwirtschaft, Transport, Energiewirtschaft, Bauwirtschaft etc. erzielten in den 2000er Jahren jährlich zweistellige Wachstumsraten. Dies zeigt auch, dass nicht mehr nur der Öl- und Gassektor den Aufschwung des russischen Kapitals trug, sondern auch in der Regierung größeres Gewicht auf Entwicklung wie Subventionierung bestimmter Industrien gelegt wurde, also eine Abkehr stattfand von der bisherigen „Staatszurückhaltung“ in Kombination mit Verschleuderung von Beteiligungen und der Hoffnung auf Einnahmen aus dem Rohstoffexport.
Diese Orientierung auf eine aktivere Rolle des Staates in der Wirtschaft bedeutete auch, dass einerseits bestimmte Geschäftspraktiken nicht mehr geduldet wurden bzw. der Staat bestimmte Unternehmen wieder unter seine Kontrolle bringen wollte. Eine wichtige Rolle spielten dabei die neuen, von der Exekutive ähnlich wie sonst in der Justiz kontrollierten Insolvenzgerichte. Etliche Unternehmen, die aus Sicht der Staatsführung interessant waren oder sich unbeliebt gemacht hatten, wurden einfach für insolvent erklärt und unter günstigen Bedingungen verstaatlicht. Während es von 1993 bis 1998 ganze 6.000 Insolvenzanträge gab, waren es 1999 in einem Jahr schon 12.000 – und das blieb in den Folgejahren auf diesem hohen Niveau. Auch die Zahl der „feindlichen Übernahmen“, bei denen auch der Staat eine wichtige Rolle spielte, stieg enorm. Dahinter steht eine Tendenz zur Konzentration und starker Verflechtung der entstehenden Monopole mit dem Staat.
Ein gewisser Teil der bekannten „Oligarch:innen“ war nicht bereit, diese Umorientierung und damit auch den eigenen Machtverlust zu akzeptieren. Beresowski hatte unter Jelzin nicht nur sehr viele Firmenbeteiligungen eingesammelt, sondern auch politische Macht und einen Medienkonzern aufgebaut. Doch seine fragwürdigen Geschäftspraktiken führten schnell zu einer grundlegenden Anklage und raschen Übernahme seiner Geschäfte durch Konkurrent:innen und den Staat. Beresowski setzte sich schon im ersten Jahr von Putins Präsidentschaft ins Exil nach London ab. Gussinski wiederum hatte sich mit seinem Medienkonzern im Hinblick auf die Berichterstattung über den Untergang des Atom-U-Bootes K-141 (Kursk) im Jahr 2000 in der Barentssee unbeliebt gemacht. Auch ihm wurden schon Ende 2000 eine Reihe von betrügerischen Aktivitäten seiner Bank „nachgewiesen“, und auch sein Firmengeflecht (mitsamt den Fernsehsendern) wurde von Tochtergesellschaften von Gazprom übernommen.
Der bekannteste und folgenschwerste Fall ist aber die Auseinandersetzung um den Ölkonzern Yukos und der tiefe Fall des Michail Chodorkowski. Dieser war durch den Ölboom und die Ausdehnung des Yukos-Konzerns Anfang der 2000er Jahre in einer sehr starken Position und versuchte auch, seinen politischen Einfluss durch Parteienfinanzierung auszubauen. Mit seinen politischen Projekten geriet er bald in direkten Konflikt mit Putin. Vor allem aber hatte Chodorkowski eine grundlegend andere Orientierung, was die Weiterentwicklung des russischen Kapitalismus betraf. Im Unterschied zu den bestimmenden Kräften der neuen Wirtschaftspolitik seit 1999 sah er nicht die Notwendigkeit einer Stärkung der Rolle des Staates in der Ökonomie, sondern im Gegenteil einer Radikalisierung der Liberalisierungen, insbesondere was die Öffnung gegenüber Weltmarkt und Kapitalimport betraf. Konkret betrieb er mit der Fusion von Yukos und Sibneft die Bildung des größten russischen Ölkonzerns, bei gleichzeitiger „Kooperation“ mit westlichen Konzernen wie ExxonMobil. Dies sollte zu einer großen Beteiligung von US-Gesellschaften an einem strategischen Konzern des russischen Kapitalismus ausgebaut werden. Eine ähnliche Ausrichtung (sein politisches Projekt nannte er entsprechend „Offenes Russland“), insbesondere auf Verbindungen zum westlichen Kapitalismus, sah er für alle Bereiche der russischen Wirtschaft als „Zukunftsprojekt“.
Die Entscheidung zwischen den alternativen Entwicklungskonzepten im herrschenden Block konnte nur durch einen entschiedenen Machtkampf gelöst werden. Der Konflikt wurde zunächst öffentlich in den Medien ausgetragen. Im Oktober 2003 wurde Chodorkowski dann unter Anklage der Unterschlagung und Steuerhinterziehung in Höhe von einer Milliarde US-Dollar verhaftet. Wer geglaubt hatte, dass sein großes Vermögen, der Protest westlicher Regierungen und Entscheide internationaler Gerichte etwas bewirken würden, sah sich getäuscht. 2005 wurden er und sein Geschäftspartner Platon Lebedew zu 9 Jahren Straflager verurteilt. Der Yukos-Konzern wurde einem der bekannten „Insolvenzverfahren“ unterzogen und letztlich sein Ölgeschäft von der staatlichen Rosneft-Gesellschaft übernommen, während Sibneft zu Gazprom überführt wurde (Gazprom Neft ab 2006).
Die Härte, mit der hier gegen einen der mächtigsten „Oligarchen“ vorgegangen wurde, führte auch dazu, dass das in den 1990er Jahren entstandene System des „Oligarch:innenkapitalismus“ eigentlich auch schon wieder vorbei war. Keine/r der Superreichen in Russland traute sich noch, in der Politik eine offene Rolle zu spielen – außer als „Berater:in“ des Präsidenten. Die auch im westlichen Kapitalismus übliche Teilung zwischen im Hintergrund agierenden großen Kapitalinvestor:innen und dem im Vordergrund stehenden Konzernmanagement setzte sich durch. Dies betrifft nicht nur die „Insiderprivatisierungen“ wie bei Lukoil, sondern durchaus auch die großen Konzerne mit mehrheitlicher Staatskontrolle wie Gazprom. Ökonomisch gesehen sind es die Managerkapitalist:innen an der Spitze der Konzerne, gleich welcher Eigentumsstruktur, die das Sagen haben, während der Staat nur allgemeine Grundlinien und Verfahrensweisen kontrolliert. Wie Dsarassow richtig bemerkt, haben die Veränderungen seit der Privatisierung die komplexe Struktur der Großkonzerne und die darauf basierende Macht des Topmanagements wenig berührt, stattdessen wurde diese mit der Schwächung der Position der „Oligarch:innen“ sogar noch verfestigt. Er[xxxviii] spricht von einer „Insiderrente“, auf der der russische Kapitalismus wesentlich beruht. Wie immer man zu seiner Analyse im Detail steht – die Tatsache, dass die russische Industrie weiterhin auch im Vergleich zu vielen westlichen Konkurrent:innen sehr stark von Großbetrieben geprägt ist, führt wie überall im Monopolkapitalismus zu einer Aneignung eines beträchtlichen Teils des Profits durch das Management (siehe Managergehälter, Boni etc.).
Nach den sehr ausführlichen Analysen von Michael Pröbsting[xxxix] zur Frage des Monopolkapitalismus in Russland arbeiten 80 % der Beschäftigten in der RF in Betrieben mit mehr als 250 Beschäftigten – im Vergleich dazu sind es in den USA 63 %, in Deutschland 54 %. 86 % der Investments in diese Großbetriebe wiederum kommen aus Russland selbst. In den 2000er Jahren hat sich insgesamt die Bedeutung des staatlich kontrollierten Eigentums konsolidiert, und dabei handelt es sich um Konzerne, bei denen der Staat einen bedeutenden Prozentsatz des Anteileigentums kontrolliert (auch Gazprom ist heute nur zu 50 % unmittelbar in Staatsbesitz). Laut Schätzungen des IWF machte dieser Sektor 2016 etwa 30–35 % der Wirtschaft aus, während sogar etwa 50 % der formellen Beschäftigung hier angesiedelt sind[xl].
Gegenüber Dsarassows These eines von den russischen Managerkapitalist:innen dominierten Blocks aus Staat und Großunternehmen vertrat Simon Pirani[xli] in einer entsprechenden Debatte die These von einer Verschiebung der Machtverhältnisse: Die größere Rolle des Staates in den 2000er Jahren drücke eine essenzielle Schwäche des russischen Kapitalismus aus, die zu einem vom Staat mehr schlecht als recht kontrollierten Zufluss von Auslandskapital geführt habe, d. h., die Kontrolle in Russland würde immer mehr vom westlichen Finanzkapital übernommen. Tatsächlich kann man speziell in der Phase 1999–2008 eine Zunahme an ausländischen Direktinvestitionen in Russland feststellen. Im Vergleich zur anhaltenden Kapitalflucht aus Russland wurden in dieser Phase durch Auslandskredite und -anteilskäufe Nettozuflüsse erzielt. Dem Argument, dass viele dieser „Auslandsinvestitionen“ tatsächlich gewaschenes russisches Geld (über Zypern, British Virgin Islands etc.) waren, entgegnet Pirani, dass dies nachgewiesen nur bei 23 % des Zuflusses der Fall gewesen sei. Dagegen seien aus Deutschland, UK und den Niederlanden 54 % gekommen. Abgesehen davon, dass viel russisches Kapital auch über die Niederlande, UK und die Schweiz recycelt wurde, ist dies allein nicht Beweis für eine Dominanz von Auslandskapital – der größte Fluss von Direktinvestitionen weltweit geschieht zwischen imperialistischen Ländern (etwa 80 %). Ein typisches Beispiel in dieser Phase ist Lukoil: Der US-Konzern ConocoPhillips kaufte 2004 7,6 % seiner Anteile, während im Gegenzug Lukoil einen Teilbereich des US-Unternehmens Getty Oil übernahm – ein Geschäft, das im Übrigen unter Vermittlung von Putin selbst zustande kam.
Sicherlich ist richtig zu bemerken, dass deutsches Kapital eine wichtige Rolle in der Expansion der 2000er Jahre spielte: einerseits durch die russisch-deutsche „Energiepartnerschaft“, die ab 2005 durch das berühmt-berüchtigte „Nord Stream“-Pipelineprojekt gekrönt wurde, andererseits durch deutsche Exporte von Waren und Kapital. Vom Beginn der 2000er Jahre bis 2008 verdoppelte sich das deutsche Exportvolumen, und Russland wurde zum wichtigsten Handelspartner außerhalb der EU. Die Direktinvestitionen betrafen vor allem Automobilindustrie, Chemie, Verkehrswesen, große Einzelhandelsketten und Energiewirtschaft. Diese umfassten Volkswagen (Werk Kaluga), BASF und Wintershall, Metro, Siemens (Hochgeschwindigkeitszüge) und E.ON (Privatisierung der Energieversorgungsunternehmen), um nur die wichtigsten zu nennen. Umgekehrt investierten russische Unternehmen in Deutschland, und zwar nicht nur Gazprom (Gazprom Germania), Lukoil und Rosneft im Energie-, sondern u. a. auch im Stahl- und Aluminiumbereich (Severstal, Evraz, RUSAL), in der Automobilindustrie etc., aber auch im deutschen Immobilienmarkt wurde viel russisches Kapital angelegt. Insgesamt stellt dieser Kapitalfluss offensichtlich eine starke strategische Verflechtung von deutschem und russischem Kapital dar, die auch der Gesamtausrichtung der beiden nationalen Gesamtkapitale entsprach (Lissabon-Agenda, multipolare Weltordnung).
Die wichtigste von Pirani genannte Vergrößerung des Einflusses ausländischen Kapitals in Russland spricht gerade nicht für die Unterwerfung des russischen Kapitals unter das Diktat der „Masters of the Universe“, des wohl als eine Art Hyperimperialismus verstandenen Diktats des US-Finanzkapitals. Die von Putin und den Konzernen betriebene neoliberale Politik war nicht auf den Druck der „internationalen Märkte“ zurückzuführen, sondern war ganz klar der Absicht zur Sicherung der eigenen Profit- und Machtbasis des eigenen herrschenden Blocks geschuldet.
Zudem muss man sagen, dass Piranis These von der wachsenden Bedeutung des Auslandskapitals nach 2008 einfach durch die Realität widerlegt ist. Auch wenn sich nach dem Kapitalabfluss 2008 Anfang der 2010er Jahre wieder eine gewisse Erholung ergab, gibt es seit 2014 eine eindeutige „nationalkapitalistische Wende“, die die Bedeutung ausländischer Direktinvestitionen noch weiter zurückgedrängt hat. Erst seit Ende der 2010er Jahre gibt es eine Zunahme bei chinesischen Investitionen. Es war aber immer eine Charakteristik des russischen Kapitalismus nach 1999, dass in strategischen Bereichen ausländisches Kapital keinen bestimmenden Einfluss erhielt. Der Staat übernahm durch seine Kontrolle und eigene Eigentumsanteile eine wichtige Schutzfunktion, tat dies aber klar im Sinne der Manager- und Oligarchenkapitalist:innen und der Sicherung ihrer Profitanteile und nicht, um ausländische Investitionen nach Russland zu bringen.
8.1 Von der Weltwirtschaftskrise 2008 bis zur nationalkapitalistischen Wende
Die globale Krise 2008 traf Russland gleich doppelt: durch den Verfall der Rohstoffpreise und den massiven Abzug von Auslandskapital. Der Ölpreis der Marke Ural fiel im vierten Quartal 2008 von 95,1 US-Dollar/Barrel auf knapp 43. Gleichzeitig gingen ausländische Direktinvestitionen von über 22 Milliarden US-Dollar im zweiten Quartal 2008 auf nur noch 9 Milliarden Anfang 2009 zurück. Kurzfristig angelegtes Kapital floh noch schneller, so wie der Aktienindex RTS von Mai bis Oktober 2008 um sagenhafte 1.900 Punkte fiel. Die russische Regierung samt Zentralbank konnte, wie anderswo auch, den Absturz nur abbremsen. 2009 fiel der Rückgang des BIP mit 7,8 % im internationalen Vergleich ziemlich stark aus. Dies war offensichtlich die Kehrseite der starken Abhängigkeit von Rohstoffexporten und einer neuen Öffnung zu den internationalen Finanzmärkten.
Allerdings war die russische Finanzwirtschaft 2008 besser vorbereitet als 1998. Die Staatsverschuldung war vernachlässigbar, die Devisenreserven kräftig und die Banken reguliert genug, dass es nicht wieder zu einem Dominoeffekt von Zusammenbrüchen kam. Die Regierung unter dem neuen Staatspräsidenten Dmitri Anatoljewitsch Medwedew (von 2008 bis 2012, bis wieder Putin übernahm) entwickelte ein Rettungsprogramm, das im Wesentlichen auf die Verhinderung von Firmenpleiten ausgerichtet war. D. h., anders als andere Länder, die auch die Nachfrageseite durch größere Investitionen oder soziale Sicherungen stärkten, konzentrierte sich die russische Regierung auf die Angebotsseite: durch große Ausdehnung der Kredit- und Subventionsvorgaben vor allem für große Betriebe (300 Milliarden Rubel an Finanzhilfen für Unternehmen, staatliche Garantien in enormer Höhe für Kreditvergaben). Die russische Wirtschaft erholte sich auch schnell: mit Wachstumsraten von 4,5 % 2010 und 5,2 % 2011. Die negativen Folgen der Krise hatte vor allem die Masse der Arbeiter:innen zu tragen. Auch wenn Entlassungen so vermieden wurden, gab es Kurzarbeit, Lohnkürzungen und Preissteigerungen. Während die Regierung den Interessen des Großkapitals voll und ganz entgegengekommen war, wuchs der Unmut in der Bevölkerung über dieses Regime.
Die Protestwelle 2011–2013 war daher auch eine Reaktion auf die soziale Krise. Die große Beteiligung von Menschen, die einfach aus Protest gegen ihre schlechte Lage auf die Straße gingen, war sicher ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal zu den „Farbenrevolutionen“ in Serbien, Georgien und der Ukraine im Jahrzehnt zuvor. Zwar wurden auch in Russland 2011 die ersten Großdemonstrationen durch Vorwürfe des Wahlbetrugs bei den Wahlen ausgelöst, aber sie waren keineswegs auf diese Fragen reduzierbar. Die Protestformen stützten sich auch weniger auf die Methoden der „Farbenrevolutionen“ als vielmehr auf die zur gleichen Zeit stattfindenden internationalen Antikrisenproteste von Spanien bis zum Arabischen Frühling. Dies macht sich zum Beispiel an den Formen der Platzbesetzungen fest, aber auch an der Art der Organisierung der Proteste. Anders als in den „Farbenrevolutionen“ wurde diese Organisierung nicht der „liberalen Opposition“ überlassen, sondern z. B. der demokratischen Selbstorganisation in den Besetzungscamps. Dazu kam, dass die „Liberalen“ durch ihre Wirtschaftspolitik in den 1990er Jahren nicht gerade als Alternative galten, und auch in Medwedews Kabinett agierten einige der bekannten liberalen Wirtschaftspolitiker:innen weiter. Sowohl der Westen als auch das Regime selbst zeichneten dagegen das Bild einer liberalen Mittelschicht, die von den „Normalbürger:innen“ isoliert sei, so dass diese daher die Unterdrückung der „liberalen Protestler:innen“ nicht weiter stören würde. Das ignorierte die tatsächliche Verankerung der Proteste damals, als immerhin Demonstrationen mit über 100.000 Menschen mobilisiert werden konnten. Überdies fanden in einer großen Zahl von Provinzstädten Proteste statt, in der es kaum liberale Oppositionelle gab.
Ihr Problem war jedoch von Anfang an ihre heterogene Zusammensetzung und das mangelhafte Aufgreifen der schwerwiegenden sozialen Probleme. Die vertretenen Hauptkräfte waren die liberale Opposition, Nationalkonservative und eine breit aufgefächerte Linke. Während die liberale Opposition sich nach dem Vorbild der „Farbenrevolutionen“ auf „Demokratie“ und „Weg mit den Wahlbetrüger:innen“ beschränken wollte, geriet sie in ihren wirtschaftspolitischen Vorstellungen (Westöffnung) in scharfen Konflikt mit der in Russland immer verbreiteter werdenden Strömung der Nationalkonservativen. Diese sahen in einer starken Binnenorientierung und einem „gesunden“ russischen „Wohlfahrtsstaat“ die Antwort auf die Probleme. Dagegen war die Linke zwar in den konkreten Mobilisierungen stark aktiv, konnte aber die Verbindung zu den sozialen Kämpfen nicht wirklich herstellen, z. B. zu den zur selben Zeit stattfindenden Streiks in der Automobilzulieferindustrie um Gewerkschaftsrechte. Aus diesen Gründen konnte die Protestbewegung keine gemeinsame politische Alternative entwickeln und wurde letztlich durch immer schärfere Repression demoralisiert.
Das Regime wurde vom Ausmaß der Proteste zunächst überrascht. Danach entwickelten sich beim Sicherheitsapparat und in der politischen Führung immer stärkere Befürchtungen vor „vom Ausland“ gesteuerten „Farbenrevolutionen“, die in Russland geplant würden. Die Repression gegen NGOs (denen Kontakte zum oder Geldzahlungen vom Ausland unterstellt wurden) und z. T. deren Verbot wurden beschlossen – ebenso von Fernsehsendern, denen ähnliche Verbindungen unterstellt wurden. Trotzdem wurden allenthalben immer wieder „Farbenproteste“ „entdeckt“ und mit Repression beantwortet, ganz zu schweigen von der Angst vor solchen „Machenschaften“ im „nahen Ausland“. Andererseits wurde ein Teil der ehemaligen Protestbewegung durchaus integriert: Die nationalistische Opposition passte zum neuen Kurs und war auch geeignet, die übrig gebliebenen „Liberalen“ im Staatsapparat zu säubern und zur Anpassung zu bringen. Eine wichtige Rolle dabei spielte auch die reaktionäre Wende im Kampf zum „Schutz der russischen Familienwerte“ und gegen „westliche Einflüsse“, wie z. B. im Hinblick auf die Akzeptanz von Homosexualität etc.
Ein wichtiger Aspekt dieser nationalistischen Wende betrifft auch die Wirtschaftspolitik. Denn das Problem der Rettungspakete und der wirtschaftlichen Erholung 2010/2011 war, dass sie nicht nachhaltig waren und stark an der zwischenzeitlichen Erholung des Ölpreises hingen. 2012 konnten die hohen Wachstumsraten nicht mehr erreicht werden, und 2013 und 2014 ging es direkt in eine neue Wirtschaftskrise (Wachstum 2014: 0,7 %, 2015: –2 %). Natürlich spielten auch die Ukrainekrise und die darauf verhängten Sanktionen eine Rolle, um eine schroffe Wende auch in der Wirtschaftspolitik zu befördern. Tatsächlich wurden auch immer mehr Politiker:innen aus dem nationalistischen Lager in den Staatsapparat integriert, so u. a. Vizepremier Rogosin (zuständig für die Rüstungsindustrie) und der Wirtschaftsberater des Präsidenten, Glasjew, (beide zuvor Mitglieder der linksnationalistischen Partei Rodina in der Duma). Beide sind nicht nur glühende Neoimperialisten, was Länder wie die Ukraine oder Belarus betrifft. Sie betrachteten die Abkühlung des Verhältnisses zum Westen geradezu als Chance für eine Neuausrichtung der russischen Volkswirtschaft. Dabei fällt Rogosin in die Kategorie der international weit verbreiteten rechtsradikalen Clowns mit mittlerem Unterhaltungswert, doch Glasjew ist ein anerkannter Wirtschaftswissenschaftler mit breitem akademischen Anhang.
Er hatte als Wirtschaftswissenschaftler mehrere Artikel über eine Wende weg von der einseitigen Abhängigkeit von Rohstoffexporten und hin zu Importsubstitution geschrieben. Tatsächlich war die russische Ökonomie angesichts der wirtschaftlichen Probleme 2014 zu einer solchen „nationalkapitalistischen“ Wende gezwungen.
Die weltwirtschaftliche Entwicklung ab 2012 war allgemein durch Stagnation geprägt und musste daher bei der hohen Abhängigkeit von Rohstoffexporten zu dem erwähnten Einbruch der Wachstumszahlen führen. Dies geschah natürlich zusammen mit der Tatsache, dass der versiegende Fluss der westlichen Auslandsinvestitionen nicht, wie einige erwartet hatten, nur vorübergehend war. Daher wurde ein Vortrag von Glasjew, den dieser vor dem Nationalen Sicherheitsrat zur Neuausrichtung der Wirtschaftspolitik 2015 hielt, sehr stark wahrgenommen. Bisher wurden Wirtschaftswissenschaften und die Wirtschaftspolitik von Zentralbank bis zu den Ministerien weiterhin von der „neoklassischen“ Orthodoxie beherrscht, während Glasjew eine klare Minderheitsposition vertrat. Er gehört allerdings dem von der russischen Rüstungsindustrie stark unterstützten nationalistischen Thinktank Isborsk-Klub an, der mit seinen Schriften zu einem russischen, eurasischen Imperialismus im Staatsapparat und in der Öffentlichkeit spätestens seit der Ukraine-Zuspitzung immer mehr Gehör findet. Als Glasjew seine Thesen vortrug, waren die „liberalen Ökonom:innen“ daher aufgeschreckt und kritisierten ihn heftig, während er in den Gesellschaftswissenschaften und unter nationalistischen Politiker:innen begeisterte Zustimmung erhielt.
Seine Präsentation begann gleich mit einer interessanten These: „Die USA versuchen, ihre Hegemonie aufrechtzuerhalten durch einen neuen Weltkrieg.“ Die Aggression gegenüber Russland, wie sie sich in der Übernahme der Kontrolle der Ukraine darstelle, sei ein zentrales Element in der Auseinandersetzung mit dem Hauptrivalen China. Die Krise der US-Hegemonie wird mit der Langen-Wellen-Theorie begründet, einer absehbaren, durch überlegenes Produktionspotenzial bedingte Überholung durch China. Mit dem Angriff auf Russland treffe man eine schwächere Macht, würde aber insgesamt die Rohstoffabhängigkeit Chinas verschärfen, insbesondere was den Bedarf Chinas an fossilen Energieträgern betrifft. Der Krieg der USA sei hybrid und würde vor allem durch Massenbeeinflussung und Nadelstiche funktionieren und militärische Macht nur als letztes Mittel erfordern. So wie in der Ukraine würde man im Wesentlichen andere dazu bringen, für sie zu kämpfen, als ginge es um die eigene Sache. Insofern besagt die zweite These, dass es das Hauptziel der US-Strategie sei, Europa und Russland in einen Krieg zu treiben und eine mögliche russisch-europäische Partnerschaft grundlegend zu untergraben. Hier beginnt Glasjew ökonomisch zu analysieren: Die Zuspitzung des Konflikts, insbesondere mit Europa, habe schwerwiegende Folgen für die russische Wirtschaft – „aufgrund der hohen Außenabhängigkeit der russischen Ökonomie folgt daraus eine grundlegende Bedrohung der nationalen Sicherheit“. Dann beginnt Glasjew (2015!) genau die Sanktionen aufzuzählen, die 2022 tatsächlich verhängt wurden – und entwickelt ein Schutzprogramm dafür. Dies betrifft die Billionen von Guthaben in Fremdwährungen, die auf Konten in Ländern unter NATO-Kontrolle angelegt sind, die Abwicklung von Welthandelsgeschäften über Institutionen wie SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication; ein weltweites Telekommunikationsnetzwerk für Banken) und über andere US-Dollar-basierte Systeme. Dies betrifft die Masse an privaten russischen Anlagen im Ausland, insbesondere zur Steuerumgehung. Wer sich fragt, wie Russland sich auf diese Arten von Problemen vorbereitet hat, findet bei Glasjew eine Reihe detaillierter Maßnahmen (z. B. Alternativen zur Zahlungsabwicklung im Rahmen der EAWU und der BRICS-Staaten, vorsorgliche Umschichtung von Devisenreserven, Drohung mit Schuldenmoratorien für Länder, die Konten einfrieren, etc.). Es ist interessant, dass gerade dieser Abschnitt von Glasjews Präsentation von den westlichen Kommentator:innen als Ausdruck besonders extremer Paranoia gedeutet wurde. Insbesondere für westeuropäische „Russlandexpert:innen“ kam die „Zeitenwende“ nämlich erst später.
Die dritte These Glasjews ist direkt gegen die liberale Mehrheit in der damals russischen Wirtschaftspolitik gerichtet: „Die russische Zentralbank dient weiterhin den Interessen der westlichen Finanzmärkte“. Trotz der Finanzkrisen 1998, 2008 und 2014 würde die Finanz- und Zentralbankpolitik weiterhin unter dem Primat der Offenmarktpolitik stehen. Stattdessen müssten, nach Glasjews Analyse, strikte Beschränkungen für ausländische Direktinvestitionen in bestimmte Sektoren, Kapitalverkehrskontrollen und das Primat der eigenen Kreditquellen gegenüber Finanzierung aus dem Ausland durchgesetzt werden. Insbesondere wurde von ihm die vorsichtige, an der Rohstoffpreisflaute orientierte Hochzinspolitik der Zentralbank kritisiert. Stattdessen müsse durch eine expansive Geldpolitik die inländische Investitionstätigkeit stimuliert werden. Die falsche Zinspolitik sei ein Diktat des IWF, genauso wie das Zulassen der Abwertung des Rubels, der zur Schwächung derjenigen industriellen Sektoren führe, die Importe aus dem Ausland ersetzen könnten, jetzt aber mit billigeren Importen konkurrieren müssten. Die vierte These bezieht sich auf Kapitalverkehrskontrollen und die Notwendigkeit, diese gegen die IWF-Diktate durchzusetzen, insbesondere um die hohe Auslandsverschuldung von russischem privaten Geschäftskapital abzubauen. Dies würde die russische Ökonomie anfällig für Finanzschocks machen und die inländische Kreditbasis schmälern. Kritiker:innen machten aus dieser Passage später, dass Glasjew de facto das Außenhandelsmonopol wieder einführen wolle.
Die zentrale These setzte Glasjew ans Ende: „Eine abhängige Ökonomie aufrechtzuerhalten, bedeutet die Niederlage im hybriden Krieg.“ Die vorgeschlagene Zielsetzung wurde kurz zusammengefasst als Modell einer „autarken Mobilisierungswirtschaft“. Die Strategie der USA könne nur durchkreuzt werden, wenn das Modell der „Einbettung in die westliche Weltwirtschaft“ überwunden werde. Dazu müssten die Bereiche, in denen Russland vom Import aus dem Westen abhängig ist, durch geförderte russische Produzent:innen ersetzt werden. Entsprechend soll vom Maschinenbau bis zur Hochtechnologie ein entsprechender Plan zum Aufbau russischer Großbetriebe in diesen Bereichen aufgestellt werden (in einem Annex wird dann sogar direkt von der Wiedereinführung der Planwirtschaft gesprochen).
Erstaunlich an dieser Präsentation bzw. den Berichten darüber in der russischen Presse ist, wie viel dazu geschrieben und diskutiert wurde. Auch im Westen gibt es etliche Rechtspopulist:innen, die die Einbettung ihrer jeweiligen imperialistischen Ökonomie als eine große Ausbeutung durch die „Globalist:innen“ oder sonstige Feind:innen sehen. Die Reaktion auf Glasjew zeigt, wie verbreitet seine Ansichten in den Spitzen der Gesellschaft und Teilen der herrschenden Klasse schon zu diesem Zeitpunkt waren. Die bekanntesten Vertreter:innen der „liberalen Wirtschaftspolitik“, die noch Ministerien und Zentralbank beherrschten, wiesen besonders seine Vorschläge zur Finanz- und Geldpolitik zurück, mit Hinweisen auf die Gefahren für Inflation und Konjunktureinbrüche durch Kapitalflucht bzw. der Warnung vor einem Zurück zur Planwirtschaft. Interessanterweise konzentrierte sich die Kritik nicht auf die drohende tiefgreifende politisch-ökonomische und möglicherweise sogar militärische Auseinandersetzung mit den USA und den notwendigen Schulterschluss auch ökonomisch mit China. Hier dürfte sich also damals schon ein gewisser Konsens gezeigt haben, dass man sich auf eine solche Konfrontationslage einstellen müsse.
Die Vorschläge Glasjews[xlii] wurden so unmittelbar nicht umgesetzt. Allerdings waren sie wohl wichtig, um ab 2015 zahlreiche kleinere Schritte in Richtung einer Abkoppelung von den westlichen Ökonomien zu setzen und den „nationalen Kapitalismus“ zu stärken.
8.2 Wirtschaftspolitische Wende nach 2015
Die schon erwähnte EAWU wurde 2015 gegründet, als Nachfolge verschiedener bestehender Kooperationsverträge (Glasjew war einer der Architekten dieser Union). Zusammen mit der SOZ und der OVKS wird hier versucht, unter Kooperation mit China einen von der „westlichen Einflusssphäre“ geschützten Bereich zu bilden, in dem russisches und chinesisches Kapital bevorzugte Bedingungen für ihre Investitionen bzw. Rohstoffbedarfe erhalten. Für den russischen Kapitalismus ist dies für die Öl- und Gaskonzerne, für Nuklear-, Rüstungs- und Weltraumindustrie, aber auch für das Agrobusiness sehr wichtig. Von den ehemaligen Sowjetrepubliken fielen hier von vornherein nur die baltischen Staaten grundlegend aus dem Zielgebiet heraus. Die Ukraine und die Republik Moldau wurden als strategisch wichtig für die Integration in die Eurasische Wirtschaftsgemeinschaft gesehen (aufgrund der auch nach Ende der Sowjetunion starken ökonomischen Beziehungen, die bis 2014 bestanden). Aserbaidschan war zwar Zielgebiet für wichtige Investitionen, wurde aber aufgrund der eigenen starken Ölindustrie und der Verbindungen zur Türkei mit besonders behandelt. Georgien ist bis heute umkämpft und Armenien durch seinen Konflikt mit Aserbaidschan ein vor allem politisch heikles Investment. Doch die übrigen ehemaligen Sowjetrepubliken sind allesamt in das dargestellte Netzwerk eingebunden.
Wesentlich ist natürlich auch der Aufbau der BRICS-Kooperation, der nicht nur zu einer stärkeren Ausrichtung der russischen Wirtschaft auf das Chinageschäft führt, sondern auch das mit Lateinamerika (nicht mehr nur Venezuela und Kuba) und Afrika belebt hat. Ein gutes Beispiel für diese Neuausrichtung ist wieder der Rohstoffgigant Nornickel des berühmt-berüchtigten Wladimir Potanin (dem es offenbar gelingt, in jeder veränderten Situation gute Geschäfte zu machen): Einerseits übernahm er de facto die Kontrolle über einen wichtigen südafrikanischen Bergbaukonzern, der wiederum kontrollierende Anteile an vielen afrikanischen Bergbaukonzernen besitzt, andererseits verlagerte er große Teile seiner Erzaufbereitungsanlagen zwecks Export nach China, das seit 2023 jetzt auch sein größter Markt ist.
Insgesamt kann man nach den Boomjahren der 2000er Jahre feststellen, dass, anders als es Glasjews düsteres Bild malt, die Abhängigkeit von ausländischen Direktinvestitionen gering ist. Im Gegenteil, seit der großen Rezession übersteigen die ins Ausland fließenden Investitionen regelmäßig die ausländischen Direktinvestitionen, wobei Letztere zu einem großen Prozentsatz rückfließendes russisches Offshorekapital sind (seit einiger Zeit wurde hier von Zypern aus in Nicht-EU-Steueroasen verschoben). Dies ergibt einen beständigen Überschuss an Kapitalexport von etwa 2–3 % des BIP[xliii] (nur während der Russlandkrise 2014 gab es eine negative Kapitalbilanz), also ein Verhältnis des Kapitalexports zum Kapitalimport, das für imperialistische Länder typisch ist (wenn auch am unteren Rand). Neu ist seit 2015 nur die Verschiebung in die bereits genannten alternativen Zielgebiete. Allerdings war die Wende für Russland bis 2022 nicht wirklich eine Öffnung Richtung China. Es wollte vor allem chinesische Investitionen, während China den Abbau von Handelsbeschränkungen anstrebte – keines von beiden Anliegen kam weit voran. Einige gemeinsame Projekte betrafen vor allem den Rohstoffsektor, wie z B. den erwähnten Bergbau, aber vor allem den Bau der Pipeline Power of Siberia, durch die seit 2019 Gas nach China strömt (seit 2023 38 Milliarden Kubikmeter). Wichtig war aber auch die Zusammenarbeit von China und der RF beim Ausbau von Kasachstan als zentralem „Verteilknoten“ für Öl und Gas durch ein umfangreiches Pipelinenetz zwischen Westsibirien, den Erschließungsgebieten rund ums Kaspische Meer, dem Iran einerseits und China andererseits. Auch die Türkei wurde inzwischen zu einer solchen „Drehscheibe“ für die Verteilung aus diesem Netz Richtung Westen – z. B. mit der TurkStream-Pipeline (derzeit etwa 32 Milliarden Kubikmeter).
Ein wichtiger anderer Bereich, der in der Umorientierung seit 2015 besonders gefördert wurde, ist das Agrobusiness (das auch zu den großen Unterstützern von Glasjew & Co. zählt). Dies war sogar das erste Thema, mit dem sich die 2015 von der russischen Regierung eingesetzte Kommission für Importsubstitution beschäftigte. Die westlichen Sanktionen führten zunächst zu einem Anstieg des Agrarhandels mit Brasilien und Serbien, aber auch zu einer Ausweitung der Agrarsubventionen, die den Sektor schon seit 2005 starkmachten. Immer wieder hatte die russische Regierung Importbeschränkungen und -zölle als Druckmittel gegen Länder wie Georgien oder die Republik Moldau genutzt. In vielen landwirtschaftlichen Sektoren ist die RF tatsächlich nicht mehr von Importen abhängig, insbesondere bei Fleisch und Getreide, aber auch Futtermitteln, Saatgut, Dünger und landwirtschaftlichen Maschinen. Was die Landwirtschaft betrifft, gibt es auch eine seit der Sowjetunion bestehende enge Verbindung mit Belarus. Das Land stellt für diesen Bereich den wichtigsten Exportmarkt der RF dar. Abhängigkeiten gibt es in gewissen Ausmaßen noch in Bezug auf Milchprodukte und Gemüse. Insgesamt hat aber die verstärkte Subventionierung des Agrarsektors das sowieso schon von großen Holdings geprägte Agrobusiness durch Zufluss weiteren spekulativen Kapitals gestärkt, was zur Erschließung weiteren, bisher nicht genutzten Landes und zu noch mehr Exportorientierung geführt hat. Im Rahmen der BRICS-Kooperation gab es seit 2014 eine gegenseitige Senkung von Zöllen für Agrarprodukte zwischen Brasilien und der RF und ähnliche Maßnahmen, die inzwischen zu einer sehr starken Verzahnung dieser beiden Giganten im globalen Agrobusiness geführt haben (insbesondere im Bereich Düngemittel, Saatgut und Tierfutter). Seit 2022 hat sich der Agrarhandel zwischen den beiden Ländern sogar verdoppelt.
Was sonstige Industrien betrifft, so gab es seit 2015 sehr unterschiedliche Erfolge der „Importsubstituierung“. Im Maschinen- und Ausrüstungsbereich wuchs die Produktion in den Jahren 2017, 2018 und 2019 um jeweils 8,3 %, 2,4 %, 13,5 %. Insgesamt machten Maschinenbau und Elektronikbranche Fortschritte, die sich für die Zulieferung an die Automobil- und Luftfahrtindustrie, Telekommunikation und Medizintechnik positiv auswirkten. Dies betrifft auch Halbleiter und Mikrochips. Auch die IT-Branche insgesamt machte Schritte in Richtung Eigenständigkeit, besonders durch die Senkung der Gewinnsteuer in diesem Bereich von 20 % auf 3 %. Unternehmen wie Kaspersky Lab (Sicherheitssoftware), 1C (CRM-Systeme; Kund:innenbeziehungsmanagement), Aschmanow (KI), Yandex/SPB (Suchmaschinen) etc. stellen eine Reihe von Ersatzapplikationen für den Dienstleistungssektor bereit, die die Standardanwendungen der US-IT-Industrie ablösen. Russische Softwaretechniker:innen gehören zu den besten der Welt. Daher ist der Erfolg dieser Unternehmen keine Überraschung.
Auch wenn es also in Teilbereichen Erfolge gab, so blieben andere Bereiche, z. B. Chemie und Kunststoffproduktion, zurück bzw. blieben die Anlageinvestitionen insgesamt auf niedrigem Niveau. Trotz der großen Ankündigungen finanzierte der Staat in diesen „strategische Investitionen“ jeweils nur zu 16 %, der Rest musste privat aufgetrieben werden. Erst 2017 wuchsen die Investitionen in diesen Bereichen um 4,8 % stärker als die Industrieproduktion, ähnlich 2018 (wobei insbesondere die hohen Investitionen in den Pipelineausbau zu Buche schlugen). Auch wuchsen in diesen Jahren paradoxerweise die Importe von Anlagegütern (die ja gerade substituiert werden sollten), was jedoch auch als Anschubinvestitionen verstanden werden kann. Insgesamt blieb die Produktivität der russischen Industrie gering, was darauf hindeutet, dass die Investitionen zwar zur Ausweitung der eigenständigen Produktion führten, aber der Rationalisierungsschub dabei gering war – kein Wunder bei den eher niedrigen Arbeitskosten. D. h., bei Abreißen der Importe in diesen Sektoren gibt es zwar inländischen Ersatz, aber zu ungünstigeren Bedingungen, was Preis und Qualität betrifft. Insgesamt blieb daher beim Export die Dominanz des Rohstoffbereichs ungebrochen – und damit auch die Abhängigkeit der russischen Wirtschaft insgesamt von Öl- und Gasexporten. Auch der Ersatz ausländischer Importe blieb relativ schwach. Immerhin wächst seit 2015 der Anteil des Handels mit China kontinuierlich. Kamen 2008 noch 33 % der Importe aus der APEC-Region (APEC: Asiatisch-Pazifische Wirtschaftsgemeinschaft), so waren es 2017 bereits über 40 %. 2023 lag allein der Anteil Chinas schon bei über 35 %.
Einen der strategisch wichtigsten und global bedeutsamsten Bereiche der russischen Ökonomie bildet der „Nuklearkomplex“. Seit 2007 wurden die verschiedenen Teile der russischen Atomindustrie im Staatskonzern Rosatom zusammengefasst. Dieser gigantische Konzern hat über 300.000 Beschäftigte und über 400 Einzelbetriebe unter sich und umfasst alles, von Uranbergbau, -aufbereitung, Atomkraftwerkbau und -betrieb, Atommüllindustrie bis hin zur Lieferung und Entsorgung atomwaffenfähiger Materialien. Seit Sowjetzeiten wurden zwar erst 7 neue Atomkraftwerke gebaut, aber die 2015 geplanten 25 % der Stromversorgung durch AKWs wurden wohl bereits erreicht (womit mehr fossile Brennstoffe exportiert werden können). Außerdem werden in etwa 7 Ländern russische AKWs gebaut (z. B. in China, der Türkei, Ungarn, 12 Reaktoren allein in Indien). Und auch das berühmt-berüchtigte Atomprogramm des Iran wird von Rosatom technisch unterstützt. Zusätzlich bietet es seit einiger Zeit „schwimmende AKWs“ an, die für viele Länder des globalen Südens als billige Variante zur Lösung ihrer Energieprobleme angesehen werden (in Russland selbst werden schwimmende Eisbrecher-AKWs in arktischen Regionen eingesetzt). Dazu ist Rosatom auch groß in den Markt der „Atommüllbeseitigung“ eingestiegen. Traditionell setzte die sowjetische/russische Atomindustrie auf Wiederaufbereitung und ist auch weiterhin führend in der gefährlichen Technologie von Brennelementerecycling und schnellen Brütern. Inzwischen nimmt Rosatom Atommüll aus der ganzen Welt – mit welchem langfristigen Konzept ist unklar. Wie hoch auch immer die gewaltigen ökologischen und nuklearen Risiken sind, die hier auf bestimmte (insbesondere von ethnischen Minderheiten bewohnte) Regionen in der RF verteilt werden – klar ist, dass dies für den russischen Staat enorme Einnahmen bringt und eine billige Quelle für atomwaffenfähiges Material liefert. Dazu kommt die Kontrolle über den Rohstoff selbst: Auch wenn in der RF selbst nur etwa 15 % des weltweiten Uranabbaus stattfinden, so gibt es durch die besonderen Beziehungen zu Kasachstan, das 40 % davon konzentriert, einen weitaus größeren Einfluss in diesem Geschäft. Außerdem hat Rosatom Anfang der 2010er Jahre den kanadisch-südafrikanischen Konzern Uranium One übernommen, über den inzwischen in vielen Ländern der Welt bestimmte Beteiligungen im Uranbergbau erworben wurden, insbesondere in Afrika. Rosatom ist damit in der Atomindustrie einer der wichtigen globalen Player neben Framatome, Cogema (beide Frankreich), Cameco (Kanada) und ERA (Australien).
In diesem Zusammenhang muss auch noch die russische Raumfahrt erwähnt werden, nachdem 2016 sämtliche Aktivitäten in diesem Bereich im Staatskonzern Roskosmos zusammengefasst wurden. Insbesondere seit 2000 hatte die russische Raumfahrt durchaus Vorteile, da einerseits der Bedarf an Satelliten und Frachtflügen (z. B. zur internationalen Raumstation ISS) stark anstieg, andererseits NASA und ESA Wachstumsprobleme aufwiesen. Seit 2014 nehmen die Aufträge aus dem Westen stark ab, und mit SpaceX etc. entsteht eine große private Konkurrenz. Dies kann nur teilweise durch andere Nutzer:innen, z. B. aus China und Indien (die inzwischen aber beide über eigene Raumfahrtprogramme verfügen), ausgeglichen werden, so dass Roskosmos hochgradig defizitär ist. Inzwischen nutzt es außer dem berühmten Raumfahrtbahnhof Baikonur in Kasachstan auch zwei direkt in der RF gelegene Startplätze, Wostotschny im Amurgebiet und Plessezk bei Archangelsk. Von Ersterem können inzwischen die neuen Angararaketen (Nachfolgerinnen der Proton) starten, die zu den leistungsstärksten Frachtraketen gehören und mit einem wiederverwendbaren Booster ausgestattet sind. Letzterer wird vor allem militärisch verwendet, auch für Tests von Interkontinentalraketen. Da China durch die USA seit langem aus internationalen Raumfahrtprogrammen ferngehalten wird (Veto der Beteiligung Chinas an der ISS), gibt es zwangsläufig eine engere Kooperation der aufstrebenden Raumfahrtprogramme Chinas mit dem kriselnden Roskosmos. Sichtbarstes Zeichen dafür ist die geplante gemeinsame Mondstation ILRS (International Lunar Research Station), für die 2025 die ersten Module gelandet werden sollen – dies in Konkurrenz zum Artemis-Programm der USA, einer Raumstation im Mondorbit.
Insgesamt bleibt das Geschäft mit Gas, Öl und selbst mit Kohle weiterhin zentral für die Weltmarktpräsenz der russischen Volkswirtschaft. Seit den Einbrüchen rund um die globale Rezession versuchen Staat und die großen drei (Gazprom, Lukoil, Rosneft), diese Industrie zu modernisieren und die Aktivitäten im In- und Ausland auf neue Gebiete auszudehnen. Im Ausland zählen dazu vor allem Investments und Joint Ventures in Usbekistan, Kasachstan, Aserbaidschan, Irak und Venezuela. In Venezuela startete Rosneft 5 große Joint Ventures (unter anderem am Orinoco), während gleichzeitig russische Banken für Milliardenkredite sorgten (die inzwischen immer wieder restrukturiert werden), damit Venezuela diese Fördergebiete erschließen und auch Milliarden an Rüstungsgütern aus Russland beschaffen kann. Auch wenn die Geschäfte derzeit nicht viel Profit abwerfen, scheint Russland sich mit dem Engagement in Venezuela langfristig eines der Gebiete mit den größten Erdölreserven der Welt sichern zu wollen. Außerdem wurde wohl auch dafür gesorgt, dass der Sicherheitsapparat Venezuelas eine feste Stütze des gegenwärtigen Regimes bleibt. Unmittelbar profitabler waren wohl die Geschäfte im Irak, insbesondere in den kurdisch kontrollierten Teilen. Seit 2017, als Rosneft aufgrund wieder steigender Ölpreise einen großen Einnahmesprung machte, begann der Konzern, stark im Auslandsgeschäft zu investieren – dazu zählte z. B. 2017 der 1,3-Milliarden-US-Dollar-Kredit an die kurdischen Gebiete im Irak zur Erschließung der Erdölfördergebiete um Kirkuk.
Die wichtigste Expansion findet jedoch in der RF selbst statt. Da die Erschöpfung der Lagerstätten in Westsibirien in den nächsten Jahrzehnten absehbar ist, wurden umfangreiche Projekte zur Erschließung neuer Fördergebiete in Ostsibirien und in der Arktis gestartet. Dazu zählen die wahrscheinlich größten noch unerschlossenen Öl- und Gasfelder der Welt bei der Insel Sachalin. Die derzeit dort in Erschließung befindlichen 6 Ölfelder östlich der Insel sollen eine die Nordsee bei weitem übersteigende Lagerstätte darstellen. Auf Sachalin wird auch die weltgrößte Anlage für die Erzeugung von Flüssigerdgas betrieben (von Gazprom mit einigen japanischen Partner:innen), das in großen Mengen an Japan geliefert wird (5 % des LNG weltweit stammen heute daher). Ebenso wird das riesige Gebiet der Republik Jakutien (Sacha) (etwa so groß wie Indien, aber mit einer Bevölkerungszahl kleiner als München) mit seinen bisher großen, nicht erschlossenen Öl- und Gasvorkommen durch den Anschluss an die Power-of-Siberia-Pipeline seit 2019 bedeutsam. Dieses Gas wird inzwischen bis nach Wladiwostok transportiert, wo es über Flüssiggasterminals in den ganzen pazifischen Raum exportiert wird. Ein weiteres Terminal befindet sich auf der arktischen Halbinsel Jamal (Samojeden-Halbinsel) im Gebiet der Jamal-Nenzen (Oblast Tjumen). Seit 2017 starten hier LNG-Eisbrechertanker, die Flüssigerdgas innerhalb überraschend kurzer Zeit nach Westeuropa transportieren können, das auch nach Umladen ohne Probleme bis heute in Rotterdam ins europäische Gasnetz gespeist wird (trotz Sanktionen).
Durch die Erderwärmung werden inzwischen die riesigen Bodenschätze in der Arktis erschließbar. Hier werden global 13 % der Ölreserven, 30 % der Gasvorräte und 20 % der natürlichen Flüssiggasvorkommen vermutet. Bisher haben Russland, Kanada, Norwegen und Dänemark (über Grönland) den besten Zugriff auf die Erschließung dieser enormen Reserven – natürlich wollen aber auch die USA und China mit dabei sein. Mit ihrer Nationalen Arktis-Strategie von 2020 hat die Russische Föderation auf etwa 58 % der Rohstoffe der Arktis Besitzanspruch erhoben – und damit praktisch den „Kalten Krieg“ um die Region eröffnet. Diese Strategie umfasst nicht nur ökonomische Erschließungspläne (wie sie um Jamal herum exemplarisch vorangetrieben wurden), sondern auch ihre militärische Absicherung, z. B. durch die neue Klasse von Atom-U-Booten, wie die Archangelsk, die auch unter Eis operieren können.
9. Neue Großmachtpolitik Russlands
Auf Grundlage des wirtschaftlichen Aufschwungs der 2000er Jahre, der beschriebenen Wendepunkte um den Kosovokrieg und des siegreichen zweiten Tschetschenienkriegs vollzog sich auch eine „Wiederkunft“ russischer Großmachtpolitik. Wie in der Rede Putins auf der Münchener Sicherheitskonferenz 2007 deutlich geworden ist, sah sich Russland einer Offensive der USA ausgesetzt, die eine „unipolare Weltordnung“ durchsetzen wollten. Durch die NATO-Beitritte Polens, Tschechiens und Ungarns 1999 und die weiteren Beitritte 2004 (Bulgarien, Rumänien, Slowenien, Slowakei und die baltischen Staaten) sah sich Russland unmittelbar herausgefordert. Der Kosovokonflikt, das dortige Eingreifen der NATO und der Prozess der Anerkennung des Kosovo (der 2008 abgeschlossen wurde) wurden als Muster einer Angriffsperspektive auch auf die Russische Föderation gesehen. Als zukünftige Konfliktpunkte wurden schon damals die Ukraine und, noch unmittelbarer, Georgien eingeschätzt.
9.1 Georgien
Mit der „Rosenrevolution“ 2003 wurde der im Westen als liberaler Musterdemokrat gefeierte Micheil Saakaschwili Staatspräsident, der sogleich eine „Befreiung“ vom russischen Einfluss und eine Beitrittsperspektive zu EU und NATO anstrebte. Dabei hatte er ein spezielles nationales Problem geerbt: die beiden „abtrünnigen“ Regionen Abchasien und Südossetien, beide an der Südgrenze der Russischen Föderation gelegen. In Abchasien war bereits am Ende der Sowjetunion ein Krieg ausgebrochen, den Georgien gegen die Unabhängigkeitsbefürworter:innen 1991 verlor. In beiden Regionen wurden die Unabhängigkeit verkündet und GUS-Friedenstruppen stationiert. De facto verlor die Zentralregierung in Tiflis damit die Kontrolle über etwa ein Fünftel ihres Territoriums, über den wichtigen Schwarzmeerhafen Sochumi und das landwirtschaftlich wichtige Abchasien (Zitrusfrüchte, Tee). Das aufstrebende Saakaschwili-Regime wollte die Kontrolle über diese „von Marionetten Moskaus“ beherrschten Regionen unbedingt zurückgewinnen und strebte auch entsprechende Militärhilfe aus den USA an. Umgekehrt nutzte die russische Regierung die Anerkennung des Kosovo durch den Westen, um ihrerseits die Unabhängigkeit von Abchasien und Südossetien anzuerkennen. Nach unzähligen Scharmützeln von 2007 bis 2008, vor allem in Südossetien, marschierte die georgische Armee im August 2008 in Südossetien ein. Die russische Armee schlug sofort und sehr erfolgreich zurück und unterbrach mit der Eroberung von Gori (Zentralgeorgien) auch die Verbindung von Tiflis zum Schwarzen Meer. Saakaschwili musste einen demütigenden Rückzug und einen von der EU vermittelten Friedensplan akzeptieren. Abchasien und Südossetien sind seither nicht mehr Teil Georgiens, werden allerdings nur von der Russischen Föderation, Venezuela, Nicaragua und Syrien als unabhängige Staaten anerkannt. Abchasien wurde in das russische Agrobusiness eingegliedert, ist ein wichtiger russischer Tourismusstandort und beherbergt viele Militärbasen. Südossetien strebt die Vereinigung mit der nördlichen Teilrepublik Nordossetien-Alanien an.
Saakaschwili musste sich in Georgien aufgrund seiner nicht sehr erfolgreichen Russlandpolitik einer starken inneren Opposition erwehren, die er 2008 mit immer autoritäreren Mitteln bekämpfte. Damit verlor er auch seinen wichtigsten Unterstützer, den Oligarchen Bidsina Iwanischwili. Dieser hatte in den 1990er Jahren in Russland (wie oben beschrieben) Milliarden verdient, um sie in den 2000er Jahren in seiner Heimat zu investieren. Praktisch alle privaten georgischen Investitionen gehören zu seinem Imperium – andere georgische Oligarchen, wie Kachaber Bendukidse, waren unter Saakaschwili eher dadurch aufgefallen, dass sie georgische Unternehmen an ausländisches Kapital verkauften. Als Iwanischwili die gegenüber Russland zu forsche Politik Saakaschwilis nicht mehr als günstig für seine Investitionen einschätzte, gründete er selbst eine Partei, den Georgischen Traum. Diese gewann 2012 die Parlamentswahlen und stellt seitdem ununterbrochen die georgische Staatsführung. Seither versucht Georgien, ähnlich wie es die Ukraine lange tat, eine Schaukelpolitik zwischen EU und Russland. 2022 entschied sich Iwanschwili letztlich für Russland als „das kleinere Übel“. Auch wenn die Proteste gegen den Wahlbetrug 2024 die zerstrittene Opposition wieder vereint haben, so dürfte die wirtschaftliche Macht der georgischen Oligarchie hier kaum mehr zu brechen sein. Zumindest bezüglich Georgien dürfte Russland in der seit 1990 andauernden Auseinandersetzung gegenüber dem Westen einen Punktsieg erlangt haben.
9.2 Russland als Atommacht
Nach Georgien 2008 wurde Russland von den USA wieder klar als Rivale in der Weltpolitik wahrgenommen. Während des Georgienkrieges gab es wohl Überlegungen, auf der Seite Georgiens einzugreifen, aber angesichts der Probleme im Irak und Afghanistan und der neuen Stärke der russischen Streitkräfte nahmen Bush Jr./Cheney davon wieder Abstand. Erst seit etwa 2010 – siehe Ukraine nach 2014 – bereiteten sich die USA wieder stärker auf die Konfrontation mit Russland vor.
In Russland wurde ab 2008 eine neue Militärdoktrin (Serdjukow-Reform) umgesetzt, die die russischen Streitkräfte „verschlanken“ und modernisieren sollte. Deren Ziel war die Vorbereitung auf schlagkräftige Einsätze im postsowjetischen Raum zur Eindämmung einer/s äußeren Feind:in, der/die mehr oder weniger als NATO/Westen umschrieben wurde. Mit der Reform wurde die Armee auf etwa eine Million aktive Soldat:innen konzentriert und ein kleineres Offizierskorps gebildet. Damit besitzt Russland weiterhin eine der größten Armeen der Welt – neben China, den USA und Indien. Dies sowohl, was die Zahl der Soldat:innen (USA: 1,3 Millionen) als auch, was die Militärausgaben betrifft (Russland 2024: 130 Milliarden US-Dollar, über 6 % des BIP; USA: 916 Milliarden, 3,4 % des BIP. Gleichzeitig ist Russland der zweitgrößte Waffenexporteur nach den USA. Spätestens nach dem Georgienkrieg musste man es als Großmacht aufgrund der Größe seiner Armee wieder ernst nehmen.
Dazu kommt, dass Russland mit dem Budapester Memorandum von 1994 sämtliche Atomwaffen der ehemaligen Sowjetunion unter seine Kontrolle brachte. Auch wenn es etwa 9 Staaten gibt, die Atomwaffen besitzen, so sind es tatsächlich nur zwei, die wirklich als „Atommächte“ bezeichnet werden können. Denn nur die USA und Russland besitzen Erst- und Zweitschlagkapazitäten, die jede/n Gegner:in völlig zerstören könnten. Russland besitzt mit über 6.000 Atomsprengköpfen inzwischen das größte einsetzbare Arsenal (USA: um die 4.000). China, UK und Frankreich liegen hier nur im niedrigen dreistelligen Bereich, alle anderen, wie Israel oder Indien, eher im zweistelligen. Zusätzlich besitzen die russischen Nuklearstreitkräfte sämtliche Trägersysteme (von Interkontinentalraketen über strategische Bomberflotten und Atom-U-Boote bis zu Mittel- und Kurzstreckenraketen). Bedenklicher Weise sind so gut wie alle während und kurz nach dem Kalten Krieg abgeschlossenen Begrenzungsabkommen (START I + II [strategische Systeme], INF [Mittelstreckensysteme], ABM [anti-ballistische Systeme]) inzwischen nicht mehr in Kraft oder ausgesetzt. Dass die Drohungen eines Atomeinsatzes während des Ukrainekrieges durch „westliche Expert:innen“ als „Bluff“ abgetan werden, kann da wenig beruhigen. Wozu leistet man sich ein derart teures Waffenarsenal, wenn es nur als eine Art Theaterkulisse dienen soll?
Immerhin liefert der Status Russlands als Atommacht auch die Grundlage für seine Rolle in der UNO – als Mitglied im Weltsicherheitsrat. Die besondere Rolle der RF als Atommacht kommt auch in der weltpolitisch bedeutsamen Auseinandersetzung um das iranische Atomprogramm zum Ausdruck. An sich waren, historisch gesehen, die russisch-persischen Beziehungen nicht die besten, was sich bis zum sowjetisch-iranischen Krieg nach dem 2. Weltkrieg und der Unterdrückung der Tudeh-Partei fortsetzte. Mit dem Sturz des Schah-Regimes und der Etablierung der Islamischen Republik gab es zunächst jahrelang eine Art „neutrales“ Verhältnis. Erst etwa seit dem Jahr 2000 und den Auseinandersetzungen um das Atomprogramm des Iran hat sich hier eine starke Verschiebung ergeben. Zunächst waren es einfach die russischen Atomkonzerne, die die vorher von westlichen gebauten Atomkraftwerke übernahmen. Dazu kam dann das Bestreben des Iran, selbst Brennelemente zu produzieren und dabei ebenso mit Rosatom zu kooperieren. Dieses Ansinnen wurde von den USA und Israel von Anfang an als Programm zur Produktion von Atomwaffen verurteilt. In den jahrelangen Verhandlungen um Begrenzung und Überwachung des Atomprogramms spielte Russland in IAEO (Internationale Atomenergie-Organisation), UNO und den jeweiligen „Kontaktgruppen“ eine wesentliche Rolle. Dabei ging es nicht nur um wirtschaftliche Interessen der russischen Atomindustrie (und auch der Kooperation im Öl- und Gasgeschäft), sondern auch darum, den Einfluss Russlands in seinem „Nahen Osten“ wiederherzustellen. Die US-Sanktionen nach 2010, kurz unterbrochen durch den „Iran-Deal“, der 2018 von Trump wieder gekündigt wurde, erschwerten die Irangeschäfte beträchtlich. Aufgrund der Russlandsanktionen nach 2022 intensivierten sich die Geschäftsbeziehungen allerdings umso mehr. Dabei ist der militärischen Zusammenarbeit jedoch eine gewisse Schranke gesetzt, da Russland auch besondere Beziehungen zu Israel pflegt. Einerseits sind ja ein Fünftel der jüdischen Bevölkerung Israels russischstämmig und pflegen weiterhin Kontakt zur „alten Heimat“, andererseits gibt es größere russische Investments in Israel (viele der bekannten Oligarch:innen besitzen sogar russisch-israelische Doppelstaatsbürgerschaften). Deshalb und aufgrund der besonderen Beziehungen insbesondere der rechten Parteien Israels zu Russland beteiligt sich Ersteres auch nicht an den Ukrainesanktionen gegen Russland und hält sich auch zurück, was Lieferungen bestimmter Waffensysteme an die Ukraine betrifft. Umgekehrt bedeutet das auch, dass Russland sich in Bezug auf den Iran bei allem zurückhält, was direkt mit Atomwaffen zu tun haben könnte (nicht jedoch z. B. bei Flugabwehrsystemen).
9.3 Naher Osten und Afrika
Die erfolgreichsten Nahost-Interventionen betrafen aber sicherlich 2015–2017 die im syrischen Bürgerkrieg und Libyen 2014 bis heute. Die Intervention in Syrien war Mitte der 2010er Jahre geeignet, um die Effizienz russischer Auslandseinsätze für verbündete Regime zu demonstrieren. Sie war auch deswegen dafür günstig, da der westliche Imperialismus im syrischen Bürgerkrieg wenig eigene Verbündete und keine essenziellen eigenen Ziele verfolgte (nur vermittelt über die Türkei und arabische Verbündete, bzw. später in den kurdischen Gebieten, was den Anti-IS-Kampf und die dortigen Ölfelder betraf). Der russische Einsatz 2015–2017 war begrenzt und umfasste nur Luftwaffen- und Lenkraketen-Zerstörer-Einsätze zur Unterstützung der Regierungstruppen (und deren Verbündeter, insbesondere der Hisbollah). Die 50–80 Luft-/Raketenangriffe pro Tag bei einem Expeditionskorps von 2.000 Soldat:innen waren aus der Sicht des Regimes effektiv und die russischen Verluste gering. Während der Intervention konnte Suchoi auch neuere Flugzeugtypen und -ausrüstungen testen. Wahrscheinlich gab es auch am Boden Einsätze der berüchtigten Wagner-Söldner:innen. Beim Zusammenbruch des Assad-Regimes Ende 2024 ist sicher nicht das russische Expeditionskorps das Problem gewesen. Nach den Berichten sowohl von russischer Seite als auch der Hisbollah waren die syrischen Regierungstruppen einfach nicht mehr in der Lage oder willens weiterzukämpfen. Wenn die eigenen Bodentruppen nicht kämpfen, dann helfen Unterstützungskontingente auch nichts mehr. Allerdings war die russische Rüstungsindustrie der wichtigste Waffenlieferant für Syrien, und auch sonst waren russische Importe wichtig, und deshalb scheint das neue HTS-Regime auch weiterhin Beziehungen zu Russland aufrechtzuerhalten und die Militärbasen an der Küste nicht in Frage zu stellen – eine eher zynische Haltung nach den zum Teil verbrecherischen Angriffen auch auf zivile Ziele während der Luftwaffeneinsätze. Außerdem haben die russischen Streitkräfte ihre wichtigsten Einheiten von dort inzwischen nach Libyen verlagert.
Die Intervention im libyschen Bürgerkrieg war zwar öffentlich nicht so bekannt und spektakulär, aber aus heutiger Perspektive zumindest erfolgreicher. Im zweiten libyschen Bürgerkrieg seit 2014 unterstützt Russland die abtrünnige Regierung im Osten (Tobruk) um General Chalifa Haftar – zusammen mit Ägypten und den VAE –, während die Regierung in Tripolis vom Westen und besonders von der Türkei unterstützt wird. Die Unterstützung durch Russland betrifft nicht nur massive Waffenlieferungen (gemeinsam mit Belarus), sondern auch den Einsatz von angeblich 3.000 Wagner-Söldner:innen. Nachdem die Eroberung von Tripolis durch die Haftar-Truppen 2019 gescheitert war, kam 2020 durch Vermittlung Erdogans und Putins eine Waffenruhe zustande. Diese wird seither immer wieder gebrochen und Friedensverhandlungen kommen nicht sehr weit. Jedenfalls ermöglicht dies Russland, im Osten Libyens größere Militär- und Marinebasen aufzubauen, die zentrale Anlaufpunkte für seine Interventionen in Afrika darstellen.
Nach den Ereignissen im Ukrainekrieg wurde die „Wagner-Truppe“ inzwischen umgruppiert und wird vor allem für Einsätze auf dem afrikanischen Kontinent verwendet. Sie ist jetzt keine private Söldner:innentruppe mehr, sondern ist dem Verteidigungsministerium unterstellt und nennt sich jetzt Afrikakorps. Nach den Umstürzen in Mali, Burkina Faso und Niger wurde von den jeweils neuen Machthabern russische Unterstützung angefordert, und diese Länder haben Rüstungsgüter samt einigen hundert Soldat:innen dieses Korps erhalten. Man kann sagen, dass Russland auf dem Weg ist, Frankreich im Maghreb und der Region südlich der Sahelzone als wichtiger militärisch-politischer Player abzulösen.
9.4 Zentralasien und Kaukasus
Im Zentrum des Agierens der Russischen Föderation als Großmacht stehen aber sicherlich die Nachfolgestaaten der Sowjetunion. Hierbei spielen die erwähnten Bündnisstrukturen (EAWU, SOZ, OVKS) eine wichtige Rolle. Damit wurden bereits auch einige Militäreinsätze zur Sicherung „befreundeter“ Regime durchgeführt, insbesondere in Tadschikistan und Kasachstan. Georgien (Abchasien, Südossetien) wurde schon erwähnt. Ebenso beinhaltet die Union mit Belarus auch eine beträchtliche Militärkooperation (seit einiger Zeit auch Stationierung von Atomwaffen). Eine Reihe von ethnischen bzw. globalen Konfliktherden bedingt ein nicht unbeträchtliches Netz von Militärbasen und „Sicherheitskooperationen“ in Zentralasien. Einer dieser Brennpunkte ist das Ferghanatal: In diesem nur 300 km langen und 110 km breiten Tal zwischen Tian Shan (Tienschan) und Alaigebirge sind 20 % der Bevölkerung Zentralasiens konzentriert und dieses Gebiet ist durch eine sehr komplizierte Grenzziehung zwischen Kirgisistan, Usbekistan und Tadschikistan gekennzeichnet, die sich mit den ethnischen Verteilungen nur bedingt deckt. Durch die immer wieder aufflammenden bewaffneten Konflikte rund um bestimmte Grenzen und die starken wirtschaftlichen Interessen russischer Konzerne (Uran, Gas etc.) hat dies zu einer beständigen russischen Militärpräsenz geführt. Mitten im Ferghanatal liegt als bekanntestes Beispiel die russische Airbase Kant (Kirgisistan) mit etwa 50 Suchoi-Flugzeugen. Bei mehreren Konflikten wurden die dort stationierten 500 Uniformierten durch rasche Verlegung von Fallschirmjäger:innentruppen unterstützt. Die kirgisische Regierung vergütet Russland für diese Basis durch die russische Beteiligung an kirgisischen Staatsunternehmen. Tadschikistan verzeichnet sogar eine weitaus höhere russische Militärpräsenz. Dort wurde nach dem Rückzug aus Afghanistan eine Division mit 12.000 Soldat:innen belassen, die auch nach dem Ende der Sowjetunion von der neuen tadschikischen Regierung als „Stabilitätsfaktor“ beibehalten wurde, heute mit etwa 6.000 in russischem Sold Stehenden. Dies ist wohl hauptsächlich als Absicherung gegenüber „Problemen“ aus Afghanistan zu sehen (tatsächlich drohte der Krieg dort Anfang der 1990er Jahre, nach Tadschikistan überzugreifen).
Außerhalb Zentralasiens und Georgiens sind insbesondere die Interventionen und Stationierungen in der Republik Moldau und in Armenien/Aserbaidschan bedeutsam. Das Verhältnis Russlands zu Armenien und Aserbaidschan ist seit Zarenzeiten durch das klassische Teile-und-herrsche-Prinzip geprägt. Bei diesen beiden Nachfolgestaaten der Sowjetunion wird die Vorstellung von „lupenreinen Nationalstaaten“ mit „völkerrechtlich klaren Grenzen“ besonders absurd. Ohne hier auf die komplexe Geschichte der armenischen Ethnie in Anatolien und im Kaukasus eingehen zu können, ist klar, dass der antiarmenische Nationalismus sowohl in der Türkei als auch bei den Aseris stark ausgeprägt ist – bis hin zur Bereitschaft zum Genozid. Vom Autokraten Aserbaidschans, Alijew (İlham Heydər oğlu Əliyev), ist denn auch zu hören, dass Armenien ein historisches Konstrukt und heute eigentlich Siedlungsgebiet der Aseris sei. Insbesondere wird dies durch die Region Bergkarabach brisant, die historisch gesehen eine Mischung aus Armenier:innen und Aseris beheimatet (Karabach ist eine Kaukasusregion, deren „hochgelegener“ Teil Nagorny Karabach, wörtlich „Oberes Karabach“, hauptsächlich armenisch, während der tiefergelegene Teil v. a. von Aseris besiedelt ist). Zum Ende der Sowjetunion brach hier ein Bürgerkrieg bzw. Krieg zwischen Armenien und Aserbaidschan aus, der bis 1994 dauerte und mit der Errichtung der armenisch beherrschten Republik Arzach und der Vertreibung von etwa 160.000 Aseris endete. Das militärisch und ökonomisch eher schwache Armenien konnte sich dabei nur durchsetzen und auch dem Druck danach lange standhalten, weil es Unterstützung aus der Russischen Föderation erhielt. Lange Zeit bewirkte dieser Konflikt daher die besondere Nähe Armeniens zu den verschiedenen internationalen Projekten Russlands: Mitgliedschaft in der EAWU, Mitglied im OVKS etc. Zuletzt waren 3.000 Soldat:innen als „Friedenstruppen“ letzterer Vertragsgemeinschaft (d. h. im Wesentlichen russische) in Karabach (vor allem in deren Hauptstadt Stepanakert) stationiert. Allerdings fand 2018 auch in Armenien eine „Farbenrevolution“ statt, die den etwas moskaukritischeren Nikol Pashinjan an die Macht in Jerewan (Eriwan) brachte. Auch wenn er oft als prowestlich dargestellt wird, ist er auch nur einer jener populistischen Autokrat:innen im postsowjetischen Raum, die versuchen, durch eine Schaukelpolitik zwischen dem Westen und Russland zu profitieren. Doch seine Versuche, durch die Drohung der Annäherung an EU und NATO die Russische Föderation zu stärkerer Unterstützung für Arzach (Bergkarabach) zu gewinnen, gingen ziemlich schief. Die Unsicherheit im Hinblick auf das armenische Regime und die komplexen neuen Beziehungen Russlands zur Türkei und zu Aserbaidschan bewirkten wohl, dass sich die RF im Zuge des zweiten Bergkarabachkrieges (seit 2020) nicht mehr stark für Armenien engagierte. Entsprechend agierten die „Friedenstruppen“ bei der siegreichen Offensive Aserbaidschans sehr passiv. Als Aserbaidschan 2023 das Gebiet ganz eroberte und die Existenz der Republik Arzach beendete, rührte Moskau keinen Finger – diesmal wurden über 100.000 Armenier:innen vertrieben. Die Zukunft der Region wie auch der russisch-armenischen Beziehungen, samt den russischen „Friedenstruppen“, ist ungewiss, ebenso wie die der „Friedensgespräche“, die eine neue Grenzziehung bzw. eine eventuell andere Autonomieregelung erzielen sollen.
9.5 Republik Moldau
Wenn ein „National“staat als Konstrukt zu bezeichnen ist, dann hat die Republik Moldau diese Kennzeichnung sicherlich verdient. In der Grenzregion am Schwarzen Meer zwischen Zarenreich und Osmanischem Reich wurden verschiedene Pufferstaaten immer wieder neu zusammengestückelt. Aus dem ursprünglich rumänischen Kernfürstentum Moldau wurde von den Osman:innen 1812 der östliche Teil (der heutige überwiegend rumänischsprachige Teil Moldawiens) zusammen mit dem Budschak (direkt an der Schwarzmeerküste liegend) an das Zarenreich abgetreten – und dort als Bessarabien bezeichnet. Nach vielen weiteren „Umgruppierungen“ kam in der Zeit der Sowjetunion nach 1945 ein Gebiet am östlichen Dneprufer dazu (das heutige Transnistrien), während der Budschak an die Ukraine fiel. Somit ist der westliche Teil Moldawiens wesentlich rumänischsprachig, während es im östlichen Teil starke russisch- und ukrainischsprachige Volksgruppen gibt. Dazu kommen im Süden, an den Budschak angrenzend, große bulgarische und gagausische Minderheiten (Gagaus:innen: Turkvolk mit türkischem Dialekt) . Die „Bessarabier-Deutschen“ wurden während des Hitler-Stalin-Pakts großenteils nach Deutschland und Österreich „umgesiedelt“. Das Land ist landwirtschaftlich äußerst produktiv und traditionell mit dem Schwarzmeerhafen Odessa aufs Engste verbunden.
Nach dem Ende der Sowjetunion sahen die rumänischen Nationalist:innen Moldawiens ihre Stunde gekommen, um die jahrzehntelange Russifizierung abzuschütteln, z. B. mit der Einführung von Rumänisch als Staatssprache und dem Plan des Anschlusses an Rumänien. Dies führte schon 1990 zur Unabhängigkeitserklärung Transnistriens und Gaugasiens von der Republik Moldau. Gaugasien gliederte sich jedoch nach der Verhandlung eines umfangreichen Autonomiestatuts 1994 wieder ein. In Transnistrien versuchte es die moldawische Führung 1992 mit militärischer Gewalt, wurde aber von den recht gut organisierten transnistrischen Milizen zurückgeschlagen. Daraufhin intervenierte die Russische Föderation. In der Sowjetrepublik Moldawien war bis 1990 die 14. Gardearmee stationiert, doch mit deren Unabhängigkeit zog sich diese Armee bzw. das, was von ihr übrig war (etwa 6.000 russischsprachige Soldat:innen), im Wesentlichen nach Transnistrien zurück. Mit dem Ausbruch der Kämpfe um Transnistrien unterstellte Jelzin diese „Armee“ dem Oberkommando der Russischen Föderation und ernannte seinen „Chefmilitär“, Generalleutnant Lebed, zum Sekretär des Föderationssicherheitsrats. Dieser verlagerte auch einen großen Teil der Waffendepots aus Odessa nach Transnistrien. Somit entstand um Tiraspol (der Hauptstadt Transnistriens) eine hochbewaffnete Militärpräsenz der Russischen Föderation, mit heute wahrscheinlich etwa 3.000 Soldat:innen, unterstützt durch etwa 10.000 prorussische Paramilitärs und 4.500 reguläre transnistrische Soldat:innen. Die Republik Moldau ist nicht in der Lage, diese Militärmacht auch nur annähernd herauszufordern. Alle Versuche, den „eingefrorenen Konflikt“ zu lösen, etwa durch die Bildung einer Föderation (die auch von den Gaugas:innen verlangt wurde), sind bisher gescheitert. Aus der Ukraine wurde natürlich nach den Vorstößen der russischen Armee im Süden eine Zangenbewegung auch aus Transnistrien Richtung Odessa befürchtet. Inzwischen wurde die für die Energieversorgung sehr wichtige Gasleitung durch die Ukraine nach Moldawien/Transnistrien Ende 2024 durch Kiew gekappt – allerdings wird die Versorgung jetzt über die TurkStream/Balkan-Pipeline ersetzt, je nachdem, ob die Republik Moldau ihre Schulden bei Gazprom bezahlt (hier ist der russischen Regierung offenbar der Druck auf die moldawische Politik wichtiger als die Energieprobleme ihrer transnistrischen Verbündeten, die bisher russisches Gas im Gegensatz zu Restmoldawien kostenlos erhalten hatten).
9.6 Ukraine
Die spektakulärste Ausprägung russischer Großmachtpolitik ist aber sicherlich die langwierige und vielfältige Intervention in die postsowjetische Entwicklung der Ukraine. Wie in anderen Nachfolgerepubliken gab es auch in der Ukraine einen Widerstreit zwischen fortbestehenden Verbindungen zur Russischen Föderation und neuen Einflüssen aus „dem Westen“. Überall gab es eine Skala von eher großem russischen (Zentralasien) bis eher großem westlichen Einfluss (Baltikum). Die Ukraine, Restmoldawien und Georgien waren lange Zeit gerade die Halbe-Halbe-Fälle, die mal eher dorthin, mal eher in die andere Richtung tendierten. Gerade die Ukraine wies sowohl in Bezug auf ihr Agrobusiness, Bergbau- und Grundstoffindustrien im Osten, Tourismus (Krim), IT-Industrie etc. sehr starke ökonomische Verbindungen zu russischen Unternehmen auf und profitierte auch weiterhin von besonders günstigen Bedingungen bei der Energielieferung, d. h., blieb wie Belarus von der sonstigen Normalisierung der Preise von Gazprom & Co. verschont. Auch in der Ukraine bildete sich in den 1990er Jahren eine Schicht superreicher Oligarch:innen, die durch ihre Geschäfte mit russischen Konzernen ebenfalls eine schwankende Position einnahmen.
Ein Musterbeispiel ist sicher der bis vor einigen Jahren wohl reichste ukrainische Kapitalist Rinat Achmetow. Auch bei ihm begann das große Geschäft mit der Gründung einer Bank und der abenteuerlichen Aneignung ehemaliger Staatskonzerne (er erwarb z. B. einen Großteil der noch profitablen Stahlwerke in der Ostukraine und das Mariupoler Stahlkombinat). Seine Metinvestgruppe stieg zur größten Stahllieferantin für die GUS auf. Folgerichtig gehörte er zu den Hauptunterstützer:innen des Präsidenten Wiktor Janukowytsch und war für dessen Partei auch im Parlament (was ihn später nicht daran hinderte, „immer schon“ für die Opposition gewesen zu sein). Auf Dauer konnte allerdings der Schaukelkurs Janukowytschs (Ministerpräsident 2002–2005 und 2006–2007, Präsident 2010–2014), sowohl Annäherung an die EU als auch weitere Integration in die sich bildende EAWU, nicht gut gehen. Aber auch die Episode der Präsidentschaft Wiktor Juschtschenkos (2005–2010) brachte keine Entscheidung: Er strebte zwar nach EU- und NATO-Mitgliedschaft, wollte Russisch als Amtssprache abschaffen, trat für die Ehrung der ukrainischen Nationalist:innen der 1940er Jahre ein etc. – war aber wirtschaftspolitisch ungemein erfolglos.
Das Resultat dieser Politik war eine tiefe Spaltung des Landes: Die Hauptstadtregion und die Westukraine unterstützten eine Politik à la Juschtschenko, der Osten und Süden eine à la Janukowytsch. Im Jahr 2013 kam es schließlich zur Entscheidung. Einerseits kam Janukowytsch wohl unter Druck Russlands (Versprechen eines Milliardenkredits und günstigen Gaspreises) und setzte im November 2013 das Assoziierungsabkommen mit der EU aus, während er gleichzeitig „langfristig“ weiter eine Annäherung an sie halt „etwas später“ versprach. Die ungünstige Wirtschaftslage, wuchernde Korruption und Wahlbetrugsvorwürfe führten dazu, dass diese Entscheidung die langwierigen Euromaidanproteste explodieren ließ. Dass das heterogene Oppositionsbündnis den unbeliebten und ungeschickt agierenden Janukowytsch zu Fall brachte (Amtsenthebung am 23.2.2014), ist an sich nichts Außergewöhnliches. Entscheidend war, dass dies in einem bereits tief gespaltenen Land geschah, das gleichzeitig in den Fokus der Weltpolitik geriet. Es ist unbestritten, dass rechte und rechtsextreme Gruppen eine wichtige Rolle in der Radikalisierung des Maidan spielten – insbesondere für die kompromisslose Haltung gegenüber Janukowytsch und damit das Durchhalten bis zu dessen Sturz. Sie waren auch in der Übergangsregierung vertreten und (auch wenn ihre Organisationen, wie z. B. die Allukrainische Vereinigung „Swoboda“, letztlich Kleinparteien blieben) drängten den herrschenden Block in der ukrainischen Parteienlandschaft stark in eine ukrainisch-nationalistische Richtung. Gleichzeitig kam es zur Unterdrückung von politischen Kräften, die bisher stärker auf Russland orientiert waren, wie die „Partei der Regionen“ und die KP. Ausdruck der nationalistischen Tendenz waren die Sprachengesetze und die Rehabilitierung von Bandera & Co. Auch wenn davon einiges bald relativiert wurde (und die rechten Parteien bald wieder marginalisiert waren), reichte dies, um auf der Krim und in der Ostukraine für Entfremdung und für Anti-Maidanmobilisierungen zu sorgen.
9.6.1 Die Zuspitzung des Ukrainekonflikts
Damit besaß die russische Regierung die Ansatzpunkte wie auch schon in Georgien oder Moldawien, um als „Schutzmacht“ aufzutreten. Das erste Ziel war bekanntlich die Krim. Diese Region war eher zufällig nach 1945 an die Ukraine gefallen und wird zu fast 60 % von sich als „Russ:innen“ bezeichnenden Menschen bewohnt bzw. ist Russisch dort die dominierende Sprache (die vormals große Gruppe der Krimtataren, die unter Stalin schwer verfolgt wurde, macht heute wieder etwa 12 % der Bevölkerung aus). Durch den riesigen Flottenstützpunkt in Sewastopol war dort jedoch auch nach der Unabhängigkeit der Ukraine eine große militärische Präsenz Russlands weiter vorhanden. Die wohl lange vorbereitete Eroberung der Krim durch umfirmierte russische Truppen begann fast unmittelbar nach der Absetzung von Janukowytsch Ende Februar 2014 und war Ende März mit dem Abzug der letzten ukrainischen Soldat:innen abgeschlossen. Bereits Mitte März wurde ein Referendum über die Abspaltung von der Ukraine und den Beitritt zur Russischen Föderation abgehalten, was angeblich mit 96 % der abgegebenen Stimmen angenommen wurde. Noch im März wurde die Krim als neues Mitglied vom Föderationsrat für aufgenommen erklärt, und noch 2014 verhängten die EU und USA Sanktionen gegen bestimmte Personen im Umkreis von Putin (z. B. die oben erwähnten Glasjew und Rogosin) und gegen bestimmte Institutionen (wie die Bank Rossija).
Auch wenn bereits die Krimintervention eine neue Stufe der Eskalation in der Konfrontation mit dem Westen darstellte, so ist die Entwicklung in der Ostukraine nochmals von einer ganz anderen Qualität. Insgesamt war die Krimintervention noch eher im Rahmen der üblichen begrenzten und in ihren Zielen überschaubaren Großmachtaktionen geblieben, ähnlich wie in Georgien (und im Wesentlichen in einem Monat abgewickelt). Dass sich dagegen der Konflikt in der Ostukraine zu einem „Weltordnungskrieg“ ausweiten würde, war wohl am Anfang nicht allen Beteiligten klar. Die zugespitzte Situation in der Restukraine im März 2014 musste zu heftigen Spannungen führen: Die Maidan-Regierung setzte eine antirussische Politik um, verstärkt noch durch den Verlust der Krim, die von den prorussischen politischen Kräften und Teilen der russischsprachigen Minderheit mit Protesten beantwortet wurde, insbesondere in Odessa, Charkiw, Mariupol, Donezk und Luhansk. In der Donbass-Region nahm dies ab April 2014 bewaffnete Form an – sehr bald mit Unterstützung aus der Russischen Föderation. Anfang April wurden die „Volksrepubliken“ Luhansk und Donezk ausgerufen, und am 14. April rief die ukrainische Regierung den Beginn einer „Antiterror“-Operation gegen die Separatist:innen aus, womit der Krieg im Donezbecken begann. Nachdem die ukrainischen Truppen (verstärkt durch Freiwilligenverbände) zunächst die „Volksmilizen“ zurückdrängen konnten und Donezk und Luhansk einkesselten, griff im August 2014 eine russische Panzerbrigade direkt in die Kämpfe ein. Dies führte zur Niederlage der ukrainischen Offensive und dem „Einfrieren“ der Konfliktlinien durch das „Minsk I“-Waffenstillstandsabkommen unter Vermittlung der OSZE im Herbst 2014. Nach Wiederaufflammen der Kämpfe zu Beginn 2015 kam es unter Vermittlung Frankreichs und Deutschlands im Februar 2015 zum „Minsk II“-Abkommen.
Die Besonderheiten des Konflikts in der Ostukraine sind erstens die Größe und wirtschaftliche Bedeutung des betroffenen Gebiets. Bei einer Frontlinie von über 400 Kilometern, dem Vorhandensein mehrerer Großstädte (vor allem der Millionenstadt Donezk) und einer größeren Zahl riesiger Industrieanlagen konnte hier keine „begrenzte Operation“ mit einer überschaubaren Zahl von „Spezialkräften“ durchgeführt werden (wie auf der Krim oder in Südossetien). Hier ging es um einen konventionellen Krieg mit Panzern und Infanterie in großer Zahl (schon in diesem ersten Ukrainekrieg starben an die 15.000 Menschen). Auch wenn die Bedeutung des Kohlereviers gesunken war, war zumindest die Stahlindustrie noch bedeutsam. Für die Ukraine geht es beim Verlust des Ostteils um bedeutende ökonomische Faktoren, nicht zuletzt um Bodenschätze, deren Abbau in Zukunft wichtig sein wird: unter anderem Seltene Erden, Lithium und Titan.
Zweitens waren die oligarchischen Cliquen, die mit Russland verbunden waren und spezielle Interessen gerade in der Ostukraine hegten, auch der Kern der antidemokratischen, autoritären und korrupten Strukturen in der gesamten Ukraine. Der Kampf um Demokratie und gegen Korruption vermischte sich daher stark mit dem nationalistischen um „Befreiung vom russischen Einfluss“ und für eine Ukraine nach dem Vorbild „westlicher Demokratien“ – und damit auch mit Illusionen in die Auswirkungen von EU- und NATO-Beitritt. Die wichtigsten ukrainischen Oligarch:innen wie Achmetow verloren durch den Krieg in der Ostukraine aber riesige Vermögen und schwenkten schnell auf die Westorientierung um. Bezeichnenderweise wurde im Mai 2014 einer der bekanntesten Oligarchen, Petro Poroschenko, zum ersten Präsidenten der Maidanukraine gewählt (der über seine Investmentfirma Ukrprominvest von Panama aus auch während seiner Präsidentschaft seine vielen Unternehmungen weiter, natürlich steuergünstig, kontrollierte). An der oligarchischen, korrupten und autoritären Struktur der Ukraine änderte sich also wenig, außer dem westlichen Anstrich – aber jegliche Opposition, z. B. gewerkschaftlicher Protest gegen Verschlechterungen des Arbeitsrechts, konnte jetzt als „prorussische Agitation“ verfolgt werden. Im Unterschied zu Georgien oder der Republik Moldau funktionierte also die russische Taktik nicht, nämlich dass über die Probleme in abtrünnigen Regionen und die damit verbundenen wirtschaftlichen durch Krieg und Wegfall von russischem Handel und Investitionen im Restland eine starke prorussische Opposition entstünde, insbesondere unter den Oligarch:innen (wie Iwanischwili in Georgien). Die Intervention in der Ostukraine, das letztlich dort installierte Regime und die fortgesetzten Konflikte an der „Kontaktlinie“ haben die Ukraine und die Russische Föderation aber nur weiter entfremdet. Ukrainisches Kapital und Staat haben sich ganz in die Hände von westlichen Investor:innen begeben. Im Jahr 2014 gewährte der IWF zusammen mit EU und USA Kredite in der Höhe von 27 Milliarden US-Dollar, um den Wegfall russischer Gelder abzufangen und eine weitreichende „Öffnung“ des ukrainischen Marktes zu ermöglichen.
Drittens ist im Fall der Ukraine eine andere Reaktion des Westens festzustellen. Ihre Größe und Bedeutung weckten offensichtlich Begehrlichkeiten, in diesem Fall nunmehr die Krise der russischen Dominanz auszunutzen und nach Osteuropa und dem Baltikum einen weiteren Schritt in Richtung Reduktion der russischen Einflusssphäre zu gehen – nochmals, wie in Georgien 2008, wollte man sich nicht überraschen lassen. In der „National Security Strategy“ (NSS) der US-Regierung (ein Dokument, das in der Regel alle 4–5 Jahre die globale Strategie der USA zusammenfasst)[xliv] wurde eine „dynamische Verschiebung im globalen Machtgefüge“ festgestellt, die sich vor allem aus dem Aufstieg Chinas, den Potenzialen Indiens und der „Aggression Russlands“ ergibt. Insofern wurde hier von den USA die strikte Orientierung auf die „Eindämmung Russlands“ und seine Isolation von den europäischen Verbündeten ausgegeben. Hier zeigten sich auch klar unterschiedliche Interessen im „Westen“. Mit „Minsk II“ verfolgten die wichtigsten Staaten der EU, Deutschland und Frankreich, eine Befriedung des Konflikts um die Ostukraine, indem in dem Abkommen ein Pfad Richtung neuer Verfassung der Ukraine aufgenommen wurde, der zu einem Bundesstaat mit weitreichenden Autonomierechten der Regionen mit großer russischsprachiger Bevölkerung führen sollte – eine Perspektive, die damals auch von Poroschenko geteilt wurde. Dagegen verfolgten die USA und Britannien den Weg der Aufrüstung der Ukraine, ihrer Integration in die NATO-Logistik und der Bestärkung der dortigen Kräfte, die für die volle Wiederherstellung der Souveränität ohne Änderung der Verfassung eintraten.
Noch 2019 in Paris wurde in Verhandlungen unter Vermittlung Frankreichs und Deutschlands mit den Präsidenten Putin und Selenskyj versucht, Minsk II umzusetzen („Steinmeier-Formel“): Donezk und Luhansk sollten in die ukrainische Souveränität unter Sonderstatus zurückkehren und dort Wahlen für die Autonomievertretung stattfinden. Umstritten war „lediglich“, in welcher Reihenfolge! In diesem Punkt wurde nie Einigkeit erreicht – stattdessen beteiligte sich die Ukraine an NATO-Manövern und bereitete sich auf einen russischen Angriff vor, während die russische Seite die beiden östlichen Regionen immer mehr integrierte (z. B. in Bezug auf Staatsbürger:innenschaftsrechte) und ab Anfang 2021 mit einem systematischen Truppenaufmarsch begann. Offenbar sah man in Moskau die Perspektiven auf einen prorussischen Umschwung in der Ukraine schwinden und ihre Integration in NATO und EU als unausweichlich. Die Frage eines Kompromisses für die Ostukraine blieb wohl zweitrangig gegenüber dem strategischen Ziel, die Ukraine im eigenen Einflussbereich zu behalten. Somit war wohl der russische Großangriff im Februar 2022 vorprogrammiert.
Am 24.2. marschierten über 180.000 Soldat:innen der Russischen Föderation in die Ukraine ein, womit der größte konventionelle Krieg auf europäischem Boden seit dem Zweiten Weltkrieg begann. Inzwischen (2025) sind auf beiden Seiten jeweils über 700.000 Soldat:innen am Kriegsgeschehen beteiligt, mitsamt Massen an Panzern, Artillerie, Flugzeugen, Raketen, Drohnen und sogar Kriegsschiffen. Aus dem Regionalkonflikt wurde ein langandauernder Krieg mit großen internationalen Zusammenhängen.
Die Entschlossenheit der Herrschenden in Russland, „ihren Einflussbereich“ zu bewahren, und diejenige der USA, seit spätestens 2015 die „russische Aggression“ einzudämmen, verurteilten die Ukraine zu einem entscheidenden Ort der Auseinandersetzung um die „Neuaufteilung der Welt unter den Großmächten“. Die Zuspitzung dieses Neuaufteilungskampfes hatte das Potenzial, aus dem Konflikt die Ursache für einen neuen Weltkrieges zu machen. Die überraschende Schwäche der russischen Armee (insbesondere beim Kampf um Kiew und Charkiw) sowie die überraschende Stärke der ukrainischen Verteidigung (sicherlich durch die zuvor vor allem durch die USA erfolgte Aufrüstung) und der Widerstandswille der ukrainischen Massen gegen die großrussische Okkupation haben dazu geführt, dass nach den ersten beiden Kriegsmonaten der Westen wohl davon ausging, dass die Ukraine ihre Verteidigung ohne westliche direkte Intervention nur mithilfe von Waffenlieferungen schaffen würde. Ob die USA/NATO tatsächlich zu einer Intervention und direkten Konfrontation mit der Atommacht Russland bereit gewesen wären, ist eine andere Frage. Fakt ist, dass auch die folgende Unterstützung der Ukraine durch die NATO-Staaten immer unter der Vorgabe stand, die NATO nicht direkt in den Konflikt zu ziehen bzw. nur solche Waffensysteme zu liefern, die nicht zu einer solchen Eskalation führen würden. Auch wenn der Krieg durch Waffenlieferungen und Sanktionen den Aspekt eines „Stellvertreter:innenkrieges“ annimmt, so ist dieser dem legitimen nationalen Verteidigungskrieg innerhalb der Ukraine gegen die angreifende Großmacht Russland untergeordnet.
Der historische Vergleich zum „1. Weltkrieg“ ist hier wichtig: Er wurde bekanntlich ausgelöst durch die regionale Konfrontation zwischen der imperialistischen Großmacht Österreich-Ungarn und der Halbkolonie Serbien, die sich zwischen Juni (Attentat in Sarajevo) und August 1914 immer mehr zuspitzte. Zuvor hatten die Balkankriege (Aufstieg Serbiens zur Regionalmacht) und die wachsende Konkurrenz Österreich-Ungarns und Russlands um Einfluss auf dem Balkan dazu geführt, dass um Serbien und Bosnien ein Stellvertreterkonflikt zwischen den beiden Großmächten aufgebaut wurde. Dazu kam, dass das langjährige russisch-französische Bündnis dazu führte, dass die russische Unterstützung für Serbien durch eine finanziell und waffentechnisch sehr viel wirksamere Unterstützung durch Frankreich ergänzt wurde. Der Angriff der k.u.k. Armee auf Serbien folgte zwar etwa Mitte August und wäre für sich genommen sicherlich trotz der „Stellvertreter“natur Serbiens ein imperialistischer Okkupationsversuch gewesen, in dem Sozialist:innen klar auf dessen Seite im nationalen Verteidigungskampf hätten stehen müssen. Tatsächlich aber wurde der Angriff auf Serbien durch die Kettenreaktionen der europäischen Bündnisverpflichtungen überholt – noch bevor die ersten Schüsse in Serbien fielen, war die deutsche Armee an der Westfront schon voll im Einsatz. Serbien geriet zu einem Nebenschauplatz eines riesigen Völkermordes, der von allen imperialistischen Mächten betrieben wurde. Der Ukrainekrieg dagegen wirkt im Vergleich noch, als wenn der Angriff auf Serbien zwar stattgefunden hätte, aber alle anderen Großmächte noch mit der „Generalmobilmachung“ warten. Die Trigger auf einen Weltkrieg sind zwar gesetzt, aber es gibt noch Bremsfunktionen, die die NATO-Staaten (oder eine Mehrheit unter ihnen) vor einem direkten Eingreifen gegen die Atommacht Russland zurückschrecken ließen.
Die Rhetorik der „Zeitenwende“ im Westen ist allerdings Element einer solchen „Generalmobilmachung“: Russland wird als allgemeine Bedrohung für „die Freiheit“ in ganz Europa, ja der Welt dargestellt, oder, wie es der NSS-Report formuliert, als „Macht, die die regelbasierte Weltordnung revidieren will“. Daher wären eine gewaltige Aufrüstung und die totale Isolierung Russlands (und damit auch des mit ihm verbündeten China) notwendig. Gerne wird dabei Putins Vorschlag einer eurasischen Freihandelszone von „Lissabon nach Wladiwostok“ herangezogen, um angebliche Eroberungspläne für ganz Europa zu beweisen. Bei aller gesteigerten nationalistischen Rhetorik aus Moskau (insbesondere seit der Integration der Nationalkonservativen in die Regierung) sind alle Hitler-Putin-Vergleiche natürlich absurd, ahistorisch und haben mit der tatsächlichen Großmachtpolitik Russlands wenig zu tun. Die aggressive Durchsetzung einer eigenen Einflusssphäre ist kein Alleinstellungsmerkmal Russlands. Dem US-Präsidenten Trump ist zu verdanken, dass ziemlich deutlich wird, um welche „Werte“ es dem Westen in der Ukraine wirklich geht: Sicherheitsinteressen (nach Trump eher der Europäer:innen) und die großen Ressourcen der Ukraine. Dabei hätten schon vorher die Konferenzen der „Geberländer“ zum „Wiederaufbau“ und die IWF-Kreditbedingungen (die Einschaltung des IWF dient der Risikominimierung der privaten und einzelstaatlichen Geldgeber:innen, die Milliardenkredite des IWF sind nur der Kern des Gesamtpakets) erkennen lassen können, was die Zukunft für eine „demokratische“ Ukraine unter westlicher Dominanz bereithalten würde. Insbesondere zielt die Beteiligung des IWF auf die Durchsetzung der Politik des „Washington Consensus“, also der Marktöffnung für westliches Kapital.
Der entscheidende Punkt neben der „Liberalisierung“ von Haushaltspolitik und Arbeitsrecht ist dabei vor allem die Zerschlagung der bisherigen großen Kapitalkonglomerate und deren Verbindungen zum Staat – damit der Abstieg der bisherigen ukrainischen Oligarch:innen, am meisten symbolisiert durch den tiefen Fall des Ihor Kolomojskyj (einst Besitzer der größten Privatbank im GUS-Raum), der ursprünglich Selenskyj selbst an die Macht gebracht hat (und heute unter Korruptionsverdacht im Gefängnis sitzt). Dieses „Aufbrechen“ der alten Kapitalstrukturen erlaubte eine Durchdringung des ukrainischen Kapitalmarktes durch US- und EU-Kapital, wie sie bisher in keinem GUS-Staat möglich war. Wahrscheinlich ist dieses Anschauungsbeispiel auch der Hauptgrund für den Schwenk Iwanischwilis in Georgien.
10. Hauptmerkmale russischer Großmachtpolitik
Bei der Analyse der Großmachtpolitik Russlands wird gern die Kontinuität zum Zarenreich und zur Sowjetunion behauptet. Auch wenn es diese gibt, so ist es für das Verständnis der gegenwärtigen Politik wesentlich, auch die Brüche herauszuarbeiten. Der Zarismus hat eine Vielzahl von Nationalitäten und Ethnien unter seine Herrschaft gebracht, zumeist in vorkapitalistischen Entwicklungsstadien – keine davon jemals mit eigenständiger Nationalstaatsgeschichte (dies betrifft auch die Ukraine oder das Baltikum). Die Nationalstaatsbestrebungen entstanden zumeist im Kampf gegen den Zarismus (oder benachbarte konkurrierende Großmächte der jeweiligen Zeit). Die Bolschewiki integrierten diese Unabhängigkeitskämpfe in ihren Kampf zum Sturz des Zarismus und förderten insofern sowohl die Entstehung eigenständiger Staaten wie die Bildung einer freiwilligen Föderation dieser unter nachkapitalistischen Bedingungen, d. h. auch der Enteignung der nationalen Bourgeoisien. Föderation, autonome Regionen, Minderheitenrechte und als Klammer eine internationalistische Arbeiter:innenklasse und ihre neue ökonomische Ordnung waren die Prinzipien, die den großrussischen Chauvinismus des Zarenreiches überwinden sollten. In der stalinistischen Diktatur wurden diese Prinzipien in eine zentralistische Herrschaft eines Bündnisses nationaler Bürokratien unter klarer Hegemonie der russischen Nomenklatura umgewandelt. Dies ist aber alles andere als die „Herrschaft der roten Zar:innen“. Die nachkapitalistische Ökonomie, auch unter Bedingungen der bürokratischen Planwirtschaft, führte zu einem gewissen Ausgleich zwischen den verschiedenen nationalen und ethnischen Teilen der Sowjetunion. In allen Teilbereichen bildete sich eine Nomenklatura, die besondere Privilegien erlangte, dafür die Zentralherrschaft stützte und somit in das Netzwerk der sowjetischen auf Unionsebene eingebunden war. Antibürokratischer Protest verband sich daher oft mit Nationalismus und Antikommunismus, während sich andererseits die Teilbürokratien gern selbst an die Spitze nationaler Proteste setzten, um ihre Position zu verbessern (oder im Fall des Falles an der Spitze eines neuen Staates zu stehen). Unter der Decke der stalinistischen Diktatur, die die nationalen Auseinandersetzungen einzufrieren schien, blieben daher mehr oder weniger alle ethnischen und nationalen Konflikte der vorsowjetischen Zeit am Leben und brachen zum Ende der Sowjetunion mit voller Wucht auf.
Mit der Entstehung einer Vielzahl kapitalistischer Staaten in ihrer Nachfolge in den 1990er Jahren änderte sich die Situation nochmals grundlegend. Das Zarenreich hatte zwar seit Ende des 19. Jahrhunderts eine rasche kapitalistische Entwicklung begonnen, war aber weitgehend vom Kapitalzufluss der großen europäischen Kapitale abhängig und entwickelte seine Regionen nur sehr ungleichzeitig. Am Ende der Sowjetunion gab es in allen Regionen große Industrie-, Bergbau- oder Dienstleistungskonglomerate, die mehr oder weniger durch den zentralen Plan verbunden waren. Die Schocktherapien zerstörten diese Verbindungen zunächst und ließen viele dieser Großbetriebe als nicht überlebensfähig erscheinen. Tatsächlich erwiesen sich die großen Betriebe im Grundstoff- und Agrarbereich und auch die sonstige industrielle Infrastruktur jedoch als langfristige Unterscheidungsmerkmale gegenüber üblichen „Dritte Welt“-Ökonomien. Für das westliche Kapital zu unprofitabel für direkte Übernahmen, waren stattdessen die neuen oligarchischen Kapitalist:innen zusammen mit Teilen der alten Nomenklatura in Staat und betrieblichem Management in der Lage, aus diesen Restbeständen schnell ein ziemlich profitables Geschäft zu schaffen. Natürlich waren der russische Öl- und Gasbereich und die dort entstandenen Konzerne der Kern, um den sich die neuen postsowjetischen Kapitale (auch in vielen anderen ehemaligen Unionsrepubliken) formierten. Die Superprofite aus diesen Konzernen speisten auch die russischen Banken, die dann wiederum ihre alten Verbindungen zu den anderen Republiken nutzten, um dort das neue oligarchische Kapital in seinen Geschäften zu unterstützen. Schon in den 2000er Jahren kam es so zu einem wechselseitigen ökonomischen Aufschwung im gesamten postsowjetischen Raum, der weit über den Grundstoffbereich hinausging und wesentlich auf den neuen, günstigen Ausbeutungsbedingungen der jeweiligen Arbeiter:innenklassen beruhte, aber eben auch zu einer neuen Verflechtung der Ökonomien unter russischer Dominanz führte. Außer im Baltikum waren in allen (auch in der Ukraine bis 2014) die Gas- und Ölgeschäfte mit Russland von zentraler Bedeutung. Die weitaus bestimmenden Banken waren Sberbank und VTB, und in den Handelsbilanzen stand die Russische Föderation wieder an der Spitze.
Eine Folge der oligarchischen Wirtschaftsstruktur und der Transformation der alten Nomenklatura in neue „nationale“ Staats- und Managementkader ist die mehr oder weniger autoritäre Herrschaftsform, die sich in den meisten Nachfolgestaaten der Sowjetunion herausgebildet hat. Ähnlich wie in der Russischen Föderation wurden nach und nach Justiz, Medien und Parteien vom neuen herrschenden Block und seinen Geldmitteln vollständig abhängig gemacht. Durch die neuen Verbindungen dessen zu Russland (ob über Konzerne oder auf Regierungsebene) erscheint dieser neue Autoritarismus, der eigentlich ein Resultat der spezifischen kapitalistischen Entwicklung ist, als eine Art „Putinismus“ oder Wiederbelebung der Sowjetunion. Der demokratische Protest wird also wiederum mit antirussischem Nationalismus vermischt bzw. es wird auf die „demokratische EU“ gegen das „autoritäre Russland“ gesetzt. Wie das Beispiel der Ukraine zeigt, dient die Zerschlagung der „Oligarch:innen“-Konglomerate der Übernahme profitabler Einzelteile durch westliche Kapitale. Die herrschenden russischen betonen dagegen ihren angeblichen sozialen Schutz und konstruieren aus bestimmten Elementen der antirussischen Protestbewegung die Notwendigkeit eines Kampfes gegen den „Faschismus“. Eine echte Opposition für demokratische und soziale Rechte muss sich natürlich gegen den politischen Betrug dieser beiden Seiten richten.
Seit der Stabilisierung des Kapitalismus in den 2000er Jahren basiert die russische Großmachtpolitik also auf der Stärke ihrer monopolistischen Sektoren im Öl- und Gasbereich, Bergbau, Agrobusiness und in der Rüstungsindustrie sowie der Kapitalstärke der russischen Banken im Gefolge der Profite dieser Bereiche. Die neuen oligarchischen Strukturen in den meisten postsowjetischen Republiken bildeten die Grundlage für eine ökonomische Expansion in diese Länder hinein, die dort die Errichtung eines neuerlichen politischen Einflussbereichs bewerkstelligt hat. Die Interessen dieser Konzerne gingen aber weit über diesen Raum hinaus. Wie gesehen, ist Afrika, insbesondere was Bergbau und Rüstungsindustrie betrifft, inzwischen für russische Politik und Ökonomie ein wichtiges Feld. Nach der Niederlage in Syrien verbleiben mit dem Iran und Teilen des Iraks weiterhin wichtige Interventionsfelder, während mit der Türkei/Aserbaidschan eine komplexe, wechselnde Partnerschafts-/Rivalitätsbeziehung vorherrscht. Während mit Venezuela und Kuba, neben den Interessen im Öl- und Bergbaubereich, vor allem die Herausforderung der Hegemonie der USA in Lateinamerika im Vordergrund steht, ist die Beziehung zu Brasilien neben der Bedeutung im Agrobusiness hauptsächlich durch die neue Bündnispolitik bestimmt. Russland ist sicherlich ökonomisch und politisch das Land (neben dem Iran), das sich am meisten vom „Westen“ abkoppeln muss und daher zu einer Reihe neuer Bündnisse gezwungen ist, nicht nur über solche Projekte wie BRICS, SOZ etc., sondern auch bilateral wie zum Iran und zu Nordkorea. Die stärkere Ausrichtung auf Importsubstitution nach 2015, die Ausdehnung der Rohstoffexploration (Arktis), die Stärkung des Nuklearkomplexes und des Agrarsektors etc. haben Russland als Großmacht bis zum Ukrainekrieg sicherlich stärker gemacht. Die Konsequenzen des sehr langen Ukrainekrieges und der damit verhängten Sanktionen gegen Russland für seine Zukunft als Großmacht werden wir im abschließenden Kapitel besprechen.
11. Der imperialistische Charakter Russlands
Seit dem Ukrainekrieg wird der Begriff des „Imperialismus“ auch in der bürgerlichen Öffentlichkeit wieder verwendet, freilich nur in Bezug auf Russland. Dabei hat dieser Begriff im Marxismus eine klar bestimmte Bedeutung, die mit einer politökonomischen Analyse und nicht mit einer bestimmten Form des außenpolitischen Verhaltens zu tun hat. Wenn wir hier die Frage des imperialistischen Charakters Russlands behandeln, so muss dies in klarer Abgrenzung zu dieser gegenwärtigen Ideologisierung des Imperialismusbegriffs zum bürgerlichen Kampfbegriff geschehen.
11.1 Die Imperialismustheorie
Als Lenin 1916, mitten im Ersten Weltkrieg, die Dynamik der kapitalistischen Weltentwicklung hin zu gerade solchen globalen Katastrophen analysierte, fasste er grundlegend neue, epochemachende Veränderungen im gegenwärtigen Kapitalismus als „Eintritt in die imperialistische Epoche“ zusammen. Es geht also um eine bestimmte Stufe der kapitalistischen Entwicklung, nicht um eine besondere Art von Politik, von der diese Epoche vielmehr eine ganze Menge unterschiedlicher, mehr oder weniger gewaltvoller Formen hervorbringt. Das, was die imperialistische Epoche auszeichnet, ist erstens die vollständige globale Durchsetzung des Kapitalismus als dominierendes Produktionsverhältnis, also der Anschluss aller Ecken der Welt an den Weltmarkt, die Unterordnung noch vorhandener Reste alter Gesellschaftsformationen (z. B. feudaler) unter die Gesetzmäßigkeiten der ungleichzeitigen und kombinierten Entwicklung einer diesem Weltmarkt eingegliederten nationalen Kapitalentwicklung. Zweitens geht diese neue globale Totalität des Kapitalismus einher mit einer wachsenden Konzentration und Zentralisation des Kapitals, die Lenin mit dem Begriff der Bildung von „Monopolen“ zusammenfasste. Dies sollte nicht mit der juristischen Form der Unterbindung von Konkurrenz auf einem nationalen Markt verwechselt werden (die klassische Form: Kartellabsprachen). Vielmehr geht es darum, dass große Kapitale („Konzerne“) entstehen, für die der nationale Markt gar nicht mehr der Ort der Konkurrenz ist (dort sind sie zu groß, um von nur national agierenden Kapitalen herausgefordert zu werden). Ihr Ort der Kapitalbewegung, der Akkumulation und der Konkurrenz ist der Weltmarkt. In jeder seiner Branchen bildet sich eine kleine Zahl von großen Kapitalen, die mehr oder weniger den Markt global unter sich aufteilen – und den kleineren nationalen Kapitalen vielleicht noch Nischenbereiche übriglassen. Die Monopole in diesem Sinn können durch ihre Marktdominanz auch der angesprochenen Tendenz zur Ausgleichung der Durchschnittsprofitrate entgegenwirken und sehr viel längerfristig mit einer höheren Monopolprofitrate rechnen (in Krisenperioden allerdings bricht die Tendenz zum Ausgleich der Profitrate dann umso katastrophaler durch). Dies ist die Grundlage für die Herausbildung eines mit diesen Monopolen verbundenen Finanzkapitals, das über Banken oder Kapitalmärkte die Grundlage der Finanzierung aller Akteur;innen auf dem Weltmarkt bildet. Dieses Finanz- und Monopolkapital agiert zwar international (d. h. auf dem Weltmarkt), ist aber dennoch letztlich nationalstaatlich verankert und abgesichert – nicht zuletzt dadurch, dass die Kapitaleigner:innen ihre Vermögen (Ersparnisse aus Kapitalerträgen) in sicheren Heimathäfen anlegen wollen. Diese nationalen Heimathäfen dienen sowohl als Basis des auf dem Weltmarkt verwendeten Geldes als auch zur internationalen Absicherung der dort getätigten Investitionen bzw. in den an diesen Weltmarkt angeschlossenen Ländern. Dabei übersteigen solche Investitionen (Kapitalexport), ob in Form von Krediten, Kapitalanlagen, Aufbau untergeordneter Firmen- und Zuliefernetze etc. in der imperialistischen Epoche das unmittelbare Volumen von Warenhandel auf dem Weltmarkt um ein Vielfaches. Daher sind auch die Staatsapparate dieser Länder auf besondere Weise mit dem Monopol- und Finanzkapital verbunden, und dies nicht nur über die vielfältigen finanz- und wirtschaftspolitischen Funktionen des Staates (von Zentralbanken und internationalen Kreditinstitutionen bis zu großen Staatskonzernen), sondern auch in Hinblick auf den außen- und sicherheitspolitischen Bereich (Fehlverhalten in Bezug auf Marktöffnung oder Schuldenrückzahlung wird ja gewöhnlich mit entsprechendem Druck beantwortet).
Tatsächlich bildeten sich Ende des 19. Jahrhunderts mit dem Monopol- und Finanzkapital, das die verschiedenen Sektoren des Weltmarktes jeweils unter ein paar wenigen großen Konzernen aufteilte, auch eine kleine Zahl von Staaten, die genau mit diesen Monopolen verbunden und damit das Zentrum von Kapitalexport und Akkumulation des Kapitals auf Weltmarktebene waren. Auf dieser ökonomischen Grundlage, sagt Lenin, bilde sich auch eine neue politische Ordnung auf Weltebene heraus: „Die Epoche des jüngsten Kapitalismus zeigt uns, daß sich unter den Kapitalist:innenverbänden bestimmte Beziehungen herausbilden auf dem Boden der ökonomischen Aufteilung der Welt, daß sich aber daneben und im Zusammenhang damit zwischen politischen Verbänden, den Staaten, bestimmte Beziehungen herausbilden auf dem Boden der territorialen Aufteilung der Welt, des Kampfes um die Kolonien, des ‚Kampfes um das Wirtschaftsgebiet‘“.[xlv]
Hier sieht man bei Lenin eine feine Unterscheidung, die bei vielen schematischen Wiedergaben seiner Imperialismusbroschüre, insbesondere der berühmten „5 Kriterien“[xlvi], übergangen wird: Es sollte differenziert werden zwischen der ökonomischen Analyse des imperialistischen Kapitals (Monopol- und Finanzkapital, Rolle der Banken und Kapitalmärkte, Kapitalexport) samt seiner Weltmarktanteile und der darauf aufbauenden Aufteilung der Welt unter kapitalistischen Großmächten. Die politischen Akteur:innen imperialistischer Kämpfe um Einflusssphären, die Großmächte, sind getrieben bzw. erhalten ihre Macht durch die hinter dem System der Großmächte stehende ökonomische der Monopole. Lenin weist hierbei aber z. B. darauf hin, dass zwar der russische Zarismus als imperialistische Großmacht agiert habe, aber das russische Großkapital in fast allen Bereichen von Kapitalimport und der Unterordnung unter Monopole anderer Länder abhängig gewesen sei. Die politische Ebene ist also nicht eins zu eins aus der ökonomischen abzuleiten. Durch die schiere Größe und militärische Bedeutung des Zarismus und seine Einbindung in ein imperialistisches Bündnis war er in der Lage, als Imperialismus zu agieren, auch wenn er sich ökonomisch erst auf dem Weg dahin befand.
Wenn man diesen differenzierten Imperialismusbegriff Lenins in Bezug auf das zaristische Russland kennt, ist es umso erstaunlicher, dass Marxist:innen, die sich auf ihn berufen, Schwierigkeiten haben, das heutige Russland als imperialistisch zu bezeichnen. Dabei ist das heutige Russland nach den in diesem Artikel angeführten Entwicklungen sicherlich auch im ökonomischen Sinn, nicht nur als politische und militärische Großmacht, den imperialistischen Ländern zuzurechnen.
11.2 Das heutige Russland als imperialistische Ökonomie
Die russische Ökonomie wird geprägt durch einige große und auf dem Weltmarkt strategisch bedeutsame Monopole. Wie schon erwähnt, ist sie sogar stärker in Großbetrieben organisiert als die USA oder Deutschland. Die Konzerne im Gas- und Ölsektor (vor allem Gazprom, Rosneft und Lukoil) decken die gesamte dortige Wertschöpfungskette ab und belegen in diesem Bereich eine strategische Stellung auf dem Weltmarkt (größter Erdgas-Exporteur 2019 mit 19 % Weltmarktanteil, zweitgrößter Erdölexporteur nach Saudi-Arabien mit 11 %, drittgrößte Raffineriekapazität mit 7 % nach den USA und China). Die russischen Bergbaukonzerne wie Nornickel nehmen eine strategische Stellung auf dem Weltmarkt für industriell entscheidende und knappe Metalle (Nickel, Platin, Aluminium, Cobalt, Metalle der Seltenen Erden etc.) ein. Der russische Nuklearkomplex (um Rosatom) deckt die gesamte Wertschöpfungskette vom Uranbergbau bis zur Atommüllentsorgung ab und ist in diesem Bereich Weltmarktführer. Die russische Luft- und Raumfahrtindustrie gehört zu den wenigen großen Playern, die es in diesem Sektor auf dem Weltmarkt gibt, auch wenn China und Indien hier in den nächsten Jahren überholen könnten. Die russische Rüstungsindustrie hat in ihrem Ruf mit dem Ukrainekrieg sicherlich gelitten, ist aber weiterhin zweitgrößte Waffenexporteurin auf dem Weltmarkt und besitzt mit Rostec einen der größten Militär- und Technologiekonzerne der Welt. Im Agrobusiness, spielen in den letzten Jahren auf dem Weltmarkt auch russische Konzerne vor allem im Getreide- und Fleischbereich eine immer größere Rolle (größter Weizenexporteur der Welt mit etwa 18 %). Auch wenn in den Bereichen Maschinenbau, IT, Halbleiter, Chemie und Automobile die russische Volkswirtschaft international nicht auf Spitzenplätzen liegt und hier technologisch sicherlich hinter dem „Westen“ und China hinterherhinkt, gibt es auch in diesen Sektoren jeweils genug Großkonzerne, die im Zuge der Importsubstitutionspolitik seit den 2010er Jahren die russische Wirtschaft zumindest genügend autark gemacht haben, um das Sanktionsregime seit 2022 intern kompensieren zu können (die Importe aus China haben sich aufgrund der Sekundärsanktionen nicht so stark entwickelt wie erwartet).
Die Entwicklung dieses relativ starken und unabhängigen Monopolkapitals war nicht nur möglich aufgrund des Rohstoffreichtums und der aus der Sowjetunion transformierten großbetrieblichen Struktur, sondern auch aufgrund der über 70 Millionen Lohnabhängigen. Diese sind durch das ausbeuterische Arbeitsrecht nicht nur profitabel verwertbar, sondern bieten auch, zumindest in absoluten Zahlen, eine große Zahl gut qualifizierter Fachkräfte (Facharbeiter:innen, Ingenieur:innen, wissenschaftliches Personal). Dies ist die Grundlage für das Mitmischen in wichtigen Weltmarktsektoren wie auch für die Möglichkeiten nachholender Entwicklung in den anderen Bereichen. Leider bildet die unqualifizierte Masse der Arbeiter:innen auch ein sehr großes Reservoir, um Soldat:innen zu „gewinnen“.
Wesentlich für die heutige Entwicklung der russischen Ökonomie war natürlich die Ersetzung des Zusammenhangs der Großbetriebe innerhalb der Planökonomie durch denjenigen der Steuerungswirkung von Kapitalkreisläufen, vermittelt über Banken und Kapitalmärkte. Die Schaffung großer Kapitalvermögen war aufs Engste verbunden mit der Bildung der oben genannten Monopole und der Konstruktion von Mechanismen, über die die Monopolprofite zur Grundlage der privaten Kapitalakkumulation werden konnten. Dabei spielten die privaten, aber auch staatlichen Banken und die Herausbildung eines eigenen russischen Kapitalmarktes eine entscheidende Rolle. Heute sind die dominierenden Banken (über Anteilseigentum) staatlich kontrolliert, werden aber in ihrer Politik bestimmt durch die Profitinteressen der großen Privatkapitale. Dies sind vor allem die Sberbank und die VTB, aber auch Banken, die unmittelbar mit den großen Monopolen verbunden sind, wie die Gazprombank. Im russischen Banken- und Kapitalmarktsektor spielen im Unterschied zu wirklich abhängigen Ländern ausländische Banken und Finanzinstitutionen so gut wie keine Rolle. Dass ausgerechnet die österreichische Raiffeisen Bank International die größte ausländische Bank in Russland ist, ist an sich schon bezeichnend (da diese im Bereich des internationalen Zahlungsverkehrs mit Russland wichtig ist, wurde ihr Russlandgeschäft trotz aller Sanktionen bis heute nicht abgewickelt). Über verschiedene Kanäle der internationalen Finanzmärkte fließt natürlich Kapital in Beteiligungen an allen möglichen Firmen (auch Banken), aber in allen wichtigen Firmen dominieren russisches Privatkapital oder der russische Staat. Mit den Mehrheitsbeteiligungen des Staates an der Sberbank (50 %, ein Drittel des Bankvermögens in Russland, drittgrößte Bank in Europa), an der VTB (über 60 %, größte Investmentbank samt Auslandsgeschäft), der Gazprombank und der WEB (Wneschekonombank; dt.: Bank für Außenwirtschaft; vergleichbar mit der KfW in Deutschland) ist der russische Staat aufs Engste mit dem Finanz- und Monopolkapital verflochten. Man könnte fast von einem Musterbeispiel für Lenins Verschmelzung von Staat, Finanzkapital und Monopolen sprechen. Dazu kommt, dass die geringen Schulden des russischen Staates bis 2022 und die stark positive Leistungsbilanz dazu führten, dass die russische Zentralbank über einen großen Spielraum für währungs- und finanzpolitische Maßnahmen verfügte, womit sich nicht nur die starke Resilienz gegenüber den Sanktionen im Finanzbereich erklärt, sondern auch die Finanzierbarkeit von Importsubstitutions- und Aufrüstungspolitik.
Zentral für imperialistische Expansion ist, wie oben bereits besprochen, der Kapitalexport. Dies sollte nicht abstrakt in den rein statistischen Kategorien bestimmter Kapitalexportphänomene (internationale Kredite, Beteiligungen, Portfolioinvestitionen etc.) verstanden werden, sondern über die zentrale Rolle eines Landes in den für die Weltwirtschaft wichtigen Kreisläufen der Kapitalakkumulation, die es als erkennbare Quelle und Senke von Kapital im Verwertungskreislauf erkennen lassen. Wie beschrieben lassen sich im Öl- und Gasgeschäft, Bergbau, in der Rüstungs-, Atomindustrie und im Agrobusiness solche Kreisläufe mit einer bestimmenden Rolle russischer Konzerne finden, die Zentralasien, den Kaukasus, Afrika, den Nahen Osten und sogar Lateinamerika einbeziehen. Diese Investments werden über russische Finanzinstitutionen, die großen Monopole und den russischen Staat organisiert und abgesichert – insbesondere der oben erwähnte „Stabilisierungsfonds“ (in Höhe von etwa 10 % des BIP). Auch wenn der russische Kapitalexport statistisch nur etwa 2 % des weltweiten Geschäftes damit ausmacht, so handelt es sich um strategisch wichtige Investments, die die Weltmarktstellung Russlands in seinen Monopolbereichen absichern. Eine wichtige Verzerrung der Kapitalimport/-export-Statistiken muss man natürlich immer berücksichtigen: Große Teile des russischen Privatkapitals (bis zu einem Viertel) werden in ausländischen Steueroasen geparkt (inzwischen nicht mehr vor allem in Zypern oder der Schweiz) und fließen von dort als „ausländische Investitionen“ nach Russland zurück. Wie schon ausgeführt, erschien es speziell im 2000er Jahrzehnt so, als ob es eine wachsende Auslandsbeteiligung an den großen russischen Monopolen gäbe, doch hat sich dies inzwischen stark reduziert. Seit den 2010er Jahren gibt es einen eindeutigen Überschuss des Kapitalexports gegenüber dem -import.
Dass Russland auf weltpolitischer Ebene seit den 2000er Jahren wieder als Großmacht agiert, wurde oben ausführlich dargestellt. Seine Interventionsfähigkeit als „Ordnungsmacht“ gegenüber schwächeren Akteur:innen wurde in Tschetschenien, Georgien, der Republik Moldau und Zentralasien deutlich demonstriert. Doch man agierte nicht nur als „Regionalmacht“, sondern auch international, etwa in Syrien, Libyen und mehreren afrikanischen Staaten. Dies wird ermöglicht durch eine der größten Militärmaschinerien der Welt, die wahrscheinlich größten Atomstreitkräfte und einen dahinterstehenden militärisch-industriellen Komplex. Dazu kommt das beschriebene Netzwerk von militärischen Stützpunkten oder „Kooperationen“ außerhalb der Russischen Föderation (Zentralasien, Belarus, Republik Moldau, Armenien, Libyen, Mali, Niger, Syrien, Venezuela, Nicaragua, Kuba, Vietnam). Diese eigenständige Großmachtfähigkeit wird ergänzt durch eine Reihe von internationalen Bündnissen und Organisationen. Dies betrifft sowohl die eigene Regionalmachtstellung wie OVKS und EAWU als auch die überregionalen Bündnisstrukturen BRICS und SOZ. Wie dargestellt, agiert der russische Imperialismus gegenüber seinen über hundert nichtrussischen Minderheiten im Kaukasus, Zentralasien, Sibirien und der Pazifikregion wie eine innere Kolonialmacht, sowohl was die rücksichtlose Ausbeutung von natürlichen Ressourcen ohne entsprechende Beteiligung betrifft als auch die Ausnutzung rassistischer Unterdrückung dieser Minderheiten als billigere Arbeitskräfte und „willige“ Rekruti:innen. Die Erschließung der Arktis bildet ein weiteres gigantisches Großmachtprojekt, das wie so viele andere extraktive Erschließungsprojekte Russlands ökologisch eine Katastrophe darstellt.
Die Herausbildung des russischen Imperialismus, vor allem aber die gleichzeitige Entstehung des chinesischen trafen auf eine imperialistische Welt, die weitgehend aufgeteilt war unter der Hegemonie der Supermacht USA. Der Zusammenbruch der bürokratischen Planwirtschaften in der UdSSR, in Osteuropa und China musste in den bestehenden imperialistischen Blöcken, die sich auch gerade aus einer Krisenperiode herausbewegten, das Bedürfnis nach Expansion und neuem Wachstum ihrer Ökonomien durch Eingliederung dieser riesigen Rohstoff- und Wirtschaftsregionen wecken. Nachdem sich im Chaos der 1990er Jahre diese Illusionen außer in Osteuropa nicht erfüllten und mit Russland und China in den 2000er Jahren zugleich neue Konkurrenten erschienen, musste dies zu einem Kampf um die Neuaufteilung der Welt führen, insbesondere nachdem man mit der großen Krise 2008/2009 in eine Phase der globalen wirtschaftlichen Stagnation und verschärften Konkurrenz um Weltmarktanteile eintrat. Ohne diese zentrale Dynamik innerimperialistischer Konflikte der großen Blöcke (USA, EU, Japan, China, Russland) und ihrer inneren Widersprüche zu berücksichtigen, wird man keine konsequent antikapitalistische und antiimperialistische Position gegenüber deren Folgen (Kriegstreiberei, Rassismus, Rechtsruck, Aufrüstung, verschärfte Standortkonkurrenz- und Sozialabbaupolitik etc.) entwickeln können.
Die aufgeführten Merkmale, die die russische Volkswirtschaft als imperialistisch charakterisieren, müssen in Relation zur globalen imperialistischen Ordnung gesehen werden. Die russische Ökonomie gehört sicherlich nicht zu den „Lokomotiven“ der Weltwirtschaft. Russland hat zwar eine von Großbetrieben und großen Banken bestimmte, diese Monopole und Finanzkapitale sind aber im Vergleich zu denen von USA, China, Japan und den zentralen EU-Ökonomien klein. Insbesondere in Bereichen der Produktionsmittelindustrien (z. B. Maschinenbau) und Hochtechnologie ist Russland – mit einigen Ausnahmen (Luft- und Raumfahrt-, Nuklearindustrie) – eher in den hinteren Reihen aufgestellt. Allerdings ist das russische BIP nach Kaufkraftparität das viertgrößte der Welt – wenn auch weniger als ein Viertel so groß wie das der USA oder Chinas. Die Größe des Landes, sein Rohstoffreichtum und die Masse an Arbeitskräften (und Soldat:innen) machen einen zusätzlichen Faktor aus. Aber wie schon bei Lenins Analyse des zaristischen Russland ist klar, dass es vor allem seine aus diesen Größenfaktoren, seiner geographischen Lage und seinen militärischen Potenzialen sich ergebenden Fähigkeiten zur Großmachtpolitik sind, die aus einer ökonomisch nachgeordneten Position eine imperialistische Großmacht schaffen. Dieses Verhältnis von Wirtschaft und Großmachtansprüchen begründet auch die besondere Tendenz zu autoritärem Regieren nach innen und aggressivem Verhalten nach außen.
11.3 Andere Positionen zum imperialistischen Charakter Russlands
Die Argumentationen gegen den imperialistischen Charakter Russlands können in folgenden Linien zusammengefasst werden:
11.3.1 Russland als nichtkapitalistisch
Einige „marxistisch-leninistische“ Organisationen, zumeist aus dem altstalinistischen Umfeld, sehen China weiterhin als „sozialistisch“ an, um dann den Verbündeten Russland als zumindest „objektiv antiimperialistisch“ zu charakterisieren, das dem chinesischen Bestreben nach einem Brechen der Vorherrschaft des „Imperialismus“ durch eine „multipolare“ Welt folge. Angesichts der Tatsache, dass China und Russland gegenüber ihren eigenen Arbeiter:innenklassen zutiefst ausbeuterisch agieren, sämtliche demokratischen Rechte (auch gewerkschaftlicher Art) brutal unterdrücken und ihre kapitalistische Struktur offen zu Tage liegt, ist eigentlich jegliche Zuschreibung eines progressiven „sozialistischen“ Charakters für diese beiden Länder bis zum Äußersten absurd. Auch die Charakterisierung als degenerierter Arbeiter:innenstaat im Sinne Trotzkis braucht für Russland nach der obigen Beschreibung des Ablaufs der kapitalistischen Restauration in den 1990er Jahren und deren neoliberaler Stabilisierung unter Putin hier nicht mehr behandelt zu werden. Etwas modifiziert tritt dies etwa in der Auffassung auf, dass in Russland und China die kapitalistische Restauration erst in einem „Anfangsstadium“ stecke (so etwa die argentinische Gruppe Partido Obrero).[xlvii] Als Argument wird hier die wenig entwickelte Bourgeoisie angeführt, die zu einer besonders starken Rolle des Staates führe. Abgesehen davon, dass sich in Russland die Zahl der großen oligarchischen Vermögen nicht wesentlich von derjenigen in westlichen Ländern unterscheidet und hier wie dort ein beträchtlicher Teil der Bourgeoisie aus „angestellten“ Manager:innenschichten besteht, ist die Verschmelzung von Staat und Monopolen dagegen ja gerade kennzeichnend für imperialistische Nationen. Dass andere imperialistische Länder unterschiedliche Formen davon aufweisen, hat mit verschiedenen historischen Bedingungen der Herausbildung der heutigen imperialistischen Staaten zu tun. Die herausragende Bedeutung des Staates in der chinesischen und russischen Wirtschaft hat gerade mit der Transformation von bürokratischen Planwirtschaften hin zu neuen imperialistischen Ländern zu tun, die ihre von der Staatswirtschaft geprägten Großbetriebe als kapitalistisch neu zusammengesetzte Monopole erst auf dem Weltmarkt gegen etablierte Privatkonzerne (hinter denen entsprechende Staatsapparate stehen) durchsetzen mussten. Die Durchsetzung der Prinzipien der Kapitalakkumulation in Osteuropa war dagegen von vornherein unter der Dominanz westlicher Investitionen zustande gekommen, die die dortigen Ökonomien schnell in die Teile spalteten, die sie ihren Wertschöpfungsketten anschließen konnten, und diejenigen, die eine marginale eigenständige Akkumulation fristen konnten. Und dort war daher von vornherein kein starker Staat in der Wirtschaft nötig, da das in- und ausländische Privatkapital die für abhängige Ökonomien üblichen Verwertungsformen annahm. Die besonders starke Rolle des Staates in der russischen und chinesischen Ökonomie ist daher kein Zeichen einer noch nicht abgeschlossenen Restauration des Kapitalismus und damit eines „objektiv antiimperialistischen Noch-nicht-Kapitalismus“, sondern ein Resultat des mehr oder weniger direkten Übergangs aus dem degenerierten Arbeiter:innenstaat in einen imperialistischen Kapitalismus, der sich aggressiv und ausbeuterisch im Kampf um die Neuaufteilung der Welt durchsetzen muss.
11.3.2 Russland als „Peripherie“land
Andere Organisationen, die sich auf die Analyse Lenins zum Imperialismus berufen, sehen in Russland eine abhängige oder halbkoloniale Ökonomie. Dabei berufen sie sich vor allem auf die geringe Rolle des Kapitalexports und den hohen Einfluss des Staates, insbesondere im Bankenbereich. Die spezifische Form dieser beiden Felder im russischen Imperialismus wurde oben schon ausführlich dargelegt. Erstens ist empirisch nachweisbar, dass es zumindest nach 2010 systematische Überschüsse des Kapitalexports gegenüber -importen gab und dass Ersterer eine wichtige Rolle in der strategischen Absicherung der Monopole spielt. Die relative Schwäche des Kapitalexports im Vergleich zu dem anderer imperialistischer Mächte ist in der Geschichte des Imperialismus nichts Ungewöhnliches. Schon in seiner Imperialismusschrift wies Lenin darauf hin, dass der imperialistische Zarismus abhängig von ausländischem Kapitalzufluss war bzw. die unterschiedlichen Stärken von deutschem Industriekapital und französischem Finanzkapital zu sehr unterschiedlichen Formen des Kapitalexports führten. Die Argumentationen zu diesen Punkten (Kapitalexport und starke Rolle des Staates) brauchen wir hier nicht mehr im Detail auseinanderzusetzen. Wer sich hier genauer informieren will, kann die detaillierten Widerlegungen (mit entsprechendem empirischen Material) von PO, LIT, UIT und FT von Michael Pröbsting in „Anti-Imperialism in the Age of Great Power Rivalry“ (S. 121–157) nachlesen.
Neben der Infragestellung des imperialistischen Charakters Russlands auf leninistischer Basis gibt es noch solche, die eher auf postkolonialen oder auf „Weltsystemtheorie“-basierten Imperialismusbegriffen beruhen. Hierbei wird Russland (mehr oder weniger immer schon) der „Peripherie“ und der Welt der „abhängigen Entwicklung“ zugeordnet. Hierzu zählt natürlich Boris Kagarlizki mit dem berühmten „Empire of the Periphery: Russia and the World System“. Aber auch die hier oft zitierten Dsarassow und Jaintner gehen von Russland als einer vom westlichen Imperialismus dominierten, abhängigen Volkswirtschaft aus. Der wesentliche Grund wurde schon im Zusammenhang mit dem „Extraktivismus“konzept behandelt. Hierbei wird davon ausgegangen, dass eine Ökonomie, die ihren Reichtum vor allem durch den Abbau von Naturschätzen (endlich und nicht nachhaltig) erwirtschaftet und vollkommen darauf bauen muss, diese extrahierten Güter auf dem Weltmarkt abzusetzen, nur eine von den eigentlich produzierenden Kapitalen abhängige Ökonomie sein könne. Dazu ist festzuhalten, dass einerseits alle großen kapitalistischen Ökonomien für den Weltmarkt produzieren („Exportweltmeister Deutschland“) und damit eigentlich „abhängige“ Ökonomien wären. Andererseits wird hier von einer bestimmten materiellen Arbeitsteilung statt von der Verwertungslogik des Kapitals ausgegangen. Für das Kapital ist es egal, ob es Autos oder Gas verkauft werden, Hauptsache Extraprofit. Das Problem beim klassischen Extraktivismus besteht gewöhnlich eher darin, dass die Abbauländer gar nicht selbst die auf dem Weltmarkt eigentlich gehandelten Waren bereitstellen, sondern nur von den Förderrechten selbst leben (Rohstoffrente, Royalties). Bei den russischen Rohstoffmonopolen werden jedoch sowohl die Förderrechte als auch die Förderung selbst, die Aufbereitung als weiterverarbeitbares Produkt, die Transportleistungen wie der Vertrieb und die Finanzierung selbst übernommen. Es wird also der volle Monopolprofit angeeignet, und dies bei einem für die Weltwirtschaft entscheidenden Faktor: der Energiebasis der globalen Gesamtproduktion.
Letztlich ist es auch falsch zu behaupten, dass die russische Wirtschaft nach der Industrialisierung durch die Sowjetunion mit der Restauration des Kapitalismus praktisch wieder vollständig deindustrialisiert und wesentlich auf eine Rohstoffexporteurin zurückentwickelt wurde. Wir haben bereits dargelegt, wie viel nach der Stabilisierung am Ende der 1990er Jahre von dem erreichten industriellen Niveau der Sowjetunion doch, wenn auch in modifizierter Form, erhalten geblieben ist. Dies betrifft nicht nur wenige zentrale Bereiche wie Nuklearindustrie, Luft- und Raumfahrt, Rüstungs- und Hochtechnologien, sondern auch einen in absoluten Zahlen großen Teil wissenschaftlich und technisch gut ausgebildeter Arbeitskräfte. Dies ermöglichte auch z. T. erfolgreiche Importsubstitution. Auch das durch Energieversorgung und Agraraufschwung bedingte Ausmaß an Autarkie gegenüber dem Weltmarkt spricht nicht für die These einer total abhängigen und peripheren Ökonomie. Solche Theorien der „Randständigkeit Russlands“ unterschätzen total sowohl das enorme Potenzial dieses Landes als auch die enorme Gefahr, die von einem Rückzug auf die „autarke Festung Russland“ ausgeht (wie sie etwa in der oben zitierten Rede von Glasjew zum Ausdruck kam).
Leider ist es auch die sogenannte Kommunistische Partei der Russischen Föderation, die das „russische Vaterland“ von „dem Imperialismus“ bedroht sieht und sich daher in seine „Verteidigung“ einreiht. Bisher ist von der KPRF allerdings keine Analyse im Sinne Lenins zur Frage zu finden, was Imperialismus ist und warum die RF irgendwie in der Tradition der Sowjetunion stehen soll und inwiefern etwa die Kritik Putins an Lenins Position (von der berechtigten Selbstbestimmung der Ukraine) nicht doch die plumpe Rechtfertigung einer großrussisch-imperialistischen Politik darstellt. Gegenüber der KPRF kommt der Vereinigten Kommunistischen Partei Russlands (OKP) zumindest das „Verdienst“ zu, eine „Analyse“ vorzulegen, die Russland als peripheres Land einstuft, das sich auf dem Weg zur Kolonie befindet. Danach könne das periphere Russland, sobald es nicht mehr sozialistisch sei, nur auf den Weg geraten, vom „Imperialismus“ unterjocht und kolonisiert zu werden. Die scheinbare Radikalität der Alternative „Für den Sozialismus oder wir werden kolonialisiert“ führt hier zur Wirklichkeitsverweigerung gegenüber der tatsächlichen imperialistischen Natur des eigenen Landes und damit Verklärung der aggressiven Politik, die zum „Abwehrkampf“ gegen den Imperialismus hochstilisiert wird. Eine noch krudere Wende vollzieht die Russische Kommunistische Arbeiter:innenpartei innerhalb der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, bis 2012 bekannt unter dem Namen Russische Kommunistische Arbeiter:innenpartei – Revolutionäre Partei der Kommunisten (RKAP-RPK). Diese erkennt zwar immerhin an, dass das gegenwärtige Russland eine imperialistische Macht sei, aber es wird zwischen den verschiedenen Imperialismen als mehr oder weniger gefährlich für eine zukünftige progressive Entwicklung unterschieden, so wie es auch richtig gewesen wäre, die „demokratischen Imperialismen“ im Zweiten Weltkrieg gegen den faschistischen deutschen Imperialismus zu unterstützen. Was Russland und China derzeit „progressiver“ machen soll als den westlichen Imperialismus, ist nicht wirklich klar, aber allein die Methode, imperialistische Politik nach dem Maßstab des geringeren Übels zu bewerten, ist sicher kein sozialistischer, leninistischer Ansatz, um die gegenwärtige Neuaufteilung der Welt unter gleichermaßen räuberischen Monopolkapitalen zu erklären.
11.3.3 Russland erst auf dem Weg zum Imperialismus
In solche Argumentationsmuster passt auch die Position der trotzkistischen Fraktion – 4. Internationale (TF – VI), die ablehnt, Russland und China als imperialistisch zu charakterisieren, da die Entstehung neuer imperialistischer Mächte nur durch einen Weltkrieg möglich sei. Dies ist eine mechanische Verkürzung der leninistischen Charakterisierung der imperialistischen Epoche als einer, in der die Welt zwischen Großmächten aufgeteilt ist. Dazu bemerkte Lenin selbst, dass „Aufteilung“ nur in dem Sinn gemeint sein könne, dass alle Regionen der Welt von einer solchen Aufteilung erfasst würden, „endgültig nicht in dem Sinne, daß eine Neuaufteilung unmöglich wäre – im Gegenteil, Neuaufteilungen sind möglich und unvermeidlich“.[xlviii] Bei Kolonialaufteilung ist so eine Neuaufteilung sicherlich kaum ohne kriegerische Auseinandersetzung vorstellbar. Tatsächlich beherrschen imperialistische Mächte bestimmte Regionen zumeist nur indirekt (von Lenin als Halbkolonien bezeichnet), durch ökonomische und politische Unterordnung. Dies kann sich auch durch starke ökonomische Veränderungen verschieben – von Lenin etwa am Beispiel des Aufstiegs Japans zur imperialistischen Macht dargestellt. Im Fall von Russland und China kommt dazu, dass diese Regionen durch die jahrzehntelange Abkopplung vom imperialistischen Weltsystem als nichtkapitalistische Ökonomien ja nicht bei der Verteilung auf dem Weltmarkt vertreten waren, hier also von vornherein eine Neuaufteilung stattfinden musste. Natürlich stellt die Herausbildung neuer imperialistischer Staaten die Frage der Neuorganisierung des gesamten Systems der Großmächte, insbesondere da die ökonomische Stagnationsphase nach 2008/2009 zu einer Weltsituation geführt hat, in der die großen Kapitale sowieso aufs Heftigste um Weltmarktanteile kämpfen müssen. Daher lautet die Frage nicht, wie Russland und China ohne Krieg imperialistische Mächte geworden sein können, sondern: Wie kann unter der Voraussetzung der verschärften Konkurrenz auf den Weltmärkten und Heraufkunft zweier neuer imperialistischer Mächte der sich abzeichnende neue imperialistische Weltkrieg noch verhindert werden?
11.3.4 Viele neue Imperialist:innen?
Insofern ist auch die Theorie der Internationalen Koordination revolutionärer Parteien und Organisationen (ICOR; in Deutschland: MLPD) der „neuimperialistischen Länder“ nicht hilfreich: Diese Theorie analysiert zwar anhand der ökonomischen Analyse Russland und China richtig als neue imperialistische Mächte. Sie geht aber weiter, indem sie die Epoche des neoliberal entfesselten globalen Kapitalismus zu einer des Aufstiegs einer großen Zahl neuer imperialistischer Mächte umschreibt, also etwa auch der Türkei, Indiens oder Südkoreas neben vielen anderen (etwa zwei Drittel der Menschheit leben danach in imperialistischen Ländern). Einerseits wird Lenins ökonomische Analyse im Wesentlichen auf die Frage der Monopole reduziert, wobei dazu für sie eigentlich jeder Großkonzern zählt. Und da die meisten der genannten Länder in diesem Sinne Monopole besitzen, werden sie kurzerhand imperialistisch. Ohne ins Detail zu gehen, werden hier die genaue Analyse des Weltmarktes und der beherrschenden Stellung eines Monopol- und Finanzkapitals in strategischen Sektoren des Weltmarktes ausgelassen, genauso wie die Frage der Fähigkeit zur Großmachtpolitik (wenn auch nur innerhalb eines imperialistischen Blocks). Natürlich weist Südkorea wichtige Weltkonzerne auf (sehr viel mehr als z. B. die Türkei), andererseits ist es keine bestimmende Großmacht in einem imperialistischen Block, sondern in seiner weltpolitischen und militärischen Lage vollständig von der politisch-militärischen Unterstützung durch die USA abhängig (solange sich nicht der historisch sehr unwahrscheinliche Block Japan-Südkorea-Taiwan herausbildet). Ebenso eignet die Türkei zwar Elemente der militärisch gestützten eigenständigen Regionalmachtpolitik, hat aber ein Monopol- und Finanzkapital, das auf dem Weltmarkt kein strategisch bedeutsames Feld beherrscht. Die Inflation des „Neuimperialismus“-Begriffs führt daher zu einer Verkennung der zentralen Konfliktlinien in der Neuaufteilung der Welt zwischen wenigen, sehr großen imperialistischen Blöcken, in denen allerdings Bündnisse mit und Einordnungen solcher aufstrebenden Länder wie Indien, Türkei etc. sehr wesentlich sein werden.
11.3.5 Russland als Subimperialismus
Eine andere Variante der neuen „Multipolarität“ bildet die Erweiterung der Theorie des „Subimperialismus“, wie sie etwa beim südafrikanischen Dependenztheoretiker Patrick Bond zu finden ist. In den 1970er Jahren entwickelte der brasilianische Dependenztheoretiker Ruy Mauro Maurini für Länder wie Brasilien die Theorie vom „Subimperialismus“, der in bestimmten Regionen als eine Art Gendarm des Imperialismus für die Aufrechterhaltung von dessen Ordnung sorgt und dabei auch Vorteile für die einheimischen Monopole durchsetzen kann. Bond setzt diese Analyse bis zu den BRICS-plus-Staaten fort: „Trotz wachsender Widersprüche zwischen den USA und China/Russland stellen die BRICS-Staaten keinen Block dar, der die westliche Dominanz der Multilateralen (USA, EU, UK, Japan) wirklich herausfordern könnte, sondern vielmehr eine widersprüchliche, unzusammenhängende Arena, in der subimperiale Mächte die kapitalistischen Formen der Ausbeutung und Aneignung verstärken.“ Tatsächlich würden die BRICS-Staaten durch ihre finanz- und handelspolitischen Aktivitäten in bestimmten Regionen der Welt die Arbeit der westlichen Imperialist:innen komplementieren und dabei für ihre Führungsmächte China und Russland eigene Einflussregionen schaffen, die ihnen günstigere Ausbeutungsbedingungen ermöglichen – immer letztlich den übergeordneten Kapitalbewegungen von USA & Co. unteworfen. Russland wird als ein Land der „Semiperipherie“ charakterisiert, das vom Rohstoffexport und damit von dessen „Superzyklen“ abhängig sei. Ab dem Jahr 2015 sei die Semiperipherie als erste von der globalen Überakkumulationskrise getroffen worden (aufgrund des Endes des Rohstoffbooms und der Überkapazitäten in den chinesischen Produktionszentren). Dadurch angetrieben, gerieten die Führungsmächte der Semiperipherie zu „Rivalinnen auf der Weltbühne“, aber eben als „Subimperialismus“, der gezwungen sei, seine Wachstumsschranken zu überwinden, und zwar durch Kampf um „Räume“ im Interesse des Abbaus seiner Überkapazitäten, um der Entwertung von Kapital zu entgehen. Bond erkennt, dass sich Russland und China bei aller noch bestehenden Machtdifferenz zum westlichen Imperialismus einer aggressiven neoliberalen Expansionspolitik ihrer Kapitale verschrieben hätten. Und auch wenn sie „Noch-Nicht-Imperialisten“ seien (in diesem Sinn versteht er „Subimperialismus“), so seien sie doch im Begriff, richtige imperialistische Mächte zu werden. Daher sieht er (Vijay Prashad zitierend) mit ihrem Aufstieg die Gefahr verbunden, dass sich das Verhältnis der USA zu seinen „verlässlich subimperialen kapitalistisch-expansiven Partner:innen“ in „Richtung einer sehr viel ernsteren interimperialistischen Konkurrenz“ entwickeln könnte.[xlix]
Insbesondere an den Kriterien, die Bond/Prashad daran anlegen, warum China/Russland „subimperialistisch“ seien (ihnen fehle trotz BRICS ein wirklich multilateraler Herrschaftsraum), wird deutlich, dass sie unter imperialistischen Mächten solche verstehen, die wesentliche Akteurinnen einer Aufteilung der Welt unter Großmächten sind (also selbst Achsen der „multilateralen imperialistischen Ordnung“ und nicht bloß hilfsweise Übertragungselemente). Offensichtlich suggeriert der Begriff des „Subimperialismus“ eine relativ statische Ordnung von imperialen Großmächten, die, ausgehend von den Metropolen, in einer Art Stufenleiter von sich nach unten verkleinernden imperialistischen Mächten (Sub/Sub-Sub/…-Mächten) bis in die letzten Winkel der Peripherie organisiert ist. Dies verwischt den grundlegenden Widerspruch von Imperialismus und Beherrschten, dem ein bestimmtes ökonomisches Verhältnis (Monopol- und Finanzkapital) zugrunde liegt – und die damit verbundene Dynamik, dass eine Veränderung der ökonomischen Verhältnisse (Verschiebung in den internationalen Kräfteverhältnissen zwischen den Monopolen) in Widerspruch zu den bestehenden politischen globalen Dominanzsystemen gerät. Es ist ein Widerspruch in der imperialistischen Epoche, der nur zu oft zu einer Periode heftiger Neuorganisation und Großmächtekonfrontation geführt hat. Wenn unter die Kategorie des „Subimperialismus“ sowohl Länder eingeordnet werden, die offenbar kein Potenzial zur Herausforderung der bestehenden imperialistischen Ordnung besitzen (wie Brasilien), als auch solche, denen die Autoren ein Potenzial zum interimperialistischen Konflikt zuschrieben, so verschleiert der Subimperialismusbegriff diese grundlegende Widerspruchsdynamik – und damit auch die Gefahren, die von solchen „imperialistischen Newcomern“ ausgehen. Es besteht eine gedankliche Hintertür dazu, dass es sich doch um etwas „Progressiveres“ als die alten imperialistischen Mächte handelt, einen „Hauch von Antiimperialismus“, der hier Ländern mit aggressiver und ausbeuterischer Dynamik nach innen und außen angedichtet wird.
11.3.6 Russland im Kampf um die multipolare Welt
Für John Bellamy Foster (den Herausgeber des einflussreichen Magazins Monthly Review) stellt diese Subimperialismustheorie für die Länder Russland und China eine schlimme Revision der „Errungenschaften der Imperialismustheorie“ dar – fast so schlimm, wie diese Länder direkt als imperialistisch zu charakterisieren. Fosters Artikel „The Denial of Imperialism in the Left“[l] liefert eine sehr ausführliche Abrechnung mit gegenwärtigen Auffassungen über den internationalen Kapitalismus, vor allem im akademischen Marxismus. Hier soll nicht im Detail auf die verschiedenen, zum Teil berechtigten, Elemente dieser Kritik eingegangen werden. Bemerkenswert ist, was er genau unter der Imperialismustheorie versteht. Auch wenn er Lenin als Ausgangspunkt nimmt, fügt er ziemlich umstandslos hinzu: „Lenin stand jedoch keineswegs allein da. Seine Gesamtanalyse wurde zu verschiedenen Zeiten durch die Dependenztheorie, die Theorie des ungleichen Austauschs, die Weltsystemtheorie und die Analyse der globalen Wertschöpfungskette ergänzt und aktualisiert, wobei neue historische Entwicklungen berücksichtigt wurden. Dabei blieb die marxistische Imperialismustheorie in ihren Grundzügen erhalten und prägte die revolutionären Kämpfe weltweit.“ (Eigene Übersetzung; Red.) Elemente, die eigentlich eine grundlegende Revision der marxistischen politischen Ökonomie darstellen wie Dependenztheorie, Theorie des ungleichen Tausches, Weltsystemtheorie und später auch noch Baran/Sweezy’s Verkürzung der Monopoltheorie, mutieren also unter der Hand zu Elementen der „Standardtheorie“ des Imperialismus, und es stellt sich heraus, dass Revisionist:in ist, wer diese kritisiert. Leider ist dieser eklektische Theoriemix tatsächlich verantwortlich für eine Verflachung der Imperialismustheorie, die zu jeder Menge Opportunismus gegenüber angeblichem Antiimperialismus geführt hat. Die hier erwähnten ökonomischen Theorien vom ungleichen Tausch einschließlich Baran/Sweezy haben wir ausführlich in unserem Buch „Imperialismus“, RM 53, kritisiert.[li] Hier soll nur insoweit darauf eingegangen werden, wie es zur Frage des russischen Imperialismus wesentlich ist.
Der Hauptpunkt ist, dass im Gefolge der Theorie des ungleichen Tausches – in der Weise wie bei Samir Amin – behauptet wird, dass sich der Imperialismus durch die Auflösung der Kolonien und die folgende Neokolonialisierung grundlegend geändert habe: Der ungleiche Tausch zwischen den imperialistischen Ländern und den abhängigen Ökonomien führe zu einem beständigen Werttransfer von der Peripherie in die Metropolen. Die sei die neue Form der imperialistischen Ausbeutung geworden (gegenüber der Ära der Kapitalexporte und der unmittelbaren Aneignung). Dies sei begründet in der nicht vollständig durch Produktivitätsunterschiede bestimmten Lohndifferenz, womit für die ausgetauschten Güter in der Peripherie mehr Arbeit geleistet werden müsse als in den Metropolen, also somit ein Werttransfer stattfinde. Grundlage dafür seien die ungerechten Verhältnisse auf dem Weltmarkt, die durch die Art der weltweiten Arbeitsteilung und die finanziellen Rahmenbedingungen (Währungen, Verschuldung, Kapitalzugang etc.) erzeugt würden. Sieht man sich seine Herleitung des ungleichen Tausches (als Modifikation des Wertgesetzes) jedoch an, so wird klar, dass die entscheidende Voraussetzung für einen solchen systematischen Werttransfer allein über die Weltmarktpreise in der Annahme besteht, dass sich in Wirklichkeit zwischen den Metropolen und der Peripherie die Profitraten ausgleichen. Nur dann wird der in dem Niedriglohnland erzielte höhere Mehrwert auch in Geldform in das Land mit den günstigeren „Terms of Trade“ transferiert. Gerade dies lässt sich aber empirisch bis heute überhaupt nicht feststellen. Die Profitraten gleichen sich zwar zwischen den Triadenregionen (USA, EU, Japan) an, nicht jedoch zwischen diesem Block und dem Rest der Welt. Die größeren Profite, die außerhalb der Triade zu erzielen sind, sind sowohl Ausdruck höherer Ausbeutung (und niedrigerer Löhne) als auch der für die abhängigen Länder in den meisten Sektoren geltenden geringeren Produktivität – dies aber in Ergänzung mit sehr gut entwickelten Sektoren, die hohe Exporterlöse versprechen und in denen die höheren Profitraten in dem Land dann Kapitalimporte anlocken. Es ist weiterhin die globale Akkumulationsbewegung der großen Weltmonopole, die zu ungleichzeitiger und kombinierter Entwicklung führt, damit den Ausgleich der Profitraten verhindert und sowohl Profittransfer als auch, untergeordnet, ungleichen Tausch hervorbringt – nicht umgekehrt! Mit dieser Akkumulationsbewegung der Monopole auf dem Weltmarkt sind damit sowohl deren Extraprofite verstetigt als auch Gewinne der lokalen Bourgeoisie garantiert (die in den Sektoren mit hohen Profitraten mitbeteiligt ist). Zugleich bleibt die Entwicklung der Restökonomie zurück, ebenso wie auch die Einkommen der arbeitenden Klassen. Gerade die Branchen, die für die Reproduktion der Arbeitskräfte sorgen, sind diejenigen, die im Weltmarktvergleich für die größere Kaufkraft geringer Löhne sorgen, z. B. durch Subsistenzwirtschaft, die ein Überleben trotz eines Hungerlohns erlaubt.
Der Punkt in Bezug auf Russland oder China ist, dass die angeführten geringen Lohnstückkosten bzw. das Vorherrschen extraktiver Bereiche im russischen Export jeweils keine Belege für „ungleichen Tausch“ und damit für Werttransfer in die Triade sind. Foster verwendet hier z. B. in Bezug auf China das klassische Argument des „ungleichen Tausches“: „Niedrige Lohnstückkosten für im globalen Süden produzierte Güter haben zu steigenden Bruttogewinnmargen für multinationale Unternehmen aus dem Zentrum des Systems geführt, deren Rohstoffe in China und anderen Entwicklungsländern produziert und dann in den globalen Norden exportiert werden, wo der Endverkaufspreis der Güter um ein Vielfaches über dem Exportpreis der Rohstoffe in den Erzeugerländern liegt.“ (Eigene Übersetzung; Red.)[lii] Das Argument der geringen Lohnstückkosten (der höheren Ausbeutung der Arbeitskraft) ignoriert, dass im Fall Chinas und Russlands der jeweils höhere Profit auch dort von Staat und einheimischem Kapital angeeignet wird. Diese Länder werden in ihrer ökonomischen Struktur gerade nicht durch dominierenden westlichen Kapitalimport geprägt, der in beiden Ländern im Vergleich zu Halbkolonien, wie besprochen, stark beschränkt ist, und erzielen in ihren Exportindustrien (aus unterschiedlichen Gründen) höhere Profitraten als die Triadenländer. Von daher spricht der Lohstückkostenvergleich vor allem für höhere Profitmassen, die vom chinesischen bzw. russischen Kapital angeeignet werden. Damit ist auch das von Bond/Prashad oben erwähnte Phänomen der Überakkumulation in China und Russland während der 2010er Jahre die richtige Beobachtung. Die Steigerung der Akkumulation, die steigende Profitmassen und fallende Profitraten kombinierte, musste ab einem bestimmten Punkt zu einem Problem der Überkapazität, nämlich Auseinanderfallen des Verhältnisses von Masse des zu verwertenden Kapitals zu investierbarem Kapital, führen. Und genau dies erklärt die zu diesem Zeitpunkt nach außen aggressiv werdende Dynamik dieser beiden kapitalistischen Ökonomien und ihrer Staaten.
Für die statische Imperialismustheorie Fosters dagegen ist es unvorstellbar, dass „Schwellenländer“ wie China oder Russland die übermächtige Triade (USA, EU, Japan) herausfordern könnten. Hier kann es nur umgekehrt sein, dass die Krise der Hegemonie der USA und das Schwächeln der Triade insgesamt zu deren aggressiven Eindämmungsaktionen gegenüber den beiden aufstrebenden „Schwellenländern“ führen. Die Krise „des Imperialismus“ führe also zum Zusammenstoß mit den nach berechtigter Entwicklung drängenden Peripherieländern. Der Sieg der Letzteren wäre dann so etwas wie der Zusammenbruch „des Imperialismus“ und die Heraufkunft einer multipolaren Übergangsgesellschaft. Die Ignoranz gegenüber der enormen kapitalistischen Dynamik dieser neu aufsteigenden Mächte und die Verleugnung des Grundgesetzes der imperialistischen Epoche, dass nämlich eine von Monopolen beherrschte Weltökonomie auch notwendig zur Aufteilung der Welt unter imperialistischen Großmächten führt, lässt die Verteidiger:innen des peripheren Charakters Russlands und Chinas damit zu Unterstützer:innen einer neuen imperialistischen Ordnung werden. Wie die alte Sozialdemokratie hat man damit seinen progressiven Imperialismus gefunden: das Lager der „multipolaren Weltordnung“ als Vorstufe zu einer in ferner Zukunft erscheinenden sozialistischen Welt. Foster behauptet in besagtem Artikel auch, die „Imperialismustheorie“ würde eine Revision der marxistischen Revolutionstheorie bedeuten, da sich in den Peripherieländern die Arbeiter:innenklasse anderen, im antiimperialistischen Kampf zentraleren, nicht proletarischen Klassen unterordnen müsse. Damit entwickelt er eine neue Art der Etappentheorie, nach der sich reaktionäre, arbeiter:innenfeindliche kapitalistische Staaten wie China und Russland in Demiurgen der nächsten progressiven Etappe der Menschheitsgeschichte verwandeln. Dies ist nur eine weitere verhängnisvolle antiproletarische Ideologie im Gefolge des Stalinismus, die jeglichen Kampf um den Sozialismus tief ins Verderben führen wird. Diese Ausrichtung kann nur zum nächsten Verrat und zur kriminellen Unterordnung unter verbrecherische Regime führen, wie sich das auch heute schon in Venezuela, Nicaragua, Syrien und der Ukraine zeigt.
11.4 Der besondere Weg Russlands vom degenerierten Arbeiter:innenstaat zum Imperialismus
Hier muss noch auf einen wichtigen Punkt hingewiesen werden, der Russland und China wesentlich von anderen „Schwellenländern“ unterscheidet: Es sind nicht einfach Länder mit einer raschen, nachholenden kapitalistischen Entwicklung, die wie alle solche stark von der ungleichzeitigen und kombinierten Entwicklung geprägt sind (einige wenige hochmoderne, profitable und exportorientierte Bereiche, viele zurückgebliebene und vom Weltmarkt abgeschnittene oder bedrohte Sektoren). Vielmehr stammen beide aus einer nachkapitalistischen Vergangenheit, einer vollständig staatlich organisierten Planwirtschaft bzw. Gesamtökonomie mit jeweils sehr großen betrieblichen und überregionalen Konglomeraten, ein wichtiger Faktor auch für die heutige Struktur der russischen und chinesischen Wirtschaft. Man sollte nicht der falschen Vorstellung erliegen, dass bürokratische Planwirtschaft und Monopolkapitalismus in total verschiedenen Welten leben würden. Wir haben im ersten Teil herausgearbeitet, weshalb trotz unterschiedlicher gesellschaftlicher Basis und Steuerung des Gesamtkreislaufes (Plan und Weltmarkt) überraschend viele Gemeinsamkeiten zwischen der Bürokratie der sowjetischen Wirtschaftskomplexe und dem Management von Monopolbetrieben bestanden (bei Ersterer war allerdings der „Fordismus“ zählebiger als in Letzteren). In der Restauration des Kapitalismus in Russland, wie wir sie oben beschrieben haben, ist der „Film“ der wirtschaftlichen Entwicklung der Sowjetunion nicht einfach rückwärtsgelaufen, und man gelangte wieder zurück zur peripheren Struktur des zaristischen Kapitalismus mit einigen wenigen modernen Weltmarktkonzernen und einem wieder deindustrialisierten Rest. Die Vorstellung, dass nur Rohstoffkonzerne wie Gazprom und dazu noch ein paar Rüstungsmonopole die heutige ökonomische Stellung Russlands ausmachen würden, ist vollständig verfehlt. Trotz der „Disruption“ durch die chaotische Restaurationspolitik der 1990er Jahre („Schocktherapie“) haben die betrieblichen Strukturen und ihre Verbindung in beträchtlichem Ausmaß überlebt, wenn auch oft in völlig neuer Zusammensetzung (wie wir am Beispiel von Lukoil gezeigt haben). Auch wenn die großen Monopole im Öl- und Gasgeschäft, in der Rüstungsindustrie, im Bergbau, der Luft- und Raumfahrt-, der Atomindustrie, des Agrobusiness etc. das Rückgrat der Weltmarktbedeutung der russischen Volkswirtschaft bilden, so ist diese – anders als in allen Schwellenländern (man denke nur an Indien) – vollständig in der Lage, alle wichtigen Bereiche der modernen Ökonomie (Maschinenbau, Chemie, Halbleiter, IT, Mobilität etc.) durch großbetriebliche Strukturen mit entsprechender Outputerhöhung abzudecken. Dies hat sie nach 2022 in Folge der massiven westlichen Sanktionen ziemlich deutlich bewiesen. Keine noch so entwickelte Halbkolonie hätte solche Sanktionen auch nur einige Monate überlebt.
Diese spezielle Bedeutung der Herkunft des russischen Monopolkapitalismus aus einer bürokratischen Planwirtschaft mit riesigen natürlichen und menschlichen Ressourcen verweist auf das letzte Kapitel von Lenins Imperialismus-Broschüre: „Der Platz des Imperialismus in der Geschichte“.[liii] Der Imperialismus ist nicht einfach eine weitere besondere Stufe der kapitalistischen Entwicklung. Er entwickelt die Widersprüche zwischen den Tendenzen zur Vergesellschaftung (jegliche Arbeit wird zum Bestandteil des globalen gesellschaftlichen Produktionsprozesses) und der gewaltigen Konzentration von Privateigentum bei einer kleinen Gruppe der Weltbevölkerung bis zum Extrem, und das spiegelt sich auch in den Konfrontationen von Staaten wider. Den Imperialismus bezeichnet Lenin daher sowohl als Epoche von „Fäulnis, Stagnation und fieberhaftem Wachstum“ in einem als auch als „Übergangsepoche“,[liv] weil die globale Vergesellschaftung der Produktion ein Ausmaß erreicht hat, das eine internationale sozialistische Lösung für die Krisenhaftigkeit der Epoche von „Stagnation und überhitztem Wachstum“ notwendig und realisierbar macht. Hierzu führt er an dieser Stelle einige zeitgenössische Schilderungen der neuen gesellschaftlichen Rolle der Spitzen des Finanzkapitals an, die in ihren Schilderungen praktisch darstellen, wie diese Bankiers und ihre wissenschaftlichen Berater:innen Pläne für Großprojekte und ganze Wirtschaftszweige entwickeln, die ganze Volkswirtschaften auf lange Sicht in ihrer Entwicklung bestimmen. Natürlich haben sich diese Apparate und Bürokratien des Finanzkapitals seit Lenins Zeiten nochmals in ihrer Bedeutung und ökonomisch-politischen Wirkmächtigkeit stark vergrößert. Deshalb werden die wichtigen Investmentbanker:innen der USA gern als „master of the universe“ bezeichnet. Von daher ist es aber auch umgekehrt verständlich, warum in Russland nach der Auflösung der Planbehörden und einer Übergangszeit die teilprivatisierten Banken (in Kooperation mit den privaten Kapitalmarktakteur:innen) rasch die vergesellschaftende Funktion der Planbehörden nutzen konnten, so dass sie sich zwischen den großbetrieblichen (zu kapitalistischen Konzernen umgewandelten) Produktionsagent:innen bewegen konnten. Darum erklärt auch die Herkunft aus der kapitalistischen Restauration einer bürokratischen Planwirtschaft, dass eine so rasche Festigung eines Finanz- und Monopolkapitalismus in Russland möglich war. In Kombination mit seiner Größe (seines großen Arbeitsmarktes, seiner Produktionspotenziale, seiner großen natürlichen Ressourcen), imperialen Geschichte und seiner im globalen Maßstab sehr großen Militärmacht konnte nach einer Stabilisierung des Verhältnisses von Staat und Monopolen mit Russland nur ein Herausforderer des bestehenden Kartells der imperialistischen Mächte entstehen.
12. Russland im Krieg
In der wohl größten Schlacht der Weltgeschichte, dem Kampf um Stalingrad 1942/43, starben in nur 200 Tagen eine Million Menschen – ein Vielfaches der Opfer des bisher dreijährigen Ukrainekrieges (bei dem die schlimmsten Schätzungen von um die 400.000 Toten auf beiden Seiten ausgehen). Allein bei Hügel 102 im Kampf um das Stahlwerk „Roter Oktober“ starben an wenigen Tagen über 30.000 Soldat:innen. Nach dem Krieg wurde auf diesem Mamajew-Hügel eine der größten (85 Meter hoch) Statuen der Welt „Mutter-Heimat ruft!“ (Rodina-mat sowjot!) erbaut, Zentrum einer gigantischen Erinnerungskultur zum „Großen Vaterländischen Krieg“ und seinen Millionen von Opfern für den Widerstand gegen die Okkupant:innen aus dem Westen, und das Schwert der sich verteidigenden Mutter zielt gegen den Westen. Seit Februar 2022 finden regelmäßig auf der Gedenkstätte Zeremonien statt, während der in die Ukraine ziehende Soldat:innen auf das „Nie wieder Faschismus“ schwören und feierliche Eide auf die Verteidigung der Heimat gegen die neuerliche Aggression ablegen. In allen größeren Städten in der Russischen Föderation und auch außerhalb dieser in der ehemaligen Sowjetunion gibt es Ableger dieser großen Gedenkstätte, und überall in der Russischen Föderation spielen sich derzeit ähnliche Szenen ab. In Kiew übrigens wurde erst kürzlich die auch sehr ähnliche Statue in „Mutter-Heimat Ukraine“ umbenannt und die sowjetischen Symbole wurden durch das Wappen der Ukraine ersetzt; Dort soll die Statue jetzt an die ukrainische Tragödie im Zweiten Weltkrieg erinnern (verbunden mit einem offensichtlich sehr beschönigenden Umgang mit den ukrainischen Nazi-Kollaborateur:innen).
Diese Beschwörung des „Großen Vaterländischen Krieges“ hat eine wichtige politische Bedeutung. Sie bildet ein Element eines in den letzten Jahren immer größer werdenden nationalistischen Lagers in der russischen Politik. Dieses hat sich nicht nur auf der Ebene der Ideologie gezeigt: der wachsenden Verherrlichung der Stalin-Ära, des Gefühls der wachsenden Bedrohung durch den Westen (auch z. B. in Form der „westlichen Lebensweise“), der Sehnsucht nach „alter Größe“ etc. Beispielsweise durch Alexander Dugin und eine wahre Legion ähnlicher Intellektueller wird das an Universitäten, in Medien und Thinktanks zum Ausdruck gebracht. Es sind vor allem auch politisch organisierte Kräfte im Umkreis der Macht, die diesen „Überlebenskampf der Heimat Russland“ zu ihrer politischen Mission gemacht haben.
12.1 Politisch-ideologische Vorbereitung
In der Duma gibt es seit einigen Jahren im Wesentlichen nur noch fünf Parteien: die Präsidenten-Partei „Einiges Russland“, die rechtsnationalistischen „Liberaldemokrat:innen“, die national-stalinistische KPRF, die „links“nationalistische Partei „Gerechtes Russland“ und eine Parteigruppierung wechselnden Namens der liberalen Bourgeoisie (früher „Wachstumspartei“, jetzt „Neue Leute“). „Einiges Russland“ hat gewöhnlich über 50 % und die KP an die 20 %, während die übrigen drei Parteien alle etwas über 5 % erhalten. Alle Parteien außer den bürgerlich-liberalen teilen heute die Erzählung von der Bedrohung Russlands durch den Westen und tragen die Politik der Regierung gegenüber der Ukraine mit. Die Bürgerlich-Liberalen lehnen im Wesentlichen nur die konfrontative Art der Politik gegenüber dem Westen und der Ukraine ab (hätten wohl mehr auf Kompromisse gedrängt) und konzentrieren sich (insbesondere nach der Ermordung von Boris Nemzow) in ihrer praktischen Politik auf Wirtschaftsliberalismus und Fragen der Rechtsstaatlichkeit. Trotz seiner relativ geringen parlamentarischen Stärke ist das bürgerlich-liberale Lager (das seinen Ursprung in den Radikalreformer:innen der 1990er Jahre hat, von denen heute z. B. Tschubais immer noch wirtschaftspolitische Funktionen ausübt) in den Bereichen Finanz- und Wirtschaftspolitik in Regierung, Zentralbank und Staatsbetrieben stark vertreten, ebenso in den akademischen Institutionen der Wirtschaft.
Die Partei „Gerechtes Russland“ (oft mit ihrem Vorsitzenden Sergei Mironow identifiziert), die bis zum zweiten Ukrainekrieg Mitglied der „Sozialistischen Internationale“ war, äußerte zwar stärkere Kritik an der Sozialpolitik der Regierung und leistete auch ein gewisses Ausmaß an Unterstützung der Proteste nach 2011. Aber mit dem ersten Ukrainekrieg gab es eine scharfe Wende hin zum Nationalkonservativismus. Aus ihren Reihen wurde der Flügel ausgeschlossen, der die Krim- und Ostukrainepolitik der Regierung öffentlich kritisiert hatte, insbesondere der Abgeordnete Ilja Ponomarjow, der als einziger gegen die Aufnahme der Krim in die RF in der Duma gestimmt hatte. Die „Liberaldemokrat:innen“ Wladimir Schirinowskis waren sowieso immer schon durch extrem-nationalistische, großrussische Positionen definiert. Schließlich vollzog auch „Einiges Russland“ nach 2014 eine eindeutige Wende hin zu einer Politik der „Verteidigt das Mutterland“-Rhetorik.
Dabei hatte „Einiges Russland“ sich schon lange vorher auf eine eigentümliche Form der imperialistischen Ideologie ausgerichtet. Wladislaw Surkow, der langjährige Mastermind hinter Putin, hielt 2006 eine Rede vor Parteikadern, in der er den russischen Sonderweg der „souveränen Demokratie“ darlegte.[lv] Dieser Begriff reagierte auf den Versuch der „demokratischen Revolution“ in der Ukraine 2004, der von den Herrschenden in der RF als eine Art grundlegender Angriff auf die im postsowjetischen Raum etablierte Form von Herrschaft angesehen wurde. Es hätte sich in der Ukraine herausgestellt, so Surkow in seiner Rede, dass „die Europäer:innen“ zwar keine Feinde, aber doch Konkurrent:innen seien. Sie seien zwar militärisch schwach, aber ihre zentralen Staaten ökonomisch stark, so dass sie eine Reihe „unsouveräner“ Länder um sich gruppieren könnten, die sie wirtschaftlich dominieren. Ihre Waffe dafür sei „Demokratie“, „westliche Lebensweise“ und Aufspaltung „starker Nationen“ in möglichst leicht beherrschbare kleine oder schwache Staaten. Russland dagegen sei eine selbstbestimmte Großmacht und einzigartige Zivilisation, die keine Einmischung aus dem Westen und schon gar nicht Belehrungen in Sachen Demokratie zulasse. Man würde sich gegen ähnliche Verschwörungen und Unterwanderungen wie in der Ukraine zu Wehr zu setzen verstehen; man sei eine „souveräne Demokratie“. Die „Sicherung der Souveränität“ werde organisiert durch die Aufrechterhaltung der Kontrolle über das „nationale Kapital“, insbesondere das Finanzsystem und die natürlichen Ressourcen, die Kommunikationsmittel und Medien. In seiner Rede wird auch ein klares Misstrauen gegenüber allen selbstorganisierten und unkontrollierten Aktivitäten aus dem Volk deutlich, dafür sei „das Volk“ noch nicht „reif“. Somit seien solche Aktivitäten leicht vom Westen zu manipulieren. „Demokratie“ ist also bei Surkow, was den herrschenden Eliten und ihrem Staatsapparat im kapitalistischen Russland nutzt, ist „gelenkte Demokratie“. Dementsprechend müsste für die nächsten Jahrzehnte die Partei „Einiges Russland“ beständig die Regierungspartei sein, als Garantin dieser Entwicklung der „souveränen Demokratie“, weil nur eine starke Regierungspartei Russland gegen die Auflösungs- und Unterwanderungsstrategie des Westens schützen könne.
Surkows Neuausrichtung auf Konfrontation mit den „westlichen Demokratien“, die mit dem Konzept „souveräne Demokratie“ impliziert war, wurde Ende der 2000er Jahre nur von einem Teil des herrschenden Blocks geteilt. Als prominentester Widersacher trat Dmitri Medwedew auf, der von 2008 bis 2012 als Staatspräsident kurzzeitig Putin „vertrat“ und danach bis 2020 Ministerpräsident war. Medwedews Ablehnung einer „Demokratie eigener russischer Art“ und sein Programm, Russland weiterhin an Europa heranzuführen, machten ihn damals zu einem Hoffnungsträger der „Westler:innen“ und Liberalen. Liest man dann aber das Wahlprogramm der Partei „Einiges Russland“, deren Vorsitzender er bis heute ist, wird klar, dass zu diesem Zeitpunkt Surkows Konzept der „souveränen Demokratie“ vollständig zum Grundsatzprogramm dieser Partei geworden war. Offensichtlich fand aufgrund der Protestbewegung 2011–2012 (nach den Betrugsvorwürfen nach der Dumawahl 2011) und der sich ab 2013 entwickelnden schweren Wirtschaftskrise (Ölpreisverfall) eine Entscheidung im herrschenden Block zugunsten der Hardliner:innen um Surkow statt, und seitdem gehört auch der offensichtlich flexible Medwedew zu den überzeugten Antiwestler:innen.
Auch wenn Putin 2007 auf der Münchner Sicherheitskonferenz Textblöcke aus Surkows Rede vom heraufziehendem neuen Ost-West-Konflikt als Schockmoment für die anwesenden westlichen Politiker:innen aufgefahren hatte, zeigte seine Unterstützung für Medwedew auch, dass er sich noch beide Optionen offenhielt und wie ein Bonaparte über den Flügeln in der wirtschaftlichen und politischen Elite Russlands thronte. Alle, die heute behaupten, man hätte bei Putin schon in den 1990er Jahren Schriften finden können, die wie bei Hitlers „Mein Kampf“ nachlesbar machen, dass er irgendwann ganz Europa angreifen würde, phantasieren sich Politik als Dämonologie zusammen. Die komplexe Herausbildung einer bürgerlichen Klasse und der Herrschaftsapparate eines dazu passenden Staats mussten sehr widersprüchliche Interessen und damit auch widerstreitende Fraktionen im herrschenden Block hervorbringen. Ein pragmatischer und machtbewusster Politiker wie Putin konnte sich hier nur durchsetzen und an der Macht halten, weil er scheinbar alle diese Interessen und Fraktionen zusammenhalten und repräsentieren konnte. Und seine Reden und Schriften bedienen natürlich alle diese Tendenzen, so dass sich der/die „lupenreine Demokrat:in“ genauso wie der/die imperialistische Großruss:in darin finden lässt. Diese Zerrissenheit spiegelt letztlich die Widersprüche der bürgerlichen Klassenherrschaft in Russland wider: die exportorientierten großen Monopole im extraktiven Sektor, die Notwendigkeit der technologischen Modernisierung durch westliche Importe, die Bestrebungen zum Aufbau eigenständiger russischer Industrien und Agrarbetriebe in Konkurrenz zu den Importen, der Aufbau eines eigenen Finanzsektors ohne Abfluss großer Mengen Kapitals in Steueroasen, der Ausbau der noch aus Sowjetzeiten bestehenden ökonomischen Beziehungen durch die Aktivitäten der großen Monopole im Gas/Öl- und Rüstungsbereich etc. All dies erzeugte sowohl das Bedürfnis nach mehr Handelsbeziehungen und Kapitalaustausch auch mit dem Westen als auch nach größerer Importsubstitution und Absicherung der eigenen Einflusssphäre. Glasjews Wirtschaftsprogramm der „Festung Russland“ von 2015 zeugt davon, dass ab diesem Zeitpunkt wohl die Waage zugunsten der größeren Autarkie und imperialer Großmachtpolitik gekippt war.
Surkow lässt in einem späteren (2018) grundlegenden Artikel[lvi] zur Rolle Russlands in der Welt durchscheinen, dass es 2014 wohl im engeren Kreis der Regierenden noch Zweifel an der Art der Intervention in der Ukraine und an der Zukunft des Verhältnisses zu Europa gegeben habe. Ihm sei mit dem Maidan und dem Krimereignis klar gewesen, dass der „Weg Russlands in den Westen“ jetzt für sehr lange Zeit vorbei sei. Damals aber habe es die russische Führung noch aus Angst vor dem „Aufschrei im Westen“ versäumt, mit ihrer ganzen Militärmacht den Kampf um „Noworossija“ (Neurussland; historische russische Bezeichnung einer Region unmittelbar nördlich des Schwarzen Meeres. Das Gebiet erstreckte sich in etwa über die südliche Hälfte der heutigen Ukraine) anzutreten. Surkow suggeriert, dass er wohl schon damals für den offenen Krieg und den Bruch mit dem Westen gewesen sei, während Putin noch an der Zwitterpolitik festgehalten hatte. Surkow hatte nach 2014 die Hauptverantwortung für die Kontakte zu den „Volksrepubliken“ und gab wohl, etlichen Berichten zufolge, die Linien für die Fortführung der Kämpfe innerhalb des Minsk-II-Regimes vor.
12.2 Die Minsk-II-Etappe
Die Etappe nach 2014 war durch die Mixtur von Ausrichtung auf Importsubstitutionen, das Minsk-II-Abkommen und die Befriedung des Verhältnisses zur EU geprägt. Allerdings wurde die Lage in der Ostukraine ökonomisch und sozial für die dortige Bevölkerung immer prekärer bzw. wechselten sich Eskalationen von beiden Seiten der Kontaktlinie und neue Befriedungsabkommen regelmäßig ab. Nach dem Scheitern der oben geschilderten Pariser Verhandlungen über den Status von Donezk und Luhansk stellte sich für die russische Regierung die Frage nach der weiteren Perspektive. Zunächst einmal wurde Surkow immer mehr zum Sündenbock für die festgefahrene Situation und kam Anfang 2020 seinem Hinauswurf zuvor, indem er als Chefberater des Präsidenten zurücktrat. Die Schwierigkeiten in der Ostukraine fielen zusammen mit einer schlechter werdenden ökonomischen Konjunktur in Russland selbst. Aufgrund der daraus folgenden ökonomischen Probleme für die ärmeren Schichten verlangte Putin angesichts der 2021 stattfindenden Dumawahlen eine grundsätzliche Kehrtwende der Regierung. Daraufhin trat nach Surkow auch die gesamte Regierung Medwedew zurück. Beides ließ nicht nur eine Wende in der Wirtschaftspolitik, sondern auch eine andere Vorgehensweise in Bezug auf die Ukraine erwarten, insbesondere da der neue Premierminister Michail Mischustin zwar nur ein politisch wenig bekannter Wirtschaftstechnokrat war, aber dem neoliberalen Finanzblock zugeordnet wurde. Tatsächlich gelang es der Mischustin-Regierung, auch während der Coronakrise die Ökonomie zu stabilisieren, die Umorientierungen in Richtung Osten einzuleiten und die Stärkung der eigenen Industriesektoren besser zu organisieren als die Medwedew-Regierung. Es stellte sich aber schnell heraus, dass das politische Leichtgewicht Mischustin in der Außenpolitik nichts zu sagen hatte; das war mehr denn je Chefsache Putins. Und Putin repräsentierte schon längst die auch in der Duma und der Öffentlichkeit vorherrschende Mainstreamposition von der unausweichlichen Notwendigkeit der Verteidigung der Souveränität des Mutterlands gegen die Einschnürung durch den Westen – die Liberalen hatten, außer als Wirtschaftstechnokrat:innen, nichts mehr zu sagen. Bei der Dumawahl verlor „Einiges Russland“ 4 % und sank auf 48 %, während KPRF und „Gerechtes Russland“ die Gewinnerinnen der Wahl waren – an der Mehrheit für den harten Ukrainekurs änderte sich nichts.
2021 fiel auf, dass Putin seine Stellungnahmen zum Ukrainekrieg immer zugespitzter und ausführlicher formulierte. Zur Verschärfung dürfte nicht nur die schwierige Lage in der Ostukraine, die offensichtliche Vertiefung der militärischen Zusammenarbeit der Ukraine mit der NATO (z. B. durch gemeinsame Manöver), sondern vor allem eine ganz bestimmte politische Entwicklung beigetragen haben: Seit 2014 hatte es in der (Rest‑)Ukraine noch eine „prorussische“ Partei von Bedeutung gegeben, die OPZH („Oppositionsplattform – Für das Leben“), die bei den letzten Parlamentswahlen vor dem Krieg 2019 immerhin mit 13 % noch die zweitgrößte Partei nach Selenskyjs Sluha narodu („Dienerin des Volkes“) war. Ihre zentrale Führungsfigur war einer der großen ukrainischen Oligarchen, Wiktor Medwedtschuk. Dieser war schon unter Kutschma und Janukowytsch einer der erfolgreichsten Kapitalist:innen der Ukraine, der besonders durch das Russlandgeschäft verdiente und offenbar auch gute Verbindungen zum Umfeld Putins hatte. Auch nach 2014 profitierte er weiterhin sehr gut vom, wie auch immer fortgeführten, Handel über die Fronten hinweg und blieb damit der einzige der großen ukrainischen Oligarch:innen mit „Russlandnähe“. Im Mai 2021 wurde Medwedtschuk wegen Hochverrats und illegaler Bereicherung von der ukrainischen Staatsanwaltschaft (offenbar auf Betreiben der Regierung) angeklagt und inhaftiert. Was immer die Rechtsgrundlage für diese Strafverfolgung ausmachte, sie bereitete die politische Repression gegen die größte Oppositionspartei in der Ukraine vor – die Partei, auf die offenbar in der russischen Führung gebaut hatte, um weiter für Russlands Interessen in der Ukraine eine Rolle zu spielen. Mit diesem Wegfall jeglicher russischer Einflussmöglichkeiten in der Ukraine selbst sah die russische Führung in der ukrainischen Führung wohl nur noch ein Werkzeug des Westens, ein feindliches Regime, mit dem es nichts mehr zu verhandeln gab.
12.3 Die Ukrainerede Putins
Die Sichtweise der russischen Führung wurde von Putin sodann in seinem berühmten Aufsatz „Zur historischen Einheit von Russen und Ukrainern“[lvii] im Juli 2021 öffentlich gemacht. Über diesen vielbesprochenen Essay wurde behauptet, Putin hätte darin eine Art „Geschichtsfälschung“ betrieben, eine Art eigenständiger Konstruktion, mit der er die Aggression gegen die Ukraine rechtfertigen würde. Dazu ist zu bemerken, dass an den geschichtlichen Ausführungen dort wenig originelle, neue Darstellungen zu finden sind. Das meiste davon ist Wiedergabe der russischen Geschichtsschreibung seit dem 19. Jahrhundert (unterbrochen durch die kurze Phase nach der Oktoberrevolution bis zur Durchsetzung des Stalinismus). Dies wird durch Putin jedoch ergänzt durch eine Neubewertung seit der Oktoberrevolution, die eine bemerkenswerte Abgrenzung von Lenins Position zur Ukraine enthält und das Konzept der föderativen Staatsform im postzaristischen Raum einen „historischen Irrtum“ nennt. Daraus werden dann von ihm Schlussfolgerungen gezogen, die nur zu einer radikalen Lösung der „Ukrainefrage“ führen konnten.
Im Essay stellt Putin fest, dass die „ukrainische Nation“ eine abwegige Konstruktion sei, einerseits erdacht durch abgehobene Intellektuelle ukrainischer Sprache im 19. Jahrhundert, andererseits verstärkt durch die Behörden des Galizien (Westukraine) beherrschenden Österreich-Ungarns, das diesen Oppositionellen Schutz gab, um ins Zarenreich hineinzuwirken. Dieser „künstliche“ Nationalismus stehe im Gegensatz zum natürlichen Zusammengehörigkeitsgefühl der Ostslaw:innen (Russ:innen, Belaruss:innen und Ukrainer:innen), das Putin mit vielen historischen Begebenheiten und sprachlich-kulturellen Merkmalen zu belegen versucht. Die Bolschewiki hätten nach der Oktoberrevolution einen schweren Fehler begangen, indem sie diesen künstlichen Nationalismus ernst genommen und im Sinne „abstrakter“ Prinzipien des Selbstbestimmungsrechts das Recht auf eine unabhängige Ukraine (die es so nie als Staat gegeben habe) verteidigt hätten. An der Episode der zeitweise unabhängigen Ukrainischen Volksrepublik (Ukrajinska Narodna Respublika; UNR), geführt vom Linksnationalisten Symon Petljura, versucht Putin, zweierlei zu zeigen: Erstens, dass eine scheinunabhängige Ukraine ein Spielball ausländischer Mächte sein musste (und heute wieder ist) – erst der deutschen und österreichischen Imperialist:innen, dann der polnischen Annexion der Westukraine mit britisch-französischer Unterstützung. Deshalb könne nur die Integration der Ukraine in das „brüderliche“ Russland eine ihrem Wesen gemäße eigenständige Entwicklung ermöglichen (ein Hohn, wenn man die wirkliche Geschichte der Region betrachtet, aber ein Gemeinplatz für den russischen Nationalismus). Zweitens sagt Putin, dass die Bolschewiki die nationale Frage „benutzt“ hätten, um die „große russische Nation“ zu zerlegen und schwächen, um ihre sozialistischen Ziele erreichen zu können (denn, so Putin, sie hätten das böse Ziel gehabt, langfristig alle Nationalstaaten abzuschaffen). Daher hätten sie alle möglichen Teile vom großen russischen Staat abgeschnitten und hätten solche „Kunstprodukte“ wie die Sowjetrepubliken der Ukraine und von Belarus gegründet. Kernsatz: „Die moderne Ukraine ist also ganz und gar ein Produkt der Sowjetära.“ Im Lauf der Entwicklung der Sowjetunion habe man sogar künstlich eine „Ukrainisierung“, auch der stark russisch geprägten Teile der Ukraine, betrieben. Ein besonderes Missfallen äußert Putin über die Politik Lenins gegenüber der kurzlebigen Sowjetrepublik Donez-Kriwoi Rog, die interessanterweise ziemlich genau das Gebiet umfasste, das gegenwärtig von der russischen Armee zu erobern versucht wird. Dieses stark industrialisierte Gebiet war von russischen Arbeiter:innen dominiert, gut von den Bolschewiki organisiert und bewaffnet und stark genug, um die UNR-Verbände zu vertreiben. Diese Sowjetrepublik stellte den Antrag zur Aufnahme in Sowjetrussland. Dessen Führung unter Lenin lehnte dies jedoch ab und verlangte stattdessen den gemeinsamen Kampf mit den Genoss:innen in der Gesamtukraine, um eine Sowjetukraine entstehen zu lassen – laut Putin ein schwerer historischer Fehler, der Russland auf lange Zeit diese wertvollen Gebiete kostete. Wahrscheinlich wäre ohne diese Politik der Bolschewiki die restliche Ukraine wirklich verloren gewesen (auch wenn sie im Russisch-Polnischen Krieg 1920 an Polen verloren wurde). Und vor allem ging es Lenin um ein wesentliches politisches Signal an die Arbeiter:innen und Unterdrückten der Welt, die gegen den Imperialismus kämpften: Sowjetrussland nimmt die Frage der Selbstbestimmung ernst und kämpft für sie, auch wenn das Verzicht auf unmittelbare Gebietsgewinne bedeutet. Ein Gedanke, der Putin offenbar besonders fremd ist.
Putin stellt also klar, dass er die Ukraine für ein (ohne Russland) nicht lebensfähiges Kunstprodukt hält. Er führt weiter aus, dass zwischen der Ukraine und Russland ein Netz gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Beziehungen über Jahrhunderte aufgebaut worden sei, das nun von den Regierenden in der Ukraine willkürlich zerstört würde. Dies habe die Masse der Ukrainer:innen schwer getroffen und die einstigen wirtschaftlichen Zentren dahinsiechen lassen. Faschist:innen würde freier Lauf gelassen und Gesetze gegen nicht ukrainischsprachige Minderheiten erlassen, Nazikollaborateur:innen geehrt etc. Es sei nicht genug, dass man sich mit aller Gewalt von Russland trenne – nein, man baue die Ukraine bewusst als eine Art „Antirussland“ auf. Er schreibt: „Das ‚antirussische‘ Projekt wurde von Millionen von Einwohner:innen der Ukraine abgelehnt. Die Menschen auf der Krim und in Sewastopol haben ihre historische Entscheidung getroffen. Und die Menschen im Südosten der Ukraine haben friedlich versucht, ihre Position zu verteidigen. Aber sie alle, auch die Kinder, wurden als Separatist:innen und Terrorist:innen bezeichnet. Sie drohten mit ethnischer Säuberung und dem Einsatz militärischer Gewalt. Und die Einwohner:innen von Donezk und Luhansk griffen zu den Waffen, um ihre Häuser, ihre Sprache und ihr Leben zu verteidigen.“
Putin behauptet dann weiter, dass die Regierung der Russischen Föderation und die Volksrepubliken in Donezk und Luhansk bereit wären zu einer friedlichen Lösung der „Beendigung des Bruderkrieges“, und dies drücke sich gerade in den Minsker Abkommen aus, mit denen es zu einer Wiederherstellung der Ukraine unter den Bedingungen einer Akzeptanz von russlandfreundlichen politischen Kräften dort hätte kommen können. Aber, so stellt es Putin dar, die Herrschenden in der Ukraine wären zu keinen Kompromissen bereit gewesen. Sie wären zwar von ihren Verbündeten in Paris und Berlin immer wieder zurückgepfiffen worden, hätten sich aber nur zum Schein an Minsk gehalten, in Wirklichkeit jedoch ihr „antirussisches Projekt“ mit größerer Vehemenz fortgeführt. In der ukrainischen Gesellschaft werde ein Klima der Angst vor der russischen Bedrohung geschaffen, um NATO-Berater:innen ins Land zu holen und entsprechende militärische Strukturen aufzubauen. Politische Kräfte gegen das „antirussische Projekt“ würden unterdrückt, verboten und verfolgt. Und das, wie Putin damals wohl wirklich geglaubt hat, obwohl die Mehrheit der ukrainischen Bevölkerung diese Politik der Abwendung von Russland ablehnen würde.
Aus dem Essay geht klar hervor, dass die russische Regierung Mitte 2021 davon ausging, dass mit der damals bestehenden ukrainischen Regierung keine friedliche Lösung im Rahmen der Minskverträge (und der entsprechenden Verhandlungsformate) mehr möglich gewesen sei. Die Angebote zum „Dialog“ im Essay richteten sich nunmehr abstrakt an „die“ Ukrainer:innen. Es gab wohl die Hoffnung, dass der Aufbau militärischer Drohkulissen und Destabilisierung im Inneren dazu führen würden, dass die ukrainische Regierung durch den Druck derjenigen, die einen „Bruderkrieg“ vermeiden wollten, zum Einlenken gebracht werden würde.
Tatsächlich begann der Aufmarsch von an die 100.000 Soldat:innen mitsamt schwerem Kriegsgerät bereits im Frühjahr 2021. Dies wurde durch entsprechende Manöver und Truppenverlegungen der NATO gerechtfertigt. Im Dezember 2021 legte die russische Regierung dann der NATO und den USA einen Vertragsentwurf vor, der im Wesentlichen den Ausschluss des NATO-Beitritts von Ukraine und Georgien enthielt, sowie den Rückzug von NATO-Truppen hinter die NATO-Grenzen von 1997 (Oder-Neiße-Linie) und den Verzicht auf Stationierung von Kurz- und Mittelstreckenraketen, die russisches Territorium erreichen könnten, forderte. In der NATO bestand noch Uneinigkeit darüber, ob es sich um ein Ultimatum handele und wer wie mit Russland verhandeln sollte. Offensichtlich war es schon damals die Absicht der russischen Regierung, nur mit den USA zu verhandeln und in Europa Einflusssphären zwischen den beiden Großmächten festzulegen (die ehemaligen Sowjetrepubliken sollten damit selbstverständlich in der russischen Sicherheitszone liegen). Die damalige US-Regierung unter Biden demonstrierte jedoch Einigkeit mit ihren „europäischen Verbündeten“ und beharrte auf der Souveränität aller Staaten, Bündnissen beizutreten oder nicht. Lediglich über Raketenstationierungen könne man verhandeln. Mit der entsprechenden Ablehnung des „Verhandlungsangebots“ durch die USA am 26. Januar waren die Würfel gefallen. Die russische Regierung nahm wohl noch Rücksicht auf die Olympischen Winterspiele in Peking vom 4. bis 20. Februar 2022, wodurch noch mehrere diplomatische Initiativen möglich wurden. Aber am 21. Februar begann mit dem Anerkennungsprozess der Volksrepubliken Donezk und Luhansk der Ausstieg aus dem Minskabkommen, und der Einmarsch der russischen Armee in diese Gebiete (zum „Schutz vor Völkermord“) folgte. Am 21. Februar abends hielt Putin im Fernsehen seine berühmte Rede, bei der er im Wesentlichen die Positionen seines Essays wiederholte und zusätzlich das Pathos der „Verteidigung des Mutterlands“ auspackte. Am 24. Februar kurz vor 4 Uhr morgens meldete Putin sich noch einmal übers Fernsehen, kündigte militärische „Spezialoperationen“ an und rief das ukrainische Militär zur Niederlegung der Waffen auf, da keine Invasion geplant sei. Ziel seien „lediglich“ die Demilitarisierung der Ukraine und ihre Entnazifizierung. Kurz danach begann der Angriff der russischen Streitkräfte und der militärischen Verbände der Volksrepubliken auf die Ukraine.
12.4 Kriegsverlauf
Der ursprüngliche russische Angriffsplan endete bekanntlich zum großen Teil als Fehlschlag. Allgemein wird von zwei Kriegszielen ausgegangen: Erstens wollte man in Großmachtmanier eine „Enthauptungsaktion“ (oder vornehmer: „regime change“) in Bezug auf die Spitzen der ukrainischen Politik und Armee durchführen; zweitens, entgegen der Behauptung, keine Invasion mit Gebietsabtrennung zu planen, die Ostukraine bis zum Dnepr bzw. Charkiw und Cherson besetzen. Ersteres sollte durch eine Kommandoaktion mit Spezialkräften und der Drohkulisse eines riesigen Aufmarsches Richtung Kiew erzielt werden, zweiteres durch einen Angriff nördlich von Charkiw, aus den Volksrepubliken und von der Krim aus. Zusätzlich war offenbar geplant, über Cherson hinaus Richtung Odessa vorzustoßen und dies mit einem Angriff aus Transnistrien von Westen und einer amphibischen Landung vom Schwarzen Meer her über die Schlangeninsel zu unterstützen. Kaum etwas davon war erfolgreich. Die Kommandoaktion in Kiew scheiterte gleich in den ersten beiden Tagen, und der Truppenvorstoß auf Kiew blieb bald in den ukrainischen Verteidigungslinien um die Stadt herum stecken. Die Front vor den Volksrepubliken wurde nicht durchbrochen und auch Charkiw nicht erobert. Einzig erfolgreich war der Vorstoß in den Norden von Luhansk samt der Verbindung zu den Truppen vor Charkiw. Ebenso gelang der Vorstoß aus der Krim mit der Eroberung der Südostukraine (samt Mariupol) und der von Cherson (Brückenkopf über den Dnepr im Süden). Der weitere Vorstoß Richtung Mykolajiw (Südukraine) scheiterte ebenso wie der Aufmarsch der Schwarzmeerflotte vor Odessa, so dass auch der Zusammenschluss mit Transnistrien und die Eroberung Odessas aufgegeben wurden. Ab Ende April 2022 wurde das russische Kriegsziel auf die Eroberung der Ostukraine reduziert – unter großem Protest der heimischen nationalistischen Gruppierungen.
Gründe für das Scheitern der ursprünglichen Pläne war eine völlig falsche Einschätzung sowohl der ukrainischen Streitkräfte als auch der Stimmung in der ukrainischen Bevölkerung. Was diese „Stimmung“ betraf, existierte in der russischen Führung und der nationalistischen Öffentlichkeit die Irrmeinung, dass sich die Masse der ukrainischen Bevölkerung außerhalb der „Kiewer Blase“ russisch fühle und die russischen Truppen als „Befreierinnen“ von der korrupten und antirussischen Führung empfangen werde. Das Gegenteil war der Fall: Die Masse der ukrainischen Bevölkerung, sogar vielfach auch in der Ostukraine, sah die russischen Truppen als Invasorinnen, die ihnen eine fremde, autoritäre Regierung aufzwingen würden (die Regime in den Volksrepubliken boten dafür auch entsprechende warnende Beispiele). Der russische Angriff wurde eben nicht als „nationale Befreiung“ gesehen, sondern als das, was er war: ein imperialistischer, großrussisch-chauvinistischer Akt der Unterdrückung des eigenen Landes (mit dem man sich durch den Angriff nunmehr umso stärker identifizierte). Jahrhundertelange großrussische Unterdrückung und Bevormundung führten zu einer starken nationalen, antiimperialistischen Abwehrhaltung in der Masse der ukrainischen Bevölkerung, auch der Arbeiter:innen und Bäuer:innen. Gerade in den ersten Wochen der Invasion war die Unterstützung der Verteidigungskräfte aus der lokalen Bevölkerung entscheidend für das Zurückschlagen eines möglichen raschen Vormarsches der russischen mobilen Verbände. Was die ukrainische Armee betrifft, so war sie kaum mehr vergleichbar mit den maroden und schlecht ausgerüsteten Verbänden, die der russischen Armee 2014 kaum Schwierigkeiten bereitet hatten. Die reformierte und reorganisierte Armee (auch durch westliche Militärberater:innen) war 2022 zu einer gut organisierten und schlagkräftigen Truppe geworden. Dazu kam, dass insbesondere seit 2020, als ein russischer Angriff immer wahrscheinlicher wurde, bestimmte Staaten mit bedeutenderen Waffenlieferungen begannen. Dazu zählten neben den USA und Britannien, die vor allem Flugabwehrsysteme und panzerbrechende Waffen lieferten, Polen, Tschechien und die baltischen Staaten, die Waffen und Munition lieferten für Waffensysteme, die mit denen der ukrainischen Armee kompatibel waren. Außerdem wurde insbesondere durch die USA die Ausrüstung für die IT-Logistik und Satellitenunterstützung (Aufklärung, Kommunikation) zur Verfügung gestellt, zusammen mit den später immer zahlreicher gelieferten Drohnen ein entscheidender Vorteil im Kampf gegen große mobile Einheiten. Nach dem 24.2. waren die USA und ihre europäischen Verbündeten offenbar überrascht über die Stärke des ukrainischen Widerstandes und die Schwäche der russischen Armee. So wurden diese Lieferungen massiv vervielfacht und mehr Länder und Waffensysteme kamen hinzu, so dass russische Offensivaktionen immer verlustreicher wurden. Daher zog sich die russische Armee verlustreich aus dem Gebiet um Kiew vollständig zurück und versuchte, die Gebiete in der Ostukraine per Stellungskrieg zu konsolidieren. Allerdings gelang noch eine erfolgreiche Offensive bis Juli, in der die restlichen Teile der Oblast Luhansk (Lyssytschansk, Siwerskodonezk) erobert wurden und vor allem ein Keil Richtung Isjum im Süden der Oblast Charkiw getrieben wurde. Von Isjum und Bachmut aus drohte, dass die restlichen Gebiete der Oblast Donezk (Slowjansk, Kramatorsk) gänzlich erobert würden. Die nach dem Ende der Kiewkämpfe umgruppierte und vom Westen mit Offensivwaffen ausgerüstete ukrainische Armee ging aber im September 2022 zur Gegenoffensive über, eroberte die Gebiete nördlich und östlich von Charkiw und bereitete den russischen Truppen bei Isjum und Lyman eine schwere Niederlage, so dass sie ganz auf Luhansk zurückgeworfen wurden. Als dann im November 2022 die russische Armee sich in der Oblast Cherson von der rechten Seite des Dnepr zurückziehen musste, wurde der stabile Frontverlauf erreicht, der sich seither auch durch große und verlustreiche Offensiven beider Seiten kaum bzw. nur um wenige Kilometer verändert hat. Ähnlich dem Ersten Weltkrieg ist der Bewegungs- in einen Stellungskrieg übergegangen. Jegliche Angriffe größerer mobiler Verbände wurden sofort entdeckt und mit Artillerie, Drohnen und aus der Luft aufgehalten bzw. blieben an den Verteidigungsanlagen hängen. Dies war auch das Schicksal der groß angelegten ukrainischen Offensive 2023 in Richtung Südukraine. Übrig blieben die großen Materialschlachten und Menschenschlächtereien um Bachmut, Awdijiwka und jüngst um Pokrowsk. Alle diese verlustreichen Schlachten mit mehreren zehntausend Toten bewegen die Front nur leicht nach vorn, sind aber zusammen mit dem wieder langsam aufgenommenen Angriff auf Isjum wohl der Versuch, die Eroberung des Donbass abzuschließen. 2024 eröffnete die russische Armee südlich von Belgorod (Russland) wieder eine Front Richtung Charkiw, während die ukrainische Armee einen Keil ins russische Gebiet südlich von Kursk trieb. Beides dient wohl mehr oder weniger als Faustpfand für künftige Verhandlungen.
Diese militärische Ebene muss ergänzt werden durch die globale politische und ökonomische Auseinandersetzung, die diesen nationalen Verteidigungskrieg der Ukraine überlagert. Aus unterschiedlichen Gründen waren die USA und die zentralen Mächte der EU an einer Niederlage des russischen Imperialismus in diesem Konflikt interessiert. Im Rahmen der Neuaufteilung der Welt unter den Großmächten ging es den USA um die Verunmöglichung einer EU-Russland-Achse, der EU dagegen um eine weitere Ausdehnung ihrer Einflusssphäre nach Osten auf Kosten Russlands. Der Ukrainekonflikt lieferte einen günstigen Vorwand für eine gemeinsame heftige Reaktion gegen Russland, unter Vermeidung einer direkten militärischen Konfrontation. Für Letztere war man weder genug gerüstet noch wollte man die Kosten eines möglichen Atomkrieges in Kauf nehmen. Zunächst erwartete die Mehrheit der EU-Regierungen, dass schwere Wirtschaftssanktionen ausreichend sein könnten. Tatsächlich wurde Russland von den westlichen Finanz- und Warenmärkten isoliert, und diesmal kamen auch die Hauptexportgüter Russlands auf die Sanktionsliste (nicht nur Gas und Öl). Daneben dachte man, dass die Lieferung von „Defensivwaffen“ an die Ukraine das entsprechende Mittel sei, um Russland weiter unter Druck zu setzen, ohne eine Ausweitung und eigene direkte Kriegsbeteiligung befürchten zu müssen. Die Schwierigkeiten und Rückschläge der russischen Armee und auch erste ökonomische Probleme 2022 schienen diese Strategie zu bestätigen. Wie schon besprochen, konnte die russische Volkswirtschaft aufgrund ihrer verstärkten Importsubstitution seit 2015, ihrer günstigen Staatsfinanzen sowie der schon lange vor dem Krieg begonnenen Umorientierung auf neue Exportmärkte die Sanktionen nicht nur abfedern. Im Gegenteil: Sie war vorbereitet auf ein großes Ausmaß an Autarkie und den Umbau zur Kriegswirtschaft. Außerdem beteiligte sich ein großer Teil des globalen Südens überhaupt nicht an den Sanktionen, und die westliche Strategie hatte langfristig die Stärke des russischen Imperialismus wesentlich unterschätzt. Stattdessen bekam man selbst Probleme: Insbesondere in den EU-Ländern verstärkten steigende Energiepreise und der Wegfall eines großen Absatzmarktes die Tendenzen zur Stagnation, und die Haushaltsprobleme wuchsen durch immer weiter steigende Ukrainehilfen. Vor allem aber war man im Westen keineswegs vergleichbar mit Russland so gut wie gar nicht auf die Umstellung Richtung Kriegswirtschaft vorbereitet. Dies schlug umso mehr durch, als sich der Charakter des Krieges in den eines Ermattungskrieges veränderte.
Der Stellungskrieg in der Ostukraine ab 2023 war etwas, was man lange nicht mehr kannte: ein konventioneller Krieg, bei dem nicht Spezialtechnologien, sondern vor allem die Masse an Munition und Geschützen entscheidend war. Die westlichen Rüstungsindustrien waren auf kleine, hoch technisierte Truppen ausgerichtet, die in Spezialeinsätzen relativ kurzzeitig mit überschaubaren Mengen an konventionellen Mitteln zum Erfolg kommen. Ein monatelanger Stellungskampf mit großen Massen an Soldat:innen und erheblichem Materialverbrauch konventioneller Art war nicht vorgesehen. Dagegen stellten die Rüstungsgroßbetriebe der Russischen Föderation schnell auf Massenfertigung im Mehrschichtbetrieb um. An Stahl- und Energiezulieferung herrschte und herrscht kein Mangel. Insofern wurde ab 2023 die Jahresproduktion der Standardartilleriemunition auf 1 Million Stück im Jahr gesteigert. Die Verbündeten versprachen der Ukraine in dem Jahr eine halbe Million 155-Millimeter-Geschosse, konnten letztlich aber nur 180.000 liefern. Die ukrainische Artillerie verschießt am Tag 2.000 bis 5.000 Schuss davon, die russische Front etwa fünfmal so viel! Die ukrainische Armee verschoss damit 2023 in fünf Tagen so viel Munition, wie die US-Rüstungsindustrie in einem Monat produzieren konnte. Im Durchschnitt produzierte die russische Munitionsindustrie in den letzten Jahren etwa dreimal so viel wie die Rüstungsindustrien aller NATO-Länder zusammen. Dies liegt auch vielfach daran, dass die Stahlproduktion weitgehend aus den westlichen Ländern ausgelagert worden war, genauso wie viele notwendige Zulieferbereiche (dazu zählt auch die Beschaffung von Nitrozellulose, die man im Westen im Wesentlichen von China bezog, während Russland dafür Quellen in Zentralasien besitzt). Diese Materialvorteile der russischen Seite führten zur Gefahr des Zusammenbruchs der ukrainischen Front; dies wurde insbesondere bei den Schlachten um Bachmut und Awdijiwka deutlich. Aufgrund der Klagen über die „mangelhafte Unterstützung“ durch die Verbündeten musste man erstaunt zur Kenntnis nehmen, dass „der Westen“ gar nicht so stark war wie angenommen. Weder wirtschaftlicher Druck noch die Rüstungsindustrie erwiesen sich als stark genug, den russischen Imperialismus in die Knie zu zwingen. Gerettet hat die ukrainische Front in Bezug auf den Munitionsnachschub letztlich einerseits das enorme Hochfahren der tschechischen Munitionsfabriken (Tschechien war schon in der Habsburger Monarchie, im Zweiten Weltkrieg und im Warschauer Pakt ein Zentrum der europäischen Rüstungsindustrie), die zum Teil auch direkt in der Ukraine produzierten. Andererseits entwickelte sich die deutsche Rheinmetall zu einem Großproduzenten für Munition. Sie steigerte ihre Produktion von bisher 70.000 auf eine halbe Million Granaten im Jahr und übertrifft damit die gesamte US-Rüstungsproduktion in diesem Bereich (offenbar hat der deutsche Imperialismus den Ukrainekrieg bereits für die massive Expansion seiner Rüstungsindustrie genutzt). Im Jahr 2024 hat sich damit das Munitionsproblem der ukrainischen Armee entspannt, auch wenn man weiterhin hinter der Versorgung der russischen Armee zurückliegt. Daher erklärt sich die Notwendigkeit des Einsatzes von Raketen und Drohnen gegen die Versorgungswege hinter der russischen Front. Dafür aber hat die ukrainische Armee ein immer größeres Personalproblem – was angesichts der verschiedenen Bevölkerungszahlen der beiden Länder nicht verwunderlich ist und mit der Dauer des Krieges durchschlagen musste. Trotzdem ist zu erwarten, dass beide Seiten rein militärökonomisch auf diese Weise noch bis ins Jahr 2026 weiterkämpfen können, also der Ermattungskrieg weitergeht.
Natürlich zeitigte der weitaus umfassendere Krieg als ursprünglich gedacht für die Ökonomie der Russischen Föderation gravierende Auswirkungen. Der Rückgang im Handel durch die Sanktionen, insbesondere im Öl- und Gasbereich, aber auch beim Import von Zulieferprodukten, führte 2022 zu einem Einbruch des Wirtschaftswachstums von –1,3 % (bei der Ukraine als unmittelbar vom Krieg betroffenem Land im Vergleich sogar um –36 %). International agierende Konzerne wie Lukoil, die auch auf den Kapitalmärkten größere Verflechtungen aufwiesen, waren von Kapitalabfluss, Beendigungen von Joint Ventures und Einfrieren von Vermögensanteilen betroffen – eine Entwicklung, die allerdings schon lange vor 2022 einsetzte. Vom Management solcher Konzerne kamen auch die im Ausland am lautesten zu hörenden Bedenken aus dem herrschenden Block in Russland in Bezug auf den Ukrainekrieg. Der Vorstand von Lukoil sprach von „tragischen Ereignissen in der Ukraine“ und forderte ein baldiges Ende des Krieges. Der langjährige Vorstandsvorsitzende von Lukoil, Wagit Alekperow, trat im April 2022 „aus gesundheitlichen Gründen“ zurück, mehrere andere Vorstandsmitglieder stürzten aus Versehen aus dem Fenster, starben an unerwartetem Herzversagen oder Alkoholvergiftung. Noch 2022 erholten sich die Öl- und Gasexporte durch das Hochfahren der Alternativrouten und neue Kund:innen, wie oben schon ausführlicher beschrieben. Dies trifft nicht nur auf China, sondern insbesondere auch auf Indien zu, das seitdem in etwa so viel mehr Öl aus Russland importiert wie Europa vor den Sanktionen (Anteil des russischen Öls jetzt 20 %, vorher etwa 15 %). Gleichzeitig nutzten einige der neuen Importeur:innen die Lage Russlands aus, um den Preis zu drücken. Daraufhin verhandelte die russische Regierung über die Fusion der drei Firmen Rosneft, Gazprom Neft und Lukoil zu einem vereinigten russischen Ölmonopol, das auf dem Weltmarkt die Nummer zwei vor der saudischen Aramco wäre und ein Vielfaches größer als etwa ExxonMobil. In Absprache mit den Saudis könnten dann Versuche der USA, mit dem Ölpreis Politik zu machen, unterbunden werden.
Mit der Erholung des Öl- und Gasgeschäfts, der Aufrechterhaltung der Agrarexporte zu höheren Preisen, der Ausdehnung des Handels mit Metallen (auch bei steigenden Preisen), dem stark wachsenden Nukleargeschäft etc. und natürlich der wachsenden Kriegsproduktion schnellten die Wachstumsraten der russischen Wirtschaft 2023 auf über 4 % und blieben auch in den Folgejahren auf dem hohen Niveau von 3,6 %. Die Kehrseite dieses Wachstums, insbesondere durch die Kriegsproduktion, ist, wie immer in solchen Fällen, die Inflation. Diese hatte mehrere Ursachen: Erstens führten die Sanktionen, z. B. durch Einfrieren russischer Devisenreserven, sofort zu einer Abwertung des Rubels und damit zu einer drastischen Erhöhung der Importpreise, was die Konsument:innen sogleich durch einen etwa zwanzigprozentigen Anstieg der Preise bei Obst und Gemüse merkten. Zweitens aber wurde die Nachfrageseite durch die Ausdehnung der Kriegsproduktion und der damit größer werdenden zahlungskräftigen Arbeiter:innenschaft ausgedehnt. Hier ist zu bemerken, dass nicht nur die Einberufung der Wehrpflichtigen und die Teilmobilisierung vom September 2022 (300.000 Soldat:innen), sondern auch die massenhafte Flucht, besonders von besser qualifizierten Arbeitskräften (bis Ende 2022 alleine schätzungsweise 900.000), Wirkung zeigte. Dies hat nämlich den Arbeitsmarkt in Russland verengt. Inzwischen liegt bei einer Arbeitslosenzahl von unter 2 % das Lohnniveau entsprechend um 18 % über Vorkriegsniveau. 2022 waren es hauptsächlich Importpreise und Kosten der Importsubstitution, die die Inflation auf etwa 18 % hochgetrieben haben. Allerdings war dies für den russischen Staat kein großes Problem, da er bei kaum vorhandener Verschuldung auch kein Problem mit steigenden Zinsen oder Schuldrückzahlungen hatte und auch keine Auslandsschulden oder ein Leistungsbilanzdefizit aufwies, was ein Devisenproblem ergeben hätte. Von daher konnten die rigorosen Maßnahmen der Staatsbank die Inflation 2023 auf unter 3 % drücken. Danach wurden die Kosten der Kriegsproduktion und die steigenden Lohnkosten offenbar immer spürbarer, so dass die Inflation Ende 2024 auf 9,5 % stieg (immer noch kein Vergleich zu Inflationsraten in der Türkei oder Argentinien!). Die Zentralbank reagiert darauf derzeit mit Zinsfüßen von 21 %, was insbesondere Konsument:innen und Privatschuldner:innen hart trifft, die Regierung aber weiterhin nicht, denn die hohen Exporteinnahmen führen weiterhin zu einer niedrigen Verschuldung trotz Kriegsausgaben. Das Abkommen mit Nordkorea (Soldat:innen gegen Gas) stellt daher auch eine Entlastung des russischen Arbeitsmarkts dar (natürlich auch die Vermeidung einer nicht populären weiteren Mobilisierung).
Offenbar bereiten „Personalnot“ für Armee und Wirtschaft ein immer größeres Problem. In einigen Wirtschaftsbereichen sind daher die Bedingungen für harte Arbeitskämpfe gegeben. So wurde im November 2024 beim Fahrzeugproduzenten Awtomobilny Sawod „URAL“ (Tscheljabinsk) bei einem Streik, bei dem es um die Einhaltung der Arbeitsgesetze bei der Festlegung von Tarifbedingungen ging kurz vor Streikbeginn der Gewerkschaftsführer Anatolij Bannykh verhaftet. Den um ihre Arbeitsbedingungen Kämpfenden wurde vorgeworfen, die Front durch ausbleibende Lieferungen von Trucks zu gefährden und möglicherweise mit dem ukrainischen Geheimdienst in Verbindung zu stehen. Eine solche Vorgehensweise ist natürlich in vielen autoritären Kriegswirtschaftsregimen verbreitet, kann aber bei akutem Arbeitskräftemangel durchaus durchbrochen werden. Dies erfordert jedoch eine starke und solidarische Organisation in den Betrieben, die es ermöglicht, die Drohungen von Kapital und Staat ins Leere laufen zu lassen. Die Härte, mit der schon gegen einen beschränkten Tarifkampf in einem rüstungsrelevanten Betrieb vorgegangen wird, zeigt, wie groß die Sorge der Herrschenden in Russland ist, dass sich in der gegenwärtigen Situation solche Konflikte ausbreiten könnten. Angesichts der allgemeinen Kriegsmüdigkeit in Russland (wegen der vielen Toten und Verwundeten und der konstant schlechten Versorgungslage) kann daraus auch möglicherweise ein Generalstreik werden, der sich gegen die Kriegspolitik als Ganzes richtet. Gegenüber der zahnlosen und zerstrittenen liberalen Opposition hätte eine russische Linke, die sich auf die wachsende Unzufriedenheit in den Betrieben stützt, somit echte Machtmittel für eine wirksame Opposition gegen Krieg und Ausbeutung.
13. Auf dem Weg zu einem neuen Jalta-Abkommen?
Im Februar 1945 war die Krim schon einmal Schauplatz der Weltgeschichte, als die absehbar im 2. Weltkrieg siegreichen Großmächte USA, Britannien und die Sowjetunion im Kurort Jalta die Welt in Einflusssphären aufteilten. Die Protokolle dieser Krimkonferenz enthalten eine lange Liste von Regionalkonflikten und umstrittenen Staatsgrenzen, die mit einem Federstrich oder in Form von Prozentzahlen auf Servietten während des Essens (z. B. Jugoslawien: 50%–50%) zwischen den drei Großmächten „geregelt“ wurden. Auch wenn die Details später in Verhandlungen und auf der offiziellen Konferenz von Potsdam festgelegt wurden, so ist die aus diesem Prozess entstandene Weltordnung der Nachkriegszeit zu Recht als die „Ordnung von Jalta“ in die Geschichte eingegangen.
Mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion und der Auflösung des Warschauer Pakts entstand eine Übergangsperiode, in der die USA als einzige verbliebene Supermacht eine neue Weltordnung zu bestimmen schienen, mit ihr im Zentrum, in „multilateraler“ Koordination mit Japan, Kanada und den 4 Hauptmächten der EU (G7). Sie erwiesen sich langfristig jedoch weder ökonomisch noch politisch und militärisch in der Lage, diese Rolle des „Welthegemonen“ auf Dauer allein zu spielen. Ökonomisch gesehen entstanden neue Konkurrent:innen in Form der EU, Chinas und Russlands. Im Laufe der Globalisierungsperiode verschob sich das Zentrum der US-Wirtschaft von traditionellen Industrien weg und hin zum Finanzsektor, bestimmten Hochtechnologiebranchen und der eigenen Öl- und Energiewirtschaft. Die neuen Konkurrent:innen begannen in vielen anderen Bereichen, durch ausgedehnte, kostensenkende Zulieferketten und Nutzung von Handels- und Finanzierungsliberalisierungen, die Position der US-Wirtschaft zu untergraben. Mit fallenden Profitraten, Überakkumulation und folgenden Finanzblasen steuerte die US-Ökonomie 2008/2009 auf eine Wirtschaftskrise zu, die in den USA und der EU zur Stagnation führte, aber China zu einem wesentlichen Faktor für die Stabilisierung der Weltwirtschaft machte. Es wurde klar, dass es die USA bald nicht nur ökonomisch herausfordern würde. Spätestens mit der ersten Trump-Administration begannen die USA, viele Aspekte der ökonomischen Globalisierung infrage zu stellen, zu protektionistischen Maßnahmen zu greifen und eine rücksichtslose Wirtschaftspolitik (Verschuldung auf Basis der Kontrolle der internationalen Finanzmärkte) zu eigenen Gunsten zu beginnen – und dies änderte sich um keinen Deut unter der Biden-Administration. Damit leiteten auf ökonomischem Gebiet die USA den Kampf um die Neuaufteilung der Welt ein.
Der Niedergang der Sowjetunion schien die Jalta-Ordnung durch eine neue Grundlage zu ersetzen: Im November 1990 wurde im Rahmen der Sondergipfelkonferenz der KSZE (heute OSZE) von 32 europäischen Staaten sowie den USA und Kanada die Charta von Paris unterzeichnet (damals war die Sowjetunion noch durch Gorbatschow vertreten). Darin erklärte man die „Teilung Europas“ für beendet, und dass das Zusammenleben in Europa in Zukunft durch die wechselseitige Anerkennung der Souveränität der bestehenden Staaten unter Akzeptanz der „Unverletzlichkeit ihrer Grenzen“ geregelt werden solle. Diese abstrakte Erklärung ging natürlich darüber hinweg, dass viele dieser Grenzen wenig mit tatsächlichen „einheitlichen Nationalstaaten“ zu tun hatten, eine lange Geschichte nationaler Unterdrückungen beinhalteten und jede Menge Konfliktstoffe bargen, was in den 1990er Jahren sofort im blutigen Bürgerkrieg in Jugoslawien und in der nicht von der „Charta von Paris“ gedeckten NATO-Intervention zum Ausdruck kam.
Und dies verweist auch gleich auf die zweite Schwäche der Nach-Jalta-Ordnung: Auch wenn nur vier Monate nach der Verabschiedung der Charta der Warschauer Pakt aufgelöst wurde, so galt dies nicht für das andere große Militärbündnis, das in Europa bestand und bis heute besteht – die NATO. Insofern lauerte im Rahmen der „Ordnung von Paris“ nicht nur jede Menge explosiver Regionalkonflikte, sondern existierten auch weiterhin zwei große sich gegenüberstehende Militärmaschinerien (zu Beginn der 1990er Jahre hatte die russische Föderation noch über 2 Millionen Soldat:innen unter Waffen). Folgerichtig wurde die Charta von Paris 1992 durch den sogenannten KSE-Vertrag (Vertrag über Konventionelle Streitkräfte in Europa) präzisiert, der die Militärapparate und ihre Einsetzbarkeit beschränken sollte. Er enthielt Obergrenzen für Truppen, Panzer, Artillerie etc., aber auch Bedingungen für grenzüberschreitende Manöver und „friedensbewahrende“ Interventionen. Interessanterweise hielten sich Russland, Belarus, Kasachstan und die Ukraine sehr viel länger an diesen Vertrag als die NATO-Staaten. Insbesondere die NATO-Osterweiterung ab 1997 setzte ein klares Zeichen, dass es mit der Auflösung beider Blöcke in Europa doch nicht so weit her war. Mit der NATO-Russland-Grundakte aus diesem Jahr wollte man zwar Russland insofern entgegenkommen, als die Erweiterung bestimmter Arten von Stationierungen (z. B. von Luftwaffenstützpunkten, weitreichenden Raketensystemen etc.) und grenznahe Manöver ausgeschlossen wurden bzw. gemeinsame Schlichtungsgremien vereinbart wurden. Doch ab 2000 begann das Wechselspiel, dass bestimmte russische Aktionen, z. B. in Tschetschenien, Republik Moldau, später Georgien, als Begründung dafür herhalten mussten, dass KSE- und Grundakte-Vereinbarungen von der NATO nicht eingehalten wurden und die NATO-Staaten selbst (z. B. in Jugoslawien oder dem Irak) ihrerseits völkerrechtswidrig handelten. Auch wenn jetzt im Zusammenhang mit der Reaktion auf die NATO-Osterweiterung gern vom „russischen Narrativ“ und von der Missachtung des Selbstbestimmungsrechts der osteuropäischen Staaten in Bezug auf den NATO-Beitritt die Rede ist, ist klar, dass es hierbei um die Ausdehnung der Einflusssphäre der großen Westmächte auf Kosten einer anderen Großmacht in der Region ging und auch geht. Was immer die NATO verkörpert – ein Hort der Demokratie, Menschenrechte und gleichberechtigter Partnerschaft war dieses „Bündnis“ nie (man denke nur an die früheren Diktaturen, die auch Mitglied waren, wie Portugal, Spanien, Griechenland, Türkei, und auch heute sind mindestens die Türkei und Ungarn von autokratischen Tendenzen gekennzeichnet). Unter dem „Schutzschirm“ der NATO konnten der US-Imperialismus und die imperialistischen Mächte in Europa gemeinsam ihre neoliberale Ausbeutungsordnung in ganz Europa organisieren: die einen ihre Zulieferketten ausdehnen, die anderen ihre technologischen Monopole festigen. Und auch wenn die EU- und NATO-Erweiterung für die betreffenden Bourgeoisien und Mittelschichten „stabile Verhältnisse“ brachte, so bedeutete sie für die große Masse der Lohnabhängigen und ärmeren Schichten in Osteuropa eine Ausdehnung von sozialer Unsicherheit und verstärkter Ausbeutung. Diese soziale Spaltung legte angesichts der Schwäche der Arbeiter:innenbewegung die Grundlage von mehr oder weniger autoritär-populistischen Erscheinungen, die tatsächlich die dort bestehenden „demokratischen Verhältnisse“ immer mehr untergraben oder destabilisieren (Polen, Slowakei, Ungarn, Bulgarien, Rumänien, Nordmazedonien). In vielen dieser Bewegungen (außer natürlich in Polen und dem Baltikum) spielen auch besondere Beziehungen dieser autoritären Parteien zur Russischen Föderation eine wichtige Rolle.
Entgegen der Selbstbeweihräucherung der NATO als „Bündnis gleichrangiger Partner:innen“ sind die Gewichte dort eindeutig verteilt: Sie verfügt bisher über militärisches Gewicht so gut wie nur, weil die US-Streitkräfte ihr Rückgrat bilden und im Wesentlichen auch die Kommando- und Informationsstrukturen bereitstellen. Für die USA war die NATO nach 1990 ein wichtiges Instrument, um weiterhin eine entscheidende Rolle in der europäischen Politik zu spielen und diese wichtigen Märkte für US-Waren, -Dienstleistungen und -Investments offen zu halten. Heute wird immer deutlicher, dass die NATO bei einem Rückzug der USA aus Europa praktisch nur noch eine Hülle wäre, die ohne enorme Anstrengungen der großen europäischen Mächte militärisch zum Papiertiger mutierte. Das Märchen von der „Überwindung der Teilung Europas“, der selbstbestimmten, freien, demokratischen Entwicklung aller seiner Regionen und Klassen unter kapitalistischen Bedingungen hat mit der ökonomischen, sozialen, politischen und militärischen Realität des Kontinents nichts zu tun. Dieses Märchen geht derzeit an seinen vielen Widersprüchen krachend zu Bruch.
Die besonderen Widersprüche in den Festlegungen der Charta von Paris (bzw. des KSE-Vertrags) – bei gleichzeitigem Fortbestehen und sogar Ausbau der NATO – mussten mit dem Wiederaufstieg Russlands zur Großmacht in den 2000er Jahren zu einem internationalen Großkonflikt heranwachsen. Diverse Verstöße gegen den KSE-Vertrag und die Grundakte (z. B. was Stationierungen oder Manöver betraf) wurden jeweils von der Russischen Föderation zum Vorwand genommen, ihrerseits dagegen zu verstoßen. Bereits auf der Münchener Sicherheitskonferenz 2007 drohte Putin, gänzlich aus dem KSE-Vertrag auszusteigen, und mit dem Ukrainekrieg 2014 bzw. 2022 tat er es dann real, um es 2023 formell zu verkünden. Auch wenn der Chor europäischer Politiker:innen meinte, Putin sei, als er mit der Missachtung der Unverletzlichkeit der Grenzen der Ukraine die Charta von Paris gebrochen habe, zum absoluten Paria der Weltpolitik geworden, so haben diese Politiker:innen nicht verstanden, dass diese Ordnung von Paris schon längst vor Trump am Zusammenbrechen war und die Welt der Großmächte neu sortiert wird. Nur dass diesmal West-/Mitteleuropa dabei in der zweiten Reihe sitzt und auch ein neues Jalta, das eine stabile Weltordnung errichtet, nicht zu erwarten ist.
Mit dem Amtsantritt der Trump-Administration scheint sich in der Beziehung zwischen Europa, Russland und den USA eine „Zeitenwende“ anzudeuten. Viele Elemente davon waren zwar schon länger sichtbar, aber erlangen jetzt offenbar eine neue Qualität. Im Februar 2025 haben die wichtigsten sicherheitspolitischen Akteur:innen der USA einige für ihre „europäischen Verbündeten“ sehr überraschende Schritte vollzogen. Verteidigungsminister Peter Hegseth eröffnete eine NATO-Tagung damit, dass sich die Europäer:innen selbst um ihre militärischen Belange zu kümmern hätten und dafür auch ihre eigenen Haushalte und nicht den der USA heranziehen müssten. Vizepräsident James David Vance erklärte auf der Münchener Sicherheitskonferenz, dass er nicht Russland, sondern die liberalen EU-Eliten als Hauptgefahr für die Demokratie in Europa ansehe. Danach machte das Treffen des US-Außenministers Marco Rubio mit seinem russischen Amtskollegen Sergei Lawrow in Riad klar, dass die USA offenbar zu einem Ausgleich mit Russland, auch in Bezug auf die Ukrainefrage, kommen wollten, ohne dies mit der Ukraine oder den „europäischen Verbündeten“ abzusprechen. Den offen imperialistischen Charakter einer Ukrainevereinbarung machte Trump selbst deutlich durch den Versuch eines „Deals“ mit diesem Land: militärische Unterstützung gegen Überlassung von wichtigen Rohstoffen im Wert von einer halben Billion US-Dollar zur Erschließung durch US-Konzerne. Schließlich war die öffentliche Vorführung Selenskyjs bei dessen Besuch im Oval Office am 28.2.2025 durch Trump und Vance sicherlich eine deutliche Demonstration, dass die USA dabei sind, im Ukrainekonflikt die Seiten zu wechseln – oder zumindest bereit sind, sich auf eine „neutrale Vermittlerposition“ zurückzuziehen. Inzwischen hat sich diese „Vermittlung“ als weit schwieriger herausgestellt, als sich das die Trump-Administration wohl vorstellte. Die russische Seite sieht sich durch den Trump-Move eher im Vorteil und geht auf die US-Vorschläge zu Waffenruhe und Verhandlungsformaten nur millimeterweise ein. Andererseits kann dies sogar zu einem verstärkten Wiedereinstieg der USA in die Ukraineunterstützung führen, um die russische Seite unter Druck zu setzen.
Am klarsten hat wohl US-Außenminister Rubio selbst die Wende der USA in Bezug auf Russland schon bei seinem Amtsantritt dargelegt. In einem Interview am 30.1.25 erklärte er, dass die USA am Ende des Kalten Krieges in die „unnatürliche“ Rolle geraten seien, die einzige globale Macht darzustellen, und ihnen damit die Bürde einer Art globaler Regierung aufgehalst wurde. Damit hätte man sich um viel zu viele Dinge gleichzeitig und mit hohen Kosten kümmern müssen. Diese Zeit der anomalen „unipolaren“ US-Verantwortung sei jetzt vorbei, und man bewege sich wieder in einer multipolaren Welt, wo es mehrere Großmächte in verschiedenen Teilen der Welt gebe: „Wir sehen uns derzeit mit dieser Situation in China und in gewissem Maße auch in Russland konfrontiert … “ (Eigene Übersetzung; Red.).[lviii] D.h., die US-Administration geht davon aus, dass man insbesondere mit China und Russland zu Übereinkünften kommen muss, um zu einer neuen globalen Friedensordnung zu kommen – Europa spielt dabei offenbar keine Rolle mehr als „Großmacht“.
Bekannte US-Journalist:innen sprechen in diesem Zusammenhang von einem „neuen Jalta“. So z. B. Andreas Kluth von Bloomberg: „Die Welt scheint zu einem „neuen Jalta“ zwischen Trump, Putin und Xi verdammt zu sein – also zu einem neuen Pakt für die Nachkriegsweltordnung.“ (Eigene Übersetzung; Red.)[lix] Andere, dem Trump-Lager nahestehende Kommentator:innen gehen sogar von einem Jalta-ähnlichen Gipfeltreffen in nächster Zeit zwischen den drei neuen Großmächten aus. Dort würden Regelungen zu treffen sein zu: 1. einem Ukrainedeal, 2. einem Ende der Russlandsanktionen, 3. einer Taiwanregelung, 4. einem Neustart der Vereinbarungen zur nuklearen Abrüstung.[lx] Auch weitere Verhandlungen zum Iran („Atomdeal“) und zum Nahen Osten (Gaza) werden in diesem Zusammenhang genannt.
Aber diese Vorstellung von einem neuen Jalta-Abkommen ist weit von der Realität der gegenwärtigen Kräfteverhältnisse und Krisendynamiken entfernt. Das Jalta-Abkommen 1945 kam zustande am Ende eines Entscheidungskampfes um die Neuaufteilung der Welt, in einem Moment, als die Sieger:innen feststanden. Es leitete auch, nach einer Periode von Klassenauseinandersetzungen bis Ende der 1940er Jahre, eine Art globalen Klassenkompromisses ein: das „sozialpartnerschaftlich“ abgefederte fordistische Akkumulationsregime in den westlichen imperialistischen Ländern und eine neue Expansionsbewegung der bürokratischen Planwirtschaft im „Ostblock“ – natürlich auf der Basis einer massiven Bereinigungskrise durch Vernichtung von Kapital und der strategischen Niederlage der globalen Arbeiter:innenklasse, ausgedrückt in extrem verbesserten Ausbeutungsbedingungen. Dies, zusammen mit der Transformation der alten europäischen Kolonialreiche in neokoloniale Ausbeutungsobjekte, ermöglichte den langanhaltenden Nachkriegsboom, umrahmt von der eingefrorenen militärischen Blockkonfrontation im Kalten Krieg. Von einem solchen historischen Entscheidungspunkt sind wir weit entfernt. Der Kampf um die Neuaufteilung der Welt hat gerade erst richtig begonnen, und die „Sieger:innen“ haben sich überhaupt noch nicht herauskristallisiert.
Was gegen ein neues Jalta spricht, sind folgende Punkte: 1. Die Krise der US-Hegemonie, sowohl ökonomisch als auch politisch, ist noch längst nicht vorbei. 2. Die EU ist zwar derzeit militärisch gesehen sicherlich der schwächste Block und auch ökonomisch angeschlagen, besitzt aber genug Potenzial, um weiter am globalen Machtkampf teilzunehmen. 3. Auch China hat derzeit wesentliche Probleme mit der Fortsetzung seines bisherigen Wachstumsmodells, ist aber, wie die jüngsten Handelskonflikte mit den USA zeigen, in der Lage, einer aggressiveren US-Wirtschaftspolitik wirksam entgegenzutreten. 4. Der „Rest der Welt“ (Halbkolonien, Schwellenländer) ist komplexer geworden und hat insbesondere wichtige andere Player hervorgebracht, die in eine „neue Ordnung“ eingebaut werden müssen (z. B. Indien, Brasilien, Türkei). 5. Die weltweiten sozialen, ökologischen und anderen (u. a. durch nationale oder geschlechtsbezogene Unterdrückung bedingte) Krisen lassen sich nur zeitweise durch die derzeitigen autoritären oder populistischen Scheinlösungen „befrieden“ und bilden somit für jede „Friedensordnung“ einen Quell beständiger Unterhöhlung. Insofern wäre eine solche Trump-Putin-Xi-Weltordnung keine friedliche, sondern eine instabile Unterdrückung nicht beherrschbarer Widersprüche, die notwendig in neue Kriege münden würde.
Insbesondere muss bemerkt werden, dass die Vorstellung der Trump-Administration illusorisch ist, durch ihre gegenwärtige disruptive Politik in Bezug auf interne Regulierungen, den Welthandel (Zölle etc.) und die Auflösung internationaler Organisationen in den USA einen neuen Wirtschaftsboom auszulösen (z. B. was die Reindustrialisierung betrifft), wenn diese Politik zu einer extremen Verschärfung der Konkurrenz auf dem Weltmarkt führt. Der Hang zum Protektionismus wird weltweit zu Gegenreaktionen führen, die den Welthandel und die weltweiten Lieferketten hart treffen, womit sich insgesamt die globalen ökonomischen Krisentendenzen verschärfen werden. Das Agieren von Administration und Tech-Oligarch:innen scheint insgesamt auf Einschüchterung und Spaltung der Nicht-mehr-Partner:innen in Europa zu zielen. Wenn Trump davon spricht, dass die EU gegründet worden sei, um die USA zu „bescheißen“, so drückt sich hier mindestens die Einschätzung aus, dass der EU-Imperialismus ohne US-Gelder und -Militär sofort auf subalternes Niveau absinken würde. Dies mag auch zur Vorstellung beitragen, dass die USA und Russland Europa in Zukunft sicherheitspolitisch unter sich aufteilen könnten und nach Auflösung der EU wirtschaftlich jede von deren Volkswirtschaften für sich Abkommen mit den Großen (USA und Russland) zu deren Vorteil schließen müsste.
Offenbar liegt hier ein verkürzter Begriff von „Großmacht“ vor. Die EU verfügt weiterhin über eines der größten Monopol- und Finanzkapitale der Welt. Die Wirtschaftsleistung Europas liegt mit 18 Billionen US-Dollar pro Jahr nur knapp hinter den USA (21 Billionen) und noch vor China (17 Billionen) – und fällt um ein Vielfaches größer als Russlands aus (1,7 Billionen; alle Zahlen von 2019). Auch wenn es ein großes Finanz- und Monopolkapital in Russland gibt, ist es natürlich nicht vergleichbar mit dem europäischen. Unter den größten 100 Konzernen der Welt gibt es mehr als 20 europäische, aber nur einen russischen, während sich die anderen ziemlich gleichmäßig zwischen v. a. den USA (hauptsächlich Finanzen, Technologie und Öl) und China aufteilen. Insbesondere im Nicht-Tech-Bereich und Nicht-Öl/-Gas-Bereich, also bei Industriekonzernen, dominieren chinesische, europäische und japanische Konzerne. Natürlich verfügt die EU auch über eine große und leistungsstarke Rüstungsindustrie, wie auch die oben genannte Expansion der Munitionsproduktion für die Ukraine beweist. Mit 457 Milliarden US-Dollar Rüstungsetat wurde 2024 um einiges mehr ausgegeben als in Russland (146 Milliarden, auch wenn das kaufkraftbereinigt auf etwa denselben Wert wie bei der EU kommt). Derzeit werden im EU-Durchschnitt noch etwas weniger als 2 % des BIP fürs Militär ausgegeben, in Russland sind es über 6 %. Auch wenn die EU derzeit Russland in militärischer Hinsicht sicherlich nicht ebenbürtig ist (ohne US-Unterstützung), so könnte sie das vom Wirtschaftspotenzial her offenbar problemlos wettmachen. Die Schwäche der EU, auf die jetzt sowohl die US-Administration als auch die russische Regierung bauen, ist sicherlich Ausdruck der politischen Zersplitterung und der neuen rechtspopulistischen Bewegungen mit Auflösungspotenzial für die EU. Doch sind gerade angeschlagene Großmächte in der Geschichte oft Ausgangspunkt überraschender Wendungen und politischer und militärischer Erschütterungen gewesen.
Insgesamt kann man das Fazit des bisherigen Verlaufs des Ukrainekriegs für den russischen Imperialismus als durchwachsen bezeichnen. Der Bruch mit Kerneuropa scheint unumkehrbar. Und selbst bei einem Ende des umfassenden Sanktionsregimes werden wohl die wirtschaftlichen Beziehungen und die spezielle Energie-/Industriepartnerschaft mit Deutschland nur marginal das Vorkriegsniveau erreichen. Alle Hoffnungen der russischen Führung auf massenhaften Zuspruch der Bevölkerung der Ukraine zur „Vereinigung mit Russland“ – und selbst großer Teile der Bevölkerung in der Republik Moldau oder Georgien – werden wohl Illusionen bleiben. Selbst in großen Teilen Zentralasiens ist Russlands Popularität stark gesunken, und die dortigen Regime haben begonnen, ihre wirtschaftlichen und politischen Beziehungen mit ihm zu reduzieren. Die Popularität der Russischen Föderation unter den russischsprachigen Minderheiten im Baltikum hat stark abgenommen und eine Perspektive von deren Wiedereingliederung ist mit dem Beitritt Finnlands und Schwedens zur NATO sehr viel unwahrscheinlicher geworden. In Armenien/Aserbaidschan und Syrien hat man schwere Rückschläge erlitten. Die Beziehung zu China wurde zwar ausgeweitet, aber aufgrund der Sekundärsanktionen bei den Geschäften mit den USA insgesamt vonseiten Chinas nur zögerlich.
Die russische Ökonomie hat sich im Krieg und gegenüber den Sanktionen als äußerst robust erwiesen, sowohl was Importsubstitution als auch das Hochfahren der Kriegswirtschaft betrifft. Wie oben dargestellt, kann Russland trotz der wachsenden ökonomischen Schwierigkeiten den Krieg sicher noch mindestens ein Jahr durchhalten. Wesentlich dabei ist natürlich, dass die verschiedenen Exportbranchen (Öl, Gas, Metalle, Nuklearwirtschaft) so boomen wie bisher, ohne von weiteren Sanktionen oder Kriegsfolgen betroffen zu sein. Doch stellt der militärische Verlauf des Krieges einen herben Rückschlag für die Großmachtansprüche der Russischen Föderation dar. Die „ruhmreiche“ russische Armee, mit einer Friedensstärke von 1,5 Millionen Soldat:innen, mit Tausenden Panzern und Militärflugzeugen, angeblich modernsten Raketensystemen etc., war in drei Jahren Krieg nicht in der Lage, den militärischen Zwerg Ukraine (250.000 Soldat:innen Friedensstärke) niederzuringen. Mitte 2022 stand man sogar am Rande einer demütigenden Niederlage und verlor vor Kiew Tausende Panzer, so dass die Welt den Eindruck bekam, die russische Armee wäre ein einziger demotivierter Schrotthaufen. Durch Eingrenzung der Kriegsziele auf die Ost- und Südukraine konnte man die militärische Lage wieder halbwegs stabilisieren und ist seit den Ermattungskämpfen 2023/2024 jetzt wieder in der Lage, langsam vorzurücken. Viele der moderneren Waffensysteme (Panzer, Kampfflugzeuge, Raketensysteme) erwiesen sich als noch nicht einsatztauglich, so wie sich auch die Seestreitkräfte durch westliche Raketensysteme stark verwundbar zeigten – alles ein Desaster für die russische Rüstungsindustrie und ihre Exporte.
Ein großer Erfolg des russischen Imperialismus in diesem „Krieg der Systeme“ bestand sicherlich darin, so lange durchgehalten und die relative Isolation überwunden zu haben. Mit der Trump-Wende ist die russische Regierung jetzt wieder auf die Bühne der Weltpolitik zurückgekehrt (wie auch das Abstimmungsverhalten der USA im UNO-Sicherheitsrat zeigt). Die Aufhebung der Wirtschaftssanktionen, insbesondere durch die USA, wird in absehbarer Zeit für wirtschaftliche Entspannung sorgen und besonders den Handel mit und Investitionen von China erleichtern. Doch die Hoffnungen auf ein rasches Ende des Ukrainekrieges, die sich wohl vor allem die US-Administration vor dem Treffen in Riad gemacht hat, waren verfrüht. Russische Bedingungen für ein Friedensabkommen sind Gebietserweiterungen über die bisher eroberten Gebiete hinaus (Donbass, Charkiw, Cherson), Wiederöffnung der Gaspipelines (insbesondere nach Moldawien), Rückzug aller NATO-eigenen Truppen hinter die Grenzen von 1997, Ausschluss des NATO-Beitritts der Ukraine, keine dortigen „Sicherheitstruppen“ aus NATO-Staaten – und offenbar auch die Ersetzung von Selenskyj durch einen „legitimen“ Präsidenten. Da die meisten dieser Bedingungen erwartungsgemäß von der ukrainischen Regierung und ihren europäischen Verbündeten grundlegend abgelehnt werden, bleibt unklar, was die USA überhaupt als Plan für eine „Friedensordnung“ im Schilde führen. Entweder müssten sie ihre ehemaligen Verbündeten mit starken Druckmitteln (die sie durchaus haben) dazu pressen, einige dieser Bedingungen zu schlucken. Oder sie müssten umgekehrt durch stärkere Beteiligung wieder auf Seiten der Ukraine eingreifen, um die russische Seite zur Aufgabe einiger ihrer Forderungen zu bringen. Schon der Versuch, vor Beginn von Friedensverhandlungen zu einer Waffenruhe zu kommen, ist zumindest vorläufig krachend gescheitert. Die im März vereinbarte Waffenpause in Bezug auf Energieinfrastruktur war wohl eher eine Propaganda-Ente. Ein Frieden in der Ukraine ist jedenfalls nicht in Sicht – und im Gegenteil deutet viel darauf hin, dass sich der Konflikt auf weitere Konfliktherde zwischen den europäischen NATO-Staaten und Russland/Belarus ausweiten könnte. Inzwischen ist sogar fraglich, ob etwa bei einer Auseinandersetzung um die baltischen Staaten die USA überhaupt einen NATO-Bündnisfall annähmen – um auch hier nur einen Deal zum Ausgleich mit Russland anzustreben (Trump zur Frage der Unterstützung der baltischen Staaten lapidar: „Sie haben eine starke Nachbarschaft“; eigene Übersetzung; Red.).
Russland konnte sich also in der Auseinandersetzung mit „dem Westen“ behaupten. Sein Monopol- und Finanzkapital konnte sich geschwächt halten, wenn auch ohne groß zu expandieren. Die Wende „nach Osten“ war nur teilweise erfolgreich. Mit dem gesteigerten Geschäft mit China und den USA in nächster Zeit könnte sich das ändern. In Bezug auf die USA ist für Russland natürlich ungewiss, wie lange diese neue „Freundschaft“ halten wird, denn diese könnte sich schon mit den nächsten US-Zwischenwahlen deutlich abschwächen. Daher wird für Russland die Ausweitung der Beziehungen zu China sicherlich im Vordergrund stehen. Inwiefern allerdings der russische Imperialismus diese „Umarmung“ durch die sehr viel stärkeren chinesischen und amerikanischen Kapitale ohne größere Abhängigkeiten von mindestens einem der beiden überstehen wird, ist noch ungewiss. Außerdem wird die Konfrontation mit dem Rest Europas sicherlich weitergehen. Dabei sind auch neue Kriege, z. B. um die Landbrücke nach Transnistrien/Republik Moldau und Georgien, nicht ausgeschlossen. Auch die sehr großen russischsprachigen Minderheiten im Baltikum und der militärisch verlockende Vorstoß durch die „Suwałki-Lücke“ (dünnbesiedeltes Gebiet zwischen Litauen, Polen, Belarus und Kaliningrad) lägen in der Logik der russischen Großmachtpolitik. Der allumfassende Angriff Russlands gegen den Westen (insbesondere gegen Polen und Finnland), mit dem jetzt die europäische Politik riesige Aufrüstungsprogramme rechtfertigt, wäre von russischer Seite her allerdings weder klug noch entspricht er der „Verteidigungsideologie“, mit der der Krieg gegenüber der Ukraine als unumgänglich betrachtet wurde. Zumindest wird die russische Führung nach einem offenbar noch nicht so baldigen Ende des Ukrainekriegs einige Jahre der wirtschaftlichen Konsolidierung und des Ausbaus des China- und USA-Geschäfts brauchen, um sich wieder einen neuen Krieg leisten zu können. Man muss allerdings die oben zitierten Erörterungen von Putins Vordenker Surkow durchaus ernst nehmen: Wenn die russische Führung davon ausgeht, dass der Bruch mit den westeuropäischen Eliten für Jahrzehnte essenziell nicht zu kitten ist und man sich praktisch in einem Überlebenskampf ihnen gegenüber befindet, so wird man auch vor einem Großkonflikt, den ein Angriff auf die baltischen Staaten bedeuten würde, nicht zurückschrecken. Auch wenn hier „nur“ die europäischen Teile der NATO eingriffen (z. B. die von der Bundeswehr geführte Panzerbrigade in Litauen), wären wir dann mit einem zumindest europäischen imperialistischen Krieg konfrontiert.
Offensichtlich wird die Auseinandersetzung der Großmächte um die Neuaufteilung der Welt immer gefährlicher und droht neben der ökologischen und ökonomischen Katastrophe auch noch mit einer unvorstellbaren Ausweitung kriegerischer Auseinandersetzungen. Wenn dies auch gerne durch „wahnsinnige“, autokratische, „rückwärtsgewandte“ und „populistische“ Führungspersönlichkeiten wie Putin und Trump erklärt wird, so sind diese Erscheinungen nur die Personifizierung der viel tieferliegenden grundlegenden Krise des kapitalistischen Systems. Dieses von einer systematischen Verwertungskrise betroffene, angesichts der Entwicklung der Produktivkräfte längst überholte System ist nicht mehr in der Lage, die wachsenden globalen Probleme auf vernünftige und demokratische Weise zu lösen. Die Klassenherrschaft der Bourgeoisie in ihrer gegenwärtigen Entwicklungsstufe wird auf präzise Weise durch solche Gestalten wie Trump und Putin personifiziert. Es wird höchste Zeit, dass die einzige globale Kraft wieder auf die Weltbühne zurückkehrt, die diese Katastrophe noch aufhalten kann: das revolutionäre Proletariat. Wiederum ist es das russische Proletariat, dem eine entscheidende Rolle für das Durchbrechen des heute vorherrschenden Wahnsinns von Krieg, Aufrüstung und nationalistischem Amoklauf zukommt. Genauso wird es im Westen immer wichtiger, dass das Proletariat der Aufrüstung und der allgemeinen Mobilisierung, die angeblich der Verteidigung gegen das autoritäre und irrational-aggressive Russland dient, entgegentritt, um den Weltkrieg zur Aufteilung der Ausbeutungsgebiete unter die internationalen Kapitalist:innengangs noch zu verhindern!
Endnoten
[i] Vladimir Esipov, Die russische Tragödie, München, Heyne, 2024
[ii] Boris Kagarlizki, Empire of the Periphery, London, Pluto Press, 2007
[iii] Felix Jaitner, Russland: Ende einer Weltmacht, Hamburg, VSA, 2023
[iv] Ruslan Dzarasov [englische Schreibweise; Red.], The Conundrum of Russian Capitalism, London, Pluto Press, 2014
[v] Ebda., S. 54
[vi] Tony Cliff, State Capitalism in Russia, Postscript from Chris Harman: From Stalin to Gorbatchev, London, Bookmarks, 1988
[vii] Ebda., S. 67 f.
[viii] Leo Trotzki, Verratene Revolution – Was ist die UdSSR und wohin treibt sie?, (1936), Trotzki Schriften, Band 1.2, Hamburg, Rasch und Röhring, 1988, S. 810
[ix] Ebda., S. 788
[x] Ebda., S. 978
[xi] Ebda., S. 954 f.
[xii] Dzarasov, a. a. O., S. 57
[xiii] Siehe Felix Jaitner, Einführung des Kapitalismus in Russland, Hamburg, VSA, 2014, S. 32 ff.
[xiv] Pjotr Awen, in: ebda., S. 36 f.
[xv] Ebda., S. 36
[xvi] Dzarasov, a. a. O., S. 63
[xvii] Jaitner, Einführung …, a. a. O., S. 43
[xviii] Jegor Gaidar, Untergang eines Imperiums, Wiesbaden, Springer, 2016; Original: Moskau, 2006
[xix] The Degenerated Revolution – The Rise and Fall of the Stalinist States. Second Edition. Edited by P. Main. London, Prinkipo, 2012
[xx] Friedrich August Hayek, Collectivist Economic Planning, London, Routledge, 1935
[xxi] Oskar Lange, The Computer and the Market, in: C.H. Feinstein (Hrsg.): Socialism, capitalism and economic growth. Essays presented to Maurice Dobb, Cambridge, 1967, S. 158-161
[xxii] Numerik ist ein Teilgebiet der Mathematik, das Algorithmen zur annäherungsweisen, nicht exakten Lösung von mathematischen Problemen, wie z. B. Gleichungssystemen, erforscht, wobei die Größenordnung des Fehlers in Abhängigkeit vom Rechenaufwand (Anzahl der Approximationsschritte) exakt bestimmt ist.
[xxiii] Zitiert aus Jelzins Autobiografie nach Jaitner, Einführung …, a. a. O., S. 62
[xxiv] Ebda., S.79
[xxv] Zitiert nach: Klaus Joachim Herrmann, Chasbulatows Einsichten, in: Das Blättchen, 18.1.2023
[xxvi] Alle Zahlen nach Dzarasov, a. a. O., S. 72
[xxvii] DGB-Bildungswerk, Gewerkschaften in Russland, Düsseldorf, 2008, S. 14
[xxviii] https://www.labournet.de/interventionen/solidaritaet/gewerkschaft-der-russischen-autoarbeiter-von-petersburger-gericht-verboten/
[xxix] https://www.boeckler.de/fpdf/HBS-006050/p_edition_hbs_298.pdf, Appendix 2
[xxx] Ebda., S. 42
[xxxi] Jewgenij Gontmacher, Reformvorschläge für das System der sozialen Sicherheit, in: Russland unter Putin, Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg, 2001, Heft 2/3, S. 151
[xxxii] Siehe: Jaitner, Einführung …, a. a. O., S. 70 ff.; Dzarasov, a. a. O., S. 83 ff.
[xxxiii] Karl Marx, Das Kapital – Erster Band, MEW Band 23, Berlin/DDR, Dietz, 1971, S. 742
[xxxiv] Alle Daten in diesem Absatz aus: Jaitner, Einführung …, a. a. O., S. 64
[xxxv] Zitiert nach Jaitner, ebda., S. 99
[xxxvi] Jaitner, ebda., S. 102
[xxxvii] Ebda., S. 103
[xxxviii] Ruslan Dzarasov, The Conundrum of Russian Capitalism, a. a. O., S. 134 f.
[xxxix] Michael Pröbsting, Russia’s Monopolies: An international comparison, www.thecommunists.net, April 2022
[xl] Michael Pröbsting, The Peculiar Features of Russian Capitalism, www.thecommunists.net, August 2021
[xli] Simon Pirani, What Makes Russian Capitalism: A Response to Ruslan Dzarasov, Debate: Journal of Central and Eastern Europe, 19:1-2, 499-506, April–August 2011; https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0965156X.2011.632555 (14. November 2011)
[xlii] Sergey Glazyev (englische Schreibweise; Red.), Report: About urgent measures to counter threads to the existence of Russia. Englische Übersetzung und Kurzfassung von Glazews Präsentation vor dem Sicherheitsrat aus „Business-online“ vom 15.9.2015: www.business-gazeta.ru/article/140998
[xliii] Eigene Berechnung aus den Daten des IWF zur Kapitalbilanzrechnung: https://data.imf.org/en/datasets/IMF.STA:BOP_AGG
[xliv] The White House, National Security Strategy 2015, Februar 2015, S. 4: https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/docs/2015_national_security_strategy_2.pdf
[xlv] W. I. Lenin, Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus, LW Band 22, Berlin/DDR, Dietz Verlag, 1972), S. 258
[xlvi] Ebda., S. 270 f.
[xlvii] Zitiert nach Michael Pröbsting, Anti-Imperialism in the Age of Great Power Rivalry, S. 121; PDF online: https://s92d78bb733e1903e.jimcontent.com/download/version/1681225325/module/13699788427/name/BOOK%20Defeatism%20in%20Imperialist%20States_WEB.pdf
[xlviii] Lenin, Der Imperialismus als höchstes …, a. a. O., S. 258
[xlix] Patrick Bond, BRICS+ und die Widersprüche des neuen Multipolarismus, Zeitschrift Luxemburg – Gesellschaftsanalyse und Linke Praxis, Januar 2024; online: https://zeitschrift-luxemburg.de/artikel/brics-und-die-widersprueche-des-neuen-multipolarismus/
[l] John Bellamy Foster, The Denial of Imperialism on the Left, Monthly Review, November 3, 2024; online: https://monthlyreview.org/2024/11/01/the-new-denial-of-imperialism-on-the-left/
[li] Markus Lehner, Imperialismustheorie und Neokolonialismus, Kapitel „Werttransfer und ,ungleicher Tausch’“ und „Kritik des ‚ungleichen Tausches‘“, in: Revolutionärer Marxismus Nr. 53, Berlin, global red, November 2020, S. 178–188
[lii] John Bellamy Foster, a. a. O.
[liii] Lenin, Der Imperialismus als höchstes …, a. a. O., S. 304 ff.
[liv] Lenin spricht er davon, dass der Imperialismus als „Übergangskapitalismus oder, richtiger, als sterbender Kapitalismus“ charakterisiert werden muss, ebda., S. 307
[lv] Siehe: Margareta Mommsen, Surkows ‚Souveräne Demokratie‘ – Formel für einen russischen Sonderweg?, Russland-Analysen, Ausgabe 114, 20.10.2006, S. 2–5; online: https://laender-analysen.de/russland-analysen/114/surkows-souveraene-demokratie-formel-fuer-einen-russischen-sonderweg/
[lvi] Wladislaw Surkow, 100 Jahre geopolitische Einsamkeit, 9.4.2018, Russia in global Affairs, https://www.dekoder.org/de/article/geopolitik-surkow-russland-europa
[lvii] Wladimir Putin, Über die historische Einheit von Russen und Ukrainer:innen, http://kremlin.ru/events/president/news/page/145, 12. Juli 2021
[lviii] Secretary Marco Rubio with Megyn Kelly of The Megyn Kelly Show, Interview, Washington, DC, January 30, 2025, https://www.state.gov/secretary-marco-rubio-with-megyn-kelly-of-the-megyn-kelly-show/
[lix] Andreas Kluth: Trump Is Like Putin and Xi: an Imperialist, Bloomberg, 29 January 2025, https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2025-01-29/trump-is-an-imperialist-like-putin-and-xi
[lx] David Goldman and Uwe Parpart: Donald Trump’s multipolar diplomacy, 20 February 2025, https://asiatimes.com/2025/02/donald-trumps-multipolar-diplomacy/; zitiert nach: Michael Pröbsting, Trump-Putin Rapprochement Signals End of “Trans-Atlantic Partnership”, 21.2.25; online: https://www.thecommunists.net/worldwide/global/trump-putin-rapprochement-signals-end-of-trans-atlantic-partnership/