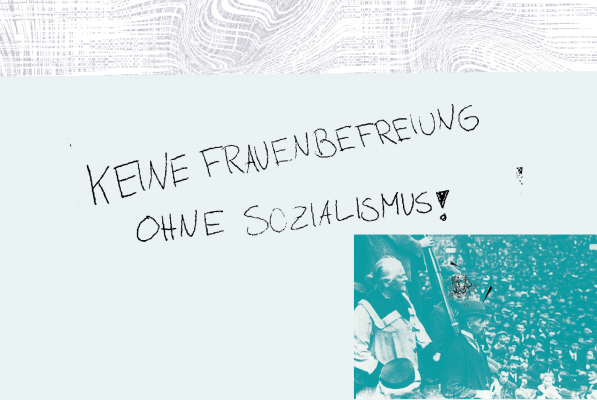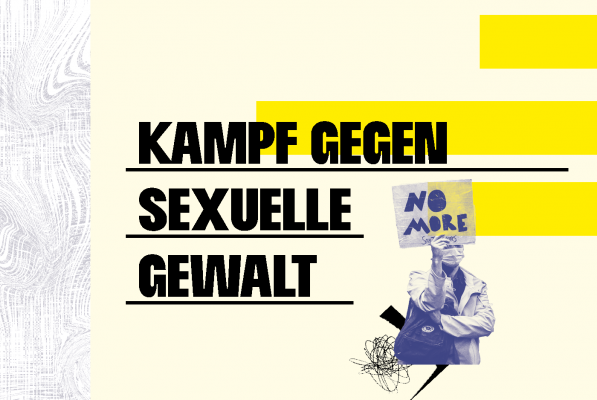Gaza: Was kann den Genozid stoppen?

Jaqueline Katherina Singh, Neue Internationale 293, Juli / August 2025
Seit über 20 Monaten führt der israelische Staat – mit Rückendeckung durch die imperialistischen Zentren, allen voran USA und Deutschland – einen Vernichtungskrieg gegen das palästinensische Volk. Gleichzeitig wird das Leben in der Westbank erstickt: Landraub durch Siedler:innenmilizen, Razzien, Abriegelung ganzer Städte und Dörfer – mit Duldung oder teilweise aktiver Teilnahme der „Palästinensischen Autonomiebehörde“. Währenddessen weitet sich die israelische Aggression über Gaza hinaus aus: Angriffe auf den Südlibanon, auf den Irak, Syrien und Iran– all das unter dem Banner der „Selbstverteidigung“ und im Namen des „Kampfs gegen den Terror“. Der letzte Rest an Humanität scheint mit jeder Bombe auf ein Krankenhaus oder eine Schule zu zerbersten.
Deswegen gehen seit 20 Monaten weltweit Millionen Menschen auf die Straße – und doch geht der Genozid weiter. In London demonstrierten mehrmals Hunderttausende, in Jakarta über zwei Millionen. Auch in Jemen, Jordanien, Tunesien, Marokko oder Südafrika füllten sich die Plätze. Selbst wenn in Deutschland – trotz staatlicher Repression, reaktionärer Staatsräson und weitgehender medialer Gleichschalung – protestieren Zehntausende. Aber selbst wenn eines Tages eine halbe Million Menschen in Berlin demonstrieren würden: Allein das Beispiel Britanniens zeigt, dass Massendemonstrationen allein nicht reichen. Die zentrale Frage ist: Warum nicht? Was braucht es, um den Genozid zu stoppen? Wie können wir eine viele größere Masse erreichen und mobilisieren – und welche Kampfmittel, welche Kampfformen müssen wir in Gang setzen, um die Maschinerie des kolonialen Vertreibung, des systematischem Mordens zu stoppen?
Empörung reicht nicht aus
Wer verstehen will, warum Millionen auf der Straße nichts verändern, muss verstehen, was Veränderung im Kapitalismus überhaupt bedeutet. Es reicht nicht, laut zu sein. Es reicht nicht, Recht zu haben. Und es reicht nicht, dass die Mehrheit etwas „moralisch falsch oder richtig“ findet. Ideen verändern die Welt nicht von selbst. Im Vorwort von „Zur Kritik der politischen Ökonomie“ schreibt Marx: „Es ist nicht das Bewußtsein der Menschen, das ihr Sein, sondern umgekehrt ihr gesellschaftliches Sein, das ihr Bewusstsein bestimmt.“
Das heißt: Menschen handeln nicht, weil sie von abstrakten Prinzipien überzeugt sind, sondern weil sie in materiellen Verhältnissen leben, aus denen sich ihre Interessen, Ängste, Hoffnungen und Handlungsspielräume ergeben. Sie machen ihre Geschichte, aber sie machen sie nicht unter freien, selbst gewählten Bedingungen, sondern unter vorgefundenen. Diese Verhältnisse sind gesellschaftlich gemacht – aber sie erscheinen den Einzelnen als von Natur gegeben, als unveränderlich, da der Kapitalismus selbst ihre inneren Ursachen verschleiert. Eigentum, Markt, Ausbeutung – all das erscheint „normal“, weil es so eingerichtet ist. Daher lässt sich auch erklären, warum die Mehrheit der Menschen selbst in Deutschland die bedingungslose Unterstützung Israels ablehnt, warum sogar Mehrheit gegen Waffenlieferungen sind, aber zugleich nicht mobilisiert werden können. Viele gehen auch davon aus, dass sie die Lage ohnedies nicht ändern könne, dass man dagegen eben nichts machen könne, weil Barbarei, Krieg, Vertreibung eben zur Menschheit gehören würden. Diese „Normalität“ ist eine Ideologie, die die herrschenden Verhältnisse absichert. Und sie funktioniert natürlich auch dadurch, dass einzelne auf sich gestellt ohne Organisation und Plan tatsächlich nichts ändern können. Deshalb ist es in einer Klassengesellschaft nicht genug, auf „menschliche Vernunft“ oder „Mitgefühl“ zu setzen.
Es geht an diese Stelle keineswegs darum, moralische Empörung, Mitgefühl, Menschlichkeit kleinzureden. Diese können mächtige Impulse sein zu mobilisieren und Menschen in Bewegung zu setzen. Doch Proteste, die sich allein auf moralische Wahrheit oder symbolische Sichtbarkeit verlassen, bleiben letztlich politisch ohnmächtig. Sie verkennen, dass sich im Kapitalismus nicht der durchsetzt, der für eine gerechte Sache eintritt hat – sondern der, der Macht organisiert. Die Klasse, die vom System profitiert, lässt sich nicht durch Appelle überzeugen – sie verteidigt ihre Macht. Moral kann berühren, aber sie kann keine Verhältnisse stürzen. Damit Empörung, damit Ideen zu einem politischen Faktor werden, müssen sie selbst zu einer materiellen, gesellschaftlichen Kraft werden, die die Macht der Herrschenden real in Frage stellen und im Optimalfalls auch brechen kann.
Das ist auch einem Teil der Bewegung bewusst. Zurecht wird gesagt, dass die letzten Monaten „Demokratien“ wie Deutschland oder der USA (mal wieder) den Heiligenschein vom Kopf gestoßen, und gezeigt haben, was Menschenrechte, Freiheit oder Frieden für die in der Praxis bedeuten. Und das stellt eine nicht zu unterschätzende Basis für unseren weiteren Kampf dar, weil die Herrschenden zurecht fürchten, dass aus der passiven Entrüstung, aus der wachsenden Delegitimierung eine Bewegung erwächst, die über die Grenzen von symbolischen Protest und die Grenzen der bisher Mobilisierten hinausgeht. In Ländern, wo die Bewegung weiter ist, sind sie sich dieser Gefahr durchaus bewusst, was auch erklärt, warum etliche imperialistische Regierung auch mit verhaltener und letztlich folgenloser Kritik an der israelischen Regierung aufwarten. Doch das ist der Punkt: Reines Enttarnen reicht nicht. Veränderung braucht eine Kraft, die stärker ist als die des Kapitals und die auch ihre Staatsmacht in die Schranken weißen kann – die organisierte Macht der Arbeiter:innenklasse.
Zum einen weil der bürgerliche Staat das Instrument der herrschenden Klasse ist. Natürlich ist es legitim und notwendig, an diesen Forderungen – z. B. nach einem sofortigen Stopp von Waffenlieferungen an Israel, nach der Aufhebung aller reaktionären Gesetze gegen die Solidaritätsbewegung und zur Entkriminalisierung alle palästinensischen Organisationen stellen. Aber wir wissen, dass die bürgerlichen Regierung dies nicht freiwillig umsetzen werden, sondern nur, wenn sie von Millionen unter Druck gesetzt werden. Stop the Genocide interessiert Keir Starmer nicht. Und selbst wenn eine Millionen Menschen durch Londons Straßen ziehen, wird er versucht das auszusitzen. Und das führt uns zum anderen. Die Macht der Arbeiter:innenklasse liegt nicht in Wahlen oder Petitionen, sondern in ihrer Stellung im gesellschaftlichen Produktionsprozess, in ihrer Fähigkeit durch gemeinsames handeln, durch politische Streiks die Produktion und den Transport von Waffen und anderen Gütern nach Israel zu blockieren und zu boykottieren. Das Betrifft nicht nur Beschäftige in der Produktion und im Transport. Die Angestellten im IT- und im Finanzsektor könnten auch Transaktionen mit dem israelischen Staaten oder Firmen verweigern und so nicht minder großen Druck ausüben, indem sie die materielle Unterstützung des Genozids unterbrechen.
Druck aufbauen – aber wie?
Das setzt jedoch nicht nur enorme Empörung aus, sondern auch ein hohes Klassenbewusstsein, Entschlossenheit und einen starken Grad der Organisierung, so dass die gesamte Klasse den Lohnabhängigen, die an vorderster Front in einem solchen Kampf stehen, selbst aktiv unterstützen, wenn die Kolleg:innen von Repression betroffen werden. Streiks haben den Vorteil, dass sie Druck ausüben können und zwar auf jene, die vom aktuellen Krieg und Morden profitieren. Fehlt Druck, bleibt auch die radikalste Parole oft folgenlos. Moral mag trösten – aber sie kann keine Panzer aufhalten.
Die zentrale Aufgabe der Linken ist daher nicht „besser zu moralisieren“, sondern den Kampf aus der Sphäre der Gefühle in die Sphäre der Macht zu überführen. Das heißt: Klassenkampf statt Appellpolitik. Es gibt keine Abkürzung, um diese Leerstelle herum – keine moralische Lautstärke, keine bloßen Protestdemonstrationen, keine spektakulärere Aktion kann sie ersetzen. Eine Bewegung ohne klare Vorstellung, auf welche Klasse auf welche Kampfmittel sie sich stützen muss um zu siegen, läuft Gefahr, dass ihre Energie letztlich verpufft.
Wie bauen wir also den Druck auf? Die am naheliegenste Antwort ist sicherlich, sich anzuschauen, welche Organisationen über die Kraft verfügt, wenn’s um’s organisieren von Streiks und generell von betrieblichen Aktionen geht: Die Gewerkschaften. Allein in den USA gibt es über 200 Resolution unterschiedlichster Gewerkschaftsgliederungen und Verbünde gegen den Genozid. In Frankreich und Belgien forderten Gewerkschaften wie die CGT und FGTB offen Sanktionen gegen israelische Firmen und kritisierten die Beteiligung europäischer Logistikunternehmen wie ZIM Shipping oder Thales am Krieg. Doch hier kommen wir zum springenden Punkt: Worte sind nicht mehr genug. Reine Solidaritätsbekundungen auf dem Papier, die Bewerbung von pro-Palästina-Aktionen in der eigenen Mitgliedschaft, das organisieren von Veranstaltungen – all das wäre in Deutschland eine gigantischer Schritt vorwärts, erscheint vielen wie ein Traum. Doch auch Papier ist bekanntlich geduldig. Solange die Beschlüsse nicht umgesetzt werden, geht der Genozid weiter.
Doch es gibt auch einige exemplarische, positive Beispiele: Hafenarbeiter:innen in Genua, Marseille, Antwerpen, Sydney und Oakland verweigerten mehrfach die Verladung oder Entladung von Waffenlieferungen an Israel – teils in Koordination, teils auf Initiative einzelner Gewerkschaftsgruppen. In Oakland blockierten Mitglieder der ILWU im November 2023 tagelang den Umschlag israelischer Container. Ein Distrikt der UAW in Kalifornien hat in Solidarität mit Uni-Besetzungen gestreikt. In Italien sabotierten Basisgewerkschafter:innen der Unione Sindacale di Base (USB) öffentlich Lieferungen von Kriegsmaterial. Doch warum, warum findet sowas nicht länger statt? Denn so positiv diese Beispiele sind, im Endeffekt sind es nur Momentaufnahmen. Was hindert also „die Gewerkschaften“ daran, einfach zu mobilisieren – und selber zu streiken – unbefristet, bis die Regierungen einknicken? Wäre das nicht einfach, wenn der Internationale Gewerkschaftsbund einen Aktionstag ausruft, an dem alle Mitgliedsgewerkschaften verpflichtet sind, für einen Streik zu mobilisieren – zur Beendigung des Genozids?
In den imperialistischen Zentren ist die Antwort darauf einfach. Jahrzehntelange Entpolitisierung durch Sozialpartnerschaft, Standortlogik, Reformillusion haben kämpferische Tradition untergraben und zu einer Entpolitisierung der Mitglieder geführt. Sie haben unter den Lohnabhängigen selbst dazu geführt, dass sie ihre eigenen Organisationen nicht einfach für sich werden können. Vielmehr hat sich eine bürokratische Kaste an den Entscheidungshebeln der Gewerkschaften festsetzt. Diese nimmt nicht ohne Grund eine bremsende, ja letztlich ein direkt staatstragende und pro-imperialistische Rolle ein.
Ihre Funktion und Existenzberechtigung zeichnet sich einerseits dadurch aus, dass Proteste „kleinhalten/befrieden“ können – sie nehmen eine „Vermittlerrolle“ zwischen Arbeiter:innenklasse und Kapital ein. Was sich harmlos anhört, impliziert jedoch auch, dass sie ein Eigeninteresse haben diese Vermittlerrolle zu erhalten – und somit das kapitalistische System selbst gar nicht in Frage stellen wollen. Generalstreik für Gaza? Unbefristet? Wenn’s nach ihnen geht: lieber nicht. Solche Ideen werden dann auch immer mit Floskeln abgewendet, dass das eine mit dem anderen nichts zu tun hätte. Gewerkschaften seien schließlich für ökonomische Auseinandersetzungen da – die Politik fände außerhalb statt, im Parlament und bei den Parteien (und geht es nach der Gewerkschaftsbürokratie dann vorzugsweise bei der SPD, zum Teil auch bei der Linkspartei).
Der einfache Umkehrschluss wäre also an den existierenden Strukturen vorbei zum Streik aufzurufen. Das ist übrigens auch schon mehrmals passiert in den ersten Monaten des Genozids. Was auf dem ersten Blick Sinnvoll scheint, ist es auf den zweiten nur bedingt. Um über Einzelaktionen hinauszukommen, um einen politischen Streik auch länger führen zu können, braucht er die Teilnahme und Unterstützung einer Mehrheit der Klasse und er braucht auch überbetrieblich Organisierung. Hinzu kommt, dass die Gewerkschaften in der Regel nicht nur den Apparat, sondern auch die politisch und gewerkschaftlich kampffähigsten Schichten organisieren.
Deswegen ist stellt sich nicht nur die Frage: Wie stoppen wir den Genozid? Sondern auch: Wie stoppen wir in dem jeweiligen Land die Komplizenschaft, die den Krieg und Besatzung Israels toleriert oder unterstützt? Welche Taktiken als Bewegung brauchen wir, um die Hindernisse, die dafür sorgen, dass die Arbeiter:innenklasse ihr Potenzial entfalten kann?
Dazu ist es unabdinglich, dass die gewerkschaftliche organisierten Aktivist:innen in der Solidaritätsbewegung, dass die verschiedenen politischen Kräfte, die selbst in den Betrieben wirken und dass die antizionistische, internationalistische Gewerkschaftslinke koordiniert am Arbeitsplatz und in den Gewerkschaften vorgehen, um Mehrheiten für die Solidaritätsaktionen, für Boykott (wie z. B. auch den akademischen Boykott) zu organisieren. Zum Aufbau einer solchen Kraft müssen wir uns bundesweit und international koordinieren bzw. bestehende Gruppierungen wie Gewerkschaft:innen4Gaza oder die VKG stärken, die dafür kämpfen. In der Linkspartei schlagen wir vor, dass pro-palästinensische Kräfte wie die Berliner LAG Palästina solche Vorschläge auch für die Gewerkschaftsarbeit der Linkspartei einbringen.
So wie wir in der Solidaritätsbewegung die Taktik der Einheitsfront – also eine möglicht große Kampfeinheit für gemeinsame konkrete Ziele und Forderungen bei gleichzeitiger voller Propagandafreiheit und Freiheit der Kritik gegenüber nicht-revolutionären Kräften – so brauchen wir das auch in Betrieb und Gewerkschaften. Und wir brauchen dabei sicher und leider auch viel Geduld, um die Lügen der bürgerlichen Medien und der Bürokratie zu beantworten und die Basismitglieder zu überzeugen.
Die Grenzen der Bewegung
Das der aktuelle Zustand so ist, wie er ist, ist nicht Schuld der Palästina-Bewegung. Blicken wir einige Jahre zurück, so stand auch Fridays for Future vor einem ähnlichen Problem. Bewegung kann viel schaffen, punktuell Druck aufbauen und zeitweise Hunderttausende oder gar Millionen in Bewegung setzen und politisieren – sie kann aber nicht alleine das imperialistische Weltsystem stürzen. Dafür bräuchte es eine organisierte Machtüberahme, die die Herrschenden aus ihren Regierungssesseln vertreibt und die Macht im Staat selber übernimmt. Das passiert aber nicht spontan – es kann gar nicht so einfach passieren, sondern letztlich nur durch die revolutionäre Machtergreifung der Arbeiter:innenklasse.
Ohne revolutionäres Programm, ohne Eingreifstrategie, ohne Aufbauarbeit bleiben Bewegungen dabei letztlich immer nur partiell erfolgreich – so groß sie auch sein mögen. Das Fehlen einer Kraft die sie bündelt, wird schon an ganz einfachen Fragen sichtbar: Warum gab es bisher beispielsweise keine zentralen Aktionstage beispielsweise auf europäischer Ebene – für ein oder zwei spezifische Forderungen wie das Ende der Waffenlieferungen oder gegen den Finanzierungsstopp der UNRWA?
Die Antwort darauf ist keine Schuldzuweisung an einzelne, sondern Resultat einer historischen Krise der Arbeiter:innenbewegung selbst. Die revolutionäre Arbeiter:innenbewegung wurde durch Stalinismus und Reformismus marginalisiert, die wenigen revolutionären Kräfte vermochten nicht, die Politik und das Programm der Vierten Internationale, die als Antwort auf Reformismus und Stalinismus entstanden war, gemäß den Erfordernissen der Periode nach dem Zweiten Weltkrieg zu aktualisieren. Seither befindet sich die Arbeiter:innenklasse in einer tiefen, Führungskrise. Was fehlt, ist nicht nur „mehr Bewusstsein“ – sondern eine revolutionäre Organisation, die in der Klasse verwurzelt ist, sie politisch schult, strategisch anleitet und international verbindet. Eine Kraft, die nicht nur Empörung kanalisiert, sondern Klassenmacht organisiert.
Zweifellos gehen alle Massenbewegungen auch mit einer Radikalisierung und Politisierung ihre aktivsten und politisch bewusstesten Teile einher. Selbst Revolutionen können sich wie der Arabische Frühling gezeigt hat, ohne revolutionäre Partei, ohne revolutionäre Führung aus den inneren Widersprüchen der Gesellschaft entwickeln. Aber sie können nicht ohne solche nicht siegen, nicht erfolgreich sein.
Doch selbst um die Bewegung voranzutreiben, braucht es eine möglichst klare, bewusste revolutionären Kraft, die sowohl unmittelbar nächste Schritt und Aktionsvorschläge macht, wie auch eine über die Bewegung hinausgehende Perspektive vertritt. Solange eine solche Kraft fehlt, bleibt jeder noch so mächtige Protest ein Aufschrei – aber eben auch nur ein Aufschrei. Und solange die Arbeiter:innenklasse sich nicht selbst in diese Bewegung einschreibt – als bewusste Kraft mit eigenem Ziel –, bleibt sie Objekt des Weltgeschehens, nicht dessen Subjekt.
Und ja, der Aufbau einer revolutionären Partei, einer neuen Internationale ist notwendig. Aber sie kann niemals abgekoppelt von den aktuell existierenden Kämpfen stattfinden. Für Kommunist:innen besteht die Aufgabe die Bewegung zu unterstützen, dort wo möglich, Protest selber zu initiieren, und eine internationalistische, klassenkämpferische Position hineinzutragen.