Revolutionärer Defätismus
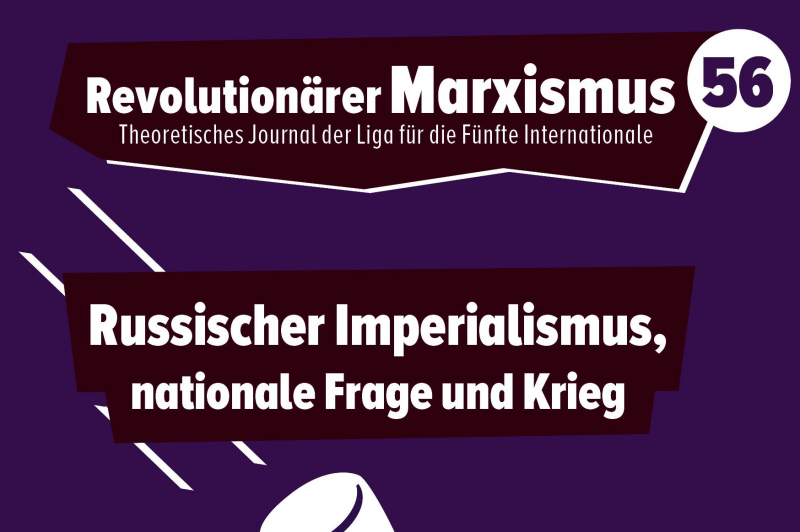
Alex Zora, Revolutionärer Marxismus 56, August 2025
In der marxistischen Debatte gibt es kaum ein Konzept, das so häufig und gleichzeitig doch so hölzern ins Feld geführt wird wie das des revolutionären Defätismus. Auf der Oberfläche scheint es für viele, die sich selbst in der Tradition Lenins sehen, klar, was es bedeutet – die Niederlage einer oder mehrerer kriegsführender Parteien in einem reaktionären Krieg. Aber schon wenn man sich die Frage stellt, ob es sich dabei um den Sturz einer kriegführenden Regierung durch die Arbeiter:innenklasse handelt oder es eher darum geht, dass in einer Situation der militärischen Niederlage durch den/die jeweiligen militärischen Gegner:in die Arbeiter:innenklasse bessere Chancen auf eine revolutionäre Machtübernahme hat, ist sie für die meisten schon recht schwer zu beantworten. Wir wollen hier untersuchen, wie revolutionäre Marxist:innen in der Geschichte zur Frage des revolutionären Defätismus standen und wie vielfältig er eigentlich als Taktik sein kann.
1. Revolutionärer Defätismus bei Lenin
1.1 Die Anfänge des revolutionären Defätismus bei Lenin
Die Geburt des leninistischen revolutionären Defätismus wird allgemein im Russisch-Japanischen Krieg von 1904/05 angesiedelt. Er entbrannte im Frühjahr 1904 zwischen dem Russischen Zarenreich und dem Japanischen Kaiserreich um die Vormachtstellung Nordostasiens (vor allem um die Mandschurei sowie die wichtigen Marinestützpunkte am Gelben Meer). Es war eine der ersten offenen Konfrontationen zwischen imperialistischen Großmächten im Zeitalter des Imperialismus und führte unmittelbar zur Russischen Revolution von 1905.
In seinem Artikel „Der Fall von Port Arthur“ vom Januar 1905 diskutiert Lenin seine grundsätzlichen Positionen zum Krieg: „Vor allem springt in die Augen, welche Bedeutung dieses Ereignis [der Fall von Port Arthur, A. Z.] für den Fortgang des Krieges hat. Das wichtigste Ziel des Krieges ist für die Japaner erreicht. Das fortschrittliche, das fortgeschrittene Asien hat dem rückständigen und reaktionären Europa einen nicht wiedergutzumachenden Schlag versetzt. Vor zehn Jahren war dieses reaktionäre Europa, mit Rußland an der Spitze, über die Niederwerfung Chinas durch das junge Japan beunruhigt [Erster Sino-Japanischer Krieg von 1894/95, A. Z.] und hatte sich zusammengetan, um Japan die besten Früchte seines Sieges zu entreißen. Europa schützte die traditionellen Beziehungen und Privilegien der alten Welt, ihr Vorrecht, ihr durch Jahrhunderte geheiligtes altes Recht auf die Ausbeutung der asiatischen Völker. Die Rückeroberung Port Arthurs durch Japan ist ein Schlag gegen das ganze reaktionäre Europa.“1(Hervorhebung von uns)
Die militärische Niederlage des Russischen Zarenreichs war hier ganz offensichtlich das angestrebte Ziel. Doch in vielerlei Hinsicht war Lenin hier in Bezug auf seine Position noch deutlich näher bei den Positionen von Marx und Engels zur Frage des Krieges. Das klassische Beispiel hierfür ist die Bewertung des Deutsch-Französischen Kriegs als Verteidigungskrieg2 auf deutscher Seite. Hier war die Betrachtung des klassischen Marxismus, dass der Krieg auf deutscher Seite dazu diente, die deutsche Kleinstaaterei zu überwinden und mit der Errichtung eines (damals) modernen Nationalstaates mit den damit einhergehenden Errungenschaften auf wirtschaftlichem und kulturellem Gebiet einhergehen würde.3 Lenin betrachtet analog im Russisch-Japanischen Krieg die japanische Seite als fortschrittlich und die russische Seite als rückschrittlich.4
Hier zeigt sich noch recht deutlich, dass Lenin 1905 noch kein eigenes Verständnis des Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus entwickelt hatte.5 Nichtsdestotrotz war es für Lenin selbst eine wichtige Erfahrung, die er selbst für seine Positionierung im Ersten Weltkrieg noch mal heranziehen sollte. Aber dazu später mehr.
Nach den Erfahrungen der Russischen Sozialdemokratie in der Russischen Revolution von 1905 wurden wichtige praktische Lehren gezogen. Diese äußerten sich beispielsweise schon auf dem Sozialist:innenkongress 1907 in einem internationalen Kontext. Zur Resolution, die sich mit Militarismus und internationalen Konflikten beschäftigte, brachten Luxemburg, Lenin und der Menschewik Martow Änderungen ein, die u. a. zum Ziel hatten, nicht nur den Ausbruch eines Krieges zu verhindern, sondern auch die allgemeine Herangehensweise vorherzusehen, die nach einem Kriegsausbruch gewählt werden sollte. Nach der Intervention der Veteran:innen der russischen Ereignisse von 1905 wurde der Schluss der Resolution auf folgende Formulierung geändert: „Falls der Krieg dennoch ausbrechen sollte, sind sie [die Sozialist:innen, A. Z.] verpflichtet, für dessen rasche Beendigung einzutreten und mit allen Kräften dahin zu streben, die durch den Krieg herbeigeführte wirtschaftliche und politische Krise zur Aufrüttelung des Volkes auszunutzen und dadurch die Beseitigung der kapitalistischen Klassenherrschaft zu beschleunigen.“6
Hier wird klar, dass der Klassenkampf im Krieg nicht ruhen sollte (wie es später sowohl von den sozialchauvinistischen als auch von einem großen Teil der pazifistischen Kräfte vertreten wurde), sondern dass er im Krieg genauso – wenn nicht sogar mit erhöhter Dringlichkeit – fortgeführt werden sollte. Ziel war, den Krieg auszunutzen zur Beseitigung der kapitalistischen Klassenherrschaft, eine Formulierung, die schon in Richtung der späteren Losung („Umwandlung des imperialistischen Kriegs in den Bürgerkrieg“) weist.
Die Erfahrungen der Russischen Revolution von 1905, die wiederum unmittelbar mit dem Russisch-Japanischen Krieg verknüpft war, waren essenziell für die weitere Entwicklung des revolutionären Defätismus. Hier zeigte sich ganz praktisch die Auswirkung militärischer Niederlagen auf revolutionäre Ereignisse. Die militärische Niederlage Russlands schwächte nicht nur den russischen Imperialismus und verschlechterte die Lage für weite Teile der Bevölkerung, sondern spielte auch eine wichtige psychologische Rolle: Ganz praktisch wurde den Massen vor Augen geführt, dass die bewaffneten Organe des Zarismus besiegt werden können – warum sollte das dann nicht auch für die revolutionäre Bewegung in Russland möglich sein?
1.2 Kriegsausbruch und revolutionärer Defätismus
Lenin betrachtete seine Position zum Krieg immer als eine Fortsetzung und Verteidigung der Positionen von Marx und Engels, die jedoch wesentlich auf die Problemstellungen der vorimperialistischen Epoche eingingen und eingehen mussten. Die Position Lenins zum Russisch-Japanischen Krieg (1904/05) ist dabei auch noch von Überlegungen von Marx und Engels geprägt, während zugleich auch schon wichtige Aspekte des revolutionären Defätismus sichtbar werden.
Je akuter die Gefahr eines allgemeinen Krieges zwischen den Großmächten – eines Weltkrieges – desto mehr drängte auch eine Weiterentwicklung des Marxismus angesichts neuer Problemstellungen, die die imperialistische Epoche selbst auf die Tagesordnung setzte.
Der Beginn des Ersten Weltkrieges brachte die wahre Gemengelage in der internationalen Sozialdemokratie der Zweiten Internationale zum Vorschein. Bis auf wenige Ausnahmen7 schwenkten die sozialdemokratischen Parteien in den kriegführenden Nationen auf eine manchmal sehr aktive, manchmal eher passive Unterstützung der Kriegsanstrengungen der eigenen Bourgeoisie um. Das war nicht nur ein Verrat an den allgemeinen Interessen des internationalen Proletariats, sondern auch an den ganz konkreten Beschlüssen von internationalen Kongressen wie denen in Stuttgart 1907, in Kopenhagen 1910 oder in Basel 1912.
Mit Ausbruch des Krieges war klar, dass die internationale Sozialdemokratie in ihrer historischen Rolle versagt hatte. Die Tageszeitung der österreichischen Sozialdemokratie (der aufgrund der Tatsache, dass der Reichsrat zu diesem Thema nicht tagte, eine Zustimmung zu Kriegsanleihen erspart blieb) titelte beispielsweise am 5. August nach der Zustimmung der deutschen Sozialdemokratie zu den Kriegskrediten: „Der Tag der deutschen Nation. Diesen Tag des vierten August werden wir nicht vergessen. Wie immer die eisernen Würfel fallen mögen – und mit der heißesten Inbrunst unseres Herzens hoffen wir, dass sie siegreich fallen werden für die Sache des deutschen Volkes –: das Bild, das heute der deutsche Reichstag […] bot, wird sich unauslöschlich einprägen in das Bewusstsein der gesamten deutschen Menschheit, wird in der Geschichte als ein Tag der stolzesten und gewaltigsten Erhebung des deutschen Geistes verzeichnet werden.“8
Lenin, der kurz nach Ausbruch des Kriegs in die Schweiz gelangte und dort bis zum Ausbruch der Februarrevolution 1917 verweilte, musste sich in dieser komplett neuen Situation erst mal mit einigen wichtigen Fragen auseinandersetzen. Im Schweizer Exil war, neben seiner Frau Krupskaja, sein engster Mitarbeiter Grigori Sinowjew. Gemeinsam mit ihm setzte er sich systematisch mit der marxistischen Haltung zum Krieg auseinander, später folgte auch die systematische Auseinandersetzung mit dem Imperialismus als neuem Stadium des Kapitalismus.
In den ersten Monaten des Krieges positionierten sich die Bolschewiki klar und deutlich. In einer wenige Wochen nach Kriegsbeginn geschriebenen Stellungnahme „einer Gruppe von Sozialdemokraten, Mitgliedern der SDAPR“9 (aufgrund der Agitation gegen den Krieg und der darauffolgenden Repression konnte das Zentralkomitee in Russland nicht zusammentreten) stellten die Bolschewiki klar, dass nicht nur keine der großen kriegführenden Nationen (konkret werden die Motive und die Stellung Frankreichs und Deutschlands diskutiert) einen gerechten Krieg führt, sondern sie definierten auch ihre Herangehensweise an die russischen Kriegsanstrengungen.
„Vom Standpunkt der Arbeiterklasse und der werktätigen Massen aller Völker Rußlands wäre das kleinere Übel die Niederlage der Zarenmonarchie und ihrer Truppen […].
7. Die Losungen der Sozialdemokratie müssen gegenwärtig sein:
1. allseitige, sowohl unter den Truppen als auch auf den Kriegsschauplätzen zu treibende Propaganda für die sozialistische Revolution und für das Gebot, die Waffen nicht gegen die eigenen Brüder, die Lohnsklaven anderer Länder, zu richten, sondern gegen die reaktionären und bürgerlichen Regierungen und Parteien in allen Ländern. […];
2. als eine der nächsten Losungen Propaganda für die deutsche, die polnische, die russische usw. Republik und zugleich für die Umwandlung aller einzelnen Staaten Europas in republikanische vereinigte Staaten von Europa;
3. Kampf insbesondere gegen die Zarenmonarchie und gegen den großrussischen, panslawistischen Chauvinismus und Propaganda für die Revolution in Rußland, desgleichen für die Befreiung und Selbstbestimmung der von Rußland unterdrückten Völker, und zwar mit den nächsten Losungen: demokratische Republik, Konfiskation der Gutsbesitzerländereien und Achtstundentag.“10
Hier wird ein wichtiger Aspekt, der die Politik des proletarischen Antimilitarismus sehr deutlich von der eines (klein)bürgerlichen Pazifismus abgrenzt, deutlich: die Ablehnung jeglicher Illusionen in eine Losung nach Frieden oder ein Niederlegen der Waffen. Vielmehr geht es revolutionären Marxist:innen darum, die Waffen gegen die reaktionären und bürgerlichen Regierungen zu richten.
Außerdem wird die kompromisslose Haltung gegenüber dem Zarenreich und dem großrussischen Chauvinismus klar. Die konkrete Losung der Niederlage als kleineres Übel wird hier erst mal nur auf Russland angewendet, auf die anderen Staaten zu diesem Zeitpunkt noch nicht.
In einem Ende August bis Ende September 1914 geschriebenen, aber erst nach dem Krieg veröffentlichten Manuskript beschäftigt sich Lenin noch einmal mit der Frage des Verhältnisses zwischen der Losung der Niederlage des russischen Zarismus und der Position von Sozialist:innen in anderen Ländern.
„Denn überall gibt es Bourgeoisie und Imperialisten, überall die niederträchtige Vorbereitung zum Gemetzel. Ist der russische Zarismus besonders gemein und barbarisch (reaktionärer als alle anderen), so ist der deutsche Imperialismus ebenfalls monarchistisch, hat feudal-dynastische Ziele und eine brutale Bourgeoisie, die weniger frei ist als in Frankreich. Die russischen Sozialdemokraten hatten recht, als sie sagten, daß für sie die Niederlage des Zarismus das kleinere Übel ist, daß ihr unmittelbarer Feind vor allem der großrussische Chauvinismus ist“ – und die berühmte Losung Liebknechts vorwegnehmend – „die Sozialisten eines jeden Landes aber (die nicht Opportunisten sind) mußten ihren Hauptfeind in ‚ihrem‘ (,einheimischen‘) Chauvinismus sehen.“11
Ähnliches wird auch im ersten ausführlichen formellen Statement der Bolschewiki, das am 1. November 1914 als „Der Krieg und die russische Sozialdemokratie“ erschien, deutlich:
„Die Aufgabe der Sozialdemokratie eines jeden Landes muß in erster Linie der Kampf gegen den Chauvinismus des betreffenden Landes sein. […]
Bei der jetzigen Lage kann vom Standpunkt des internationalen Proletariats nicht bestimmt werden, welche der beiden Gruppen von kriegführenden Nationen die Niederlage das kleinere Übel für den Sozialismus wäre. Aber für uns russische Sozialdemokraten kann es keinen Zweifel unterliegen, daß vom Standpunkt der Arbeiterklasse und der werktätigen Massen aller Völker Rußlands die Niederlage der Zarenmonarchie, der reaktionärsten und barbarischsten Regierung, die weitaus die meisten Nationen und größten Bevölkerungsmassen Europas und Asiens unterjocht hat, das kleinere Übel wäre.“12
Hier wird klar, dass Lenins Losung der Niederlage als kleineres Übel sich analog zu seiner Position in Bezug auf den Russisch-Japanischen Krieg erst mal auf eine militärische Niederlage des russischen Zarenreichs gegen seine militärischen Gegner:innen bezieht. Wichtig ist festzuhalten, dass Lenin hier in erster Linie die Taktiken für russische Sozialist:innen entwickelte. Einige wichtige systematische Analysen wie die des Imperialismus oder die der marxistischen Herangehensweise an Kriege stehen hier noch aus. Nichtsdestotrotz tritt die Abgrenzung in Bezug auf Vaterlandsverteidigung sowie Pazifismus sehr deutlich in der Methode der russischen Revolutionär:innen hervor.
Das Ganze wird noch deutlicher, wenn wir uns den Text „Über den Nationalstolz der Großrussen“ ansehen. In ihm versucht Lenin, im Nationalstolz der Großrussen antizaristische Ansätze („Ein Volk, das andere unterdrückt, kann selbst nie frei sein“) zu finden und gleichzeitig klar die reaktionären Seiten aufzuzeigen. Hier findet sich aber auch eine interessante Formulierung zu seinem Verständnis von Niederlage:
„Man kann im 20. Jahrhundert und in Europa (sei es auch im fernen Osteuropa) nur dadurch das ‚Vaterland verteidigen‘, dass man mit allen revolutionären Mitteln gegen die Monarchie, die Gutsbesitzer und Kapitalisten des eigenen Vaterlandes, d. h. gegen die schlimmsten Feinde unserer Heimat, kämpft; die Großrussen können nur dadurch das ‚Vaterland verteidigen‘, daß sie in jedem Kriege die Niederlage des Zarismus herbeiwünschen – als das kleinere Übel für neun Zehntel der Bevölkerung Großrusslands […].“13
Dieses „Herbeiwünschen“14 drückt klar die Hoffnung auf einen nicht unmittelbar von einem selbst abhängigen Prozess aus. Da Lenin nicht unbedingt dafür bekannt war, besonders großen Stellenwert auf Wünsche zu legen, können wir hier zweierlei festhalten: Auf der einen Seite sehen wir das Begehren nach der Niederlage der „eigenen“ herrschenden Klasse („Der Hauptfeind steht im eigenen Land“). Die Betonung dieses tiefen Klassenhasses war Lenin speziell in einer Situation wichtig, in der auch relevante Teile des Proletariats (und in größerem Ausmaß auch ihre Führer:innen) von Nationalismus und Chauvinismus ergriffen waren. Auf der anderen Seite drückt es aber auch aus, dass es sich hierbei nicht um die Niederlage gegen einen bürgerlich-demokratischen oder proletarischen Aufstand handelt, sondern um den militärischen Ausgang am real existierenden Schlachtfeld – sonst wären „Wünsche“ alles andere als eine nachvollziehbare Formulierung.
In „Der Krieg und die russische Sozialdemokratie“ finden wir zum ersten Mal die berühmte Losung der Umwandlung des imperialistischen Kriegs in den Bürgerkrieg:
„Die Umwandlung des gegenwärtigen imperialistischen Krieges in den Bürgerkrieg ist die einzig richtige proletarische Losung. Das zeigt die Erfahrung der Kommune, das ist im Basler Manifest (1912) vorgesehen, und das ergibt sich aus den ganzen Bedingungen des imperialistischen Krieges zwischen hochentwickelten bürgerlichen Ländern.“15
Im Gegensatz zur Niederlage als kleinerem Übel, die wir hier in erster Linie als grundsätzliche Herangehensweise verstehen müssen und die als wichtige Abgrenzung zu den Sozialchauvinist:innen der „Vaterlandsverteidigung“ verwendet wird, wird die Umwandlung des imperialistischen Kriegs in den Bürgerkrieg klar als konkrete Losung bezeichnet. Sie ist das Resultat der Erfahrungen der Pariser Kommune16 (wie von Lenin richtig hervorgehoben) wie auch der Russischen Revolution von 1905, die wir schon weiter oben diskutiert haben. Lenin stellt sie auch in die Tradition der Resolution von 1912, die – wie schon erwähnt – davon spricht, „die durch den Krieg herbeigeführte wirtschaftliche und politische Krise zur Aufrüttelung des Volkes auszunutzen und dadurch die Beseitigung der kapitalistischen Klassenherrschaft zu beschleunigen“. Es sollte aber auch offensichtlich sein, dass sie in Radikalität und Klarheit eine neue Qualität darstellt.
1.3 Entwicklung während des Krieges
Während des Schweizer Exils arbeiteten Lenin und sein unmittelbares Umfeld, insbesondere seine Frau Nadeschda Krupskaja, Grigori Sinowjew und Inessa Armand, an einigen theoretischen Fragen. Als Erstes bearbeiteten Lenin und Sinowjew systematisch die marxistische Haltung zum Krieg. Es erschienen einige Texte und den Abschluss fand diese Arbeit in Sinowjews „Der Krieg und die Krise des Sozialismus“ (1916). Systematisch wird hier die Geschichte der marxistischen Haltung zum Krieg, mit einem Hauptaugenmerk auf die deutsche Sozialdemokratie, diskutiert. Sinowjew untersucht, unter welchen Umständen Marxist:innen Kriegsparteien unterstützen können (in gerechten Kriegen) und wann nicht. Er teilt die Entwicklung des Kapitalismus nach der französischen Revolution in zwei Zeitalter: die Epoche der (legitimen) nationalen Kriege für West- und Zentraleuropa bis zum Ende des Deutsch-Französischen Kriegs 1871 und die danach folgende Epoche der imperialistischen Kriege. Entsprechend müsste sich auch die Herangehensweise von Sozialist:innen unterscheiden. Die Entwicklung der Zweiten Internationale teilt er ebenfalls in zwei Teile, 1889 bis ungefähr 1904 „Gegen den Zarismus“ (als der Zarismus als Hauptstütze der europäischen Reaktion diente) und nach der Russischen Revolution von 1905 bis zum Baseler Kongress 1912 „Gegen den Imperialismus“.
Die Schwäche der Zweiten Internationale wird darin gesehen, dass sie nicht klar unterscheiden konnte zwischen den Taktiken in einer Zeit, in der es noch legitime Aufgaben der nationalen Einigung gegen die feudale Reaktion gab (auch in solchen Ländern, die selbst nicht durch andere Länder unterdrückt wurden), und den Aufgaben während der imperialistischen Epoche, in der Kriege zwischen imperialistischen Mächten einen grundsätzlich reaktionären Charakter aufweisen. Im Vordergrund steht hier immer der Kampf um Märkte, Ressourcen und Einflusssphären, ideologische Phänomene (wie heutzutage „Demokratie gegen Autoritarismus“) tragen hier immer nur einen sekundären Charakter.
Der zweite wichtige Baustein für die theoretische Weiterentwicklung der leninistischen Herangehensweise an den Krieg war Lenins systematische Beschäftigung mit Imperialismus, die er im Schweizer Exil begann. Einen vorläufigen Abschluss fand diese Arbeit in seinem berühmten Werk „Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus“. In ihm untersucht er die ökonomischen Veränderungen im Kapitalismus im Kontext der Aufteilung der Welt unter einige wenige imperialistische Großmächte, die Entwicklung von Finanzkapital als Zusammenschluss von Bank- und Industriekapital sowie andere wichtige Entwicklungen (beispielsweise Ablösung der Zentralität von Warenexport durch Kapitalexport oder die Herausbildung einer besser bezahlten Schicht der Arbeiter:innenklasse, der Arbeiter:innenaristokratie).17
Ergebnis war nicht nur ein Verständnis des Imperialismus als gesellschaftliche Gesamtheit und Stadium des Kapitalismus, sondern auch des imperialistischen (Welt‑)Krieges im Besonderen. Trotz aller Bekundungen für einen Kampf gegen russische Selbstherrschaft, deutsches Kaisertum oder später sogar für nationale Selbstbestimmung war das zentrale Ziel der imperialistischen Großmächte eine neue Aufteilung der Welt18 – die revolutionären Anti-Kriegs-Linken sprachen diese Wahrheit von Anfang an schonungslos aus.
Die Verallgemeinerung der leninistischen Position des Defätismus gleichermaßen auf alle Länder bei gleichzeitiger Nuancierung der Rolle der (militärischen) Niederlage sehen wir 1915 bei Lenin. Dafür ausschlaggebend waren nicht nur die beiden oben genannten theoretischen Projekte, sondern auch die Diskussion der Bolschewiki in der Schweiz. Zur Konferenz der Auslandsgruppen der Bolschewiki im Frühjahr 1915 in Bern trug eine Gruppe von Bolschewiki aus Baugy19 in Montreux (Schweiz), geführt von Nikolai Bucharin, eine Kritik an der Linie der Partei sowie des Sotsial-Demokrat (der von Lenin und Co. herausgegebenen Publikation) in Bezug auf den revolutionären Defätismus vor.
„Die Gruppe verurteilt entschieden jedes Vorantreiben der sogenannten Losung ‚Der Niederlage Russlands‘, insbesondere in der Art und Weise, wie sie in Nr. 38 des Zentralorgans vorgebracht wurde. Sowohl im Manifest des Zentralkomitees [das schon weiter oben zitierte ,Der Krieg und die russische Sozialdemokratie’20 [A. Z.] als auch in der Antwort an Émile Vandervelde21 wird die Niederlage Russlands als das ,kleinere Übel’ bezeichnet, nach einer objektiven Bewertung der anderen Fragen des Krieges. Der Leitartikel der Nr. 38 hingegen sagt, dass jeder Revolutionär verpflichtet ist, sich ,die Niederlage Russlands’ zu wünschen.
Einer solchen Betrachtung der Frage fehlt nicht nur, nach dem Urteil der Gruppe, jeder praktische Sinn, sondern sie fügt dieser auch eine unerwünschte Verwirrung hinzu. Wenn ein Revolutionär lediglich verpflichtet ist, sich die Niederlage zu ,wünschen’, dann ist es sinnlos, Leitartikel im Zentralorgan der Partei darüber zu schreiben. Wenn er aber verpflichtet ist, mehr zu tun als nur zu ,wünschen’, dann wäre dies nicht einfach eine objektive Bewertung, sondern die Verkündigung einer aktiven Teilnahme am Krieg, die von der Redaktion des Zentralorgans kaum gebilligt werden würde.
Noch unbefriedigender ist nach Ansicht der Gruppe die Betrachtung derselben Frage im dritten und letzten Absatz des Artikels, wenn die Erwünschtheit der Niederlage mit den möglicherweise folgenden revolutionären Erhebungen begründet wird. Die absolute Unmöglichkeit praktischer Agitation in diesem Sinne erzwingt die Ablehnung à la limite (äußerstenfalls; d. Red.) einer solchen Agitation für die Niederlage. Wir stellen fest, dass in dem erwähnten Artikel die Grenze zwischen der objektiven, völlig zulässigen und richtigen Einschätzung der Lage und der Agitation für die Niederlage überhaupt nicht gezogen wurde. Die Fraktion hält es für dringend notwendig, alle Verwirrung und Unklarheit in dieser Frage auf entschiedenste Weise zu beseitigen.“22
Der angesprochene Artikel aus dem Sotsial-Demokrat Nr. 38 war „Der Krieg und das Schicksal unserer Befreiung“23 von Sinowjew. In ihm formuliert er es folgendermaßen: „Wir sind Russen und deshalb treten wir für die Niederlage des russischen Zarismus ein, – diese Formel steht uns, russischen Sozialisten, viel mehr zu Gesicht, wenn schon einmal argumentiert werden muß, dass ‚wir Russen‘ sind.“ 24 In dem Artikel wird auch noch einmal deutlich, dass er sich hier klar auf die militärische Niederlage gegen die Mittelmächte bezieht. Gleichzeitig stellt er für die anderen am Krieg teilnehmenden Länder lediglich die schon bekannte Losung der „Überleitung des imperialistischen Krieges in den Bürgerkrieg“ auf.
Leider sind weder der genaue Ablauf noch die Inhalte der Diskussionen dieser Konferenz klar erhalten geblieben. Was uns bekannt ist, sind vor allem ihre Ergebnisse.25 Im Wesentlichen kann man davon sprechen, dass sich Lenins Linie durchsetzte. Nichtsdestotrotz lassen sich danach einige Änderungen feststellen. Die erste wichtige war, dass die Taktik des Defätismus ein für alle Mal explizit und gleichermaßen in allen kriegführenden Ländern angewandt werden sollte: „In keinem Lande darf der Kampf gegen die eigene, am imperialistischen Krieg beteiligte Regierung vor der Möglichkeit haltmachen, dass dieses Land infolge der revolutionären Agitation eine Niederlage erleidet. Eine Niederlage der Regierungsarmee schwächt die betreffende Regierung, fördert die Befreiung der von ihr geknechteten Völkerschaften und erleichtert den Bürgerkrieg gegen die herrschenden Klassen.“26
Hier wird zwar durchaus auch das Positive der Niederlage des eigenen Landes betont, aber gleichzeitig wird deutlich, dass die Niederlage an sich nicht angestrebt wird, sondern dass das Kernelement des revolutionären Defätismus ist, dass die Niederlage aufgrund von Klassenkampf und revolutionärer Agitation gegen die Regierung in Kauf genommen wird – immerhin ist sie auch ein Übel, wenn auch das kleinere. Die sich aus dem Krieg ergebende Situation (Einzug von Jugendlichen zur Armee, verstärktes Arbeitsregime, Einschränkung der demokratischen Freiheiten, …) muss für Klassenkampf und revolutionäre Agitation und Propaganda ausgenutzt werden – auch wenn damit die Gefahr der Niederlage des „eigenen“ Landes in Kauf genommen wird. Auf die internationale Situation angewandt gab es keine „Losung der Niederlage“, vielmehr war das bereitwillige In-Kauf-Nehmen der Niederlage ein wichtiger Lackmustest für alle revolutionären Kriegsgegner:innen.
Für Russland verblieb aber weiterhin eine gewisse Sonderstellung: „Auf Rußland angewandt, ist diese These [siehe obiges Zitat, A. Z.] besonders zutreffend. Ein Sieg Rußlands zöge eine Stärkung der Weltreaktion, eine Stärkung der Reaktion innerhalb des Landes nach sich und wäre gleichzeitig von der völligen Versklavung der Völker in den bereits okkupierten Gebieten begleitet. Infolgedessen ist eine Niederlage Rußlands unter allen Umständen das kleinere Übel.“27
Hier sehen wir auch, dass für Russland offenbar die Niederlage „unter allen Umständen“ das kleinere Übel ist, sprich, dass das hier sowohl für die reine militärische Niederlage gegen die Mittelmächte auf dem Schlachtfeld als auch für die für alle Länder angestrebte Niederlage in Folge revolutionärer Agitation gilt. Wir können also hier feststellen, dass die grundlegende Herangehensweise des revolutionären Defätismus grundsätzlich für alle kriegführenden Nationen gilt, dass es aber gleichzeitig die Möglichkeit für nationale Besonderheiten – hier in Bezug auf Russland28, das den Bolschewiki als Hort der Reaktion galt – gibt.
1.4 Kontroverse mit Trotzki
Trotzki, der zu dem Zeitpunkt als prinzipienfester Kriegsgegner gemeinsam mit einigen linken Menschewiki (wie Martow oder dem späteren Bolschewik Antonow-Owsejenko), die sich als „Internationalisten“ verstanden und die kriegsbefürwortenden Sozialdemokrat:innen kritisierten, eine Tageszeitung (Nasche Slowo; Unser Wort) in Paris herausgab, hatte anfangs ein doch recht anderes Verständnis der marxistischen Taktik im Krieg. Seine Losungen waren:
„Keine Kontributionen!
Das Recht jeder Nation auf Selbstbestimmung!
Die vereinigten Staaten Europas – ohne Monarchien, ohne ständige Heere, ohne regierende Feudalkasten, ohne Geheimdiplomaten!“29
Doch in Bezug auf die Frage der Niederlage bezog er eine andere Position als Lenin:
„Könnte nicht wirklich die Niederlage des Zarismus der Sache der Revolution Vorschub leisten? […] Gegen diese Möglichkeit ist nichts einzuwenden. Dessen ungeachtet war der russisch-japanische Krieg ein mächtiger Anstoß zu den ihm folgenden revolutionären Ereignissen.
Solche Folgen lassen sich darum auch vom deutsch-russischen Krieg erwarten. [..]
Diejenigen, welche denken, daß der russisch-japanische Krieg die Revolution hervorgebracht hat, kennen und verstehen die Ereignisse und ihre Zusammenhänge nicht. Der Krieg hat den Ausbruch der Revolution nur beschleunigt. Doch hat er auch eben dadurch die Revolution geschwächt. Denn hätte sich die Revolution aus dem organischen Auswachsen der inneren Kräfte heraus entwickelt, so wäre sie später aufgetreten, aber mächtiger und planmäßiger. Folglich ist die Revolution durchaus nicht an einem Kriege interessiert. Das als Erstes. Zweitens hat der russisch-japanische Krieg, indem er den Zarismus schwächte, den japanischen Militarismus gestärkt. Auf den deutsch-russischen Krieg beziehen sich die beiden obigen Betrachtungen in noch höherem Grade.“30
Trotzki hängt hier sicher stärker als Lenin einem historischen Determinismus an (die Revolution wäre ohne den Russisch-Japanischen Krieg einfacher, später, aber dafür mächtiger ausgebrochen). Aber insbesondere die Ereignisse 1917 sollten zeigen, wie wichtig eben genau die Erfahrungen der Revolution 1905 – insbesondere der Errichtung von Arbeiter:innenräten (Sowjets) – sein sollten für den Februar- wie auch Oktoberumsturz.
Allgemein gesprochen war Trotzkis Perspektive aber von Anfang an eine, die nicht versuchte, von der russischen Perspektive aus eine Antwort auf den Krieg zu geben, sondern von vornherein aus einer internationalistischen Sichtweise den Krieg betrachtete. Das ist allgemein zwar richtig, aber setzte nicht die erste wichtige Trennungslinie zu den pazifistischen Teilen der Sozialdemokratie, die sich dem Krieg nicht aktiv entgegensetzen wollten. Dieses Versäumnis stieß Lenin bitter auf. Er sah zwar durchaus die Nähe zu den Kräften um das Nasche Slowo und versuchte beispielsweise – nach einem Angebot durch Nasche Slowo –, mit ihnen 1915 einen Block für die Londoner Konferenz der Sozialist:innen der Entente-Staaten zu bilden (was aber scheiterte). Eine nähere Zusammenarbeit mit Trotzki scheiterte damals aber weniger wegen Lenins und Trotzkis Differenzen in Bezug auf die Frage des Defätismus, sondern eher wegen Trotzkis Ablehnung der „Methoden“ der Bolschewiki (worauf wir hier nicht speziell eingehen wollen).
Der Konflikt spitzte sich dann im Sommer 1915 zu. In einem offenen Brief an das theoretische Journal der Bolschewiki „Kommunist“ schreibt Trotzki:
„Außerdem kann ich mich unter keinen Umständen Ihrer Meinung anschließen, die durch eine Resolution31 unterstrichen wird, dass die Niederlage Russlands das ‚kleinere Übel‘ wäre. Diese Meinung stellt eine grundsätzliche Übereinstimmung mit der politischen Methodik des Sozialpatriotismus dar, eine Übereinstimmung, für die es keinen Grund und keine Rechtfertigung gibt und die den revolutionären Kampf gegen den Krieg und die Bedingungen, die diesen Krieg hervorbringen, durch eine (unter den gegenwärtigen Bedingungen äußerst willkürliche) Orientierung an der Linie des „kleineren Übels“ ersetzt.“32
„Das ist ein völlig unnötiges und völlig ungerechtfertigtes Zugeständnis an die politische Methodik des Patriotismus. Ich bin auch nicht einverstanden mit der Art und Weise, in der Sie die Frage des Sozialpatriotismus in seiner organisatorischen Form aufgeworfen haben. Er scheint mir völlig unklar und zweideutig zu sein. Er erscheint nur deshalb präzise und klar, weil seine Position alle praktischen Probleme vermeidet, die sich den Internationalisten in ihrem Kampf gegen den Sozialpatriotismus stellen, um die Arbeitermassen zu beeinflussen.“33
Lenin sah das als Zugeständnis an den pazifistischen Teil der Sozialdemokratie. Er sah schon einige Zeit lang die Hauptspaltungslinie in der sozialistischen Bewegung als die zwischen Chauvinist:innen und Anti-Chauvinist:innen an, so meinte er in einem Brief an Schljapnikow, den Verbindungsmann in Skandinavien zu den Bolschewiki in Russland: „Ich denke, sowohl bei uns in Rußland wie in der ganzen Welt zeichnet sich eine neue grundlegende Gruppierung innerhalb der Sozialdemokratie ab: die Chauvinisten (,Sozialpatrioten’) und ihre Freunde, ihre Verteidiger – und die Antichauvinisten. Im Großen und Ganzen entspricht diese Teilung der in Opportunisten und revolutionäre Sozialdemokraten, aber sie ist plus précis [präziser, A. Z.] und stellt sozusagen ein höheres, der sozialistischen Umwälzung näherkommendes Entwicklungsstadium dar.“34
Lenin antwortete Trotzki schließlich in einem eigenen Artikel „Über die Niederlage der eigenen Regierung im imperialistischen Krieg“35. Er beginnt mit einer der wohl bekanntesten Formulierungen des revolutionären Defätismus:
„Die revolutionäre Klasse kann in einem reaktionären Krieg nicht umhin, die Niederlage ihrer eigenen Regierung zu wünschen. Das ist ein Axiom. […] Revolutionäre Aktionen gegen die eigene Regierung während des Krieges bedeuten aber zweifellos, unbestreitbar nicht nur den Wunsch nach einer Niederlage der eigenen Regierung, sondern auch die praktische Mitwirkung an einer solchen Niederlage. (Für den ,scharfsinnigen Leser’ sei bemerkt: Das bedeutet keineswegs, dass man ,Brücken sprengen’, erfolglose Militärstreiks inszenieren und überhaupt der Regierung helfen soll, den Revolutionären eine Niederlage beizubringen.) […] Vor der ,Losung’ der Niederlage bekreuzigen sich die Chauvinisten (samt dem OK und der Fraktion Tschcheidse36) eben deshalb, weil einzig und allein diese Losung die konsequente Aufforderung zu revolutionären Aktionen gegen die eigene Regierung während des Krieges bedeutet.“37
Interessant ist, dass Lenin in diesem Text, wenn er von der „Losung der Niederlage“ spricht, das Wort „Losung“ genauso oft in Anführungszeichen verwendet wie ohne. Die eigentliche Losung der Bolschewiki war nämlich die der „Umwandlung des imperialistischen Kriegs in den Bürgerkrieg“. Gleichzeitig lesen wir hier vom Wunsch nach Niederlage als Axiom. Lenin geht es hier vor allem darum, die offenen Enden, die Trotzki gegenüber dem linken Menschewismus (und dessen unklarer Haltung zur Frage der Vaterlandsverteidigung) zeigt, anzugreifen. Wichtig ist hier aber hervorzuheben, dass die Bolschewiki die Frage der Niederlage – bis auf wenige Ausnahmen vor allem bei Sinowjew – nie zur Losung erhoben. Vielmehr war es ihre grundsätzliche Herangehensweise zur Frage von Revolution und Krieg, dass bei den Pazifist:innen und linken Reformist:innen jedes auch nur so kleine Festhalten an der Verteidigung des eigenen imperialistischen Staates notwendigerweise in einer Politik der Burgfriedenspolitik münden würde.
In der für die Zimmerwalder Konferenz geschriebenen Broschüre der Bolschewiki „Sozialismus und Krieg“ thematisierte Lenin zwar auch wieder die Frage der Niederlage der „eigenen“ Regierung und stellte klar, dass „[d]ie revolutionäre Klasse […] in einem reaktionären Krieg nicht anders als die Niederlage der eigenen Regierung wünschen [kann]“38. In Bezug auf Losungen formuliert er aber Folgendes:
„Die Losung der Marxisten ist die Losung der revolutionären Sozialdemokratie
Der Krieg hat zweifellos eine Krise schwerster Art heraufbeschworen und die Leiden der Massen ungeheuerlich verschärft. Der reaktionäre Charakter dieses Krieges, die unverschämte Lüge der Bourgeoisie aller Länder, die ihre Raubziele unter dem Mäntelchen ,nationaler’ Ideologie versteckt – all dies ruft auf dem Boden der objektiv revolutionären Situation unweigerlich revolutionäre Stimmungen in den Massen hervor. Es ist unsere Pflicht, diese Stimmungen bewußtzumachen, zu vertiefen und ihnen Gestalt zu geben. Diese Aufgabe findet ihren richtigen Ausdruck nur in der Losung: Umwandlung des imperialistischen Kriegs in den Bürgerkrieg und jeder konsequente Klassenkampf während des Krieges, jede ernsthaft durchgeführte Taktik von ,Massenaktionen’ muß unvermeidlich dazu führen.“39
1.5 Lenins Taktik 1917
Nach dem Jahr 1915, in dem sich der revolutionäre Defätismus mit seiner grundlegenden Herangehensweise internationalisierte, widmete sich Lenin Ende 1915 und 1916 vermehrt anderen Themen, hierunter insbesondere das Thema Imperialismus, das Lenin 1915 und 1916 stark beschäftigte, sowie mehrere wichtige Polemiken zum Selbstbestimmungsrecht der Nationen.40 Zum Thema der Niederlage äußerte er sich weniger, aber verteidigte klar und deutlich weiter die grundlegende Herangehensweise des revolutionären Defätismus, beispielsweise in einer Polemik gegen den deutschen Sozialdemokraten Wilhelm Kolb41 oder in seiner Auseinandersetzung mit Rosa Luxemburgs Junius-Broschüre42.
Die Vorhersage der Bolschewiki, dass die militärische Niederlage die Bedingungen für revolutionäre Entwicklungen verbessert, bewahrheitete sich schließlich im Frühjahr 1917. Das russische Zarenreich war nach mehr als zweieinhalb Jahren Krieg am Rande seiner Kräfte – Hunger, Inflation und militärisches Arbeitsregime brachten die Massen in unmittelbaren Konflikt mit dem unfähigen Zarenregime. Die Februarrevolution fegte dann die Monarchie und das alte Regime hinweg. Es wurde eine provisorische Regierung aus offen bürgerlichen Kräften und reformistischen bzw. populistischen Kräften (anfangs nur mit den Sozialrevolutionär:innen, später auch mit Beteiligung der Menschewiki) gebildet.
Die Situation nach der Februarrevolution war sehr ambivalent. Auf der einen Seite konnten viele Revolutionär:innen nach Russland zurückkehren (darunter auch Lenin und Trotzki) und die Arbeiter:innenräte der Revolution von 1905 wurden wieder aufgebaut und dieses Mal entstanden auch in substanzieller Zahl Soldat:innenräte. Das Land erlebte die mit Abstand größten demokratischen Freiheiten (speziell in den Anfangsmonaten) aller kriegführenden Nationen. Die Räte und die provisorische Regierung standen sich in einer Situation der Doppelmacht gegenüber. Gleichzeitig führte die provisorische Regierung aber den Krieg gegen die Mittelmächte im Bündnis mit den Westmächten weiter, es wurde keine ökonomische Verbesserung der Situation der Massen erreicht und die versprochenen Wahlen zu einer konstitutionellen Versammlung wurden immer wieder verschoben. Auch wenn sich das politische Regime änderte, blieb der Charakter des imperialistischen Kriegs erhalten und die ökonomische Macht der Kapitalist:innen war ungebrochen.
In dieser Situation war es für viele Bolschewiki erst einmal schwer, sich neu zu orientieren. Ein Teil rund um die Redaktion der Prawda (Kamenew, Stalin, Muranow) argumentierte anfangs noch sehr zweideutig. Stalin selbst beschreibt das selbst in einer Rede von 1924:
„Die Partei (ihre Mehrheit) versuchte tastend zu dieser neuen Orientierung zu gelangen. Sie schlug eine Politik des Drucks der Sowjets auf die Provisorische Regierung in der Frage des Friedens ein und konnte sich nicht entschließen, sofort den Schritt vorwärts von der alten Losung ,Diktatur des Proletariats und der Bauernschaft’ zu der neuen Losung ,Macht den Sowjets’ zu tun. Diese Politik der Halbheiten war darauf berechnet, den Sowjets Gelegenheit zu geben, anhand der konkreten Fragen des Friedens das wahre imperialistische Wesen der provisorischen Regierung zu durchschauen und sie dadurch von dieser loszulösen. Dies war jedoch eine zutiefst falsche Position, denn sie erzeugte pazifistische Illusionen, leitete Wasser auf die Mühle der ,Vaterlandsverteidiger’ und erschwerte die revolutionäre Erziehung der Massen. Diese irrige Auffassung teilte ich damals mit anderen Parteigenossen und habe mich von ihr erst Mitte April vollständig losgesagt, als ich mich den Thesen Lenins anschloss.“43
Lenin, der erst im April nach Russland gelangen konnte, stellte mit seinen Aprilthesen die revolutionäre Ausrichtung der Bolschewiki klar. In ihnen erläuterte er, dass es keine Form von Unterstützung für die provisorische Regierung geben sollte, dass die einzige Form der revolutionären Regierung die Sowjets darstellen und dass diese in einer Räterepublik (im Gegensatz zur parlamentarischen Republik) organisiert sein müsste. Im selben Text stellt er aber auch klar, dass die Position der Bolschewiki nicht die der „revolutionären Vaterlandsverteidigung“ sein dürfte.
Interessant ist hier ein Artikel, den Lenin im Oktober 1915 geschrieben hatte und in dem er das Ergebnis der nächsten Revolution in Russland diskutiert. Schon hier ist seine Position eigentlich sehr deutlich:
„7. Die Teilnahme von Sozialdemokraten an einer provisorischen revolutionären Regierung zusammen mit dem demokratischen Kleinbürgertum halten wir nach wie vor für zulässig, aber keinesfalls eine Teilnahme zusammen mit revolutionären Chauvinisten. – 8. Als revolutionäre Chauvinisten bezeichnen wir diejenigen, die den Sieg über den Zarismus zu dem Zweck wollen, Deutschland zu besiegen, andere Länder zu rauben, die Herrschaft der Großrussen über die übrigen Völker Rußlands zu festigen usw. Die Grundlage des revolutionären Chauvinismus ist die Klassenlage des Kleinbürgertums. Es schwankt stets zwischen Bourgeoisie und Proletariat. […]
9. Wenn die revolutionären Chauvinisten in Rußland siegten, so würden wir gegen eine Verteidigung ihres ,Vaterlandes’ im gegenwärtigen Krieg sein. Unsere Losung: Gegen die Chauvinisten, auch wenn sie Revolutionäre und Republikaner sind, gegen sie und für das Bündnis des internationalen Proletariats zur Durchführung der sozialistischen Revolution.“44
In der Situation nach dem Februaraufstand waren die Bolschewiki noch eine klare Minderheit im Proletariat. Die übergroße Mehrheit empfand Sympathien für die gemäßigten Parteien der Menschewiki oder der Sozialrevolutionär:innen. Damit einher ging auch, dass es eine große Unterstützung in den Massen für eine „revolutionäre Vaterlandsverteidigung“ gab. Lenin beschrieb das folgendermaßen:
„Der Vaterlandsverteidiger aus der Masse sieht die Dinge einfach, auf Spießbürgerart: ‚Ich will keine Annexionen, der Deutsche will mir ,an den Kragen‘, folglich verteidige ich eine gerechte Sache und durchaus nicht irgendwelche imperialistischen Interessen.‘ Einem solchen Menschen muß immer wieder klargemacht werden, daß es nicht auf seine persönlichen Wünsche ankommt, daß es sich vielmehr um politische Verhältnisse und Beziehungen der Massen, der Klassen, um den Zusammenhang des Krieges mit den Interessen des Kapitals und dem internationalen Bankennetz usw. handelt.“45
Die subjektive Situation hatte sich gegenüber dem Krieg des Zarenreichs also geändert. Gab es vor der Februarrevolution keine guten Gründe für die Vaterlandsverteidigung, so änderte sich das mit der Revolution. Aber auch wenn es nun gute Gründe für eine Vaterlandsverteidigung im Auge der Mehrheit der Arbeiter:innen in Russland gab (aktive und mächtige Sowjets, große demokratische Freiheiten, Republik etc.), so brachte das die Bolschewiki nicht dazu, selbst auf die Linie der „revolutionären Vaterlandsverteidigung“ umzuschwenken. In einer Broschüre, in der die Bolschewiki die Positionen der unterschiedlichen Parteien zu unterschiedlichen Fragen darlegen, wird deutlich, wie eng sie die Verbindung von „revolutionärer Vaterlandsverteidigung“ und Unterstützung der bürgerlichen Regierung betrachteten:
„14. Für den jetzigen Krieg oder gegen ihn?“ […] Unbedingt gegen den imperialistischen Krieg überhaupt; gegen alle bürgerlichen Regierungen, die ihn führen; auch gegen unsere Provisorische Regierung; unbedingt gegen die ,revolutionäre Vaterlandsverteidigung’ in Rußland.“46
In den Aprilthesen macht Lenin aber auch deutlich, dass er nicht gegen die „revolutionäre Vaterlandsverteidigung“ als solche ist, sondern dafür gewisse Voraussetzungen gegeben sein müssen:
„In unserer Stellung zum Krieg, der von seiten Rußlands auch unter der neuen Regierung Lwow und Co. – infolge des kapitalistischen Charakters dieser Regierung – unbedingt ein räuberischer, imperialistischer Krieg bleibt, sind auch die geringsten Zugeständnisse an die ‚revolutionäre Vaterlandsverteidigung‘ unzulässig.
Einem revolutionären Krieg, der die revolutionäre Vaterlandsverteidigung wirklich rechtfertigen würde, kann das klassenbewußte Proletariat seine Zustimmung nur unter folgenden Bedingungen geben: a) Übergang der Macht in die Hände des Proletariats und der sich ihm anschließenden ärmsten Teile der Bauernschaft; b) Verzicht auf alle Annexionen in der Tat und nicht nur in Worten; c) tatsächlicher und völliger Bruch mit allen Interessen des Kapitals.“47
Mit dem Forschreiten der Revolution 1917 änderten sich jedoch der Schwerpunkt und die Praxis des revolutionären Defätismus im Vergleich zur vorhergegangenen Phase des Zarismus, in der die Niederlage Russlands „unter allen Umständen“ das kleinere Übel (also auch in einer Situation der militärischen Niederlage gegen Deutschland) gewesen war. Einerseits blieb die strikte Opposition zu jeder Unterstützung der imperialistischen Kriegsführung auch unter einem „demokratischen“ Imperialismus ein Wesensmerkmal seiner Politik. Andererseits galt es auch, deutlich zu machen, welche Politik eine genuine, revolutionäre Regierung der Arbeiter:innen und Bäuer:innen durchführen würde, unter der eine „revolutionäre Vaterlandsverteidigung“ gerechtfertigt wäre. Diese beiden Fragen zogen sich mehr oder weniger ungebrochen bis zur Machteroberung der Bolschewiki im Zuge der Oktoberrevolution durch.
Wir wollen diese Änderung des Schwerpunkts ein bisschen illustrieren. Im Verlauf des Jahres 1917 zeichnete sich ab, dass auch unter der neuen Regierung die russische Armee auf dem Schlachtfeld nicht erfolgreich sein konnte. Die Moral der Truppe nahm beständig ab. In der wohl besten programmatischen Schrift Lenins, die unmittelbar vor der Oktoberrevolution geschrieben wurde, legte er dar, warum die Errichtung der Räteherrschaft und die Überwindung des Kapitalismus am geeignetsten dafür sind, die „drohende Katastrophe“ zu verhindern. In der wohl besten Anwendung der Übergangsmethodik 1917 konnte Lenin das Programm der Bolschewiki mit den unmittelbaren Bedürfnissen der Massen verbinden. Ein wichtiger Fokus war, dass die Rätemacht deutlich besser dafür geeignet wäre, die militärische Verteidigung zu organisieren:
„Die Frage der Maßnahmen zur Bekämpfung der herannahenden Katastrophe führt uns zur Beleuchtung einer anderen, äußerst wichtigen Frage: zur Frage des Zusammenhangs zwischen Innenpolitik und Außenpolitik oder, anders ausgedrückt, des Verhältnisses zwischen einem imperialistischen Eroberungskrieg und einem revolutionären, proletarischen Krieg, zwischen einem verbrecherischen Raubkrieg und einem gerechten demokratischen Krieg.
Alle von uns geschilderten Maßnahmen zur Bekämpfung der Katastrophe würden, wie wir bereits erwähnt haben, die Verteidigungsfähigkeit oder, anders ausgedrückt, die militärische Macht des Landes außerordentlich stärken. Dies einerseits. Doch anderseits kann man diese Maßnahmen nicht in die Tat umsetzen, ohne den Eroberungskrieg in einen gerechten Krieg umzuwandeln, ohne den Krieg, den die Kapitalisten im Interesse der Kapitalisten führen, in einen Krieg umzuwandeln, den das Proletariat im Interesse aller Werktätigen und Ausgebeuteten führt.
In der Tat. Die Nationalisierung der Banken und Syndikate in Verbindung mit der Aufhebung des Geschäftsgeheimnisses und der Arbeiterkontrolle über die Kapitalisten würde nicht nur eine riesige Einsparung von Volksarbeit bedeuten, nicht nur die Möglichkeit bieten, Kräfte und Mittel zu sparen, sie würde auch eine Verbesserung der Lage der arbeitenden Massen der Bevölkerung, der Mehrheit der Bevölkerung bedeuten. […]
Die Verteidigungsfähigkeit, die militärische Macht eines Landes mit nationalisierten Banken, ist größer als die eines Landes, in dem die Banken in Privathänden bleiben. Die militärische Macht eines Bauernlandes, in dem sich der Boden in den Händen von Bauernkomitees befindet, ist größer als die eines Landes mit gutsherrlichem Grundbesitz.“48
Lenin knüpft hier klar und deutlich an der Stimmung der Vaterlandsverteidigung an, zeigt aber gleichzeitig auf, dass sie nur unterstützenswert auf der einen Seite und durchführbar auf der anderen Seite ist, wenn die Macht in die Hände des Proletariats übergeht und der imperialistische Krieg in einen gerechten, revolutionären Krieg verwandelt wird. Das brachte ihn sogar in einer polemischen Rede gegen die Sozialrevolutionär:innen im Laufe der Diskussion über die Friedensverhandlungen von Brest-Litowsk im Frühjahr 1918 zur folgenden Äußerung:
„Aber wie haben wir die Armee zersetzt? Wir waren Defätisten unter dem Zaren, aber unter Zereteli und Tschernow [gemeint ist die provisorische Regierung mit Beteiligung der Menschewiki und Sozialrevolutionär:innen; A. Z.] waren wir keine Defätisten. Wir haben in der ,Prawda’ einen Aufruf veröffentlicht, den Krylenko, damals noch ein Verfolgter, in der Armee verbreiten ließ: ,Warum ich nach Petrograd fahre.‘ Er sagte: ,Wir fordern euch nicht zu Revolten auf.‘ Das war keine Zersetzung der Armee. Die Armee hat diejenigen zersetzt, die diesen Krieg für einen großartigen Krieg ausgaben.“49
Gleichzeitig stellte er aber auch in der Rede auf demselben Kongress klar, dass das nicht bedeutete, dass er damit die Position der Bolschewiki während der Provisorischen Regierung als Vaterlandsverteidigung verstanden sehen möchte:
„Seit dem 25. Oktober [dem Datum der Oktoberrevolution; A. Z.] haben wir offen erklärt, dass wir für die Verteidigung des Vaterlands sind, denn wir haben dieses Vaterland, aus dem wir die Kerenski und Tschernow hinausgejagt haben; denn wir haben die Geheimverträge vernichtet, haben die Bourgeoisie unterdrückt, vorderhand noch schlecht, aber wir werden es lernen, das besser zu machen.“50
1.6 Schlussfolgerungen
Die komplexe Anwendung der Bolschewiki vor und nach der Februarrevolution ist ein wichtiges Beispiel dafür, wie lebendig der Marxismus auf neue Situationen angewandt werden kann und muss. Der revolutionäre Defätismus bezieht sich dialektisch auf die Aufgaben und Entwicklung der Revolution im Krieg – und daher verändert sich notwendigerweise auch seine Akzentuierung mit der Entwicklung der Revolution, der Umwandlung des reaktionären Krieges in einen revolutionären Bürger:innenkrieg. Daher verändert sich auch, wie und in welchem Ausmaß beispielsweise die Niederlage aktiv herbeigeführt wird oder nicht.
Beispielsweise kann es Situationen geben, in denen wir uns nicht nur die Niederlage wünschen, sondern auch praktisch darauf hinarbeiten. Gleichzeitig kann es aber auch Situationen geben, in denen wir deutlich von jeglicher Unterstützung der bürgerlichen Regierung des eigenen Landes absehen, aber gleichzeitig aufzeigen, wie die Machtergreifung des Proletariats einen reaktionären Angriff besser abwehren könnte (wie beispielsweise am eben gezeigten Beispiel Lenins). Wir verstehen den revolutionären Defätismus nicht als simples Schema, das sich schablonenhaft gleichermaßen auf jede Situation anwenden lässt, sondern als Theorie, die unterschiedliche Schwerpunkte je nach konkreter Situation zulässt.
Dabei kann die Politik des Defätismus in wichtigen Aspekten eben auch Elemente der „revolutionären Vaterlandsverteidigung“ (oder wie wir es von hier an weiter als revolutionären Defensismus bezeichnen werden, was unserer Meinung nach der genauere Begriff ist) beinhalten. Wichtig ist aber, dass es im revolutionären Defätismus keinerlei Unterstützung für die jeweilige Regierung geben kann, während es im revolutionären Defensismus unterschiedliche Formen der Zusammenarbeit (von militärischen Absprachen bis hin zu ausgereifteren Formen der antiimperialistischen Einheitsfront) geben kann. Diese Annäherung der Taktiken an reale Situationen (wie beispielsweise in einer Situation der Doppelmacht mit großen demokratischen Freiheiten bei einer gleichzeitig stark geschwächten Bourgeoisie) ist auch nicht weiter verwunderlich; dasselbe gilt auch bei anderen Theorien. Beispielsweise geht die allgemeine Relativitätstheorie bei schwachen Gravitationsfeldern und niedrigen Geschwindigkeiten in die Newton’sche Gravitationstheorie über, genauso wie die allgemeine Relativitätstheorie bei schwachen Gravitationsfeldern, kleinen Distanzen und freiem Fall in die spezielle Relativitätstheorie übergeht. Newton’sche Gravitation und spezielle Relativitätstheorie sind eben nur spezifische Ausdrücke ein und derselben übergreifenden Theorie. Genauso sind eben revolutionärer Defätismus und revolutionärer Defensismus konkrete Ausdrücke ein und derselben marxistischen Theorie der Kriegstaktik.
Exkurs: Revolutionärer Defensismus
Wir wollen an dieser Stelle nur kurz das Konzept des revolutionären Defensismus diskutieren. Als Gegenstück zum revolutionären Defätismus ist es zwar nicht Hauptthema dieser Diskussion, bietet doch als sein Gegenstück einen wesentlichen Beitrag zur Abgrenzung und Definition des revolutionären Defätismus. Als revolutionäre Kommunist:innen wenden wir den revolutionären Defensismus in Kriegen an, die einen gerechtfertigten Charakter tragen. Klassische Beispiele dafür sind beispielsweise die Verteidigung Chinas gegen den reaktionären Angriff des japanischen Imperialismus 1937 oder die Verteidigung der Sowjetunion im 2. Weltkrieg gegen Nazideutschland. Wesentlich ist hierbei, dass nicht der Charakter des politischen Regimes entscheidend ist (ob demokratisch oder autoritär), sondern die grundlegende Stellung der kriegführenden Staaten. Im Normalfall verteidigen wir (halb)koloniale Staaten oder (degenerierte) Arbeiter:innenstaaten gegen Angriffe des Imperialismus. Das bedeutet aber nicht, dass wir deswegen unsere grundlegende Kritik am herrschenden Regime (beispielsweise die stalinistische Diktatur oder die nationalistische Diktatur Chiang Kai-sheks [auch: Tschiang Kai-scheks]) einstellen würden.
Vielmehr geht es beim revolutionären Defensismus darum, in einem gerechten Krieg die falsche und reaktionäre Führung herauszufordern und vor den Augen der Massen die Überlegenheit einer revolutionären Methode für den gerechten Krieg aufzuzeigen, und so ist er damit in gewisser Weise der Einheitsfrontpolitik sehr ähnlich. Das kann sich auch auf Bürger:innenkriege beziehen wie beispielsweise den spanischen Bürger:innenkrieg wo die Trotzkist:innen auf Seiten der letztlich bürgerlichen spanischen Republik gekämpft haben, ohne wie viele andere Kräfte in die bürgerliche Regierung einzutreten oder sie politisch zu unterstützen. Zentral bleibt dabei aber, dass Revolutionär:innen nicht in bürgerliche Regierungen eintreten oder bürgerliche (bzw. stalinistische) Regime politisch unterstützen.
Interessant ist hierbei zu erwähnen, dass es keineswegs eine rein schematische Sicht ist, die die Frage beantwortet, in welchen Fällen revolutionärer Defätismus oder revolutionärer Defensismus anzuwenden sind. Lenin ordnete beispielsweise 1914 die gerechtfertigten Interessen Serbiens gegenüber Österreich-Ungarn dem allgemeinen Aspekt des imperialistischen 1. Weltkriegs unter51. Gleichzeitig erwähnte er, dass es selbst während des imperialistischen Weltkriegs auch legitime nationale (antikoloniale bzw. antiimperialistische) Aufstände geben kann, wie beispielsweise potenziell in Marokko, China, Indien und Persien oder der Osteraufstand in Irland)52.
Wesentlich bei der Politik des revolutionären Defensismus ist einerseits die vom Charakter des jeweiligen Regimes unabhängige Verteidigung im entsprechenden gerechten Krieg. Wir hätten beispielsweise im Kalten Krieg die degenerierten Arbeiter:innenstadten trotz der stalinistischen Diktatur bedingungslos gegen den (bürgerlich‑)demokratischen westlichen Kapitalismus in einem offenen Krieg verteidigt. Gleichzeitig treten revolutionäre Kommunist:innen für eine Politik der Formierung der eigenen Klasse ein. So treten wir für das Recht auf demokratische Organisierung der Soldat:innen ein und befürworten klassenkämpferische Methoden der Verteidigung, beispielsweise Antikriegspropaganda unter den Besatzungssoldat:innen, die „Verbrüderung“ an der Front oder die Arbeiter:innenkontrolle über die Kriegsproduktion.
2. Revolutionärer Defätismus nach der Oktoberrevolution
Nach der Oktoberrevolution, als sich für Sowjetrussland die Frage des revolutionären Defätismus nicht mehr stellte, weil die Macht in die Hände des revolutionären Proletariats und der armen Bauern- und Bäuerinnenschaft übergegangen war, verlor die Frage des revolutionären Defätismus erst mal an Bedeutung. Nichtsdestotrotz verschwand der Begriff nicht aus Lenins Vokabular, wie manche Kritiker:innen53 des revolutionären Defätismus behaupten würden. Beispielsweise freut sich Lenin in einer Rede im August 1918 darüber, dass „[in] Deutschland […] schon eine ‚defätistische‘ Bewegung begonnen [hat], so wie wir sie bei uns hatten […].“54. Nichtsdestotrotz fand der Begriff bei Lenin nach dem Krieg in einem geschlossenen und vollständigen Rahmen (wie so viele andere Themenbereiche) keine gesonderte Aufarbeitung.
2.1 Komintern und revolutionärer Defätismus
In der revolutionären Phase der Komintern, die leider durch die Degeneration der Sowjetunion schon Anfang der 1920er Jahre beendet wurde, gab es keine wirkliche systematische Auseinandersetzung mit der Frage der Kriegstaktik oder des revolutionären Defätismus. Das ist auch nicht weiter verwunderlich, war doch der imperialistische Weltkrieg vorbei und die revolutionären Nachkriegsjahre brachten andere Prioritäten mit sich. Erst in der beginnenden Auseinandersetzung nach Lenins Tod kam das Thema des Defätismus wieder auf. In der zweiten Ausgabe des Theoriejournals der Komintern „Kommunistische Internationale“ nach Lenins Tod gab es einen Artikel, der sich mit dem revolutionären Defätismus beschäftigte. Anlässlich Lenins Tod beschäftigte sich der ehemalige Menschewik Martynow, der von seinem Beitritt zur KPdSU 1923 bis zu seinem Tod glühender Stalinist war, mit dem Vermächtnis Lenins. Er griff dabei auch direkt Trotzkis Position im Krieg (der Lenin vorgeworfen hatte, sein Defätismus wäre nur umgestülpter Sozialchauvinismus) an:
„Gegen diesen Verrat erhob sich von Kriegsbeginn an nicht nur Lenin allein; auch die internationalistischen Minderheiten der verschiedenen sozialistischen Parteien nahmen gegen den Krieg Stellung. Aber die Parolen, die Lenin damals verkündete, waren so mutig, so tollkühn, daß sie nicht nur im Gegensatz zu den Anschauungen aller Sozialpatrioten, sondern auch zu denen aller Internationalisten standen. […] Jede der sozialistischen Parteien fürchtete, daß, falls sie auf den Krieg mit einer Revolution antwortete, ohne daß diese Revolution auf das Nachbarland übergriff, ihr eigenes Vaterland und alle jene Werte, die das Proletariat in seinem langjährigen Kampfe aufgehäuft hat, zerstört werden würde. […] Diese ,Niederlagentheorie’ stieß auf einen Protest nicht nur bei den Sozialpatrioten, sondern auch bei allen Internationalisten, die radikalsten unter ihnen mit einbegriffen, wie beispielsweise Trotzki. […] Heute ist es wohl allen klar, daß diese Anklage haltlos war. Lenin forderte vom russischen Proletariat, die Initiative der Revolution zu ergreifen, weil diese in Rußland leichter durchuzführen war, weil die russische Bourgeoisie und der russische Staat unfähig waren, der Revolution einen gleich starken Widerstand entgegenzusetzen wie die westeuropäischen Staaten, […].“55
Später versuchte Sinowjew, der zum damaligen Zeitpunkt gemeinsam mit Kamenew und Stalin die Troika gegen Trotzki bildete, in „War & Leninism“ die Position Lenins während des Krieges zu beschreiben. Auch hier – diesmal aber nur indirekt – wurde Trotzki kritisiert.56
Doch im Gegensatz zu Angriffen auf andere Teile seiner Differenzen mit Lenin, wie beispielsweise die Auseinandersetzung rund um die Theorie der permanenten Revolution, hielt sich Trotzki nicht groß mit der Debatte dazu auf. Es gibt keine ausführliche Auseinandersetzung mit dem Thema bei Trotzki aus dieser Zeit. Nichtsdestotrotz gibt es zumindest einen Kommentar von ihm zu diesem Thema einige Jahre später. In der Zeit des zugespitztesten innerparteilichen Kampfes Mitte 1927 thematisierte er kurz den revolutionären Defätismus. In einer Rede vor der gemeinsamen Sitzung des Zentralkomitees und des zentralen Kontrollkomitees der KPdSU äußerte er sich zur Frage des revolutionären Defätismus folgendermaßen:
„Ich sehe mich gezwungen, mit einem Punkt zu beginnen, der mich persönlich betrifft: Ich sehe mich gezwungen, die unsinnige Behauptung zurückzuweisen, dass ich die Politik des Defätismus für die bürgerlichen Länder ablehne, insbesondere unter den Bedingungen ihres Kampfes gegen die UdSSR. Die Thesen des Politbüros versuchen, durch Aufblähung, Übertreibung, Verzerrung bis hin zur Karikatur die längst überwundenen Differenzen wieder aufleben zu lassen, die mich in bestimmten Fragen während des imperialistischen Krieges von Wladimir Iljitsch trennten und in denen das Unrecht auf meiner Seite lag. Meine Abweichungen von Lenin (ich wiederhole hier, was ich vor dem Exekutivkomitee der Komintern gesagt habe) in diesen Fragen waren nicht einmal ein Zehntel so groß wie die heutigen Abweichungen von Stalin, Woroschilow und anderen!“57
Auch in seiner ausführlichen „Geschichte der russischen Revolution“, die Trotzki in seinem türkischen Exil in Prinkipo (heute Büyükada), wo er sich nach seiner Verbannung aus der UdSSR Anfang 1929 aufhielt, erarbeitete, schreibt er über die defätistische Politik der Bolschewiki:
„Die bolschewistische Dumafraktion, schwach in der personellen Zusammensetzung, zeigte sich im Augenblick des Kriegsbeginns nicht auf der Höhe. Gemeinsam mit den menschewistischen Deputierten brachte sie eine Deklaration ein, in der sie sich verpflichtete, ,das kulturelle Wohl des Volkes gegen jeden Anschlag, woher er auch kommen möge, zu verteidigen’. Mit Beifall unterstrich die Duma diese Preisgabe der Position. Von den russischen Organisationen und Gruppen der Partei bezog keine einzige eine offen defätistische Stellung, wie sie Lenin im Ausland proklamierte. Indes erwies sich der Prozentsatz an Patrioten unter den Bolschewiki als geringfügig. Im Gegensatz zu den Narodniki und Menschewiki begannen die Bolschewiki bereits seit dem Jahre 1914 in den Massen schriftliche und mündliche Agitation gegen den Krieg zu entfalten.“58
Insbesondere kritisierte er auch die Politik der weiter oben schon erwähnten Prawda-Redaktion aus Stalin, Kamenew und Muranow nach der Februarrevolution:
„Im Programmartikel der neuen Redaktion wurde verkündet, die Bolschewiki würden die Provisorische Regierung entschieden unterstützen, ,insofern sie gegen Reaktion und Konterrevolution kämpft’. In der Frage des Krieges sprachen sich die neuen Leiter nicht weniger kategorisch aus: solange die deutsche Armee ihrem Kaiser gehorcht, müßte ,der russische Soldat „fest auf seinem Posten stehen, Kugel mit Kugel und Geschoß mit Geschoß beantworten’. ,Nicht das inhaltlose ‚Nieder mit dem Krieg‘ ist unsere Losung. Unsere Losung ist – der Druck auf die Provisorische Regierung mit dem Ziele, sie zu zwingen … mit einem Versuch hervorzutreten, alle kämpfenden Länder zur sofortigen Aufnahme von Friedensverhandlungen zu bewegen … Bis dahin bleibt aber jeder auf seinem Kampfposten! Idee wie Formulierung sind durch und durch im Geiste der Landesverteidigung. In ihrer Verteidigung vor der patriotischen Presse ging die Prawda noch weiter: ,Jeglicher ‚Defätismus‘, schrieb sie, ,oder richtiger das, was die nicht sehr wählerische Presse unter dem Schutze der zaristischen Zensur mit diesem Namen brandmarkte, starb in dem Augenblick, als in den Straßen Petrograds das erste revolutionäre Regiment erschien.‘ Das war direkt Abgrenzung gegen Lenin. Der ,Defätismus’ war keinesfalls eine Erfindung der feindlichen Presse unter dem Schutze der Zensur, er wurde von Lenin mit der Formel gegeben: ,Die Niederlage Rußlands ist das kleinere Übel.‘ Das Erscheinen des ersten revolutionären Regiments und sogar der Sturz der Monarchie änderte an dem imperialistischen Charakter des Krieges nichts“.59
Das Programm des Druckes auf die imperialistische Regierung mit dem Ziele, diese zur friedlichen Handlungsweise „zu bewegen“, war das Programm Kautskys in Deutschland, Jean Longuets in Frankreich, MacDonalds in England, keinesfalls aber das Programm Lenins, der zur Niederwerfung der imperialistischen Herrschaft aufrief. Trotzki nahm also – ähnlich wie in anderen Fragen, beispielsweise der des demokratischen Zentralismus oder klaren Abgrenzung gegen alle Formen des (Links-)Reformismus und Zentrismus – hier weitgehend Lenins Position an. Aber natürlich nicht in der knöchernen Form, wie sie Sinowjew und andere formulierten, sondern in der kreativen und lebendigen Anwendung, wie sie bei Lenin ihren Ausdruck fand.
2.2 Revolutionärer Defätismus und Vierte Internationale
Nachdem sich die Internationale Linke Opposition nach der Machtübernahme Hitlers und der Unfähigkeit der Komintern, sich angesichts dieser katastrophalen Niederlage der stärksten kommunistischen Partei (KPD) außerhalb der Sowjetunion selbstkritisch zu hinterfragen, auf den Aufbau eigenständiger kommunistischer Organisationen und den Aufbau einer neuen Internationale orientierte, gab es auch erneute Diskussionen zur Frage des revolutionären Defätismus. Die stalinistische Komintern, die Ende der 1920er Jahre den revolutionären Defätismus noch in ihre Programmatik aufgenommen hatte, verabschiedete sich Mitte der 1930er Jahre und im Zuge der Volksfrontpolitik aber immer mehr von dieser Politik.
Währenddessen gab es zur Frage des revolutionären Defätismus neue Debatten in der Vierten Internationale. Im Sommer 1934 veröffentlichte die Internationale Kommunistische Liga (wie die internationale Strömung der Trotzkist:innen ab 1933 hieß) ein zentrales Dokument zu dieser Frage, „Krieg und die Vierte Internationale“, das von Trotzki geschrieben wurde. Im Zuge der Diskussion des Dokuments traten einige Differenzen zu Tage, die sich um die Frage des (revolutionären) Defätismus drehten.60 Es gab hier offenbar in erster Linie vom deutschen Trotzkisten Eugen Bauer (Erwin Heinz Ackerknecht) Kritik daran, dass sich Trotzki zu sehr vom revolutionären Defätismus entfernen würde. Dieser antwortete wiederum, dass die Reduktion des Defätismus auf den Wunsch nach Niederlage ohne Beschreibung, was das für die revolutionäre Praxis bedeutet, nicht brauchbar sei. Obwohl Trotzki in „Krieg und die Vierte Internationale“ den Begriff des revolutionären Defätismus noch nicht verwendet61, nützt er ihn doch in den folgenden Jahren explizit. Die Frage, wie wichtig hierbei die Kritik von beispielsweise Eugen Bauer war, können wir mit den uns zugänglichen Primärquellen leider nicht endgültig klären.62 In „Lernt Denken“63 beispielsweise fasst Trotzki sein Verständnis des revolutionären Defätismus kurz und bündig zusammen:
„Der revolutionäre Defätismus bedeutet lediglich, dass die proletarische Partei sich im Klassenkampf keinen ‚patriotischen‘ Überlegungen beugt, da die Niederlage ihrer eigenen imperialistischen Regierung, von der revolutionären Massenbewegung ausgelöst oder beschleunigt, ein unvergleichlich kleineres Übel ist als der Sieg um den Preis der nationalen Einheit, d. h. der politischen Demütigung des Proletariats. Hierin liegt die gesamte Bedeutung des Defätismus, und diese Bedeutung reicht völlig aus.“
2.3 Am Vorabend des Zweiten Weltkriegs
Wie schon weiter oben angedeutet, war bildete für Trotzki einen zentralen Faktor für die unterschiedliche Ausprägung des revolutionären Defätismus die Frage der Stellung der imperialistischen Nationen zum damals einzigen (degenerierten) Arbeiter:innenstaat, der Sowjetunion. Wir werden das hier noch einmal sehr deutlich an ein paar Beispielen zeigen, um diesen Grundsatz noch einmal klar zu verdeutlichen.
In der Dewey-Kommission, die 1937 anlässlich der Moskauer Prozesse die Anschuldigungen gegen Trotzki untersuchte, wird dieser danach gefragt, wie er zur Verteidigung der Sowjetunion und insbesondere zur Politik in den mit der Sowjetunion verbündeten Staaten steht:
„Stolberg [Teil der Dewey-Kommission; A. Z]: […] Russland und Frankreich haben bereits ein militärisches Bündnis [gemeint ist der sowjetisch-französische Beistandsvertrag 1935; A. Z]. Angenommen, ein internationaler Krieg bricht aus. […] Was würden Sie der französischen Arbeiterklasse in Bezug auf die Verteidigung der Sowjetunion sagen? ,Ändert die französische bürgerliche Regierung’, würden Sie sagen?
Trotzki: Diese Frage wird mehr oder weniger in meinen Thesen ,Der Krieg und die Vierte Internationale’ in folgendem Sinne beantwortet: In Frankreich würde ich in Opposition zur Regierung bleiben und diese Opposition systematisch entwickeln. In Deutschland würde ich alles tun, was ich kann, um die Kriegsmaschinerie zu sabotieren. Das sind zwei verschiedene Dinge. In Deutschland und in Japan würde ich militärische Methoden anwenden, soweit es mir möglich ist, die Maschinerie, die militärische Maschinerie Japans, zu bekämpfen, mich ihr zu widersetzen und sie zu verletzen, um sie zu desorganisieren, sowohl in Deutschland als auch in Japan. In Frankreich geht es um politischen Widerstand gegen die Bourgeoisie und die Vorbereitung der proletarischen Revolution. Beides sind revolutionäre Methoden. Aber in Deutschland und Japan habe ich als unmittelbares Ziel die Desorganisation der gesamten Maschinerie. In Frankreich habe ich das Ziel der proletarischen Revolution.“64
Hier fällt klar ins Auge, dass Trotzki die Taktik in Frankreich und Deutschland (bzw. Japan) sehr deutlich unterscheidet. Wichtig ist, dass er hier nicht in erster Linie beurteilt, ob es sich bei den kriegführenden Ländern um Demokratien oder Diktaturen handelt. Er macht dies auch recht deutlich daran, dass er einen Sieg Frankreichs über Nazideutschland nur für möglich hält durch einen massiven Ausbau der Militärmaschinerie und der damit verbundenen Tendenzen in Richtung Faschismus. Ein Sieg über Deutschland könnte, so Trotzki, die Errichtung des Faschismus in Frankreich bedeuten. Ganz offensichtlich kam es in der Geschichte anders, aber die unzweideutige Ablehnung eines Bündnisses mit einem (wenn auch demokratischeren) Teil der imperialistischen Bourgeoisie trat bei Trotzki immer klar und deutlich hervor.
Wenige Zeit später schrieb Trotzki für die Vierte Internationale das Übergangsprogramm65. In ihm legt er nur recht kurz die Herangehensweise der Kommunist:innen der Vierten Internationale gegenüber Kriegen zwischen unterschiedlichen Staaten fest, er lehnt sich dabei eng an die Formulierungen bei Lenin an:
„Deshalb wird der nächste Krieg seinem Grundcharakter nach ein imperialistischer Krieg sein. Der wesentliche Inhalt der Politik des internationalen Proletariats wird somit der Kampf gegen den Imperialismus und seinen Krieg sein. Der Grundsatz dieses Kampfes wird lauten: ,Der Hauptfeind steht im eigenen Land’ oder ,Die Niederlage der eigenen (imperialistischen) Regierung ist das kleinere Übel’.
Aber nicht alle Länder der Welt sind imperialistische Länder. Im Gegenteil, die meisten sind Opfer des Imperialismus. Einige koloniale oder halbkoloniale Länder werden ohne Zweifel den Krieg zu dem Versuch auszunützen, das Sklavenjoch abzuwerfen. Auf ihrer Seite wird der Krieg kein imperialistischer, sondern ein Befreiungskrieg sein. Die Pflicht des internationalen Proletariats wird es sein, den unterdrückten Ländern im Krieg gegen ihre Unterdrücker beizustehen. Diese Pflicht erstreckt sich auch auf die Sowjetunion oder jeden anderen Arbeiterstaat, der vor oder während des Krieges entstehen mag. Die Niederlage jeder imperialistischen Regierung im Kampf gegen einen Arbeiterstaat oder ein Kolonialland ist das kleinere Übel.“66
Hier wird der Unterschied zwischen dem Defätismus in einem innerimperialistischen Krieg und demselben in einem imperialistischen Krieg gegen einen Arbeiter:innenstaat oder ein Kolonialland noch etwas wenig herausgearbeitet. In einem innerimperialistischen Krieg ist der revolutionäre Defätismus auf Seiten aller imperialistischen Länder die prinzipienfeste Herangehensweise von Revolutionär:innen. Wie wir weiter oben an unterschiedlichen Stellen schon gezeigt haben, kann er durchaus unterschiedliche Ausprägungen annehmen. Wenn aber beispielsweise ein imperialistisches Land gegen einen Arbeiter:innenstaat Krieg führt, steht außer Frage, dass Revolutionär:innen nicht nur die Niederlage in Kauf nehmen, sondern sie auch aktiv herbeiführen wollen, um den Sieg des Arbeiter:innenstaates zu begünstigen.
Diese allgemeine Herangehensweise und die revolutionären Prinzipien während eines Krieges unter Beteiligung zumindest eines imperialistischen Landes sollten dann in den Jahren, die der Gründung der Vierten Internationale folgten, auch praktische Konsequenzen haben.
2.4 Proletarische Militärpolitik und die Rolle der Partisan:innenbewegung
Der Zweite Weltkrieg kam für kaum jemanden unerwartet. Ende der 1930er Jahre zeichnete sich eine immer stärkere Militarisierung der imperialistischen Staaten ab. Alle erhöhten massiv ihre Militärausgaben, die Wehrpflicht wurde teilweise eingeführt (Großbritannien, Deutschland) oder verlängert (Frankreich). In dieser Situation sah sich die trotzkistische Bewegung damit konfrontiert, wie man mit dieser Entwicklung umgehen wollte.
Demgegenüber entwickelten die Trotzkist:innen die sogenannte Proletarische Militärpolitik. Sie erkannten im Angesicht des schier unaufhaltsamen Anstiegs von Militarisierung sowie der drohenden Kriegsgefahr die Notwendigkeit, hier eine konkrete Antwort zu geben. Die grundlegende Herangehensweise war, dass man sich den objektiven Entwicklungstendenzen nur begrenzt entgegenstellen konnte (insbesondere im Angesicht der eigenen Schwäche) und deshalb die Trotzkist:innen die Frage aufwerfen sollten, welche Klasse die Kontrolle über die Militarisierung ausüben sollte. In der von der US-amerikanischen Sektion der Vierten Internationale 194067 beschlossenen „Resolution über die Proletarische Militärpolitik“ fasst sie ihre allgemeine Herangehensweise folgendermaßen zusammen:
„Der imperialistische Krieg ist nicht unser Krieg und der Militarismus des kapitalistischen Staates ist nicht unser Militarismus. Wir unterstützen den Krieg und den Militarismus der Imperialist:innen genauso wenig, wie wir die kapitalistische Ausbeutung der Arbeiter:innen in den Fabriken unterstützen. Wir sind gegen den Krieg als Ganzes, genauso wie wir gegen die Herrschaft der Klasse sind, die ihn führt, und unter keinen Umständen stimmen wir dafür, ihr irgendein Vertrauen in ihre Kriegsführung oder Kriegsvorbereitung zu geben: keinen Mann, keinen Cent, keine Waffe mit unserer Unterstützung. Unser Krieg ist der Krieg der Arbeiter:innenklasse gegen die kapitalistische Ordnung. Aber nur mit den Massen ist es möglich, die Macht zu erobern und den Sozialismus zu errichten. Und in diesen Zeiten sind die Massen in den militärischen Organisationen dazu bestimmt, die entscheidendste Rolle von allen zu spielen. Folglich ist es unmöglich, den Lauf der Dinge durch eine Politik der Enthaltung zu beeinflussen. Es ist notwendig, den kapitalistischen Militarismus als eine etablierte Realität zu betrachten, für deren Abschaffung wir noch zu schwach sind, und unsere praktischen Taktiken daran anzupassen. Unsere Aufgabe ist es, die Klasseninteressen der Arbeiter:innen in der Armee nicht weniger zu verteidigen als in der Fabrik. Das bedeutet, sich an der Militärmaschinerie für sozialistische Zwecke zu beteiligen. Die proletarischen Revolutionär:innen sind verpflichtet, in den militärischen Ausbildungslagern und auf den Schlachtfeldern ihren Platz an der Seite der Arbeiter:innen einzunehmen, genauso wie in der Fabrik. Sie stehen Seite an Seite mit den Massen der Arbeitersoldat:innen, vertreten zu jeder Zeit und unter allen Umständen den unabhängigen Klassenstandpunkt und bemühen sich, die Mehrheit für die Idee zu gewinnen, den Krieg in einen Kampf für ihre sozialistische Emanzipation umzuwandeln. […]
Die revolutionäre Strategie kann nur darin bestehen, diesen Militarismus als Realität zu nehmen und dem Programm der Imperialist:innen in jedem Punkt ein Klassenprogramm des Proletariats entgegenzustellen. Wir kämpfen dagegen, die Arbeitersoldat:innen ohne angemessene Ausbildung und Ausrüstung in die Schlacht zu schicken. Wir wenden uns gegen die militärische Führung der Arbeitersoldat:innen durch bürgerliche Offizier:innen, die keine Rücksicht auf ihre Behandlung, ihren Schutz und ihr Leben nehmen. Wir fordern Bundesmittel für die militärische Ausbildung der Arbeiter:innen und Arbeiteroffizier:innen unter Kontrolle der Gewerkschaften. Militärische Mittel? Ja – aber nur für die Einrichtung und Ausstattung von Arbeiter:innenausbildungslagern! Obligatorische militärische Ausbildung der Arbeiter:innen? Ja – aber nur unter der Kontrolle der Gewerkschaften!“68
Hier sehen wir schon die Ähnlichkeit mit der Herangehensweise von Lenin nach der Februarrevolution, als er hervorhob, dass man den „Krieg, den die Kapitalisten im Interesse der Kapitalisten führen, in einen Krieg um[…]wandeln [solle], den das Proletariat im Interesse aller Werktätigen und Ausgebeuteten führt.“69 Diese Herangehensweise war auch im Einklang mit Trotzkis Position, der wenige Wochen zuvor seine Einschätzung den britischen Trotzkist:innen geschildert hatte:
„Wir sind absolut für eine obligatorische militärische Ausbildung und ebenso für die Wehrpflicht. Wehrpflicht? Ja. Durch den bürgerlichen Staat? Nein. Wir können diese Arbeit, wie jede andere, nicht dem Staat der Ausbeuter:innen anvertrauen. In unserer Propaganda und Agitation müssen wir diese beiden Fragen sehr stark voneinander abgrenzen. Das heißt, dass wir nicht gegen die Notwendigkeit kämpfen, dass die Arbeiter:innen gute Soldat:innen sind und eine Armee aufbauen, die auf Disziplin, Wissenschaft, starken Körpern usw. basiert, einschließlich der Wehrpflicht, sondern gegen den kapitalistischen Staat, der die Armee zum Vorteil der Ausbeuter:innenklasse missbraucht.“70
Leider vermischten die Trotzkist:innen nach Trotzkis Tod recht bald die Frage der Stellung zur Militarisierung mit ihrer zum Krieg. Insbesondere die US-amerikanischen Trotzkist:innen unter James P. Cannon sollten bald die kompromisslose Haltung gegen den Krieg der eigenen imperialistischen Bourgeoisie aufgeben bzw. unklar beantwortet lassen.71
Grundsätzlich verstehen wir die Proletarische Militärpolitik als spezifische Taktik in einer konkreten historischen Situation (die natürlich in der einen oder anderen Form auch wieder auftreten kann und wird), die aber nicht im Widerspruch zur Politik des revolutionären Defätismus steht. Sie sollte nicht verstanden werden als Anwendung einer Burgfriedenspolitik mit ein paar Kritikpunkten an der Kriegsführung der Bourgeoisie. Vielmehr muss sie immer verbunden werden mit einer kompromisslosen Ablehnung der Interessen und Methoden der „eigenen“ Bourgeoisie mit dem Ziel der Umwandlung des imperialistischen Kriegs in einen Klassenkrieg gegen sie.
An dieser Stelle wollen wir kurz begründen, warum wir in bestimmten Situationen den Begriff des Klassenkriegs verwenden, also eine andere Formulierung als die klassische leninistische, der von der Umwandlung des imperialistischen Kriegs in einen Bürgerkrieg spricht. In etlichen imperialistischen Ländern haben wir es heute mit der Vorbereitung zum imperialistischen Krieg, also noch nicht mit einem direkten Krieg zu tun. Die Aufgabe besteht darin, den Krieg selbst zu verhindern – und das heißt, den Klassenkampf gegen die herrschende Klasse unversöhnlich zu führen und damit den Klassenkrieg vorzubereiten – eine Form des Klassenkampfes, die wesentlich dem Leninschen Begriff des Bürger:innenkriegs entspricht, uns aber in der aktuellen Lage vermittelter zu sein scheint, sofern der Begriff „Klassenkrieg“ nicht einfach als Synonym mit dem Begriff Klassenkampf verstanden wird.
3. Revolutionärer Defätismus nach Trotzki
Nach Trotzkis Tod und der Übernahme von Kontinentaleuropa durch den Faschismus zerbrach die Vierte Internationale weitgehend. Die damals wichtigste Sektion – die US-amerikanische Socialist Workers’ Party (SWP) – entzog sich weitgehend ihrer Verantwortung, die Führungsrolle in der Vierten Internationale zu übernehmen, und kam auch selbst in wesentlichen Aspekten von der revolutionären Linie ab. Während des Kriegs spielten Trotzkist:innen keine entscheidende Rolle, auch wenn sie heroische Arbeit gegen Faschismus und Krieg leisteten.72 Während des Krieges gab es sowohl Sektionen, die opportunistische als auch sektiererische Fehler begingen. Dennoch stellte die Fähigkeit der Vierten Internationale, sich während des Krieges in Europa auch unter der faschistischen Herrschaft zu reorganisieren, eine historische Leistung dar. Eine der wenigen, aber umso maßgeblicheren revolutionären Proklamationen der Vierten Internationale während des Krieges, die auf einer geheimen Konferenz der europäischen Sektionen der Vierten Internationale im von Hitler-Deutschland besetzten Frankreich 1944 beschlossen wurde, waren die „Thesen zur Liquidierung des Zweiten Weltkrieges und zum revolutionären Aufschwung“.
In ihnen umreißen die Trotzkist:innen nicht nur ihre allgemeine Herangehensweise an den Krieg, sondern auch ihre konkreten Taktiken gegenüber der immer stärker werdenden Partisan:innenbewegung in Europa. In Bezug auf die allgemeine Charakterisierung wurde die Position bestätigt, dass es sich beim Krieg um einen imperialistischen Krieg handelte. Darüber hinaus wurde auch weiterhin die Verteidigung der Sowjetunion als degenerierter Arbeiter:innenstaat betont. Für die Arbeit in der Sowjetunion wurde die Losung nach einer Einheitsfront mit der sowjetischen Führung mit den Forderungen nach demokratischen Rechten sowie der Perspektive einer politischen Revolution verknüpft:
„[Klassenbewusste Arbeiter:innen] fordern die Abschaffung der Privilegien der Bürokratie, die Freiheit der Arbeiter:innenpresse, die Legalisierung der Sowjetparteien, die Unabhängigkeit der Gewerkschaften vom Staat, ihre Demokratisierung, die gnadenlose Unterdrückung von Horten, Spekulation und Wucher, die Ausrichtung der Wirtschaft auf die Bedürfnisse der werktätigen Massen.
Dieser Kampf wird nicht nur in Worten geführt, sondern im Rahmen einer systematischen Klassenaktion einschließlich der politischen Revolution zum Sturz der Macht der Bürokratie.
Die Erfordernisse der sowjetischen Verteidigung müssen, im Gegensatz zu unserer Politik in einem kapitalistischen Staat, im Hinblick auf die Entwicklung der politischen Revolution berücksichtigt werden und zeigen heute die Notwendigkeit einer ,Einheitsfront’ mit der thermidorianischen Partei der Bürokratie gegen die imperialistische Offensive. Dies bedeutet jedoch nicht, dass wir auf die politische Revolution verzichten, denn letztlich kann nur das Proletariat an der Macht die UdSSR wirksam verteidigen, ihre Wirtschaft wieder aufbauen und die Massen für die von ihnen erbrachten Opfer entschädigen.“73
Hier wird auch deutlich, wie sich die Taktik in der Sowjetunion von der in den Ländern des „demokratischen“ Imperialismus unterscheidet. Während in der Sowjetunion ihre Verteidigung an oberster Stelle stand, stand in den Ländern des „demokratischen“ Imperialismus die Opposition gegen die eigene Bourgeoisie an oberster Stelle.
Aber auch hier musste auf konkrete Massenphänomene wie die Partisan:innenbewegung Rücksicht genommen werden, auch wenn die Partisan:innenverbände in der Regel objektiv im Interesse des „demokratischen“ Imperialismus handelten:
„Die Beteiligung der Massen ändert natürlich nichts an der objektiven Rolle der militärischen Organisationen, die vor dem angloamerikanischen Imperialismus buckeln und in die die meisten Partisan:innenbewegungen kanalisiert wurden. Aber sie verändert mehrere Merkmale des Kampfes:
Sie führt dazu, dass bewaffnete Massen, die dazu neigen, im Einklang mit ihren eigenen objektiven Klasseninteressen zu handeln, in die politische Arena eintreten.
Durch die Mobilisierung eines wichtigen Teils der aktiven Kräfte der Arbeiter:innenklasse und der kleinbürgerlichen Jugend stellt sich die brennende Frage: Wird diese Jugend die Revolution oder die reaktionärsten Kräfte des Imperialismus unterstützen?
In den kommenden revolutionären Entwicklungen, in dem sich entwickelnden Chaos, können diese kleinen Armeen, die auf strategische Punkte gerichtet sind, eine wichtige Rolle für oder gegen die Arbeiter:innenklasse und die Revolution spielen.
[…] Daher können sich die Bolschewiki-Leninist:innen heute nicht damit begnügen, diese Organisationen als im Interesse des Imperialismus arbeitend anzuprangern. Sie können sich nicht darauf beschränken, den Arbeiter:innen gegenüber die Priorität der Fabrikarbeit zu betonen. Sie müssen gleichzeitig mit ihrer eigenen Politik in die Reihen der Partisan:innen eindringen, um die in ihnen schlummernden revolutionären Kräfte auf einer klassenpolitischen und organisatorischen Grundlage zu organisieren.
Mit diesem Ziel vor Augen entwickeln sie das folgende Programm:
a) Sie müssen begreifen, dass es ihre Aufgabe ist, die Rolle von bewaffneten Abteilungen im Dienste der proletarischen Revolution zu spielen, Vorläuferinnen der Arbeiter:innemilizen, und nicht die von Nachfolgerinnen der imperialistischen Armee.
b) Sie organisieren sich, wo immer möglich, unabhängig und auf demokratischer Grundlage unter Ausschluss aller bürgerlichen oder reaktionären Elemente.
c) Sie organisieren sich in den Reihen der militärischen Organisationen, die von der nationalen Einheit der antideutschen Bourgeoisie und den Stalinist:innen kontrolliert werden, als geheime Fraktionen mit eigener Disziplin, die fest darauf ausgerichtet sind, mit diesen Organisationen im günstigsten oder notwendigsten Moment zu brechen.
d) Sie lehnen die Politik der (willkürlichen) Ermordung deutscher Soldat:innen, jeden Sabotageakt, auch militärischer Art, der einen Bruch zwischen den einheimischen Arbeiter:innen und den (einfachen) deutschen Soldat:innen schafft, rundweg ab;
e) Sie müssen sich der Kontrolle und politischen Führung der proletarischen Bewegung unterwerfen. Sie unterstützen die Kämpfe der Arbeiter:innen mit Mitteln, die der allgemeinen und örtlichen Situation angemessen sind. Sie verbinden die Partisan:innentätigkeit mit derjenigen in den Betrieben. Sie fördern militärische Kader aus Arbeiter:innen und die Bewaffnung von Arbeiter:innen und Bauern/Bäuerinnen in großem Umfang.
f) Sie nehmen am Klassenkampf auf dem Lande teil, während sie in der Landwirtschaft arbeiten, indem sie die werktätige Bauern-/Bäuerinnenschaft gegen die staatliche Ausbeutung und gegen die reichen Bauern/Bäuerinnen, Großgrundbesitzer:innen und Mittelleute usw. unterstützen. Jede Räuberei gegen die werktätige Bauern-/Bäuerinnenschaft muss erbarmungslos gegeißelt werden.
g) Sie organisieren eine Vergeschwisterungspropaganda unter den Besatzungstruppen und öffnen ihre Reihen für deutsche Deserteur:innen.
h) Sie entwickeln proletarische Kämpfer:innen durch marxistisches Studium und politische Diskussion, im Gegensatz zu der bürgerlichen Theorie: ,Keine Politik in der Armee.‘
Die Sektionen der Vierten Internationale müssen diese Politik sowohl außerhalb als auch innerhalb der Partisan:innenorganisationen verfolgen, mit dem Ziel, schließlich alle revolutionären Elemente der Partisan:innenbewegung auf einer unabhängigen Klassenbasis zu reorganisieren, sowohl ideologisch als auch organisatorisch. Ohne eine richtige Politik werden diese Kräfte unweigerlich reaktionären Strömungen zum Opfer fallen.“74
Hier wird richtigerweise das Massenelement der Partisan:innenbewegung begriffen und die Notwendigkeit für Revolutionär:innen, sich an ihr zu beteiligen. Gleichzeitig wird das strategische Ziel formuliert, diese Organisationen in bewaffnete Verbände des Proletariats zu verwandeln. Wir würden an dieser Stelle aber eine wichtige Unterscheidung machen, die unserer Meinung nach fehlt. Die Thesen machen keinen Unterschied zwischen den von der nationalen Bourgeoisie und von den Stalinist:innen organisierten Partisan:innenverbänden. Das ist zu ihrem Veröffentlichungszeitpunkt durchaus verständlich, herrschte doch zwischen diesen Gruppen weitgehend ein strategisches Bündnis der Volksfront. Nichtsdestotrotz würden wir (natürlich gestützt auf die Erfahrung der nachfolgenden Ereignisse) doch eine wesentliche Unterscheidung zwischen den von der nationalen Bourgeoisie und den von den Stalinist:innen organisierten Partisan:innenverbänden treffen. Im Regelfall bestand zwischen diesen Verbänden eine organisatorische Unabhängigkeit, aber auch politisch und ideologisch gab es wichtige Unterschiede.
Während die stalinistische Partisan:innenbewegung (wie FTP [Francs-tireur; Freischütz:innen] in Frankreich, Brigate Garibaldi in Italien, ELAS [Griechische Volksbefreungsarmee] in Griechenland, die Tito-Partisan:innen in Jugoslawien oder die Rote Armee in China) einer recht strikten Kontrolle durch die jeweiligen kommunistischen Parteien unterlag, wurde die bürgerliche Partisan:innenbewegung (wie ORA [Organisation de Résistance de l’Armée; Widerstandsorganisation der Armee] in Frankreich, Giustizia e Libertà [Gerechtigkeit und Freiheit] in Italien, EDES [Nationale Demokratische Griechische Liga] in Griechenland oder die Partisan:innenverbände der Nationalist:innen in China) von der nationalen Bourgeoisie kontrolliert. Wir würden deshalb grundsätzlich die stalinistische Partisan:innenbewegung bevorzugen, auch wenn wir sie für ihre strategische Politik der Volksfront kritisieren. Die Partisan:innenbewegung, die hingegen durch Fraktionen der nationalen Bourgeoisie kontrolliert wurde, würden wir als verlängerten Arm ebenjener ansehen. Die praktischen Konsequenzen dieser Unterscheidung wurden in Einzelfällen schon während des Zweiten Weltkriegs deutlich (Schlacht um Athen 1944 oder Zwischenfall mit der Neuen Vierten Armee 1941 in China), aber im großen Stil (Griechischer und Chinesischer Bürger:innenkrieg) erst nach 1945.
Diese Widersprüche zwischen den Partisan:innenverbänden hätten ausgenutzt werden können, um die einfachen kommunistischen Partisan:innen von der Politik des Stalinismus wegzubrechen. Im Regelfall hätte es bedeutet, dass sich die Trotzkist:innen im Zweiten Weltkrieg in erster Linie in den stalinistisch geführten Verbänden (klandestin)75 hätten organisieren müssen. In Ländern wie beispielsweise Polen, in denen es keine kraftvollen stalinistischen Verbände gab, bräuchte es hier vermutlich noch mal eine gesonderte Betrachtung, die wir an dieser Stelle nicht geben können.
4. Fazit
Die Geschichte der marxistischen Kriegstaktik ist fast so alt wie der Marxismus selbst. Von Anfang an verstanden die Marxist:innen, dass Krieg kein außerhalb von Politik und Klassenverhältnissen stehendes Ereignis ist. Ganz nach Clausewitz wurde der Krieg als „Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln“ begriffen. Genau deshalb bräuchte es auch eine eigene proletarische Herangehensweise an den Krieg. Deshalb kann die Antwort von revolutionären Kommunist:innen eben auch nicht einfach nur Pazifismus oder die Ablehnung von Krieg als moralisches Übel schlechthin sein. Vielmehr braucht es sowohl ein Verständnis von Krieg im Allgemeinen, seiner Verknüpfung mit der (kapitalistischen) Klassengesellschaft und seiner Funktion für den Kapitalismus in seinem imperialistischen Stadium, aber auch ein Verständnis von Krieg und Kriegstaktik im Besonderen. Hierbei ist speziell die Organisierung des bewaffneten Aufstands76 von großer Bedeutung.
In seinem imperialistischen Stadium tendiert der Kapitalismus noch einmal mehr zur Austragung der internationalen Konkurrenz sowie zur Aufrechterhaltung der Hierarchie des globalen Ausbeutungsregimes mit kriegerischen Methoden. In der ersten Hälfte der Geschichte des Imperialismus gab es eine Menge an innerimperialistischen Konflikten und Kriegen (Spanisch-Amerikanischer Krieg, Russisch-Japanischer Krieg, Italienisch-Türkischer Krieg sowie den Ersten und Zweiten Weltkrieg). Lenin redete in einem Brief an Sinowjew 1916 über diese Art von Kriegen als das „Typische“ (wenn auch explizit nicht Einzige).77
Seit 1945 gab es aber kaum noch eine direkte innerimperialistische Auseinandersetzung. Das liegt auf der einen Seite daran, dass bis zum Zusammenbruch der Sowjetunion die Widersprüche zwischen den einzelnen imperialistischen Großmächten gegenüber dem Gegensatz zu Letzterer in den Hintergrund traten, auf der anderen Seite sicher auch, weil im Zeitalter der nuklearen Waffen jeder innerimperialistische Krieg auch immer die Gefahr der kompletten Zerstörung der Menschheit in sich trägt.
Gerade in den letzten Jahren sehen wir aber, wie die Widersprüche zwischen den imperialistischen Großmächten doch immer bedenklichere Ausmaße annehmen. Insbesondere auf dem Schlachtfeld in der Ukraine sehen wir, wie fleißig Technologie und Taktik für einen möglichen direkten Zusammenstoß zwischen den Großmächten studiert und getestet werden. Für die Arbeiter:innenbewegung und die Linke ist es deshalb schon heute wichtig, sich mit solchen Fragen auseinanderzusetzen, um nicht wie so oft in der Geschichte von der nationalistischen Welle im Zuge eines Krieges weggespült zu werden.
Wir haben versucht, mit diesem Beitrag auf der einen Seite die revolutionäre Methode des revolutionären Defätismus zu verteidigen und sie gleichzeitig nicht als totes Schema darzustellen. Unsere geschichtliche Darstellung beschränkte sich hierbei logischerweise in erster Linie auf die wichtigsten innerimperialistischen Kriege (1. und 2. Weltkrieg) und im Kontrast dieser beiden Weltkriege zeigt sich auch gut der Unterschied in der Anwendung des revolutionären Defätismus.
Die Zentralität einer konsequenten Ablehnung der „Vaterlandsverteidigung“ in imperialistischen Kriegen sowie jeglicher Burgfriedenspolitik, die Lenin im 1. Weltkrieg so konsequent gegen jede Form von Pazifismus oder Nationalchauvinismus in der Arbeiter:innenbewegung verteidigte, stellt ein zentrales Element des revolutionären Defätismus dar. In imperialistischen Ländern darf es für Kommunist:innen kein in irgendeiner Form geartetes Bündnis mit ihrer „eigenen“ Bourgeoisie geben – insbesondere nicht im Krieg.
Gleichzeitig sehen wir bei Lenin 1917 und dann in weiterer Folge bei Trotzki in den 1930er Jahren, dass der revolutionäre Defätismus alles andere als eine starre, gleichbleibende Taktik ist. Vielmehr muss er den Verhältnissen angepasst werden. Wie schon weiter oben erwähnt, verstehen wir ihn als dialektische Einheit von Klassenkampf bzw. Revolution und Niederlage. Der revolutionäre Defätismus verhält sich daher ähnlich wie die dialektische Einheit des demokratischen Zentralismus. In gewissen Situationen kann hier das demokratische Element überwiegen (beispielsweise in der Diskussionsperiode vor Konferenzen), in anderen wiederum das zentralistische Element (beispielsweise in Situationen der Illegalität).
Hierbei gibt es kein einzelnes und immer richtiges Kriterium der Entscheidung, welches Element im Vordergrund stehen sollte. Vielmehr geht es darum, konkrete Situationen – im Lichte der historischen Erfahrungen – genau zu analysieren. Nichtsdestotrotz gibt es einige wichtige Beispiele, die wir hier noch einmal wiederholen wollen.
Auf der einen Seite ist es wichtig, die Situation des Klassenkampfes zu analysieren. Das kann sich beispielsweise ausdrücken in der Schaffung einer Doppelmachtsituation oder einer kräftigen proletarischen Bewegung. So eine Situation kann sogar dazu führen, dass Teile der Bourgeoisie selbst eine Niederlage gegen den imperialistischen Kontrahent:innen gegenüber dem Sieg der Revolution vorziehen würden. Eine solche Situation können wir sowohl 1917 in Russland als auch 1940 in Frankreich sehen. Hier kann der revolutionäre Defätismus sogar die Form annehmen aufzuzeigen, wie die Machtergreifung des Proletariats besser zur Landesverteidigung geeignet ist.
Auf der anderen Seite gibt es die spezifische Situation der Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg. Das Überleben des stalinistischen degenerierten Arbeiter:innenstaates war wesentlich für das globale Kräfteverhältnis zwischen den Klassen. Die mit der Sowjetunion verbündeten imperialistischen Mächte wurden deshalb von Trotzki anders analysiert als die sich im Krieg mit der Sowjetunion befindenden. Während auf deutscher Seite der unmittelbare Kampf gegen die Kriegsmaschinerie auf der Tagesordnung stehen würde, ginge es in Frankreich um den politischen Widerstand gegen die Bourgeoisie und die Vorbereitung der proletarischen Revolution.
Nichtsdestotrotz bleibt es wesentlich zu betonen, dass das Kernelement des revolutionären Defätismus immer aus bedingungsloser Opposition zu jedem Bündnis mit der imperialistischen Bourgeoisie bestehen muss. Auch in einer kreativen Anwendung kann er niemals dazu verwendet werden, in irgendeiner Form ein Bündnis mit der „eigenen“, imperialistischen Bourgeoisie zu knüpfen. Oder um es mit Karl Liebknecht zu sagen: „Der Hauptfeind steht im eigenen Land!“
Endnoten
1 Lenin, W. I.: „Der Fall von Port Arthur“, in: Werke Band 8, Berlin/Ost [Dietz], 1. Auflage 1958, S. 34 f.
2 Wichtig ist hierbei, dass sich die Bedeutung von „Verteidigungskrieg“ nicht in erster Linie davon ableitet welche der beiden Seiten „Angreiferin“ oder „Verteidigerin“ ist, sondern dass es sich um einen gerechten Krieg handelt.
3 Siehe hierzu beispielsweise Marx, K. „Erste Adresse des Generalrats über den Deutsch-Französischen Krieg“, in: Marx/Engels-Werke Band 17, Berlin/Ost [Dietz], 1973, S. 3 f.
4 Die Debatte um den Charakter des Deutsch-Französischen Krieges verlief zwischen Marx und Engels, dem Braunschweiger Ausschuss, einer Art Parteivorstand der SDAP, welche eine der beiden Vorläuferinnen der SPD war, dem Generalrat der IAA, deren französischer Sektion sowie August Bebel und Wilhelm Liebknecht. Hier gab es durchaus Dissonanzen, wenn auch untergeordnete. Marx und Engels sowie der Generalrat fielen allerdings Bebel und Liebknecht, die sich bei der Abstimmung über die Kriegskredite im Reichstag des Norddeutschen Bundes enthalten hatten, nicht in den Rücken, auch wenn sie betonten, dass es sich auf deutscher Seite bis zur Niederlage Louis Bonapartes um einen gerechten Krieg mit der Folge der Überwindung der Kleinstaaterei und Abhängigkeit von Russland und Frankreich handelte. Ab hier war die I. Internationale sich wieder vollständig einig. Siehe dazu: „Marx und Engels und der deutsch-französische Krieg von 1870/71“ (https://marx-engels-revisited.de/2022/07/28/marx-und-engels-und-der-deutsch-franzoesische-krieg-von-1870-71/). Allerdings vertritt der Artikel die Position: „So hatten Marx und Engels den Sozialdemokraten, die 1914 für die Kriegskredite stimmten, die Argumente geliefert: nämlich, dass es sich um einen gerechten Verteidigungskrieg gegen das reaktionäre Russland handeln würde.“ Dieses Argument entkräftet Karl Radek vollständig in „Marxism and the Problems of War“ (1914), aus: Revolutionary History, Bd. 8, Nr. 2, 2002, S. 50–58 (https://www.marxists.org/archive//radek/1914/xx/war.html) (Alle Links abgerufen am 10.4.2025).
5 Siehe dazu: Hal Draper, „The Myth of Lenin’s ‘Revolutionary Defeatism‘“ (https://www.marxists.org/archive/draper/1953/defeat/chap2.htm) (abgerufen am 10.4.2025). Draper kommt zum Schluss, dass Lenins damalige Position keine des revolutionären Defätismus gewesen sei, sondern sich dieses Konzept erst mit seiner Imperialismusposition herausgebildet habe, wohingegen Sinowjew 1916 es bereits als im Russisch-Japanischen Krieg 1904/1905 angewandt sah. Lenins Haltung ähnelte damals mehr der von Marx und Engels im Deutsch-Französischen Krieg von 1870/1871. Trotzdem enthielt es eine internationalistische Haltung („Verbrüderung“ der russischen und japanischen Arbeiter:innen). Allerdings ignoriert es den imperialistischen Charakter der japanischen Eroberungspolitik (Korea, Nordostchina) als Folge seiner noch nicht ausgearbeiteten Imperialismusanalyse.
6 Haupt, G.: „Der Kongress fand nicht statt – die Sozialistische Internationale 1914“, Wien [Europa Verlag], 1967, S. 26
7 Insbesondere in Russland (sowohl Menschewiki wie Bolschewiki verweigerten die Zustimmung zu den Kriegskrediten), Serbien und Bulgarien (hier die „engen Sozialist:innen“) wurde die Zustimmung von der Sozialdemokratie zu den Kriegskrediten verweigert.
8 Arbeiter-Zeitung vom 5. August 1914, Wien
9 Sozialdemokratische Arbeiterpartei Russlands
10 Lenin, W. I.: „Die Aufgaben der revolutionären Sozialdemokratie im europäischen Krieg“, in: Werke Band 21, Berlin/Ost [Dietz], 1970, S. 4 f.
11 Lenin, W. I.: „Der europäische Krieg und der internationale Sozialismus“, in: Werke Band 21, Berlin/Ost [Dietz], 1970, S. 8.
12 Zentralkomitee der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands: „Der Krieg und die russische Sozialdemokratie“, in: Werke Band 21, Berlin/Ost [Dietz], 1970, S. 19
13 Lenin, W. I.: „Über den Nationalstolz der Großrussen“, in: Werke Band 21, Berlin/Ost [Dietz], 1970, S. 93 f.
14 Im russischen Original „желать“. Neben (Herbei-)Wünschen auch eine Konnotation von Begehren, Ersehnen, Verlangen.
15 Lenin, W, I.: Werke Band 21, Berlin/Ost [Dietz], 1970, S. 20
16 Im Zuge des Deutsch-Französischen Kriegs und der verheerenden Niederlage der französischen Armee erhob sich im März 1871 das Pariser Proletariat gegen die konservative Zentralregierung und errichtete zum ersten Mal in der Geschichte die Klassenherrschaft des Proletariats.
17 Siehe auch dazu den Revolutionären Marxismus Nr. 53 „Imperialismus – Theorie, Kontroversen und Kritik“, Berlin [global red], 2020.
18 Wie beispielsweise auch durch die Veröffentlichung der Geheimverträge der Alliierten im November 1917 belegt.
19 In der Literatur findet sich auch die Bezeichnung Beaugy.
20 Zentralkomitee der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands: „Der Krieg und die russische Sozialdemokratie“, in: Lenin Werke Band 21, Berlin/Ost [Dietz], 1970, S. 11 f.
21 Lenin, W. I.: „Lage und Aufgaben der Sozialistischen Internationale“, in: Werke Band 21, Berlin/Ost [Dietz], 1970, S. 22 f.
22 Zitiert nach Hal Draper „The Myth of Lenin’s ‘Revolutionary Defeatism’“ auf https://www.marxists.org/archive/draper/1953/defeat/chap3.htm (abgerufen am 27.12.2023; Übersetzung von uns).
23 Sinowjew, G.: „Der Krieg und das Schicksal unserer Befreiung“, in „Gegen den Strom“, Hamburg, [Verlag der Kommunistischen Internationale], 1921, S. 51 ff.
24 Ebenda, S. 52
25 Senn, A. E.: „The Bolshevik Conference in Bern, 1915“ in Slavic Review, 1966; 25(4): 676–678
26 „Konferenz der Auslandssektionen der SDAPR, Resolution: Die Niederlage der Zarenmonarchie“, in: Werke Band 21, Berlin/Ost [Dietz], 1970, S. 152
27 Ebenda
28 Leider gibt es keine ausführliche Diskussion, wie beispielsweise Lenin den revolutionären Defätismus in Serbien konkret ausgelegt hätte.
29 Trotzki, L.: „Der Krieg und die Internationale“, in: Ders.: „Schriften zum imperialistischen Krieg“, Frankfurt/Main [I. Stibor], 1978, S. 22 f.; https://www.marxists.org/deutsch/archiv/trotzki/1914/kriegint/kap07.htm (abgerufen am 5.5.2024)
30 Trotzki, L.: „Der Krieg und die Internationale“, in: Ders.: „Schriften zum imperialistischen Krieg“, Frankfurt/Main [I. Stibor], 1978, S. 66; https://www.marxists.org/deutsch/archiv/trotzki/1914/kriegint/kap03.htm (abgerufen am 5.5.2024)
31 Gemeint ist die Resolution der bolschewistischen Konferenz im Frühjahr 1915.
32 Bis hier zitiert nach Pearce, B.: Lenin and Trotsky on Pacifism and Defeatism auf https://www.marxists.org/history/etol/writers/pearce/1961/xx/defeatism.html (abgerufen 30.12.2023; Übersetzung von uns).
33 Rest zitiert nach einer japanischen Übersetzung des „Offenen Briefs an die Redaktion des Kommunist“ auf https://www.marxists.org/nihon/trotsky/1910-2/ns-com.htm (abgerufen 30.12.2023; maschinenübersetzt).
34 Lenin, W. I.: „An A. Schljapnikow“, in: Werke Band 35, Berlin/Ost [Dietz], 1962, S. 162
35 Lenin, W. I.: „Über die Niederlage der eigenen Regierung im imperialistischen Krieg“, in: Werke Band 21, Berlin/Ost [Dietz], 2. Auflage 1959, S. 273 f.
36 Lenin grenzt sich nicht nur hier gegen Sabotage der Kriegsmaschinerie ab, er tut dies auch schon sehr früh im Krieg, als er in einem anderen Brief an Schljapnikow schreibt: „Nicht Sabotage des Kriegs, sondern Kampf gegen den Chauvinismus und Konzentration der gesamten Propaganda und Agitation auf den internationalen Zusammenschluß (Annäherung, Solidarisierung, Einigung selon les circonstances [den Umständen gemäß; A. Z]) des Proletariats zum Zwecke des Bürgerkriegs. Es wäre sowohl falsch, zu individuellen Aktionen, Niederschießen von Offizieren etc. aufzufordern, als auch Argumente zuzulassen wie: wir wollen nicht dem Kaisertum helfen. Ersteres wäre eine Abweichung zum Anarchismus, letzteres zum Opportunismus.“ Lenin, W. I.: „An A. Schljapnikow“, in: Werke Band 35, Berlin/Ost [Dietz], 1962, S. 138
36 Beides Organisationen der Menschewiki
37 Lenin, W. I.: „Über die Niederlage der eigenen Regierung im imperialistischen Krieg“, in: Werke Band 21, Berlin/Ost [Dietz], 1970, S. 273 f.
38 Lenin, W. I.: „Sozialismus und Krieg“, in: Werke Band 21, Berlin/Ost [Dietz], 1970, S. 316
39 Ebenda, S. 314
40 Insbesondere zu nennen sind hier „Die sozialistische Revolution und das Selbstbestimmungsrecht der Nationen (Thesen)“ (1916) und „Die Ergebnisse der Diskussion über die Selbstbestimmung“ (1916), beides zu finden in Werke Band 22, Berlin/Ost [Dietz], 1972.
41 „,Die Folge’ (der Taktik der Anhänger Liebknechts), schreibt Kolb, ,wäre ein bis zur Siedehitze gesteigerter innerer Kampf unter der deutschen Nation und damit eine militärische und politische Schwächung derselben gewesen’ … zum Vorteil und zum Siege des ‚Imperialismus des Dreiverbandes [Entente, A. Z.]‘!! Da haben wir den Kern des opportunistischen Geschreis gegen den ,Defätismus’!!
Das ist tatsächlich der Kern der ganzen Frage. Der ,bis zur Siedehitze gesteigerte innere Kampf’ ist eben der Bürgerkrieg. Kolb hat recht, die Taktik der Linken führt dazu; er hat recht, sie bedeutet die ,militärische Schwächung’ Deutschlands, d. h. den Wunsch nach seiner Niederlage und die Mitwirkung dabei, bedeutet Defätismus. Kolb hat nur – nur! – darin unrecht, daß er den internationalen Charakter einer solchen Taktik der Linken nicht sehen will. In allen kriegführenden Ländern ist ,ein bis zur Siedehitze gesteigerter innerer Kampf’, die ,militärische Schwächung’ der imperialistischen Bourgeoisie und (kraft dessen, in Verbindung damit, mittels dessen) die Umwandlung des imperialistischen Krieges in den Bürgerkrieg möglich. Das ist der Kern der Frage.“ In: Lenin, W. I.: „Wilhelm Kolb und Georgi Plechanow“, in: Werke Band 22, Berlin/Ost [Dietz], 1972, S. 143
42 „Denselben Fehler begeht Junius [Rosa Luxemburg, A. Z.] in seinen Ausführungen über das Thema, was besser sei: Sieg oder Niederlage? Er zieht die Schlußfolgerung, daß beides gleich schlecht sei (Ruin, vermehrte Rüstungen usw.). Das ist nicht der Standpunkt des revolutionären Proletariats, sondern eines pazifistischen Kleinbürgers. Wenn man von der ,revolutionären Intervention’ des Proletariats spricht – davon aber sprechen, leider zu allgemein, Junius und die Leitsätze der Gruppe ,Internationale’ –, so muß die Frage unbedingt von einem anderen Standpunkt aus gestellt werden: 1. Ist eine ,revolutionäre Intervention’ ohne die Gefahr einer Niederlage möglich? 2. Ist es möglich, die Bourgeoisie und die Regierung des eigenen Landes zu geißeln, ohne dieselbe Gefahr heraufzubeschwören? 3. Haben wir nicht immer gesagt, und lehrt die historische Erfahrung der reaktionären Kriege nicht, daß Niederlagen das Werk der revolutionären Klasse erleichtern?“ in: Lenin, W. I.: „Über die Junius-Broschüre“, in: Werke Band 22, Berlin/Ost [Dietz], 1972, S. 324
43 Stalin, J.: „Trotzkismus oder Leninismus“, in: Werke Band 6, Berlin/Ost [Dietz], 1. Auflage 1952, S. 298
44 Lenin, W. I.: „Einige Thesen“, in: Werke Band 21, Berlin/Ost [Dietz], 1970, S. 409
45 Lenin, W. I.: „Die Aufgaben des Proletariats in unserer jetzigen Revolution“, in: Werke Band 24, Berlin/Ost [Dietz], 3. Auflage 1972, S. 50 f.
46 Lenin, W. I.: „Die politischen Parteien in Rußland und die Aufgaben des Proletariats“, in: Werke Band 24, Berlin/Ost [Dietz], 3. Auflage 1972, S. 87
47 Lenin, W. I.: „Die Aufgaben des Proletariats in unserer jetzigen Revolution“, in: Werke Band 24, Berlin/Ost [Dietz], 1972, S. 3 f.
48 Lenin, W. I.: „Die drohende Katastrophe und wie man sie bekämpfen soll“, in: Werke Band 25, Berlin/Ost [Dietz], 1972, S. 371 f.
49 Lenin, W. I.: „Außerordentlicher IV. Gesamtrussischer Sowjetkongreß – 3 Schlusswort zum Referat über die Ratifizierung des Friedensvertrags 15. März“, in: Werke Band 27, Berlin/Ost [Dietz], 1972, S. 181 f.
50 Lenin, W. I.: „Außerordentlicher IV. Gesamtrussischer Sowjetkongreß – 2 Referat über die Ratifizierung des Friedensvertrags 14. März“, in: Werke Band 27, Berlin/Ost [Dietz], 1972, S. 176
51 „Das nationale Element im jetzigen Krieg ist nur durch den Krieg Serbiens gegen Österreich vertreten (was, nebenbei bemerkt, in der Resolution der Berner Konferenz unserer Partei gesagt ist). Nur in Serbien und unter den Serben haben wir seit vielen Jahren eine nationale Befreiungsbewegung, die Millionen ,Volksmassen’ umfasst und deren ,Fortsetzung’ der Krieg Serbiens gegen Österreich ist. Wäre dieser Krieg isoliert, d. h., wäre er nicht mit dem gesamteuropäischen Krieg, mit den eigensüchtigen und räuberischen Zielen Englands, Rußlands usw. verknüpft, so wären alle Sozialisten verpflichtet, der serbischen Bourgeoisie den Sieg zu wünschen – das ist die einzig richtige und absolut notwendige Schlußfolgerung aus dem nationalen Moment im jetzigen Krieg.“ (Hervorhebungen im Original; zitiert nach Lenin, W. I.: „Der Zusammenbruch der II. Internationale“, in: Werke Band 21, Berlin/Ost [Dietz], 1970, S. 230)
52 „Die Sozialisten verstanden unter einem ‚Verteidigungskrieg‘ stets einen in diesem Sinne ‚gerechten‘ Krieg (wie sich Wilhelm Liebknecht einmal ausdrückte). Nur in diesem Sinne erkannten und erkennen jetzt noch die Sozialisten die Berechtigung, den fortschrittlichen und gerechten Charakter der ,Vaterlandsverteidigung’ oder des ,Verteidigungs’krieges an. Wenn zum Beispiel morgen Marokko an Frankreich, Indien an England, Persien oder China an Rußland usw. den Krieg erklärten, so wären das ,gerechte’ Kriege, ,Verteidigungs’kriege, unabhängig davon, wer als erster angegriffen hat, und jeder Sozialist würde mit dem Sieg der unterdrückten, abhängigen, nicht gleichberechtigten Staaten über die Unterdrücker, die Sklavenhalter, die Räuber – über die ,Groß’mächte – sympathisieren.“ (Hervorhebungen im Original; zitiert nach Lenin, W. I.: „Sozialismus und Krieg“, in: Werke Band 21, Berlin/Ost [Dietz], 1970, S. 300 f.)
53 Genannt sei an dieser Stelle vor allem Hal Draper, der in seinem durchaus interessanten Debattenbeitrag „The Myth of Lenin’s ‘Revolutionary Defeatism’“ 1953/1954 suggeriert, Lenin hätte 1917 den revolutionären Defätismus aufgegeben.
54 Lenin, W. I.: „Rede auf einer Kundgebung im Butyrki-Stadtbezirk 2. August 1918“, in: Werke Band 28, Berlin/Ost [Dietz], 1972, S. 29
55 Martynow, A.: „Der große proletarische Führer“, in: Die Kommunistische Internationale. Jg. 5, Nr. 31/32, Reprint Nr. 16, Band 7, Erlangen [Politladen], 1974, S. 31 f.
56 Sinowjew, G.: „War & Leninism“ (https://www.marxists.org/archive//zinoviev/works/x01/x02.htm)
57 Trotzki, L.: „О военной опасности и политике обороны“ („Über die Kriegsgefahr und die Verteidigungspolitik“), in „Коммунистическая оппозиция в СССР, 1923–1927, том 4“ („Kommunistische Opposition in der UdSSR, 1923–1927, Bd. 4“), Vermont [Chalidze Publications], 1988; eigene Übersetzung.
58 Trotzki, L.: „Geschichte der Russischen Revolution“, Berlin [S. Fischer], 1960, S. 48
59 Ebenda, S. 233 f.
60 Wir stützen uns hier – trotz wichtiger inhaltlicher Differenzen – unter anderem auf die Darstellung von J. P. Joubert, einem Mitarbeiter im Institut Leon Trotsky in Grenoble, das mit dem Tod des führenden Kopfes des Instituts, Pierre Broué, sein Ende fand. Siehe Joubert, J. P.: „Le défaitisme révolutionnaire“ („Der revolutionäre Defätismus“), erstmalig erschienen in Cahiers Leon Trotsky, Grenoble, 1985. Die von uns herangezogene englische Übersetzung findet sich auf https://www.marxists.org/history/etol/revhist/backiss/vol1/no3/revdeft.html (abgerufen am 16.1.2024).
61 Es wird zwar durchaus der Begriff des Defätismus verwendet, aber mit unterschiedlichen Ausprägungen. So spricht Trotzki beispielsweise sowohl vom Defätismus gestürzter herrschender Klassen wie auch von Lenins Defätismus im Ersten Weltkrieg.
62 Die Online-Ressourcen des Trotzki-Archivs in Harvard sind hierbei zwar hilfreich, aber leider sind große Teile des Archivs, insbesondere der vollständige Schriftverkehr mit Eugene Bauer oder auch die unterschiedlichen Entwürfe von „Der Krieg und die Vierte Internationale“, dort bisher nicht verfügbar.
63 Trotzki, L.: „Lernt Denken“ (https://www.marxists.org/deutsch/archiv/trotzki/1938/05/denken.htm (abgerufen 17.7.2024)
64 „The Case of Leon Trotsky“ („Der Fall Leo Trotzki“), zitiert nach https://www.marxists.org/archive/trotsky/1937/dewey/session08.htm (abgerufen 7.5.2024; unsere Übersetzung).
65 Trotzki, L.: „Der Todeskampf des Kapitalismus und die Aufgaben der Vierten Internationale“ in „Das Übergangsprogramm“, Essen [Arbeiterpresse], 1997
66 Ebenda, S. 106 f.
67 Die USA waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht im Krieg, wandten sich aber immer aktiver der britischen Seite zu. Die Resolution wurde wenige Tage nach der Einführung der Wehrpflicht in den USA angenommen.
68 Socialist Workers Party, „Resolution on Proletarian Military Policy” („Resolution über die Proletarische Militärpolitik“) https://www.marxists.org/history/etol/document/icl-spartacists/prs2-pmp/swp-pmp.html (abgerufen am 27.4.2024; unsere Übersetzung)
69 Lenin, W. I.: „Die drohende Katastrophe und wie man sie bekämpfen soll“, in: Werke Band 25, Berlin/Ost [Dietz], 1970, S. 371
70 Trotzki, L.: „On Conscription“ („Über die Wehrpflicht“) https://www.marxists.org/archive/trotsky/1940/07/letter04.htm (abgerufen 27.4.2024; unsere Übersetzung)
71 Siehe hier auch das Kapitel „Die Epigonen zerstören Trotzkis Internationale“ in unserer Broschüre „Der Letzte macht das Licht aus – Die Todesagonie der Vierten Internationale“, verfügbar unter http://www.arbeitermacht.de/broschueren/vs/ka2.htm.
72 Siehe hierzu beispielsweise den Artikel von Pierre Broué „How Trotsky and the Trotskyists confronted the Second World War“ („Wie Trotzki und die Trotzkist:innen den Zweiten Weltkrieg konfrontierten“) https://www.marxists.org/history/etol/revhist/backiss/vol3/no4/brouww2.html.
73 „Theses on the Liquidation of World War II and the Revolutionary Upsurge“ („Thesen zur Liquidierung des Zweiten Weltkrieges und zum revolutionären Aufschwung“) https://www.marxists.org/history/etol/document/fi/1938-1949/ww/1945-ww02.htm (abgerufen 27.4.2024; unsere Übersetzung)
74 Ebenda
75 Nicht selten wurden Trotzkist:innen – oder auch nur vermeintliche Trotzkist:innen –, nachdem ihre Identität den stalinistischen Anführer:innen bekannt wurde, einfach standrechtlich erschossen.
76 Siehe hierzu beispielsweise auch das von der Komintern 1928 in deutscher Sprache (illegal) herausgegebene Werk „Der bewaffnete Aufstand – Versuch einer theoretischen Darstellung“. An der Erstellung arbeiteten u. a. Ho Chi Minh und Michail Tuchatschewski mit. Abgedruckt in: (A. Neuberg) Kippenberger, H., et al.: „Der bewaffnete Aufstand – Versuch einer theoretischen Darstellung. Eingeleitet von Erich Wollenberg“, Frankfurt am Main [Europäische Verlagsanstalt], 1971.
77 Lenin, W. I.: „An G. Sinowjew“, in: Lenin Werke Band 35, Berlin/Ost [Dietz], 2. Auflage 1959, S. 204 f.




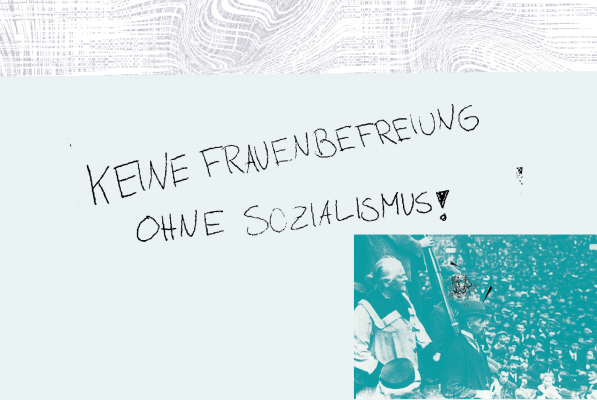

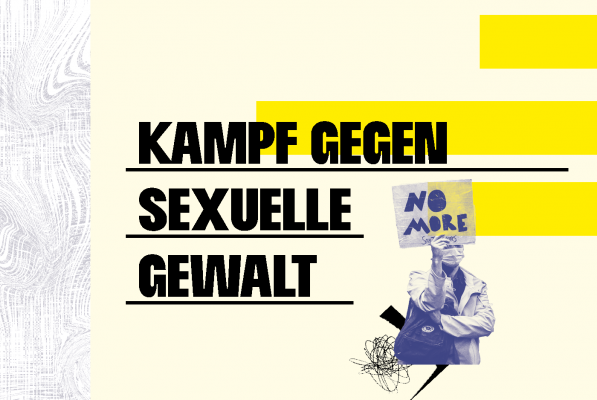


One thought on “Revolutionärer Defätismus”