Die Häuser, denen, die sie brauchen!

Frauenbefreiung und Wohnprogramm der KPÖ
Nelly, Revolution Österreich, Fight! Revolutionäre Frauenzeitung 13, März 2025
100 Jahre nach dem Roten Wien schreibt sich erneut eine kommunistische Partei Wohnpolitik auf die Fahne – und konnte damit trotz des verstärkten Rechtsrucks in den letzten Jahren in mehreren Regionen Österreichs große Gewinne einfahren. Die Rede ist von der Kommunistischen Partei Österreichs (KPÖ), die mit ihrer Politik in Graz die Bürgermeisterin Elke Kahr stellt und in Salzburg zur zweitstärksten Kraft in der sonst stark ÖVP-lastigen Stadt wurde. Während sie noch vor Jahren in der Bedeutungslosigkeit umherschipperte, konnte siedurch Aktionen wie dem Abtreten eines Großteils ihrer Politiker*innengehälter oder dem Mieternotruf Sympathiepunkte in der Bevölkerung sammeln. Dabei hängen ihre Erfolge
stark mit der angespannten Situation am Wohnungsmarkt zusammen. Da Wohnen der Ort ist, wo die meiste Reproduktion stattfindet, ist Wohnpolitik dezidiert mit Frauenbefreiung verbunden. Die KPÖ sagt selbst, Wohnpolitik sei Frauenpolitik. Man kann also zu Recht behaupten, dass der Schwerpunkt auf dem Thema Wohnen liegt, aber wie viel Kommunismus und Frauenbefreiung stecken wirklich im Wohnprogramm der KPÖ?
„Eine Stimme für leistbares Wohnen“
Die wohnspezifischen Forderungen zur Nationalratswahl beinhalten ein in der Verfassung verankertes Grundrecht auf Wohnen, einen Mietendeckel und Einfrierung der Mieten bis 2029, ein Ende von befristeten Mietverträgen und den Ausbau von öffentlichem Wohnbau. Sie kritisieren das jetzige Mietschutzgesetz, welches hauptsächlich den Interessen von Vermieter*innen und Investor*innen entspricht, und fordern einen einheitlichen Mieter*innenschutz und eine staatliche Kontrollinstanz zur Kontrolle der Einhaltung von Mietverträgen. Außerdem sollen die Wohnkosten der KPÖ höchstens ein Viertel des monatlichen Budgets eines Haushalts ausmachen. Wohnungsknappheit will die KPÖ durch Bekämpfung von Leerstand und öffentlichem Wohnbau forcieren. Letzteres soll durch verschiedene Maßnahmen finanziert werden, einerseits durch Zweckwidmung der Wohnbauförderung und der Mehrwertsteuer auf Mieten sowie die „angemessene Besteuerung von Widmungsgewinnen“. Außerdem sollen die Baukosten durch „das Kapital der öffentlichen Hand“ gedeckt werden. Was das heißt, wird jedoch nicht weiter ausgeführt.
Und was bringt das für Frauen?
Die KP wirbt damit, dass Wohnpolitik auch Frauenpolitik sei. „Wie wir bauen, bestimmt, wie Hausarbeit organisiert wird, wie Sorgearbeit stattfindet und unter welchen Bedingungen Frauen ihr Leben gestalten können oder eben nicht.“ Zu finden im Nationalratswahlprogramm 2024. Außer der Schlussfolgerung, dass Frauen durch genug leistbaren Wohnraum leichter aus gewaltvollen Beziehungen entkommen können, gibt es im Frauenprogramm von 2014 noch die Punkte, dass sie den Ausbau von ganztägigen gratis Kindergärten sowie eine gemeinsame ganztägige Pflichtschule von 6 bis 15 Jahren und das Einbeziehen unbezahlter Sorgearbeit ins Pensionssystem fordert. Kritisch anzumerken ist, dass soziale Unterdrückungen wie Queer-Unterdrückung oder Rassismus nur in Nebensätzen oder mit einer Handvoll Forderungen behandelt werden und Frauen die einzige unterdrückte Gruppe sind, die ein eigenes Programm gewidmet bekommt.
Reicht das, oder reicht es nicht?
Als Kommunist*innen wissen wir: Das gesellschaftliche Sein bestimmt das (vorherrschende) Bewusstsein. Damit ist gemeint, dass die Art und Weise, wie wir produzieren, unsere Gesellschaft strukturiert und uns maßgeblich beeinflusst. Der Kapitalismus basiert auf Ausbeutung und folgt der Profitlogik, während die Mehrheit unterdrückt wird.
Deswegen ist es unsere Aufgabe, wenn wir unsere Situation tatsächlich verbessern wollen, die Produktionsverhältnisse dauerhaft umzuwälzen. Als revolutionäre Kommunist*innen glauben wir, dass dies nur erfolgreich sein kann, wenn der Kampf um konkrete Verbesserungen damit verbunden wird, dass wir Forderungen implementieren, die den Weg in eine sozialistische Gesellschaft aufzeigen und darauf hinführen, existierende Strukturen herauszufordern. Solche Momente der Doppelmacht können nicht ewig bestehen bleiben – entweder es erfolgt eine positive Auflösung dieser durch die Zerschlagung des bürgerlichen Staates und das Brechen mit der kapitalistischen Profitlogik oder es fällt zurück auf die kapitalistische Verwaltung.Die Erkenntnis, dass es eine Umwälzung des kapitalistischen Systems geben kann, also das revolutionäre Bewusstsein, fällt nicht einfach so vom Himmel. Vielmehr muss diese in die Arbeiter*innenklasse hineingetragen werden. Deswegen braucht es Forderungen, die aufzeigen, wie eine andere, sozialistische Perspektive aussieht. Das bedeutet nicht, dass man neben existierenden Kämpfen steht und sagt: „Alles ist sinnlos, was ihr macht, solange nicht XYZ passiert“, sondern in bestehende Kämpfe interveniert, gemeinsam diskutiert und die Notwendigkeit dessen aufzeigt. Argumentationen wie „Die Leute sind noch nicht bereit genug, um das zu verstehen“ lehnen wir dementsprechend ab. Denn ja, es mag sein, dass manche Forderungen anfangs auf Unverständnis stoßen. Aber es gilt, im gemeinsamen Kampf, eine Perspektive aufzeigen zu können, wenn bisherige Methoden scheitern. Nur so kann die Arbeiter*innenklasse von einer real existierenden Ansammlung an Menschen in der Bevölkerung zu einer Kraft werden, die für sich und ihre Befreiung Politik betreibt.Dementsprechend kritisch stehen wir zum Programm der KPÖ.Zwar haben manche Forderungen eine regulierende Wirkung auf den freien Wohnungsmarkt, doch richtig angreifen tun sie ihn nicht. In Österreich befinden sich im Moment circa 1 Million von 1,74 Millionen Hauptmietwohnungen in der Hand von Gemeinden, Genossenschaften oder gemeinnützigen Kapitalgesellschaften. Doch selbst diese sind in der Hand des Staates (oder von Genossenschaften) zum Teil der Profitlogik unterworfen. Problematisch ist dabei vor allem, dass vage Formulierungen wie „öffentliche Hand“ verschleiern, wer die Kontrolle über Wohnraum, Neubau oder Planung haben soll, und klammern aus, dass der bürgerliche Staat keine Institution ist, die wir einfach übernehmen oder transformieren können. Dies ist darin begründet, dass er selbst Produkt der Klassengesellschaft ist und letzten Endes Institutionen wie das Privateigentum schützt. Mit einfachen Gesetzen kommt man langfristig nicht weiter, vor allem wenn man an die Praktiken von größeren Immobilienkonzernen denkt, die wie Vonovia in Deutschland verfahren. Hinzu kommt, dass auch progressive Errungenschaften wie die Wohnbauförderung eher mittleren und höheren Einkommensgruppen zugutekommen. Falsch sind die Forderungen der KPÖ also nicht. Nur unzureichend und nicht besonders kommunistisch.
Ähnliches gilt in puncto Frauenbefreiung. Natürlich sind die Forderungen der KPÖ fortschrittlich. Aber sie verbleiben beim Verwalten des kapitalistischen Istzustandes. Die Kosten der Reproduktion würden sich für den Staat und die Kapitalist*innen mit Forderungen wie gratis Kindergarten etc. zwar erhöhen, der Ort der Reproduktion wäre aber noch immer die bürgerliche Kleinfamilie. Die Vergesellschaftung von Reproduktionsarbeit wie Kochen, Putzen und Kindererziehung nach der Schulglocke rührt die KPÖ nicht an. Mit der Forderung nach Einbeziehung der Sorgearbeit ins Pensionssystem wird zwar der Gender Pension Gap minimiert, dass diese repetitiven, oft auslaugenden Arbeiten hauptsächlich von Frauen und im Privaten ausgeführt werden, wird dadurch aber nicht angegangen. Dabei ist es gerade in diesem Punkt zentral, eine breitere Perspektive aufzuwerfen! Als revolutionäre Kommunist*innen sehen wir das Absterben der bürgerlichen Kleinfamilie als Norm und die Vergesellschaftung der Reproduktionsarbeit als unumgängliches Ziel der Frauenbefreiung. Dazu gehört natürlich auch die Vergesellschaftung von jeglichem Wohnraum, damit der Ort der Reproduktion in unserer Hand liegt.
Es ist nicht verwunderlich, dass die KP die Vergesellschaftung der Reproduktionsarbeit nicht aufwirft. Sie ist zu einer reformistischen Partei geworden, die keinen konsequenten revolutionären Antikapitalismus lebt und damit auch nicht die Wurzeln des Kapitalismus angreifen will. Nach Beendigung des Fraktionskampfs mit dem stalinistischen Flügel 2004 steuert die KPÖ einen Kurs eurokommunistischer bis transformationstheoretischer Prägung an. Anstatt sich auf die Ursprünge der kommunistischen Bewegung zu beziehen, übernahm man eine Vorstellung von einer Transformation in eine „solidarische Gesellschaft“ als Weg zum Sozialismus. Somit beschränkt es sich nur auf Forderungen, die sowohl theoretisch im bürgerlich-parlamentarischen Rahmen erfüllbar sind, als auch solche, die diesen nicht im Geringsten infrage stellen und nicht einmal auf eine Gesellschaft jenseits des Kapitalismus verweisen. Damit haben wir uns in dem Artikel „Der Erfolg der KPÖ: Alpenkommunismus auf dem Vormarsch?“ auch noch mal intensiver auseinandergesetzt.
Aus der Geschichte lernen
Tatsächlich hat Österreich eine Geschichte der progressiven Wohnpolitik. Durch die Politik des Roten Wiens, einen groß angelegten Ausbau des öffentlichen Wohnbaus in den 1920er Jahren, sind die Mieten Wiens heute deutlich geringer als in so manchen anderen Großstädten. Forderungen, die die KPÖ heute nicht mal in den Mund nehmen würde, wurden damals von der Sozialdemokratie umgesetzt. Eine weitere Errungenschaft: Elemente der Vergesellschaftung der Hausarbeit. Zwischen 1923 und 1934 wurden über 60.000 neue Wohnungen gebaut, die an Konsumgenossenschaften und Bildungseinrichtungen geknüpft waren. Die Gemeindebauten wurden mit Zentralwaschküchen, Bibliotheken und Kindergärten ausgestattet. Die Stadtverwaltung übernahm bereits in Gemeindehand befindliche Betriebe (zum Beispiel Gas-, Wasser- und Elektrizitätswerke, Verkehrsbetriebe) und setzte die Kommunalisierung fort (Müllabfuhr, Kanalisation etc.). Die Wohnungsmiete wurde kostendeckend berechnet und betrug 1926 um die vier Prozent eines durchschnittlichen Arbeiter*innenmonatslohns. Durch Aneignung von Leerstand wurden Notquartiere zum Beispiel für Wohnungslose errichtet. Die finanzielle Basis für die Reformen schuf die Stadtregierung durch eine breit angelegte steuerliche Umverteilung. Möglich war dies, nachdem Wien im Jahr 1922 zu einem eigenen Bundesland geworden war und damit in der Steuerpolitik einen größeren Handlungsspielraum gewonnen hatte. Steuern auf Luxusgüter und -konsum wie Automobile, Pferde(rennen) oder Hauspersonal wurden erhoben. Zentral war zudem die sozial gestaffelte Wohnbausteuer, die auf Villen und Hausbesitz zielte, Wohnungen von Arbeiter*innenhaushalten aber ziemlich unbelastet ließ.
Was Revolutionäre fordern müssen …
Natürlich gibt es am Roten Wien sowie an der Sozialdemokratie einiges zu kritisieren. Um die Steuerhoheit in Wien zu erlangen, ließen sie eine Trennung von Niederösterreich und Wien zu. Außerdem verzichteten sie bei einem Kuhhandel mit den Christlich Sozialen auf die Organisierung der Landarbeiter*innen. Trotzdem zeigt das Rote Wien Ansätze zur Vergesellschaftung der Hausarbeit. Doch wie alle Errungenschaften innerhalb der bürgerlichen Demokratie halten sie nur so lange, wie das Kapital es gestattet. Deswegen ist die Vergesellschaftung der Reproduktionsarbeit nur mit dem Sturz des Kapitalismus permanent umsetzbar, was man auch gut am Roten Wien sieht.
Deswegen muss eine revolutionäre Partei die Forderungen nach Enteignung und Vergesellschaftung des Wohnraums sowie der Reproduktionsarbeit unter Kontrolle der Beschäftigten fordern. Kommunale Wasch- und Gemeinschaftsküchen, Räume, in denen man kollektiv zusammenkommen kann, flächendeckende Kinderbetreuung die ganze Zeit – all das kann Wirklichkeit werden, wenn wir anfangen, Wohnraum kollektiv zu denken und bewusst einzufordern. Dies sind Punkte, die helfen, die Doppelbelastung von Frauen zu verringern, und sie stellen den Anfang dar, auch Reproduktionsarbeit gesellschaftlich auf alle Hände zu verteilen. Darüber hinaus gibt es noch einiges anderes, was in Hinblick auf Diskriminierung und Wohnraum gefordert werden sollte, wie beispielsweise:
- Weg mit Rassismus und Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt: Kontrolle und Offenlegung der Wohnungsvergabe!
- Barrierearmut in allen Wohnungen: Wohnungen müssen für Menschen mit Behinderung zugänglich sein, außerdem soll die Pflege ausgebaut werden.
- Die Wohnung denen, die sie brauchen: Gegen jede Zwangsräumung! Umwidmung und Enteignung von leer stehendem Wohnraum sowie Spekulationsobjekten zu Schutzräumen für Frauen, Queers und Jugendliche sowie zur Unterbringung von Geflüchteten!
- Umstrukturierung des Wohnraums: Für größere Wohneinheiten mit Gemeinschaftsräumen, kommunalen Wasch- und Gemeinschaftsküchen!
Um der Wohnungsknappheit entschlossen entgegenzutreten und es gar nicht erst zuzulassen, dass Immobilienkonzerne massiv Kohle scheffeln können, braucht es:
- Wohnraummangel? Nein, danke! Für eine Wohnbauoffensive, finanziert durch Besteuerung der Reichen und erleichterten Zugang zu diesen Wohnungen, Kontrolle der Mietverträge und der Hausverwaltung durch Mieter*innenausschüsse!
- Mietpreisbindung/Mietendeckel, kontrolliert durch Mieter*innen und Gewerkschaften!
- Entschädigungslose Enteignung der großen Immobilienkonzerne unter Arbeiter*innen- und Mieter*innenkontrolle!
- Offenlegung der Bilanzen von Immobilienkonzernen unter Hinzuziehung von Expert*innen, die das Vertrauen der Mieter*innen- und Arbeiter*innenbewegung besitzen! Für Grundsteuer und Reparaturkosten zahlen Mieter*innen nicht!




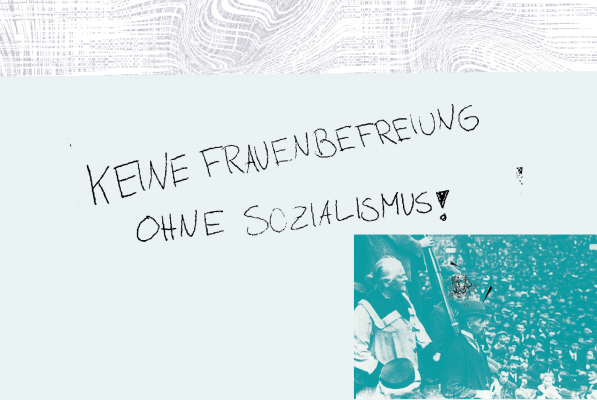

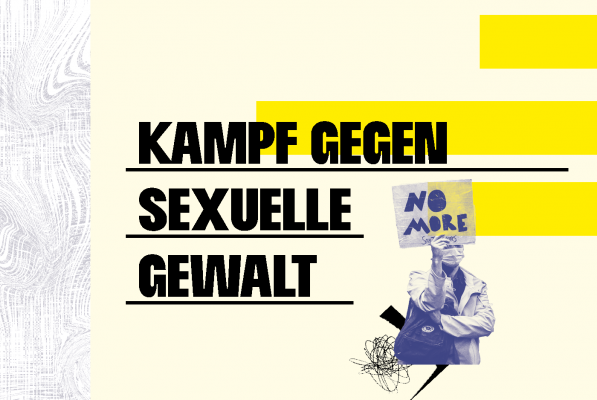


„Die Häuser denen, die drin wohnen!“ würde heißen, dass die Häuser den Bewohnern gehören. Ergo: Hauskollektive, die sich kommunal vernetzen. Ihr beschränkt die Eigentumsfrage auf kommunales Eigentum und Mieterkontrolle. Das ist unmarxistisch.