Bildung & Uni im Kapitalismus
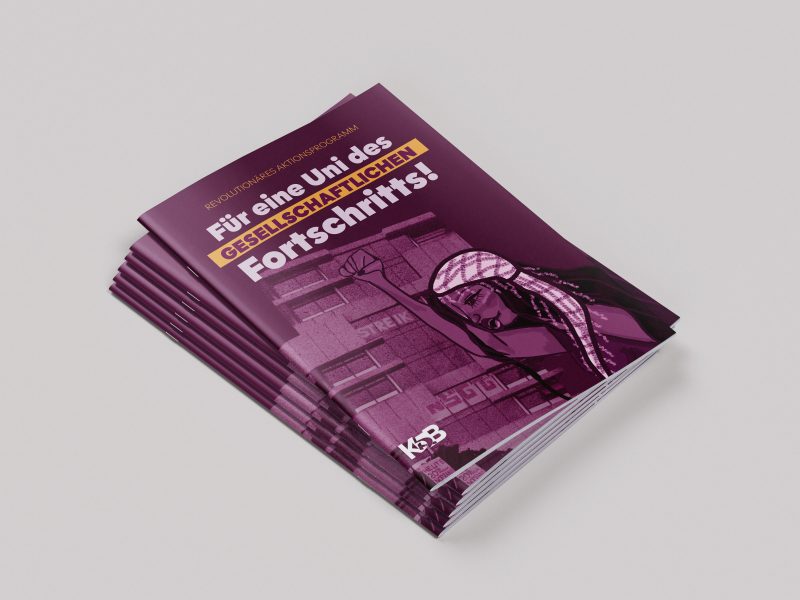
Im Zuge der Entwicklung des Kapitalismus veränderte sich die Stellung von Universitäten und Hochschulen im Verhältnis zu Ökonomie und Politik beträchtlich. Die Rolle, Größe, Bedeutung und der Wandel der Universität spiegeln dabei selbst veränderte Erfordernisse des Gesamtkapitals und damit verbunden des bürgerlichen Staats- und Herrschaftsapparates wider. Grundsätzlich dient die Strukturierung des Bildungsbereichs immer den Interessen des Gesamtkapitals.
Doch dieses setzt sich selbst immer erst als Resultat gesellschaftlicher Kämpfe innerhalb und unter verschiedenen/r Klassen durch. Die Erfordernisse des gesellschaftlichen Gesamtkapitals sind dabei keineswegs bloß die Summe einzelner Kapitalinteressen. Im Gegenteil, vom Standpunkt der Einzelkapitale, der einzelnen konkurrierenden Unternehmen, erschienen die für das Gesamtsystem notwendigen Bildungskosten als zusätzliche Ausgaben, als „Verschwendung“, auch wenn sie natürlich von qualifizierten Arbeitskräften profitieren. Vom Standpunkt des Gesamtkapitals und zur Reproduktion des kapitalistischen Systems hingegen ist die Herausbildung von Akademiker:innen und der damit einhergehenden Qualifikation eine Notwendigkeit für den unmittelbaren Produktionsprozess (z. B. in der Arbeit von Ingenieur:innen, Techniker:innen, Chemiker:innen usw.), für die Forschung, in den staatlichen Institutionen (Verwaltung, Gerichte, Repressionsapparat), für die Ausbildung weiterer Arbeitskräfte (z. B. Lehrer:innen) sowie für die soziale und medizinische Versorgung (Ärzt:innen, Sozialarbeiter:innen usw.).
Um diesen, in letzter Instanz selbst von der Akkumulationsbewegung des Kapitals abhängigen Anforderungen zu entsprechen, muss der Staat als ideeller Gesamtkapitalist fungieren. Die Bildung wird nicht nur an den Universitäten durch den bürgerlichen Staat organisiert. Dementsprechend gibt es auch staatliche Regularien, um sie zu ordnen, selbst wenn immer mehr Institutionen privat betrieben werden. Da die Akkumulation des Gesamtkapitals demnach auch die Ausbildungsbedingungen bestimmt, wirkt sich deren Veränderung auf die Hochschulen aus, wenn auch in der Regel zeitlich verschoben und über verschiedene gesellschaftliche Kämpfe und Institutionen (darunter nicht zuletzt die Eigendynamik der Institution selbst) vermittelt.
Beispielhaft können wir uns die Lage nach dem 2. Weltkrieg ansehen, wo das sogenannte „Wirtschaftswunder“ eine beschleunigte Akkumulation darstellte. Dieser Boom sorgte dafür, dass mehr qualifizierte Arbeitskräfte benötigt wurden. Das wiederum führte zu einer „Vermassung“ der Universitäten und auch dazu, dass immer mehr Studierende nach ihrem Abschluss lohnabhängig werden. Durch die Expansion der Universität gab es auch gleichzeitig einen erhöhten Bedarf an Ausbilder:innen und Lehrer:innen einerseits, an qualifizierten Kräften, die im staatlichen Dienst stehen sollten, andererseits. Die oft beklagte Verschulung der Unis, die Bolognareformen usw. sind Ausdruck dafür, die nötige akademische Arbeitskraft möglichst effektiv zu liefern.
Wissenschaft und Forschung als Produktivkraft
Im Zuge der Entwicklung des Kapitalismus bilden sich notwendigerweise immer größere Kapitale. Dies wiederum steigerte nicht nur den Bedarf nach wissenschaftlich gebildeter Arbeitskraft in allen Sphären, sondern führte auch dazu, dass Forschung und Entwicklung gerade im industriellen Bereich nur auf großer Stufenleiter und mit immensen Mitteln organisiert werden können. Daher sind die Universitäten, wenn auch in verschiedenen Formen, eng an die Bedürfnisse des Kapitals angepasst – einerseits um deren Inhalte (mit) zu bestimmen, andererseits auch, um Kosten für Entwicklung und Forschung, die ansonsten vom privaten Kapital alleine vorgeschossen werden müssten, zumindest teilweise auf den Staat abzuwälzen. Stiftungen, Forschungsinstitutionen wie die Max-Planck-Gesellschaft und Drittmittel dienen dazu, diese Verbindung zu organisieren. Ähnliches gibt es auch im Bereich staatlicher Institutionen, wie z. B. in der vermehrten Kooperation von Bundeswehr und Universitäten (nicht nur auf technologischem Gebiet, sondern auch im Bereich der Sozialwissenschaften). Grundsätzlich entspricht diese Tendenz einer allgemeinen Entwicklung des Kapitalismus – der zunehmenden Vergesellschaftung der Produktion unter privater Aneignung.
Kosten
Die Kosten für den Bildungsbereich werden aus der sogenannten Revenue bezahlt. Diese umfasst Gehälter und andere Ausgaben, die aus der Lohnarbeit oder dem Mehrwert des Kapitals gedeckt werden und in Form von Abgaben und Steuern an den Staat gehen (dazu später noch einmal mehr). Diese Form kann durch private Universitäten (oder andere Bildungseinrichtungen) modifiziert werden, sodass Studierende direkt aus dem Einkommen ihrer Eltern oder aus eigener Arbeit diese Kosten bezahlen. Der Kampf um die Finanzierung der Universitäten, ihre Ausstattung, die Arbeits- und Lernbedingungen bildet daher auch einen wichtigen Teil des Klassenkampfes, sprich: Welche Klasse finanziert zu welchen Teilen die Universität selbst?
Rolle der Arbeit an der Uni
Die Arbeit der Angestellten an der Universität ist für die Reproduktion des Gesamtkapitals von enormer Wichtigkeit. Sie stellt aber eine Form der unproduktiven Arbeit dar, da sie nicht direkt zur Schaffung des Mehrwerts für ein Kapital beiträgt. Das ändert nichts daran, dass sie in vielfältiger Weise mittelbar in den Verwertungsprozess eingeht.
Doch die Expansion hochqualifizierter Arbeitskraft birgt Widersprüche. Höhere Bildungskosten etwa könnten den Wert der Ware Arbeitskraft erhöhen, was nicht dem Interesse der Einzelkapitale entspricht. Gleichzeitig versuchen die Kapitalist:innen, die Gesamtkosten zu senken. Daran können wir also erkennen, wie sich die Interessen des einzelnen Unternehmens und des Gesamtkapitals widersprechen. Zudem wird die Finanzierung unproduktiver Arbeit durch Schwankungen der Mehrwertproduktion bestimmt. Im Fall der Hochschulen führt das zu staatlich vermittelten Angriffen auf die Universitätsstruktur, also Flexibilisierungen, Rationalisierungen und Reformen wie dem Bologna-Prozess. Ziel dabei ist es u. a., die Dauer des Studiums zu verkürzen und die zukünftigen Arbeitskräfte stärker auf ihre späteren Berufe zu orientieren, während Lohnkosten wissenschaftlicher Mitarbeiter:innen niedrig und die Arbeitsbedingungen durch Befristungen, wie sie nur aufgrund des Wissenschaftszeitgesetzes möglich sind, prekär gehalten werden sollen. Daraus erklärt sich die Krisenhaftigkeit der Uni. In Zeiten der Überakkumulation und kapitalistischen Krise, wie wir sie heute erleben, sollen die Ausbildungskosten für das Gesamtkapital reduziert werden. Gleichzeitig soll die deutsche Wirtschaft durch qualifizierte Fachkräfte und exzellente Forschung angekurbelt werden und der Studienstandort auch für ausländische Studierende attraktiv sein. Dieser Widerspruch lässt sich innerhalb des Kapitalismus nicht wegreformieren, sondern allenfalls durch eine Neuordnung des Kapitalverhältnisses selbst, also durch Krise und Klassenkampf temporär neu bestimmen, verschärft also die Kämpfe um die Finanzierung dieser Institution und damit auch den Klassenwiderspruch um die und in der Universität – ganz unabhängig davon, ob die Beteiligten dies wollen oder nicht.
Umstrukturierung & die Klassenlage der Studierenden
An den Hochschulen in Deutschland sind aktuell (Wintersemester 2023/24) knapp 2,9 Millionen Studierende eingeschrieben, wovon 150.000 einem dualen Studium nachgehen. Es gab in Deutschland seit dem Wintersemester 1998/99 einen starken Anstieg der Studierendenzahlen. Waren damals nur rund 1,8 Millionen Studierende eingeschrieben, so stieg die Zahl insbesondere Anfang der 2010er Jahre immer weiter an. 2023 begannen 26,3 % aller Anfänger:innen im Bildungsgeschehen ein Studium, wohingegen 37,6 % eine Ausbildung starteten. 20 % der Studierenden haben einen Migrationshintergrund (internationale Studierende nicht mitgerechnet). Im Vergleich zu staatlichen Hochschulen erleben nichtstaatliche und davon besonders private Hochschulen weiterhin einen Boom. Im Wintersemester 2023/24 waren 13 % aller Studierenden (372.887 Personen) an einer privaten Einrichtung immatrikuliert. Mehr als 40 % der Studierenden, die in Teilzeit arbeiten, sind an privaten Hochschulen eingeschrieben.
Längst sind die Universitäten also nicht mehr nur Bildungsstätten der herrschenden Klasse, wie es noch die Realität im 19. und 20. Jahrhundert darstellte. So schrieb Trotzki 1910: „Die Universität ist die letzte Etappe der staatlich organisierten Ausbildung der Söhne der besitzenden und herrschenden Klassen, wie die Kaserne das letzte Ausbildungsinstitut für die junge Generation der Arbeiter und Bauern ist. [ … ] Die Universität bildet prinzipiell für den Einsatz in der Verwaltung, für die Führung und Herrschaft aus.“
Auch wenn letztere Funktion ebenso wie jene der Ideologieproduktion zweifellos erhalten blieb, so hat sich selbst in diesem Bereich die Rolle der Universitäten deutlich verändert. Die Ideologieproduktion und zahlreiche akademisch qualifizierte Verwaltungstätigkeiten haben im Kapitalismus des 20. und 21. Jahrhunderts derart an Umfang zugenommen, dass sie von Angehörigen der lohnabhängigen Mittelschichten oder der oberen Schichten der Arbeiter:innenklasse verrichtet werden müssen und nicht primär von den Kindern der besitzenden Klassen. Generell können wir auch an der Ausdehnung und Ausdifferenzierung des Produktionsprozesses und von Forschung und Entwicklung gerade nach dem Zweiten Weltkrieg beobachten, dass es für immer mehr Lohnabhängige notwendig wird, eine Ausbildung an der Hochschule zu absolvieren. Ein Beispiel hierfür ist auch die Professionalisierung von Ausbildungsberufen. So gibt es immer mehr Studiengänge im Bereich Erziehung, soziale Arbeit und Pflege, wenngleich diese als klassische soziale Ausbildungsberufe gelten. Grund hierfür sind auch die steigenden Anforderungen an die „Ware Arbeitskraft“ und somit auch ihre Reproduktion. Der Mythos, dass die meisten Studierenden keinen Klassenhintergrund als Kinder von Lohnabhängigen (wir sprechen von Klassenhintergrund, da die Klassenzugehörigkeit der Studierenden in etlichen Fällen noch nicht festgelegt ist und die Universität auch ein mögliches Mittel ist, von einer Klasse in eine andere aufzusteigen) hätten, hält sich weiterhin hartnäckig. An den staatlichen Universitäten finden sich natürlich Studierende aus verschiedenen Klassen, inklusive solcher aus der Arbeiter:innenklasse. Auch wenn ein bedeutender Teil der Kapitalist:innenklasse Unis besucht, so stammt der größte Teil der Studierenden aus folgenden drei gesellschaftlichen Klassen/Schichten: A aus dem Kleinbürger:innentum, vor allem aus dem städtischen; B aus den lohnabhängigen Mittelschichten und C aus der Arbeiter:innenklasse, dabei jedoch vor allem aus der Arbeiter:innenaristokratie und akademisch gebildeten Schichten der Klasse. Diese Herkunft entspricht nicht notwendig ihrer Zukunft als Schicht/Klasse, aber aufgrund der Tendenz zur Proletarisierung auch wissenschaftlich gebildeter Arbeitskraft steht einem größer werdenden Teil eine Zukunft als Lohnabhängige bevor (und zwar nicht nur für den Fall, dass sie das Studium abbrechen und andere Jobs finden müssen).
Dabei bilden die lohnabhängigen Mittelschichten den Kern der zukünftigen akademisch gebildeten Arbeitskräfte. Im Vergleich zur Masse der Arbeiter:innenklasse und auch der Arbeiter:innenaristokratie wird ihre Arbeitskraft (noch) nicht reell unter das Kapital subsumiert (wie z. B. die „normale“ industrielle Arbeit, wo die Arbeitskraft zum Anhängsel der Maschine wird). Das umfasst zum Teil Kommandofunktionen des Kapitals (z. B. im Staatsdienst und im Repressionsbereich) und zum Teil, dass ihre Arbeit dem Kapital noch nicht voll untergeordnet ist (z. B. in der universitären Forschung). Allerdings erleben wir auch hier massiv fortschreitende Proletarisierungsprozesse, wo die technische Entwicklung eine Art Taylorisierung der Kopfarbeit zum Übergang lohnabhängiger Mittelschichten ins Proletariat (v. a. in die Arbeiter:innenaristokratie) befördert.
Gleiches gilt andererseits nicht im selben Umfang für die privaten Hochschulen, deren Ziel durchaus die Ausbildung der Kinder der herrschenden Klasse (und in Teilen auch des gehobenen Kleinbürgertums) ist. Der Zugang für Studierende mit einem anderen Klassenhintergrund bleibt verwehrt, da sie die horrenden Studiengebühren nicht tragen können. Doch da diese Institutionen insbesondere der Klassenreproduktion dienen, ist dies nicht verwunderlich, sondern genau so gewollt. Auch zwischen diesen gibt es Unterschiede: Manche sind hochspezialisiert, andere dienen dazu, dass auch die Bourgeoisie-Sprösslinge ohne viel Aufwand einen akademischen Abschluss erhalten können (wenn man Papas Millionenunternehmen erbt, wäre ja wenigstens ein Bachelor ganz nett), und wiederum andere, wie die Business Schools, sind Elitehochschulen der herrschenden Klasse. Dennoch gibt es auch private Hochschulen, die grundsätzlich auch den Kindern der Arbeiter:innenklasse einen Zugang gewähren. Hierbei handelt es sich dann um duale Studiengänge, bei denen der Praxispartner die Studienkosten übernimmt. Vom Gehalt bleibt dann natürlich trotzdem wenig übrig und durch die Belastung stellt sich auch die Frage, wie das restliche Leben der Studierenden finanziert werden soll.
Grundsätzlich sind die Universitäten und Hochschulen jedoch weiter sozial extrem selektive Institutionen, auch wenn der Anteil von Studierenden aus lohnabhängigen Verhältnissen mit der massiven Ausweitung der akademischen Ausbildung in absoluten Zahlen stark gestiegen ist.
Das verdeutlicht ein Vergleich der „Bildungsherkunft“ von Studienanfänger:innen im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung dieser Altersgruppe. So betrug 2022 der Anteil von 18–25-Jährigen mit mindestens einem Elternteil mit einem Hochschulabschluss 28 %; unter den Studienanfänger:innen stellten sie jedoch 53 %! Umgekehrt sind Kinder von Menschen ohne Schulabschluss mit nur 2 % gegenüber 6 % in der Gesamtbevölkerung krass unterrepräsentiert, ebenso Kinder von Eltern, die über kein Abitur, sondern „nur“ über eine Berufsausbildung verfügen (30 % der Studienanfänger:innen gegenüber 53 % des Jahrgangs).
Im Klartext: Die unteren Schichten der Arbeiter:innenklasse sind faktisch von den Hochschulen ausgeschlossen. Die Kernschichten der produktiven industriellen Lohnarbeit wie auch die Masse von Beschäftigten in den Dienstleistungsberufen sind extrem unterrepräsentiert. Diese Benachteiligung setzt sich auch im Studium mehrfach fort. Erstens sind die Studierenden aus „bildungsfernen“ und damit auch ärmeren Schichten deutlich mehr dazu gezwungen, während des Studiums zu jobben. Zweitens vermittelt sich im schulischen wie im akademischen Alltag immer auch der Druck der Normen und Erwartungen des akademischen, bildungsbürgerlich geprägten Milieus gegenüber den Studierenden aus anderen Klassen und Schichten. Der selektive Charakter des Hochschulsystems spiegelt sich schließlich auch in höheren Abbruchquoten von Studierenden aus unteren und Kernschichten der Arbeiter:innenklasse wider.
Diese klassenspezifische Selektion trifft verschärft Studierende aus migrantischen Communitys. Auch wenn der Anteil von Studierenden mit Migrationshintergrund gestiegen ist, liegt ihr Anteil deutlich unter dem Anteil an der Gesamtbevölkerung, was die rassistische Unterdrückung in allen gesellschaftlichen Bereichen und die Verdrängung der Arbeitsmigrant:innen in weniger oder schlecht qualifizierte Arbeit widerspiegelt.
Der Anteil von weiblichen Studierenden schließlich ist in den letzten Jahrzehnten stetig gestiegen. Mittlerweile beträgt der Anteil Absolventinnen der Universitäten rund 50 %. Die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung der Gesellschaft reproduziert sich hier jedoch in der Studienwahl, sodass bestimmte Studiengänge (z. B. technische und naturwissenschaftliche) nach wie vor klar männlich dominiert sind. Zweitens findet die geschlechtsspezifische Selektion vor allem beim Berufseinstieg und im Berufsleben selbst statt, nicht direkt beim Zugang zur Universität. Generell macht sich die Krise des Hochschulsystems für die Studierenden mehrfach drückend deutlich.
Erstens durch eine immer stärkere Ausrichtung der Lehrpläne der Unis hin zu den anvisierten zukünftigen Berufsanforderungen.
Ob diese nach Abschluss wirklich den Erfordernissen oder dem beruflichen Alltag entsprechen, ist jedoch zweifelhaft und aufgrund der kapitalistischen Konkurrenz notwendigerweise immer ungewiss.
Zweitens werden kritische oder auch nur stärker universalistisch orientierte Inhalte an den Rand des universitären Betriebs gedrängt, insbesondere in den ersten Studienjahren.
Drittens erhöht sich an den Hochschulen der Druck gegenüber den Studierenden. Sie müssen ihre Leistung mit maroder und unterfinanzierter Infrastruktur erbringen – und das unter prekäreren Einkommensbedingungen, die sie in Billigjobs (inklusive einer Lohndrückerfunktion gegenüber anderen Beschäftigten) und/oder in Verschuldung zwingen.
Viertens erwartet viele, selbst wenn sie ihr Studium in der Zeit und mit guten Noten absolvieren, eine zunehmend unsichere Zukunft mit befristeten und unsicheren Beschäftigungsverhältnissen.
Fünftens reproduziert die Universität die für jede Klassengesellschaft konstitutive Trennung von Hand- und Kopfarbeit. In einigen Fällen wird diese noch dadurch verstärkt, dass Absolvent:innen von Hochschulen als Vorgesetzte Kommandofunktionen über fremde Arbeit ausüben und somit der Masse der Lohnabhängigen als verlängerter Arm des Kapitals gegenübertreten. Oder sie nehmen im Staatsdienst die Rolle von Entscheidungsträgern bei Behörden ein, fungieren also als Personifikation der Staatsgewalt. Aber auch dort, wo diese nicht der Fall ist, führt die verwurzelte Trennung von Hand- und Kopfarbeit dazu, dass sich selbst lohnabhängige oder auch proletarisierte „Kopfarbeiter:innen“ den „normalen“, vor allem manuell Arbeitenden als „überlegen“ vorkommen. Dieser aus dem bildungsbürgerlichen Milieu stammende Standesdünkel wird durch die kapitalistische Entwicklung, durch die Tendenz zur Proletarisierung intellektueller oder akademisch gebildeter Arbeit, objektiv unterminiert. Aber in vielen Fällen bleibt das Bewusstsein der Studierenden und erst recht der Absolvent:innen hinter dieser Entwicklung zurück, klammert sich an im Grunde reaktionäre, von der Zeit längst überholte und oft verklärte Vorstellungen der universitären „Unabhängigkeit“ und „Selbstbestimmung“. Dies stellt nicht nur eine romantisierende bürgerliche Ideologie dar. Sie bildet auch ein Hindernis für den notwendigen, kollektiven, mit den Mitteln der Arbeiter:innenklasse und gemeinsam mit allen Lohnabhängigen zu führenden Widerstand gegen die Verschlechterung der Lage der Studierenden.
Rollback an den Unis
Die Zeiten des Fordismus sind vorbei, zumindest in den imperialistischen Kernzentren. Bandarbeit und Massenabfertigung stellen nicht länger den zentralen Arbeitsprozess dar. Teilweise wurden sie ersetzt, teilweise in Halbkolonien ausgelagert, auch wenn zugleich z. B. in der Logistik neue, gering qualifizierte Jobs entstehen (und dieser Prozess einer stärkeren Teilung zwischen Hand- und Kopfarbeit wie auch einer Entwertung letzterer mit der Ausweitung von AI unter kapitalistischen Bedingungen massiv zunehmen wird). Das Kapital benötigt aber auch vermehrt hochqualifizierte Arbeitskräfte, z. B. Ingenieur:innen, aber auch Lehrkräfte und Forscher:innen, die die wirtschaftliche Innovation vorantreiben und somit den Mehrwert steigern sollen. Das macht eine längere Ausbildung nötig, welche die Arbeiter:innen vorbereiten soll. Natürlich ist eine solche Ausbildung für die Unternehmen wenig ertragreich, weswegen der Staat als ideeller Gesamtkapitalist die Aufgabe übernehmen muss, die Reproduktion der Ware Arbeitskraft zu sichern.
Nichtsdestotrotz ist die Uni aber auch ein Ort der Ideologieproduktion. Das gilt insbesondere für die Geistes- und Sozialwissenschaften, auch wenn sie sich einen besonders kritischen Anstrich geben. Genau dieser macht es jedoch möglich, diese Ideologieproduktion zu verschleiern und ihr eine Legitimation zu verschaffen. In der Soziologie werden z. B. Geschlechterverhältnisse, Rassismus und Armut kritisch betrachtet. Auch vor dem Kapitalismus wird nicht Halt gemacht. Eine revolutionäre Perspektive jedoch, die erklären kann, dass Unterdrückung und Ungleichheit der Klassengesellschaft entspringen und dem Kapital nützen, sucht man bis auf einzelne Stimmen vergeblich. Stattdessen soll die bürgerliche Demokratie gestärkt werden, ein starker Sozialstaat müsse her. Die bürgerliche Gesellschaft wird legitimiert. Ferner wird von Schichten und Habitus anstatt von Klassenverhältnissen gesprochen, was die Möglichkeit des Aufsteigens innerhalb dieser Schichten suggeriert. Dann fehlt es am kulturellen Kapital und nicht am Besitz der Produktionsmittel, um in eine der besitzenden Klassen aufzusteigen. Neben diesen liberalen und reformistischen Verklärungen der bürgerlichen Gesellschaft hat sich gerade in den Kultur-, Geistes- und Sozialwissenschaften in den letzten Jahrzehnten der Postmodernismus breitgemacht. Er tritt als pseudo-radikale Kritik auf – und zwar nicht so sehr des Kerns der bürgerlichen Wissenschaft, sondern jeder Gesellschaftstheorie, die die bestehende kapitalistische Ordnung nicht nur kritisieren, sondern revolutionär durch eine vernünftige, nach den Bedürfnissen der Gesellschaft selbst eingerichtete klassenlose Gesellschaft ersetzen will
Doch im Zuge der aggressiveren Außen- wie Innenpolitik wie auch des Aufstiegs der Rechten werden selbst reformistische, liberal-progressive Ideologien, die Frauen- und Genderstudies und andere fortschrittliche Lehrstühle und Professuren zurückgedrängt. Im Extremfall kann dies sogar mit der Kriminalisierung antiimperialistischer und antikolonialer Inhalte einhergehen.
So wurden die Universitäten in den letzten Jahren – insbesondere auch im Zuge der Kriminalisierung der Palästinasolidarität – auch zu einem Schauplatz der Durchsetzung der deutschen Staatsräson. Das heißt, in der gegenwärtigen Periode sollen kritische, revolutionäre, antiimperialistische und marxistische Ideen nicht nur ideologisch bekämpft und institutionell marginalisiert – eine Aufgabe, die die bürgerliche Universität immer schon hatte –, sondern auch regelrecht kriminalisiert werden. Das heißt, neben dem Kampf gegen bürgerliche Ideen tritt für Marxist:innen an den Universitäten auch der Kampf für die Freiheit des Denkens selbst, eine Aufgabe, die sich einst eigentlich die bürgerliche Revolution auf die Fahnen schrieb, von der jedoch die imperialistische Bourgeoisie nichts mehr wissen will und kann.
Mehrwert & Revenue
Neben der ideologischen Auseinandersetzung spielen Forschung und Innovation eine gewichtige, seit dem Beginn der imperialistischen Epoche zunehmend unverzichtbare Rolle. Schließlich ist die Wirtschaft drauf angewiesen, dem tendenziellen Fall der Profitrate etwas entgegenzusetzen (auch wenn der langfristig natürlich unausweichlich ist). Profitablere Produktionsweisen, Entwicklung neuer Produkte und nicht zuletzt die effektivere Ausbeutung von Arbeitskräften (BWL sei Dank) sind hier wichtig. Auch die Entwicklung von Kriegstechnologie wird vorangetrieben. Dieses Verhältnis machen auch Drittmittelfinanzierungen und Exzellenzinitiativen deutlich: Im Jahr 2022 erhielten die Hochschulen rund 27 Milliarden Euro an Grundmitteln und 10,4 Milliarden Euro an Drittmitteln, was einer Drittmittelquote von 28 % entspricht. Der Bund hat seinen Anteil an der Drittmittelfinanzierung über die Jahre deutlich gesteigert und war 2022 größter Drittmittelgeber, während die Einnahmen aus der Wirtschaft kontinuierlich zurückgegangen sind.
Die Uni hat also konkrete Aufgaben im kapitalistischen System, um dessen Fortbestand zu sichern, die Klassen zu reproduzieren und die Wirtschaft anzukurbeln. Trotzdem befinden sich weite Teile der Uni außerhalb des unmittelbaren Produktionsprozesses und werden der Sphäre der Reproduktion zugeordnet. Finanziert werden die Gehälter von Wissenschaftler:innen und anderen Mitarbeiter:innen wie bereits erwähnt aus der sogenannten Revenue und die Arbeitsverhältnisse an der Uni werden dem Bereich der unproduktiven Arbeit nach Marx zugeordnet. Unproduktive Arbeit ist ein zentraler Begriff in der Analyse des Kapitalismus. Sie bezeichnet nicht etwa Arbeit, die keinen Nutzen bringt, sondern solche, die keinen Mehrwert für ein Kapital schafft.
Mehrwert entsteht in der kapitalistischen Produktion durch die Ausbeutung der Arbeitskraft, die im Arbeitsprozess, der zugleich auch ein Verwertungsprozess ist, mehr Wert schafft, als den Reproduktionskosten der Ware Arbeitskraft entspricht. Diese Differenz nennt man Mehrwert. Unproduktive Arbeit hingegen kann durchaus auch neue Produkte schaffen, z. B. wenn die Universität direkt Menschen in der Mensa beschäftigt, aber nicht als privater Wirtschaftsbetrieb fungiert. Dieselbe Arbeit wird zur produktiven Arbeit, wenn die Mensa privatisiert und von einer Firma zur Erwirtschaftung von Profit betrieben wird. Ob eine Arbeit produktiv oder unproduktiv ist, hat also nichts damit zu tun, ob die Arbeit nützlicher oder besser ist, sondern damit, ob der/die Beschäftigte direkt für ein Kapital arbeitet oder nicht. So kann auch die Arbeit an einer Universität (oder einer Schule) durch die Privatisierung zu einer Produktionsstätte von Mehrwert für ein Hochschulkapital werden – was jedoch nichts über die Qualität dieser Arbeit für die Studierenden oder die Wissenschaft aussagt.
Dieses Phänomen treffen wir natürlich nicht nur an der Uni an. Marx begreift den Kapitalismus als ein Produktionsverhältnis, das in Wechselwirkung mit den Produktivkräften steht. Dieses Verhältnis beschreibt die Art und Weise, wie Arbeit im Kapitalismus organisiert und klassenspezifisch aufgeteilt wird, etwa in Lohnarbeit und Kapital. Neben der Produktion spielen dabei ideologische und staatliche Überbaufunktionen wie Verwaltung, Polizei oder Bildungssysteme eine Rolle, die das System stabilisieren und absichern. Unproduktive Arbeit ist oft in der Zirkulationssphäre angesiedelt. Dort verkürzt sie etwa die Umlaufzeit des Kapitals und wirkt indirekt auf die Profitrate. Tätigkeiten wie Verwaltung, Marketing oder tw. Vertrieb fallen auch in diesen Bereich. Diese Arbeit wird als notwendig für das Gesamtkapital betrachtet, schafft aber selbst keine Werte.
Ein weiterer Bereich unproduktiver Arbeit ist die staatlich organisierte Herrschaftssicherung. Dazu gehören Institutionen wie Justiz, Polizei, Militär oder staatliche Verwaltung. Diese Arbeit wird über die sogenannte Revenue finanziert, einer Unterkategorie des Mehrwerts. Die Revenue umfasst Gehälter und andere Ausgaben, die aus der Besteuerung der Lohnarbeit oder des Kapitals gedeckt werden (wobei für das einzelne Kapital die Revenue einen Abzug vom Profit darstellt). Auch Bildung und Forschung zählen oft dazu, da sie entweder der Reproduktion der Arbeitskraft und der Stabilisierung ideologischer Herrschaftsverhältnisse dienen oder aber so hohe Kosten bei unsicherem Ausgang mit sich tragen, dass die Privatkapitale deren Auslagen nicht übernehmen, sondern lieber vom Staat finanziert und organisiert sehen wollen.
Eine dritte Kategorie unproduktiver Arbeit sind persönliche Dienste, wie sie etwa in der bürgerlichen Kleinfamilie oder im privaten Haushalt erbracht werden. Auch diese Tätigkeiten tragen nicht direkt zur Produktion von Mehrwert bei, sondern erhalten lediglich die Arbeitskraft. Sie sind oft Ausdruck eines Paradoxons: Obwohl die Revenue aus der Mehrwertproduktion stammt, führt ihre Ausweitung nicht zu mehr Freizeit, sondern zu potenzieller Intensivierung der Arbeit. Die Finanzierung dieser Tätigkeiten aus der Revenue birgt Widersprüche. Höhere Bildungskosten etwa könnten den Wert der Ware Arbeitskraft erhöhen, was für einzelne Kapitalist:innen problematisch wäre. Gleichzeitig versuchen die Kapitalist:innen, die Gesamtkosten zu senken. Dieser Konflikt zeigt, wie sich die Interessen des individuellen Kapitals und des ideellen Gesamtkapitals widersprechen. Die Finanzierung unproduktiver Arbeit ist von den Schwankungen der Mehrwertproduktion abhängig. Dies führt zu staatlich vermittelten Flexibilisierungen, Rationalisierungen und Reformen wie dem Bologna-Prozess. Forschung und Lehre stehen dabei im Spannungsfeld zwischen ideologischer Herrschaftssicherung und den Profitinteressen einzelner Kapitalist:innen. Marx bezeichnet diese Nebenkosten als „faux frais“, die für die Stabilität des Systems zwar unvermeidbar, jedoch keine produktiven Beiträge zur Kapitalakkumulation sind. Die unproduktive Arbeit verdeutlicht somit die Widersprüche des Kapitalismus. Sie ist abhängig von der Produktivität der produktiven Arbeit und trägt gleichzeitig zu deren Entwicklung bei, indem die Reproduktionsarbeit die Produktivität erhält und neue Technologien an den Universitäten entwickelt werden. In diesem Spannungsfeld wird sichtbar, wie die Produktionsverhältnisse langfristig zu einer Fessel für die Entwicklung der Produktivkräfte werden können. Demnach lässt sich also auch herleiten, warum in Zeiten der Krise auch im Bildungswesen gekürzt und umstrukturiert werden muss, wenngleich die herrschende Klasse eigentlich auf verschiedenste Elemente der Universität zur Herrschaftssicherung und Profitmaximierung angewiesen ist.
Heutzutage prägen Kürzungen, Befristungen und das New Public Management die Universitäten, doch welche politischen Entwicklungen in Deutschland haben dazu geführt?
Von der Nachkriegszeit bis zur Bologna-Reform
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Universitäten in der Bundesrepublik Deutschland weitgehend ohne personelle Veränderungen weitergeführt. Dennoch begann sich die Funktion der Universität zu ändern. Es gab Expansionen im Bereich der Sozialwissenschaften, auch um „mehr Demokratie zu lehren“, wie es durch die Besatzungsmacht der Alliierten auch in anderen Bereichen, wie zum Beispiel dem öffentlichen Rundfunk, durchgesetzt wurde. Gleichzeitig strömten immer mehr Studierende aufgrund des „Wirtschaftswunders“ der Nachkriegszeit in die Universitäten. Die „Vermassung“ der Universitäten wurde real. Viele Professor:innen und Dozent:innen, die während der NS-Zeit lehrten, blieben aber dennoch weiter im Amt. Der Spruch „Unter den Talaren – Muff von 1.000 Jahren“ ist sicherlich auch heute noch vielen ein Begriff und stammt aus dieser Zeit.
Die Hochschulen standen in den 1960er Jahren vor einem entscheidenden Wandel. Der sogenannte Wissenschaftsrat propagierte eine „günstige Balance“ zwischen unbefristeten Dauer- und begrenzten Durchgangsstellen. In den 1970er Jahren setzte sich die Forderung nach Befristungen durch: Eine kurze, produktive Phase an der Hochschule sollte Platz für Innovation schaffen. Mit steigenden Studierendenzahlen wurde die Stellenteilung jedoch verschärft. 1985 führte die Regierung Kohl das Gesetz über befristete Arbeitsverträge mit wissenschaftlichem Personal ein, das die Unsicherheit im akademischen Mittelbau weiter zementierte.
Mit der 6+6-Regel (2002) und dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz (WissZeitVG) von 2007 wurde das „Up-or-Out“-Prinzip eingeführt: Wer nach der Befristung keinen festen Platz erlangte, musste die Hochschule verlassen. Gleichzeitig wurden Drittmittel und Projektfinanzierungen zunehmend zur Grundlage akademischer Forschung, was Konkurrenz und Unsicherheit in den Universitäten verstärkte.
Die Bologna-Reform, die ab 1999 eingeführt wurde, zielte auf eine Vereinheitlichung des europäischen Hochschulsystems durch die Einführung von Bachelor- und Master-Abschlüssen. Es gab auch davor schon einige Bestrebungen zur Vereinheitlichung, aber diese Reform stellt die weitreichendste dar. Unter den Vorzeichen der notwendigen Vereinheitlichung von Europa als Block nach dem Fall der Sowjetunion sollte unter anderem die Flexibilisierung der Arbeitskraft gewährleistet werden. Durch die Einführung des European Credit Transfer Systems (ECTS) und den zweistufigen Abschlüssen sollte den Kapitalist:innen die Möglichkeit gegeben werden, die Abschlüsse von Bewerber:innen aus unterschiedlichen EU-Ländern besser vergleichen zu können. Das sollte natürlich auch die Konkurrenz der (zukünftigen) Arbeitskräfte weiter zuspitzen. Gleichzeitig sollte durch die Einteilung der Lerninhalte in Module dafür gesorgt werden, dass die Studierenden auch nur das lernen sollten, was sie später auf dem Arbeitsmarkt leisten sollten. Das ist aber auch eine Frage des Ideologiekampfs: Denn Studierende verinnerlichen so, dass sie flexibel sein müssen, lebenslang weiter lernen sollen und sich anpassen müssen, wenn sie „employable“ sein wollen.
Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) betonte, dass die Bologna-Reform primär der Förderung eines europaweiten Studierendenaustauschs dienen sollte. Tatsächlich führte die Reform jedoch zu einer Verdichtung der Studieninhalte, einer Verkürzung der Studienzeit und einer stärkeren Ausrichtung auf den Arbeitsmarkt. Insbesondere für einzelne Kapitalisten mit dem Bedarf nach qualifizierten Fachkräften ist es natürlich von großem Interesse gewesen, Studierende schneller in den Arbeitsmarkt integrieren zu können bei gleichzeitiger Ausbildung, die wesentlich praxisorientierter durchgeführt werden sollte. Studiengebühren wurden zeitweise eingeführt, insbesondere im Masterbereich. Trotz dieser Einschnitte wurde das Ziel eines echten europäischen Studienraums nicht erreicht. Von 2009 bis 2010 fanden in Deutschland massive Bildungsstreiks statt. REVOLUTION und Arbeiter:innenmacht forderten damals: Abschaffung aller Studiengebühren und vollständige Lehr- und Lernmittelfreiheit, Rückkehr zu einem weniger verschulten Studiensystem und die Abschaffung des Bachelor-Abschlusses, demokratische Kontrolle der Hochschulen durch Studierende, Lehrende und die Arbeiter:innenbewegung. Die Bologna-Reform wurde von weiten Teilen der Studierendenschaft als ein massiver Angriff auf das Bildungssystem angesehen. Besetzungen von Universitäten in Österreich, Italien und Deutschland unterstrichen die grenzübergreifende Dimension des Protests. Bei den Bildungsprotesten gingen allein in Deutschland 2009 bis zu 265.000 Studierende auf die Straße.
Zurückgenommen wurden zwar einzelne Punkte wie die Studiengebühren, massive Überfrachtung der Studiengänge und das extreme Auslassen theoretischer Grundlagen im Bachelor, aber der grundsätzliche Fokus blieb natürlich bestehen: Bachelor- und Masterabschlüsse existieren, wie wir wissen, weiterhin.
Dennoch gibt es vor allem in wissenschaftlichen und technischen Bereichen weiterhin einige, wenngleich wenige, Diplomstudiengänge, die sich durch die komplexe Tätigkeit der Ingenieur:innen begründen lassen.
Die Hochschulen in Deutschland haben seit den 1960er Jahren einen tiefgreifenden Wandel erlebt: von einer konservativen Institution mit geringerer Studierendenbeteiligung hin zu einem wettbewerbsorientierten System, das durch Drittmittel, Befristungen und Marktprinzipien geprägt ist. Die Bologna-Reform und das New Public Management sind Ausdruck dieses Umbaus, der die Bildung stärker den Interessen des Kapitals unterordnet.
Governance-Reformen
Die Struktur der Hochschule kann als Doppelstruktur verstanden werden. Einerseits gibt es die akademische Selbstverwaltung (welcher wir später einer ausführlichen Kritik unterwerfen wollen), andererseits gibt es auch eine Uni-Bürokratie, welche nicht von Studierenden, wissenschaftlichen Mitarbeiter:innen und Professor:innen besetzt ist. Das stellt ein widersprüchliches Spannungsverhältnis dar. Denn einerseits ist die Universität eine Körperschaft des öffentlichen Rechts mit Selbstverwaltungsrechten in Bezug auf den akademischen Bereich und andererseits eine staatliche Einrichtung. Die akademische Selbstverwaltung gilt als demokratisch, während die Zentralverwaltung hierarchisch organisiert ist. Diese basiert auf klaren Weisungen und Regeln. Demnach kommt es auch immer wieder dazu, dass die akademische Selbstverwaltung von der Politik und der Verwaltung zurechtgestutzt werden soll, um dieses Spannungsverhältnis zu lösen.
Aus diesem Grund kam es in den 1990er Jahren zu den sogenannten Governance-Reformen, welche verschiedene Probleme lösen und zu einer besseren Verzahnung der Doppelstruktur führen sollten. Die Probleme, welche hier angegangen werden sollten, sind die folgenden: die schwache Ausprägung der Zentralverwaltungen an den Universitäten, die nicht mehr zeitgemäße akademische Selbstverwaltung (z. B. Nichtangriffspakte unter Profs und mangelnde Professionalität) sowie die fehlende Möglichkeit, die wissenschaftliche Arbeit zu steuern.
Durch diese Reformen sollten die Unis „[…] in die Lage versetzt [werden], wie Unternehmen zu handeln, sich selbst zu managen, marktgerecht zu positionieren und gegenüber der Öffentlichkeit Rechenschaft abzulegen. Die Erwartung ist, dass sie dies selbst erheblich flexibler und effizienter tun, als wenn sie durch staatliche Bürokratien gesteuert werden.“ (Maasen und Weingart 2006: 23)
Dabei soll die Verwaltung als eine Art Hochschul-Management fungieren. Gleichzeitig geht das mit einem Bedeutungsabbau der akademischen Selbstverwaltung einher, denn Professuren sollen abgebaut und umgewandelt werden. Dabei gibt es eine Binnendifferenzierung zwischen S-Professuren und Tenure-Track-Professuren. S-Professuren sind Sonderprofessuren oder Stiftungsprofessuren, wobei es aber verschiedene Modelle gibt. Grundsätzlich sollen die Professor:innen mehr Forschung als Lehre betreiben und sind nebenbei auch in außeruniversitären Einrichtungen angestellt (z. B. NGOs, Forschungseinrichtungen, Stiftungen). Diese Professuren werden drittmittelfinanziert und somit kann davon ausgegangen werden, dass es auch eine Einflussnahme von Kapitalseite gibt. Zusätzlich erhöht das auch den Druck auf die Professor:innen, da diese Anstellungen unsicher sind und oft zeitlich begrenzt. Tenure-Track-Professuren (TTP) hingegen werden als Karrieresprungbrett bezeichnet. Inspiriert sind sie von Strukturen aus den USA und wurden in Deutschland 2017 eingeführt, um den Mangel an Jungprofessuren zu beseitigen. Für Jungprofessor:innen gibt es mit diesem Ansatz eine Art zeitlich befristete „Probezeit“ (ca. 6 Jahre) und bei einer positiven Evaluation kann dann auch eine Professur auf Lebenszeit „herausspringen“.
Auch das erhöht den Druck und die Unsicherheit. Dennoch wird es als innovativ beschrieben und soll angeblich auch die Planbarkeit der wissenschaftlichen Karriere verbessern, folgt aber ganz dem Muster des „Up-or-Out-Systems“. Ziel sollte es sein, bis 2025 ein Fünftel aller Professuren in eine solche TTP umzuwandeln. Nun sind im Jahr 2025 bereits über 40 % der Juniorprofessuren – das sind gut 1.300 Stellen – als TTP ausgestaltet. Doch das, was uns als Innovation verkauft wird, bringt Probleme mit sich. Die Ziele der Evaluation, denen sich die TTPs unterziehen müssen, sind bereits vor ihrer Anstellung festgelegt. Dabei kann es gut sein, dass diese nicht mit den Forschungszielen zusammenpassen und zu einer zusätzlichen Belastung führen. Außerdem gibt es sehr starre Gradmesser, wie z. B. die Anzahl der Publikationen (und deren Bedeutung – also Häufigkeit der Zitate usw.). Teilweise gehören zu den Kriterien auch das Einholen von Drittmittelfinanzierung, selbst wenn das für die Forschungsabsicht gar nicht nötig ist. Außerdem gibt es auch Einschränkungen in der Art der Publikation. Zusätzlich unterliegen die TTPs einem hohen Leistungsdruck, denn es sollen relevante Ergebnisse erzielt werden. Wer sich einmal damit beschäftigt hat, bemerkt, dass so der Publikationsbias (dieser geht davon aus, dass Publikationen mit positiven oder gravierenden Ergebnissen eher veröffentlicht werden als negative oder solche, in denen kaum Unterschiede zwischen den Kontrollgruppen bestehen) bestärkt wird.
Dieser Leistungsdruck besteht deswegen, weil die deutsche Wissenschaft einerseits in einer internationalen Konkurrenz steht und andererseits auch die Hochschulen untereinander konkurrieren. Um das zu unterstützen, gibt es auch die sogenannte Exzellenzinitiative, die besonders guten Unis mehr Förderung ermöglicht, wodurch dann auch die S-Professuren und TTPs finanziert werden können. Das ist als „Kampf um die besten Köpfe“ zu verstehen und soll zusätzliche Anreize bieten.
Die Lage der Beschäftigten: Rationalisierung & Kürzungen
Auch im Bereich der Wissenschaftler:innen, Lehrenden und Angestellten gibt es Unterschiede: Während es an der Hochschule auch Teile der Bourgeoisie und insbesondere der lohnabhängigen Mittelschichten gibt, deren Arbeitsbedingungen als privilegiert zu bezeichnen sind, wie z. B. Professor:innen, gibt es gleichzeitig eine hohe Anzahl an wissenschaftlichen Mitarbeitenden, die wenig Lohn erhalten, befristet und teilweise auf Projektbasis angestellt sind, und auch reguläre Arbeitskräfte, die bspw. in der Verwaltung, Mensa oder Reinigungskolonne arbeiten. Bei Letzteren ist es aber häufig so, dass diese bei externen Firmen angestellt sind und somit der Lohn gedrückt werden kann, da keine Tarifbindung besteht.
Generell können wir unter den Beschäftigten ebenso wie unter den Studierenden feststellen, dass jener Teil größer wird, der der Arbeiter:innenklasse angehört, auch wenn sich dies im vorherrschenden Bewusstsein längst nicht widerspiegelt, wo eigentlich kleinbürgerliches vorherrscht, der Klassenlage der Mittelschichten und des Kleinbürger:innentums entsprechend. Für den Klassenkampf und kommunistische Politik an den Universitäten stellt dies eine mehrfache Herausforderung dar. Erstens, weil es im Bewusstsein eine Tendenz zum Individualismus erhöht und selbst gewerkschaftliche Organisierung behindert, zweitens auch überhaupt erschwert, den Klassenstandpunkt der Arbeiter:innenklasse einzunehmen.
Wir können also sehen: Die Uni wird zunehmend rationalisiert und Innovation wird großgeschrieben. Grund dafür ist auch der tendenzielle Fall der Profitrate und die schlechte wirtschaftliche Lage Deutschlands. Durch diese Umstrukturierung soll die Wirtschaft angekurbelt werden und es sollen mehr Fachkräfte, die mehr Mehrwert erwirtschaften können, nach Deutschland geholt werden. Gleichzeitig geht das mit Angriffen an allen Ecken und Enden einher. Überall wird gespart und gekürzt. Auch in der Verwaltung, was zu einer massiven Arbeitsintensivierung führt.
Das sind also zwei Seite derselben Medaille des Angriffs, denn es ist nur logisch, dass das alle an der Universität betrifft. Wozu führt das aber nun? Einige Angriffe können wir bereits jetzt sehen, so wie das Streichen von sogenannten Orchideenfächern, die als exotisch gelten. Dabei trifft es besonders kleinere Fächer der Kultur- und Sozialwissenschaft, z. B. Japanologie. Andere treffen nicht nur einzelne Fächer wie z. B. Streichung von Studienplätzen und Arbeitsplätzen, Einstellungsstopps, Befristungen, schlechtere Betreuung von Studierenden, weniger Zugriffe auf Forschungsmaterialien (z. B. Bibliothek und digitale Zugriffe auf Fachpublikationen).
Gremien und Strukturen an der Hochschule
Wie genau die Struktur einer Universität aufgebaut ist, hängt allerdings von Bundesland und Universität ab. Dennoch wollen wir versuchen, eine abstrakte allgemeine Struktur darzustellen. So gibt es verschiedene Gremien, einerseits die universitären, andererseits die studentischen (die teilweise auf Forderungen der Studierendenbewegung der 1968er Jahre zurückgehen).
Das höchste Gremium in der akademischen Selbstverwaltung ist der Akademische Senat. Dieser entscheidet zu Themen wie wissenschaftlichen Entwicklungsfragen, der Zukunft der Studiengänge, der Geldverteilung und der Grundordnung der Hochschule. Aber es besteht natürlich auch eine Zusammenarbeit mit bzw. ein Abhängigkeitsverhältnis von den jeweiligen Landesregierungen, da diese die gesetzlichen Grundlagen und die Finanzierung der Hochschulen regeln. Die Landesregierung versucht natürlich auch, Einfluss zu nehmen. Dafür gibt es auch das Kuratorium, was dies strukturell absichert: Das Kuratorium ist ein besonderes Organ der Hochschule, welches i.d.R. vor allem aus außeruniversitären Mitgliedern besteht. Diese sind oftmals Abgeordnete oder auch in der Wirtschaft tätig. Wie das genau funktioniert ist aber abhängig vom jeweiligen Hochschulgesetz des Landes. In Sachsen-Anhalt hat bspw. das (Bildungs-)Ministerium das Vorschlagsrecht für ein Mitglied des Kuratoriums. Dieses muss dann im Anschluss noch vom Hochschul-Senat gewählt werden. Das Kuratorium unterstützt die Hochschule in allen wichtigen Angelegenheiten und fördert somit Profilbildung, Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit. Die ehrenamtlichen Mitglieder bleiben dazu fünf Jahre im Amt und zu den wichtigsten Aufgaben gehört z. B. die Genehmigung des Haushaltsplans, wodurch eine politische Einflussnahme ebenso möglich ist.
An der FU in Berlin sind aber neben den außeruniversitären Mitgliedern auch Vertreter:innen der verschiedenen Gruppen der Hochschule im Kuratorium vertreten.
Des Weiteren gibt es eine Ungleichverteilung im Akademischen Senat: Professor:innen sind in der Mehrzahl, wohingegen Studierende, wissenschaftliche Mitarbeiter:innen und Verwaltungsangestellte unterrepräsentiert sind. Somit können leicht Dinge beschlossen werden, die sich gegen die Interessen der Studierenden und der nichtprofessoralen Beschäftigten richten. Zum Beispiel wurde an der Uni Halle ein massiver Kürzungsplan durch die professorale Mehrheit verabschiedet, gegen die sich der Großteil der Studierendenschaft gestellt hatte und wogegen es auch eine Protestwelle gab. Diese Unterrepräsentation findet aber nicht nur im Akademischen Senat statt, sondern zieht sich auch durch alle anderen Gremien, an denen sich unterschiedliche Gruppen der Universität beteiligen, z. B. auch Fakultätsräte. Aber die Unterrepräsentation stellt hier nur ein Symptom des eigentlichen Problems dar. Denn das Wahlrecht an der Universität ist rückschrittlich ständisch, d. h., nur Mitglieder einer bestimmten Gruppe können aus ihrer Gruppe ihre Repräsentant:innen wählen. Zu Recht wurde das Ständewahlrecht abgeschafft, was einen Fortschritt darstellte, da es die Klassenherrschaft einer privilegierten Minderheit antidemokratisch absicherte.
Aber die extreme Unterrepräsentation von Studierenden im Akademischen Senat war nicht immer so extrem ausgeprägt. Von 1969 bis ca. 1973 war er in einigen Bundesländern und Universitäten viertelparitätisch organisiert, also in einem Verhältnis von 1:1:1:1. Das wurde durch die Student:innenbewegung in den 1960er Jahren erkämpft, welche sich für die demokratische Gruppenuniversität einsetzte, in der auch Studierende, wissenschaftliche und sonstige Mitarbeitende an der Uni auf Augenhöhe mit den Profs entscheiden konnten. Auch die studentischen Gremien sind aus diesen Initiativen heraus entstanden. Doch vieles wurde wieder zurückgenommen, da die herrschende Klasse der Meinung war, dass Punkte, die die Lehre betreffen, eher von den Professor:innen beschlossen werden sollten, welche nun eine Gewichtung von 50 % der Stimme dafür haben sollten. Allerdings gibt es hier auch eine Differenzierung zwischen den Lehrenden und Forschenden, denn diese 50 % beziehen sich nur auf die Lehrenden, aber eben nicht auf die Forscher:innen und wissenschaftlichen Mitarbeiter:innen. Somit kann die Macht der Professor:innen selbst auf formaler Ebene durch ein Bündnis der anderen Gruppen nicht gebrochen werden.
Kritik der akademischen Selbstverwaltung
Doch das Ideal der akademischen Selbstverwaltung, welches u. a. zu dieser viertelparitätischen Teilung im Senat führt, existierte schon davor. Zu verdanken haben wir es Humboldt, der inspiriert von der französischen Revolution dem preußischen Innenministerium klarmachen wollte, dass nur die institutionelle Autonomie der Universität den Fortschritt von Wissenschaft und Forschung garantiere. Der Staat müsse sich bewusst machen, dass es „immer hinderlich ist, sobald er sich hineinmischt, dass die Sache an sich ohne ihn unendlich besser gehen würde (…)“.
Jede Einmischung des Staates oder anderer nichtuniversitärer Stellen verletze laut ihm die Freiheit, welche die notwendige Voraussetzung für wissenschaftliche Selbstreflexion sei, verzerre die Idee der Wahrheit und verhindere so jede wirklich unabhängige Erkenntnis. Die Gewinnung von Wahrheit sei nur möglich unter striktem Absehen von ihrer praktischen Verwendung. Der Staat habe lediglich die finanzielle Unabhängigkeit der Universitäten zu garantieren. Dies wurde dann auch durchgesetzt, da der preußische Staat sich aufgrund von sozialrevolutionären Tendenzen für einige Reformen entscheiden musste, um die Arbeiter:innenklasse zu befrieden. Doch dies ist an mehreren Stellen ziemlich idealistisch.
1. Ist es fragwürdig, anzunehmen, dass es überhaupt keinen staatlichen Einfluss gibt. Wie wir bereits bei der Struktur der Universität gesehen haben, ist dieser durchaus vorhanden. Es ignoriert auch jegliche Funktion des Staates im Kapitalismus und die Aufgabe der Universitäten zur Reproduktion der Ware Arbeitskraft, der Ideologie- und Wissensproduktion. Denn wie wir bereits ausgeführt haben, hat der Staat ein großes Interesse daran, dass der Universitätsbetrieb in seinem Sinne funktioniert. Generell lässt sich in der imperialistischen Epoche mit der Entwicklung von großen Monopolen auch eine direktere Verzahnung von Kapital und Universität feststellen, die ihrerseits die Ideologie von der „Freiheit“ der Wissenschaft beständig unterminiert. Unsere Antwort besteht dabei nicht darin, einem falschen Ideal nachzutrauern, sondern für die gesellschaftliche Kontrolle der Universität, von Forschung und Lehre durch die Arbeiter:innenklasse zu kämpfen. Die gegenwärtige Krise der Hochschulen bildet dabei den Hintergrund dafür, den Kampf an den Unis in seinen Besonderheiten und zugleich als Teil des Klassenkampfes zu betrachten.
2. Auch die Loslösung des Wahrheitsgewinnes von jeglichem praktischen Nutzen ist idealistisch, da Forschung und Erkenntnisgewinn somit zu einem Selbstzweck anstatt zur objektiven Voraussetzung von gesellschaftlicher Veränderung werden. Das verstärkt die künstliche Trennung zwischen Kopf- und Handarbeit, die alle Klassengesellschaften prägt, die aber im Kapitalismus auf die Spitze getrieben wird und zu einer zusätzlichen Entfremdung der Arbeiter:innen im Produktionsprozess führt. Dennoch erkennen wir als Marxist:innen an, dass für den Fortschritt in der Wissenschaft teilweise das Loslösen von unmittelbarem praktischem Nutzen vonnöten ist, beispielsweise hinsichtlich theoretischer Bestrebungen oder Grundlagenforschung. Das trifft insbesondere auch auf Gesellschaftskritik zu. Gleichzeitig hat es außerdem auch seine Berechtigung, sich vom staatlichen Einfluss lösen zu wollen, da ansonsten nur Auftragsforschung möglich ist.
3. Das Ideal der akademischen Selbstverwaltung stellt eine Technokratie dar. Anstatt dass die breite Gesellschaft Entscheidungen trifft, wird es einem Gremium von Expert:innen übertragen. Das ist letztlich undemokratisch, da weite Teile der Gesellschaft ausgeschlossen werden, das Wissen der Expert:innen auch vom herrschenden bürgerlichen Bewusstsein durchtränkt ist und es letztlich zu einer Machtkonzentration bei den Expert:innen führt.
Als Marxist:innen denken wir nicht, dass die Wissenschaft völlig losgelöst von den Zielen der restlichen Gesellschaft agieren sollte. Die Wissenschaft sollte genauso demokratisch und transparent organisiert werden, wie wir es uns bei der Produktion vorstellen, d. h., über Belange der Universität sollten auch Vertreter:innen der Arbeiter:innenklasse entscheiden, um die gesamtgesellschaftliche Perspektive mit abzusichern. Denn das Einsperren im Elfenbeinturm der Universität führt nicht unbedingt dazu, dass man die Bedürfnisse der gesamten Gesellschaft besser im Blick hat, im Gegenteil: An der Uni herrschen bürgerliche und kleinbürgerliche Klasseninteressen vor, die es zu unterbinden gilt. Wenn wir eine Uni im Sozialismus haben, wird auch diese einen gesellschaftlichen Nutzen bringen, nämlich die sozialistische Gesellschaft weiter voranzubringen. Demnach lehnen wir es ab, Lehre und Forschung als reinen akademischen Selbstzweck zu verstehen.
Gleichzeitig bedeutet unsere Kritik am Idealismus der akademischen Selbstverwaltung und dem bürgerlichen Konzept der Wissenschaftsfreiheit natürlich nicht, dass wir diese nicht auch gegen Angriffe von autoritären Strukturen verteidigen, die die Universitäten noch stärker für die eigene Ideologieproduktion vereinnahmen und kritische Stimmen aus der Studierendenschaft und den Reihen der Wissenschaftler:innen unterbinden wollen. Besonders im Kontext des israelischen Genozids gegen Gaza und der Zeitenwende zeigt sich, dass dieses Ideal mit Füßen getreten wird.
Dennoch müssen wir auch anerkennen, dass das Ideal der akademischen Selbstverwaltung die realen Verhältnisse verschleiert: So gibt es eine Einflussnahme von Kapital durch staatliche Strukturen wie die jeweilige Landesregierung, da die parlamentarische Regierung letztendlich auch bloß die Herrschaft der Bourgeoisie ist. Zu sehen ist das z. B. an der Mittelvergabe, und als Beispiel kann herangezogen werden, dass Forschende, die sich solidarisch mit Palästina gezeigt haben, auf einmal keine Förderungen mehr erhalten sollen. Ein Blick in die USA zeigt, wie weit das führen kann: Da Trump der Columbia University Mittel entziehen wollte, entschloss sie sich kurzerhand, Studierende, welche in der Palästinasolidaritätsbewegung aktiv waren, zu exmatrikulieren und teilweise sogar ihre Abschlüsse (!) abzuerkennen. Zurück nach Deutschland: In manchen Bundesländern gibt es auch die Möglichkeit, Einfluss auf die Berufung von Professor:innen zu nehmen. Das passiert in Berlin beispielsweise durchaus auch aufgrund politischer Motivation. Auch Vorgaben zu Kürzungen und Haushaltsplänen kommen von den Landesregierungen. Des Weiteren können auch durch die Änderung des Hochschulgesetzes, z. B. hinsichtlich Zwangsexmatrikulationen, staatliche Interessen durchgesetzt werden. Natürlich gibt es auch einen Einfluss durch die Drittmittelfinanzierung, da so die Forschungsrichtung festgelegt bzw. beeinflusst werden kann.
Besonders heftig ist in diesem Bereich die Forschung für militärische Zwecke, die oft zivil getarnt wird (Dual-Use), aber letztendlich dem deutschen Imperialismus und dem deutschen Kapital dient, denn es gibt nicht an allen Unis eine Zivilklausel. Die Zivilklausel ist eine freiwillige Selbstverpflichtung der Unis, nicht rüstungsrelevante Forschung zu betreiben und außerdem keine Drittmittel von Bundeswehr und Rüstungsunternehmen zu nutzen. Erkämpft wurde sie von der Friedensbewegung.
Aktuell besitzen diese ca. 70 Universitäten und Hochschulen in Deutschland. Aber die Zeitenwende macht auch vor der Zivilklausel nicht halt. So forderte Johann-Dietrich Wörner, Präsident der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften, im Juni 2022: „Die Hochschulen sollten darüber nachdenken, ob ihre Zivilklauseln noch zeitgemäß sind oder im Verständnis einer friedlich ausgerichteten Verteidigungspolitik neu formuliert werden sollten.“ Ähnlich äußerte sich kurz darauf auch Friedrich Merz, Vorsitzender der CDU und aktueller Bundeskanzler: „Sogenannte Zivilklauseln, die militärische Forschung an den Hochschulen verbieten, sollten aufgehoben werden. Das ist nicht mehr zeitgemäß.“ Auch drängen die Rüstungsunternehmen in den letzten Jahren vermehrt in die zivile Forschung. Dabei wird Geheimhaltung aber großgeschrieben. Oftmals ist daher unklar, wo militärisch geforscht wird. Somit wird die Freiheit von Wissenschaft und Lehre zur Freiheit, sich zu verkaufen, ad absurdum geführt. Das alles kann durch den Verweis auf die akademische Selbstverwaltung sehr leicht verschleiert werden.
Einer ihrer weiteren Aspekt ist das oft beschworene Mittel der studentischen Beteiligung. Wie wir aber bereits bei der Betrachtung des Akademischen Senats gesehen haben, geht das kaum über eine plakative Beteiligung hinaus. Zudem nutzen viele Studierende die Hochschulwahlen und die Gremien auch als Karrieresprungbrett und wollen gar nicht wirklich etwas verändern oder die Interessen ihrer Kommiliton:innen vertreten. Neben den Sitzen im Senat und in den Fakultätsräten gibt es auch weitere Studierendengremien, nämlich StuRa, StuPa und AStA. Diese unterscheiden sich jedoch, auch wenn sie mitunter synonym verwendet werden: Der AStA ist der Allgemeine Studierendenausschuss (ähnlich wie eine Regierung), während das StuPa als eine Art Parlament zu verstehen ist. Der StuRa (Studierendenrat) hingegen besteht vor allem in Ostdeutschland (insbesondere Sachsen und Sachsen-Anhalt) und vereint die Funktionen des AStA mit der des StuPa. Auch wenn sich diese Gremien für studentische Belange einsetzen wollen, reicht es oftmals nicht über eine Mittelvergabe hinaus. Ein positiver Aspekt ist jedoch, dass die Möglichkeit, eine Vollversammlung einzuberufen, besteht, wenn ein bestimmter Prozentsatz der Studierenden dafür ist, der StuRa/StuPa dies macht oder sich mehrere Fachschaftsräte zusammenschließen.
Exkurs: How to Vollversammlung an der Uni
Vollversammlungen (VV) sind ein wichtiges Instrument der Studierenden, das euch nicht nur die Möglichkeit gibt, euch politisch zu organisieren, sondern auch ein verankertes Recht darstellt. Ihr habt das Recht, durch eine Vollversammlung politische Fragen zu diskutieren und Entscheidungen zu fällen, die die ganze Hochschule betreffen. Diese Vollversammlung ist jedoch kein Selbstzweck, sondern ein Mittel, um politische Veränderung und gesellschaftliche Auseinandersetzungen voranzutreiben. Wenn ihr an eurer Hochschule gegen rechts aktiv werden wollt, kann das Organisieren einer Vollversammlung eine erste mögliche Aktion sein, um Gleichgesinnte für die Politik an der Uni zu finden.
Warum Vollversammlungen wichtig sind
Die Vollversammlung bietet eine Plattform, um politischen Druck aufzubauen – nicht nur auf den AStA, das Rektorat, den Senat oder andere Gremien, sondern auf die gesamte Hochschule und deren Strukturen. Sie kann auch für gesamtgesellschaftlichen Druck genutzt werden. Hier können Themen angesprochen werden, die für die Studierenden von unmittelbarem Interesse sind, sei es gegen die Politik des Rechtsrucks oder für eine bessere Hochschulfinanzierung. Es ist sicherlich hilfreich, sich auch mit den konkreten Problemen an eurer Uni zu beschäftigen: Gibt es rechte Profs oder Studentenverbindungen? Wurden die Mensapreise und die Mietpreise des Student:innenwohnheims erhöht? Fällt euch buchstäblich die Decke auf den Kopf, weil die Regierung mal wieder Mittel gekürzt hat? Bei der VV geht es dann darum, als Studierende zusammenzuwirken, um die Grundlage für gemeinsame politische und soziale Aktionen zu schaffen. Es sollte aus unserer Sicht weniger darum gehen, Forderungen an bestehende Hochschulstrukturen zu richten, sondern vielmehr darum, die Basis für eine politische Bewegung zu mobilisieren. Dafür können Forderungen aber sicherlich auch hilfreich sein, diese müssen aber eben auch einen Weg aus der Misere heraus aufzeigen.
Wie man eine Vollversammlung einberuft
Die Einberufung einer VV erfordert eine klare Zielsetzung. Ein Antrag auf eine VV muss von einer Gruppe von Studierenden oder dem AStA (bzw. dem entsprechenden Gremium: StuPa oder StuRa) eingebracht werden und ist in der Regel an bestimmte organisatorische Voraussetzungen gebunden – etwa eine Mindestzahl von Unterschriften oder die Zustimmung durch andere studentische Gremien. Das solltet ihr also vorher überprüfen. Wichtig ist, dass das Thema der Vollversammlung klar definiert und relevant für die Studierenden ist. Eine VV muss auf Grundlage aktueller politischer oder sozialer Themen organisiert werden, die uns kollektiv betreffen. Sobald die Beantragung erfolgt ist, muss es natürlich an die Mobilisierung gehen, damit möglichst viele Studierende dabei sind: Info-Stände, Flyer, Plakate, Bannerdrops, Durchsagen während Vorlesungen. Es gibt viele Möglichkeiten!
Der politische Ansatz
Vollversammlungen sind aus unserer Sicht aber mehr als nur Diskussionsplattformen. Sie dienen uns als politisches Instrument, um gesellschaftliche und politische Auseinandersetzungen auf den Campus zu tragen.
Es geht nicht um formelle Mitbestimmung innerhalb bestehender Strukturen, sondern um die Schaffung von Basisstrukturen, die die Studierenden in konkrete politische Handlungen einbinden.
Daher ist es maßgeblich, dass die VV nicht als bloße Veranstaltung zum Austausch von Meinungen verstanden wird, sondern als ein Schritt hin zu einer politischen Praxis, die mit konkreten Forderungen und Handlungsansätzen verbunden ist. Das heißt, es sollten nicht nur Anträge und Forderungen beschlossen werden, sondern auch konkrete Aktionen (z. B. eine Demonstration, eine Besetzung) und Strukturen, mit denen der Kampf geführt werden kann (z. B. ein Aktionskomitee, Versammlungen an Fakultäten und Instituten, um die Basis zu verbreitern).
Hier kann also die Grundlage für kollektive Aktionen geschaffen werden, die weit über die Hochschulpolitik hinausreichen. Es macht also Sinn, einen Plan zu entwickeln, wo man vorher Forderungen abstimmt – für die Universität, aber auch gesamtgesellschaftlich, um eine politische Perspektive zu bieten. Wenn ihr auch aktiv werden wollt an eurer Uni und Unterstützung braucht, meldet euch gerne bei uns per Mail (info@arbeiterinnenmacht.de) oder auf Instagram (@arbeiterinnenmacht).
Studentische Bewegung an den Hochschulen
Neben Asta, StuRa und StuPa gibt es aber auch noch eine Vielzahl an politischen Hochschulgruppen, die oftmals mit den Parteien der bürgerlichen Demokratie zusammenhängen und bei den Hochschulwahlen antreten: Juso-Hochschulgruppe (SPD), Grüne Hochschulgruppe (Bündnis 90/Die Grünen), SDS (Die Linke), Ring Christlich-Demokratischer Studenten (CDU/CSU), Liberale Hochschulgruppe (FDP), Campus Alternative (AfD, aktiv vor allem 2016–2018, aktuell sind diese aber eigentlich nicht mehr wirklich relevant und aktiv). Des Weiteren gibt es auch gewerkschaftliche Hochschulgruppen für Studierende. Diese treten insbesondere im Zusammenhang mit den Belangen studentischer Beschäftigter auf, so z. B. im Rahmen von TVStud (Tarifvertrag studentische Beschäftigte). Auch diese können bei den Hochschulwahlen antreten und haben dies z. B. an der Uni Halle auch bereits ziemlich erfolgreich getan (bei der ersten Wahl, bei der die Liste TVStud angetreten ist, konnten 3 Sitze von insgesamt 18 im StuRa erzielt werden).
Reaktionäre Studentenbewegungen
Die Vergangenheit zeigt uns aber auch, dass Studentenbewegungen absolut konservativ sein können. So agierten z. B. in den 1920er Jahren die Studentenverbände als Streikbrecher. Während der NS-Zeit war der Faschismus schon längst an den Unis verwurzelt, bevor überhaupt die Massenbewegung losgetreten wurde. So übernahm der NS-Studentenbund (NSDStB) auch im Laufe von Hitlers Machtsicherung die Deutsche Studentenschaft (ein Gremium, in dem die verschiedenen Studentenschaften der Universitäten zusammengeschlossen waren) und sorgte so für die Gleichschaltung der Universitäten. Der NSDStB rief außerdem zu antisemitischen Aktionen gegen Jüd:innen an den Universitäten auf, was Einschüchterungen von jüdischen Studierenden und Lehrenden bedeutete. Des Weiteren war er Hauptorganisator der Bücherverbrennung 1933, bei welcher seine Anhänger Bücher aus Universitätsinstituten und Bibliotheken stahlen und diese verbrannten. Auch bei der Reichspogromnacht 1938 beteiligten sich Mitglieder des NSDStB, jedoch eher vereinzelt und nicht organisiert.
Auch die Burschenschaftsbewegung im späten 19. Jahrhundert war zutiefst reaktionär, denn sie war geleitet von deutschnationalen Idealen und Antisemitismus und hatte das erklärte Ziel, Deutschland in eine wehrhafte konstitutionelle Monarchie umzuwandeln. Andererseits darf aber nicht vergessen werden, dass die Burschenschaften zu Beginn des 19. Jahrhunderts noch antimonarchisch und ein Teil des Liberalismus waren und auch 1848 für eine demokratische Revolution kämpften. Dennoch kam es zu einem reaktionären Wandel, da die Revolution 1848 scheiterte und viele desillusioniert waren. Durch die Reichsgründung 1871 unter Bismarck wurde das Ziel des vereinten Deutschlands auf einem anderen Weg erreicht, was dazu führte, dass die Burschenschaften sich diesen Ideen unterordneten. Zudem wurden Autoren wie Paul de Lagarde und Heinrich von Treitschke, die den akademischen Antisemitismus prägten und die Großmachtstellung Deutschlands herbeisehnten, immer populärer und besonders von den Burschenschaften, aber auch im gebildeten Bürger:innentum, sehr geschätzt.
Konservative Student:innenbewegungen gab es aber außerdem auch als Reaktion auf linke Ideen an der Uni, so z. B. die Aktion Widerstand, welche die 68er-Reformen verhindern wollten, und die Neue Rechte in den 80er Jahren, welche sich eine Kulturrevolution von rechts wünschten und deren Ideen sich auch heutzutage noch in denen der Identitären Bewegung wiederfinden. Um diesen reaktionären Tendenzen entgegentreten zu können, braucht es also auch gemeinsamen gewerkschaftlichen Kampf mit Mittelbau und anderen Mitarbeitenden der Hochschule aus der Verwaltung! Nur so kann gewährleistet werden, dass die kleinbürgerlichen Tendenzen innerhalb der Bewegung bekämpft werden können. Gerade in Zeiten des Rechtsrucks und der Militarisierung können Universitäten schließlich auch umgerüstet werden und die reaktionäre Politik des Staats ideologisch verteidigen. In konkreter Aktion können dann auch beispielsweise Voll- und Betriebsversammlungen kombiniert werden, um sich der gemeinsamen Probleme an der Universität und in der Gesellschaft annehmen zu können.
Linke Student:innenbewegung
Nach dem Zweiten Weltkrieg waren die Studierenden zu großen Teilen konservativ geprägt, und Burschenschaften dominierten das studentische Leben. In dieser konservativen Atmosphäre gründete die SPD den Sozialistischen Deutschen Studentenbund (SDS). Sein Ziel war es, die sozialistische Theorie weiterzuentwickeln und Studien für die Öffentlichkeitsarbeit der Partei zu erstellen. Der SDS war zwar eine reformistische Organisation, profilierte sich aber bald durch Kampagnen gegen die atomare Aufrüstung Deutschlands und gegen die Beschäftigung von Kriegsverbrecher:innen in Staatsanwaltschaften und Gerichten. 1961 schloss die SPD den SDS auf ihrem Bad Godesberger Parteitag aus. Hintergrund war die Annäherung der SPD an die Wiederbewaffnung und NATO-Integration der Bundesrepublik.
Der SDS entwickelte daraufhin einen eigenständigen Weg und suchte nach einem „dritten Weg“ für die Umsetzung des Sozialismus, der sich sowohl vom Reformismus der SPD als auch vom Stalinismus der SED abgrenzte. In den 1960er Jahren wurde der SDS zum Zentrum einer wachsenden Studierendenbewegung, die sich durch Protestaktionen und Theoriebildung radikalisierte. Ein Wendepunkt war 1967 die Erschießung des Studenten Benno Ohnesorg während einer Demonstration gegen den Schah des Iran in Berlin. Die Vertuschung der Umstände durch die Berliner Staatsanwaltschaft vergrößerte die Wut der Studierenden und führte zu einer landesweiten Mobilisierung und der Schaffung einer Gegenöffentlichkeit. 1968 organisierte der SDS den Vietnam-Kongress, der internationale Aufmerksamkeit erregte und die Bewegung mit Antikriegsprotesten weltweit vernetzte. Im gleichen Jahr folgte die Kampagne „Enteignet Springer“, nachdem Rudi Dutschke, einer der führenden Köpfe der Bewegung, von einem Attentäter fast getötet wurde.
Die Proteste gegen die Notstandsgesetze, die 1968 beschlossen wurden, scheiterten jedoch. Im Gegensatz zu anderen Ländern, etwa Frankreich, gelang es der Studierendenbewegung in Deutschland nicht, eine breite Verbindung zur Arbeiter:innenklasse herzustellen. Der Grund hierfür war die Nähe und politische Kontrolle durch die SPD und die mit ihr verbundene Gewerkschaftsbürokratie über die organisierte Arbeiter:innenbewegung. Andererseits hatte der SDS keine klare Vorstellung davon, wer das Subjekt revolutionärer Veränderung eigentlich sein solle – und damit keine Politik, wie die Arbeiter:innenklasse von einer Klasse an sich zu einer für sich werden könne. Dennoch führte der SDS einen Linksruck innerhalb der Studierenden herbei, der auch über das Jahr 1968 hinaus wirkte.
So sorgten sie dafür, dass sich auch in der Gesellschaft radikale und reformistische Teile vergrößerten: Die Jusos wurden stärker und auch die DKP ist ein Stück weit aus der Student:innenbewegung hervorgegangen. Somit wurden also in der BRD auch der Stalinismus und der Maoismus gestärkt, im Gegensatz zu Frankreich und Italien, wo dies nicht oder nur begrenzt der Fall war. Im Gefolge der Bewegung von 1968 prägten verschiedene Strömungen der Linken die Universitäten bis zur kapitalistischen Wiedervereinigung: Das waren vor allem die Spontis und später die Autonomen, gewissermaßen die linksradikalen Erben der 68er-Bewegung, die etliche Hochschulen oder Fachschaften als ihre „Bastionen“ begriffen und tw. sehr große Mobilisierungskampagnen anführten und auch mit Massenbewegungen verbunden wurden (Anti-AKW-Bewegung, Anti-IWF-Mobilisierung). Politisch orientierten sie sich in den 1980ern mehr oder weniger eng an den neu entstandenen Grünen oder an deren radikalerem Flügel. In den frühen 1970er Jahren stellten auch die maoistischen K-Gruppen einen Faktor dar, aber mit deren Niedergang lösten sich viele in Richtung Grüne auf.
Die anderen dominierenden linken Kräfte stellten die beiden reformistischen Hochschulverbände MSB Spartakus (Hochschulorganisation der DKP) und SHB (Sozialistischer Hochschulbund, der 1960 als SPD-konforme Konkurrenz gegründet worden war und in den 1970er Jahren teilweise auch in Konflikt zur SPD und den Jusos stand). Der MSB hatte in Hochzeiten 6.500 Mitglieder, der SHB rund 3.000. Nach 1989 kollabierten MSB und SHB, die Autonomen zeitverzögert ebenfalls. An den Unis entstand ein politisches Vakuum, das bis heute nicht annähernd gefüllt wurde. Die Juso-Hochschulgruppen führen ein politisches Schattendasein. Die Fachschaftslisten verstricken sich in eine bornierte, entpolitisierte Institutsreformerei, die ASten werkeln abseits der realen Interessen der Studierenden vor sich hin. Hinzu kam die reaktionäre Rolle der Antideutschen, die sich in den 90er Jahren an den Unis ausbreiteten.
In den letzten Jahren ist allerdings der SDS zu einer bundesweiten linken, wenn auch reformistischen Studierendenorganisation angewachsen. Zum anderen entstanden mit der Palästinasolidaritätsbewegung Ansätze einer bundesweiten, antiimperialistischen Radikalisierung, die es an den Unis über Jahrzehnte nicht mehr gegeben hat.
Anders als vor 1968 konnten die konservativen oder gar rechten Verbände ihre Hegemonie an den Unis nie wiederherstellen, selbst nach dem tiefen Einbruch 1989. Das spiegelt nicht nur die tiefen politischen Nachwirkungen der Student:innenbewegung wider, sondern auch eine veränderte Zusammensetzung der Studierenden. Die Sprösslinge der traditionellen Eliten, die noch vor dem Zweiten Weltkrieg an den Unis reproduziert wurden und diese zu einem Hort der Reaktion machten, wurden zu einer Minderheit. Ihre Organisationen leben zwar weiter und radikalisieren sich in Form der Burschenschaften wieder weiter nach rechts oder gar ins Protofaschistische. Aber die reaktionären Kernschichten bürgerlicher und kleinbürgerlicher Studierender bilden eine klare Minderheit und auch eine, die bislang nicht vermochte, größere Massen anzusprechen. Das hängt auch damit zusammen, dass sie sich elitärer und dünkelhafter geben als breitere rechte, konservative oder rechtspopulistische Vereinigungen.
Was ist die Aufgabe von Revolutionär:innen an der Hochschule?
Das bedeutet, dass es zur Zeit (noch) günstige Bedingungen gibt, die Studierenden für eine linke Politik zu gewinnen. Das erfordert aber, dass Revolutionär:innen an den Hochschulen und Universitäten systematisch den Klassenkampf auf drei Ebenen führen müssen:
a) Aufgreifen und Bündeln der sozialen und politischen Forderungen der Studierenden gegen die neoliberalen Angriffe, Kürzungen, Prüfungsregularien, Billigjobs, Ausgrenzung und Selektion und für eine soziale Absicherung aller Studierenden.
b) Mobilisierung für internationale Solidarität im Klassenkampf, für den gemeinsamen Kampf mit den Arbeiter:innen und Unterdrückten gegen die Regierung, das Kapital und die Rechten!
c) Kampf gegen den Einfluss von Kapital und Staat und Kritik der bürgerlichen Universität und Ideologie, die von Hochschulen produziert wird.
Revolutionäre Hochschulpolitik, die auch nur eines dieser Felder nicht systematisch betreibt, verfehlt letztlich ihr Ziel und bleibt einseitig und unzureichend. Daher wollen wir mit dem KSB (Kommunistischer Studieredenbund) eine bundesweite Studierendenorganisation aufbauen, die die Auseinandersetzung auf diesen drei Ebenen sucht. Das wird nicht über Nacht geschehen, aber wir sind zuversichtlich, dass wir eine solche Arbeit in den nächsten Jahren gemeinsam entwickeln können.
Wenngleich Hochschulwahlen nicht wirklich für die Änderungen sorgen werden, die wir uns wünschen, und die studentischen Gremien eher zur Befriedung der Studierenden führen, können wir die Hochschulwahlen durchaus für revolutionäre Politik nutzen. Ähnlich wie bei politischen Wahlen eröffnen sie ein Feld zur Diskussion mit Interessierten, da die Hochschulpolitik etwas mehr Aufmerksamkeit bekommt. In diesem Kontext kann auch die Taktik der kritischen Wahlunterstützung Anwendung finden. Grundsätzlich streben wir aber an, bei den Wahlen als KSB anzutreten. In Listenverbindungen treten wir als KSB offen für unser Programm ein.
Wir schlagen vor, eine revolutionäre Studierendenfraktion, den kommunistischen Studierendenbund, aufzubauen, denn der Kampf gegen die Angriffe und für die Forderungen muss über die einzelnen Unis hinausgehen.
Diese Hochschulgruppen sollen als kämpferische Gruppen agieren, deren Aufgabe es ist, aktiv in universitäre Kämpfe einzugreifen, das politische Bewusstsein zu vertiefen und praktische Schritte aufzuzeigen, die zum Ziel führen können, und dadurch auch die Führung der Bewegung zu erringen. Dies muss eine politische Orientierung an der Arbeiter:innenklasse und nicht an den kleinbürgerlichen Tendenzen der Wissenschaft beinhalten und außerdem mit einer Kritik an der bürgerlichen Wissenschaft einhergehen. Die Trennung zwischen Kopf- und Handarbeit, wie sie im Ideal der akademischen Selbstverwaltung zu finden ist, darf nicht reproduziert werden!
Wichtig ist daher auch, dass der Kommunistische Studierendenbund keine eigenständige Organisation darstellt, sondern die Hochschulgruppe der Gruppe Arbeiter:innenmacht. Dem Kommunistischen Studierendenbund obliegt demnach die Aufgabe, mit, durch und für die GAM politische Programme für die Studierenden im Konkreten und in Bezug auf die Hochschule sowie Wissenschaft und Forschung im Allgemeinen zu entwickeln und unter den Studierenden und Beschäftigten an der Hochschule zu verbreiten.
Dabei beteiligt der KSB sich auch am Kampf um ökonomische, demokratische, politische und soziale Rechte an der Hochschule. Des Weiteren soll der KSB auch in die Auseinandersetzung mit bürgerlichen und kleinbürgerlichen Ideologien und Theorien (auch ihren linken Spielarten) an der Hochschule eingreifen. Er strebt an, den historisch-dialektischen Materialismus in seiner revolutionären Form (Marxismus) unter Studierenden zu verbreiten und so die Entwicklung und Wiederbelebung marxistischer Theorie auf den verschiedenen Feldern der Wissenschaft zu befördern. Der KSB verknüpft dies mit dem aktiven Beitrag zum revolutionären Klassenkampf im Allgemeinen. Er stellt regelmäßig ideell und praktisch Verbindungen zu politischen und ökonomischen Klassenkämpfen in und außerhalb der Universität her. Er zielt daher darauf ab, Studierende zu Kommunist:innen im Allgemeinen zu entwickeln, die eine organische Verbindung zu den gesamtgesellschaftlichen Kämpfen der Linken und der Arbeiter:innenbewegung haben. Das kann z. B. u. a. dadurch erfolgen, dass Studierende sich auch in den gewerkschaftlichen Hochschulgruppen organisieren, wobei sie sich entsprechend ihrer vorhersehbaren Berufssegmente orientieren sollten. Es braucht also keine eigene Studierendengewerkschaft, denn die meisten Studierenden werden aufgrund der veränderten Stellung im Produktionsprozess sowieso früher oder später zu Lohnarbeiter:innen. Gerade die Bildungsstreiks in den frühen 2000ern und die 68er-Bewegung zeigen auf, dass Student:innenbewegungen progressiv sein können und Verbesserungen erkämpfen bzw. Verschlechterungen zurückschlagen können. Aber gerade die 68er-Bewegung war in Deutschland gleichzeitig auch entfernt von der Arbeiter:innenklasse. Die Kluft kann und wird nicht von alleine überwunden werden. Dazu brauchen wir eine bewusste, revolutionäre Organisation und den KSB als Kraft, die für den Aufbau einer solchen Partei kämpft.






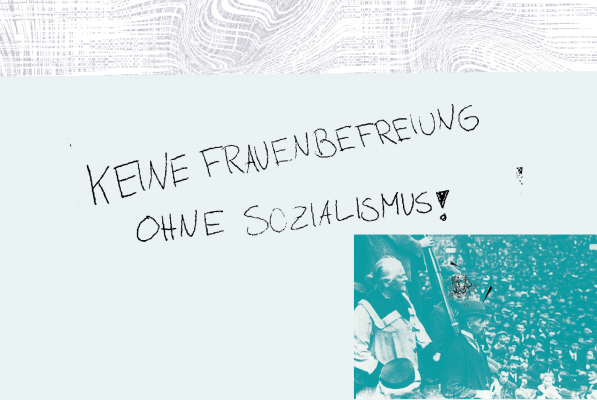

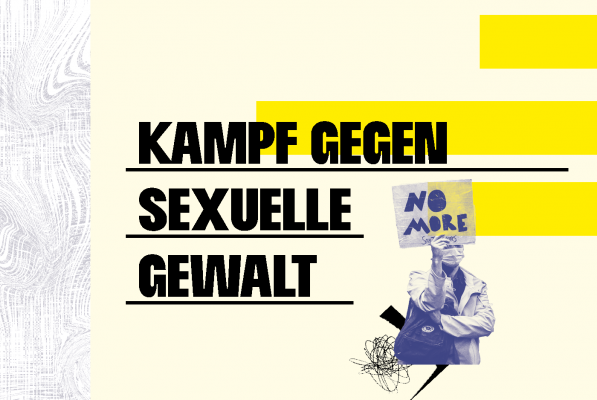


One thought on “Bildung & Uni im Kapitalismus”