Sackgasse Linkspopulismus
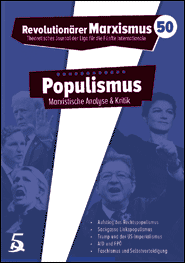
Eine Kritik der Theorien von Laclau und Mouffe
Martin Suchanek, Revolutionärer Marxismus 50. November 2018
Historische Krisenperioden gehen notwendigerweise auch mit einer raschen Umwälzung der politischen Bewegungen, Parteien und Ideologien einher. Der Niedergang der Sozialdemokratie, die Krise der Gewerkschaften und die Unfähigkeit des Linksreformismus, dieses politische Vakuum dauerhaft zu füllen, bilden auch den Nährboden für das Wachstum populistischer Parteien und Bewegungen.
Bis vor wenigen Jahren galten diese in den imperialistischen Zentren praktisch ausschließlich als rechte Phänomene. Nur in den halbkolonialen Ländern nahmen sie auch nach dem Zweiten Weltkrieg immer wieder linksnationalistische, antiimperialistische und „sozialistische“ Züge an – z.B. in Form des Peronismus oder des Bolivarismus. Doch in den letzten Jahren wurden wir Zeugen des raschen Aufstiegs eines linken Populismus, auch in Europa oder in den USA. Organisationen wie Podemos, France insoumise oder die Sanders-Bewegung mobilisieren Massen und erscheinen einem bedeutenden Teil der Linken als Modell zur Neuformierung. All diese Kräfte erblicken jedoch nicht im Klassenwiderspruch den zentralen, die Gesellschaft prägenden Antagonismus, sondern im Gegensatz von „Volk“ und „Elite“ (der „Oligarchie“ oder der „Kaste“ ).
Während der Linkspopulismus selbst die politische Krise der ArbeiterInnenbewegung zum Ausdruck bringt, ist er jedoch weit davon entfernt, eine Lösung dieser Krise darzustellen. Im Gegenteil, er verschärft sie. Auf den Niedergang der Klassenorganisationen, die Anpassung und das Schrumpfen der Gewerkschaften, die Wende der Sozialdemokratie zum sog. „Dritten Weg“ oder zur „neuen Mitte“ und den Rückgang des Klassenbewusstseins antwortet der Linkspopulismus nicht mit dem Kampf um eine revolutionäre oder zumindest kämpferische Neuformierung des Proletariats, sondern mit dem Abschied von der Klassenpolitik.
Die Spitzen von Podemos oder France insoumise versuchen gemeinsam mit ihren Verbündeten in anderen europäischen Ländern (z.B. „aufstehen“ in Deutschland), diese Politik praktisch voranzutreiben. Doch der Linkspopulismus hat nicht nur „PraktikerInnen“ hervorgebracht, er wird auch theoretisch und ideologisch gerechtfertigt. Seine TheoretikerInnen kritisieren nicht nur die „konsensorientierte“, ins System integrierte Sozialdemokratie oder den „Kosmopolitizismus“ der radikalen, postautonomen Linken, sondern attackieren vor allem den Marxismus und dessen angeblichen „Klassenessentialismus“.
Dabei geht es nicht nur um einen Bruch mit revolutionärer oder klassenorientierter Politik. Anstelle des Reformismus soll der Populismus treten. Zwar sind beide Formen bürgerlicher Politik. Aber der Reformismus stützt sich historisch und organisch – z.B. über eine Verankerung in den Gewerkschaften, Massenorganisationen, Mitgliedschaft und WählerInnen – auf die Lohnabhängigen. Er wurzelt in der ArbeiterInnenbewegung, auch wenn diese Verankerung – nicht zuletzt aufgrund der Politik der Sozialdemokratie – in den meisten Ländern immer schwächer wird, zerbricht oder diese Parteien sogar implodieren. Der Linkspopulismus versucht dieses Problem zu lösen, indem er nach einer anderen sozialen Basis sucht – dem Volk, also einer Allianz und imaginären Einheit verschiedener sozialer Klassen. Anstelle einer reformistischen, bürgerlichen ArbeiterInnenpolitik soll eine „Volksbewegung“ treten.
Mélenchon in Frankreich, Iglesias und Errejón in Spanien, Wagenknecht und Lafontaine in Deutschland wollen reformistische, in der ArbeiterInnenklasse organisch verankerte bürgerliche ArbeiterInnenpartei durch eine populistische Bewegung ersetzen, da nur so die Rechte geschlagen werden könne. Ihre theoretischen Weihen erfahren sie durch IdeologInnen wie Ernesto Laclau und Chantal Mouffe.
In ihrem jüngsten Buch „Für einen linken Populismus“ (1), das Mouffe als eine „politische Intervention“, also eine Art Streitschrift, versteht, wird die Intention folgendermaßen zusammengefasst:
„Die zentrale These dieses Buches lautet, dass eine erfolgreiche Intervention in diese Krise der hegemonialen Ordnung den Aufbau einer klaren politischen Formation voraussetzt und dass ein linker Populismus – verstanden als diskursive Strategie, die auf die Errichtung einer politischen Frontlinie zwischen ‚dem Volk’ und ‚der Oligarchie’ abzielt – in der derzeitigen Lage genau die Art von Politik darstellt, die zur Wiederherstellung und Vertiefung der Demokratie vonnöten ist.“ (2)
Im einführenden Kapitel macht Mouffe auch gleich das Haupthindernis in der Linken aus, das einer solchen Politik entgegensteht, den „Klassenessentialismus“:
„Schnell wurde uns klar, dass die Hindernisse, die es zu überwinden gilt, in erster Linie der essentialistischen Sichtweise entspringen, die das linke Denken beherrschte. Nach dieser Sichtweise, die wir als ‚Klassenessentialismus’ bezeichnet haben, waren politische Identitäten Ausdruck der Stellung gesellschaftlicher Akteure innerhalb der Produktionsverhältnisse, und ihre Interessen durch diese Stellung definiert.“ (3)
Zweifellos bedürften die verschiedenen populistischen Projekte einer scharfen Kritik. Die Beschwörung des „Volkes“ muss sich notwendigerweise in einem positiven Bezug auf den bürgerlichen Nationalismus äußern. Wie jede Politik, die vorgibt, sich über die Klassengegensätze zu erheben, bedarf der Populismus des Rückgriffs auf Ideologien, die durch ebendiese Widersprüche hervorgebracht werden – freilich nicht ohne diese ideologisch zu verklären. Genau des macht einen zentralen Aspekt seines reaktionären Kerns aus.
Im diesem Artikel werden wir uns daher zuerst mit Laclaus und Mouffes Kritik des Marxismus auseinandersetzen. Ohne den Bruch mit dem historischen Materialismus lassen sich die Notwendigkeit und Alternativlosigkeit des Linkspopulismus schlecht begründen. Wie wir sehen werden, fußt diese Kritik auf Entstellungen, Halbwahrheiten und einer idealistischen Methode. In unserer Antwort stellen wir daher auch immer wieder die marxistische Konzeption dem Populismus gegenüber.
Im zweiten Teil des Artikels beschäftigen wir uns mit den idealistischen Grundlagen und reaktionären Konsequenzen des Linkspopulismus. Dieser stellt nicht nur einen theoretischen Angriff auf den Materialismus dar, sondern einen fundamentalen Bruch mit Internationalismus, Klassenpolitik und jedem konsequenten Kampf gegen Unterdrückung.
Schließlich werden wir die politische Dürftigkeit und Beliebigkeit des Linkspopulismus aufzeigen. Diese stellen keine zufälligen Begleitumstände dar, sondern eine logische Folge seiner theoretischen Grundlagen.
Warum Kritik am Marxismus?
Die Kritik am Marxismus bildet den Ausgangspunkt der beiden VerfechterInnen des Linkspopulismus. Diese wird von Ernesto Laclau zuerst in „Politik und Ideologie im Marxismus. Kapitalismus – Faschismus – Populismus“ (4) entwickelt und später gemeinsam mit Chantal Mouffe in „Hegemonie und radikale Demokratie. Zur Dekonstruktion des Marxismus“ (5) weitergetrieben und radikalisiert.
Auch wenn diese Arbeiten vor allem eine theoretische Kritik an Marxismus beinhalten, so entspringt das Motiv für die Beschäftigung mit dem Populismus durchaus praktischen Zwecken. Die Linke sei nämlich immer wieder daran gescheitert, eine Antwort auf die politischen Herausforderungen an den Wendepunkten des 20. Jahrhundert zu geben.
Dazu gehörten das Versagen im Kampf gegen den Faschismus, die Unfähigkeit, den Peronismus und andere Formen des Populismus in Lateinamerika zu verstehen ebenso, wie den Erfolg des Thatcherismus zu begreifen. So habe die ArbeiterInnenbewegung vor allem deshalb gegen die neoliberale Offensive verloren, weil die Linke die Fähigkeit Thatchers (und Reagans) nicht begriffen habe, die neoliberale Offensive mithilfe einer populistischen Verknüpfung durchzusetzen. Damit meinen sie, dass es Thatcher gelungen sei, die neoliberale Politik mithilfe der Schaffung eines neuen hegemonialen Blocks durch Artikulation von Partikularinteressen des KleinbürgerInnentums und der „Mittelschichten“ durchzusetzen. Sie hätte dazu den Wunsch nach „Freiheit“ mit dem nach Wirtschaftsliberalismus und Antietatismus verbunden und gegen eine „Elite“ aus staatlichem Filz, KorporatistInnen, Gewerkschaften und Labourismus gewendet. Thatcher sei dadurch in der Lage gewesen, die Mittelschichten und das KleinbürgerInnentum sowie rückständige ArbeiterInnenschichten gegen die Gewerkschaften und die ArbeiterInnenbewegung mit dem Großkapital zu vereinen. So wurde eine „populäre“, wenn auch reaktionäre Verbindung zwischen heterogenen Elementen geschaffen und die Mehrheit der Gesellschaften gegen die ArbeiterInnenbewegung mobilisiert, die als Feind von Markt und Freiheit denunziert wurde.
Die Linke habe dieser demagogischen Verknüpfung nichts entgegenzusetzen gewusst, weil sie ihr nur den Bezug auf ein Klasseninteresse entgegengestellt habe und daher unfähig gewesen sei, „das Volk“ um sich zu gruppieren. Deshalb sei der Sieg des Thatcherismus unvermeidlich gewesen. Dabei stellen Laclau und Mouffe die reale Politik der Labour Party, die in Wirklichkeit leider nicht zu viel, sondern viel zu wenig Klassenpolitik betrieben hatte, und der Gewerkschaften auf den Kopf, die dem Entscheidungskampf auszuweichen versuchten und die BergarbeiterInnen im Stich ließen. Die britischen BergarbeiterInnen, bzw. die britische ArbeiterInnenklasse, haben den Klassenkrieg verloren, weil sie an entscheidenden Punkten vor der Konfrontation zurückgewichen sind. Zuerst beim Malvinas-Krieg, den die Regierung Thatcher 1982 gegen Argentinien um einen Rest des britischen Kolonialgebietes, die Malvinas (Falkland)-Inseln, führte. Die Labour-FührerInnen traten dem nicht entgegen, sondern unterstützen einmal mehr „ihr Land“ als gute PatriotInnen. Zweitens, indem sie sich weigerten, den BergarbeiterInnen durch einen Generalstreik zu Hilfe zu kommen, also die Schlacht zum Kampf um die Macht zuzuspitzen. Im Gegensatz dazu vertrat Thatcher entschlossen ihre Klasseninteressen, und darin lag das „Geheimnis“ ihres Erfolg. Die Bourgeoisie hatte einen Führungsstab, der den Krieg gegen die ArbeiterInnenklasse und deren Avantgarde zu Ende führen wollte – der ArbeiterInnenklasse fehlte dieser jedoch. Die Führung der Labour-Party und die Gewerkschaftsbürokratie des TUC waren nicht in der Lage, die Mittelschichten an ihre Seite zu ziehen oder zu neutralisieren, weil sie nicht mit allen Mitteln um den Sieg kämpfen wollten, sondern der Konfrontation auswichen. Diesen Klassenverrat, der der britischen ArbeiterInnenklasse eine strategische Niederlage bescherte und der neoliberalen Offensive international einen enormen Auftrieb verlieh, entschuldigen Laclau und Mouffe ganz nebenbei.
Wie wir später zeigen werden, sind solche Entstellungen der realen geschichtlichen Kämpfe keine Zufälligkeiten, sondern folgen aus der Politikkonzeption und dem Populismusbegriff von Laclau und Mouffe, der notwendigerweise inhaltlich derartig unbestimmt ist, dass fast jede offensive und konfrontative bürgerliche Klassenpolitik auch als „populistisch“ charakterisiert werden kann.
Neben dem Scheitern der ArbeiterInnenbewegung im Kampf gegen bürgerliche Offensiven in historischen Umbruch- und Krisenperioden führen Laclau und Mouffe ein zweites politisches Phänomen als Beleg für die Unbrauchbarkeit des „Klassenessientialismus“ an, nämlich das Entstehen der neuen sozialen Bewegungen. Die Frauenbewegung, die Umweltbewegung oder antirassistische Kämpfe hätten nicht in das angeblich immer schon vorherrschende Primat der „Klassenpolitik“ der Linken gepasst und wären daher von ihnen als Nebenfragen abgetan worden.
Bemerkenswert an Laclaus und Mouffes Kritik ist auch hier, dass die konkrete Politik der verschiedenen Strömungen der ArbeiterInnenbewegung oder der radikalen Linken nicht weiter untersucht wird. Wir finden daher auch keine nähere Beschäftigung mit den unterschiedlichen Antworten und politischen Konsequenzen dieser Gruppierungen. Allen Strömungen der ArbeiterInnenbewegung wird vielmehr eine gemeinsame „Essenz“ unterstellt, die alle Differenzen als sekundär erscheinen lässt und die zugleich einen unüberbrückbaren Bruch der linkspopulistischen TheoretikerInnen mit dem Marxismus notwendig macht.
Wir werden daher im Folgenden wesentliche Momente ihrer Argumentation nachzeichnen und unserseits einer Kritik unterziehen.
Falsche Perspektiven des Marxismus
In ihrer Arbeit „Hegemonie und radikale Demokratie“ versuchen Laclau und Mouffe die Wurzeln des Problems in ihrer historischen Genese wie auch auf theoretischer Ebene nachzuzeichnen.
Im Revisionismusstreit der Zweiten Internationale sei die Problematik erstmals, wenn auch unzureichend, artikuliert worden. Die lange Expansionsphase des Kapitalismus Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts habe die marxistische Vorstellung einer Zuspitzung der gesellschaftlichen Gegensätze infrage gestellt. Die Mittelschichten und das KleinbürgerInnentum seien nicht verschwunden, sondern vielmehr weiter angewachsen. Kurz gesagt, der Revisionismus habe in der Einschätzung der gesellschaftlichen Entwicklung recht gehabt. In ihren Worten:
„Es ist wichtig zu erkennen, dass Bernstein die Veränderungen, die den Kapitalismus ergriffen, als er in die monopolistische Ära eintrat, klarer verstand als jeder Vertreter der Orthodoxie. (…) Bernstein erfasste ebenfalls die politischen Konsequenzen der kapitalistischen Reorganisation. Die drei hauptsächlichen Veränderungen – Asymmetrie zwischen der Unternehmens- und Vermögenskonzentration; die Existenz und Zunahme der Mittelschichten; die Rolle der ökonomischen Planung in der Verhütung von Krisen – konnten nur eine totale Veränderung in den Voraussetzungen, auf denen die Sozialdemokratie basieren sollte, beinhalten. Weder wurden die Mittelklassen und die Bauernschaft durch die ökonomische Entwicklung proletarisiert und die Proletarisierung der Gesellschaft vergrößert, noch konnte erwartet werden, dass der Übergang zum Sozialismus aus einem revolutionären Ausbruch als Folge einer ernsten ökonomischen Krise resultieren würde. Unter solchen Bedingungen musste der Sozialismus sein Terrain und seine Strategie wechseln; das theoretische Schlüsselmoment war der Bruch mit der rigiden Trennung von Basis und Überbau, die jedwede Konzeptualisierung der Autonomie des Politischen verhindert hatte.“ (Laclau/Mouffe, Hegemonie und radikale Demokratie, S. 64)
Bernstein habe gewissermaßen am Beginn eines Bruchs mit den Fehlern der „Orthodoxie“ gestanden. So wird ihm hoch angerechnet, dass er die Vorstellung Kautskys, aber auch die von Marx und Engels verwarf, dass grundlegende Bewegungsgesetze der kapitalistischen Produktionsweise entschlüsselt werden könnten und dass der Sozialismus eine geschichtliche Notwendigkeit darstelle. Gesetzmäßigkeiten in der Geschichte – diese gelten Laclau und Mouffe als eine der „Todsünden“ des Marxismus.
Bernstein habe jedoch den Fehler begangen, in einem Fortschrittsschema der Geschichte verhaftet zu bleiben, die marxistische Orthodoxie durch die Vorstellung zu ersetzen, dass sich die gesellschaftliche Entwicklung einen immer größeren Spielraum für die relative Unabhängigkeit von Kultur, Ethik, Moral und damit für einen schrittweisen demokratischen und sozialen Fortschritt erlaube. An die Stelle der marxistischen Geschichtsauffassung trete bei ihm der kategorische Imperativ.
Für Mouffe und Laclau stellt Bernstein daher zwar einen Schritt vorwärts dar, aber er bleibe in der ihrer Auffassung nach irrigen Vorstellung gefangen, dass eine Gesellschaft vernünftig organisiert werden könne. Noch weiter in die richtige Richtung seien jedoch die Auffassungen Sorels, eines Syndikalisten der Zweiten Internationale, gegangen. Er habe nicht nur Bernsteins Revisionismus und Croces Kritik am Marxismus akzeptiert, sondern auch die Vorstellung fallengelassen, dass das Klassenbewusstsein, ja letztlich die Existenz der Klassen auf einer „sozialen Struktur“, also Produktionsverhältnissen fußen würde. Die ArbeiterInnenklasse, das revolutionäre Subjekt, würde vielmehr nur im Kampf gegen den Gegner konstituiert, das Verhältnis von „Klasse an sich“ zu „Klasse für sich“ existiere nicht mehr, weil es die Klasse nur im gesellschaftlichen und ideologischen Kampf gebe. Damit habe Sorel einen wirklichen Schritt vorwärts gemacht, weil das Subjekt nicht mehr gesellschaftlich determiniert, sondern „diskursiv“ konstitutiert sei. Gleichwohl bleibt für Laclau und Mouffe eine Haar in der Suppe, nämlich Sorels Vorstellung, dass das politisch und „mythisch“ konstituierte Subjekt ein Klassensubjekt sein müsse.
Die „Orthodoxie“
Weitaus kritischer betrachten Laclau und Mouffe das marxistische Zentrum und die Linken der Zweiten Internationale, denn für sie machen sich beide Strömungen des Festhaltens am „Klassenessentialismus“ schuldig. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts hätten sich, so Mouffe und Laclau, die gesellschaftlichen Verhältnisse so verkompliziert, dass die ArbeiterInnenklasse nicht mehr als eine sich entwickelnde Einheit in Erscheinung getreten sei. Der Marxismus sei nun vor das Problem gestellt worden, dass die ArbeiterInnenklasse fragmentiert oder ihr Bewusstsein nicht spontan sozialistisch gewesen sei. Dabei unterziehen sie die Arbeiten so unterschiedlicher AutorInnen wie Rosa Luxemburg, Karl Kausky, Plechanow, Lenin und Trotzki einer „Kritik“, die vor allem darin besteht, ihnen allen „Klassenessentialismus“ nachzuweisen.
Kautsky wird vorgeworfen, dass er zu den allgemeinen Entwicklungstendenzen des Kapitalismus Zuflucht nehme, wenn er mit diesen widersprechenden Erscheinungsformen konfrontiert wird. Die Einheit der Klasse sei zwar auch für ihn nicht spontan gegeben, sondern könne nur durch die Konstituierung der ArbeiterInnenklasse zur Partei und durch das Hineintragen von Klassenbewusstsein in das Proletariat erfolgen. Damit diese Tätigkeit auf einen fruchtbaren Boden fallen könne, müsse sie sich jedoch auf eine zukünftige objektive Entwicklung stützen, die zu einer Verschärfung des Klassengegensatzes führt. Und genau darin liege der Kardinalfehler Kauskys und Plechanows, nämlich auf historische Gesetzmäßigkeiten zu rekurieren.
Auch Rosa Luxemburg, Lenin und Trotzki wären in dieser Denkweise gefangen gewesen, auch wenn sie flexibler und dynamischer auf gesellschaftliche Veränderungen reagiert hätten. Um sowohl ihre These von der Einheit als auch ihr Urteil über den gleichen Grundfehler all diese TheoretikerInnen zu belegen, müssen Mouffe und Laclau auf eine einseitige Lesart, Entstellungen und argumentative Tricks zurückgreifen.
Erstens unterstellen sie dem „Klassenessentialismus“ eine Passivität bei allen Fragen, die nicht den Klassenkampf von Bourgeoisie und Proletariat betreffen, und zwar einfach, indem sie dies behaupten. Zwar findet sich in der Konzeption Kautskys und Plechanows eine Form des passiven Abwartens, doch selbst Kautsky wird dieser Position, wenn wir nur z.B. an seine Schriften zur nationalen Frage, seine Intervention um das Erfurter Programm denken, nicht gerecht. Doch Mouffe und Laclau meinen mit ihrem Vorwurf des „Essentialismus“ eigentlich etwas anderes, wie das folgende Zitat belegt:
„Zweitens wurden die Differenzen, die innerhalb dieser reduktionistischen Problematik nicht an ihre eigenen Kategorien angeglichen werden konnten, mit zwei Argumentationsweisen angegangen, die wir das Argument von der Erscheinung sowie das Argument von der Kontingenz nennen wollen. Das Argument von der Erscheinung: alles, was sich als verschieden darstellt, kann auf eine Identität reduziert werden. Dies kann zwei Formen annehmen: entweder ist die Erscheinung eine bloße List der Verbergung oder es ist eine notwendige Manifestation des Wesens. (Ein Beispiel für die erste Form: ‚Nationalismus ist eine Maske, die die Interessen der Bourgeoisie verbirgt.; ein Beispiel für die zweite: ‚der liberale Staat ist eine notwendige politische Form des Kapitalismus.’) Das Argument von der Kontingenz: eine gesellschaftliche Kategorie beziehungsweise eine soziale Schicht mag nicht reduzierbar auf die zentralen Identitäten einer bestimmten Gesellschaftsformation sein, in diesem Fall jedoch erlaubt uns ihre völlige Marginalität sie als irrelevant abzutun. (Zum Beispiel: ‚Weil der Kapitalismus zur Proletarisierung der Mittelklassen und der Bauernschaft führt, können wir sie ignorieren und unsere Strategie auf die Auseinandersetzung zwischen Bourgeoisie und Proletariat konzentrieren.’)“ (7)
Natürlich immunisiert auch der Marxismus nicht gegen falsche Verallgemeinerungen. Doch das müsste konkret am Gegenstand gezeigt werden. Mouffe und Laclau verzichten jedoch darauf, sich mit den unter „Argument der Erscheinung“ genannten Beispielen inhaltlich zu beschäftigten oder diese zu widerlegen. Dabei hat der Marxismus nicht erst seit der „Orthodoxie“ gezeigt, dass der Nationalismus eine bürgerliche Ideologie darstellt, die sich im Kampf gegen den Feudalismus herausbildete und der Bourgeoisie erlaubte, sich selbst zur führenden Kraft der Nation zu erheben, die plebejischen Klassen hinter sich zu bringen und unter ihrer Führung zu vereinen. Mit der Festigung der bürgerlichen Herrschaft bleibt der Nationalismus eine Ideologie, die die besonderen Interessen der herrschenden Klasse als jene der Gesellschaft ausgibt, den Klassencharakter ihrer Herrschaft verschleiert und erlaubt, die Massen für ihre Ziele zu mobilisieren. Ebenso wenig neu ist die Erkenntnis, dass jeder Gesellschaftsformation auch bestimmte Staatsformen entsprechen, dass also der „liberale Staat“ eine Form der Klassenherrschaft des Kapitals darstellt.
Mouffe und Laclau machen sich an dieser Stelle erst gar nicht die Mühe, den Inhalt dieser Aussagen zu widerlegen. Sie lehnen den „Klassenessentialismus“ vielmehr ab, weil er Wesen und Erscheinung als ein zu analysierendes Verhältnis betrachtet, weil er zwischen Basis und Überbau unterscheidet. Mouffe und Laclau kritisieren auch an Kautsky oder Plechanow nicht deren Schwächen, sondern ihre Stärken.
Dabei scheuen sie beim „Argument von der Kontingenz“ auch vor einer demagogischen Entstellung nicht zurück. Weder Kautsky, Plechanow noch irgendein/e andere „KlassenessentialistIn“ hat jemals den falschen Schluss gezogen, dass die Bauernschaft und das KleinbürgerInnentum wegen der Proletarisierungstendenzen der Gesellschaft „ignoriert“ werden sollten. Aber es macht sich natürlich weitaus einfacher, eine offenkundig falsche Position zu unterstellen, auch wenn sie niemand vertritt. Wie absurd die ganze Unterstellung der Beschränktheit des sog. Klassenessentialismus ist, der allen MarxistInnen unterschoben wird, zeigt allein ein Zitat aus Lenins „Was Tun“:
„Das Bewußtsein der Arbeitermassen kann kein wahrhaftes Klassenbewußtsein sein, wenn die Arbeiter es nicht an konkreten und dazu unbedingt an brennenden (aktuellen) politischen Tatsachen und Ereignissen lernen, jede andere Klasse der Gesellschaft in allen Erscheinungsformen des geistigen, moralischen und politischen Lebens dieser Klassen zu beobachten; wenn sie es nicht lernen, die materialistische Analyse und materialistische Beurteilung aller Seiten der Tätigkeit und des Lebens aller Klassen, Schichten und Gruppen der Bevölkerung in der Praxis anzuwenden.“ (8)
Zweitens verzichten Laclau und Mouffe auf jede konkrete Untersuchung der politischen Taktik, der Theorie, des Programms, die durch so unterschiedliche „KlassenessentialistInnen“ wie Luxemburg, Lenin, Trotzki, Kautsky oder Plechanow vertreten wurden. Die Kontroversen und scharfen Debatten interessieren allenfalls am Rande oder werden selbst noch als Form der „Auflösung des Konkreten im Abstrakten“ denunziert – natürlich ohne jegliche inhaltliche Beschäftigung mit dem Gegenstand. So werden die grundlegenden Differenzen über den Charakter der Revolution in der russischen Sozialdemokratie oder auch in der Zweiten Internationale als „essentialistische“ Versuche abgetan, lediglich den Ablauf der geschichtlichen Entwicklung in einer zeitlichen Abfolge „gesetzmäßig“ zu fixieren.
Untersuchen wir jedoch den Inhalt dieser Debatte, so zeigt sich, wie grundlegend falsch die Darstellung der beiden populistischen TheoretikerInnen ist. Der Menschewismus betrachtete die Russische Revolution im Rahmen eines „tradierten“, mechanischen Schemas, als Wiederholung der bürgerlichen Revolutionen in Westeuropa. Dieser Vorstellung zufolge musste auch in Russland die Bourgeoisie die Erhebung gegen den Zarismus anführen, dann an die Macht kommen, und die ArbeiterInnenklasse müsste sich mit der Rolle einer Opposition begnügen, die das Bürgertum „vorantreibt“. Trotzkis Theorie der permanenten Revolution verstand die Besonderheiten der russischen Entwicklung hingegen vor dem Hintergrund der Entwicklung des Kapitalismus als globale Gesellschaftsordnung im Rahmen der Theorie der permanenten Revolution und sah damit die geschichtliche Möglichkeit und Notwendigkeit, dass die ArbeiterInnenklasse im Bündnis mit der Bauernschaft in Russland an die Macht kommen könne, ja müsse, um die Aufgaben der bürgerlichen Revolution zu vollenden und zugleich eine sozialistische Transformation zu beginnen.
Auch die Verteidigung der Gesellschaftsanalyse des Revisionismus gegenüber jener ihrer orthodoxen und linken KritikerInnen erweist sich angesichts der realen Entwicklung – zwei imperialistische Weltkriege, Zusammenbruch des Weltmarktes und Weltwirtschaftskrise, Revolutionen und Konterrevolutionen bis hin zum Faschismus – als überaus fragwürdig. Im Gegensatz zur Unterstellung von Laclau und Mouffe entsprachen die theoretischen Analysen und die politischen Perspektiven des linken Flügels der Sozialdemokratie der realen Entwicklung – und nicht jene des Revisionismus. Doch wo die wirkliche geschichtliche Entwicklung dem Narrativ von Laclau und Mouffe widerspricht, herrscht Schweigen, wird diese einfach umgangen.
Die Methode der linkspopulistischen TheoretikerInnen, die uns immer wieder begegnen wird, funktioniert wie folgt: Menschewiki, Bolschewik und Trotzki/Parvus stritten heftig um den Charakter der Russischen Revolution, aber letztlich stimmten alle darin überein, dass die Sozialdemokratie die Interessen der ArbeiterInnenklasse vertreten müsse, womit bewiesen wäre, dass alle VertreterInnen des „Klassenessentialismus“ gewesen wären.
Die grundlegenden politischen Differenzen in der ArbeiterInnenbewegung der Zweiten Internationale, ja, selbst während des Ersten Weltkrieges und danach, werden als letztlich nebensächlich betrachtet. Zwar müssen sie anerkennen, dass die „Essentialisten“ Lenin und Trotzkis in der Lage waren, die ArbeiterInnenklasse in Russland zum Sieg zu führen. Aber auch hier richtet sich ihre Kritik vor allem an die starre Vorstellung des revolutionären Subjekts. Der Fehler des Leninismus und des Trotzkismus bestünde nämlich darin, dass sie auf der führenden Rolle der ArbeiterInnenklasse beharrten. So heißt es bei ihnen:
„Nicht einmal im Ansatz finden wir bei Trotzkis die Vorstellung, dass die demokratische und anti-absolutistische Identität der Massen eine spezifische Subjektposition konstitutiert, die verschiedene Klassen artikulieren können, und dass, indem sie dies tun, ihre eigene Natur modifizieren. Die unerfüllten demokratischen Aufgaben sind nur ein Sprungbrett für die Arbeiterklasse, um sie zu ihren eigenen Klassenzielen vorwärtszubringen.“ (9)
Laclau und Mouffe verkennen an dieser Stelle, dass gerade das Verfolgen der eigenen Klassenziele, also der historischen Interessen des Proletariats (nicht bloß seiner unmittelbar ökonomischen Interessen) die Voraussetzung dafür bildete, nichtproletarische Klassen zum Sieg über den Zarismus zu führen. Daher können sie auch nur mit Unverständnis darauf blicken, dass das Überleben der Russischen Revolution auf Gedeih und Verderb mit dem der internationalen Revolution verknüpft war. In ihren Worten: „Es gibt weder für Trotzki noch für Lenin eine Spezifik, die das Überleben eines Sowjetstaats sichert, wenn nicht in Europa eine Revolution ausbricht und die siegreichen Arbeiterklassen der entwickelten Industrieländer den russischen Revolutionären zu Hilfe kommen. Hier verknüpft sich die ‚Anomalie’ der Verwerfung der Entwicklungsstufen in Russland mit der ‚normalen’ Entwicklung des Westens; was wir eine ‚zweite Erzählung’ genannt haben, ist in die ‚erste Erzählung’ reintegriert.“ (10)
Die Revolutionskonzeption von Lenin und Trotzki interessiert beide nur insofern, als sie mit einem „Narrativ“, also der Etappentheorie der Revolution bricht. Die Frage, wie sie in die internationale Revolution eingebettet ist, interessiert nicht, ja, Mouffe und Laclau begegnen ihr mit Unverständnis. Der internationale Charakter der sozialistischen Umwälzung ist für sie ein Buch mit sieben Siegeln.
Die Isoliertheit der Sowjetunion und der utopische Versuch, den Sozialismus in einem Land aufzubauen, werden nicht als die entscheidenden Ursachen für die bürokratische, stalinistische Degeneration betrachtet, sondern die dem Bolschewismus zugrundeliegende „essentialistische“ und „autoritäre“ Klassenpolitik. Lenin und Trotzki hätten zwar erkannt, dass das Proletariat Verbündete und daher eine Bündnispolitik mit anderen Klassen benötige. Diese müsse jedoch autoritär sein, weil sie die ArbeiterInnenklasse als führende Kraft betrachte, während sie dem kleinbürgerlichen Bündnispartner die Fähigkeit abspricht, eine eigenständige Politik zu betreiben. Dass dieses „Absprechen“ aus der Analyse der gesellschaftlichen Stellung des Kleinbürgertums oder generell der Mittelschichten folgt, ficht Laclau und Mouffe nicht an. Für sie stellt nämlich die Herleitung des Charakters einer Ideologie aus der gesellschaftlichen Stellung einer bestimmten sozialen Gruppe/Klasse bloß eine „Konstruktion“ dar.
Verhältnis von Basis und Überbau
Laclau und Mouffe greifen hier direkt die Marx´sche Theorie an. Im „Vorwort zur Kritik der Politischen Ökonomie“ legt Marx das Verhältnis von Basis und Überbau, von gesellschaftlichem Sein und Bewusstsein, folgendermaßen dar:
„Das allgemeine Resultat, das sich mir ergab und, einmal gewonnen, meinen Studien zum Leitfaden diente, kann kurz so formuliert werden: In der gesellschaftlichen Produktion ihres Lebens gehen Menschen bestimmte, notwendige, von ihrem Willen unabhängige Verhältnisse ein, Produktionsverhältnisse, die einer bestimmten Entwicklungsstufe ihrer materiellen Produktivkräfte entsprechen. Die Gesamtheit dieser Produktionsverhältnisse bildet die ökonomische Struktur der Gesellschaft, die reale Basis, worauf sich ein juristischer und politischer Überbau erhebt, und welcher bestimmte gesellschaftliche Bewußtseinsformen entsprechen. Die Produktionsweise des materiellen Lebens bedingt den sozialen, politischen und geistigen Lebensprozeß überhaupt. Es ist nicht das Bewußtsein der Menschen, das ihr Sein bestimmt, sondern umgekehrt ihr gesellschaftliches Sein, das ihr Bewußtsein bestimmt.“ (11)
Der „Klassenessentialismus“ findet sich also schon bei Marx. Es folgt sodann eine kurze Darlegung der Entwicklungsdynamik des inneren Widerspruchs einer Gesellschaftsformation und damit der Bedingungen für deren revolutionäre Umwälzung:
„Auf einer gewissen Stufe ihrer Entwicklung geraten die materiellen Produktivkräfte der Gesellschaft in Widerspruch mit den vorhandenen Produktionsverhältnissen oder, was nur ein juristischer Ausdruck dafür ist, mit den Eigentumsverhältnissen, innerhalb deren sie sich bisher bewegt hatten. Aus Entwicklungsformen der Produktivkräfte schlagen diese Verhältnisse in Fesseln derselben um. Es tritt dann eine Epoche sozialer Revolution ein. Mit der Veränderung der ökonomischen Grundlage wälzt sich der gesamte ungeheuere Überbau langsamer oder rascher um.“ (12)
Die Kritik am „Klassenessentialismus“ erfordert von Laclau (und Mouffe) eine Zurückweisung aller wichtigen Aspekte dieses „allgemeinen Resultats“ der Marx´schen Theorie.
Gegen die Dialektik
In „Politik und Ideologie des Marxismus“ unternimmt Laclau erste entscheidende Schritte auf diesem Weg, auch wenn ihm dies nach seinen späteren Aussagen noch zu sehr in der Marx´schen Klassentheorie verhaftet erscheint.
In seiner ersten Kritik oder genauer in seinem Unverständnis von Marx stützt sich Laclau selbst noch stark auf den Strukturalismus von Althusser, Poulantzas oder Balibar. Für diese Schule geht es grundsätzlich darum, Marx von seinen hegelianischen Restbeständen zu reinigen. Erst so könne er auf eine wahrhaft wissenschaftliche Basis gestellt werden. Dies bedeutet notwendigerweise auch, dass die dialektische Sicht der Entwicklung der Gesellschaft selbst als ein Makel, eine Form der Unwissenschaftlichkeit betrachtet wird.
Ein zentrales Moment dabei ist, dass sich der Strukturalismus davon verabschiedet, die Gesellschaft als eine in sich widersprüchliche Totalität zu begreifen. Damit ist er jedoch notwendigerweise nicht in der Lage, den Marx´schen Begriff der „Gesellschaftsformation“, also der Gesamtstruktur der Gesellschaft, die die ökonomische Basis mit dem Überbau dialektisch verbindet, zu verstehen. Anstatt von der kapitalistischen oder bürgerlichen Gesellschaftsformation als einer Totalität auszugehen, begreift der Strukturalismus diese vielmehr als ein System verschiedener gesellschaftlicher Subsysteme oder Strukturen. Wenn Althusser oder Poulantzas von Totalität sprechen, so verstehen sie darunter etwas anderes als Hegel oder Marx.
Die Ablehnung des Hegel´schen Totalitätsbegriffs geht im Strukturalismus untrennbar mit der Ablehnung der Dialektik einher. Dabei ermöglicht gerade diese Marx, Engels, Lenin oder Trotzki, die Bestimmtheit der politischen, ideologischen, geistigen Kämpfe und Theorien durch die ökonomische Basis der Gesellschaft so zu fassen, dass dadurch auch deren relative Eigendynamik erfasst werden kann. „Bestimmtheit“ bedeutet in einem dialektischen Verhältnis keineswegs eine starre, mechanische Ableitung, wie sie sich im Verständnis der Zweiten Internationale und deren passivem Geschichtsdeterminismus mehr und mehr durchsetzte.
Dies war jedoch keineswegs bloß die Folge einer innertheoretischen Bewegung. Vielmehr spiegelte dieses Geschichtsverständnis, das mehr und mehr in Kautskys und Plechanows Version des „orthodoxen Marxismus“ kodifiziert wurde, die Expansion des Kapitalismus am Beginn seiner monopolistischen Ära und ein stetiges Anwachsen der ArbeiterInnenbewegung wider. Revisionismus, Gradualismus und Kautskyanismus entsprachen den ideologischen Bedürfnissen des rechten, revisionistischen Flügels der ArbeiterInnenbewegung und des Zentrums und gingen eigentlich mit einer Abkehr von der Dialektik einher. Zweifellos war auch der linke Flügel der Sozialdemokratie um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert von diesen Entwicklungen beeinflusst, aber der Kampf um eine revolutionäre Alternative führte auf Seiten der Linken auch dazu, den Kautskyanismus und das „Zentrum“ in Frage zu stellen und mit diesem zu brechen.
Für uns von Bedeutung ist dabei, dass die dialektische Auffassung der Geschichte, die Anerkennung der inneren Widersprüchlichkeit der Gesellschaft selbst in der bürgerlichen Gesellschaft und in der sozialistischen Umwälzung, dem „subjektiven Faktor“, der Organisiertheit und der Bewusstheit der revolutionären Klasse, einen zentralen Stellenwert beimisst.
Erstens bedeutet das, dass gesellschaftliche Krisen keineswegs nur am grundlegenden Widerspruch zwischen Lohnarbeit und Kapital hervortreten müssen, sondern dass sie sich oft in politischen Krisen, in Kämpfen um die Neuaufteilung der Welt oder in anderen mit dem System der Ausbeutung der Lohnarbeit verwobenen Unterdrückungsverhältnissen entzünden. So prägt heute in einer Vielzahl der Länder der Rassismus die gesellschaftlichen Auseinandersetzungen. Für den Marxismus handelt es sich dabei um keine vom „eigentlichen“ Klassenkampf getrennte Auseinandersetzung, sondern um eine Form des Klassenkampfes.
Mouffe und Laclau identifizieren jedoch den Marxismus mit dem Strukturalismus der Althusser-Schule und halten diese sogar für seine theoretisch entwickeltste Form. In Wirklichkeit stellt sie in vielfacher Hinsicht einen Bruch mit dem Marxismus dar. An Stelle eines Marx´schen Verständnisses von „Basis und Überbau“ tritt eine Beziehung von Subsystemen. Zwischen diesen besteht zwar ein Verhältnis der „Determiniertheit“, bei dem in letzter Instanz die Ökonomie bestimmt, aber wir haben es nicht mit einem in sich widersprüchlichen Gesamtsystem zu tun. Der Widerspruch muss gewissermaßen aus der Realität verbannt werden. Daran knüpft Laclau an:
„Wenn Hegel die Struktur der Wirklichkeit in Begriffen des dialektischen Widerspruchs analysieren konnte, dann nur, weil er – wie alle idealistischen Denker – die Wirklichkeit auf den Begriff reduzierte. Aber die unüberwindliche Schwierigkeit für jeden Materialismus, der sich dialektisch nennt, rührt daher, daß man, um von einer Dialektik der Dinge selbst sprechen zu können, die Negation zur letzten Realität der Dinge machen muss, was mit dem Begriff eines wirklichen Gegenstandes, der außerhalb des Geistes existiert, unvereinbar ist.“ (13)
Dialektik könne also allenfalls nur als idealistisches Unterfangen verstanden werden, als hegelianischer Restbestand im Marxismus, der vom „eigentlichen“ wissenschaftlichen Marxismus zu trennen wäre. Allerdings bleibt dann von Marx wenig übrig. An verschiedenen Stellen im Kapital verweist er explizit auf die reale dialektische Bewegung der kapitalistischen Produktionsweise. So nimmt Marx im berühmten Abschnitt über die „Geschichtliche Tendenz der kapitalistischen Akkumulation“ am Ende des 1. Bandes des „Kapitals“ direkt auf die Dialektik Bezug:
„Die aus der kapitalistischen Produktionsweise hervorgegangene kapitalistische Aneignungsweise, daher das kapitalistische Privateigentum, ist die erste Negation des individuellen, auf eigne Arbeit gegründeten Privateigentums. Aber die kapitalistische Produktion erzeugt mit der Notwendigkeit eines Naturprozesses ihre eigne Negation. Es ist Negation der Negation. Diese stellt nicht das Privateigentum wieder her, wohl aber das individuelle Eigentum auf Grundlage der Errungenschaft der kapitalistischen Ära: der Kooperation und des Gemeinbesitzes der Erde und der durch die Arbeit selbst produzierten Produktionsmittel.“ (14)
Dieser Verweis auf die dialektische Bewegung der Realität und die innere Dynamik des realen Widerspruchs stellt keine bloße Behauptung dar, wie Anti-MarxistInnen seit Dühring unterstellen, sondern den Endpunkt einer umfassenden Analyse des Produktionsprozesses des Kapitals. Wie z.B. Rosdolsky in seiner „Entstehungsgeschichte des Kapitals“ (15) überzeugend darlegt, steht der endgültige Aufbau des „Kapitals“ in engem Zusammenhang mit der nochmaligen Beschäftigung mit Hegel.
Die Althusser-Schule musste bei ihrer „Verbesserung“ des Marxismus unweigerlich mit dem realen, dialektischen Marx in Widerspruch geraten. Auf diesen Bruch mit dem revolutionären Marxismus stützt sich Laclau.
Das erklärt nebenbei auch, warum ihm das Verhältnis von Notwendigkeit und Zufall als unmögliches Verhältnis erscheinen muss. Die von Hegel herrührende Vorstellung, dass sich geschichtliche Gesetzmäßigkeit und Notwendigkeiten vermittelt durch zufällige Bewegungen und Entwicklungen durchsetzen, ist Laclau vollkommen fremd, ja erscheint im einfach widersinnig. Für ihn ist eine Sache entweder notwendig – und damit letztlich im Sinne einfach vorbestimmt – ,oder sie ist nicht notwendig. Nur im Nicht-Notwendigen, im Kontingenten, eröffne sich ein Möglichkeitsspielraum, ein Raum für Handeln und damit für Alternativen in der Geschichte.
Für Hegel, Marx oder Engels setzt sich die gesellschaftliche Notwendigkeit, also die Lösung der inneren Widersprüche einer bestimmten Gesellschaftsformation, jedoch immer vermittelt über den Zufall durch, dringt so zur Wirklichkeit. Wichtig ist dabei zu verstehen, dass der Zufall nicht bloß unentdeckte, noch nicht bewusste Notwendigkeit darstellt, sondern in der Tat etwas Neues in die Geschichte bringt. In einer in sich widersprüchlichen Gesellschaftsformation bedeutet dies, dass dem Handeln der gesellschaftlichen Subjekte, also der gesellschaftlichen Klassen, eine entscheidende Bedeutung zukommt für den Verlauf der Geschichte. „Die Menschen machen ihre eigene Geschichte, aber sie machen sie nicht aus freien Stücken, nicht unter selbstgewählten, sondern unter unmittelbar vorgefundenen, gegebenen und überlieferten Umständen.“ (16)
Für den Befreiungskampf des Proletariats nimmt daher die Frage des Bewusstseins eine zentrale Rolle ein. Die Konstituierung der ArbeiterInnenklasse von einer „Klasse an sich“ zu einer „Klasse für sich“ ist erforderlich, die inneren Widersprüche der Gesellschaft revolutionär aufzulösen, das gesellschaftlich Notwendige Wirklichkeit werden zu lassen. Das ist nur über eine Reihe von Kämpfen, Klassenkämpfen möglich, in denen sich die bewusstesten Teile des Proletariats zu einer revolutionären Partei formieren, die das Bewusstsein des historisch Notwendigen, der Bewegungsgesetze der modernen Gesellschaft, die Erfahrungen bisheriger Klassenkämpfe mit dem Eingreifen in die ökonomischen, politischen und ideologischen Auseinandersetzungen verbindet, und dabei nicht nur das Proletariat, sondern alle unterdrückten Schichten der Gesellschaft zur Revolution führt.
Der revolutionäre Marxismus hat also längst eine Lösung für ein Problem gefunden, das Laclau und Mouffe umtreibt. Der sog. „Klassenessentialismus“ ist kein ökonomistisch verflachter Marxismus, sondern, richtig verstanden, eine umfassende revolutionäre Strategie zur Befreiung der gesamten Gesellschaft, zur Aufhebung sämtlicher Ausbeutungs- und Unterdrückungsverhältnisse.
Mouffe und Laclau müssen diese Lösung schon alleine deshalb verwerfen, weil sie den Marxismus durch die strukturalistische Brille betrachten. In der Althusser-Schule ist mit dem Verwerfen der Dialektik notwendigerweise auch die zentrale Rolle, die der Marxismus dem subjektiven Faktor beimisst, verworfen worden.
Populistische Kritik am Strukturalismus und Widerspruch „Volk – Machtblock“
Übernimmt Laclau von der Althusser-Schule u.a. die Ablehnung der geschichtlichen Dialektik und die Verwerfung des Marxschen Basis-Überbau-Modells, so knüpft Laclau an die strukturalistische Sicht der Gesellschaft an. In ihrer Analyse der kapitalistischen Produktionsweise unterscheiden Poulantzas und Balibar zwischen drei wesentlichen Subsystemen: dem ökonomischen, dem politischen und dem ideologischen, wobei das ökonomische in letzter Instanz die beiden anderen bestimme.
Nachdem der Strukturalismus selbst den Hegel´schen Totalitätsbegriff und ein dialektisches Verständnis der Gesellschaft verworfen hat, wirft Laclau die Frage auf, warum eigentlich die ökonomische Ebene die anderen bestimme. Hinter der ständigen Betonung der „relativen Autonomie“ der Subsysteme, wie sie in Schriften strukturalistischer Theoretiker zu finden ist, finde sich eine Scheu, die „Autonomie“ des politischen Subsystems wirklich anzuerkennen.
Dies würde nämlich den letzten verbliebenen Bestandteil der Bindung an den „Klassenessentialismus“ zerstören. Bevor wir auf diese Kritik am Strukturalismus und namentlich an Poulantzas eingehen, müssen wir uns aber kurz damit beschäftigen, wie Laclau in „Politik und Ideologie des Marxismus“ die ArbeiterInnenklasse bestimmt.
Nachdem er die innere Unstimmigkeiten der Begriffs der Produktionsweise und der Ökonomie, wie sie Balibar und Poulantzas und angeblich auch Marx verwenden, herausarbeitet, schlägt Laclau vor, zwischen dem Begriff der „Ökonomie“ und der „Produktion“ zu unterschieden. Unter letzterer versteht er die Produktion des materiellen Lebens, die alle Gesellschaftsformationen auf die eine oder andere Weise zu gewährleisten haben. Den Begriff der „Ökonomie“ will er nur auf eine Waren produzierende Gesellschaft angewendet wissen, dort aber auch nur auf die Sphäre der Produktion. Für Laclau, und das ist für seine ersten Schritte zu einer Theorie des Populismus von grundlegender Bedeutung, konstituieren sich Klassen in der Sphäre der Ökonomie, im „ökonomischen Subsystem“. Klassenspezifische Forderungen, Politik, Formierungen sind daher für ihn wesentlich die Verlängerung ökonomischer Lagen und Interessen.
Er schiebt hier selbst einen verkürzten Begriff der ArbeiterInnenklasse ein, doch für ihn ist dieser notwendig, um die Frage aufzuwerfen, wie und ob die Klassen aus der Sphäre der Ökonomie in der politischen und ideologischen Auseinandersetzung auftreten. Der „Essentialismus“ hätte darauf natürlich schon eine „reduktionistische“ Antwort:
„Das stellt für eine traditionelle marxistische Konzeption kein Problem dar: jeglicher ideologischer Inhalt hat eine eindeutige Klassen-Konnotation und jeder Widerspruch kann – über ein mehr oder weniger kompliziertes System von Vermittlungen – auf einen Klassenwiderspruch reduziert werden.“ (17).
Laclau stellt dem seine Konzeption gegenüber:
„Diesem reduktionistischen Ansatz stellen wir die folgenden Thesen entgegen: 1. Klassenkampf ist nur das, was Klassen als solche konstituiert. 2. daher ist nicht jeder Widerspruch ein Klassenwiderspruch, doch jeder Widerspruch ist durch den Klassenkampf überdeterminiert.“ (18)
Mit dem zweiten Halbsatz – dem noch verbliebenen Rest des strukturalistischen Marxismus – werden Laclau und Mouffe bald brechen.
Wichtig für uns ist jedoch, dass, nachdem die Konstitution der ArbeiterInnenklasse ausschließlich auf der Ebene der Ökonomie verortet wird, nicht nur der Klassenbegriff, sondern notwendigerweise auch der Klassenkampf auf die ökonomische Ebene reduziert wird. Für ihn erstreckt sich nämlich der Klassenantagonismus auf die ökonomische Sphäre, während sich außerhalb der Produktionsweise eigentlich keine Klassen mehr gegenübertreten. Er kommt daher zu folgendem Schluss:
„In diesem Antagonismus würden die Beherrschten sich nicht als Klasse verstehen, sondern als ‚die Anderen’, als ‚Gegenmacht’ zum herrschenden Machtblock, als ‚Unterdrückte’. Während der erste Widerspruch – auf der Ebene der Produktionsweise – sich ideologisch in der Anrufung der Handelnden als Klasse ausdrückt, wird dieser zweite Widerspruch ausgedrückt in der Anrufung der Handelnden als Volk. Der erste Widerspruch ist Sphäre des Klassenkampfes, der zweite die Sphäre des popular-demokratischen Kampfes. Das ‚Volk’ oder die ‚popularen Schichten’ sind nicht, wie einige Konzeptionen unterstellen oder in den marxistischen politischen Diskurs geschmuggelte liberale oder idealistische Begriffe. Das ‚Volk’ ist eine objektive Determinante des Systems und von der Klassendetermination zu unterscheiden: Das Volk ist einer der Pole des in einer Gesellschaftsformation dominierenden Widerspruchs, der nur unter Berücksichtigung der politischen und ideologischen Herrschaftsverhältnisse (und nicht bloß der Produktionsverhältnisse) zu begreifen ist. Während der Klassenwiderspruch der dominierende Widerspruch auf der abstrakten Ebene der Produktionsweise ist, dominiert auf der Ebene der Gesellschaftsformation der Widerspruch zwischen dem Volk und dem Machtblock.“ (19)
Nachdem Laclau mit dem Marx`schen Verständnis einer Gesellschaftsformation und dessen Klassenbegriff gebrochen hat, stellt er nun dem Marx`schen Konzept ein Modell zweier gesellschaftlicher Sphären gegenüber, die von verschiedenen Widerspruchsverhältnissen geprägt seien.
Als Subjekt der Veränderung, als Teil eines Pols gesellschaftlicher Widersprüche tritt nun das „Volk“ in Erscheinung. Anders als in seinen späteren Schriften bleibt Laclau hier aber noch bestimmten marxistischen Momenten, darunter auch dem Ziel, eine sozialistische Gesellschaft zu schaffen, verhaftet.
Er führt jedoch schon in „Politik und Ideologie des Marxismus“ eine zentrale Vorstellung ein, die sich seither in den Arbeiten von Laclau und Mouffe immer wieder findet:
„Die popular-demokratische Anrufung hat nicht nur keinen präzisen Klasseninhalt, sie ist vielmehr das zentrale Feld des ideologischen Klassenkampfes. Jede Klasse kämpft auf ideologischem Gebiet gleichzeitig als Klasse und Volk oder, genauer, sucht ihren ideologischen Diskurs kohärent zu machen, indem sie ihre Klassenziele als Erfüllung populistischer Ziele hinstellt.“ (20)
Und noch deutlicher:
„Wenn Klassen auf der ideologischen und politischen Ebene auftreten – da die Produktionsverhältnisse die letztlich bestimmende Instanz bleiben – und wenn die Inhalte der Ideologie und der politischen Praxis nicht mehr die notwendigen Existenzformen von Klassen auf diesen Ebenen sind, so kann dieses Auftreten nur erklärt werden, wenn man davon ausgeht, daß der Klassencharakter einer Ideologie durch ihre Form und nicht durch ihren Inhalt gegeben ist. Worin besteht die Form einer Ideologie? Wir haben an anderer Stelle gesehen, daß die Antwort im Artikulationsprinzip ihrer konstituierenden Anrufungen liegt. Der Klassencharakter eines ideologischen Diskurses zeigt sich in seinem, wie wir es nennen, spezifischen Artikulationsprinzip.“ (21)
Der Autor verdeutlicht das selbst am Beispiel des Nationalismus. Dieser hätte „für sich selbst betrachtete (…) keine Klassenkonnotation.“ (22) Er könnte von feudalen, bürgerlichen und „sozialistischen“ Kräften gleichermaßen gebraucht werden.
Als Beispiel für den „feudalen Nationalismus“ führt er die Politik Bismarcks an. Hier hätte der Nationalismus zur Aufrechterhaltung eines hierarchisch-autoritären Systems traditionellen Typus geführt. Er verkennt dabei vollkommen, dass auch der Nationalismus Bismarcks einem bürgerlichen Zweck, nämlich der Herstellung der deutschen Einheit, diente, dass das Bürgertum dabei jedoch politisch das Zepter einer besonderen Form des preußischen Bonapartismus übergeben musste, um seine Ziele umsetzen zu können.
Auf der anderen Seite habe jedoch Mao den chinesischen Nationalismus erfolgreich mit kommunistischer Politik verbunden. Laclau unterscheidet hier nicht zwischen der Unterstützung des nationalen Befreiungskampfes und der Übernahme nationalistischer Ideologie. Die vermeintliche Stärke des Maoismus, sein positiver Bezug zum Nationalismus und dessen Übernahme, stellte in Wirklichkeit eine grundlegende politische Schwäche dar. Damit sollte ursprünglich die Anpassung an die nationale Bourgeoisie und damit eine strategische Unterordnung unter die „demokratische“ Revolution gerechtfertig werden, später diente der Nationalismus als Rechtfertigungsideologie für die Herrschaft einer bürokratischen Kaste in Maos China und ist vergleichbar mit der Wiederbelebung des russischen Nationalismus unter Stalin.
Am Beispiel des Nationalismus zeige sich Laclau zufolge, welche „Elemente“ des ideologischen Diskurses „keine Klassenkonnotation“ hätten. Der Nationalismus oder der Volksbegriff sind aber schließlich nicht irgendwelche Ideologien, sondern zentrale Elemente der Ideologien der herrschenden Klassen im Kapitalismus selbst. Sie sind unverzichtbar zu Rechtfertigung bürgerlicher Herrschaft, weil in der Nation oder im Volk notwendigerweise der Klassenantagonismus verschwindet und im Rahmen einer imaginären Einheit aufgelöst wird.
Mit Laclaus Vorstellung jedoch, dass „Elemente“ von Ideologien keinen Klasseninhalt hätten, sondern situativ im Interesse dieser oder jener Klasse zusammengesetzt, also durch eine „Artikulationskette“ miteinander verbunden würden, entfällt nicht nur die Notwendigkeit, eine revolutionäre Theorie und Programmatik gemäß den Klasseninteressen des Proletariats auszuarbeiten, sondern auch die herrschende Klasse hat eigentlich keine eigene Ideologie. Die vorherrschenden Ideen sind bei Laclau nicht, wie bei Marx, die Ideen der Herrschenden, sondern eigentlich ein Patchwork, das in einer bestimmten Situation hegemonial geworden sei.
In „Politik und Ideologie des Marxismus“ schwingt bei Laclau noch immer ein Moment von Marxismus mit. So geht er bei allem revisionistischen Eifer davon aus, dass seine Theorie der sozialistischen Bewegung ein weites politisches Feld eröffne, weil sie so viel besser – und ohne allzu viel Rücksicht auf „traditionelle“ Vorbehalte gegen Volk und Nation – ein weites Feld der Politik, der „antagonistischen Artikulation“ finden könne. Laclau unterscheidet in diesem Zusammenhang zwischen einem Populismus der „Eliten“ (z.B. im Faschismus) und einem Populismus der Linken, dessen höchste Form der Sozialismus wäre.
Doch wie wir gesehen haben, stehen diese Vorstellungen letztlich in einem theoretischen Spannungsverhältnis. Laclau merkt schon 1981 an, dass seine „Studien zu Faschismus und Populismus zu buchstäblich den traditionellen marxistischen Klassenbegriff akzeptiert und unterstellt habe, daß nur die Klassen sich als hegemoniale Kräfte konstituieren können.“ (23)
Unabhängig davon bricht schon „Hegemonie und Politik im Marxismus“ mit grundlegenden Positionen des Marxismus. Laut Laclau hätten Ideologien, politische Theorien, Programme keinen notwendigen Klassencharakter oder -inhalt, ebenso wenig wie der Staat. Diese seien vielmehr Felder, auf denen der Kampf um Hegemonie ausgetragen werde.
Die Überreste an „Klassenpolitik“ sind daher schon damals nicht mehr als „Überreste“. Und damit sollte auch bald Schluss sein. Der Untertitel des Buches „Hegemoniale und radikale Demokratie“, das 1983 erstmals erschien, lautet nicht von ungefähr: „Zur Dekonstruktion des Marxismus.“
Angriff auf den Klassenbegriff
Wenn wir Laclaus erste Schriften noch als Versuche verstehen können, den Marxismus „zu bereichern“, in dem durch die Wende zum Populismus ein „hegemonialer Block“ um die ArbeiterInnenklasse geschaffen würde, so geht es in Mouffes und Laclaus Werk „Hegemoniale und radikale Demokratie“ darum, zu beweisen, dass marxistische Politik selbst außer Stande sei, gesellschaftlich hegemonial zu werden, weil sie Klassenpolitik sei. Für Mouffe und Laclau haben alle politischen und theoretischen Kämpfe in der ArbeiterInnenbewegung und im Marxismus der letzten 150 Jahre letztlich einen sekundären Charakter:
„Selbst jene marxistischen Strömungen, die am härtesten für die Überwindung des Ökonomismus und Reduktionismus gekämpft haben, haben auf die eine oder andere Weise jene essentialistische Konzeption der Strukturierung des ökonomischen Raums beibehalten, die wir gerade beschrieben haben. Demgemäß war die Debatte zwischen ökonomistischen und anti-ökonomistischen Strömungen innerhalb des Marxismus notwendigerweise auf das sekundäre Problem reduziert, welches Gewicht den Überbauten bei der Bestimmung von historischen Prozessen beigemessen werden sollte.“ (24)
Daher müssten auch die Grundsätze der ökonomischen Theorie einer Kritik unterzogen werden:
„Unsere drei Bedingungen für die grundlegende Konstitution hegemonialer Subjekte durch die ökonomische Ebene entsprechen drei Grundthesen der klassischen marxistischen Theorie: die Bedingung bezüglich des endogenen Charakters der Bewegungsgesetze der Ökonomie korrespondiert mit der These der Neutralität der Produktivkräfte; die Bedingung der Einheit der sozialen Agenten auf der ökonomischen Ebene mit der These der wachsenden Hegemonisierung und Verelendung der Arbeiterklasse; und die Bedingung, dass die Produktionsverhältnisse der Ort der ‚historischen Interessen’ sein sollten, die den ökonomischen Bereich transzendieren, mit der These, dass die Arbeiterklasse ein fundamentales Interesse am Sozialismus hat. Wir werden nun zeigen, dass diese drei Thesen falsch sind.“ (25)
Wir wollen im Folgenden die „Beweisführung“ von Laclau und Mouffe selbst einer Prüfung unterziehen.
1.
Laclau und Mouffe beginnen damit, dass der Marxismus zur Begründung seiner Theorie selbst auf eine „Fiktion“ habe zurückgreifen müssen: „er stellte sich die Arbeitskraft als Ware vor.“ (26). Wie begründen sie diese recht eigenwillige These? Durch eine Kritik an der Bestimmung des Begriffs der Ware Arbeitskraft, ihres Wertes usw.? Mitnichten.
Statt dessen wird, nicht zum ersten Mal in ihren Ausführungen, unterstellt, dass es sich Marx und nach ihm alle MarxistInnen zu einfach gemacht hätten. Sie hätten nämlich über hundert Jahre lang „übersehen“, dass der Kapitalist die Arbeitskraft nicht nur kaufen, sondern auch dazu bringen müsse zu arbeiten.
„Dieser wesentliche Aspekt entgeht jedoch der Auffassung von Arbeitskraft als einer Ware, deren Gebrauchswert Arbeit ist. Wenn sie lediglich eine Ware wie andere wäre, könnte der Gebrauchswert offensichtlich vom Augenblick des Kaufs an automatisch effektiv gemacht werden.“ (27)
Wenn diese „Argumentation“ etwas beweist, so nur, dass sich Mouffe und Laclau nicht einmal die Mühe gemacht haben, Marx zu lesen.
Dieser verweist selbst darauf, dass die Arbeitskraft insofern eine besondere Ware darstelle, als sie sich selbst zum Markte trage. Gerade weil der Produktionsprozess des Kapitals Arbeitsprozess und Verwertungsprozess zugleich sei, tobe ein Klassenkampf um die Länge des Arbeitstages, die Intensität der Arbeit, kurzum die Ausbeutungsrate, der beständig die Form eines veritablen Kleinkrieges zwischen Lohnarbeit und Kapital annehme und z.B. im Kampf um den 10-Stunden-Tag zum offenen politischen Klassenkampf werden könne. Marx widmet diesem Thema ganze Abschnitte des Ersten Bandes des Kapitals, darunter das berühmte über den Arbeitstag:
„Von ganz elastischen Schranken abgesehn, ergibt sich aus der Natur des Warenaustausches selbst keine Grenze des Arbeitstags, also keine Grenze der Mehrarbeit. Der Kapitalist behauptet sein Recht als Käufer, wenn er den Arbeitstag so lang als möglich und womöglich aus einem Arbeitstag zwei zu machen sucht. Andrerseits schließt die spezifische Natur der verkauften Ware eine Schranke des Konsums durch den Käufer ein, und der Arbeiter behauptet sein Recht als Verkäufer, wenn er den Arbeitstag auf eine bestimmte Normalgröße beschränken will. Es findet hier also eine Antinomie statt, Recht wider Recht, beide gleichmäßig durch die Gesetze des Warenaustausches besiegelt. Zwischen gleichen Rechten entscheidet die Gewalt. Und so stellt sich in der Geschichte der kapitalistischen Produktion die Normierung des Arbeitstages als Kampf um die Schranken des Arbeitstags dar – ein Kampf zwischen dem Gesamtkapitalisten, d. h. der Klasse der Kapitalisten, und dem Gesamtarbeiter, oder der Arbeiterklasse.“ (28)
Mehr noch. Marx beschäftigt sich im Kapital unter anderem mit der Notwendigkeit des Kapitals, eine ganze Schicht unproduktiver Unteroffiziere des Kapitals (lieutenants of Labour) anzuheuern, ein System der Produktion als Verwertungsprozess zu installieren, das immer auch die Kontrolle der Arbeitskraft inkludiert, sicherstellen soll, dass nicht gebummelt wird usw. So verweist er selbst im Abschnitt über die „Kooperation“ darauf, dass der Kapitalist Aufsicht und Kontrolle der ArbeiterInnen ab einer gewissen Größe des Betriebs auf spezialisierte Gruppen von Lohnabhängigen übertrage: „Wie eine Armee militärischer, bedarf eine unter dem Kommando desselben Kapitals zusammenwirkende Arbeitermasse industrieller Oberoffiziere (Dirigenten, managers) und Unteroffiziere (Arbeitsaufseher, foremen, overlookers, contre-maîtres), die während des Arbeitsprozesses im Namen des Kapitals kommandieren.“ (29)
Hinzu kommt, dass Marx selbst im Kapitel über den Arbeitstag darauf hinweist, dass sich die kapitalistische Produktionsweise von vorhergehenden Systemen der Ausbeutung dadurch unterscheide, dass ihr Bedürfnis nach Mehrarbeit schrankenlos sei.
„Indes ist klar, daß, wenn in einer ökonomischen Gesellschaftsformation nicht der Tauschwert, sondern der Gebrauchswert des Produkts vorwiegt, die Mehrarbeit durch einen engern oder weitern Kreis von Bedürfnissen beschränkt ist, aber kein schrankenloses Bedürfnis nach Mehrarbeit aus dem Charakter der Produktion selbst entspringt.“ (30)
Diese Besonderheit der kapitalistischen Produktionsweise bedeutet keineswegs, dass dem Gebrauchswert oder dem konkreten Gebrauch der Ware Arbeitskraft keine Bedeutung zukommen. Es verdeutlicht vielmehr, warum der Produktionsprozess als Kontrollprozess der Ware Arbeitskraft organisiert sein muss, warum die Produktionsweise selbst zu einer ständigen Umwälzung nicht nur der Technik, sondern auch der Kontrollformen der lebenden Arbeit führt und führen muss. Marx analysiert und illustriert dies u.a. in den Kapiteln über den relativen und absoluten Mehrwert. In diesen Kapiteln beschäftigt sich Marx außerdem mit einem weiteren Phänomen, das er lt. Laclau/Mouffe „vergessen“ habe, nämlich dass sich das Kapital die produktiven Potenzen der Arbeitenden aneigne. So werfen sie, Bowles/Gintis zitierend, der Werttheorie vor:
„Die Bestimmung der Arbeit als Gebrauchswert der Arbeitskraft für das Kapital verdunkelt die absolut fundamentale Unterscheidung von produktiven Impulsen, die in zu sozialen Praxen fähigen Menschen verkörpert sind und all jenen übrigen Inputs, für die der Besitz durch das Kapital hinreichend ist, den ‚Konsum’ ihrer produktiven Dienste zu erreichen.“ (31).
Wenn wir unter dem „fundamentalen Unterschied“ verstehen, dass bestimmte Interessen, Fähigkeiten … der Arbeitskraft, die für eine bestimmte Tätigkeit nicht gebraucht werden (z.B. die Fähigkeit, bei der Fleißbandarbeit mehrere Sprachen zu sprechen), so sind des einfach Fähigkeiten, die das Kapital nicht nutzt, die daher auch nicht verausgabt werden und auch nicht in die Produktion eingehen. Es zeichnet letztlich jede Tätigkeit im kapitalistischen Arbeits- und Verwertungsprozess aus, dass die LohnarbeiterInnen auf bestimmte, einseitige Verausgabung ihrer menschlichen Fähigkeiten reduziert werden.
Wenn damit gemeint ist, dass sich das Kapital auch weniger normierte Kenntnisse aneignet, die nicht im „automatischen“ Prozess des Fabriksystems absorbiert werden, so handelt es sich hier um Tätigkeiten und Fähigkeiten, die bislang nur formell und nicht reell unter das Kapital subsumiert sind. Der Gang der kapitalistischen Entwicklung zeigt jedoch, dass auch diese Tätigkeiten mehr und mehr dem Kapital vollständig unterworfen, reell subsumiert werden. IngenieurInnen oder IT-SpezialistInnen können davon ein Lied singen.
Schließlich könnte mit der Formulierung gemeint sein, dass die Produktivkraft der ArbeiterInnen nicht nur als individuelle, sondern als kooperative, als Massenkraft, fungiert. Im Kapitalismus erscheint auch diese Fähigkeit des Gesamtarbeiters nicht als Produktivkraft der Arbeit, sondern als eine des Kapitals – nicht etwa, weil das Kapital selbst „produktiv“ wäre, sondern weil die Kooperation die Zentralisation der Produktivkraft voraussetzt und daher Anleitung und Kommando durch den Eigentümer der Produktionsmittel oder seiner StellvertreterInnen im Produktionsprozess.
„(…) unter allen Umständen ist die spezifische Produktivkraft des kombinierten Arbeitstags gesellschaftliche Produktivkraft der Arbeit oder Produktivkraft gesellschaftlicher Arbeit. Sie entspringt aus der Kooperation selbst. Im planmäßigen Zusammenwirken mit andern streift der Arbeiter seine individuellen Schranken ab und entwickelt sein Gattungsvermögen.“ (32)
Da jedoch die Produktionsmittel in den Händen der KapitalistInnenklasse monopolisiert sind, können die ArbeiterInnen ihre Fähigkeiten nur in entfremdeter Form entfalten, unter dem Kommando des Kapitals. Daher erscheint ihnen die gesellschaftliche Produktivkraft als Produktivkraft des Kapitals. „Der Zusammenhang ihrer Arbeiten tritt ihnen daher ideell als Plan, praktisch als Autorität des Kapitalisten gegenüber, als Macht eines fremden Willens, der ihr Tun seinem Zweck unterwirft.“ (33)
2.
Wir müssen an dieser Stelle kurz zu Marx’ Bestimmung der ArbeiterInnenklasse als Klasse doppelt freier LohnarbeiterInnen zurückkommen, also als eine Gruppe von Menschen, die einerseits von tradierten feudalen Banden befreit ist, sich frei bewegen und frei Verträge abschließen kann, andererseits frei von Produktionsmitteln ist, also gezwungen ist, ihre Arbeitskraft als Ware zu verkaufen. Diese Bestimmung ist – anders als es sich Laclau in „Politik und Ideologie im Marxismus“ vorstellt – keine, die sich nur auf die Sphäre der Produktion oder der Ökonomie bezieht. Es ist von vornherein die Bestimmung einer gesellschaftlichen Klasse (nicht nur eines Produktionsagenten). Die Laclau`sche Verengung des Klassenbegriffs, die sich ihm aus den System-konstruktionen des Strukturalismus aufdrängt, verengt diesen Begriff nicht nur, sie schafft auch Probleme, die der Marx’sche Klassenbegriff nicht kennt. Oder anders herum, Laclau selbst sitzt einer bestimmten notwendigen Erscheinungsform der ArbeiterInnenklasse im Kapitalismus auf. Sie erscheint nämlich nicht „spontan“ als Klasse, sondern nur als EinkommensbezieherIn, als WarenbesitzerIn unter anderen.
Dass sie im Kern eine gesellschaftliche Klasse ist, wird im Kapitalismus notwendigerweise selbst ideologisch verschleiert, ganz so, wie der Mehrwert und die Ausbeutung im Arbeitslohn verschwinden und z.B. die illusorische Vorstellung eines „gerechten Lohns“ entsteht. An der gesellschaftlichen Oberfläche erscheint die ArbeiterInnenklasse (wie auch die anderen Klassen) nur durch ihre Einkommensquellen verschieden. Der von Laclau dem Marxismus unterschobene Klassenbegriff ist eigentlich selbst nur ein verkürzter Begriff der Klasse. Diese erscheint bei ihm nur im Kaufakt. Ihre gesellschaftlichen und politischen Dimensionen, aber auch der Kampf um den Mehrwert im Produktionsprozess erscheinen daher als vom Marxismus „übersehen“. In Wirklichkeit „übersehen“ bzw. missverstehen Laclau und Mouffe nur den Marxismus.
Im Kapitel „Verwandlung von Geld in Kapital“ wirft Marx selbst ein Licht auf das Verständnis des Kapitalverhältnisses als gesellschaftliches Verhältnis (und eben nicht nur der Produktion). Bevor er Kauf und Verkauf der Arbeitskraft analysiert, formuliert er selbst das Problem, wie sich der Wert verwerten, wie Ware und Geld in Kapital verwandelt werden können:
„Es ist also unmöglich, daß der Warenproduzent außerhalb der Zirkulationssphäre, ohne mit andren Warenbesitzern in Berührung zu treten, Wert verwerte und daher Geld oder Ware in Kapital verwandle.
Kapital kann also nicht aus der Zirkulation entspringen, und es kann ebenso wenig aus der Zirkulation nicht entspringen. Es muß zugleich in ihr und nicht in ihr entspringen.
Ein doppeltes Resultat hat sich also ergeben.
Die Verwandlung des Geldes in Kapital ist auf Grundlage dem Warenaustausch immanenter Gesetze zu entwickeln, so daß der Austausch von Äquivalenten als Ausgangspunkt gilt… Unser nur noch als Kapitalistenraupe vorhandener Geldbesitzer muß die Waren zu ihrem Wert kaufen, zu ihrem Wert verkaufen und dennoch am Endes des Prozesses mehr Wert herausziehn, als er hineinwarf. Seine Schmetterlingsentfaltung muß in der Zirkulationssphäre und muß nicht in der Zirkulationssphäre vorgehn.“ (34)
Diese Ware findet der Kapitalist in der Ware Arbeitskraft, einer Klasse von doppelt freien LohnarbeiterInnen vor. Das zeigt jedoch, dass der Begriff der ArbeiterInnenklasse – wie der des Kapitals – nicht nur einer der Produktion ist, sondern ein gesellschaftliches Verhältnis darstellt.
3.
Die oben angeführte Behauptung, die die Marx`sche Theorie selbst missversteht und zugleich der Arbeit zahlreicher MarxistInnen widerspricht, zeigt einen „verflachten Begriff“ der ArbeiterInnenklasse und verweist darauf, dass Laclau und Mouffe gegen ein von ihnen selbst konstruiertes Zerrbild des Marxismus anschreiben. In Wirklichkeit geht es ihnen vor allem darum, dem Marxismus einen Begriff von ArbeiterInnenklasse zu unterschieben, den er nie hatte. Das verdeutlicht auch folgende Passage.
„Ein großer Teil der kapitalistischen Organisation der Arbeit kann nur verstanden werden als ein Ergebnis der Notwendigkeit, Arbeit aus der vom Kapitalisten gekauften Arbeitskraft herauszupressen. Die Entwicklung der Produktivkraft wird unverständlich, wenn diese Notwendigkeit für den Kapitalisten, seine Herrschaft mitten im Herzen des Arbeitsprozesses auszuüben, nicht begriffen wird. Diese stellt allerdings die gesamte Idee der Produktivkraftentwicklung als einem natürlichen, spontan progressiven Phänomen in Frage. Wir können daher sehen, dass sich beide Faktoren – Arbeitskraft als Ware und Produktivkraftentwicklung als neutraler Prozess – wechselseitig verstärken.“ (35)
Wir haben schon oben gesehen, was es mit dem „Nichtbegreifen“ der „Herrschaft im Herzen des Arbeitsprozesses“ auf sich hat. So wie die marxistische Analyse und ein guter Teil der Literatur zum Thema ignoriert oder z.B. die Analysen von Braverman (36) und Edwards (37) entstellt werden, so entpuppt sich auch die gesamte Vorstellung der Produktivkraftentwicklung als eines „natürlichen, spontanen, progressiven Phänomens“ nicht als marxistische Idee, sondern als dem Marxismus untergeschobene Vorstellung, hinter der das Unvermögen steht, die dialektische, widersprüchliche Bewegung der Entwicklung der Produktivkräfte im Kapitalismus zu begreifen.
Schon die oben zitierten Passagen aus dem Kapital, die auf den Klassenkampf im Produktionsprozess verweisen, verdeutlichen, dass Marx weit von der Vorstellung einer „Produktivkraftentwicklung als neutralem Prozess“ entfernt ist. In Wirklichkeit trifft das Gegenteil zu. Der grundlegende Widerspruch zwischen der Entwicklung der Produktivkräfte und den Produktionsverhältnissen, auf den Marx u.a. im Vorwort zur Kritik der politischen Ökonomie verweist, kann überhaupt nur verstanden werden, wenn wir den konflikthaften Verlauf dieses Prozesses im Auge haben. Ansonsten bliebe es vollkommen unverständlich, wie dieser Widerspruch sich zuspitzt, zu Krisen und zu seiner revolutionären Überwindung treiben muss.
Hinzu kommt, dass Marx im Kapital selbst wieder einmal ziemlich das Gegenteil von dem herleitet, was ihm Laclau und Mouffe unterstellen. So heißt es im Abschnitt über „Große Industrie und Agrikultur“ zusammenfassend:
„Die kapitalistische Produktion entwickelt daher nur die Technik und Kombination des gesellschaftlichen Produktionsprozesses, indem sie zugleich die Springquellen alles Reichtums untergräbt: die Erde und den Arbeiter.“ (38)
Für Marx stellen die gesellschaftliche Arbeit und die Erde selbst entscheidende Produktivkräfte dar. Dazu bedarf es keiner großen Kenntnis seines Werkes. Gerade daraus, dass die Produktivkraftentwicklung kein „neutraler“ Prozess ist, sondern in der kapitalistischen Form zu einer Zuspitzung führen muss, leitet sich auch die Notwendigkeit der Zuspitzung des Klassenkampfes und des revolutionären Sturzes durch das Proletariat ab. Das Fortschrittliche für Marx (und alle anderen revolutionären KommunistInnen) an der Produktivkraftentwicklung besteht nicht darin, dass die Produktivkraftentwicklung ein „neutraler“ Prozess wäre, sondern dass sie die Bedingungen für den revolutionären Sturz der Verhältnisse schafft.
4.
Auch die Vorstellung, dass die ArbeiterInnenklasse selbst qua Logik der Akkumulation immer homogener würde, entspringt einem Zerrbild des Marxismus.
Die Marx`sche Analyse selbst verweist darauf, dass es nicht nur „den Proletarisierungsprozess“ gibt, sondern dass die ArbeiterInnenklasse zugleich auch immer durch die Entwicklung der Akkumulation neu zusammengesetzt wird. Das schließt die Freisetzung bestimmter ArbeiterInnen ein, die Bildung einer „industriellen Reservearmee“ und verschiedener Schichten des Subproletariats (nicht zu verwechseln mit dem „Lumpenproletariat“). Auch Marx kennt den Unterschied von gelernten und ungelernten ArbeiterInnen, von produktiver und unproduktiver Arbeit. Auch wenn er keine Klassentheorie der Beschäftigten im staatlichen Sektor herleitet, so kennt er sehr wohl Berufsgruppen, die aufgrund ihrer verlängerten Kapital/Kontrollfunktion im Produktionsprozesse (z.B. die VorarbeiterInnen im 19. Jahrhundert) oder aufgrund ihre Repressionsfunktion (PolizistInnen) nicht zur ArbeiterInnenklasse zählen, obwohl sie ihr Einkommen in Lohnform beziehen. Er kennt selbstredend auch die Spaltung der Klasse entlang von Geschlecht, Alter, Nationalität und rassistischer Unterdrückung.
Die Auseinandersetzungen in der Ersten Internationale um die Frage der Migration, des Kampfes gegen nationale Unterdrückung, um die Frauenarbeit usw. zeigen deutlich, dass Marx weit davon entfernt war, einen automatischen Prozess der „Homogenisierung“ zu unterstellen. Im Gegenteil: Sein Kampf in der Ersten Internationale zeigt, dass er sich der Notwendigkeit bewusst war, dass diese Einheit politisch erstritten werden muss. So verdeutlicht er, warum die Anerkennung und Unterstützung des Selbstbestimmungsrechts des irischen Volkes eine Voraussetzung für den gemeinsamen Klassenkampf der englischen und irischen ArbeiterInnen und für die Unabhängigkeit des englischen Proletariats von der britischen Bourgeoisie darstellt. Besonders deutlich wird dies aus seinen Schlussfolgerungen aus dem Scheitern der Pariser Kommune, in denen er die Notwendigkeit der Schaffung von ArbeiterInnenparteien in allen Ländern erkannte, um von einer nächsten revolutionären Gelegenheit nicht überrascht zu werden, sondern diese bewusst nutzen zu können.
Engels analysiert Ende des 19. Jahrhunderts die Bildung einer ArbeiterInnenaristokratie in Britannien, deren ökonomische Basis das Weltmarktmonopol des Landes darstellt. Lenin knüpft in seiner Imperialismustheorie an Engels an und arbeitet heraus, dass der Imperialismus die Grundlage für die Bildung einer ArbeiterInnenaristokratie in allen imperialistischen Ländern (und heute sicher auch in vielen Halbkolonien) gelegt hat. Darüber hinaus zeigt der Marxismus aber auch, dass eine globale Homogenisierung der ArbeiterInnenklasse in der imperialistischen Epoche unmöglich ist, da die vom Imperialismus unterdrückten und ausgebeuteten Ländern notwendigerweise nicht dieselbe Sozialstruktur wie die herrschenden Nationen entwickeln können, da die Kapitalakkumulation in ihrem Inneren durch das Finanzkapital der herrschenden Nationen, die von ihnen bestimmten Kapitalströme, bestimmt wird. Politisch und militärisch wird diese Ordnung von den selbst miteinander in Konkurrenz stehenden Großmächten bestimmt und gesichert.
Ein weiteres, mit der imperialistischen Epoche eng verbundenes Phänomen, das für die Bildung der ArbeiterInnenklasse von größter Bedeutung ist, liegt in der ungleichzeitigen und kombinierten Entwicklung, die generell die Entwicklung prägt. So sind – ähnlich wie Russland um die Jahrhundertwende – heute viele, insbesondere halbkoloniale Länder, von extremen Gegensätzen gekennzeichnet. Eine moderne industrielle Produktion und eine dementsprechend konzentrierte ArbeiterInnenklassse gehen einher mit extremen Formen der Rückständigkeit. Für den revolutionären Marxismus stellt das in der aktuellen Entwicklung keine vorübergehende Erscheinung dar, sondern bildet vielmehr ein allgemeines Merkmal des Kapitalismus in der Niedergangsepoche und in einer sich verschärfenden Krisenperiode.
Schließlich bedeutet auch jede Krisenperiode, dass die ArbeiterInnenklasse selbst weiter nach unten gedrückt wird und ihre Heterogenität auf ökonomischer Ebene größer wird, in akuten Krisen größere Teile sogar ins Lumpenproletariat absinken können. Die gesamte Vorstellung einer stetigen Homogenisierung der Klasse (und bereits oben widerlegte „Neutralität“ der Produktivkräfte“) wird dem Marxismus unterschoben.
Nicht minder oberflächlich ist in diesem Zusammenhang die Zurückweisung der Verelendungstheorie. Auch hier gehen Laclau und Mouffe auf die Theorie der „relativen Verelendung“ der ArbeiterInnenklasse erst gar nicht ein. Dieser begegnen wir nämlich auch in Phasen der Expansion und der Erhöhung des Arbeitslohns, denn auch dann wird der neu geschaffene Reichtum in Form des Mehrwerts beständig auf Seiten des Kapitals angehäuft. So schreibt Marx: „Aber alle Methoden zur Produktion des Mehrwerts sind zugleich Methoden der Akkumulation, und jede Ausdehnung der Akkumulation wird umgekehrt Mittel zur Entwicklung jener Methoden. Es folgt daher, daß im Maße wie Kapital akkumuliert, die Lage des Arbeiters, welches immer seine Zahlung, hoch oder niedrig, sich verschlechtern muß.“ (39) Es wachsen also auch in der Periode der kapitalistischen Expansion die ökonomische Abhängigkeit der ArbeiterInnenklasse und die Dominanz des Kapitals.
Die LinkspopulistInnen sind für die Theorie der „relativen Verelendung“ blind, weil sie die immer stärkere Herrschaft der toten über die lebendige Arbeit aus den Augen lassen, die immer umfassendere Unterordnung, Vereinseitigung und Entfremdung. Im sozialdemokratischen Modell des Sozialstaats, aber auch im Stalinismus verkommt die „Befreiung“ der Klasse zu einer staatlichen Wohlfahrtsleistung, die die Entfremdung nicht aufheben kann, sondern nur schöner ausgestalten will. Für Marx hingegen bleibt auch die etwas besser bezahlte Lohnarbeit Lohnsklaverei.
Heute leben wir in einer Periode, in der immer größere Teile der Klasse mit sinkenden Einkommen zu kämpfen haben, in der selbst in den tradierten imperialistischen Zentren wie Deutschland Millionen zu prekär Beschäftigten wurden und werden, zu einem Heer von „working poor“, samt Kindern und RentnerInnen in Armut. Ebenso wächst in Ländern wie China und Indien z.B., wo sich die industrielle Produktion fieberhaft ausdehnt, auch die Zahl der überausgebeuteten Armen.
5.
Bleiben wir beim letzten „Einwand“ von Laclau und Mouffe gegen den Marxismus: Es gebe weder ein „historisches Interesse“ der ArbeiterInnenklasse noch ein grundlegendes Interesse am Sozialismus, das aus einer Position im ökonomischen Prozess deduziert werden könne. Dabei führen sie gegen den Marxismus an, dass sich die Klasse nicht spontan aus der ökonomischen Bewegung Richtung Sozialismus entwickeln würde.
Letztere Erkenntnis ist für MarxistInnen freilich nicht neu. Sie erklärt sich vielmehr logisch, wenn wir, anders als Mouffe und Laclau, davon ausgehen, dass die herrschenden Ideen einer Gesellschaftsformation die Ideen der Herrschenden sind, dass diese als bürgerliche Ideologie auch die ArbeiterInnenklasse prägen und dominieren. Das Lohnarbeitsverhältnis selbst erzeugt, wie Marx in der Analyse der Lohnform zeigt, notwendigerweise ein ideologisches, verkehrtes Bewusstsein der realen gesellschaftlichen Verhältnisse:
„Im Ausdruck: ‚Wert der Arbeit’ ist der Wertbegriff nicht nur völlig ausgelöscht, sondern in sein Gegenteil verkehrt. Es ist ein imaginärer Ausdruck, wie etwa Wert der Erde. Diese imaginären Ausdrücke entspringen jedoch aus den Produktionsverhältnissen selbst. Sie sind Kategorien für Erscheinungsformen wesentlicher Verhältnisse.“ (40)
Marx formuliert dazu: „Man begreift daher die entscheidende Wichtigkeit der Verwandlung von Wert und Preis der Arbeitskraft in die Form des Arbeitslohns oder in Wert und Preis der Arbeit selbst. Auf dieser Erscheinungsform, die das wirkliche Verhältnis unsichtbar macht und grade sein Gegenteil zeigt, beruhn alle Rechtsvorstellungen des Arbeiters wie des Kapitalisten, alle Mystifikationen der kapitalistischen Produktionsweise, alle ihre Freiheitsillusionen, alle apologetischen Flausen der Vulgärökonomie.“ (41)
Es sind aber eben die gesellschaftlichen Verhältnisse, die aufgrund ihrer inneren Widersprüchlichkeit immer wieder auch diese Verhältnisse in Frage stellen, die immer wieder und unvermeidlich Kämpfe, Klassenkämpfe, und Krisen hervorbringen.
Der Klassenkampf selbst ist in dem Zusammenhang sowohl ein notwendiges Resultat als auch treibende Kraft, die dieser Widerspruch hervorbringt und die ihn umgekehrt auf die Spitze treibt.
Jeder Kampf – auch der ökonomische, ganz zu schweigen vom politischen Klassenkampf – inkludiert ein Moment der Konfrontation mit dem Gegner, wodurch selbst auf der Ebene des ökonomischen Klassenkampfes die normale Reproduktion der Verhältnisse unterbrochen wird. So legt jeder Streik die Mehrwertproduktion für begrenzte Zeit lahm. Die Menschen werden gezwungen, sich nicht nur zum Kapitalisten als Gegner zu verhalten, sie sind auch gezwungen, ihr eigenes traditiertes Bewusstsein in Frage zu stellen, wenn der Kampf eine gewisse Intensität erreicht. So stellen bei Arbeitskämpfen das Eingreifen des Werkschutzes, der Polizei und der Justiz auf Seiten der KapitalistInnen unwillkürlich auch Illusionen in Repressionskräfte oder den Staatsapparat in Frage. Dasselbe trifft zu, wenn die Polizei Nazis und RechtsextremistInnen schützen.
All das führt natürlich noch lange nicht dazu, dass die Kämpfenden schon ein sozialistisches Bewusstsein erlangen würden. Dieses entsteht nicht aus den Kämpfen, sondern muss vielmehr in diese hineingetragen werden. Aber die Klassenkämpfe schaffen überhaupt erst die Voraussetzung dafür, dass die revolutionäre Theorie, das Programm, Strategie und Taktik auf fruchtbaren Boden fallen können.
Gerade aber weil die ArbeiterInnenklasse und die Unterdrückten immer wieder aufs neue angriffen werden, weil alle erkämpften Positionen, aller Errungenschaften im Kapitalismus nur zeitweilige sein können, erwächst aus dem Kampf auch ein Bedürfnis nach einer klassenpolitischen Antwort, nach einem Weg, die aktuelle Auseinandersetzung zu gewinnen, aber auch danach, die Wurzeln des Problems anzugehen.
Es sind gesellschaftliche Krisen, Umbruchmomente, die dies natürlich in weitaus größerer Dimension aufwerfen als begrenzte ökonomische oder soziale Kämpfe. Zur Zeit verdichten sich die allgemein krisenhaften Tendenzen der Kapitalakkumulation und der Kampf um die Neuaufteilung der Welt zu einer historischen Krisenperiode.
Dies kann freilich auch nur richtig verstanden werden, wenn der Kapitalismus als eine von Beginn an auf den Weltmarkt bezogene, internationale Produktionsweise und Gesellschaftsformation begriffen wird, weshalb der Klassenkampf international ist. Die ArbeiterInnenklasse selbst ist eine von Beginn an internationale Klasse, wenn auch eine, die sich selbst ihrer eigenen Stellung, ihrer „historischen Aufgabe“ nie spontan bewusst ist. Dazu bedarf es vielmehr einer revolutionären Partei und Internationale.
Die ArbeiterInnenklasse selbst ist die einzige konsequent revolutionäre Klasse im Kapitalismus, weil sie eine Klasse darstellt, die (neben den natürlichen Ressourcen) den Reichtum dieser Gesellschaft hervorbringt, und zwar in zunehmendem Maße. Heute stellt sie auch die Mehrheit der Weltbevölkerung.
Da der Mehrwert von der KapitalistInnenklasse angeeignet wird, muss sich die ArbeiterInnenklasse von der Ausbeutung befreien; sie muss als Klasse von Eigentumslosen, die nur ihre Arbeitskraft verkaufen können, die Enteigner enteignen, die Produktionsmittel in ihren Händen konzentrieren und planmäßig für die Befriedigung der Bedürfnisse der ProduzentInnen und die Herstellung eines nachhaltigen Mensch-Natur-Verhältnisses sorgen. Das ist ihr möglich, weil sie schon Trägerin eines gesellschaftlichen Produktionsprozesse ist, weil sie schon im Kapitalismus und unter der Kontrolle des Kapitals zu einem gesellschaftlichen, kollektiven Gesamtarbeiter geworden ist. Doch um ihre eigenen Potenzen zu entfalten, muss sie aufhören, eine von sich selbst entfremdete Klasse zu sein. Dies kann sie nur, wenn sie die Ausbeutung selbst aufhebt, und das heißt als ersten Schritt, die politische Macht zu ergreifen, die herrschende Klasse zu enteignen und deren staatliche Machtmittel zu zerschlagen. Nur sie kann auf diese Weise die Grundlagen für die Abschaffung jeder Form der Unterdrückung des Menschen durch den Menschen legen. Und das heißt auch, die Grundlage für die Aufhebung ihrer eigenen Existenz als Klasse, die Schaffung einer klassenlosen Gesellschaft zu legen.
Für alle anderen gesellschaftlichen Klassen trifft das nicht zu. Die KapitalistInnenklasse wird natürlich nicht sich selbst abschaffen, indem sie ihre Produktionsmittel freiwillig abgibt. Sie wird, im Gegenteil, mit allen Mittel kämpfen, ihre Herrschaft aufrechtzuerhalten und zu festigen.
Doch auch das KleinbürgerInnentum wird nie zu einer eigenständigen, antikapitalistischen Politik fähig sein. Als Klasse von KleinbesitzerInnen an Produktionsmitteln droht sie einerseits von der überlegenen Konkurrenz an den Rand gedrückt zu werden, andererseits fürchtet sie aber den Abstieg in die ArbeiterInnenklasse, also den Verlust ihres Privateigentums an den Produktionsmitteln. Daher nimmt ihre Politik notwendigerweise einen buntscheckigen, inkonsistenten Charakter an, auch deshalb, weil, streng genommen, das KleinbürgerInnentum selbst in unterschiedliche Schichten zerfällt, von denen die oberen eng mit der herrschenden Klasse, die unteren mögliche Verbündete der ArbeiterInnenklasse sind.
In jedem Fall ist es unmöglich, dass das KleinbürgerInnentum eine eigene, neue gesellschaftliche Ordnung schaffen könnte, denn es ist unmöglich, eine neue Gesellschaft auf Basis einer kleinbürgerlichen Produktionsweise (also einer allgemeinen kleinen Warenproduktion) zu schaffen. Ein solches Unterfangen, würde es denn gestartet, wäre notwendigerweise reaktionär, weil es die schon vorhandene gesellschaftliche Produktion und die Verkehrsmittel der Gesellschaft (Infrastruktur etc.) notwendigerweise zerteilen und in Kleinproduktion aufteilen müsste, die Gesellschaft also zwanghaft zurückentwickeln müsste. Das wäre zugleich auch utopisch, woraus sich auch erklärt, dass sich das KleinbürgerInnentum unabhängig von seinem eigenen Willen einer der beiden Hauptklassen der Gesellschaft anschließen muss. Die lohnabhängigen Mittelschichten ähneln dem KleinbürgerInnentum in vieler Hinsicht.
So wie das Proletariat versuchen muss, die unteren Schichten des KleinbürgerInnentum (z.B. auch arme und landlose Bauern) für sich zu gewinnen, so muss es auch versuchen, die lohnabhängigen Mittelschichten – und hier vor allem jenen, die sich ohnedies schon in einem Prozess des Übergangs in die ArbeiterInnenklasse befinden – für sich zu gewinnen. Es ist aber auch klar, dass die oberen Schichten des KleinbürgerInnentum (z.B. Großbauern, bildungsbürgerliche Schichten) und der lohnabhängigen Mittelschichten aufgrund ihre eigenen engen Bindung an die Bourgeoisie bzw. ihre staatlichen und gesellschaftlichen Institutionen in der Regel nicht gewonnen werden können.
Die Politik der ArbeiterInnenklasse muss also hier darauf abzielen, „untere“ nichtproletarische Schichten oder Klassen um sich als Pol zu gruppieren – und zwar nicht, indem sie auf ihr Klassenprogramm verzichtet, sondern indem sie ein Programm von Übergangsforderungen vertritt, die darauf zielen, die Macht zu erobern und die Gesellschaft auf einer sozialistischen Basis zu organisieren.
Aus all dem wird aber auch noch eines deutlich. In der sozialistischen Revolution spielt das Bewusstein eine ungleich größere Rolle als in der bürgerlichen Revolution. Eine neue, auf eine bewusste Gestaltung menschlicher Beziehungen und eines nachhaltigen Mensch-Natur-Verhältnisses orientierte Gesellschaftsordnung kann nicht „unbewusst“ aufgebaut werden, und schon der Sturz der herrschenden Klasse erfordert eine bewusste Führung, eine klare Strategie und Programmatik.
Da die ArbeiterInnenklasse selbst nicht spontan revolutionäres Klassenbewusstsein entwickelt und auch nicht entwickeln kann, braucht es eine besondere politische Kraft, eine revolutionäre Partei und Internationale, die den Pol der Bewusstheit der Klasse verkörpert, der unerlässlich ist, damit die Klasse überhaupt von einer Klasse an sich zu einer Klasse für sich werden kann.
Der Kapitalismus ist die höchste Stufe der Klassengesellschaft. Mit ihm endet die menschliche Vorgeschichte. Seine Anatomie liefert den Schlüssel zu der aller vorhergegangenen Gesellschaften. Er schafft die materiellen Voraussetzungen für die Abschaffung aller Klassen, indem er die Elementarbestandteile des Arbeitsprozesses, das subjektive Arbeitsvermögen (Proletariat) und objektive Produktionsbedingungen (Kapital) zwei verschiedenen Gesellschaftsklassen zuweist und somit vollständig voneinander trennt. Somit liefert er auch erstmals in der geschriebenen Geschichte die reale Möglichkeit der Einsicht in ihre Triebfeder, nämlich den Klassenkampf, weil der Kapitalismus ihn auf die Spitze treibt, zuspitzt in den Gegensatz zweier Klassenlager statt in verschiedene Kasten oder Stände. Wie er den Klassenbegriff in Reinform schafft, so auch die real-abstrakten Vorlagen für Vorstellungen wie abstrakte Arbeit, rein ökonomischen Zwang, objektive ideologische Gedankenformen, freies Individuum, wie sie vorkapitalistische Gesellschaften nicht kennen konnten. Unabhängig davon, was die ArbeiterInnenklasse selbst über ihre historische Aufgabe einstweilen denkt, ist sie darum die erste und einzige ausgebeutete Klasse in der Geschichte, die das System der Ausbeutung überhaupt aufheben kann. Keine andere Klasse kann ihr diese Aufgabe abnehmen.
Die postmoderne Wende
Mouffe und Laclau scheitern mit ihrer Widerlegung des Marxismus kläglich. Selbst die Kritik, die sie an den eigenen Pappkameraden aufbauen, ist zum Teil wenig überzeugend und oberflächlich. Den Marxismus selbst müssen sie, wie oben ausgeführt, entstellen, ihm teilweise das Gegenteil von dem unterstellen, was er eigentlich aussagt.
Dieser Fundamentalangriff auf den historischen Materialismus ist jedoch notwendig, um die angebliche Alternativlosigkeit einer Wendung hin zu linkem Populismus zu begründen. Wie wir gesehen haben, unterschieben Mouffe und Laclau dem Marxismus einen ökonomistisch, auf die Sphäre der Produktion verengten Klassenbegriff, um so ihre Behauptung zu „stützen“, dass der Marxismus alle wichtigen gesellschaftlichen Kämpfe auf die Ökonomie „reduziere“. Zugleich bestreiten sie den Klassencharakter politischer Ideen und Ideologien und auch den des staatlichen und sonstigen Überbaus der Gesellschaft.
Es erhebt sich damit jedoch die Frage, woran Mouffe und Laclau selbst den Charakter einer politischen Ideologie festmachen, wie sie selbst zwischen linken und rechten Positionen, zwischen fortschrittlichen und reaktionären unterscheiden, nachdem sich eine Herleitung aus den Klassengegensätzen, die diese Gesellschaft prägen, ihrer Ansicht nach verbiete.
Während eine materialistische Konzeption Ideologien, staatliche und andere Institutionen immer als Ausdruck der ökonomischen Basis der Gesellschaft versteht, konstituieren sich für Mouffe und Laclau gesellschaftliche Akteure, soziale Gruppierungen (inkl. Klassen), der Charakter politischer Ideen usw. im Diskurs selbst.
„Der zweite wichtige Grundsatz des antiessentialistischen Ansatzes lautet, dass gesellschaftliche Akteure von einer Reihe ‚diskursiver Positionen’ konstituiert werden, die innerhalb eines geschlossenen Unterscheidungssystems niemals festgemacht werden können. Sie werden von einer Vielzahl von Diskursen konstituiert, zwischen denen nicht zwangsläufig ein Bezug besteht, sondern eine ständige Überdeterminierungs- und Verdrängungsbewegung. Die ‚Identität’ solcher multipler und widersprüchlicher Subjekte ist somit stets kontingent, prekär, temporär am Schnittpunkt dieser Diskurse festgemacht und unabhängig von spezifischen Identitätsformen.“ (42)
Diese keineswegs neue Vorstellung riecht förmlich nach subjektivem Idealismus. Entlehnt ist sie der neueren postmodernen Philosophie, und ähnlich wie diese versucht sie sich des Vorwurfs des Idealismus durch einen Trick zu erwehren, nämlich, indem sie den „Diskurs“ als eine Form der Überwindung des Gegensatzes von Materialismus und Idealismus hinzustellen versucht.
„Die Tatsache, dass jedes Objekt als Objekt des Diskurses konstituiert ist, hat überhaupt nichts zu tun mit dem Gegensatz von Realismus und Idealismus oder damit, ob es eine Welt außerhalb unseres Denkens gibt. Ein Erdbeben oder der Fall eines Ziegelsteins sind Ereignisse, die zweifelsohne in dem Sinne existieren, dass sie hier und jetzt unabhängig von meinem Willen stattfinden. Ob aber ihre gegenständliche Spezifik in der Form von ‚natürlichen Phänomenen’, oder als ‚Zornesäußerung Gottes’ konstituiert wird, hängt von der Strukturierung des diskursiven Feldes ab. Nicht die Existenz von Gegenständen außerhalb unseres Denkens wird bestritten, sondern die ganz andere Behauptung, dass sie sich außerhalb jeder diskursiven Bedingung des Auftauchens von Gegenständigen konstituieren könnten.“ (43)
Diese Position versuchen sie zu untermauern, indem sie behaupten, dass jede diskursive Struktur auch einen materiellen Charakter habe. Dabei greifen sie auf Wittgensteins Theorie der Sprechakte zurück, wonach in der Sprache und mit der Sprache verbundene Handlungen zu einem „Sprechakt“ verbunden werden. Somit inkludiere der „Diskurs“ nicht nur Sprache, Texte, sondern auch Handeln oder auch ein Set von Institutionen des Überbaus (Religion, Kirche Gesetze, staatliche Institutionen. ….).
Diese Ausweitung des Begriffes des Diskurses geht nicht nur mit einer Unschärfe einher, sie erleichtert auch, von einer Frage abzulenken, die obiges Zitat aufwirft. Wenn, wie Laclau/Mouffe behaupten, die Konstituierung der „gegenständlichen Form“ eines Ereignisses von der Strukturierung des diskursiven Feldes abhängig sei, so wird damit die Möglichkeit der Erkennbarkeit der „gegenständlichen“ Form außerhalb des Diskurses im Grunde dementiert oder als unwesentlich beiseite geschoben. Allenfalls wird – wie in verschiedenen anderen Formen des Idealismus – für den „praktischen“, technischen Bereich eine solche Erkennbarkeit anerkannt, alle gesellschaftlichen Phänomene würden jedoch erst im Denken, im Bewusstsein konstituiert – in unserem Fall in einem Diskurs, der sich als „Überwindung“ von Materialismus und Idealismus präsentiert.
Wenn Mouffe und Laclau jedoch behaupten, dass die Konstitution eines Ereignisses „von der Strukturierung des diskursiven Feldes abhängt“, so erhebt sich die Frage, wodurch eigentlich das diskursive Feld strukturiert wird. Dass Mouffe und Laclau den Begriff des Diskurses „materiell“ ausweiten, dient dabei letztlich nur der Verwirrung. Wir werden weiter unten die direkt reaktionären Konsequenzen dieser Theorie betrachten. Davor wollen wir uns jedoch mit einem weiteren Beispiel beschäftigen, das die beiden als Beleg für ihre Theorie anwenden.
Marx verweist im „Kapital“ auf den Unterschied zwischen menschlicher Arbeit und der Tätigkeit von Tieren (Bienen): Der schlechteste Baumeister hätte den Plan für eine Gebäude schon fertig im Kopf, bevor der Grundstein gelegt ist, während die Biene den schönsten Bau nur instinktiv errichtet. Marx verdeutlicht damit, dass es sich bei der menschlichen Arbeit um eine zweckbestimmte Tätigkeit handelt, die notwendigerweise auch ein bewusstes Element einschließt.
Doch wie verhält sich dieses bewusste Element, also die vorher schon existierende Zweckbestimmung, zur materiellen Arbeit selbst. In der „Deutschen Ideologie“ betrachten Marx und Engels die „vier Seiten des ursprünglichen geschichtlichen Verhältnisses“ (Erzeugung der Mittel zur Befriedung des Bedürfnisses; Entdeckung des Bedürfnisses; Konstituierung als Verhältnis unter Menschen, von Mann-Frau, Eltern/Mutter-Kind; Zusammenwirken der Arbeit als kombinierte, gemeinschaftliche Produktivkraft), um sie auf die Entstehung und Entwicklung von Bewusstsein zu beziehen:
„Jetzt erst, nachdem wir bereits vier Momente, vier Seiten der ursprünglichen, geschichtlichen Verhältnisse betrachtet haben, finden wir, daß der Mensch auch ‚Bewußtsein’ hat… Aber auch dies nicht von vornherein, als ‚reines’ Bewusstsein. Der ‚Geist’ hat von vornherein den Fluch an sich, mit der Materie ‚behaftet’ zu sein, die hier in der Form von bewegten Luftschichten, Tönen, kurz der Sprache auftritt. Die Sprache ist so alt wie das Bewußtsein – die Sprache ist das praktische, auch für andre Menschen existierende, also auch für mich selbst erst existierende wirkliche Bewußtsein, und die Sprache entsteht, wie das Bewußtsein, erst aus dem Bedürfnis, der Notdurft des Verkehrs mit andern Menschen… Wo ein Verhältnis existiert, da existiert es für mich, das Tier ‚verhält’ sich zu Nichts und überhaupt nicht. (…) Das Bewußtsein ist also von vornherein schon ein gesellschaftliches Produkt und bleibt es, solange überhaupt Menschen existieren.“ (44)
Dass der Baumeister einen Plan im Kopf hat, folgt daraus, dass die Arbeit selbst ein gesellschaftliches Verhältnis darstellt, nicht daraus, dass sie erst im Diskurs konstituiert würde.
Daraus lässt sich aber auch erklären, warum das Ereignis „Erdbeben“ z.B. als „natürliches Phänomen“ oder „Zorn Gottes“ begriffen wird, und das hängt nicht von der „Strukturierung des diskursiven Feldes“, sondern von der Entwicklungsstufe der menschlichen Arbeit ab.
Reaktionäre Konsequenzen
Mouffes und Laclaus Angriff auf den dialektischen und historischen Materialismus muss man als einen Angriff auf die theoretische Fundierung der revolutionären ArbeiterInnenbewegung begreifen, der letztlich nicht nur dem Bedürfniss zur Begründung eines „linken Populismus“ entspricht, sondern auch einem Bedürfnis der imperialistischen Bourgeoisie. Der Versuch, eine Form der Überwindung des Gegensatzes von Materialismus und Idealismus zu präsentieren, kehrt in der Philosophie, Soziologie und anderen Sozialwissenschaften seit Ende des 19. Jahrhunderts immer wieder und zeigt sich natürlich auch im gesamten Postmodernismus. In „Die Zerstörung der Vernunft“ weist Georg Lukács im Zusammenhang mit der sog. „Lebensphilosophie“ nach, wie die philosophische Konstruktion mit den ideologischen Bedürfnissen der herrschenden Klasse verbunden ist.
„Diese Tendenz, sich über das angeblich falsche Dilemma von Idealismus und Materialismus zu erheben, ist eine allgemeine philosophische Bewegung der imperialistischen Zeit. Beide Richtungen erscheinen dem bürgerlichen Bewußtsein vielfach als kompromittiert: der Idealismus wegen des unfruchtbaren Akademismus seiner Verfasser (mit dem Zusammenbruch der großen idealistischen Systeme im Hintergrund), der Materialismus vor allem wegen seiner Verbundenheit mit der Arbeiterbewegung, wobei erwähnenswert ist, daß der neue, der dialektische Materialismus, in diesen Diskussionen selten auftaucht; der Materialismus der Marxschen Lehre wird einfach mit dem alten Materialismus identifiziert, (…)“ (45)
Nachdem er darauf verweist, dass sich diese Tendenz auf dem Gebiet der Naturwissenschaften rasch und recht unverhüllt als subjektiver Idealismus entpuppt hat, verweist er darauf, dass diese Frage in den Humanwissenschaften anders erscheint:
„Erst wenn die Philosophie über das rein Erkenntnistheoretische hinausgeht, entsteht das eigentliche Problem der Pseudoobjektivität. Das Weltanschauungsbedürfnis der Zeit verlangt nämlich ein konkretes Weltbild, ein Bild von der Natur der Geschichte, des Menschen. Die Gegenstände, die hier gesetzt werden, können zwar laut der herrschenden Erkenntnistheorie nur vom Subjekt geschaffen werden, sie müssen aber zugleich, soll das Weltanschauungsbedürfnis befriedigt werden, als Gegenstände von objektivem Sein vor uns stehen. Eine zentrale Stellung, die in der Methode dieser Philosophie das ‚Leben’ einnimmt, insbesondere in jener spezifischen Form, daß das Leben immer in das ‚Erlebnis’ subjektiviert und Erlebnis als Leben ‚objektiviert’ wird, gestattet ein solches – vor einer wirklichen Erkenntniskritik allerdings nie standhaltendes – Schillern zwischen Subjektivität und Objektivität.“ (46)
Eine ähnliche Funktion erfüllen der „Diskurs“ oder das „Diskursive“ in der Theorie von Laclau und Mouffe. Sie konstituieren einen Rahmen, in dem das Subjekt, das sich im Diskurs „artikuliert“ und konstituiert, freier, unbeschränkter als durch „objektivistische“ oder „essentialistische“ Vorgaben erscheint. Dem Marxismus wird eine „willkürliche“ Reduktion des Subjekts auf einen Aspekt oder eine Nebensächlichkeit, nämlich seine Klassenposition, vorgeworfen, während es sich im Diskurs vielfältiger, „reicher“, weil durch nichts Außerdiskursives „eingeschränkt“, vorkommen kann.
All dies dient in Wirklichkeit nur dazu, die reaktionären Konsequenzen der Theorie zu verschleiern.
Ausbeutungs- und Unterdrückungsverhältnisse
Eine der Konsequenzen aus dieser Strukturierung der Realität besteht darin, dass auch Ausbeutungs- und Unterdrückungsverhältnisse überhaupt erst und nur existieren, wenn sie im Diskurs artikuliert werden. Mouffe und Laclau verweigern sich dabei der Gleichsetzung (Synonymie) von Unterordnungsverhältnis, Unterdrückungsdrückungsverhältnis und Herrschaft.
„Das diese Synonomie ermöglichende Fundament ist ganz offensichtlich die anthropologische Annahme einer ‚menschlichen Natur’ und eines einheitlichen Subjekts: wenn wir a priori das Wesen eines Subjekts bestimmen können, wird jedes Unterordnungsverhältnis, das sich damit vereinbaren lässt, automatisch ein Unterdrückungsverhältnis.“ (47)
Zweifellos existieren auch Unterordnungsverhältnisse, die keine Unterdrückungsverhältnisse darstellen, sondern die sich aus bestimmten Aufgaben ergeben. So verlangt die Tätigkeit des Personals in einem Flugzeug zwar die Unterordnung von Passagieren unter bestimmte Anweisungen (z.B. Anschnallen beim Starten und Landen), aber daraus wird natürlich längst noch kein Unterdrückungs- oder Herrschaftsverhältnis. Aber darum geht es Laclau und Mouffe bei ihrer Unterscheidung nicht. Vielmehr geht es darum, unter welchen Bedingungen Unterordnung zur Unterdrückung oder gar zur Herrschaft wird.
„Wir verstehen unter einem Unterordnungsverhältnis die Unterwerfung eines sozialen Agenten unter die Entscheidung eines anderen – beispielsweise die Unterwerfung eines Arbeiters unter die Entscheidung des Unternehmers oder in bestimmten Formen der Familienorganisation die der Frau unter die Entscheidungen des Mannes und so weiter. Unterdrückungsverhältnisse nennen wir im Gegensatz dazu jene Unterordnungsverhältnisse, die sich zu Orten von Antagonismen transformiert haben. Schließlich bezeichnen wir als Herrschaftsverhältnisse die Reihe jener Unterdrückungsverhältnisse, die von der Perspektive oder im Urteil eines sozialen Agenten, der außerhalb ihrer steht, als illegitim betrachtet werden (…).“ (48)
An sich seien Unterordnungsverhältnisse, also auch die Ausbeutung von Klassen, das Patriarchat…, so Laclau und Mouffe, keine antagonistischen Verhältnisse. Sie würden dazu erst und nur dann, wenn sie als solche gesellschaftlich artikuliert werden.
„’Leibeigner’, ‚Sklave’ und so weiter bezeichnen nicht an sich antagonistische Positionen: nur in den Begriffen einer anderen diskursiven Formation, wie zum Beispiel der Behauptung ‚angeborener Rechte eines jeden Menschen’, kann die differentielle Position dieser Kategorien untergraben und Unterordnung als Unterdrückungsverhältnis konstruiert werden. Das bedeutet, dass es kein Unterdrückungsverhältnis ohne die Präsenz eines diskursiven ‚Äußeren’ gibt, von wo der Diskurs der Unterordnung unterbrochen werden kann.“ (49)
Mit anderen Worten: Die Ausbeutung der ArbeiterInnenklasse existiere nur als Unterordnungsverhältnis oder gar als Herrschaftsverhältnis einer Gruppe von Menschen über andere, wenn sie den gesellschaftlichen Akteuren diskursiv vor Augen trete. Außerhalb des Diskurses existiere es solches nicht , was natürlich auch auf die früheren Gesellschaftsformationen oder alle Formen sozialer Unterdrückung angewandt wird. So kann, nehmen wir Laclau/Mouffe ernst, von einer partiarchalen Unterdrückung der Frau nicht gesprochen werden, wenn diese derartig verfestigt ist, dass sie allen Gesellschaftsmitgliedern, Männern wie Frauen, als „natürlich“, unverändert erscheint. Gerade dann hätten wir es nur mit einer „Unterordnung“ zu tun. Alles andere würde bedeuten, der gesellschaftlichen Unterdrückung eine „Essenz“ außerhalb des Diskurses zuzusprechen. Die idealistische Konstruktion zeigt hier ihren reaktionären Gehalt.
Was für die Frauenunterdrückung gilt, gilt erst recht für die Kämpfe der ArbeiterInnenklasse. Die radikalen, antikapitalistischen Aspekte des ArbeiterInnenkampfes im 19. Jahrhundert werden in einer schiefen Polemik gegen E.P. Thompsons „Die Entstehung der englischen Arbeiterklasse“ so uminterpretiert, als ob die Radikalität nur von den untergehenden Handwerkern ausgegangen sei, die sich gegen die Vernichtung ihrer Identitäten durch das Fabriksystem und die große Maschinerie gewehrt hätten.
„Es gab ohne Zweifel im 19. Jahrhundert radikal antikapitalistische Kämpfe, nur waren sie keine Kämpfe des Proletariats – wenn wir unter ‚Proletariat’ eher den Arbeitertypus verstehen, der durch die Entwicklung des Kapitalismus produziert wurde, als jene Handwerker, deren Qualifikationen und Lebensweisen durch die Etablierung des kapitalistischen Produktionssystems bedroht waren.“ (50)
Doch diese Zeiten seien vorbei:
„Diese Arbeiterbewegung versucht jedoch immer weniger, die inzwischen auf solider Basis stehenden kapitalistischen Produktionsverhältnisse als solche anzuzweifeln und konzentriert sich auf den Kampf für eine Transformation der Verhältnisse in der Produktion. Jene Kämpfe, die die marxistische Tradition ‚reformistisch’ nennen und im Vergleich zu vorangegangenen als einen Schritt rückwärts betrachten würde, entsprechen in Wirklichkeit mehr dem Modus, den die Mobilisierungen des industriellen Proletariats angenommen hat, als die radikaleren Kämpfe früher. Die Unterordnungsverhältnisse zwischen Arbeitern und Kapitalisten wurden also bis zu einem gewissen Grad als legitime differentielle Positionen in einem einheitlichen diskursiven Raum absorbiert.“ (52)
Das Ausbeutungsverhältnis verschwindet im „einheitlichen diskursiven Raum“. Nachdem Laclau und Mouffe vom Klassencharakter verschiedener Ideologien nichts wissen wollen, reproduzieren sie selbst eine Standardideologie, und zwar eine der herrschenden Klasse. „Soziale Marktwirtschaft“ und „Sozialpartnerschaft“ hätten, jedenfalls bis zu einem gewissen Grad, einen Ausgleich der Klassen zur Realität werden lassen, diese würden als „differentielle“ (verschiedene) Positionen anerkannt. Demnach verschwinde nicht nur das Klassenbewusstsein, sondern auch die Ausbeutung selbst, sobald der Klassenwiderspruch diskursiv durch verschiedene Institutionen der Klassenzusammenarbeit für eine bestimmte Zeit befriedet und von oben reguliert werde.
Nachdem Mouffe und Laclau gegen den „Essentialismus“ zu Felde gezogen sind, wird deutlich, wohin diese Reise führt. Mit dem Verleugnen der Essenz des Klassenwiderspruchs und sozialer Unterdrückungsverhältnisse, mit der Leugnung der Tatsache, dass diese unabhängig vom Bewusstsein der Betroffenen auf Ausbeutung und Unterdrückung beruhen, verschwinden letztlich auch diese Verhältnisse.
So wie sie den grundlegenden Charakter des „Klassenessentialismus“ angreifen, so auch die materielle, vom Bewusstsein der Betroffenen unabhängige Grundlage aller Unterdrückungsverhältnisse. Auch wenn sich Mouffe und Laclau gern als VerteidigerIn der „neuen sozialen Bewegungen“ und von deren Kämpfen verstanden wissen wollen, die die ArbeiterInnenbewegung vernachlässigt habe (Umwelt, Frauen, sexuelle Unterdrückung usw.), so wendet sich ihre Theorie nicht nur gegen den Marxismus, sondern erst recht gegen alle Bewegungen sozial Unterdrückter. Frauenunterdrückung, Rassismus, Imperialismus usw. werden ja erst durch ihre Artikulation im Diskurs als Unterdrückungsverhältnis konstituiert. Davor existiert z.B. das Patriarchat oder die Sklaverei nach ihrer Argumentation nur als ein System der Unterordnung.
Mit dieser diskursiven Bestimmung entfällt schließlich auch der innere Zusammenhang von Ausbeutungs- und Unterdrückungsverhältnissen.
„Die klassische Konzeption des Sozialismus nahm an, dass aus dem Verschwinden des Privatbesitzes an Produktionsmitteln eine Kette von Wirkungen folgen würde, die über eine ganze historische Epoche zur Abschaffung aller Formen von Unterordnung führen würde. Heute wissen wir, dass dem nicht so ist. Zum Beispiel gibt es keine notwendigen Verbindungen zwischen Antisexismus und Antikapitalismus und eine Einheit zwischen beiden kann nur das Resultat einer hegemonialen Artikulation sein.“ (51)
Zweifellos haben reformistische und bürokratische Traditionen der ArbeiterInnenbewegung immer wieder zu einer Vernachlässigung, wenn nicht Ignoranz des Sexismus und des Kampfes um Frauenbefreiung geführt. Das drückte sich entweder in der Reproduktion repressiver Verhaltensweisen und Strukturen in der Bewegung selbst oder der Politik des Reformismus an der Regierung oder des Stalinismus in den bürokratisch degenerierten ArbeiterInnenstaaten aus. Wie die geschichtliche Erfahrung zeigt, darf die Befreiung der Frauen wie die Überwindung anderer Formen sozialer Unterdrückung nach einer Revolution nicht als automatische Wirkung der Abschaffung des Privateigentums an den Produktionsmitteln verstanden werden. Sie bedürfen vielmehr eines zähen, bewussten Kampfes. Aber das ändert nichts daran, dass die Abschaffung des Privateigentums an den Produktionsmittel und des kapitalistischen Weltsystems die Voraussetzung für eine reale Überwindung aller Unterdrückungsverhältnisse darstellt.
Ökonomismus und Reformismus verstanden und verstehen den Kampf gegen soziale Unterdrückung als eine den „eigentlichen“ ArbeiterInneninteressen untergeordnete Frage – ebenso wie sie den Klassenkampf selbst auf Sozialreform und Gewerkschafterei verengen. Genau darin bestand und besteht ihr fundamentaler Bruch mit dem revolutionären Marxismus.
Die Kritik von Laclau und Mouffe richtet sich in dem Zusammenhang nun vor allem gegen den Marxismus. Sie ignorieren dabei jedoch gerade die marxistische Analyse des Ursprungs der Frauenunterdrückung und deren geschichtliche Wandlung in verschiedenen Klassengesellschaften, die gerade den inneren Zusammenhang von Sexismus und Kapitalismus deutlich macht und daher auch die Notwendigkeit der Vergesellschaftung der Hausarbeit hervorhebt. Diese erfordert notwendigerweise die Überwindung der bestehenden geschlechtlichen wie auch gesellschaftlichen Arbeitsteilung. Laclau und Mouffe ignorieren aber die marxistische Analyse der Familie, des Ursprungs der Frauenunterdrückung und ihres inneren Zusammenhangs mit dem Kapitalismus.
Das ist aber vom Standpunkt ihrer Theorie auch nicht notwendig. Nachdem einmal gesetzt ist, dass Unterdrückungsverhältnisse, Herrschaftsverhältnisse und der Kampf gegen diese nur im Diskurs konstituiert werden können, kann auch der Zusammenhang zwischen diesen nur im Diskurs konstituiert werden. Das heißt aber, dass sie bei ihnen immer als voneinander getrennte Kämpfe verstanden werden müssen, die sich (a) auch ursprünglich nur als getrennte artikulieren können und (b) die nur durch eine Reihe von antagonistischen Artikulationen, also durch einen Verweis auf einen dritten gemeinsamen Feind (z.B. „die Elite“) verbunden werden können.
Die Verbindung zwischen den Kämpfen bleibt damit notwendigerweise immer instabil, prekär. Vor allem aber ist ihre Verknüpfung grundsätzlich beliebig, „kontingent“. Sie richtet sich nicht nach objektiven gesellschaftlichen Zusammenhängen, sondern sie wird je nach politischem Zweck mit diesem oder jenem verbunden. Da Laclau und Mouffe eine rationale, außerhalb des Diskurses gesetzte Verbindung zwischen verschiedenen Formen der Unterdrückung für unmöglich erklären, umfasst jede diskursive Setzung notwendigerweise ein beliebiges, politisch amorphes und letztlich auch demagogisches Element. Für Mouffe und Laclau macht genau das, wie wir sehen werden, ein Wesensmoment jeder Politik – auch linker – aus.
Keine vernünftige Einrichtung der Gesellschaft möglich
Dies verweist auf eine andere Konstante im Denken der beiden linkspopulistischen AutorInnen. Sie lehnen grundsätzlich ab, dass eine vernünftige „durchsichtige“ Organisation der Gesellschaft überhaupt möglich sei. So wirft Mouffe in ihrem Buch „Über das Politische. Wider die kosmopolitische Illusion“ einigen „liberalen Denkern“ vor:
„Der rationalistische Glaube an die Möglichkeit eines auf Vernunft basierenden universalen Konsens stellt aber – neben dem Individualismus – das andere zentrale Merkmal der meisten Formen liberalen Denkens dar.“ (53)
Lassen wir einmal dahingestellt, ob AutorInnen wie Rawl, Habermas, Beck und Giddens sowie etliche andere am ehesten als „liberale Denker“ aufgefasst werden können, so wird doch deutlich, was diesen sozialliberalen oder reformistischen TheoretikerInnen vorgeworfen wird. Mouffe/Laclau unterstellen ihnen, dass sich die gesellschaftlichen Konflikte über einen demokratischen, auf Verständigung orientierten Mechanismus „konsensual“, also trotz unterschiedlicher Interessen und gesellschaftlicher Stellung durch einen Rekurs auf wechselseitig anerkannte vernünftige Gründe, lösen ließen.
Der Utopismus und der ideologische Gehalt dieser Konzeption springen geradezu ins Auge. Der „vernünftige Konsens“ entspricht den Interessen der herrschenden Klasse bzw. deren dominanter Fraktion und ideologischer Ausrichtung. Die Vorstellungen dieser AutorInnen – vor allem von Beck und Giddens – waren und sind im Grunde Ausdruck einer sozialdemokratischen oder labouristischen Politik, die den Sieg und die Folgen des Neoliberalismus akzeptiert haben. Unter Blair und Schröder sollten allenfalls deren destabilisierende Auswirkungen auf die ArbeiterInnenaristokratie und die lohnabhängigen Mittelschichten abgeschwächt werden. Mouffe kritisiert zu Recht, dass mit der „Neuen Mitte“ oder dem „Dritten Weg“ ganz wie unter Clinton und Obama in den USA nicht viel „gemildert“ wurde, zum Teil sogar drakonische Angriffe auf die ArbeiterInnenklasse gefahren worden seien (z.B. die Agenda 2010 unter Schröder).
Aber die Kritik von Mouffe und Laclau umfasst auch einen anderen Aspekt des „Liberalismus“. Es geht um die Möglichkeit einer universellen, vernünftigen Einrichtung der Gesellschaft selbst. Mouffe wirft dem „liberalen Denken“ nicht nur vor, dass es eigentlich keiner vernünftigen Gesellschaft das Wort rede und auch die Herrschaft einer Klasse und eine bestimmte neoliberale politische Ausrichtung verkläre. Sie kritisiert darüber hinaus AutorInnen wie Habermas, aber auch Hannah Arendt, die mit dem Neoliberalismus sicher nichts zu tun hat, oder die antikapitalistischen Bewegungen um die Jahrtausende dafür, dass sie der falschen Vorstellung nachhängen würden, dass die Welt vernünftig eingerichtet werden könne.
Hier wird das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Mouffe und Laclau behaupten nämlich nicht mehr und nicht weniger als einen grundsätzlich irrationalen Charakter des Politischen:
„Nur wenn der offene, ungenähte Charakter des Sozialen gänzlich akzeptiert, wenn der Essentialismus der Totalität und der Elemente verworfen wird, wird dieses Potential klar erkennbar und kann ‚Hegemonie’ ein wesentliches Werkzeug für eine politische Analyse der Linken sein.“ (54)
Unter „ungenäht“ verstehen Laclau und Mouffe zum einen, dass das Soziale immer unartikulierte, im Diskurs oder einer hegemonialen Ordnung nicht erscheinende Momente beinhalte. Damit meinen sie aber nicht, dass die Realität immer reichhaltiger sei als jede wissenschaftliche Verallgemeinerung. Vielmehr beinhalte die diskursive Konstitution des Sozialen immer auch eine alternative, „unausgesprochene“, unbewusste Form seiner Konstituierung, z.B. durch einen „Gegendiskurs“, ohne dass rational entschieden werden könne, welcher denn als solcher vernünftiger sei.
Der Anspruch, rational zu entscheiden, ob ein bestimmter „Diskurs“, ein bestimmtes gesellschaftliches Ziel oder ein Argument vernünftig sei oder nicht, erscheint als eine Form des Totalitarismus:
„Jeder Versuch, eine endgültige Naht zu etablieren und den radikal offenen Charakter des Sozialen zu verneinen, den die Logik der Demokratie errichtet, führt zu dem, was Lefort als ‚Totalitarismus’ bezeichnet, zu einer Logik der Konstruktion des Politischen, die darin besteht, einen Ausgangspunkt zu setzen, von dem aus Gesellschaft vollkommen gemeistert werden und gewusst werden kann. Dass dies eine politische Logik und kein Typus sozialer Organisation ist, wird durch die Tatsache bewiesen, dass sie keiner besonderen politischen Orientierung zugeschrieben werden kann; sie kann das Resultat ‚linker’ Politik sein, nach der jeder Antagonismus eliminiert und Gesellschaft vollkommen transparent gemacht werden kann, oder, wie im Fall des Faschismus, das Resultat eines autoritären Fixierens der sozialen Ordnung in vom Staat etablierte Hierarchien sein. Aber in beiden Fällen erhebt sich der Staat auf den Status des einzigen Besitzers der Wahrheit der sozialen Ordnung, ob im Namen des Proletariats oder der Nation, und sucht, alle Netze der Stabilität zu kontrollieren. Angesichts der radikalen Unbestimmtheit, die die Demokratie eröffnet, bedeutet dies einen Versuch, wieder ein absolutes Zentrum einzuführen und die Geschlossenheit wiederherzustellen, die Einheit wiedereinsetzt.“ (55)
Hier wird in die Mottenkiste der reaktionären Totalitarismustheorie zurückgegriffen. Kommunismus und Faschismus werden gleichgesetzt, weil beide eine „absolute“ Ordnung schaffen wollten. Die Gleichsetzung ist nur möglich, wenn von den gegensätzlichen Zielen und dem Klassencharakter dieser politischen Kräfte abgesehen wird. Während der Faschismus eine totalitäre, von allen Stützpunkten proletarischer Demokratie gesäuberte kapitalistische Ordnung schaffen will, kämpft der Kommunismus für die umfassende Befreiung von jeder Form der Ausbeutung und Unterdrückung, für eine universelle Gesellschaft, in der bewusst zur Befriedigung der Bedürfnisse aller produziert wird.
Dabei geht es nicht darum, dass in einer zukünftigen, kommunistischen Gesellschaftsordnung alles „vollkommen gewusst werden kann“. Dies wäre in der Tat ein Ding der Unmöglichkeit, weil natürlich auch in einer zukünftigen klassenlosen Gesellschaft neue Herausforderungen entstehen würden. Diese klassenlose Gesellschaft würde sicher nicht den Endpunkt der geschichtlichen Entwicklung, sondern vielmehr den Beginn einer Entwicklungsperiode bedeuten, in der die Menschen wirklich ihre Geschichte selbst gestalten, in der ihnen ihre eigenen, von ihnen selbst geschaffenen Verhältnisse nicht als fremde, unbewusste Mächte gegenübertreten würden. In diesem Sinn würde die Überwindung der Klassengesellschaft tatsächlich die Grundlage für eine transparente Einrichtung der Gesellschaft und ein vernünftiges, nachhaltiges Verhältnis zur Natur schaffen.
Für Mouffe und Laclau ist jedoch, auch wenn sie an einigen Stellen weiter von „sozialistischen Zielen“ sprechen, eine Überwindung des Klassengegensatzes ebenso unvorstellbar wie das Absterben des Staates. Genau gegen dieses Ziel, die Schaffung einer nicht-antagonistischen Gesellschaftsformation, wenden sie sich vehement.
„Außerdem weisen wir darauf hin, dass die Ausweitung und Radikalisierung des Kampfes für mehr Demokratie niemals zu einer völlig befreiten Gesellschaft führen wird und man das emanzipatorische Projekt nicht mehr als gleichbedeutend mit der Eliminierung des Staates verstehen kann. Antagonismen, Konflikte und eine gewisse Undurchlässigkeit wird es in einer Gesellschaft immer geben. Daher gelte es, sich vom Mythos des Kommunismus als transparenter und versöhnter Gesellschaft – eine Idee, die klarerweise ein Ende der Politik einschließt – zu verabschieden.“ (56)
Antagonismus versus Klassenwiderspruch
Diese „mythologische“ Zielsetzung habe der Marxismus vom Jakobinismus der Französischen Revolution übernommen. Auch dieser habe auf einen „imaginären Bruch“ gezielt, der zum Totalitarismus habe führen müssen. Marxismus und Jakobinismus müssten daher durch „das Projekt für eine radikale Demokratie in Frage gestellt werden.“ (57).
„Die beiden wesentlichen Voraussetzungen für die Konstruktion eines neuen politischen Imaginären, das radikal libertär und in seinen Zielen unendlich viel anspruchsvoller als das der klassischen Linken ist, sind die Ablehnung von privilegierten Bruchpunkten und der Vorstellung des Zusammenfließens der Kämpfe zu einem einheitlichen politischen Raum sowie im Gegensatz dazu die Anerkennung der Pluralität und Unbestimmtheit des Sozialen.“ (58)
Dazu müsse das neue „Terrain“ beschrieben werden, das mit Beginn der bürgerlichen Gesellschaft geschaffen worden sei. Diese habe nämlich das Politische als den Raum der gesellschaftlichen Auseinandersetzung geschaffen, das in zwei Prinzipien konstituiert worden sei, die zur Mobilisierung gesellschaftlicher Kräfte grundlegend seien:
„Aber um derart mobilisierend werden zu können, musste sich zuerst das demokratische Prinzip der Freiheit und Gleichheit als neue Matrix des sozialen Immaginären durchsetzen beziehungsweise, in unserer Terminologie, einen fundamentalen Knotenpunkt in der Konstruktion des Politischen bilden. Diese entscheidende Veränderung des politischen Imaginären westlicher Gesellschaften fand vor zweihundert Jahren statt und kann dahingehend bestimmt werden, dass die Logik der Äquivalenz in das grundlegende Instrument der Produktion des Sozialen transformiert wurde. Diese Veränderung bezeichnen wir in Anlehnung an einen Ausdruck von Tocqueville als ‚demokratische Revolution’“ (59)
Nicht der Klassenkampf, sondern der „demokratische Diskurs“ und die Legitimitätsvorstellung der Französischen Revolution, nämlich dass alle Macht vom Volk auszugehen habe, bilde die Antriebskraft der politischen und gesellschaftlichen Bewegungen der letzten 200 Jahre – und auch den Rahmen für „fortschrittliche“ Politik. Mouffe und Laclau interpretieren auch die ArbeiterInnenkämpfe – wie alle anderen progressiven Kämpfe der letzten 200 Jahre – als Formen der „Ausweitung von Gleichheit und Freiheit auf immer größere Bereiche“ (60).
Nachdem die beiden viele Seiten darauf verwendet haben, das marxistische Verständnis von Basis und Überbau anzugreifen, kehren sie es schließlich um. Nicht die ökonomische Basis determiniert den staatlichen, ideologischen Überbau, sondern „die Demokratie“ konstituiert die Gesellschaft.
Während der Marxismus die vorherrschenden Ideen – und dazu gehört die bürgerliche Demokratie samt ihrer Versprechen von „Freiheit“ und „Gleichheit“ – als die Ideen der Herrschenden bestimmt, erkennen wir nun, warum es für Laclau und Mouffe von so großer Bedeutung war, den Klassencharakter jeder „popularen“ Ideologie von „Demokratie“, „Nation“, „Freiheit“, „Gleichheit“ zu leugnen.
Nach der „Dekonstruktion des Marxismus“ werden zentrale Knotenpunkte in die diskursive Bestimmung des Politischen eingeführt, und zwar als angeblich von den Klassen unabhängige Formen. Solcherart wird, wie in jeder bürgerlichen Ideologie, der Klassencharakter der eigenen Theorie verschleiert, indem grundlegende Begriffe so konzipiert werden, dass sie über den gesellschaftlichen Gegensätzen zu stehen scheinen.
Dabei kommen Mouffe und Laclau in der Tat zugute, dass die meisten „Konflikte“ der letzten 200 Jahre als Kämpfe um mehr „Demokratie“ erschienen, um mehr Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit. Das trifft zweifellos auch auf die meisten ökonomischen Kämpfe der Lohnabhängigen zu, die, solange sie im rein gewerkschaftlichen Rahmen verbleiben, wesentlich um die Verkaufsbedingungen der Ware Arbeitskraft, also um „gerechten“ Lohn geführt werden.
Dass sich die meisten Auseinandersetzungen in der bestehenden Gesellschaft im Rahmen des bürgerlichen Rechtshorizonts, im Rahmen von „Freiheit“ und „Gleichheit“ bewegen, ja, bewegen müssen, verweist letztlich auch nur darauf, dass die herrschenden Ideen die Vorstellungen aller Klassen prägen. Es sind notwendigerweise nur „Ausnahmesituationen“, heftige Klassenkämpfe, Krise, Kriege, Revolutionen und Konterrevolutionen, also „Bruchpunkte“, in denen dieser Horizont auch durch die Massen praktisch in Frage gestellt wird.
Während MarxistInnen gerade auf die Zuspitzung solcher Kämpfe und die revolutionäre Lösung von Krisen drängen, erklären Mouffe und Laclau die Aufhebung der grundlegenden gesellschaftlichen Widersprüche für unmöglich und sagen der kommunistischen Strategie offen den Kampf an:
„Der Kompromiss, der prekäre Charakter jeder Anordnung sowie der Antagonismus sind die primären Wirklichkeiten, während das Moment der Positivität und seiner Verwaltung nur innerhalb dieser Instabilität stattfinden. Ein Projekt für radikale Demokratie voranzutreiben, bedeutet deshalb, den Mythos einer rationalen und transparenten Gesellschaft dazu zu zwingen, sich nach und nach an den Horizont des Sozialen zurückzuziehen. Diese wird so ein ‚Un-Ort’, das Symbol ihrer eigenen Unmöglichkeit.“ (61)
Während der Begriff der „Demokratie“ entideologisiert wird, erfahren auch die Begriffe „Antagonismus“ und „Hegemonie“, die ursprünglich marxistischen Theorien und Diskussionssträngen entnommen sind, eine entscheidende Bedeutungsverschiebungen.
Der Begriff „Antagonismus“ erinnert zwar an den Klassenwiderspruch. Er besagt aber bei ihnen etwas gänzlich anderes. „Widerspruch“ allgemein impliziert im Marxismus nicht nur eine Verlaufsform gesellschaftlicher Kämpfe, er drängt auch zu seiner Aufhebung, er verweist also auf seine Lösung. Für Mouffe und Laclau hingegen ist der Antagonismus eine Bestimmung des politischen Terrains selbst. In dessen Rahmen müssten Gegensätze immer wieder hervortreten, die Aufteilung des Raums in ein „Wir“ und „Sie“ könne grundsätzlich nicht überwunden werden. Der „Liberalismus“ versage genau darin, diese unaufhebbare Bestimmung des Politischen anzuerkennen:
„Ich werde das zentrale Defizit des Liberalismus auf dem Gebiet des Politischen herausarbeiten: sein Negieren das Antagonismus“. (62) Die „radikalste Infragestellung des so verstandenen Liberalismus“ finde sich lt. Mouffe im Werk von Carl Schmitt, dem sie über weite Strecken folgt.
„Der für das liberale Denken charakteristische methodologische Individualismus schließt das Verständnis des Wesens kollektiver Identitäten aus, während das Kriterium des Politischen, die differentia specifica, für Schmitt die Unterscheidung von Freund und Feind ist.“ (63)
Dummerweise hat Carl Schmitt das Freund-Feind-Schema im faschistischen Sinn auf seinen Endpunkt hingedacht, die Vernichtung des Feindes durch die zur Volksgemeinschaft barbarisierte Nation. Diese ultrareaktionären, faschistischen Konsequenzen will Mouffe nicht – sie übersieht aber vollständig, dass die Vernichtung des Feindes, dessen Auslöschung in Schmitts Hauptwerk „Der Begriff des Politischen“ nicht eine beliebige Schlussfolgerung darstellt, sondern die radikale Konsequenz seiner wesentlich irrationalen Konstitution des Antagonismus ist.
Die von Mouffe so gelobte Freund-Feind-Gegenüberstellung folgt einer recht dürren essentialistischen Bestimmung Schmitts: „Der Krieg, die Todesbereitschaft kämpfender Menschen, die physische Tötung von anderen Menschen, die auf der Seite des Feindes stehen, alles das hat keinen normativen, sondern nur einen essentiellen Sinn, und zwar in der Realität einer Situation des wirklichen Kampfes gegen einen wirklichen Feind, nicht in irgendwelchen Idealen, Programmen und Normativitäten. … Gibt es wirklich Feinde in der seinsmäßigen Bedeutung, wie es hier gemeint ist, so ist es sinnvoll, aber nur politisch sinnvoll, sie nötigenfalls physisch abzuwehren und mit ihnen zu kämpfen.“ (64)
Jeder außerhalb des „Seinsmäßigen“ liegende Grund für die Feindschaft (Programme, Normen, Ideale, Ziele, …) wird als nebensächlich betrachtet. Sie fußt vielmehr in einem überhistorischen, existenzialistisch bestimmten Wesen „der Menschen“. Die „Massendemokratie“, der ständige innere Gegensatz der Gesellschaft stehe dem im Weg, hindere nach Schmitt den Staat an der Verfolgung eines einheitlichen Willens. Die Unterscheidung von Freund und Feind konstituiert für ihn nicht einfach das „Politische“, sondern vielmehr die politische Existenz des Staates. Dieser kann umso ungehinderter zwischen Freund und Feind unterscheiden, je freier er von Antagonismen im Inneren, von „Massendemokratie“ und ArbeiterInnenbewegung ist.
„Gerade indem Schmitts Gegensatzpaar ‚Freund-Feind’ mit der Prätention, alle Probleme des gesellschaftlichen Lebens zu lösen, auftritt, wird seine Leere und Willkürlichkeit offenkundig. Gerade damit erweist er sich als äußerst wirkungsvoll in der Periode der Faschisierung der deutschen Ideologie; als methodologisches, abstraktes, sich wissenschaftlich gebärdendes Prolegomenon zu dem von Hitler und Rosenberg konstruierten Rassengegensatz.“ (65)
Mouffe lehnt zwar Schmitts Schlussfolgerungen und seine faschistischen Positionen ab – sie ist aber vollkommen blind dafür, wie und warum das „Freund-Feind-Schema“ zur begeisterten Befürwortung des Faschismus, Hitlers und des deutschen Imperialismus führte. Die Leugnung der materiellen Wurzeln reaktionärer Ideologien lässt sie nicht nur diesen Zusammenhang ausblenden – sie erlaubt ihr auch, die „brauchbaren“ Seiten von Schmitt eklektisch von seinen „falschen Schlussfolgerungen“ zu trennen.
Dabei übernimmt sie jedoch unwillkürlich einen Aspekt der Schmitt’schen Konzeption. Auch für Mouffe erscheint der „antagonistische Charakter“ der Politik unüberwindbar, eine vernünftige Organisation der Gesellschaft unmöglich.
Im Unterschied zu Schmitt will sie aber den Antagonismus begrenzen:
„Wir können hier festhalten, dass die Wir-Sie-Unterschiedung – die conditio sine qua non der Bildung politischer Identitäten – immer zum Ort eines Antagonismus werden kann. Da alle Formen politischer Identitäten eine Wir-Sie-Unterscheidung beinhalten, kann die Möglichkeit der Entstehung eines Antagonismus niemals ausgeschlossen werden. Insofern ist der Glaube an eine Gesellschaft ohne Antagonismus eine Illusion. Der Antagonismus ist, so Schmitt, eine immer gegenwärtige Möglichkeit; das Politische gehört zu unserer ontologischen Verfassung.“ (66)
Mit anderen Worten: Die Überwindung von Klassengegensätzen und Unterdrückungsverhältnissen wird für unmöglich erklärt, eine „gewisse“ Ungleichheit müsse es immer geben – und daher auch das Politische. Nachdem Laclau und Mouffe in ihrer „Dekonstruktion des Marxismus“ immer wieder darauf bestanden, dass Kämpfe nur im Diskurs konstituiert würden, zeigt sich, dass der „diskursive Raum“ selbst von der vorherrschenden Klassenideologie der bürgerlichen Epoche geprägt ist. Schon bei ihrem Bezug auf die bürgerliche, „radikale“ Demokratie entpuppt sich der „diskursive Raum“ als der Raum der demokratischen Herrschaftsorganisation. Bei Betrachtung des Antagonismus greift Mouffe auf das dürre „Freund-Feind“-Schema zurück. Das Politische, das uns zuvor noch als diskursiv konstituiert präsentiert wurde, wird nun zu einer ontologischen Größe. Antagonismen wird es immer geben – diese dünne, abstrakte, von jedem besonderen gesellschaftlichen Verhältnis gereinigte Aussage steht etwa auf dem Erkenntnisniveau von Volksweisheiten wie „Streiten werden sich die Menschen immer“. Doch die wenigsten Menschen beanspruchen, solche Sätze zur Grundlagen einer politischen Theorie zu machen.
Wenn „der Antagonismus“ also immer latent vorhanden ist, kann es nur darauf ankommen, in welcher Weise Antagonismen ausgetragen werden. Im Gegensatz zur Lösung von Schmitt schlägt Mouffe eine Begrenzung von Konfrontationen vor. Zur (physischen) Vernichtung des Feindes gebe es nämlich eine Alternative: die Begrenzung auf einen gemeinsamen Bezugsrahmen, auf die bürgerliche liberale Demokratie.
„Damit ein Konflikt als legitim akzeptiert wird, muß er eine Form annehmen, die die politische Gemeinschaft nicht zerstört. Das heißt, es muß zwischen den miteinander in Konflikt liegenden Parteien eine Art gemeinsames Band bestehen, damit sie den jeweiligen Gegner nicht als zu vernichtenden Feind betrachten, dessen Forderungen illegitim sind; (..) Wollen wir einerseits die Dauerhaftigkeit der antagonistischen Dimension des Konflikts anerkennen, andererseits die Möglichkeit ihrer ‚Zähmung’ zulassen, so müssen wir eine dritte Beziehungsform in Aussicht nehmen.“ (67)
Dafür prägt Mouffe den Begriff des „Agonismus“. Darunter versteht sie nicht, dass der Antagonismus eliminiert oder verschwinden, sondern „sublimiert“ würde. Die bestehenden Verhältnisse, die Vorherrschaft der Elite würde auch bei einer solchen Begrenzung des Kampfes nicht unangetastet bleiben, sondern durchaus angegriffen werden – wenn auch innerhalb eines gewissen Rahmens:
„Im agonistischen Kampf dagegen steht die Konfiguration der Machtverhältnisse selbst auf dem Spiel, um welche herum die Gesellschaft strukturiert ist. Es ist ein Kampf zwischen unvereinbaren hegemonialen Projekten, die niemals rational miteinander versöhnt werden können. Die antagonistische Dimension ist dabei immer gegenwärtig, es ist eine reale Konfrontation, die allerdings durch eine Reihe demokratischer, von den jeweiligen Gegnern akzeptierten Verfahrensweisen reguliert wird.“ (68)
Der Kampf um Hegemonie spielt hier eine andere Rolle als im marxistischen Denken, in diesem gilt er letztlich als Mittel zur Vorbereitung der Revolution bzw. zur Umgruppierung der Kräfte in der Revolution. Das Ziel besteht in der Erringung der Hegemonie einer Klasse, des Proletariats und der Führung anderer nicht-ausbeutender Klassen oder Schichten, hin zum revolutionären Sturz des Kapitalismus.
Für Laclau und Mouffe hingegen zielt Hegemonie auf die Errichtung eines neuen „Machtblocks“ , und das auf Grundlage des bürgerlich-demokratischen Systems. Sie betrachten dessen Institutionen, den Staat usw. zwar nicht im engen Sinn als „neutral“, aber als formbar im Sinne einer jeweiligen antagonistischen Strömung oder Artikulation.
Hegemonie kann dabei nur erkämpft werden, wenn unterschiedliche gesellschaftliche Kräfte durch eine Kette von Artikulationen verbunden werden. So wäre es möglich, verschiedene Klassen, Schichten oder auch Antagonismen zu vereinen. Dies gilt für rechte wie linke Politik. Eine bestehende hegemoniale politische Struktur kann, ist sie einmal etabliert, nur gebrochen werden, wenn es gelingt, eine „gegenhegemoniale“ Verknüpfung unterschiedlicher Akteure herzustellen. Diese Verbindung nennen Laclau und Mouffe eine „Äquivalenzkette“. Diese müsse, um erfolgreich zu sein, selbst einen populistischen Charakter haben, also „das Volk anrufen“ oder gewissermaßen „schaffen“.
In den früheren Schriften wie „Politik und Ideologie im Marxismus“ oder auch in „Hegemonie und radikale Demokratie“ betonen Mouffe und Laclau auch den „antikapitalistischen“ oder gar sozialistischen Charakter einer solchen Verknüpfung. In den Arbeiten der 70er Jahre teilt Laclau mit dem Marxismus noch das Ziel der Überwindung der Klassengesellschaft und erklärt, dass die höchste Form des Populismus der Sozialismus sei und dass auch die populistische Konfrontation einen Klassenbezug haben müsse.
In „Hegemonie und radikale Demokratie“, das erstmals 1985 erschien, arbeiten sich die beiden noch vorwiegend am Marxismus ab – und schlagen eine enge Verbindung der heterogenen Akteure der „neuen sozialen Bewegungen“, von feministischen, antirassistischen, ökologischen Kämpfen und ArbeiterInnenkämpfen, zu einer populistischen Gegenkraft vor. Ihre Polemik gegen den Marxismus, gegen dessen „Privilegierung“ der ArbeiterInnenklasse, richtet sich gegen die wirkliche oder vermeintliche Ignoranz anderer Unterdrückter gegenüber und gegen den revolutionären Sturz des Kapitalismus. Schon 1985 wird allerdings die notwendige Verabschiedung vom Universalismus proklamiert, allerdings noch in einer recht allgemeinen Form (auf deren handgreifliche reaktionäre Konsequenzen kommen wir weiter unten zu sprechen).
Noch in den 1990er Jahren und auf dem Höhepunkt der antikapitalistischen oder Antiglobalisierungsbewegung beziehen sich Mouffe und Laclau positiv auf eine internationale Kraft, die sich selbst zum Ziel gesetzt habe, die Welt als ganze zu verändern und der kapitalistischen Globalisierung eine von unten entgegenzusetzen.
Da diese Bewegungen auch Elemente des „Volkes“ oder der „Völker“ waren, die zu bestimmten Zeitpunkten angesprochen oder konstituiert werden sollten, setzten diese AdressatInnen dem reaktionären Element des Linkspopulismus noch gewisse Grenzen, doch die Schriften der letzten zehn Jahre markieren hier einen weiteren Schwenk nach rechts, der seinerseits zwei Ursachen hat: einerseits den Aufstieg rechtspopulistischer Parteien, andererseits die Formierung nationalstaatlich ausgerichteter linkspopulistischer oder linksreformistischer Kräfte in Europa.
Vom Gegner was lernen?
Der Aufstieg rechtspopulistischer Parteien stellt für Mouffe und Laclau erneut ein Problem der Linken in den Mittelpunkt, das sie schon beim Aufstieg Thatchers am Werk sahen. Die Linke, die noch immer zu sehr von „Klassenessentialismus“, „Liberalismus“ oder „Kosmopolitismus“ geprägt sei, verstehe die Ursachen des Erfolgs der Rechten nicht.
Thatcher und der Neoliberalismus, so wird immer wieder betont, hätten es geschafft, eine populistische Verknüpfung, eine „Äquivalenzkette“ herzustellen, die an ein konstituierendes Moment der bürgerlichen Demokratie, die „Freiheit“ angeknüpft und gleichzeitig das andere, die Gleichheit, negativ besetzt hätten. Der Sozialstaat und seine UnterstützerInnen seien über die Äquivalenzkette „Gleichheit = Identität = Totalitarismus“ als der Feind dargestellt worden. Gleichzeitig habe die neoliberale Alternative über die zweite Äquivalenzkette „Differenz = Ungleichheit = Freiheit“ geschafft, „Verschiedenheit“ (Differenz) als etwas Positives (Freiheit) darzustellen und die Ungleichheit dabei als notwendigen Begleitumstand in die Welt gesetzt, während die Gleichheit als „Gleichmacherei“ und „Totalitarismus“ erfolgreich gebrandmarkt worden sei.
Wie wir schon am Beginn des Textes gezeigt haben, ignoriert diese Vorstellung die wirklichen Ursachen für die Siege des Neoliberalismus. Das Beispiel verdeutlicht aber, wie sich Mouffe und Laclau eine „Äquivalenzkette“ vorstellen, die natürlich auch noch einen gemeinsamen Feind, eine wirkliche oder vorgebliche „Elite“ brauche, gegen die sich das Volk wenden müsse. Im Falle des Thatcherismus seien der Sozialstaat, die „SchmarotzerInnen“ (also die Armen) und die Gewerkschaften samt der sie unterstützenden Labour-Partei als solche konstruiert worden. Der Neoliberalismus siegte, wurde für Jahrzehnte hegemonial, erschien alternativlos, globalisierte die Welt und seine einstigen Gegner (Sozialdemokratie, Linksliberalismus) richteten sich in seiner Welt ein, übernahmen sein „Narrativ“. Der letzte Satz beschreibt zweifellos einen wichtigen Aspekt der Wirklichkeit nach dem Sieg des Neoliberalismus. Die Erklärung der Ursachen dieser Erfolgs stellt jedoch die Realität auf den Kopf. Sie betrachtet die Klassenschlachten zwischen der ArbeiterInnenklasse und dem Kapital letztlich als Nebenaspekt. Nicht an der verräterischen, reformistischen Politik der Labour-Führung und der Gewerkschaftsbürokratie seien die BergarbeiterInnen gescheitert, sondern an zu wenig Populismus. Nicht der Generalstreik hätte die Machtfrage stellen können, sondern eine linke, populistische „Äquivalenzkette“ hätte dem Thatcherismus entgegengestellt werden müssen. So wären die Mittelschichten mit den BergarbeiterInnen verbunden gewesen und ein anti-neoliberales „Volk“ hätte konstruiert werden können.
Heute erleben wir eine Krise dieser hegemonialen Ordnung. Diese schafft die Bedingungen für ihre Herausforderung. Das Haupthindernis auf diesem Weg erblickt Mouffe in der von Liberalen und SozialdemokratInnen vertretenen „postpolitischen Ordnung“, die nichts von Antagonismus wissen wolle, und meint, die Gesellschaft durch Pseudoalternativen befrieden zu können. Dabei werde auf diese Weise jede Kritik an der Gesellschaft „ausgegrenzt“ und so eine untergehende Ordnung gegen ein zunehmendes Aufbegehren der Bevölkerung verteidigt. Die Linke müsse deshalb mit dieser „Postpolitik“ der Mitte brechen und von den RechtspopulistInnen lernen, dass wir einen „populistischen Moment“ durchleben:
„In dieser Untersuchung der Lage, in der Westeuropa sich derzeit befindet, habe ich argumentiert, wir durchlebten gerade einen ‚populistischen Moment’. Dieser ist Ausdruck der Widerstände gegen die postdemokratischen Zustände, die dreißig Jahre neoliberale Hegemonie hinterlassen haben. Dass diese Hegemonie nun in einer Krise steckt, eröffnet die Chance, eine neue hegemoniale Formation zu errichten. Je nachdem, wie diese Widerstände artikuliert werden und mit welcher Art von Politik der Neoliberalismus infrage gestellt werden wird, könnte diese neue hegemoniale Formation entweder demokratischer oder autoritärer als die bestehende sein.“ (69)
Die rechten Parteien hätten diese Lage besser erfasst, wie der Aufstieg der FPÖ in Österreich zeige:
„Haiders diskursive Strategie bestand darin, eine Grenze zwischen einem ‚Wir’, zu dem alle guten Österreicher gehörten – hart arbeitende Menschen und Verteidiger der nationalen Werte -, und einem ‚Sie’, das sich aus den an der Macht befindlichen Parteien, den Gewerkschaften, Bürokraten, Ausländern, Linksintellektuellen und Künstlern zusammensetze, die alle als Hindernisse für eine wirkliche demokratische Diskussion dargestellt wurden. Aufgrund dieser populistischen Strategie erfuhr die FPÖ einen dramatischen Zulauf. “ (70)
Und weiter: „Ich möchte vielmehr betonen, daß entgegen der weitverbreiteten Ansicht sicher nicht der Appell an angebliche Nazi-Nostalgie für den dramatischen Aufstieg der FPÖ verantwortlich war, sondern Haiders Fähigkeit, im Kontext der Opposition zwischen ‚dem Volk’ und den ‚Konsens-Eliten’ einen mächtigen Pol kollektiver Identifikation zu schaffen.“ (71)
Eine Analyse der sozialen Basis der FPÖ oder gar des Klassencharakters ihrer Politik fehlt bei Mouffe ebenso wie eine Betrachtung der Gründe, warum das österreichische Kapital auf eine schwarz-blaue Regierung setzte (und nun wieder setzt). Statt dessen prangert sie die Hoffnungslosigkeit der „Ausgrenzungspolitik“ der EU gegen die erste schwarz-blaue Regierung an. Den Massenwiderstand, den die Regierung Schüssel-Haider provozierte und der diese auch hätte stürzen können, erwähnt sie hingegen erst gar nicht.
Stattdessen verallgemeinert sie den Erfolg der rechts-populistischen Parteien folgendermaßen:
„Es ist höchste Zeit, den Hintergrund des Erfolgs rechts-populistischer Parteien zu erkennen. Er beruht auf in sehr problematischer Weise artikulierten, aber dennoch realen, demokratischen Forderungen, die von den traditionellen Parteien nicht berücksichtigt werden.“ (72)
Bemerkenswerterweise wird keine einzige „demokratische Forderung“ dieser Parteien angeführt. Sie wäre auch schwer zu finden. In Wirklichkeit bestehen deren Programme vor allem aus Forderungen nach der Einschränkung demokratischer Rechte, vor allem für MigrantInnen, Geflüchtete, Andersdenkende. Die „problematische Weise“, in der sie „artikuliert“ werden, besteht in erster Linie im Rassismus. Und das ist kein Zufall, sondern notwendig, um von sozialem Abstieg und zunehmender Konkurrenz bedrohte Schichten des KleinbürgerInnentums, der ArbeiterInnenklasse wie auch der herrschenden Klasse, also von Teilen der „Elite“, zu einer Partei oder Bewegung zu formieren und zu mobilisieren.
Mouffe’s Gebrauch des Begriffs der „Forderung“ ist jedoch bewusst diffus gehalten, so dass er mitunter gleichbedeutend mit „Stimmung“, „Affekt“, „Gefühl“ verwendet wird. So erscheint die Angst vor Abstieg, Deklassierung kleinbürgerlicher oder proletarischer Schichten als „Forderung“. Genau betrachtet, stellt aber erst die „problematische Weise“ ihrer Argumentation – in diesem Fall die nach Abschiebung, Schließung der Grenzen usw.– eine Forderung dar. Natürlich müssen auch Linke die Angst von Lohnabhängigen und der unteren Schichten des KleinbürgerInnentums vor Deklassierung, sozialem Abstieg usw. ernst nehmen, weshalb es gerade notwendig ist, dass sie präzise demokratische und soziale Forderungen erheben, die einen gemeinsamen Kampf aller Lohnabhängigen ermöglichen – was den Kampf für offene Grenzen, gleiche StaatsbürgerInnenrechte wie auch den Kampf um das Recht auf Arbeit, menschenwürdigen Wohnraum für alle einschließt.
Die Unschärfe der „Forderungen“ bei Mouffe, deren schwammiger Charakter – einschließlich einer Offenheit zu rechten Positionen – folgt jedoch auch aus ihrer Theorie, genauer der Vorstellung, dass popular-demokratische Forderungen keinen Klassencharakter hätten. Daher kann natürlich die Forderung nach Einreisebeschränkungen sowohl rechts als auch links artikuliert werden, also auch im Rahmen eines linkspopulistischen Programms problemlos als „fortschrittlich“ firmieren.
Das Fehlen einer Klassenanalyse des Rechtspopulismus geht unvermeidlich mit seiner Verharmlosung einher, aber auch mit der Aufforderung, dass die Linke von ihm einiges zu lernen habe. Schließlich hätten Haider und Co. vermocht, das „Volk“ gegen die „Eliten“ zu mobilisieren. Das müsse die Linke auch tun – natürlich auf demokratische und nicht auf „autoritäre“ Weise.
„Der linkspopulistischen Strategie zufolge sollte diese Frontlinie auf eine ‚populistische’ Art und Weise gezogen und ein Gegensatz zwischen dem ‚Volk’ und der ‚Oligarchie’ hergestellt werden – eine Auseinandersetzung, in der das ‚Volk’ durch die Artikulation einer Vielzahl demokratischer Forderungen konstituiert wird. Dieses ‚Volk’ ist nicht als empirischer Referent oder soziologische Kategorie zu verstehen. Vielmehr handelt es sich dabei um eine diskursive Konstruktion, die aus einer ‚Äquivalenzkette’ zwischen heterogenen Forderungen resultiert, deren Einheit durch die Identifikation mit einer radikal demokratischen Vorstellung, was ‚Bürgersein’ heißt, und der gemeinsamen Opposition gegen die ‚Oligarchie’ sichergestellt wird, jenen Kräften, die die Realisierung des demokratischen Projekts strukturell behindern.“ (73)
Die Konstruktion des Volkes
Hatte sich schon das Feld des Diskurses und des Kampfes um die Hegemonie als bürgerliche Demokratie entpuppt, so vermag auch „das Volk“ nicht diskursiv konstruiert zu werden, ohne auf das reale „Volk“ zurückzugreifen.
Schon in „Politik und Ideologie des Marxismus“ vertritt Laclau die These, dass „popular-demokratische Ideologien keine Klassenideologien“ seien, dass es daher möglich und nötig sei, diese mit dem Diskurs der ArbeiterInnenklasse zu verbinden. Daraus folgt seine positive Bewertung von Radeks Schlageter-Rede 1923, des KPD-Programms für nationale und soziale Befreiung, der Wendung zur Volksfrontpolitik und der Rede Dimitrows auf dem 7. Weltkongress der Komintern. In Wirklichkeit gehen diese opportunistischen Fehler immer mit einer Anpassung an den bürgerlichen Nationalismus einher und mit einer ideologischen Rechtfertigung dafür, an ein reaktionäres nationales Erbe des „Volkes“ anzukünpfen.
Dies erweist sich auch als unumgänglich bei der aktuellen linkspopulistischen Konstruktion des „Volkes“. Die Liberalen, die SozialdemokratInnen, aber auch die radikale Linke, hätte schon viel zu lange die „affektive Dimension für den Prozess der Identifikation“ (74) unterschätzt:
„Eine große Rolle spielt die affektive Dimension im Falle nationaler Formen der Identifikation, und deshalb kann man diese nicht einfach abtun. Sie stellen eine äußerst wichtige Form der kollektiven Identifikation dar, und die historische Erfahrung lehrt, dass sie ein wichtiges Terrain für die Unterscheidung zwischen ‚uns’ und ‚den Anderen’ sind.“ (75)
Die Ängste vor einer Zerstörung der eigenen Nation müssten daher von einem Linkspopulismus positiv aufgegriffen werden. Dazu Mouffe: „Deshalb ist es notwendig, behaupte ich, alle Versuche einzustellen, ein homogenes, postnationales ‚Wir’ zu konstruieren, das die Vielfalt des nationalen ‚Wir’ überwinden soll. Eben diese Negation des nationalen ‚Wir’, beziehungsweise die Angst, dass es dazu kommen könnte, ist die Wurzel vieler Widerstände gegen die europäische Integration und bedingt die Entstehung vielgestaltiger Antagonismen zwischen den einzelnen Nationen.“ (76)
Die realen Verhältnisse werden hier auf den Kopf gestellt. In Wirklichkeit verhindern die gegensätzlichen Interessen der führenden imperialistischen Mächte Europas die Überwindung nationaler Gegensätze und eine gleichberechtigte Vereinigung des Kontinents. Daher sind die herrschenden Klassen auch unfähig zur Überwindung der nationalen Unterschiede und zu einer Einigung Europas, die nicht auf Dominanz und Unterwerfung beruht.
MarxistInnen erkennen zwar das Recht auf Selbstbestimmung der Nationen (einschließlich des Rechts auf Lostrennung und einen eigenen Staat) an, aber sie sind zugleich keine VerteidigerInnen einer „nationalen Identität“. Im Gegenteil, jeder Nationalismus ist eine bürgerliche Ideologie, wie wir schon oben gezeigt haben. Wo aber die bürgerliche Gesellschaft diese selbst unterhöhlt, den Austausch zwischen den Menschen ausdehnt, Elemente einer globalen Kultur schafft, stellen sich MarxistInnen nicht dagegen, d.h. nicht auf den Boden der „nationalen“ Identität. Wir stellen uns nur der zwanghaften Zerstörung, der Zwangsassimilation entgegen – doch das trifft in Wirklichkeit nicht die Angehörigen der herrschenden Nationen, sondern vielmehr die Flüchtlinge und MigrantInnen, die einem realen Anpassungsdruck ausgesetzt sind, während die Sorge um „deutsche“ oder „österreichische“ Identität einen durchweg reaktionären Charakter hat (und ihre Bedrohung wahrlich rein imaginär ist).
Mouffe übernimmt die ganze reaktionäre Verklärung der „kulturellen Identität“ vollkommen unkritisch und verklärt die Enge ebendieses nationalen „Wir“, den Mief des Spießers, zu einer „Vielfalt“, während ein „postnationales Wir“ ganz homogen sein soll. In Wirklichkeit ist das nationale „Wir“ eine Waffe, eine Ideologie in den Händen der Reaktion, das eine imaginäre Einheit zwischen allen Angehörigen der Nation, oben und unten, „Volk“ und „Elite“ herstellen soll unter Ausschluss der „volksfremden“ Elemente. Das ist die unvermeidliche Logik dieses Nationalismus, und Mouffe passt sich dieser reaktionären Tendenz unserer Zeit an.
Wie für die Rechte kann auch für Mouffe die EU nur als ein Projekt überleben, das die Nationen und nationalen Identitäten nicht antastet, und auf dieser Basis ist auch Mouffe „pro-europäisch“.
Zugleich solle dieses Modell mit einer Rückkehr zu nationalstaatlicher Wirtschaftspolitik und mit Protektionismus, der ökologisch verbrämt wird, verbunden werden. Auch wenn sich Mouffe um die Frage der Migration in ihren Büchern herumdrückt, so zielt ihre Politik logisch auf eine Begrenzung von Einwanderung – schließlich würden offene Grenzen, das Niederreißen der Festung Europa usw. unweigerlich auch jedes nationale „Wir“ untergraben.
Wiederholt wendet sie sich außerdem dagegen, die WählerInnen und UnterstützerInnen dieser Migrationsbegrenzung als RassistInnen oder xenophob „abzustempeln“ oder zu diffamieren. Im Gegenteil, die Linke müsse einem „ausgrenzenden Nationalismus“ einen positiven entgegensetzen – den Patriotismus:
„Das ist ein kompliziertes Problem, das nur im nationalen Rahmen gestellt werden kann. Ich glaube zuversichtlich an einen linken Patriotismus. Im Gegensatz zu vielen Linken glaube ich, dass der Patriotismus eine wichtiger Wert ist, denn er mobilisiert die Affekte. Für die Menschen ist die nationale Identität etwas Wichtiges. (…) In Frankreich gibt es die glückliche Lage, dass die Republik wegen der Französischen Revolution etwas ist, das sich von der Linken leicht mobilisieren lässt. In Deutschland und Österreich ist das viel komplizierter. Trotzdem gibt es in der österreichischen wie in der deutschen Geschichte eine ganze Tradition der Linken, an die sie sich anschließen können. Wenn man die Affekte mobilisieren will, ist die Frage des Patriotismus ausschlaggebend“ (77).
Also kein Volk ohne Patriotismus – und damit greift Chantal Mouffe unwillkürlich auf die jeweiligen nationalen Traditionen, ja auf den Nationalismus zurück. Der „Republikanismus“, auf den die französische Linke so leicht zurückgreifen könne, entpuppt sich regelmäßig als eine Ideologie des französischen Imperialismus, mit dem die ArbeiterInnenklasse an die herrschende Klasse gebunden wird. Dass die französische Linke meint, sich dieser Ideologie für ihre Zwecke bedienen zu können, verdeutlicht nur, wie sehr der reaktionäre Nationalismus die reformistische ArbeiterInnenbewegung (Sozialdemokratie und KP) und den Linkspopulismus Mélenchons durchdringt.
Auch die deutsche und österreichische Sozialdemokratie und der Stalinismus haben es in den letzten Jahrzehnten leider nicht an Nationalismus und Patriotismus mangeln lassen. SPD und SPÖ haben sich bis zur Selbstaufgabe in den Dienst der „Nation“, also ihrer herrschenden Klasse gestellt. Die Scheidung zwischen „gutem“ Patriotismus und „ausschließenden“ Formen des Nationalismus kann – gerade in einem imperialistischen Land – nur zur altbekannten Unterordnung der Interessen der ArbeiterInnenklasse und der Unterdrückten unter jene eines „besseren“, sozialeren, für eine hegemoniale Volkskonstruktion empfänglicheren Teils der Bourgeoisie führen.
Wir sehen also, dass bei der „Anrufung des Volkes“, bei dessen Konstruktion auf die Standardideologien der herrschenden Klasse, auf Nationalismus und Patriotismus, nicht nur nicht verzichtet werden kann, sondern sie werden ausdrücklich auch zu „Essentials“ linker Politik umgedichtet.
Mit dem Volk verschwindet dabei nicht nur die ArbeiterInnenklasse im „Volksganzen“. Auch die herrschende Klasse bleibt in der populistischen Ideologie notwendigerweise gänzlich unbestimmt. Nicht nur das Volk, auch „Elite“ oder „Kaste“ sind eine recht willkürliche Konstruktion. Die Unbestimmtheit, das Vage, das jedem Populismus innewohnt, erklären nicht nur Mouffe und Laclau, sondern auch die Führer von Podemos für eine Stärke des Linkspopulismus, die sie durchaus bewusst einsetzen.
„Mouffes spanischer Gesprächspartner Inigo Errejón verweist lobend auf den Kampfruf der Occupy-Bewegung von 1999 (‚Wir sind die 99 Prozent’) und erklärt, daß ein hegemonialer Diskurs ,nicht auf Statistiken beruht, sondern performativ’ sei. (…)
Am vagesten ist die Abgrenzung – unvermeidlich aus populistischer Sicht – gegenüber dem politischen Gegner. Benennt man ihn zu genau oder zu realitätsnah, läuft man Gefahr, mögliche Zielgruppen seiner hegemonialen Appelle zu verschrecken und deren rein rhetorische Anteile als die Fiktionen zu entlarven, die sie sind. Errejón hütet sich bewußt vor einer Definition der casta, gegen die Podemos la gente zum Aufstand rufen.“ (78)
Dieselbe Unbestimmtheit der Elite findet sich auch bei Laclau und Mouffe, wenn es um den Gegner geht, gegen den das Volk konstituiert werden soll. Die Führer von Podeomos, die sich offen dazu bekennen, von den Theorien der beiden TheoretikerInnen des Linkspopulismus inspiriert zu sein, erweisen sich als gelehrige Schüler. Es ist keinesfalls ein Zufall und auch nicht nur politischer Zweckmäßigkeiten geschuldet, dass die „Elite“ im Linkspopulismus eine schwer greifbare Gruppierung darstellt. Es kann sich um Institutionen, Vorstellungen, IdeologInnen (vorzugsweise des Liberalismus und Kosmopolitismus), Strukturen, gelegentlich auch um soziale Gruppen handeln. Aber noch viel weniger, als die Lohnabhängigen ein „privilegiertes Subjekt“, eine ausgebeutete oder unterdrückte Klasse darstellen, erscheint die Bourgeoisie als Klasse. Allenfalls gibt es eine neoliberale Politik, eine immer umfassendere Öffnung der Märkte, eine zügellose Globalisierung. Doch hinter ihnen stehen als treibende Momente keine Klasseninteressen, sondern eine bestimmte „hegemoniale Konstellation“, die ebenso durch eine andere ersetzt werden könnte.
Das Programm des Linkspopulismus zeichnet sich daher auch durch Vagheit und Gemeinplätze, eine Mischung aus Reformvorschlägen „der Demokratie“, Mittelstandsförderung, kleinbürgerlichem Ökologismus, sozialstaatlichen Reformen, also eine Rückkehr zur Politik der 60er und 70er Jahre aus.
Als Instrument des Linkspopulismus bleibt – wie schon in der sozialdemokratischen oder bürgerlichen Reformpolitik – der Staat.
„Während der traditionelle Marxismus behauptete, dass der Kommunismus und das Austrocknen des Staates sich gegenseitig logisch bedingen, sagen Laclau und ich, dass man sich das emanzipatorische Projekt heute nicht mehr als die Beseitigung von Herrschaftsstrukturen durch gesellschaftliche Akteure vorstellen kann, die mit dem Standpunkt der gesellschaftlichen Totalität gleichgesetzt werden. Antagonismen, Auseinandersetzungen und Uneinigkeit wird es in der Gesellschaft immer geben, und die Notwendigkeit von Institutionen, die sich mit ihnen befassen, wird niemals verschwinden.“ (79)
Der Staat müsse nicht zerschlagen oder zerbrochen werden – er müsse nur von den Richtigen in Besitz genommen und reformiert werden:
„Die Erfahrungen progressiver Regierungen in Südamerika in den letzten zehn Jahren belegen, dass es möglich ist, den Neoliberalismus infrage zu stellen und demokratischen Werten wieder Priorität einzuräumen, ohne auf liberale repräsentative Institutionen zu verzichten. Und sie zeigen außerdem, dass der Staat keineswegs demokratischen Fortschritten im Weg stehen muss, sondern vielmehr ein wichtiges Vehikel für die Durchsetzung der Forderungen des Volkes sein kann.“ (80)
Dummerweise entpuppte sich in den letzten Jahren auch der „Volksstaat“ in Südamerika als kapitalistischer Staat. In Venezuela, Bolivien, Brasilien sind die „Volksregierungen“ in der Krise, teilweise aufgrund der eigenen inneren Widersprüche populistischer Regime oder aufgrund des Sturzes der PT-Präsidentschaft durch einen Putsch der „Elite“. Die Mobilisierung der protofaschistischen Bewegung von Bolsanaro und sein Sieg bei den Präsidentschaftswahlen verdeutlichen, dass schon heute wichtige Teile der herrschenden Klasse nicht einmal mehr bereit sind, eine von ReformstInnen geführte Regierung zu akzeptieren, selbst wenn sie sich bemüht, die Gesamtinteressen der Kapitals durchzusetzen.
Der „populistische Moment“, den die Krise lt. Mouffe schafft, erlaubt eben in Wirklichkeit keine dauerhafte „Reformpolitik“, keine Verwendung der bürgerlichen Institutionen im Interesse des „Volkes“, sondern stößt selbst bei reformistischer oder linkspopulistischer Politik auf den Widerstand der herrschenden Klasse und des Imperialismus. Davon kann auch die von Mouffe immer wieder als Vorbild für eine „populistische“ Politik ins Feld geführte Syriza-Regierung ein Lied singen.
Kosmopolitismus und Universalismus als Feindbilder
Genau diesen Zusammenhang zwischen Staat, Demokratie und Kapitalismus muss der Linkspopulismus jedoch vehement bestreiten:
„Auch wenn viele liberale Theoretiker nicht müde werden zu beteuern, politischer Liberalismus mache notwendigerweise wirtschaftlichen Liberalismus erforderlich und eine demokratische Gesellschaft setzte eine kapitalistische Wirtschaft voraus, ist evident, dass zwischen Kapitalismus und liberaler Demokratie kein zwangsläufiger Zusammenhang besteht. Unglücklicherweise hat der Marxismus zu dieser Verwirrung beigetragen, indem er die liberale Demokratie als den Überbau des Kapitalismus dargestellt hat. Es ist wirklich bedauerlich, dass dieser ökonomistische Ansatz in verschiedenen Sektoren der Linken, die nach der Zerstörung des liberalen Staates rufen, noch immer akzeptiert wird. Im Rahmen der konstitutiven Prinzipien des liberalen Staates – Gewaltenteilung, allgemeines Wahlrecht, Mehrparteiensystem und Bürgerrechte – kann man die gesamte Bandbreite der heutigen demokratischen Forderungen vorbringen.“ (81)
Bei aller Kritik an der „alten“ Sozialdemokratie oder am Labourismus endet der Linkspopulismus darin, deren illusorische Vorstellungen des bürgerlichen Staates und der liberalen Demokratie zu übernehmen. Das Programm des Linkspopulismus ist daher eine Mischung aus BürgerInnenbewegung und staatlichen Reformprogrammen. Es ist dem Reformismus durchaus ähnlich, doch als Träger der politischen Veränderung erscheint nicht mehr die ArbeiterInnenbewegung, sondern „das Volk“.
Damit ein Volk jedoch überhaupt konstituiert werden kann, braucht es ein nationalstaatliches Terrain des Politischen. Ein „globales“ Volk, eine internationale Nation, lässt sich schlecht konstituieren. Daher ist Politik auch zuerst nationale Politik:
„Was ich unterstreichen will ist, dass der hegemoniale Kampf um die Wiederherstellung der Demokratie zuerst auf der Ebene des Nationalstaates stattfinden muss, der, obgleich er viele seiner Vorrechte eingebüßt hat, nach wie vor einen der entscheidenden Räume für das Ausüben der Demokratie und Volkssouveränität darstellt. Es ist die nationale Ebene, auf der die Frage der Radikalisierung der Demokratie als Erstes gestellt werden muss. Hier sollte ein kollektiver Wille, der Widerstand gegen die postdemokratischen Auswirkungen der neoliberalen Globalisierung leistet, konstituiert werden. Erst wenn dieser kollektive Wille konsolidiert ist, kann eine produktive Zusammenarbeit mit ähnlichen Bewegungen in anderen Ländern stattfinden. (…) eine linkspopulistische Strategie kann die starke libidinöse Involvierung, die bei nationalen – und regionalen – Identifikationsformen am Werk ist, nicht ausblenden, und es wäre hochriskant, dieses Terrain dem Rechtspopulismus zu überlassen.“ (82)
Volk, Nation und Staat bilden das politische Lebenselixier der populistischen Konzeption. Der Kampf ist nicht nur zuerst ein nationaler. Die internationale ArbeiterInnenklasse hat sich zuerst im „nationalen Volkskörper“, natürlich unter besonderer Vorliebe für die „egalitären Aspekte der nationalen Tradition“, einzufinden.
Um ihr nationales Credo besonders zu untermauern, haben Laclau, Mouffe und ihre ParteigängerInnen auch gemeinsame Feinde ausgemacht, gewissermaßen Gipfelpunkte des Irrweges: den Kosmopolitismus und den Universalismus.
Der Kosmopolitismus wird von Mouffe im Wesentlichen als eine politische Strömung liberaler Eliten, von VerfechterInnen des internationalen Großkapitals, von urbanen Milieus, denen die nationalen Wurzeln der Mehrheit der Bevölkerung wenig bedeuten, von einer heterogenen Schicht von „Globalisierungsgewinnern“ betrachtet, die mit Abscheu auf die nationalen Traditionen schauen. Besonders drastisch bringt das Sahra Wagenknecht auf den Punkt:
„Der Kosmopolitismus ist die Ideologie der Gewinner des globalen Konzernkapitalismus. Diese Ideologie, die viele irrtümlich für links halten, verachtet die nationalstaatlichen Regelungen und Institutionen ebenso wie nationale Kulturen und Traditionen. Für sie gibt es keine Staatsbürger mehr, sondern nur noch Weltbürger. Nationale Identitäten sind in ihren Augen ein muffiges Relikt früherer Jahrhunderte, dem allenfalls die ungebildete Unterschicht und rechte Reaktionäre noch etwas abgewinnen können.“ (83)
Diese Passage ist typisch für linkspopulistische Konstruktionen. Der „Kosmopolitismus“ erscheint als das eigentliche Übel unserer Zeit, während der Nationalstaat als Ort zur Verteidigung der Armen und Benachteiligten zurückgewonnen werden müsse. Dort könnte nämlich noch etwas getan, die Globalisierung reguliert und staatlich eingegriffen werden.
Hier wird die reale Entwicklung des Kapitalismus selbst verkannt. Der zunehmend internationale Charakter der Produktion und des Verkehrs ist nämlich eine progressive Begleiterscheinung der kapitalistischen Produktionsweise, die natürlich v.a. für bornierte Zwecke der Einzelkapitalien, der großen Konzerne genutzt wird. Der Weltmarkt wirft in seiner Entwicklung selbst die Frage der Überwindung der nationalen Schranken auf, stößt aber zugleich darauf, dass die nationalstaatliche Verfasstheit des Kapitalismus selbst eine Hemmnis für die weitere Entwicklung darstellt. Hinzu kommt, dass der Weltmarkt wie auch die gesamte politisch-ökonomische Weltordnung immer eine ist, in der die mächtigen, imperialistischen Ländern und die in ihnen verwurzelten Kapitale die Welt beherrschen. In einer Krisenperiode, wie wir sie aktuell durchmachen, ist die Ordnung selbst erschüttert, weil neue Konkurrenten nach vorne drängen, weil z.B. China und die EU, die jahrzehntelange hegemoniale Stellung der USA herausfordern.
Hinter dieser Krise und dem Kampf um eine Neuaufteilung der Welt stehen letztlich der Fall der Profitrate in den großen Nationalökonomien und die Überakkumulation des Kapitals. Diese strukturellen Krisen können selbstredend nicht nationalstaatlich gelöst werden. Der Nationalstaat kann allenfalls zu mehr Abschottung greifen, um das nationale Kapital durch Protektionismus zu schützen, was früher oder später natürlich ähnliche Antworten der Konkurrenz hervorruft.
In jedem Fall, und das ist für den Linkspopulismus kennzeichnend, unterstellen Mouffe, Wagenknecht und Co., dass die aktuelle ökonomische Krisenhaftigkeit, die zunehmende Konkurrenz der Kapitale durch nationalstaatliche Maßnahmen eines linkspopulistischen Blocks gelöst werden könnten.
Daher stellt der Appell an Nationalismus, an Heimat, an die nationale Tradition für sie überhaupt kein Problem dar. Die „Nation“ ist für sie keine imaginäre Einheit gegensätzlicher Klassen, sondern der „natürliche“ Ort des Volkes. Die Wichtigkeit des bürgerlichen Staats und der Nation wird im Populismus geradezu zum vordringlichen Anliegen der Armen, der Unterschichten, aller, die nicht ins Ausland gehen und die nicht von der Globalisierung profitieren können, stilisiert.
In all dem erscheinen die ArbeiterInnen, die Lohnabhängigen längst nicht mehr als internationale Klasse, sondern nur als ein besonders benachteiligtes Segment von StaatsbürgerInnen, das aufgrund seiner untergeordneten Stellung besonders auf „nationale Identität“ setze. Die Lohnabhängigen erscheinen geradezu als TrägerInnen des Nationalismus, dem das „kosmopolitische“ BürgerInnentum, die Reichen und Mittelschichten (arroganterweise) entsagt hätten.
Eine solche Verkehrung liefert die Grundlage für eine rein national ausgerichtete, rückwärtsgewandte Strategie.
Mit der Identifizierung des Kosmopolitismus als Ideologie der Globalisierungsgewinner werden praktischerweise zugleich auch internationalistische Strömungen der Linken diffamiert. So werden Hardt/Negri und ihre post-autonomen AnhängerInnen wegen ihrer internationalistischen Ausrichtung, wegen des von ihnen postulierten grenzüberschreitenden Charakters der „Multitude“ als „ultralinke Version der kosmopolitischen Perspektive“ (84) denunziert. Die fortschrittlichen Momente von Hardt/Negri werden angriffen, weil der Linkspopulismus jede Schwerpunktsetzung auf die internationale Ausrichtung eines emanzipatorischen Kampf als Ablenkung vom eigentlich nationalen Feld der Auseinandersetzung versteht.
Eine weitere reaktionäre Implikation besteht in der Ablehnung des „Universalismus“. Auch hier geht der Linkspopulismus – wie schon bei der Kritik des Kosmospolitismus – den Weg, den „Universalismus“ z.B. der Menschenrechte als ein Mittel „westlicher Vormachtgelüste“ zu betrachten. Mouffe folgert daraus jedoch nicht nur, dass man z.B. humanitäre Begründungen für imperialistische Interventionen ablehnen müsste, wie z.B. der Vorwand, Frauenrechte beim Angriff auf Afghanistan zu verteidigen. Sie schließt daraus vielmehr auch, dass die Vorstellung universeller Rechte (z.B. der Frauen) als allgemeine und gleiche Menschenrechte zugunsten einer „Neudefinition“ der Menschenrechte gemäß den jeweiligen nationalen Kulturen zurückgestellt werden müssten. Hier schlägt die berechtigte Ablehnung imperialistischer Interventionen in eine reaktionäre Ablehnung der demokratischen Forderungen der Unterdrückten um.
Zweifellos beinhalten der bürgerliche Universalismus und Kosmopolitismus immer auch ein klassenspezifisches Moment – so wie jedes bürgerliche Emanzipationsversprechen einen ideologischen Charakter trägt, bei dem sich hinter dem Freiheitsversprechen das bornierte Interesse der herrschenden Klasse verbirgt. Die Kritik von Mouffe und Wagenknecht trägt jedoch durchweg reaktionäre Züge. Dem bürgerlichen Kosmopolitismus und Universalismus stellen sie die nationale Engstirnigkeit entgegen. Vor allem aber richtet sich die Kritik, wie eigentlich immer, gegen die radikalste Form des Universalismus und „Kosmopolitismus“ – den proletarischen Internationalismus und klassischen Sozialismus, die ihrerseits selbst „universalistischer Diskurs“ waren.
Programm und Beliebigkeit
Ein notwendiges Moment des Linkspopulismus besteht in dessen programmatischer und politischer Schwammigkeit. Daher reklamiert Mouffe praktisch alle Erfolge linker Parteien und Bewegungen – ob der Indignados, von Blockupy, Sanders oder Corbyn, ob von Syriza, Podemos, „France insoumise“ oder der deutschen Linkspartei – als Teil der Erfolgsgeschichte des Linkspopulismus. Der Unterschied zwischen reformistischen Parteien wie der Labour Party unter Corbyn, der Linkspartei in Deutschland oder Syriza in Griechenland zu linkspopulistischen Projekten wie Podemos, „France insoumise“ oder „Aufstehen“ wird nicht weiter betrachtet.
Zweifellos liegt das auch daran, dass es Übergangsstufen und Schraffierungen in diesem Spektrum gibt, die eine präzise Zuordnung erschweren. Linkspopulistische Projekte beinhalten oft auch Elemente reformistischer Politik oder sind aus Strömungen der ArbeiterInnenbewegung hervorgegangen. So schwankte Podemos mehrmals in seiner Geschichte zwischen der Ausrichtung auf eine „reine“ Volkspartei und einer stärkeren Hinwendung zu Organisationen, die in der ArbeiterInnenklasse verankert sind, vor allem zu Izquierda Unida (IU) und dem Gewerkschaftsverband CC.OO.
Sowohl Mélenchons „France insoumise“ als auch die „Aufstehen“-Bewegung Sahra Wagenknechts sind aus reformistischen Parteien hervorgegangen und haben natürlich auch politische Forderungen dieser Formationen übernommen.
Auch Syriza beinhaltete populistische Traditionen, wie z.B. die Abspaltung der „Volkseinheit“ nach der Kapitulation der Syriza-Anel-Regierung gegenüber der EU verdeutlichte. Hinzu kommt, dass diese reformistische Partei selbst eine „Volks“-Regierung unter Einschluss einer erzreaktionären bürgerlichen Partei (Anel) bildete und ihre Politik in der Regierung nach außen „populistisch“,als Politik im Interesse aller Klassen, verkaufte.
Während MarxistInnen die Anleihen, die reformistische Parteien bei populistischen Konzepten machen, als Schritt nach rechts betrachten, werden sie bei Laclau und Mouffe zu einer politischen Tugend. Die programmatischen Schwächen und auch die politische Bilanz dieser Parteien interessieren dabei nur am Rande. Die Formlosigkeit des Programms des Populismus erscheint ihnen geradezu als Vorzug.
„Ich habe betont, dass das Ziel einer linkspopulistischen Strategie nicht die Errichtung eines ‚populistischen Regimes’ ist, sondern die Konstruktion eines kollektiven Subjekts, das geeignet ist, eine politische Offensive zu starten, um innerhalb des liberal-demokratischen Rahmens eine hegemoniale Formation aufzubauen.“ (85)
Dieses Subjekt ist das „Volk“. Da dieses immer auf einen bestimmten Staat, eine bestimmte Nation bezogen sein muss, könne es auch politisch-programmatisch ebenso viele Wege zum Erfolg geben wie Länder auf der Erde.
„Was ich vorschlage ist kein vollständig ausgearbeitetes politisches Programm, sondern eine ganz konkrete Strategie für die Errichtung einer politischen Frontlinie. Parteien und Bewegungen, die eine links-populistische Strategie wählen, können dabei ganz unterschiedliche Wege gehen.“ (86)
Rückschläge wie Nicht-Verwirklichung der Anti-Austeritätspolitik Syrizas aufgrund des Zwangs der Europäischen Union wären dabei unvermeidlich. Die Kapitulation der Syriza-Regierung dürfe jedoch nicht bedeuten, dass „der Erfolg der populistischen Strategie, dank derer sie die Macht eroberte“ (87) geschmälert würde. Hier wird der Wahlerfolg zum Selbstzweck. Dass die Partei an der Regierung alle ihre Versprechen verriet, selbst das „Volk“, also die ArbeiterInnen und Bauern, einem Austeritätsprogramm unterzog, will sie dem „Populismus“ nicht angelastet wissen.
Die politische Kapitulation oder Anpassung an bürgerliche Kräfte, an Nationalismus, Chauvinismus oder, im Fall von Syria, auch an die EU erscheinen allenfalls als zeitweilige Rückschläge. Eine kritische Auseinandersetzung mit deren mögliche Ursachen findet erst gar nicht statt. Die reale Politik dieser linken Parteien soll schließlich der Erfolgsgeschichte des „Populismus“ keinen Abbruch tun. Schließlich geht es Mouffe und dem Linkspopulismus um kein konkretes politisches, wirtschaftliches und soziales Programm, sondern um die „Konstruktion“ eines Subjekts, eines Volkes, einer Frontlinie. Und hier werden die „unterschiedlichen Wege“, also die Anpassung an das jeweilige nationale Terrain, prinzipienlose Zugeständnisse an die KapitalistInnenklasse, überraschende Allianzen mit offen bürgerlichen oder gar reaktionären Parteien, zu raffinierten Schritten erklärt, um ein vorgeblich „linkes Volk“ zu konstruieren. Oder in ihren Worten:
„Das Ziel einer linkspopulistischen Strategie ist es, eine Mehrheit des Volkes hinter sich zu scharren, um an die Macht zu kommen und eine progressive Hegemonie aufzubauen. Für ihre konkrete Umsetzung gibt es ebenso wenig ein Patentrezept wie für das Endziel. Die Äquivalenzkette, durch die das ‚Volk’ konstituiert wird, wird von den spezifischen historischen Umständen abhängen.“ (88)
Damit erübrigt sich für den Linkspopulismus letztlich die Frage nach einer inhaltlichen Bestimmung des Programms. Es muss nur als „Volkskonstruktion“ tauglich sein. Der Ruf nach einer in sich stimmigen Politik erscheint als altbackener, „essentialistischer“ Einwand. Da das Volk nur eine politische Konstruktion sei, die diskursiv konstituiert werde, könne es natürlich auch kein bestimmtes Programm haben, sondern müsse sich dieses aus den Beständen existierender Ideologien zusammenschustern.
Das „Volk“ kennt jedoch eine kleinste Einheit, den/die BürgerIn.
„Es ist als Bürger, dass ein gesellschaftlicher Akteur auf der Ebene der politischen Gemeinschaft interveniert. Doch so zentral das ‚Staatsbürgersein’ als Kategorie in einer liberalen, pluralistischen Gesellschaft ist, so unterschiedlich sind die Auffassungen davon, und diese bedingen ganz unterschiedliche politische Konzeptionen. Der Liberalismus betrachtet Staatsbürgerschaft lediglich als Rechtsstatus und sieht den Bürger als individuellen Inhaber von Rechten, unabhängig von irgendeiner Identifikation mit einem ‚Wir’. In der demokratischen Tradition dagegen wird das ‚Staatsbürgersein’ als aktives Engagement in der politischen Gemeinschaft verstanden, als Handeln als Teil eines ‚Wir’, im Einklang mit einer bestimmten Vorstellung von Gemeinwohl. Daher kommt der Entwicklung einer radikal-demokratischen Vorstellung davon, was es heißt, ein Bürger zu sein, im Kampf gegen Postdemokratie, eine Schlüsselfunktion zu.“ (89)
Der/die StaatsbürgerIn wird zum eigentlichen Subjekt der Geschichte erhoben, gewissermaßen zur Keimzelle des „Volkes“. Das Betätigungsfeld kann freilich auch nur der Staat und reformorientierte Politik sein:
„Die radikaldemokratische Auffassung des Bürgerseins, das ich hier verfechte, steht in engem Zusammenhang mit der radikalen, reformorientierten Politik der Auseinandersetzung mit den Institutionen, die ich oben befürwortet habe. Sie betrachtet den Staat als einen wichtigen Schauplatz demokratischer Politik, weil er den Raum konstituiert, in dem Bürger Entscheidungen über die Organisation der politischen Gemeinschaft treffen können; je es ist der Ort, wo Volkssouveränität ausgeübt werden kann.“ (90)
Wieder einmal wird eine Charaktermaske der bürgerlichen Gesellschaft, der/die StaatsbürgerIn, als überideologische Figur aus der Mottenkiste geholt und als scheinbar klassenneutrales, „linkes“ Subjekt behauptet. Dem „beschränkten“, egoistischen neoliberalen Bürger wird der sorgende Bürger entgegengestellt, der endlich den Staat, der ihm ohnedies nie gehörte, nun in Besitz nehmen möchte – ganz so, als ob der bürgerliche Staat nie Klassenstaat des Kapitals gewesen sei.. Dass er Organ der „Volkssouveränität“ sei, behaupten selbst bürgerliche TheoretikerInnen heute kaum noch ernsthaft. Anders der Linkspopulismus. Hier werden ungeniert längst brüchig gewordene Rechtfertigungsideologien mit verblüffender Selbstverständlichkeit aus dem Hut gezaubert. Sobald das Politische nur noch als diskursive Konstruktion existiert, ist offenbar alles möglich.
Für die Linke haben diese naiven Theorien jedoch handgreifliche reaktionäre Konsequenzen. Das „Kollektivsubjekt“ des Linkspopulismus entpuppt sich als Dekonstruktion jedes realen kollektiven Subjekts – sei es der ArbeiterInnenklasse oder anderer gesellschaftlich Unterdrückter. Zu Ende gedacht, soll jede proletarische Bewegung, jede Jugendbewegung, jede Frauenbewegung, jede anti-rassistische Bewegung, jede anti-imperialistische und internationalistische Bewegung in einer „BürgerInnenbewegung“, genau genommen in einer „StaatsbürgerInnenbewegung“, aufgehen.
Hier wird auch offenbar, dass der Linkspopulismus gegenüber dem Reformismus einen Schritt zurück darstellt. Im Reformismus bilden dieLohnabhängigen die soziale Basis seiner Reformpolitik. Auch wenn Reformismus und Revisionismus diese Bindung immer wieder ideologisch und realpolitisch abstreifen wollten (bzw. die inneren Widersprüche dieser Politik dazu trieben und treiben), musste sich die reformistische ArbeiterInnenbewegung auch auf eine Klasse und damit auf gemeinsame, ökonomisch bestimmte Interessen beziehen. Der Linkspopulismus dagegen will diese Beziehung, die von den reformistischen Parteien strapaziert, überdehnt oder gar gekappt wurde, bewusst zerbrechen und die Linke als BürgerInnenverein neu konstituieren.
Während Mouffe und Laclau den Modellcharakter von linkspopulistischen Organisationen wie Podemos und „France insoumie“ betonen, so hat diese Ideologie auch auf bestehende reformistische Parteien einen zersetzenden, reaktionären Einfluss. In Britannien drückt das Wachstum der Labour Party unter der linksreformistischen Corbyn-Führung eine Klassenpolarisierung der Gesellschaft aus. Die Aufgabe von revolutionären Linken besteht darin, diese Entwicklung bewusst zu machen und voranzutreiben, indem sie für ein konsequentes, klassenkämpferisches und revolutionäres Programm in der Labour Party kämpfen. Mouffes Intervention zielt auf das Gegenteil, doch eine linkspopulistische Ausrichtung von Labour kann nur zur Zerstörung des politischen Potentials führen, das in den letzten Jahren sichtbar wurde.
Ein anderes Beispiel für den reaktionären Charakter der Linkspopulismus stellt die Entstehung von „Aufstehen“ unter Führung von Sahra Wagenknecht und eines Flügels der Linkspartei dar.
Die Linkspartei stagniert seit Jahren mehr oder minder. Die Verluste in den Hochburgen im Osten werden durch Zugewinne im Westen bloß ausgeglichen. Sie vermag es nicht, von der Krise der SPD und der Großen Koalition zu profitieren, weil sie selbst keine konsequente Oppositionspolitik betreibt. In Berlin, Brandenburg und Thüringen regiert sie mit, und in diesen Koalitionen ist sie praktisch kaum unterscheidbar von der SPD oder den Grünen. Bemerkenswerterweise bilden aber die bürgerliche Politik in diesen Bundesländern und die fehlende Mobilisierungsfähigkeit der Linkspartei nicht den Fokus von Wagenknechts Kritik, sondern das Gezeter über die „Politik der offenen Grenzen“, der sich die Regierung Merkel, die EU und der Kosmopolitismus angeblich verschrieben hätten. Diese Zuspitzung von Wagenknecht und Lafontaine mag nicht ganz im Sinne von Mouffe sein, die gleichzeitig Beziehungen zu Kipping wie zu Wagenknecht unterhält. Andererseits unterscheidet sich der Sozialchauvinismus von „Aufstehen“ und Wagenknecht nicht grundlegend vom „linken Republikanismus“ Mélenchons, den der Linkspopulismus als Musterbeispiel für einen positiven Bezug zum „Volk“ preist.
Aufstehen?
Wir wollen an dieser Stelle in die Niederungen populistischer Realpolitik hinabsteigen, wie sie heute in Sahra Wagenkenchts Projekt „Aufstehen“ verkörpert wird. Sie selbst hat in den letzten Jahrzehnten selbst eine politische Rechtsentwicklung durchlaufen, die es ihr überhaupt erst ermöglichte, an die Fraktionsspitze der Linkspartei zu gelangen. Sie steht wie keine andere für Linkspopulismus und ein „linkspopuläres“ Projekt in der Bundesrepublik Deutschland.
Im Gründungsaufruf von „Aufstehen“ wird ein düsteres Bild der heutigen neoliberalen Gesellschaft gezeichnet: „Profit triumphiert über Gemeinwohl. Gewalt über Völkerrecht. Geld über Demokratie. Verschleiß über umweltbewusstes Wirtschaften.“ (91) Doch eine bessere Welt könne wiederhergestellt werden, erfahren wir aus dem Aufruf, wenn wir uns nur auf Vergangenes zurückbesinnen würden:
„Wir wollen nicht in einer Gesellschaft leben, die sozial immer tiefer gespalten ist. Wir halten es für falsch, dass die deutsche Regierung sich einer unberechenbaren, zunehmend auf Konflikt orientierten US-Politik unterordnet, statt sich auf das gute Erbe der Friedens- und Entspannungspolitik Willy Brandts, Egon Bahrs und der Friedensbewegung in Ost und West zu besinnen. (…)
Der Mensch ist kein Kostenfaktor. Nicht er ist für die Wirtschaft da, sondern die Wirtschaft für den Menschen. Das deutsche Grundgesetz sagt unmissverständlich: Eigentum verpflichtet, es soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. (…)
Die Spielräume für die Politik in einzelnen Ländern sind auch heute noch weit größer als uns eingeredet wird. Eine vernünftige Politik kann den sozialen Zusammenhalt wiederherstellen und den Sozialstaat erneuern. Sie kann die Bürger vor dem globalen Finanzkapitalismus und einem entfesselten Dumpingwettbewerb schützen. Sie kann und muss in die Zukunft investieren.
Wir wollen keine marktkonforme Demokratie, in der sich die Politik von den Bürgerinnen und Bürgern immer mehr entfremdet. Heute wenden sich viele ab, weil sie sich im Stich gelassen fühlen. Weil sie immer wieder erleben, dass ihre Bedürfnisse weit weniger Einfluss auf politische Entscheidungen haben als die Wünsche zahlungskräftiger Wirtschaftslobbyisten.
Wir wollen die Politik zurück zu den Menschen bringen. Und die Menschen zurück in die Politik. Denn wir sind überzeugt: nur dann hat die Demokratie eine Zukunft.“ (92)
Diese Absätze idealisieren die guten alten Zeiten des Sozialstaats, der „Sozialpartnerschaft“, des „Klassenausgleiches“ und die „Ostpolitik“ eines Willi Brandt, als wäre die Bundesrepublik nicht auch damals von Kapitalinteresse, Profitmacherei und Imperialismus bestimmt gewesen. Die „Ostpolitik“, ein Mittel, die degenerierten, von einer konterrevolutionären Bürokratie politisch beherrschten ArbeiterInnenstaaten wieder für den Weltmarkt zu öffnen und in die Knie zu zwingen, wird zur Friedensmission verklärt. Das „Völkerrecht“ hätte das „Recht des Stärkeren“ beschränkt. Diese und ähnliche bürgerliche Gemeinplätze sollen ausgerechnet den „Neustart“ der Linken bewerkstelligen.
Die verschärfte Konkurrenz, die Krisenhaftigkeit des Kapitalismus, die zunehmenden internationalen Konflikte sollen durch eine „andere“, bessere bürgerliche Politik unter Ausnutzung staatlicher Spielräume, und zwar des bestehenden Staates!, zurückgedrängt werden. Lt. „Aufstehen“ und lt. Sahra Wagenknecht kann der Kapitalismus nämlich politisch gezähmt, gezügelt werden. Diese „Erkenntnis“ tischt sie in ihrem Buch „Reichtum ohne Gier“ auf. Dort wird nicht nur der Keynianismus, sondern auch der Ordoliberalismus der Freiburger Schule als „Zukunftsmodell“ gepriesen:
„Der deutsche Ordoliberalismus wie der Keynesianismus waren sich in dem Punkt einig, dass der Beherrschung von Märkten und Staaten durch große Firmen die Basis entzogen werden müsse, wenn Demokratie und soziale Marktwirtschaft eine Chance erhalten sollen. Deshalb setzen sie sich auch für eine De-Globalisierung der Wirtschaft und vor allem der Finanzmärkte ein, für lokale Wirtschaftskreisläufe, scharfe Kartellgesetze und strikte Regeln zur Bändigung der Renditejagd.“ (93)
So legt sich die Wirtschaftswissenschaftlerin die Realität zurecht. Dieses politische Märchen bildet freilich nur den Auftakt eines ganzen Buches, das unter anderem mit den Kapiteln wie „Warum echte Unternehmer den Kapitalismus nicht brauchen“ und „Marktwirtschaft statt Wirtschaftsfeudalismus“ überrascht.
Der zunehmenden Konzentration und Zentralisation von Kapital, der Tendenz zur Monopolbildung stellt sie die Rückkehr zur „echten Konkurrenz“ entgegen. Der Profit des Kapitals, so erfahren wir, entstünde nämlich nicht aus der Ausbeutung der Arbeitskraft, sondern aus der Monopolstellung, die entweder zeitweilig sein könne (bei Erfindung eines neuen Produktes oder einer neuen Produktionstechnik) oder aufgrund der Beherrschung des Marktes durch eine kleine Gruppe von GroßkapitalistInnen.
Der „echten“ Marktwirtschaft wird der „ungezügelte“ monopolistische Kapitalismus gegenüberstellt. So verstanden entpuppen sich alle „echten“ Unternehmer im Unterschied zu reinen Kapitaleigner als „antikapitalistisch“, denn, so erfahren wir von der ehemaligen Marxistin: „Langfristig gibt es im harten Wettbewerb auf einem offenen Markt keinen Grund, weshalb ein Unternehmer mehr als seine eigene unternehmerische Leistung bezahlt bekommen sollte.“ (94)
Vorwärts, – zurück zur Vulgärökonomie. Wagenknecht betrachtet den Kapitalismus vom Standpunkt des selbstständigen Kleinunternehmers, der im Gegensatz zum Großkapital im Betrieb eine anleitende, organisierende oder überwachende Funktion ausübt. Dumm nur, dass das große Kapital notwendigerweise aus der Konkurrenz erwächst, dass diese den Stachel zur Akkumulation bildet. Wie viele andere ApologetInnen der Marktwirtschaft – nicht zuletzt der von Wagenknecht beständig als wegweisender Ökonom und Politiker angeführte „Erfinder“ der „sozialen Marktwirtschaft“ Ludwig Erhard – behauptet auch sie einen „dritten Weg“ zwischen Kapitalismus und Kommunismus. Erhard beschönigte damit die imperialistische Politik im Interesse des Großkapitals und erfüllte damit auch ein Bedürfnis des Kapitals im Nachkriegsdeutschland. Wagenknecht hingegen stellt eine utopische Politik im Interesse der „selbstständigen“ ProduzentInnen und einer „echten“ Marktwirtschaft als linke (!) Perspektive dar – und erzeugt so bestenfalls Verwirrung.
Es zeigt aber, welches „Volk“ Wagenknecht und die „Aufstehen“-Bewegung konstruieren. Die „BürgerInnen“, die „Menschen“, die den Staat unter ihre Kontrolle und zur Rettung des sozialen Zusammenhalts „erobern“ sollen. Ihrer Ansicht nach stellen diese eine Allianz verschiedener Klassen dar: Lohnabhängige, Mittelschichten, KleinbürgerInnen in Stadt und Land und, gewissermaßen als deren Krönung, „echte“ UnternehmerInnen, KapitalistInnen, die ihr Kapital zum Nutzen des Betriebes und der Gesellschaft einsetzen und daher erhalten, was ihnen zusteht.
In dieser trauten BürgerInnenbewegung ist unter der Hand auch die Ausbeutung der ArbeiterInnenklasse verschwunden. Diese kommt gewissermaßen nur von „außen“, von jenen Teilen des Kapitals, die sich der Konkurrenz entziehen, also den Finanzmärkten, den Monopolen usw. Diese werden sodann als Träger von „Kosmopolitismus“ und „offenen Grenzen“ dargestellt, ihnen angeschlossen sind allenfalls „privilegierte“ Schichten der LohnarbeiterInnen, die es sich leisten könnten, ihre Arbeitskraft auch im Ausland zu verkaufen.
Hier werden wieder einmal zwei miteinander verbundene reaktionäre und spalterische Tendenzen deutlich. Die „einheimischen“ ArbeiterInnen sollten gefälligst in „ihrem“ Land bleiben, der Zustrom von MigrantInnen und Geflüchteten müsse begrenzt bleiben.
„Die Zerstörung des sozialen Zusammenhalts, wachsende Unzufriedenheit und empfundene Ohnmacht schaffen einen Nährboden für Hass und Intoleranz. Auch wenn der Hauptgrund für Zukunftsängste die Krise des Sozialstaats und globale Instabilitäten und Gefahren sind: Die Flüchtlingsentwicklung hat zu zusätzlicher Verunsicherung geführt. Übergriffe auf Menschen aufgrund ihres Aussehens oder ihrer Religion häufen sich. Wir lehnen jede Art von Rassismus, Antisemitismus und Fremdenhass ab. Gerade deshalb halten wir die Art und Weise, wie die Regierung Merkel mit den Herausforderungen der Zuwanderung umgeht, für unverantwortlich.“ (95)
Bemerkenswerterweise wird deshalb das zeitweilige Durchbrechen der Grenzen der Festung Europa durch Flüchtlinge und MigrantInnen der „Regierung Merkel“ als größtes Versäumnis angerechnet, nicht aber die umso barbarischere Wiedererrichtung ebendieser Grenzen!
Wie jeder BürgerInnenbewegung, die nicht die grundlegenden Verhältnisse verändern, sondern nur besser gestalten will, erscheinen auch bei „Aufstehen“ „zu viele“ MigrantInnen, d.h. zu viele Lohnabhängige und Entrechtete aus den vom deutschen Kapital ausgebeuteten Ländern, als Gefahr für ein nationales Reformprojekt. Wenn von der ArbeiterInnenklasse bei Wagenknecht und Co. überhaupt noch die Rede ist, so ist damit die „einheimische“, also die „nationale“ ArbeiterInnenklasse gemeint.
Schließlich kommt bei „Aufstehen“ auch der Staat zu seinem Recht. Dieses Instrument des Kapitals solle endlich wieder zum Instrument der „Menschen“, der BürgerInnen werden.
Dazu soll er erstens eine Reihe sozialer Reformen umsetzen, die ebenso gut von der Linkspartei oder selbst der SPD versprochen werden. Wenn es um den bewaffneten Staatsapparat geht, will sich „Aufstehen“ schon heute nicht unterstellen lassen, eine Gruppe vaterlandsloser GesellInnen zu sein. So wird unter „eine neue Friedenspolitik“ gefordert: „Die Bundeswehr als Verteidigungsarmee in eine Europäische Sicherheitsgemeinschaft einbinden, die Ost und West umfasst.“ (96) Und unter “Sicherheit im Alltag“ folgt: „mehr Personal und bessere Ausstattung von Polizei, Justiz und sozialer Arbeit.“ (97) Damit kann sich auch die verhasste Merkel-Regierung anfreunden. Schließlich heißt es am Ende des Aufrufs:
„Das Recht auf Asyl für Verfolgte gewährleisten, Waffenexporte in Spannungsgebiete stoppen und unfaire Handelspraktiken beenden, Kriegs- und Klimaflüchtlingen helfen, Armut, Hunger und Elendskrankheiten vor Ort bekämpfen und in den Heimatländern Perspektiven schaffen. Durch eine neue Weltwirtschaftsordnung die Lebenschancen aller Völker auf hohem Niveau und im Einklang mit den Ressourcen angleichen.“ (98)
Hier wird so getan, als könnten im Rahmen der imperialistischen Weltordnung die „Lebenschancen der Völker“ angeglichen werden. Die Beendigung „unfairer“ Praktiken verspricht im Kapitalismus allerdings so ziemlich jede bürgerliche Partei und Regierung, und die Flüchtlingskrise „vor Ort“ zu bekämpfen, neuerdings auch. In Wirklichkeit sind dies nur Phrasen, um die militärische und polizeiliche Abschottung an den Grenzen der EU zu rechtfertigen. Die Armen sollen gefälligst in „ihrem“ Land bleiben und auf die „Hilfe“ aus den Metropolen warten, statt unsichere Verhältnisse hierzulande noch unsicherer zu machen. Diese rechte Politik wird nicht besser, wenn sie mit humanitären Phrasen bemäntelt wird.
Schluss
Wir haben den Anspruch von Laclau und Mouffe, eine strategische Antwort auf den Rechtspopulismus und die Krise der Linken zu liefern, einer ausführlichen Kritik unterzogen. Weit davon entfernt, eine fortschrittliche Antwort auf die Krise der Linken darzustellen, theoretisieren sie vielmehr eine falsche Lösung des Problems.
Die linkspopulistischen Parteien und Bewegungen stellen eine Anpassung an den bürgerlichen Nationalismus, die bürgerliche Demokratie und andere vorherrschende Ideologien dar. Statt die Lohnabhängigen als eigene Klassenkraft zu konstituieren und so einen Pol der Veränderung der Gesellschaft zu schaffen, führt die populistische Ideologie notwendigerweise zur Auflösung der ArbeiterInnenklasse in der imaginären Einheit des „Volkes“. Mag sie auch noch zahlreich vertreten sein, so geht sie im Wust kleinbürgerlicher Ideologien, Vorurteile und Halbwahrheiten unter. Statt der Politik der herrschenden Klasse ihre eigene Politik, ihr eigenes Programm im Kampf entgegenzustellen, wird sie umso stärker an bürgerliche Ideen gebunden. Daher ist der Linkspopulismus untrennbar mit einem Angriff auf Klassenpolitik, Internationalismus, Befreiung und Sozialismus verbunden.
Die Theorien Mouffes und Laclaus, weit davon entfernt, über den Klassen zu stehen, entsprechen den politischen Bedürfnissen des sich als „Nation“, als „Volk“ proklamierenden KleinbürgerInnentums, der Mittelschichten und der unteren Schichten des Kapitals. Selbst wo und insofern Lohnabhängige die Mehrheit ihrer AnhängerInnen bilden mögen, werden sie als „Bürger“ und „BürgerInnen“ angesprochen und organisiert. Der Linkspopulismus will wie jeder Populismus nicht die Bildung eines Klassensubjekts, sondern dieses vielmehr im „Volk“ zum Verschwinden bringen.
Die gegenwärtige Kriseperiode erfordert jedoch genau das Gegenteil – nicht das Verschwinden des Proletariats als eigenständige Kraft, sondern die grundlegende Erneuerung der ArbeiterInnenbewegung. Und der Kampf gegen den Linkspopulismus, die Zurückweisung dieser kleinbürgerlichen Ideologie ist eine Voraussetzung dafür.
Eine globale politische Antwort auf die Krise des Kapitalismus erfordert den Bruch mit allen bürgerlichen Ideologien, mit jeder Unterunterordnung unter „populistische“ und sonstige klassenversöhnlerischen Ideen. Dieser Bruch stellt eine unerlässliche Voraussetzung dafür dar, dass das Proletariat von einer Klasse an sich zu einer Klasse für sich werden kann.
Endnoten
(1) Mouffe, Chantal: Für einen linken Populismus. Suhrkamp-Verlag, Berlin 2018.
(2) Mouffe, Chantal: Für einen linken Populismus, a. a. O., S. 16.
(3) Mouffe, Chantal: Für einen linken Populismus, a. a. O., S. 14 oder S. 16?
(4) Laclau, Ernesto: Politik und Ideologie im Marxismus. Kapitalismus, Faschismus, Populismus. Argument Verlag, Berlin 1981.
(5) Laclau, Ernesto/ Mouffe, Chantal: Hegemonie und radikale Demokratie. Zur Dekonstruktion des Marxismus Passagen Verlag, Wien 2015, 5. überarbeitete Auflage.
(6) Laclau/Mouffe, Hegemonie und radikale Demokratie, a. a. O., S. 64.
(7) a. a. O., S. 52.
(8) Lenin, W. I.: Was Tun? LW 5, Berlin/Ost 1955, S. 426.
(9) Laclau/Mouffe, Hegemonie und radikale Demokratie, a. a. O., S. 85.
(10) Ebenda.
(11) Marx, Karl: Vorwort zur Kritik der Politischen Ökonomie. MEW 13, Berlin/Ost 1974, S. 8/9.
(12) A. a. O., S. 9.
(13) Laclau, Ideologie und Politik im Marxismus, a. a. O., S. 177/178.
(14) Marx, Karl: Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Erster Band. MEW 23, Berlin/Ost 1971, S. 791.
(15) Rosdolsky, Roman: Zur Entstehungsgeschichte des Marxschen ‚Kapital’, Band 1 und 2. EVA, Frankfurt am Main 1972, 2. unveränderte Auflage.
(16) Marx, Karl: Der 18. Brumaire des Louis Bonaparte. MEW 8, Berlin/Ost 1973, S. 115.
(17) Laclau, Politik und Ideologie im Marxismus, a. a. O., S. 92.
(18) A. a. O., S. 93.
(19) A. a. O., S. 94.
(20) A. a. O., S. 94/95.
(21) A. a. O., S. 139.
(22) A. a. O., S. 139.
(23) A. a. O., S. 8.
(24) Laclau/Mouffe, Hegemoniale und radikale Demokratie, a. a. O., S. 110.
(25) A. a. O., S. 111.
(26) A. a. O., S. 112.
(27) Ebenda.
(28) Marx, Das Kapital, Bd. 1, a. a. O., S. 249.
(29) A. a. O., S. 351.
(30) A. a. O., S. 250.
(31) Sam Bowles/Herbert Gintis; zitiert von Mouffe/Laclau, Hegemonie und radikale Demokratie, a. a. O., S. 112.
(32) Marx, Das Kapital, Bd. 1, a. a. O., S. 349.
(33) A. a. O., S. 351.
(34) A. a. O., S. 180/181.
(35) Laclau/Mouffe, Hegemonie und radikale Demokratie, a. a. O., S. 112.
(36) Braverman, Harry: Die Arbeit im modernen Produktionsprozess, Campus-Verlag, Frankfurt am Main/New York 1985, 2. Auflage.
(37) Edwards, Richard: Herrschaft im modernen Produktionsprozess. Campus-Verlag, Frankfurt am Main 1981.
(38) Marx, Das Kapital Bd. 1, a. a. O., S. 529/30.
(39) A. a. O., S. 674/675.
(40) A. a. O, S. 559.
(41) A. a. O, S. 562.
(42) Mouffe, Für einen linken Populismus, a. a. O., S. 101.
(43) Laclau/Mouffe, Hegemonie und radikale Demokratie, a. a. O., S. 142.
(44) Marx, Karl/Engels, Friedrich: Die deutsche Ideologie. MEW 3, Berlin/Ost 1969, S. 30/31.
(45) Lukács, Georg: Die Zerstörung der Vernunft. Aufbau Verlag, Berlin/Ost und Weimar 1984, S. 326, 3. Auflage.
(46) A. a. O., , S. 326.
(47) Laclau/Mouffe, Hegemonie und radikale Demokratie, S. 190.
(48) Ebenda.
(49) Ebenda.
(50) A. a. O., S. 195.
(51) A. a. O., S. 194.
(52) A. a. O., S. 216.
(53) Mouffe, Chantal: Über das Politische. Suhrkamp-Verlag, Berlin 2007, S. 19.
(54) Laclau/Mouffe, Hegemonie und radikale Demokratie, a. a. O., S. 232
(55) A. a. O., S. 227.
(56) Mouffe, Für einen linken Populismus, a. a. O., S. 13.
(57) Laclau/Mouffe, Hegemonie und radikale Demokratie, a. a. O., S. 188.
(58) Ebenda.
(59) A. a. O., S. 191.
(60) A. a. O., S. 192.
(61) A. a. O., S. 231.
(62) Mouffe, Über das Politische, a. a. O., S. 17.
(63) Ebenda, S 18.
(64) Schmitt, Über das Politische, zitiert nach Lukács, Die Zerstörung der Vernunft, a. a. O., S. 521.
(65) Lukács, Die Zerstörung der Vernunft, a. a. O.. S. 522.
(66) Mouffe, Über das Politische, a. a. O., S. 25.
(67) A. a. O., S. 29.
(68) A. a. O., S. 31.
(69) Mouffe, Für einen linken Populismus, a. a. O., S. 92.
(70) Mouffe, Über das Politische, a. a. O., S. 89.
(71) A. a. O., S. 89.
(72) A. a. O., S. 94.
(73) Mouffe, Für einen linken Populismus, a. a. O., S. 92.
(74) Mouffe, Chantal: Agonistik – Die Welt politisch denken. Suhrkamp-Verlag, Berlin 2014, S. 80.
(75) A. a. O., S. 81
(76) A. a. O., S. 84.
(78) Anderson, Perry: Hegemonie. Suhrkamp-Verlag, Berlin 2018, S. 129/130.
(79) Mouffe, Agonistik…, a. a. O., S. 130.
(80) Ebenda, S. 183.
(81) Mouffe, Für einen linken Populismus, S. 61.
(82) A. a. O., S. 84/85.
(83) Wagenknecht, Sahra: Reichtum ohne Gier. Wie wir uns vor dem Kapitalismus retten. Campus-Verlag, Frankfurt am Main 2016, S. 32.
(84) Mouffe, Über das Politische, a. a. O., S. 14.
(85) Mouffe, Für einen linken Populismus, a. a. O., S. 93.
(86) Ebenda.
(87) A. a. O., S. 31.
(88) A. a. O., S. 63.
(89) A. a. O., S. 77.
(90) A. a. O., S. 81
(91) Gründungsaufruf von „Aufstehen“:
(92) Ebenda.
(93) Wagenknecht, Reichtum ohne Gier, a. a. O., S. 16.
(94) Wagenknecht, Reichtum ohne Gier, a. a. O., S. 154.
(95) Gründungsaufruf von „Aufstehen“, a. a. O.
(96) Ebenda.
(97) Ebenda.
(98) Ebenda.









