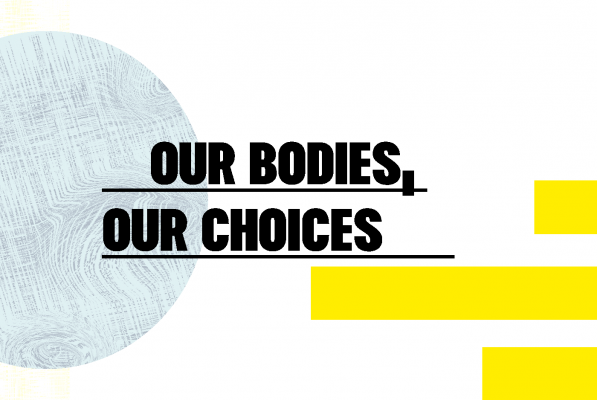Imperialismus, Rassismus und die deutsche Linke
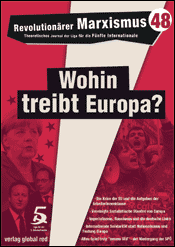
Anne Moll/Martin Suchanek, Revolutionärer Marxismus 48, August 2016
Der Rassismus ist der Sozialismus der dummen Kerls – so könnte Friedrich Engels‘ Bemerkung über den Antisemitismus des ausgehenden 19. Jahrhunderts auf die aktuelle Periode übertragen werden. Zweifellos gehören staatliche Selektion von MigrantInnen und Flüchtlingen, rassistische Ideologien und Vorstellungen untrennbar zur bürgerlichen Gesellschaft.
In den letzten Monaten und Wochen erleben wir jedoch nicht nur in Deutschland und Österreich, sondern in ganz Europa ihr massives Anwachsen. Übergriffe gegen Geflüchtete, MigrantInnen, Anschläge auf Unterkünfte nehmen in erschreckendem Ausmaß zu. Mit der AfD etabliert sich eine rechts-populistische Partei, in Österreich ist die rassistische FPÖ zur stärksten Partei geworden.
Die „Willkommenskultur“ der Regierung Merkel – verlogen wie sie immer schon war – ist nach einem Jahr einer permanenten Verschärfung von Gesetzen, Abriegelung der EU-Außengrenzen, forcierten Abschiebung gewichen. Wenn die Herrschenden von „Integration“ sprechen, meinen sie ein demütigendes Anpassungs- und Selektionsprogramm. Der Anti-Islamismus wird zugleich als „populärer“ Rassismus unserer Zeit befeuert, sexuelle Gewalttaten und reaktionäre dschihadistische Anschläge werden „den“ Flüchtlingen in die Schuhe geschoben. Zugleich dient er als Rechtfertigung für weitere imperialistische Interventionen im Nahen Osten, Zentralasien und Afrika, für die Militarisierung der Außenpolitik, Aufrüstung im der globalen Konkurrenz, Ausbau des Überwachungsstaates und die Aufhebung demokratischer Rechte im Inneren.
In einer Periode der kapitalistischen Krise ergreift Rassismus nicht nur das vom Abstieg bedrohte Kleinbürgertum und die Mittelschichten, sondern auch größere Teile der ArbeiterInnenklasse. Nicht nur der „normale“ bürgerliche Nationalismus und die Konkurrenz tragen dazu das Ihre bei. Die vorherrschende nationalstaatliche, am „eigenen“ Wirtschaftsstandort sozialpartnerschaftlich ausgerichtete Politik von Gewerkschaften und Sozialdemokratie hat das Ihre dazu beigetragen, dass große Teile der Lohnabhängigen anfällig werden für chauvinistische und rassistische Hetze. Große Teile der ArbeiterInnenklasse, die dem Rechtsruck entgegentreten wollen, stehen heute politisch perspektivlos, hilflos, ratlos da.
Dabei war die Solidaritätsbewegung mit den Geflüchteten im Sommer 2015 eine der größten gesellschaftlichen Bewegungen der letzten Jahre, wenn nicht Jahrzehnte. Ein beachtlicher Teil der Bevölkerung – Schätzungen gehen von bis zu 7 oder 8 Millionen Menschen aus, die sich an Unterstützungsaktivitäten beteiligten – hieß Hunderttausende nicht nur willkommen, sondern zeigte in zahlreichen lokalen Initiativen und Vereinigungen, dass der Rechtsruck keineswegs eine „unvermeidbare“ oder „natürliche“ Entwicklung ist. Schon davor hatten GewerkschafterInnen wie z. B. in Hamburg Initiativen ergriffen, Geflüchtete in die Gewerkschaften aufzunehmen, um ihre Solidarität zu demonstrieren und aufzuzeigen, dass diese in die ArbeiterInnenbewegung integriert werden können und müssen. Noch wichtiger war, dass sich in den letzten Jahren auch eine politische Bewegung unter den Geflüchteten gebildet hat, die mit Protestmärschen und Besetzungen ihre Anliegen öffentlich machte.
Materiell erreicht haben diese Initiativen bislang zwar nur wenig. Verbesserungen wie eine Lockerung der Residenzpflicht, die sie in einigen Bundesländern erzwangen, sollen nun wieder im Namen der „Sicherheit“ kassiert werden. Die meisten UnterstützerInnen für Geflüchtete agierten mehr als humanitäre und karitative NothelferInnen, wo sich staatliche Stellen aufgrund von Kürzungen, politischem Unwillen und auch Kalkül als unfähig erwiesen, die elementare Versorgung der Geflüchteten sicherzustellen. Trotz ihrer großen Zahl fehlte ihen eine politische Perspektive.
Aber all das verdeutlicht, dass es ein großes gesellschaftliches Potential gab und weiter gibt, das sich aktiv dem Rechtsruck entgegenstellen will. So wie die AfD, rassistische Straßenmobilisierungen bis hin zu neo-faschistischen Gruppierungen das Unterste der Gesellschaft formieren und radikalisieren, so gibt es durchaus auch ein Potential für eine aktive, antirassistische Massenbewegung. Das zeigt im Übrigen auch die Teilnahme von 500 bis 800 Menschen an „antirassistischen Aktionskonferenzen“ in den letzten beiden Jahren.
Allein: Damit diese Potentiale ausgeschöpft und zu einer wirklichen gesellschaftlichen und politischen Kraft werden, braucht es eine politische Konzeption, die den Kampf gegen den Rassismus als Bestandteil des Kampfes gegen soziale und politische Angriffe, als integralen Teil des Klassenkampfes begreift und diese Aktivitäten um konkrete Forderungen herum bündelt. Es erfordert ein Verständnis des Rassismus, seiner gesellschaftlicher Wurzeln wie auch politischer Strategie und Taktik.
Genau daran mangelt es jedoch der deutschen Linken. Während der Mainstream der bürgerlichen, staatlich integrierten ArbeiterInnenbewegung, vor allem die SPD und das Gros der Gewerkschaften, ihr Heil in einer rein bürgerlichen Politik suchen, der „Humanismus“ für die Geflüchteten mit selektiver Migration kombiniert, geben auch immer größere Teile des Linksreformismus diesem Druck nach. Die SPD und die Grünen stimmen Gesetzesverschlechterungen offen zu. Die Landesregierung Thüringens schiebt unter dem „linken“ Ministerpräsidenten Ramelow in aller Stille ab. Andere wie Lafontaine und Wagenknecht spekulieren darauf, der AFD mit offen sozialchauvinistischen Äußerungen das Wasser abzugraben – und helfen doch nur, das AfD-Schiff flott zu machen.
Aber auch die „radikale“ Linke verfügt über kein klares Verständnis, was Rassismus überhaupt ist, geschweige denn, wie er zu bekämpfen wäre. Ihre Politik schwankt zwischen Opportunismus und Sektierertum, zwischen einer „Verallgemeinerung“ der Kleingruppenpolitik der Antifa und dem Beschwören klassenübergreifender Bündnisse. Versuche, den Rassismus als Element der kapitalistischen Gesellschaftsformation zu begreifen, werden losgetrennt vom Kampf gegen Imperialismus und vom Bezug auf den Klassenkampf. Andere sind zwar gegen „Obergrenzen“ für Geflüchtete, distanzieren sich aber gleichzeitig von der Forderung nach offenen Grenzen. Zu all diesen politischen Irrungen gesellt sich ein manifestes Unvermögen – wenn nicht ein Unwille -, ein bundesweites Aktionsbündnis gegen die RassistInnen und RechtspopulistInnen wie gegen den staatlichen Rassismus aufzubauen.
Es ist daher kein Wunder, dass die Rechten heute in der Offensive sind. Der Aufschwung der AfD ist auch durch innere Zerwürfnisse und Skandale um offene Antisemiten wie im Stuttgarter Landtag nicht zu stoppen. Regierung und EU haben es geschafft, die Festung Europa wieder dicht zu machen. Nun sollen jene, die es 2015 und 2016 geschafft haben, die Festungsmauern zu überwinden, sortiert werden in „nützliche Flüchtlinge“ mit „Integrations- und Bleibeperspektive“ und andere, die so rasch wie möglich abgeschoben oder zur „freiwilligen Rückkehr“ in Länder wie Afghanistan „ermutigt“ werden sollen. Zugleich richtet sich der Rassismus – insbesondere in Form des Anti-Islamismus – zunehmend gegen MigrantInnen, die seit Jahrzehnten in Deutschland leben und nach wie vor als Menschen zweiter Klasse behandelt werden.
Im Folgenden werden wir daher kurz das marxistische Verständnis des Rassismus skizzieren und illustrieren, wie sich die Lage der MigrantInnen in den letzten Jahren verschlechtert hat. Im zweiten Schritt werden wir auf zentrale politische Probleme und Schwächen verschiedener Teile der deutschen Linken eingehen. Wir werden uns dabei nicht mit allen Strömungen, wohl aber mit wichtigen Streitfragen beschäftigen, die für das Verständnis und den Kampf gegen den Rassismus heute von Bedeutung sind. Wir verweisen außerdem auf die Resolution „Internationale Solidarität statt Nationalismus und Festung Europa“ (siehe diese Ausgabe S. 136), die von ArbeiterInnenstandpunkt und ArbeiterInnenmacht Ende März 2016 veröffentlicht wurde und die Strategie und Taktik unserer Organisationen zu Schlüsselforderungen im Kampf gegen den Rassismus darlegt.
Was ist Rassismus?
Nationalismus, Rassismus und Imperialismus sind historisch eng miteinander verflochten. Rassistische Ideologien sind kein Produkt des „menschlichen Wesens“, nicht Ausdruck einer „tief verwurzelten, archaischen Angst vor dem Fremden“, oder was es sonst noch an psychologistischen Verharmlosungen des Rassismus gibt. Richtig ist zwar, dass die Milderung der Klassengegensätze der eigenen Gesellschaft durch die Umlenkung des Kampfes auf die Auseinandersetzung mit fremden Gesellschaften eines der „bewährtesten“ Mittel aller Klassengesellschaften gewesen ist (siehe die Auseinandersetzung mit den „Barbaren“ in der Sklavenhaltergesellschaft oder mit den „Heiden“ in der Feudalgesellschaft). Doch der Rassismus zeitigt einige Besonderheiten, die erst mit der kapitalistischen Epoche möglich wurden und mit dem Entstehen bürgerlicher, imperialistischer Nationalstaaten zusammenhängen.
Erst die Bourgeoisie schuf sich aus ihrem Bedürfnis nach einem geeigneten „Binnenmarkt“ heraus den politischen Überbau des Nationalstaates. Erst der Kapitalismus brachte einen allgemeinen Weltmarkt hervor, in dem die entwickelten kapitalistischen Nationen die Bedingungen diktieren. Schon die Entstehung der bürgerlichen Nationen ist verbunden mit der Ausplünderung der Reichtümer und Nutzung der Arbeitskräfte von anderen Völkern. So beruht die ursprüngliche Akkumulation in den USA zu einem großen Teil auf der Arbeit der schwarzen Sklaven.
Als der Kapitalismus im 19. Jahrhundert zur Überwindung seiner beständigen Überproduktionskrisen gezwungen war neue Märkte zu gewinnen, entwickelte er eine Kolonialisierungspolitik, die an Gewalt und Ausmaß alles Bisherige in den Schatten stellte. Erst dies war die Geburtsstunde des Märchens von den „großen“ Nationen, die der Welt ihre „Zivilisation“ bringen. Mit der Beständigkeit der Ausbeutung der Bevölkerung der Kolonialländer wuchs der Bedarf an Erklärungen, die die Unzivilisierbarkeit dieser Menschen feststellten und sie so zu ewigen „Dienern des weißen Mannes“ machten. So war der Boden bereitet für die pseudo-wissenschaftliche Erklärung ihrer „Minderwertigkeit“ durch den Rassebegriff.
Der Nationalismus spielt von Beginn der kapitalistischen Ära an eine Schlüsselrolle. Er richtet sich nicht nur gegen die feudale Ordnung oder gegen Unterdrückung durch andere Nationen, er ist auch die Ideologie, die in Wirklichkeit unversöhnliche Klasseninteressen scheinbar im „nationalen Wohl“, im nationalen „Gesamtinteresse“ versöhnt. Anders als vorhergehende Gesellschaftsformationen präsentiert sich der bürgerliche Staat als eine Gemeinschaft formal gleicher und freier WarenbesitzerInnen, von StaatsbürgerInnen, hinter der die reale Ungleichheit, die auf dem Klassenantagonismus beruht, verschleiert wird.
Es ist daher kein Zufall, dass die kleinbürgerlichen Schichten, die „Mittelklassen“ der Gesellschaft oft die begeistertsten AnhängerInnen des Nationalismus sind. Auch wenn Rassismus und Nationalismus keineswegs ein- und dasselbe sind, so findet der Rassismus doch seinen Nährboden im Nationalismus.
Die Geschichte der Klassengesellschaft war immer überlagert durch eine Geschichte ethnischer Gegensätze. Die jeweiligen ökonomischen Möglichkeiten einer Klassengesellschaft schufen die Voraussetzung für die Bildung immer größerer gesellschaftlicher Einheiten, in denen das allgemeine Gefäß der Klassengesellschaft mit Leben gefüllt wurde. Erst in diesen Einheiten wird die Lebenswelt ihrer Mitglieder umfassend bestimmt, während das Prinzip der Klassengesellschaft nur die allgemeinen Grundzüge festlegt. Im Gegensatz zur Klassenzugehörigkeit haftet den ethnischen Institutionen (Sprache, kulturelle Überlieferung, besondere Rollenverständnisse etc.) etwas „Konventionelles“ an. Die zentrale Bestimmung des Individuums ergibt sich aus dem Klassenantagonismus und damit aus seiner Klassenzugehörigkeit. Das zeigt sich auch bei der Frage der Migration. Während es für Angehörige der KapitalistInnenklasse relativ wenige Schwierigkeiten gibt, auch in die meisten imperialistischen Länder zu reisen, so ist ein Visum für die Masse der Bevölkerung schwer erhältlich, ohne extreme Hürden kaum zu meistern. Die Einreise von ArbeitermigrantInnen ist eng an ihre Verwertbarkeit am Arbeitsmarkt gebunden. Ebenso ist die „Integration“ in die vorherrschende bürgerliche Kultur des imperialistischen Landes klassenspezifisch bestimmt.
Rassismus und Nationalismus kehren die Verhältnisse genau um. Für sie bleibt ein/e TürkIn immer ein/e TürkIn, auch wenn sie/er schon jahrzehntelang in einem anderen Land lebt. Wer auf die doppelte Staatsbürgerschaft nicht verzichten will, gilt schon als „illoyal“, wenn nicht als potentieller „Terrorist“. Der Rassismus geht sogar weiter als die Festlegung eines Individuums durch Sprache oder kulturelle Herkunft. Er macht sich zunutze, dass „man den Menschen ja ansieht, woher sie kommen“. Phänotypische Merkmale (Kopfform, Hautfarbe etc.) werden hergenommen, um die wesentliche Gruppenzugehörigkeit eines Menschen festzulegen.
Der Rassenbegriff ist dabei ein besonders bequemes Instrument der bürokratischen Grenzziehung und der demagogischen Mobilisierung. Auch wenn heute eine kulturalistische Begründung oft vorherrscht, so ist der Weg zur Schädellehre auch in den letzten Jahrzehnten keineswegs so weit gewesen, wie die aufgeklärte bürgerliche Gesellschaft sich gern vormacht. So wurden Anfang der 90er Jahre AussiedlerInnen aus Polen auf ihre Schädelmaße hin untersucht, um festzustellen, ob sie denn noch „wirklich“ Deutsche wären. Wir leben in einer Zeit, in der moderne Kommunikationsmittel die Distanz zwischen Kontinenten zu einer Nebensächlichkeit machen und die Wissenschaft sich einer immer perfekter werdenden universellen Sprache – der Mathematik und Logik – bedient. Trotz aller Möglichkeiten im Transport- und Kommunikationswesen, die wir heute hätten, unser Leben in eine andere Region zu verlegen, entscheiden über Verwirklichung eines solchen Wunsches oft Maßstäbe, deren reaktionäre Dummheit nicht einmal das Wort „mittelalterlich“ verdient.
Manchmal wird die Anwendung des Begriffes Rassismus auf die Unterdrückung der Arbeitsmigrantinnen als unpassend angesehen. Er gilt oft als ein Extremwort, das mit „Pogrom“ oder „Apartheid“ assoziiert wird. Dabei wird übersehen, dass er auch viel einfachere Formen hat, die den Alltag des Imperialismus mitbestimmen. Es muss nicht so weit gehen, dass jemand wegen einer pseudo-wissenschaftlichen Feststellung seiner „Rassenzugehörigkeit“ staatlich unterdrückt wird. Auch die Zuteilung verschiedener Rechte, je nachdem, ob man einer „rückständigen“ oder einer „zivilisierten“ Nation oder Nationalität zugeordnet wird, ist Rassismus. Sein Sinn ist nämlich genau dies: die positive Bewertung der ethnischen Zugehörigkeit zu einem imperialistischen „Staatsvolk“ und die negative für alle anderen. Grundsätzlich ist dabei Rassismus immer mit einer Abwertung von Angehörigen unterdrückter Nationen verbunden, auch wenn er sich in bestimmten Situation ebenfalls gegen Angehörige imperialistischer Nationen wenden kann (z. B. gegen italienische MigrantInnen in den 50er/60er Jahren oder gegen die Bevölkerung des Kriegsgegners in imperialistischen Kriegen). Die Abwertung von Angehörigen unterdrückter Nationen ist keinesfalls auf die imperialistischen Länder beschränkt, sondern prägt auch viele halb-koloniale Länder (siehe z. B. den Rassismus gegenüber Schwarzen und der indigenen Bevölkerung in Lateinamerika).
Der Tatsache, dass Rassismus und Nationalismus allgemeines „Volksgut“ in den imperialistischen Ländern geworden sind, liegt jedoch ein langwieriger politischer und sozialer Prozess zugrunde. Noch im kommunistischen Manifest schrieben Marx und Engels „(…) die moderne industrielle Arbeit, die moderne Unterjochung unter das Kapital, dieselbe in England wie in Frankreich, in Amerika wie in Deutschland, hat ihm (dem Proletarier) allen nationalen Charakter abgestreift. Die Gesetze, die Moral, die Religion sind für ihn ebenso viele Vorurteile, hinter denen sich ebenso viele bürgerliche Interessen verstecken.“ (1)
Doch mit dem Anwachsen der ArbeiterInnenbewegung und der Enttäuschung revolutionärer Erwartungen in den Jahren 1848 und 1870 änderte sich gegen Ende des 19. Jahrhunderts die Situation. Einerseits waren die Herrschenden gezwungen, gegen den wachsenden Druck der ArbeiterInnenbewegung auch mit sozialen Kompromissen vorzugehen. Aufgrund der imperialistischen Superprofite konnte man es sich aber auch leisten, einer gewissen Schicht der ArbeiterInnenklasse einen bescheidenen Wohlstand zuzugestehen.
Andererseits begannen sich diese Schichten der ArbeiterInnenbewegung in ihrem neuen kleinbürgerlichen Glück wohlzufühlen und wurden zugleich zur sozialen Basis für die Entstehung einer eigenen, abgesonderten ArbeiterInnenbürokratie an der Wende zur imperialistischen Epoche. Diese, den Rest der ArbeiterInnenklasse ideologisch dominierenden Schichten, begannen ihren Erfolg mit dem der „eigenen“ deutschen, englischen und französischen Industrie zu identifizieren. Damit hörte der Nationalismus auf, nur eine Ideologie der herrschenden Eliten und des Kleinbürgertums zu sein. Er fand Eingang unter die Masse der arbeitenden Bevölkerung. In dieser Zeit bildete sich der soziale und politische Kompromiss heraus, der noch heute die imperialistischen Länder bestimmt: über „demokratische“ Institutionen erhalten reformistische ArbeiterInnenorganisationen politische Mitspracherechte, anderseits bilden sich die verschiedenen Institutionen einer „Sozialpartnerschaft“ zwischen den ArbeiterInnenbürokraten und „ihren“ Unternehmern, in denen ein „angemessenes“ Stück vom Kuchen der imperialistischen Gewinne für die „eigenen“ ArbeiterInnen verlangt wird. Das Symbol dieses Kompromisses ist der „Sozialstaat“, der von Anfang an ein nationalistisches Konzept ist, in dem nur die ArbeiterInnen des Staatsvolkes Anspruch auf seine Segnungen haben.
Im Jahr 1914 riefen die sozialdemokratischen Parteien fast aller Nationen die ArbeiterInnen zur Unterstützung ihres jeweiligen Staates im Weltkrieg auf. Die Vorstellung, ArbeiterInnen könnten ihre Interessen am besten durch ihren „eigenen“ Staat durchsetzen, hatte sich in der Zweiten Internationale endgültig über den Internationalismus als dominierendes Prinzip hinweggesetzt. Schon zu Beginn des letzten Jahrhunderts hatten sich führende deutsche Sozialdemokraten für den Erwerb von Kolonien in Afrika und repressive Maßnahmen gegen die Einwanderung ausländischer Arbeitskräfte ausgesprochen. Die Vorstellung, diese seien ein Problem oder eine Bedrohung für Deutsche, der deutsche Imperialismus verkörpere dagegen eine zivilisatorische Wohltat für die unterdrückten Völker der Welt, wurde im Laufe des 20. Jahrhunderts auch in der ArbeiterInnenbewegung vorherrschend. Die Grundlage für das Eindringen rassistischer Vorurteile in breite Schichten der Gesellschaft war somit geschaffen.
Die Erfahrung zweier Weltkriege, die faschistische Diktatur und die Festigung des imperialistischen Sozialkompromisses durch den langen Boom nach dem Zweiten Weltkrieg sowie die Schwäche des Proletariats aufgrund der historischen Niederlage und des Fehlens einer revolutionären Partei haben dazu geführt, dass der Nationalismus heute wesentlich tiefer verwurzelt ist als noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Immerhin gab es noch in den 1920er Jahren einflussreiche kommunistische Parteien und, nach deren stalinistischer Degeneration, die auch mit einer nationalistischen Wende einherging, oppositionelle Strömungen, die der chauvinistischen Ideologie der offiziellen ArbeiterInnenparteien eine internationalistische Politik der ArbeiterInnensolidarität entgegensetzten. Heute dagegen ist jeder ArbeiterInnenfunktionär „staatstragend“, ein „Patriot“ – und kaum jemand findet das anstößig. Die Vorstellung, einen deutschen Arbeiter verbinde mehr mit einem deutschen Unternehmer als mit ausländischen ArbeiterInnen, gilt heute als selbstverständlich.
In vielen reformistisch geprägten Kreisen, ist der Begriff „Rassismus“ bis heute nicht gebräuchlich. Stattdessen wird oft von „Fremdenfeindlichkeit“ gesprochen. Dem liegt die verharmlosende Tendenz zugrunde, die Diskriminierung der ArbeitsmigrantInnen aus imperialisierten Ländern auf ein rein psychologisches Problem zu reduzieren. Tiefverwurzelte Vorurteile und Feindbilder würden „die Menschen“ dazu treiben „fremdenfeindlich“ zu handeln. Dies würde bedeuten, dass man dem Problem mit „Aufklärung“ und kultureller Aktivität begegnen kann. Mit Kulturveranstaltungen und Festen könnte die „Berührungsangst“ vor dem Fremden genommen werden und die Idee einer „multi-kulturellen Gesellschaft“ um sich greifen.
Dieser Ansatz verkennt, dass der Rassismus kein Problem „fehlender Aufklärung“ ist, sondern tief im gegenwärtigen Herrschaftssystem verankert. Nicht nur, dass der Rassismus ein notwendiges ideologisches Element des Imperialismus ist. Die materielle Basis des Rassismus in der ArbeiterInnenklasse ist der oben dargestellte soziale Kompromiss auf Kosten der Massen in den Halbkolonien, der einem Teil der ArbeiterInnenklasse in den imperialistischen Ländern einen gewissen Wohlstand zu garantieren scheint. Dass dieser Kompromiss nur begrenzt ausdehnbar ist, macht diese Schichten daher leicht zu VerfechterInnen einer nationalistischen Politik. Wenn schließlich die Krise den Kompromiss endgültig als Illusion entlarvt, wird dieser Nationalismus zur Basis noch schärferer Spaltungen der ArbeiterInnenklasse.
Eine anti-rassistische Politik muss grundlegend anti-nationalistisch und anti-imperialistisch sein. Es geht darum, dass der/die ArbeiterIn in den imperialistischen Ländern nicht wegen seiner/ihrer migrantischen KollegIn entlassen wird, die Miete erhöht oder die Sozialleistungen gekürzt bekommt. Anti-Rassismus beinhaltet den Kampf gegen die Illusionen, über die Unterstützung der „eigenen“ Industrie und des „eigenen“ Staates ein gutes Auskommen zu erhalten. Insbesondere SozialdemokratInnen und StalinistInnen, die wir für den anti-rassistischen Kampf zu gewinnen versuchen, werden an dieser Grenze halt machen. Sogar ihre linkesten Elemente fürchten, dass sie sich mit einer solchen Politik von der Mehrheit der „einheimischen“ ArbeiterInnen isolieren. Sie kapitulieren also vor den nationalistischen und rassistischen Tendenzen in der ArbeiterInnenklasse, die gerade ein Produkt ihrer Politik des „historischen Kompromisses“ sind. Auf diese Weise entlarven sich die ReformistInnen selbst vor den Augen fortschrittlicher ArbeiterInnen.
Zur politischen Ökonomie des Rassismus
Verschiedene Teile der ArbeiterInnenschaft gegeneinander auszuspielen, gehörte schon immer zu den Instrumenten unternehmerischer Strategie. Die nationalistische Entsolidarisierung mit den ArbeitsmigrantInnen führte nach Beginn des Einwanderungsbooms aus den vom Imperialismus beherrschten Ländern zur besonderen rechtlichen und sozialen Stellung der ArbeitsimmigrantInnen. Die FührerInnen der bürgerlichen ArbeiterInnenparteien und der Gewerkschaften hatten diesen Versuchen in den letzten Jahrzehnten wenig entgegenzusetzen, indem sie ArbeitsimmigrantInnen ähnlich wie proletarische Frauen und Jugendliche sowie Lesben und Schwule an den Rand der ArbeiterInnenbewegung drängten beziehungsweise gar nicht in diese hineinließen.
Der heutige Imperialismus greift zwar wieder mehr auf unmittelbare neo-koloniale militärische Gewalt zurück. Er funktioniert aber vor allem über indirekte ökonomische Zwänge: die Produktion der unterentwickelten Länder wird über Kapitalexport und Tauschbedingungen in Sektoren abgedrängt, die letztlich auf die Verwertungsbedürfnisse der imperialistischen Monopole ausgerichtet sind. Das mag zwar zur Entwicklung ganzer Industrien führen, ändert aber nichts an der globalen Arbeitsteilung, in die diese eingebunden sind. Durch diesen Prozess werden einerseits die Unterentwicklung der Gesamtökonomie der vom Imperialismus dominierten Länder festgeschrieben, andererseits Extraprofite an die imperialistischen Zentren abgeliefert.
Durch diese ungleiche Entwicklung der verschiedenen Wirtschaftssektoren verlieren aber auch massenhaft Arbeitskräfte aus dem ländlichen Bereich ihre Existenzbedingung. Sie ziehen in die Metropolen ihres Landes, ohne dass die unterentwickelte Industrie dort alle diese Arbeitskräfte aufnehmen könnte. Wir haben es daher mit riesigen Migrationsbewegungen zu tun, die oft Binnenmigration sind, zur Bildung von „Mega-Städten“ führen und zugleich zu einer Entstehung riesiger Schichten des Halb- und Subproletariats.
Dies ist auch eine der Triebkräfte, die zu einer grundlegenden Veränderung der Migrationsbewegung in der imperialistischen Epoche verglichen mit dem 19. Jahrhundert führten. Arbeitskräfte migrieren nun aus der sog. „Dritten Welt“ in die „Zentren“ der Welt, vorher war es umgekehrt.
Die Unternehmer der imperialistischen Länder waren in der Zeit das großen Booms auch sehr an einer Aufstockung ihrer industriellen Reservearmee interessiert. Umgekehrt sind die Regierungen der Halbkolonien – denken wir nur an Osteuropa nach der Wiedereinführung des Kapitalismus, aber auch an die Türkei – daran interessiert, frei gesetzte Arbeitskräfte abzubauen. Daher ist seit dem Zweiten Weltkrieg eine selektive, staatlich gesteuerte Migration vorherrschend, die den Zuzug der Arbeitskraft flexibel regulieren soll. Die migrantische Arbeit soll nur zeitweilig auf dem Arbeitsmarkt auftreten, danach soll sie wieder in ihr Herkunftsland verschwinden.
Ein zusätzliches Hindernis stellten für die Arbeitsmigration nach dem Zweiten Weltkrieg oft die ArbeiterInnenbürokraten dar, die den sozialen Kompromiss durch die unbeschränkte Einreise von „LohndrückerInnen“ in Gefahr sahen. So flossen schon zu Beginn der „AusländerInnenpolitik“ zwei verschiedene Interessen ineinander: einerseits das Interesse der ArbeiterbürokratInnen an einem „Schutz des inländischen Arbeitsmarktes“ durch AusländerInnenbeschäftigungsgesetze, andererseits das Interesse bürgerlicher PolitikerInnen an der rechtlichen Absicherung von Rassismus und Nationalismus durch die Schaffung polizeilicher Sonderrechte bei der Behandlung von ArbeitsmigrantInnen und die Gewährleistung ihrer politischen Rechtlosigkeit. Dies waren die Bedingungen, unter denen zu Beginn der 60er Jahre in der BRD und Österreich zwischenstaatliche Abkommen mit der Türkei und Jugoslawien über die „Einfuhr“ von Arbeitskräften abgeschlossen und die Ausländergesetze geschaffen wurden.
Der Grundsatz dieser Gesetze ist es, dass es den ImmigrantInnen so schwer wie möglich gemacht werden soll, ein vollwertiges Mitglied der jeweiligen Gesellschaft zu werden. Der von den Gesetzgebern angestrebte Status wird am entlarvendsten durch den Begriff „Gastarbeiter“ zum Ausdruck gebracht. Auch wenn jemand schon Jahrzehnte hier arbeitet, soll es rechtlich möglich sein, ihn/sie abzubauen, sprich in die alte Heimat abzuschieben. Die Schaffung eines zweiten, kapazitätsabhängigen Arbeitsmarktes war immer schon ein Traum der UnternehmerInnen für die Organisierung der industriellen Reservearmee. So meinte schon 1895 eine Studie des preußischen Handelsministeriums: „Beschränkte man die Industrie auf inländische Arbeiter, so würde bei einem Rückgang der Industrie eine große Anzahl von Arbeitern brotlos und vermehrten sich dadurch die unzufriedenen Elemente. Dagegen könne man ausländische Arbeiter in einem solchen Falle ohne weiteres abstoßen.“
Der Imperialismus konnte nach dem Zweiten Weltkrieg diesen „Traum“ von einer weltweiten Organisierung der industriellen Reservearmee realisieren. In den Slums der „3. Welt“, in den halbkolonialen Ländern, gibt es genug Reserven, die man bei entsprechender Konjunkturlage hereinholen und bei schlechterer Lage wieder zurückschicken kann. Rassismus und sozialchauvinistische ArbeiterInnenparteien sorgen dafür, dass dies vom Großteil der ArbeiterInnen in den imperialistischen Ländern hingenommen wird und der soziale Kompromiss nicht von einigen übereifrigen Unternehmern überzogen wird.
Doch ganz so perfekt funktioniert das System natürlich nicht. Inzwischen gibt es bestimmte Sektoren des Arbeitsmarktes, die auf ArbeitsimmigrantInnen angewiesen sind. Dies trifft besonders auf bestimmte Arbeiten im Gastgewerbe, am Bau oder bei besonders lärmbelasteter und gesundheitsgefährdender Tätigkeit zu sowie auf Beschäftigung mit prekären Arbeitszeiten, z. B. Altenpflege im privaten Bereich.
Aufgrund ihrer unsicheren Stellung im „Gastland“ und der beständigen Bedrohung mit Abschiebung sind die ArbeitsimmigrantInnen oft gezwungen und „bereit“, besonders schlechte Arbeits- und Lohnbedingungen in Kauf zu nehmen. Diejenigen, die schärfere Bestimmungen gegen AusländerInnen fordern, schneiden sich also ins eigene Fleisch: AusländerInnen nehmen ihnen ja nicht die Arbeitsplätze weg, sondern sie nehmen Arbeitsplätze zu umso schlechteren Bedingungen in Kauf, je schärfer sie durch AusländerInnengesetze bedroht werden. Solche Gesetze verschärfen also nur Lohndruck und Spaltung.
Die ArbeiterInnenklasse braucht dagegen eine vorwärtsgewandte, auf die internationale Solidarität abzielende Perspektive, denn es gibt keinen modernen Kapitalismus ohne Arbeitsimmigration.
Rassistische Gesetzesverschärfungen in Deutschland und der EU
Ebenso wenig gibt es Imperialismus ohne Fluchtbewegungen. Die Genfer Flüchtlingskonvention von 1948 schreibt zwar fest, dass Verfolgte Schutz genießen würden. Alle 28 Mitgliedstaaten der EU haben das unterzeichnet. In der Realität wurde dieses Recht immer mehr zur leeren Hülle.
Wird heute vom Asylrecht gesprochen, so geht im „zivilisierten“ Europa vor allem die Angst vor dessen „Missbrauch“ um. Schon seit dem Zweiten Weltkrieg wurde die Migration so reguliert, dass Not, Elend, Hunger und erst recht die Suche nach einem besseren Leben nicht als legitime Fluchtgründe anerkannt wurden.
Das drückte sich insbesondere in der Regulierung der Arbeitsmigration aus, besonders beim Arbeits-, Aufenthalts- und Sozialrecht. Das Ausländergesetz wurde 1965 verabschiedet, nachdem mit verschiedenen Staaten wie der Türkei, Griechenland, Italien sogenannte Anwerbeabkommen abgeschlossen worden waren, die dazu dienten, für eine befristete Zeit ArbeiterInnen aus diesen Ländern nach Deutschland zur Lohnarbeit zu bringen.
Das Ausländergesetz hat sich heute zum Aufenthaltsgesetz für Ausländer entwickelt und ist zusammen mit dem Asylgesetz (2015 um das Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz ergänzt) das wesentliche Element des deutschen Ausländerrechts.
Das Recht auf Asyl, im Grundgesetz §16 festgeschrieben, wurde 1993 mit dem § 16a stark eingeschränkt und seither noch mehr zur Makulatur gemacht. Dort wurde festgelegt, dass Menschen praktisch nur ein Recht auf Asyl haben, wenn sie nicht über einen sicheren Drittstaat einreisen. Das trifft auf alle Nachbarstaaten zu. So ist es nur möglich per Flugzeug nach Deutschland einzureisen, um hier ein Recht auf Asyl zu haben. An den Flughäfen wurden dafür Außenstellen der Grenzbehörde eingerichtet, in denen im Schnellverfahren über Asylanträge eingereister MigrantInnen entschieden und, bei negativem Bescheid, die Einreise untersagt wird (Asylgesetz § 18a, Verfahren bei Einreise auf dem Luftwege).
Die Dublin II-Verordnung von 2003, seit 2013 in reformierter Fassung als Dublin III gültig, ist ein Beschluss des Europaparlaments. Dort ist festgelegt, wer in der EU für welche Asylverfahren zuständig ist (die sogenannte Drittstaatenverordnung). Vor allem geht es um Datenerfassung der MigrantInnen und EU und länderübergreifende Zusammenarbeit.
Eurosur ist ein Grenzüberwachungssystem der Europäischen Union, das seit Dezember 2013 aktiv ist. Die Grenzüberwachungssysteme der Mitgliedstaaten der Europäischen Union sollen zusammengeführt werden, um Informationen auszutauschen. Als Hauptziele werden die Verhinderung von grenzüberschreitender Kriminalität und die Flüchtlingshilfe in Seenot proklamiert. Für die Überwachung ist die Agentur Frontex zuständig, deren Hauptsitz sich in Warschau befindet. FRONTEX ist für die Koordinierung von Grenzschutzsystemen zuständig sowie für die sechs Bereiche: Ausbildung von Grenzschutzbeamten, Risiko-Analyse der Grenzübergänge, Technologische Unterstützung, Koordinierung von Soforteinsatzteams für Grenzsicherungszwecke, Unterstützung bei Abschiebungen, Informationsaustausch zwischen den nationalen Grenzpolizei-Einheiten. EUROSUR wurde 2013 von der Europäischen Union eingeführt, Frontex wurde bereits 2004 errichtet und ist seit 2005 aktiv. Praktisch handelt es dabei um zentrale Institutionen zur Abschottung der EU-Außengrenzen gegen Flüchtlinge.
Die sogenannte Flüchtlingskrise hat seit 2015 weitere Gesetze in Deutschland und allen anderen EU-Mitgliedstaaten hervorgebracht.
Das Asylpaket II und die Asylrechtsnovelle kamen 2016 Schlag auf Schlag. Und immer werden sie in der Öffentlichkeit dargestellt als bessere Integrationsmöglichkeit, als „Fördern und Fordern“ und im Sinne der „Ordnung“, die besonders in Deutschland heilig zu sein scheint. Tatsächlich geht es aber um Begrenzung, Abschottung einerseits und Verschlechterung der Lebensbedingungen der Geflüchteten und der MigrantInnen andererseits. Es werden immer mehr Länder als „sichere“ Herkunftsländer „ausgewiesen“ und damit den Menschen aus diesen Ländern die Möglichkeit genommen, auch nur einen Antrag auf Asyl zu stellen.
Das neueste Gesetz, das in Deutschland eingeführt werden soll, ist das „Integrationsgesetz“. Dieses Gesetz teilt MigrantInnen in neue (legale) Gruppen ein: In Asylberechtigte, in anerkannte Flüchtlinge, in subsidiär Schutzberechtigte und in AsylbewerberInnen mit guter Bleibeperspektive. Letztere sind Menschen, die aus den Ländern Iran, Irak, Syrien, Eritrea und Somalia stammen. Der Begriff „Bleibeperspektive“ erscheint als etwas Positives, tatsächlich ist damit gemeint, dass Menschen aus diesen Ländern wohl nicht in den nächsten Jahren dorthin zurückgeschickt werden können, da ihre Lebensgrundlagen total zerstört sind oder jedes Überleben durch Kriege bzw. militärische Auseinandersetzungen extrem bedroht ist. Der Begriff beinhaltet aber ausdrücklich nicht, dass diese Menschen aus diesen Ländern ein dauerhaftes Bleiberecht erhalten. Alle Geflüchteten werden individuell geprüft. Sie müssen glaubhaft machen, tatsächlich aus gefährlichen Regionen zu kommen und auch ihren Fluchtweg beschreiben. Wenn sie schon in einem anderen EU-Staat registriert worden sind, können sie dorthin zurückgeschickt werden.
Das neue Integrationsgesetz wird uns von der Bundesregierung als „Fordern und Fördern“ der ImmigrantInnen präsentiert und setzt sich aus 7 „Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen“ (FIM) zusammen: 1. Verpflichtende Teilnahme an Integrationskursen, 2. Rechtssicherheit während der Ausbildung, 3. Bessere Steuerung durch Wohnsitzregelung, 4. Verzicht auf Vorrangprüfung, 5. Ausbildung ermöglichen, 6. Niederlassungserlaubnis hängt von „Erfolgreicher Integration“ ab, 7. Einheitliche Regelung zur Aufenthaltsgestattung.
Zuallererst wird aber klargestellt, wer von diesen Maßnahmen ausgeschlossen ist: AsylbewerberInnen aus den sogenannten sicheren Herkunftsstaaten und vollstreckbar Ausreisepflichtige werden nicht in den „Genuss“ besonderer Integrationsmaßnahmen kommen.
Die Menschen mit „Bleibeperspektive“ haben die Möglichkeit, für 6 Monate eine Arbeitsgelegenheit aufzunehmen, der gegenüber Ein-Euro-Jobs noch gut bezahlt sind: bis zu 30 Stunden pro Woche für 80 Cent die Stunde. Diese Maßnahme ist befristet bis 2020. Das Gesetz erlaubt außerdem die Kürzung der Asylbewerberleistungen, wenn Arbeitsgelegenheiten oder Integrationskurse ohne wichtigen Grund abgelehnt oder abgebrochen werden.
Bei Maßnahmen zur Ausbildung und Vorrangprüfung ist mindestens eine Duldung Voraussetzung und natürlich die „Eigenverantwortung“, selber einen Ausbildungsplatz bzw. eine Arbeitsstelle zu finden. Die Vorrangprüfung ist außerdem eine Kann-Regelung und je nach Bedingungen am Arbeitsmarkt von der Agentur für Arbeit umzusetzen oder auch nicht.
Insgesamt führt dies Gesetz zu einer weiteren Verschlechterung der Lage von Geflüchteten und zur weiteren Spaltung der ImmigrantInnen in Integrationswillige und -unwillige und zu mehr repressiven Maßnahmen, sobald sich ImmigrantInnen nicht so anpassen wie gefordert.
Dies ist nur ein grober Überblick über die neuen Gesetze und Regelungen. Sie verdeutlichen, dass die Bundesregierung weit entfernt von einer „Willkommenspolitik“ für die Geflüchteten ist. Vielmehr wurden, seitdem die Geflüchteten 2015 die EU-Außengrenzen zeitweilig durchbrechen konnten, die Gesetze drastisch verschärft. Gerade das „Integrationsgesetz“ zeigt, dass es überhaupt nicht um Integration, sondern rassistische Selektion und Abschottung geht. Es verdeutlicht zugleich, wie viel Energie die imperialistischen Staaten aufwenden, um ihren Reichtum abzusichern.
Imperialistische Politik und Flucht
Der Hauptgrund für die Zunahme von Flüchtlingen im Jahr 2015 ist leicht zu finden. Die meisten kamen aus den Ländern des Nahen Ostens, vor allem aus Syrien, sowie aus den nord- und zentralafrikanischen Staaten und Afghanistan. Die wichtigsten Fluchtgründe sind militärische Auseinandersetzungen, Bürger- oder Bandenkriege im Land. In den Nachbarländern dieser Staaten gibt es schon große Flüchtlingscamps, die nur gerade ein Überleben ermöglichen, aber keinerlei Perspektive bieten können. Auch die absolut minimale Versorgung ist in den ersten Monaten 2016 in einigen Camps zusammengebrochen, weil das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen kein Geld mehr hatte, da etliche Länder ihre Einzahlungen verzögerten.
Dabei befanden sich weltweit noch nie so viele Menschen auf der Flucht vor Krieg, Konflikten und Verfolgung wie heute. Ende 2015 waren es weltweit 63,5 Millionen Menschen. Im Vergleich dazu waren es ein Jahr zuvor 59,5 Millionen, vor zehn Jahren waren es 37,5 Millionen Menschen.
15 Konflikte in den letzten 5 Jahren treiben die Zahl der Menschen auf der Flucht nach oben. Aus Syrien flohen 4,9 Millionen Menschen, 6,6 Millionen sind Inlandsflüchtlinge. 2013 hatte Syrien 22,85 Millionen EinwohnerInnen. Es mussten also fast 50 % aller SyrerInnen ihre Heimat verlassen. Andere Länder, die stark zu Fluchtbewegungen beitragen, sind: Irak, Sudan und Südsudan, Zentralafrikanische Republik, Demokratische Republik Kongo, Burundi, Jemen, Ukraine, Myanmar, Somalia und Afghanistan.
Allein 2015 stieg die Zahl der Menschen auf der Flucht um 12,4 Millionen. Im gleichen Jahr konnten nur 201.400 Flüchtlinge in ihre Heimat zurückkehren. 86 %, also 9 von 10 Flüchtlingen fliehen in Länder, die selbst unter Armut und unsicheren Verhältnissen leiden: in die Türkei (2,5 Millionen), nach Pakistan (1,6 Millionen), in den Libanon (1,1 Millionen), in den Iran (knapp ein Million), nach Äthiopien (736.000) und nach Jordanien (664.000). Die Länder mit den meisten Binnenflüchtlingen sind Kolumbien (6,9 Millionen), Syrien (6,6 Millionen), Irak (4,4 Millionen), Sudan (3,2 Millionen), Jemen (2,5 Millionen), Nigeria (2,2 Millionen), Südsudan (1,8 Millionen), Demokratische Republik Kongo (1,6 Millionen) und Afghanistan (1,2 Millionen).
Die größten Flüchtlingslager sind in Kenia das Lager Dadaab mit über einer halben Millionen Menschen und in Jordanien das Lager Zaatari mit über 100.000 Menschen. Oft gibt es nicht mehr genug zu essen, viel zu wenig Gesundheitsversorgungsangebote und auch nur sehr prekäre und viel zu wenige Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen. Die Möglichkeiten zu arbeiten tendieren gegen null. Das größte Flüchtlingslager der Welt, Dadaab in Kenia, soll aufgelöst werden, da es überwiegend von islamischen Banden und somalischen Clans kontrolliert wird. Wir können also nicht von „Leben“ in den Lagern sprechen, höchstens von Überleben, und auch das ist schwierig, aber eben doch noch besser als in den Heimatländern der Flüchtlinge. Der Aufenthalt in einem Flüchtlingslager ist immer als kurzfristige „Lösung“ angelegt, bis militärische Konflikte beendet sind und die Menschen zurück in ihre Heimat können. Dies trifft zunehmend nicht mehr zu. Die PalästinenserInnen sind schon seit 1948 auf der Flucht und viele von ihnen bis heute in Flüchtlingslagern untergebracht. Das Schicksal teilen immer mehr Menschen. So besteht das Flüchtlingslager Dadaab schon seit 1991 und entwickelte sich zu einer kleiner Stadt. (2)
Aber die Perspektivlosigkeit für die überwiegende Zahl der Flüchtlinge bleibt und die Kapazitäten der Nachbarländer sind mehr als ausgeschöpft. Das ist ein Grund, warum mehr Menschen den überaus gefährlichen, langwierigen und teuren Weg nach Europa suchen. Der andere Grund ist, dass die Grenzabschottung der nordafrikanischen Staaten, vor allem in Libyen, zusammengebrochen ist und bis heute nicht wieder hergestellt werden konnte. Dadurch gab es endlich für hunderttausende Menschen die Möglichkeit, mit relativ „wenig Risiko“ nach Europa zu kommen. Trotzdem ist die Abschottung brutal und das Risiko groß. In den letzten 25 Jahren ertranken mehr als 25.000 Menschen, die nach Europa fliehen wollten, im Mittelmeer und an der europäischen Atlantikküste. In den ersten fünf Monaten 2016 ertranken mindestens 2500 Menschen. Die EU-Politik nimmt dies nicht nur billigend in Kauf, sie macht das Mittelmeer zum Massengrab, das abschrecken soll.
Der Weg aus dem Nahen Osten und Nordafrika ist für die meisten Flüchtenden lang und beschwerlich. An vielen Orten müssen die Menschen Zwangspausen einlegen und oft wochen- und monatelang warten, bis sie weiterziehen können. Jede Teilstrecke kostet Geld, um FluchthelferInnen zu bezahlen. Es hat sich ein System von FluchthelferInnen aufgebaut, das von den Regimes der Länder, aber vor allem von Europa unter dem fragwürdigen Begriff „Schlepperbanden“ zusammengefasst und immer als illegale und zu bekämpfende Struktur dargestellt wird.
Zugleich ist es aber zur Zeit für die meisten Flüchtenden die einzige Möglichkeit, aus ihrer lebensbedrohlichen Lage zu entkommen, und immer noch sicherer, als sich alleine auf den Weg zu machen. Die Preise sind hoch, die Transportwege oft lebensgefährlich und Banden machen damit hohe Profite auch auf Kosten von Menschenleben. Die EU-Kritik an den „Schlepperbanden“ ist jedoch zynisch und verlogen, da ihre Abschottung der Festung Europa dazu führt, dass die Geflüchteten auf solche Geschäftemacher angewiesen sind.
Dabei muss man sehen, dass die Geflüchteten selbst in das System integriert werden, anderen solange helfen, bis sie selbst genug Geld haben, um weiterreisen zu können. Alle Arbeitsmöglichkeiten der Menschen unterwegs nach Europa sind illegal, prekär und sehr gefährlich. Für Frauen gibt es oft nur die Möglichkeit der Prostitution, während Männer im Baugewerbe oder Straßenverkauf ausgebeutet werden. Und überall sind Banden, Unternehmen und Behörden im Hintergrund, die von der Situation der Flüchtlinge profitieren. In den Massenmedien ist aber ausschließlich von den „Schlepperbanden“ und ihren kriminellen Machenschaften die Rede. Das verzerrt das Bild der Situation der Menschen auf der Flucht absolut und zeigt die weltweiten Machtinteressen des Kapitals.
Diese Situation könnte durchaus verändert und verbessert werden, indem Schiffe und andere Transportmöglichkeiten für die Geflüchteten zur Verfügung gestellt werden, um die Flüchtlinge sicher und rasch in die Länder der EU zu bringen. Doch genau das ist nicht gewollt. Die jetzige Situation verlängert das Elend der Menschen, die ihre Heimat verlassen mussten, um eine weitere traumatisierende Erfahrung langer Flucht. Diese „Abschreckung“ ist gewollt und gemacht.
Frauen, Jugendliche, sexuelle Unterdrückung
Geflüchtete Frauen und Arbeitsmigrantinnen zählen zu den unterdrücktesten Schichten der Gesellschaft. Sie sind mehrfach unterdrückt als Frauen und als Ausländerinnen und werden als Arbeitskräfte ausgebeutet. Dabei gewinnt auch die Frauenunterdrückung ein doppeltes Gewicht. Einerseits verschärft sich hier noch der patriarchalische Zug der Familie, andererseits sind sie als ausländische Frauen noch verstärkt den unterdrückerischen Mechanismen der hiesigen Gesellschaft unterworfen.
Trotz aller staatlichen und gesellschaftlichen Schikanen blieben mehr und mehr Migranten dauerhaft. Sie wurden unterprivilegierter Teil der Gesellschaft, für den eine Rückkehr in die „Heimat“ immer mehr in die Ferne rückte. Somit entstand aber auch das Bedürfnis, die eigenen Familienangehörigen nachzuholen. Viele der Frauen waren ursprünglich in erster Linie Hausfrauen und wurden erst allmählich in den Arbeitsmarkt als häusliche Hilfs-, Teilzeit- oder ungelernte Kräfte, teilweise als Mithelfende im Betrieb von Verwandten integriert. Das trifft vor allem für aus der Türkei Eingewanderte zu. Die Arbeitsmigrantinnen aus den osteuropäischen Ländern wurden oft viel rascher als billige Arbeitskräfte integriert, ja für bestimmte Berufe v. a. im Pflegebereich werden direkt Frauen angeworben.
Wenn wir von der Lage der Arbeitsmigrantinnen sprechen, so unterscheidet sich diese zwischen verschiedenen Nationen beträchtlich, so wie auch das Ausmaß rassistischer Unterdrückung und der rechtliche Status sehr unterschiedliche Formen annehmen.
Zweifellos gibt es eine widersprüchliche Tendenz zu Verfestigung wie Aufbrechen tradierter partriarchaler Strukturen unter den MigrantInnen. Die doppelte Arbeitsbelastung im Haushalt und in 9- oder 10-Stundenjobs und das durch patriarchalischen Zwang eingeengte soziale Milieu führen dazu, dass proletarische Immigrantinnen kaum politisch oder gewerkschaftlich organisiert sind. Mit den ausländischen Frauen hat sich das Kapital eine besonders billige und wehrlose Arbeitskraftreserve erschlossen. Reaktionäre und konservative Familien, Gewalt, Unterdrückung von migrantischen Frauen tragen das Ihre dazu bei, ihren Kontakt mit anderen Frauen zu erschweren.
Das Haupthindernis für das Durchbrechen ihrer gesellschaftlichen Unterdrückung ist jedoch der Rassismus einschließlich dessen deutscher „KollegInnen“. Frauen werden von den Gewerkschaften oft noch mehr vernachlässigt als ihre männlichen Kollegen.
Jugendliche MigrantInnen und Geflüchtete, die oft auch unbegleitet kommen, sind ebenfalls einer besonderen Unterdrückung ausgesetzt. Sie stehen unter Generalverdacht, organisierte Diebstähle und Drogenhandel zu betreiben. Jugendliche MigrantInnen, die hier geboren wurden, gelten noch immer als „AusländerInnen“, selbst wenn sie mit dem Herkunftsland ihre Eltern oder Großeltern kaum noch etwas verbindet. Allein auf diese Art manifestiert sich alltäglich rassistische Ausgrenzung. Die Jugendlichen gehören zu den unterdrücktesten Schichten. In der Schule, in der Ausbildung werden sie benachteiligt. Minderjährige, unbegleitete, geflüchtete Jugendliche werden, wenn möglich, in Wohngruppen untergebracht, von der Bürokratie schikaniert und ansonsten vor allem sich selbst überlassen. Sie werden nicht in Schulen integriert, solange sie keinen „geklärten“ Status haben. Während ihnen mangelnde „Integrationsbereitschaft“ vorgeworfen wird, fehlt es an Deutschkursen und Möglichkeiten gemeinschaftlicher sportlicher und kultureller Betätigung.
Geflüchtete und migrantische LGBTIA-Menschen (Lesben, Schwule, bisexuelle, transsexuelle, intersexuelle und asexuelle Menschen) sind ebenfalls extremen Anfeindungen ausgesetzt. Sie treffen meistens auf heterosexuelle, repressive Sexualmoral und Normen von MitbewohnerInnen wie in der hiesigen Bevölkerung. So sind die in Unterkünften Unterdrückung und Gewalt ausgesetzt, die bei den Behörden reproduziert werden, vor denen sie sich outen oder denen sie ihre sexuelle Orientierung „beweisen“ müssen.
Rassismus verfestigt die Unterdrückung der Frauen, Jugendlichen, sexuell Unterdrückten – und gleichzeitig deren Ausbeutung, prekäre Lage und Stigmatisierung. Auch hier zeigt sich, dass der Kampf gegen den Rassismus ein integraler Bestandteil des Klassenkampfes ist.
Die deutsche Linke und der Kampf gegen den Rassismus
In den vorhergehenden Teilen haben wir einen Abriss der Grundlagen des Rassismus und seiner aktuellen Verschärfung dargelegt. Wir haben dabei gezeigt, dass er untrennbar mit Kapitalismus und Imperialismus verbunden ist, vor allem der politischen, ökonomischen und ideologischen Einbindung der ArbeiterInnenklasse in das politische und ökonomische Gesamtgefüge der bürgerlichen Gesellschaft. Das erklärt einerseits, wie Rassismus und Nationalismus die Lohnabhängigen spalten und verschiedene Teile gegeneinander in Stellung bringen. Es verdeutlicht aber auch, dass nur die ArbeiterInnenklasse ein objektives, materielles Interesse haben kann, diese Spaltung der Gesellschaft zu überwinden, dass nur sie das Subjekt eines Kampfes sein kann, der nicht nur diese spezifische Form der Unterdrückung, sondern auch ihre sozialen Wurzeln angreift und überwindet.
Den MigrantInnen, ethnisch, national oder rassistisch Unterdrückten und den Geflüchteten kommt in diesem Kampf eine Schlüsselrolle zu. Damit die ArbeiterInnenklasse überhaupt zur führenden Kraft des Kampfes gegen Rassismus werden kann, müssen auch alle Hindernisse überwunden werden, die die besonders unterdrückten Teile der Lohnabhängigen in ihren eigenen Organisationen, v. a. in den Gewerkschaften benachteiligen und diskriminieren. Daher ist der Kampf gegen Sozialchauvinismus, rassistische Vorurteile sowie gegen alle Hindernisse für die gleiche Teilnahme an der Bewegung (z. B. fehlende Übersetzung und Informationen in den verschiedenen Sprachen) ein unverzichtbarer Bestandteil einer solchen Politik. Dazu sind auch besondere Maßnahmen notwendig, seien es Übersetzungen bei Sitzungen und Versammlungen, sei es das Recht auf gesonderte Treffen (Caucus) der MigrantInnen in den Organisationen der ArbeiterInnenbewegung.
Vor allem aber muss sich jede linke Strategie, jede Bündnispolitik auch daran messen lassen, wie sie Anti-Rassismus in einen anti-kapitalistischen Kontext stellt, ob und wie sie die ArbeiterInnenklasse dabei zur führenden Kraft machen will. Nur so kann die These, dass der Kampf gegen Rassismus wie gegen jede Form der Unterdrückung integraler Bestandteil des Klassenkampfes ist, mit Leben gefüllt werden.
Die Linkspartei – vorwärts zum Sozialstaat zurück
Es ist eine gängige Mode geworden, die Linkspartei und ihre Politik anhand der sozialchauvinistischen Ergüsse von Wagenknecht und Lafontaine zu kritisieren oder aufgrund der Umsetzung des „üblichen“ Programms des staatlichen Rassismus durch die Thüringer und Brandenburger Landesregierungen. Wir wissen außerdem auch alle, dass für die Spitzen der Linkspartei Abschiebungen kein Hinderungsgrund sind, in eine Regierungskoalition einzutreten oder diese zu dulden. Antirassismus ist für die Linkspartei sicher keine „Haltelinie“, wenn es ums Mitverwalten der Krise und des Kapitalismus geht.
Immerhin gibt es in der Partei Widerspruch zu dieser Politik, die vor allem vom linken Flügel der Linkspartei kommt und der sich auch in den Beschlüssen von Parteitagen oder Verlautbarungen der Parlamentsfraktion wiederfindet. Nachdem die Antikapitalistische Linke (AKL) Sahra Wagenknecht lange mit Samthandschuhen angefasst hat, hat sie sich schließlich von deren ständig wiederkehrenden „missverständlichen“ Rufen nach Begrenzung der Migration und mehr polizeilicher Überwachung distanziert. Dass es einige Schwachköpfe gibt, die dennoch weiter Unterschriften für Wagenknecht (!) sammeln, zeigt zwar, welche Leute sich am rechten Rand der „Linken“ tummeln, ist aber zum Glück politisch nebensächlich.
Es ist aber auch eine gängige Methode, dass viele Linke diesen Schandtaten entgegenhalten, dass die Linkspartei eigentlich gute Positionen im Kampf gegen den Rassismus vertreten, dass es sich bei Wagenknecht und Ramelow um „Ausrutscher“ handeln würde. Richtig daran ist, dass deren Handlungen durch keine Parteitagsbeschlüsse gedeckt sind – was allerdings auch die Frage aufwirft, warum diese, von der rituellen Empörung abgesehen, regelmäßig folgenlos bleiben. Ein Grund dafür ist, dass auch die Linkspartei über keine an die Wurzeln gehende Kritik und Analyse des Rassismus verfügt, geschweige denn über eine konsequente Programmatik.
Das verdeutlicht auch der Beschluss des Magdeburger Parteitages „Für Demokratie und Solidarität! Gegen den Rechtsruck!“ (3) vom 28./29. Mai 2016. Dort heißt es:
„Die Prinzipien Freiheit, Gleichheit und Solidarität, die Fundamente sowohl der Aufklärung als auch der Demokratie, sind in Europa bedroht wie nie zuvor. Auch die Bundesrepublik steht am Scheideweg. Rückt sie politisch weiter nach rechts, werden die demokratischen und humanistischen Grundlagen der Gesellschaft weiter abgebaut, dann droht eine Entwicklung wie in Ungarn und Polen, Dänemark und Frankreich. Als LINKE setzen wir dem unsere Vision einer offenen, menschlichen und egalitären Gesellschaft entgegen, gegen die Positionen des rechten Kulturkampfes streiten wir für eine solidarische Alternative.“ (4)
An anderer Stelle erklärt die Linkspartei, dass die Bundesregierung und generell die neo-liberale kapitalfreundliche Politik in der EU die soziale Spaltung der Gesellschaft vertiefen und für das Wachstum von Rassismus und Rechtspopulismus verantwortlich sind.
„Das Agieren der Großen Koalition in ihrer Flüchtlings-, Integrations-, Infrastruktur- und Sozialpolitik führt dazu, dass Konflikte und Spaltungen in der Gesellschaft immer weiter zunehmen. Gesellschaftliche Gruppen werden gegeneinander ausgespielt und in Konkurrenz um Arbeitsplätze, Löhne, Wohnungen und Sozialleistungen gesetzt. Die Bundesregierung sieht es nicht als ihren Auftrag an, die Gesellschaft sozial zusammenzuhalten, in öffentliche Infrastruktur und Soziales zu investieren, bezahlbare Wohnungen zu bauen und leerstehende zur Verfügung zu stellen, für ausreichend Personal zu sorgen, Kommunen zu entlasten und auskömmliche Sozialleistungen zu garantieren, geschweige denn auszubauen, um Konflikte in der Gesellschaft abzubauen. Die Bundesregierung ist in erster Linie Sachwalterin von Kapitalinteressen.“ (5)
Hier gibt sich die Partei schon fast radikal und, wer hätte das gedacht, „entlarvt“ die Große Koalition als Sachwalterin der Kapitalinteressen.
Die Linkspartei erkennt zwar an, dass es eine kapitalistische Wirtschaftsordnung gibt. Dass diese jedoch aus ihrer eigenen Widersprüchlichkeit zur Krise treibt, dass auch die „sozialste“ und „demokratischste“ Regierungspolitik diese nicht aufhalten kann – davon will sie nichts wissen.
Zwar kritisiert sie die Regierung dafür, dass sie Kapitalinteressen verfolgt. Die staatlichen Institutionen der bürgerlichen Gesellschaft und vor allem „die Demokratie“ erscheinen ihr jedoch als die geeigneten Mittel, um die Spaltung der Gesellschaft zu mildern, wenn nicht gar zu überwinden.
„Wir haben ein Problem mit Rassismus und Rechtspopulismus. Es an der Wurzel zu packen, heißt, die soziale Spaltung der Demokratie zu bekämpfen. Nur so können demokratische Institutionen wieder gestärkt werden. Immer mehr sind draußen, immer weniger gehören dazu.“ (6)
Und weiter unten:
„DIE LINKE fordert eine soziale Offensive für alle, die Investitionsprogramme für öffentliche Infrastruktur und Integration auflegt, den Staat handlungsfähig macht mit mehr Personal im öffentlichen Dienst, bezahlbaren Wohnraum schafft, Armut bekämpft, Sozialstaat und Daseinsvorsorge stärkt, Kommunen und Länder entlastet, den gesetzlichen Mindestlohn ausnahmslos für alle auf zwölf Euro anhebt und endlich auch die Reichen und Steuerflüchtlinge ins Steuer- und Sozialversicherungssystem integriert. Geld ist genug da, aber völlig ungerecht verteilt. Uns ist bewusst, dass eine soziale Offensive nicht dafür sorgt, dass es auch nur eine Rassistin oder einen Rassisten weniger in Deutschland gibt! Eine soziale Offensive ist ein erster notwendiger Schritt, um die soziale Schieflage zu beseitigen und Gesellschaft zu stabilisieren. Um Menschen zu ermutigen, sich an der Demokratie zu beteiligen, muss ihnen die Angst vor dem sozialem Abstieg genommen werden.“ (7)
Konkrete Forderungen nach Verbesserungen sind sicher korrekt. Gesetzlicher Mindestlohn, Armutsbekämpfung, Besteuerung der Reichen, Infrastrukturausbau, bezahlbarer Wohnraum – all das sind richtige Kampfziele, für die alle Organisationen der ArbeiterInnenklasse gemeinsam kämpfen sollten.
Aber die Linkspartei kombiniert diese Forderungen mit einer illusorischen Hoffnungsmacherei. Die „soziale Offensive“ würde die Gesellschaft stabilisieren, mehr soziale Rechte würden so den Menschen die „Angst vor sozialem Abstieg nehmen“. Den Kapitalismus zu überwinden, eine sozialistische Revolution durchzuführen, zu verteidigen und die Gesellschaft auf Grundlage einer räte-demokratischen und planwirtschaftlichen, an den Bedürfnissen der Menschen ausgerichteten Planung zu reorganisieren, ist schwer. Auch ein revolutionärer Umsturz und die Machtergreifung des Proletariats werden den Menschen nicht mit einem Schlag ihre Ängste vor sozialen Verwerfungen nehmen. Aber eine sozialistische Revolution, so schwer sie sein mag, ist möglich, ja notwendig.
Eine kapitalistische Marktwirtschaft, in der es keine Angst vor sozialem Abstieg geben soll, ist jedoch einfach utopisch, ein Ding der Unmöglichkeit, zumal in einer globalen Krisenperiode. Dass sich der deutsche Kapitalismus von der Rezession 2008 relativ rasch erholte und als sehr konkurrenzfähig erwies, hat er auch seiner enormen produktiven und finanziellen Basis zu verdanken, die auf extremer Produktivität und Ausbeutung, Ausweitung des Billiglohnsektors und imperialistischen Extraprofiten beruht.
Es ist zwar möglich, dass auch in Krisenperioden Verbesserungen erkämpft werden, aber diese werden bei der nächsten Gelegenheit von der herrschenden Klasse in Frage gestellt werden. Substanzielle Reformen spitzen die gesellschaftlichen Widersprüche weiter zu, weil sie erstens den Spielraum der herrschenden Klasse einengen und zweitens eine umfassende Klassenmobilisierung der Lohnabhängigen und Unterdrückten erfordern, also eine Zuspitzung des Klassenkampfes. Kurzum, sie bringen nicht mehr Stabilität, sondern Instabilität.
Die Linkspartei streut ihren AnhängerInnen und wohl auch sich selbst Sand in die Augen. Sie verspricht eine Restabilisierung des Kapitalismus, eine Rückkehr zur angeblich guten alten sozialen Marktwirtschaft, zu einer bestimmten Phase des sozialstaatlich vermittelten Klassenkompromisses, dessen ökonomische Basis jedoch längst und unwiederbringlich erodiert ist.
So wie die Linkspartei dem Kapitalismus und seinen Gesetzmäßigkeiten die Rückkehr zu einer imaginierten sozial regulierten Marktwirtschaft gegenüberstellt, indem sie die negativen Seiten dieser Produktionsweise von ihren „positiven“ betrennt, so erscheint ihr auch der politische und staatliche Überbau, der auf eben dieser Eigentumsordnung fußt, als das Mittel, den Kapitalismus zu zähmen. Die „schlechten“ Seiten erblickt sie in einer falschen Politik. Die Lösung besteht in einer „Umkehr“ zu einer Politik für alle Klassen.
Der Staat und die Bürokratie erscheinen ihr nicht als Herrschaftsinstrumente des Kapitals, sondern als Instrumente, die grundsätzlich allen gesellschaftlichen Gruppen gleichermaßen zur Verfügung stünden. Der Staat müsse nur „ausgebaut“, ausfinanziert und den „richtigen“ politischen Imperativen untergeordnet werden.
Im politischen Arsenal der Linkspartei kommt daher die Mobilisierung der ArbeiterInnenklasse, der Kampf auf der Straße und in den Betrieben zur Umsetzung ihrer Forderungen nicht oder allenfalls am Rande vor. Sie präsentiert kein Programm des Klassenkampfes, sondern der „vernünftigen“, für alle Klassen der Gesellschaftlich akzeptablen Organisation des Kapitalismus.
Auch wenn sich die Linkspartei für das Asylrecht ausspricht und gegen Abschiebungen und „Obergrenzen“, so will sie doch bei der Organisierung der „Flüchtlingsbetreuung“ nicht auf die repressiven staatlichen Institutionen verzichten (Polizei, Ausländerbehörden, …), deren struktureller Rassismus hinlänglich bekannt ist. Die Linkspartei setzt hier ohne Wenn und Aber auf den bürgerlichen Staat und seine Organe, die allenfalls „demokratisiert“ und „politisch korrekt“ ausgerichtet werden sollen.
Die Partei stellt zwar eine Reihe sozialer und demokratischer Forderungen auf, über den Ausbau der bürgerlichen Demokratie geht sie aber nicht hinaus. Das trifft auf die „Demokratisierung“ oder „Wiederherstellung“ demokratischer Institutionen zu. Das zeigt sich aber auch bei ihrer Vision einer „Wirtschaftsdemokratie“, die auf dem Boden einer, allenfalls erweiterten, „Mit“bestimmung stehen bleibt.
Nirgendwo wirft sie die Frage nach Kontrolle z. B. des Wohnungsbaus durch Komitees von MieterInnen, Gewerkschaften, Flüchtlingen auf, ja es gibt nicht einmal Überlegungen, wie ein gemeinsamer Kampf geführt werden könnte, der sich vor allem auf die ArbeiterInnenklasse stützt.
Besonders deutlich wird das, wenn es um Fragen der Sicherheit der Geflüchteten, von MigrantInnen wie auch von linken UnterstützerInnen geht. Dabei ist das angesichts zunehmender Überfälle, Brandanschläge auf Einrichtungen, Wohnheime, Wohnungen und Personen eine unmittelbar praktische Frage. Hier kritisiert die Linkspartei letztlich nur, dass bei der Polizei und bei der Überwachung der Rechten zu viel gespart würde. Von organisierter Selbstverteidigung, von Plänen zur Mobilisierung von Beschäftigten in Betrieben oder aktiven AntirassistInnen in den Wohngebieten im Fall von Übergriffen oder größeren Überfällen und Mobilisierungen von Rechten – also alles Fragen, wo AntirassistInnen aufhören, sich auf die rassistische Polizei zu verlassen – will die Linkspartei nichts wissen.
Daher wären genau das Formen der direkten Organisierung in Nachbarschaftskomitees, gemeinsame Aktionsstrukturen, die zugleich mit der Selbstorganisation von Geflüchteten und UnterstützerInnen einhergingen. Eine solche Perspektive könnte in Betriebe und Gewerkschaften getragen werden, indem einzelne Belegschaften, deren VertreterInnen (Vertrauensleutekörper, Betriebsräte) oder eigens geschaffene Aktionskomitees direkt Verbindung mit Flüchtlingen aufnehmen. Solche müssten natürlich nicht nur auf die Verteidigung gegen Übergriffe von Nazis, RassistInnen oder der Polizei beschränkt bleiben, sondern könnten auch zu Strukturen werden, um gemeinsam für soziale Forderungen einzutreten.
Ein solches, breites Bündnis auf einer soliden Klassenbasis streben wir letztlich an. Wir wissen, dass es nicht nur „von unten“ entstehen wird, auch wenn lokale Initiativen und Ansätze dazu eine wichtige Beispielwirkung entfalten könnten. Dies müsste aber mit der beständigen Forderung an alle Organisationen der ArbeiterInnenklasse, vor allem an die Gewerkschaften, verbunden werden, ein bundesweites Aktionsbündnis zu schaffen.
Die Linkspartei will jedoch einen anderen Kurs einschlagen:
„Um eine breite Gegenbewegung gegen die politische Rechte anzustoßen, müssen sich die Kräfte bündeln. Bundesweite Initiativen sind entstanden, die beides noch enger zusammenbringen: Geflüchtete willkommen – Rassisten entgegentreten! Wir brauchen ein gesellschaftliches Bündnis gegen rechts, eine breite antirassistische Koalition aus zivilgesellschaftlichen Organisationen, Parteien, Gewerkschaften, Kirchen und jüdischen und muslimischen Religionsgemeinschaften, Wohlfahrtsverbänden, Studierenden, Migrantinnen und Migranten, Flüchtlingsinitiativen, Künstlerinnen und Künstlern und antifaschistischen Organisationen.“ (8)
Was der Linkspartei hier vorschwebt, ist keine ArbeiterInneneinheitsfront gegen Rassismus, sondern ein „breites Bündnis“, das Parteien und Vereinigungen aller Klassen beinhalten soll – bis hin zur FDP oder auch der CDU/CSU.
Zweifellos ist es richtig, dass es gegen die RassistInnen, RechtspopulistInnen und die staatliche rassistische Politik eine Massenbewegung, ein Bündnis von Massenorganisationen braucht. Wenn die ArbeiterInnenklasse zum entscheidenden Subjekt des Kampfes werden soll und muss, müssen RevolutionärInnen diese Forderungen aber an alle Parteien und Organisationen richten, die sich historisch und sozial auf diese Klasse stützen, aus der ArbeiterInnenbewegung kommen und diese zu vertreten beanspruchen. Daher ist es unserer Meinung nach notwendig, diese Forderung auch an die Gewerkschaften, die Linkspartei und die SPD zu richten – nicht weil wir denken, dass diese dem bereitwillig folgen werden, sondern weil das ein unerlässliches Mittel ist, die reformistischen und gewerkschaftlichen Führungen in den Augen ihrer AnhängerInnen und Mitglieder dem Praxistest zu unterziehen.
Wir halten es für falsch, diese Ausrichtung auf offen bürgerliche Parteien zu erweitern oder auf die Kirchen. Natürlich geht es nicht darum, deren Mitgliedern oder einzelnen RepräsentantInnen die Teilnahme an anti-rassistischen Aktionen und Demonstration zu „verbieten“. Aber es geht darum, dass es keine politischen Zugeständnisse, keine Unterordnung unter diese geben darf, nur um eine „einheitliche“ Aktion hinzukriegen.
Es geht vielmehr darum, die Einheit einer Klasse herzustellen und diese auch mit den sozialen Forderungen zu verbinden – nicht, weil dann alles wieder gut und stabil wird, sondern weil so eine soziale Kraft entsteht, die den Rechten und ihrem rabiaten Rassismus Paroli bieten und deren Behauptung praktisch und öffentlich entlarven kann, dass Rechtspopulisten wie die AfD, Bündnisse wie Pegida, die „antisystemische“ Kraft wären.
Die strategische Einheit von Linken mit allen staatstragenden Kräften, das Bündnis bis zur CDU und zum Bundespräsidenten geht nicht nur unvermeidlich mit dem Verzicht einher, den staatlichen Rassismus zu bekämpfen und auf alles zu verzichten, was den Legalismus der Versammlungsbehörden überschreitet. Noch wichtiger ist, dass so die rechten Demagogen auf der Klaviatur ihres eigenen Populismus spielen können. Der Rechts-Populismus, dessen Anwachsen wir in ganz Europa erleben, geriert sich als eine „antisystemische“ Kraft, die gegen „das Kartell“ und die „Lügenpresse“ antreten würde. Klassenübergreifende Bündnisse, wie sie von den reformistischen und gewerkschaftlichen Führungen angestrebt werden, wirken nur als Bestätigung der rechten Propaganda. Letztlich, wird jeder rechte Stammtischhetzer vorbringen, paktieren die Linken mit Kapital und Establishment gegen die „WutbürgerInnen“, die ArbeiterInnenorganisationen mit ihren Ausbeutern.
Das zeigt, dass ohne Klassenorientierung dem Rechts-Populismus einer AfD letztlich nicht beizukommen ist, vor allem sobald er angefangen hat, größere, wenn auch politisch rückständige Teile der Lohnabhängigen zu ergreifen.
„Aufstehen gegen Rassismus“
Das Bündnis „Aufstehen gegen Rassismus“ wird von der Linkspartei offiziell unterstützt und gemeinsam mit linken Gewerkschaften, linker Sozialdemokratie, Attac und post-autonomen Kräften (Interventionistische Linke) prägt sie dieses Bündnis.
Zweifellos ist es notwendig und richtig, sich an den Aktionen von „Aufstehen gegen Rassismus“ zu beteiligen wie auch von diesem zu fordern, sich zusammen mit anderen Bündnissen in eine bundesweite Einheitsfront zu transformieren. Doch davon ist „Aufstehen gegen Rassismus“ leider noch weit entfernt.
Erstens teilt das Bündnis die klassenübergreifende Konzeption, die auch die Linkspartei in ihrem Parteitagsbeschluss vertritt. „Wir rufen alle Menschen, zivilgesellschaftliche Akteure und Bündnisse, Gewerkschaften, Jugendorganisationen, Kulturschaffende, Religionsgemeinschaften und Parteien dazu auf, mit uns gemeinsam die Demonstration und das Konzert am 3.9. in Berlin zu mobilisieren und durchzuführen.“ (9)
Zweitens fällt auf, dass der Aufruf kaum konkrete Forderungen enthält.
„Wir werden weiterhin Geflüchtete mit offenen Armen empfangen. Denn Asyl ist Menschenrecht.
Wir werden uns stark machen für gleiche politische und soziale Rechte für alle Menschen.
Wir stehen an der Seite der Muslime und aller anderen, die rassistisch diskriminiert und bedroht werden.
Wir wenden uns gegen jede gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit wie Antisemitismus, Islamfeindlichkeit, Antiziganismus und jede andere Form des Rassismus, Homophobie und Frauenfeindlichkeit.“ (10)
Das sind Absichtserklärungen oder allgemeine Formeln. Um ein Bündnis zu schaffen, wären aber konkrete Forderungen viel wichtiger wie zum Beispiel: Gegen alle Abschiebungen! Nein zu den sog. „Integrationsgesetzen“! Für sozialen Wohnbau, finanziert durch Unternehmensgewinne, Kontrolle der Mietpreise durch Mieterkomitees und Beschlagnahme leer stehenden Wohnraums zur Unterbringung von Geflüchteten wie allen anderen Wohnungssuchenden.
Der Satz „Wir stehen an der Seite der Muslime und aller anderen, die rassistisch diskriminiert und bedroht werden“ müsste durch die Losung der organisierten Selbstverteidigung und ihrer Unterstützung durch das Bündnis ergänzt werden. Ansonsten verkommt er zu einem folgenlosen Lippenbekenntnis.
Vor allem aber beschränkt sich ‚Aufstehen gegen Rassismus‘ fast ausschließlich auf die Mobilisierung gegen die AfD, während die verstärkten Angriffe der Bundesregierung, die Abriegelung der EU-Außengrenzen, die schäbigen Deals mit der Türkei und mit afrikanischen Staaten zum Stopp der Geflüchteten unerwähnt bleiben.
Statt konkrete Forderungen gibt es Allerweltsphrasen: “Wir stehen für eine offene und gerechte Gesellschaft. Wir lassen nicht zu, dass Menschen gegeneinander ausgespielt werden. Wir wollen Solidarität, Zusammenhalt und ein besseres Leben für alle!“ (11)
„Aufstehen gegen Rassismus“ begreift sich nicht in erster Linie als Aktionsbündnis, sondern als „Aufklärungskampagne“. Daher ist neben Konferenzen und einzelnen Demos ihr Hauptinstrument die Ausbildung von AufklärerInnen, im eigenen Jargon: „StammtischkämpferInnen“.
„Eines der Herzstücke der ‚Aufstehen gegen Rassismus‘-Kampagne sind unsere Ausbildungen zu StammtischkämpferInnen. Dafür brauchen wir Trainer_innen!“ (12) Diese sollen Menschen, die mit rassistischen Äußerungen konfrontiert sind, in Seminaren Folgendes vermitteln:
„Hier wollen wir ansetzen und mit den Schulungen Menschen in die Lage versetzen, die Schrecksekunde zu überwinden, Position zu beziehen und deutlich zu machen: Das nehmen wir nicht länger hin!
Dazu wollen wir in Trainings uns mit Strategien beschäftigen, die uns ermöglichen, den Parolen der AfD und ihrer Anhänger Paroli zu bieten, wir wollen gängige rechte Positionen untersuchen und wir wollen gemeinsam üben, das Wort zu ergreifen und für solidarische Alternativen zu streiten statt für Ausgrenzung und Rassismus.“ (13)
Sicherlich ist es notwendig, dass Menschen lernen, wie sie rassistischen Äußerungen Paroli bieten und wie sie darauf schlagfertig antworten. Eine Strategie, der AfD, rassistischen oder faschistischen Organisationen den Boden zu entziehen, ist das aber nicht.
Der Kampf gegen den stärker werdenden Rassismus ist im Grund eine Frage, welche Klasse einen Ausweg aus der tiefen Krise der gegenwärtigen Gesellschaft zu bieten vermag, welche Klasse eine Antwort auf die Zerrüttung der Lebensverhältnisse gibt. Die „Mitte“ hat immer weniger zu bieten. Die Linkspartei und letztlich auch „Aufstehen gegen den Rassismus“ orientieren aber darauf, den „Zusammenhalt“ der Gesellschaft, den es früher gegeben haben soll, wiederherzustellen.
Das ist aber utopisch. Es ist daher notwendig, Aktionsbündnisse um konkrete soziale und demokratische Forderungen herum zu schaffen. Allgemeine „Aufklärungsparolen“ greifen hier zu kurz. Werden sie zum Kern eines „Bündnisses“ erhoben, so geht die Sache überhaupt ins Leere. Der anti-rassistische Kampf wird durch einen Seminarraum ersetzt. Rassismus wird zu einer Massenkraft nicht in erster Linie wegen fehlender Aufklärung, schlechten Schulunterrichts, sondern weil er eine reaktionäre Antwort auf den drohenden Zerfall der gesellschaftlichen Grundlagen zu bieten scheint, während die ArbeiterInnenbewegung keine Perspektive zu weisen vermag.
In diesem Kontext muss übrigens auch die strategische Bedeutung von anti-rassistischen Aktionsbündnissen der ArbeiterInnenklasse und der Unterdrückten gesehen werden. Es geht hier zum ersten natürlich darum, möglichst große Aktionen für konkrete Ziele und Forderungen durchzuführen. Es geht aber auch darum, dass in diesen Aktionen ein Bewusstsein der Gemeinsamkeit, der Einheit der Unterdrückten entsteht und so eine Basis für Kämpfe um weitergehende Ziele gelegt wird.
Die „Stammtischkämpferausbildung“ ist davon völlig losgelöst. Das zeigt sich auch darin, dass erst gar nicht in Erwägung gezogen wird, die Stärkung der Argumentationskraft als Teil des Aufbaus einer Bewegung mit betrieblichen oder lokalen Strukturen zu stellen. Die „StammtischkämpferInnen“ sind EinzelkämpferInnen, AufklärerInnen, nicht Teil einer Bewegung, die es vor allem zu schaffen gilt.
Die Interventionistische Linke (IL)
Um „Aufstehen gegen Rassismus“ gruppieren sich nicht nur reformistische und gewerkschaftliche Gruppierungen, sondern mit der IL auch eine Teil der „post-autonomen“, radikalen Linken.
In ihrem Aufruf zur Demonstration „Grenzenlos feministisch. Grenzenlos antikapitalistisch – Grenzenlos solidarisch!“ (14) betont die IL zwar die Frage der „offenen Grenzen“, der Text konzentriert sich aber fast ausschließlich auf die Frage der AfD. Durchaus pointiert greift sie deren reaktionären Gehalt an, deren Frauenfeindlichkeit und Unterstützung jeder noch so reaktionären, repressiven Marotte aus der „Herrensauna“.
Dem Aufruf der IL wie auch anderen ihrer Stellungnahmen mangelt es jedoch an Analyse und vor allem an Forderungen und Perspektive. Dem reaktionären Bezug auf die Kleinfamilie hält die IL in ihrem Aufruf das „selbstbestimmte Individuum“ entgegen: „Nicht freie, selbstbestimmte Individuen, sondern die heterosexuelle Kleinfamilie sei die Keimzelle der Gesellschaft.“ (15)
Hier wird der altbackenen, rückwärtsgewandten Ideologie des AfD-Konservativismus die ideologische Fiktion des Liberalismus gegenübergestellt, demzufolge die Gesellschaft eine Summe „freier und selbstbestimmter“ Einzelner wäre. Das „freie Individuum“, ein beschönigendes Codewort für das bürgerliche Individuum, ist selbst ein historisches Produkt, ein großer Fortschritt gegenüber vorkapitalistischen Gesellschaftsformationen. Frei und selbstbestimmt ist es natürlich nur so weit, wie es KäuferIn und VerkäuferIn der Ware Arbeitskraft auf dem Boden einer verallgemeinerten Warenproduktion sein kann. Es ist kein Zufall, dass das Individuum umso „freier“ zu sein vorgibt, je mehr es dem unmittelbaren Zwang zum Verkauf seiner Arbeitskraft entbunden scheint. Es ist kein Zufall, dass eine ihrer politischen Ausrichtung nach kleinbürgerliche Gruppierung wie die IL dem „Frauenbild“ des Konservativismus das Menschheitsideal des Liberalismus entgegenhält.
Mag diese Passage auch etwas unüberlegt in den Aufruf der IL gekommen sein, so enthält sie doch einen zentralen Gesichtspunkt, der ihre politische Strategie und Vorstellung vom anti-rassistischen Kampf prägt.
Das Subjekt gesellschaftlicher Veränderungen ist nicht die ArbeiterInnenklasse. Vielmehr ist deren Existenz wie die Verwendung des Klassenbegriffs für Post-Autonome ohnedies fragwürdig geworden. Eine Bewegung ist für sie vor allem eine Bewegung von einzelnen, von möglichst „selbstbestimmten Individuen“.
Auch wenn die IL aus einem anderen Begründungszusammenhang kommt als die Linkspartei, so tritt auch sie für „möglichst breite“ Bündnisse ein. Nennt die Linkspartei noch die Akteure als kollektive Akteure, sind es bei der IL vor allem „die Menschen“:
„Sollen wir also nicht mehr blockieren, demonstrieren? Nein – PEGIDA und ähnliche Phänomene müssen auf der Straße gestoppt werden, in breitestmöglichen Bündnissen. Doch die Begründung darf nicht eine des ökonomischen Kalküls sein. Im Gegenteil: Protest gegen Pegida muss Protest sein gegen die Logik der herrschenden Verhältnisse:
– Gegen Niedriglohn und Prekarisierung in Deutschland
– Gegen den Export dieses Sozialkahlschlags durch Austeritätspolitik in Europa
– Gegen das Sterben an den Außengrenzen der EU, organisiert von ‚demokratischen‘ Regierungen
– Gegen Militäreinsätze von NATO und EU-Staaten, die wie in Libyen Flüchtlingselend erzeugen.“ (16)
Die IL erhebt hier zwar einige Forderungen, diese bleiben aber insgesamt recht allgemein. Das trifft vor allem auf ihren Aufruf zum ersten 3. September zu:
„Unsere Alternative: Grenzenloser Feminismus!
Gleichberechtigung herrscht weder in Deutschland noch anderswo. Geschlecht und sexuelle Orientierung sind viel zu wenig anerkannte Fluchtgründe. Betroffene von Zwangsheirat, Genitalverstümmelung, mangelndem Zugang zu Verhütungsmitteln und Schwangerschaftsabbruch verlangen unsere Solidarität – egal wo auf der Welt. Mehrheitlich weiße linke Bewegungen arbeiten seit Jahren an antirassistischen Praktiken, die kritisch mit den eigenen Privilegien umgehen. Wir wollen noch mehr. Wir fordern alle zu internationaler feministischer Solidarität, zum Kampf für das Recht auf körperliche, ökonomische und sexuelle Selbstbestimmung und Gleichberechtigung auf – auch und gerade eine patriarchal sozialisierte, männlich dominierte Antifa.
Die AfD stellt sich eine Gesellschaft vor, in der alle feministisch erkämpften Errungenschaften der letzten Jahrzehnte wieder zurückgenommen werden, in der Geburtenzwang, die Verpflichtung auf die Kernfamilie und ein immer breiterer gender pay gap herrschen. Feminismus ist unser zentraler Gegenentwurf. Wir sehen uns in der Tradition feministischer Kämpfe weltweit. Wir profitieren von den Errungenschaften der europäischen Frauenbewegung in Bezug auf Bildung, Familienrecht und Strafrecht, wollen aber nicht hier stehenbleiben.
Eure Frauenquote in den Aufsichtsräten könnt ihr behalten – wir wollen die Hälfte einer Welt ohne börsennotierte Unternehmen.
Unser Feminismus bleibt antirassistisch!“ (17)
Zu Recht hebt die IL die Rechte von Frauen und deren Verbindung mit antirassistischen Kämpfen hervor. Zugleich bleibt der Text aber sehr unkonkret. Soll aber eine Bewegung aufgebaut oder um obige Zielsetzungen erweitert werden, braucht es konkrete, bestimmte Forderungen, die dann auch europaweit, global oder in Deutschland erkämpft werden können. Hier liegt aber eine grundlegende Schwäche aller post-autonomen wie der meisten „anti-kapitalistischen“ Kräfte.
Ein zweiter Schwachpunkt liegt in einem spontaneistischen Verständnis von Bewegung. Ein kurzer Auszug dem Artikel „Die soziale Frage ist offen. Lassen wir sie nicht rechts liegen!“ verdeutlicht das: „Oft haben wir in den letzten Jahren nach Griechenland oder Spanien geschaut und waren sehr beeindruckt. Dort sind unter den Bedingungen der von der Austeritätspolitik verursachten Not selbstorganisierte Solidaritätsnetzwerke entstanden, die sich zu politischen Akteuren direkt-demokratischer Vergesellschaftung weiterentwickelt haben.“ (18)
Die IL legt den Fokus auf die Selbstorganisierung. Aber sie blendet die Bedingungen aus, unter denen sie entsteht und unter denen sie, sollten sie zu keiner politischen Bewegung werden, eben nur gesellschaftlicher Notbetrieb sein können. Die „Solidaritätsnetzwerke“ zeigen zwar, dass sich die Menschen auch in der Not nicht unterkriegen lassen wollen. Die Interpretation, dass das der Weg zur „ direkt-demokratischen Vergesellschaftung“ wäre, ist jedoch vollkommen naiv und unterstellt, dass sich daraus Schritt für Schritt neue Organisationsformen einer zukünftigen Gesellschaft entwickeln könnten, ohne dass die Staatsmacht direkt heraufgefordert werden müsste. Das Gegenteil ist aber der Fall. Wenn es nicht gelingt, der herrschenden Klasse und der hinter ihr stehenden Troika die Macht zu entreißen, so müssen die lokalen Initiativen zu Organisationen werden, die nur den Mangel und die Not verwalten.
Es geht gerade darum, das Bewusstsein in diesen Netzwerken auf die Frage des politischen Kampfes zu richten und nicht den bestehenden Zustand zu romantisieren. Eine Grundlage für eine andere Form der Vergesellschaftung (einschließlich der Verallgemeinerung rudimentärer Ansätze, die in Krisenperioden aus der Not entstehen können) kann letztlich nur durch die Eroberung der Staatsmacht geschaffen werden, sie erwächst nicht graduell im Inneren der kapitalistischen Gesellschaft.
So wie die IL die Aktivitäten in Südeuropa überhöht, so macht sie das auch mit den Geflüchteten und den Supportern. Diese leisten zweifellos beachtliche Arbeit und haben auch eine beeindruckende Bewegung gebildet. Die IL geht in ihrer Einschätzung jedoch viel weiter:
„Diese Initiativen (die freiwilligen HelferInnen in der Flüchtlingsarbeit; Anm. der Red.) sind eine neue, starke und beeindruckende soziale Bewegung. Komplementär zur derjenigen der Flüchtenden selbst. Auch viele Blockupy- Aktivist_innen sind jeweils Teil solcher Solidaritätsstrukturen vor Ort, von Lesbos bis Malmö. Wir teilen nun ähnliche Erfahrungen, sind Teil eines gemeinsamen Kampfes, ganz praktisch. Hierin scheint auf, was die europäische Kommune sein kann, von der wir in letzter Zeit häufiger gesprochen haben.“ (19)
Für die IL braucht es kein revolutionäres Subjekt, keine Strategie, keine Taktik, um den Kapitalismus zu stürzen. Vielmehr entstehen in den Kämpfen, in der Organisierung durch HelferInnen der Flüchtlingsarbeit wie in der Bewegung der Refugees selbst die Konturen einer zukünftigen anderen Gesellschaft, der „europäischen Kommune“. Schon wär’s. In Wirklichkeit ist das reine, reformistische Utopie. Anders als der klassische Reformismus oder generell die bürgerliche ArbeiterInnenpolitik will die IL dem Staat nicht schrittweise Reformen abringen oder die Gesellschaft mittels parlamentarischer Mehrheiten „transformieren“, sie will nicht einmal die Verstaatlichung der großen Unternehmen.
Die Kommune erwächst vielmehr aus der Not, die zukünftige „andere“ Gesellschaft wird durch die Verallgemeinerung der Hilfe von sehr engagierten Menschen spontan gebildet. Im Grunde ist das nur eine Spielart des Genossenschaftssozialismus, der eine neue, sozialistische (und „auf der Kommune“ basierende) Produktionsweise schrittweise in der bürgerlichen Gesellschaft entwickeln will. Dummerweise ist die objektive Entwicklung des Kapitalismus durch die gegenteilige Tendenz – immer stärkere Vergesellschaftung unter dem Kommando des großen Kapitals – gekennzeichnet. Diese Vergesellschaftung, der zunehmende gesellschaftliche Charakter der Arbeit bleibt aber den bornierten Zwecken von Privateigentümern an den Produktionsmitteln unterworfen, der Profitmaximierung. Dies kann nur durchbrochen werden durch die politische Machtergreifung der ArbeiterInnenklasse und die Zentralisation der Produktionsmittel in ihren Händen, in dem von ihr geschaffenen Rätestaat.
Die IL hingegen unterschiebt den Refugees wie den UnterstützerInnen eine politische Tendenz, die sie nicht haben. Die meisten von ihnen haben von der „europäischen Kommune“ nichts gehört – und das ist auch gut so. RevolutionärInnen müssen vielmehr erkennen, dass die enorme Energie der UnterstützerInnen nicht von Dauer sein kann, noch kann es die Perspektive sein, dass die Bevölkerung einen ständigen Hilfsbetrieb dafür leistet, dass Staat, Kommunen usw. nicht ausreichend Mittel zur Versorgung der Geflüchteten bereitstellen. Die Bewegungen der UnterstützerInnen wie der Refugees müssen daher zu einer Bewegung um Forderungen wie Bleiberechte, volle demokratische Rechte, offene Grenzen, Bewegungsfreiheit, ausreichende finanzielle Ausstattung, Recht auf Arbeit und Wohnraum freier Wahl werden, zu einer Kraft, die für reale Verbesserungen kämpft und diese durchsetzen kann.
Mit ihrer Vorstellung, dass ohnedies schon die „europäische Kommune“ wachsen würde, versagt die IL vollkommen darin, der Bewegung eine Perspektive zu weisen. Ihr spontaneistisches Konzept ist letztlich die pseudo-radikale Kehrseite ihrer realen Nachtrabpolitik hinter der Linkspartei.
Ums Ganze – zwischen Antifa und breitem Bündnis
Das anti-national und anti-deutsch ausgerichtete Bündnis „Ums Ganze“ (UG) ist bei seinem Kampagnentext „Nationalismus ist keine Alternative“ (20) schon vorsichtiger als die große post-autonome Schwester, die IL.
Wie wir und alle Anti-RassistInnen erkennt UG den Erfolg der Geflüchteten an, als sie im Sommer 2015 die Mauern der Festung Europa zeitweilig durchbrechen konnten:
„Zwar sind so viele Menschen wie nie in der Geflüchtetenunterstützung und bei antirassistischen Aktionen aktiv. Gleichzeitig greifen aber RassistInnen und Nazis fast täglich Flüchtlingsunterkünfte an, feiern rechte Parteien ungeahnte Erfolge, verschärfen die bürgerlichen Parteien das Asylrecht, steht Europa im Zeichen einer umfassenden nationalen Abschottung.“ (21)
Weit mehr als die IL verbindet der Text tatsächlich die sog. „Flüchtlingskrise“ mit jener des Kapitalismus: „Die sogenannte Flüchtlingskrise ist die Folge eines allmählichen Zusammenbruchs der vom globalen Kapitalismus politisch oder ökonomisch verwüsteten Peripherie der kapitalistischen Welt ist.“ (22)
Freilich blendet UG die Verbindung der aktuellen Krise zu Imperialismus und imperialistischer Neuordnung der Welt aus. Wird auch viel vom Kapitalismus und der Wertform, von völkischem Denken und Nationalismus gesprochen, so mag das anti-nationale Bündnis vom Imperialismus bzw. von der imperialistischen Epoche nichts wissen. Daher bleibt der Zusammenhang von Expansion des Kapitals, Sicherung von Märkten und Investitionsgebieten mit der Frage der ArbeiterInnenaristokratie ebenso außen vor wie die Notwendigkeit der Unterstützung sozialer, demokratischer und nationaler Befreiungskämpfe in den vom Imperialismus beherrschten Ländern.
Überhaupt bleibt das Bündnis sehr dürftig, wenn es um die Frage der strategischen Ausrichtung geht.
Konkrete Forderungen, wie Geflüchtete, MigrantInnen, UnterstützerInnen zu einer Bewegung werden könnten, wie die Masse der Lohnabhängigen dafür gewonnen werden könnte, fehlen vollständig.
Die Kapitalismuskritik der UG speist sich theoretisch aus dem Fundus der sog. „Wertkritiker“. Bei aller mitunter auch recht treffenden Bemerkung über Fetischisierungsformen, über die Widerspiegelung der Krise im Bewusstsein der Gesellschaftsmitglieder, teilt UG die fundamentale Schwäche der Wertkritiker. Sie kennt kein revolutionäres Subjekt der Veränderung, keine ArbeiterInnenklasse. Allenfalls kommt sie als „prekäre Arbeiterschaft“ vor, die vor der verrohten Bürgerlichkeit bei der AfD ihre neue politische Heimat suche. In der Nation ist die ArbeiterInnenklasse längst untergegangen. Das Subjekt der Veränderung sind hier allenfalls die Individuen in den Helfergruppen:
„Die Aufgabe linksradikaler antirassistischer Gruppen muss sein, nach dem initialen Moment des humanistischen Helfens das Engagement mittels einer kritischen Analyse zu politisieren und praktisch zuzuspitzen. Der Übergang von Charity zu Solidarity wäre, wo die Helfenden ein Interesse entwickeln, nicht mehr nur Symptomlinderung zu betreiben, sondern die Bedingungen zu überwinden, welche die gegenwärtige Situation der Mangelverwaltung überhaupt erst produziert haben.“ (23)
Bei aller Unterschiedlichkeit im Jargon enden die beiden „post-autonomen“ Strömungen, IL und UG, beim gleichen Subjekt der Veränderung. Wenn die Klassen schon längst passé sind, bleibt nur noch das (bürgerliche) Individuum. Der Linksradikale entpuppt sich als liberales Schaf im Wolfspelz.
Daher endet der Aufruf auch mit einer Mischung aus autonomen Standards und pragmatischer Befürwortung klassenübergreifender „breiter“ Bündnisse.
„Den Rechtsruck zur Renovierung der Festung Europa und den Wiederaufbau nationaler Grenzen in ihrem Inneren wollen wir stoppen. Dafür braucht es eine Menge unterschiedlicher Aktivitäten. Die sozialen Auseinandersetzungen um Wohnraum und den Zugang zur öffentlichen Infrastruktur mit denjenigen, die schon hier sind, gemeinsam aufzunehmen, und breite Bündnisse gegen rassistische Anschläge und Aufmärsche gehören bestimmt dazu. Doch für sich genommen bleibt es zu wenig, wenn es nicht bald gelingt, den Einpeitschern der Abschottung am rechten Rand wie ihren technokratischen Organisatoren in der ‚Mitte der Gesellschaft‘ aktiv in die Parade zu fahren. Zufälligerweise hat die radikale Linke aber einige politische und kreative Methoden im Angebot, um den Preis für die Abschottung und die Entrechtung der ‚Anderen‘, egal ob aus völkischen oder ökonomischen Gründen, in die Höhe zu treiben. Und das könnte auch eine gute Gelegenheit sein, um Anlaufpunkte für die vielen Leute zu schaffen, die sich jetzt politisiert haben und die nach Gelegenheiten suchen, sich antirassistisch einzubringen.“ (24)
Das UG-Bündnis redet hier einer Arbeitsteilung das Wort, die das ganze Elend der autonomen Politik sichtbar macht. Gegen Anschläge und große Aufmärsche sollen „breite Bündnisse“ mit Gott und der Welt, mit allen möglichen Parteien und Kirchen her. Ein Klassenbezug fehlt natürlich. Wenn es um die „Masse“ geht, kennt auch UG die „Einheit der Demokraten“.
Gegen den staatlichen Rassismus wird aber erst gar keine Massenbewegung angestrebt. Dafür sollen „politische und kreative Methoden“, also individuelle Kleingruppenaktivität, „den Preis für die Abschottung und die Entrechtung (…) in die Höhe treiben.“ Hier tritt uns der elitäre Charakter des autonomen „Kämpfertums“ entgegen.
In beiden Fällen geht es nicht darum, wie die Lohnabhängigen überzeugt und politisch gewonnen werden können. Einmal wird es hingenommen, dass sie in breiten Bündnissen mit allen möglichen bürgerlichen Parteien marschieren und im demokratischen Einheitsbrei der Nation aufgehen, wo jeder Unterschied zwischen jenen, die sich auf die ArbeiterInnenklasse stützen, und den offen bürgerlichen verschwindet. Für die „radikalen“ Aktionen ist anderseits die „radikale Linke“ zuständig. Organisierte Militanz, politisches Vorgehen, Selbstverteidigung kann für diese Gruppierung offenkundig überhaupt keine Bindung zu einer Massenbewegung haben. Genau das müsste das Ziel von revolutionären KommunistInnen sein. Natürlich sind z. B. zur Verhinderung von Abschiebungen militante Aktionen notwendig. Unser Ziel ist es jedoch, diese als Aktivitäten zu konzipieren, die von einer Masse getragen werden, die z. B. mit Mitteln des Streiks im Transportsektor geführt werden. Zur Durchführung solcher Aktionen ist daher vor allem eine politische Vorbereitung und die politische Gewinnung der Aktiven wie auch größerer Teile der Klasse notwendig.
Dieser Gedanke taucht beim post-autonomen Flügel der Bewegung allerdings gar nicht erst auf. Wer von der Existenz einer ArbeiterInnenklasse nichts wissen will, braucht sich folgerichtig auch nicht den Kopf zu zerbrechen, wie deren Bewusstsein erhöht, wie sie zum Subjekt gesellschaftlicher Veränderung werden kann.
Die Frage der „offenen Grenzen“
Immerhin treten IL und UG und auch andere Teile der radikalen Linken für offene Grenzen ein, sprechen sich gegen alle Einreise- und Aufenthaltsbeschränkungen für MigrantInnen aus.
Umgekehrt erscheint diese Forderung großen Teilen der reformistischen und gewerkschaftlichen Linken, aber auch einigen zentristischen Organisationen oder Teilen der DKP als „utopisch“ oder „kleinbürgerlich.
Linksparteimitglieder wie Sahra Wagenknecht bringen das ganz offen zum Ausdruck. So erklärte sie am 27. Juli 2016 in einer Pressemitteilung: „Der Staat muss jetzt alles dafür tun, dass sich die Menschen in unserem Land wieder sicher fühlen können. Das setzt voraus, dass wir wissen, wer sich im Land befindet und nach Möglichkeit auch, wo es Gefahrenpotentiale gibt. Ich denke, Frau Merkel und die Bundesregierung sind jetzt in besonderer Weise in der Verantwortung, das Vertrauen der Menschen in die Handlungsfähigkeit des Staates und seiner Sicherheitsbehörden zu erhalten.“
Hier ruft sie ganz unverhohlen zur vermehrten polizeilichen Überwachung der Flüchtlinge auf. Wer sich hier „illegal“ aufhält, der muss um sein „Gastrecht“ bangen. Wagenknecht macht kein Hehl daraus, dass sie für die Begrenzung der Zahl von Flüchtlingen, für kontrollierte Migration ist.
Bei aller Distanzierung, die aus der Linkspartei kommt, drückt die Partei selbst sich um die Frage der „offenen Grenzen“ herum. Sie ist gegen Beschränkungen für Geflüchtete. Aber sie stellt nicht die Forderung nach einer Abschaffung aller Zuzugsbeschränkungen auf. Eine „grenzenlose“ Gesellschaft vertritt sie keinesfalls. Sie will Gleichberechtung für MigrantInnen, sie stellt aber keinesfalls die Forderung nach Abschaffung aller „Ausländergesetze“ auf, die den selektiven Zuzug von ArbeitsmigrantInnen regulieren. Damit reproduziert sie letztlich die Trennung von politischen und „Wirtschaftsflüchtlingen“.
Die Frage der Selektion ist aber unwillkürlich mit jeder Form der Beschränkung von Zuzug verbunden. Wer nicht für offene Grenzen für alle ist, muss logisch auch Kriterien angeben, nach denen Menschen ins Land gelassen und abgewiesen werden, nach denen Menschen ohne legalen Aufenthaltstitel wieder abgeschoben werden. Das ist die unvermeidliche Logik der Ablehnung von offenen Grenzen für alle.
Dabei werden gegen offene Grenzen eine Reihe von letztlich sozialchauvinistischen oder staatstragenden Argumenten vorgetragen, die wir teilweise schon im ersten Teil behandelt haben.
1. Behauptung: „Offene Grenzen“, unkontrollierte Migrationsströme würden die Arbeitslöhne drücken. Oft wird das noch damit ergänzt, dass die Kapitalisten für mehr Zuzug wären.
Diese These ist politisch kurzsichtig und in mehrfacher Hinsicht falsch. Erstens unterstellt sie einen direkten Zusammenhang von Migration und Höhe des Arbeitslohns, der so nicht existiert, selbst wenn wir nur den nationalen Arbeitsmarkt betrachten. Wenn wir annehmen, dass er stimmen würde, so müssten umgekehrt bei einer Abschottung des nationalen Arbeitsmarktes die Arbeitslöhne auch steigen. Das verkennt erstens die Ursachen für Arbeitslosigkeit, zweitens aber auch, dass Arbeitslohn letztlich eben nicht durch Angebot und Nachfrage, sondern durch den Wert der Ware Arbeitskraft bestimmt wird – und der steigt natürlich nicht, weil es weniger ArbeiterInnen gibt.
Zweitens geht diese Argumentation gänzlich von einer nationalen Sicht der Interessen der ArbeiterInnenklasse aus. Sie übersieht, dass nationalstaatliche Grenzen selbst immer schon Mittel zur Selektion sind, dass die Entrechtung und Benachteiligung der migrantischen Arbeit bis hin dazu, dass sie in die Illegalität gezwungen werden, gerade ein Mittel zur Spaltung der Klasse sind.
Die Befürwortung von Einreise- und Arbeitsbeschränkungen ist daher eine Zustimmung zu einem Mittel der Spaltung der Klasse und der ideologischen und politischen Rechtfertigung jener Grenzen, die die v. a. die imperialistischen Staaten der Welt auferlegen.
Schließlich hat die Ausschließung von migrantischen ArbeiterInnen vom Arbeitsmarkt im Namen der „etablierten ArbeiterInnen“ immer einen chauvinistischen Kern, ähnlich der Ausschließung von Frauen vom Arbeitsmarkt im 19. Jahrhundert.
Das trifft auch auf alle anderen Behauptungen zu wie, dass MigrantInnen weniger Klassenbewusstsein hätten, womöglich reaktionäre Kräfte wie die Islamisten stärker würden. All das unterscheidet sich nicht grundsätzlich von den chauvinistischen Argumenten männlicher Arbeiter im 19. Jahrhundert, die befürchteten, dass die proletarischen Frauen konservativer wählen würden als der Durchschnitt.
Einem bestimmten Teil der ArbeiterInnenklasse wird damit wie bei allen chauvinistischen oder rassistischen Ideologien unterstellt, dass sie „von Natur“ aus rückständiger wären.
2. Behauptung: Es können nicht „unbegrenzt viele“ aufgenommen werden.
Erstens wird hier immer gern mit Phantasiezahlen hantiert. Die meisten Geflüchteten sind Flüchtlinge, die von einem Land der „Dritten Welt“ in ein anderes fliehen, oder Binnenflüchtlinge.
Zweitens steht dahinter immer auch eine Entschuldung des Imperialismus, zumal der eigenen herrschenden Klasse. Dieses System bringt durch Überausbeutung, direkte Plünderung, Unterstützung von Despotien, Krieg und Interventionen jene Bedingungen hervor, die Millionen und Abermillionen zur Flucht zwingen. Einreisekontrollen, bedeuten, dass die Staaten der imperialistischen Bourgeoisien und ihrer Verbündeten festlegen, wie viele der von ihr Ruinierten, zur Flucht Getriebenen in ein Kernland der Weltbeherrschung dürfen oder nicht.
In der gegenwärtigen Lage wäre es sogar recht leicht möglich, die Flüchtlinge in Europa in die hiesigen Gesellschaften zu integrieren. Ob die Integration realiter klappen kann, ist aber eine Frage des Klassenkampfes. Die herrschende Klasse und die Regierungen organisieren die „Flüchtlingspolitik“ und die Migrationspolitik bewusst so, dass sie Geflüchtete und MigrantInnen gegen die anderen Lohnabhängigen ausspielen und in einem permanenten Zustand der Unterdrückung und Benachteiligung halten. Essentielle Momente von Integration – wie gleicher Zugang zu Arbeit, Wohnen und Bildung – werden ihnen vorenthalten.
Die Integration auf dem Arbeitsmarkt wäre natürlich rasch möglich durch ein Beschäftigungsprogramm gesellschaftlich nützlicher Arbeit und Arbeitszeitverkürzung auf 30 oder weniger Stunden pro Woche. Wäre das mit einer sofortigen Anhebung des Mindestlohns auf 12,- Euro netto kombiniert, wären wenigstens die Reproduktionskosten aller gedeckt.
Auch hier zeigt sich, dass Migration und Flucht, Grenzen usw. eine Klassenfrage sind.
3. Behauptung: Offene Grenzen sind blauäugig und gehen mit einer Verharmlosung reaktionärer Eigenschaften von MigrantInnen einher
Dieser Konnex ist eine reine Konstruktion und in sich überhaupt nicht logisch. Natürlich gibt es unter MigrantInnen auch Reaktionäre, Menschen, die sexistisch, homophob, nationalistisch usw. sind. Das trifft aber auch auf die Deutschen zu. Der Kampf für volle StaatsbürgerInnenrechte bedeutet überhaupt nicht, dass die ArbeiterInnenbewegung oder die politische Linke reaktionäre Einstellungen von MigrantInnen nicht bekämpfen sollten.
In Wirklichkeit ist es jedoch die bürgerliche Politik, die bewusst reaktionäre Kräfte unter MigrantInnen fördert, beispielsweise um den Einfluss fortschrittlicher zu bekämpfen. Wenn heute Bürgerliche über Erdogans Einfluss unter türkischen MigrantInnen jammern, so sollten wir wenigstens nicht vergessen, dass bürgerliche, nationalistische und auch islamische Vereine unterstützt wurden, um den Einfluss von kurdischen und türkischen Linken zu schwächen.
All das zeigt, dass die Kritik, dass InternationalistInnen „blauäugig“ gegenüber reaktionären Tendenzen wären, verlogen ist. Es geht bei dieser Kritik auch nicht darum, ob diese Tendenz bekämpft werden soll. Vielmehr soll der Kampf gegen die rassistische Unterdrückung von MigrantInnen, für deren uneingeschränktes Bleiberecht, für volle StaatsbürgerInnenrechte, gegen Bespitzelung und Überwachung usw. delegitimiert und staatlicher Rassismus relativiert und gerechtfertigt werden.
Schließlich verkennen diese KritikerInnen der „offenen Grenzen“ und des konsequenten Anti-Rassismus die grundlegend fortschrittlichen Tendenzen der Arbeitsmigration. Die ArbeiterInnenklasse ist ihrem Wesen nach eine internationale, keine nationale Klasse. Die KapitalistInnen werden natürlich versuchen, neue Schichten, die zur ArbeiterInnenklasse stoßen, gegen andere auszuspielen. Gelingt es jedoch, diese Spaltung zu durchkreuzen, so zeigt sich immer wieder, dass das Infragestellen von „Selbstverständlichkeiten“ der ansässigen ArbeiterInnen, das Kennenlernen und Verschmelzen zu einer Bewegung ein extrem befruchtender Prozess ist, weil er neue Kampf- und Lebenserfahrungen bringt und auch „kulturelle Gewissheiten“, die oft einen konservativen Charakter tragen, in Frage stellt.
4. Behauptung: Das ist der ArbeiterInnenklasse nicht vermittelbar.
Das ist eigentlich kein Argument, sondern eine politische Kapitulationserklärung vor dem (vermeintlich) vorherrschenden Bewusstsein. Es ist letztlich eine Ausrede von vorgeblichen InternationalistInnen, gegen den vorherrschenden Chauvinismus in der Klasse zu argumentieren.
Das treibt nicht nur reformistische Organisationen um, sondern auch zentristische. So schreibt Hannah Sell von der Socialist Party (England und Wales) auf der Webseite der SAV:
„Gleichzeitig ist es aufgrund des Bewusstseins in der Arbeiterklasse nicht möglich, einfach eine simple Parole ‚für offene Grenzen‘ oder ‚für Abschaffung der Kontrollen bei der Einwanderung‘ aufzustellen. Das würde es nur erschweren, ArbeiterInnen für ein sozialistisches Programm zu gewinnen – sowohl was die Frage der Einwanderung als auch andere Punkte angeht. Eine solche Forderung würde die große Mehrheit der Arbeiterklasse zunächst abschrecken. Das gilt auch für viele bereits seit Jahren im Land lebende EinwandererInnen, die das als Bedrohung für ihre Arbeitsplätze, Löhne und Lebensbedingungen verstehen würden.“ (25)
Der Verzicht auf eine klare, anti-rassistische Losung erleichtert mitnichten, die ArbeiterInnen für ein sozialistisches Programm zu gewinnen, weil er das Programm selbst kompromittieren und ein Abgleiten zur staatlichen rassistischen Selektionspolitik bedeuten würde. Wer gegen offene Grenzen ist, ist letztlich für Obergrenzen der Migration. Darum kommt auch die SAV nicht rum.
Dass die Losung der offenen Grenzen größere Teile der ArbeiterInnenklasse abschreckt, mag zutreffen. Umgekehrt gibt es sehr wohl Situationen, wo ganze Schichten der Klasse und v. a. der Jugend in diese Richtung tendieren oder sogar offen dafür eintreten. Das trifft auf die Solidaritätsbewegung mit den Geflüchteten in Griechenland zu, aber auch die UnterstützerInnen der Geflüchteten im letzten Jahr gingen teilweise in diese Richtung. Genau diese Kräfte sind es, die zu einer bewussten Vorhut werden können, wenn es RevolutionärInnen schaffen, ihnen Argumente zu Hand zu geben und sie zu einer Bewegung zu formieren, die Bewusstsein in die ArbeiterInnenklasse trägt.
Die Position, dass die ArbeiterInnenklasse für die Forderung der „offenen Grenzen“ nicht gewonnen werden könnte, ist daher nicht nur eine Anpassung an die rückständigeren „weißen“, oft arbeiteraristokratischen Teile der Klasse. Sie führt auch dazu, dass jene Teile, die in diese Richtung drängen, politisch zurückgezerrt werden.
An der Frage der „offenen Grenzen“ zeigen sich freilich grundlegende Fragen zur Haltung zu unserer Gesellschaft. Erstens markiert sie eine Scheidlinie zwischen jenen, die den bestehenden bürgerlichen Staat bekämpfen, die in der eigenen Bourgeoisie ihren Hauptfeind erblicken – und ihr daher auch jedes Recht absprechen, darüber zu entscheiden, welche Menschen hier leben dürfen oder nicht, und den anderen „Linken“.
Zweitens markiert sie eine Scheidelinie zwischen Internationalismus oder einer nationalen Perspektive sozialer Veränderung. Vom Standpunkt einer sozialen Transformation in einem Land hin zu einem reformierten, sozialen Kapitalismus oder zu einem nationalen Weg zum Sozialismus hat die Befürwortung eines mehr oder minder selektiven Grenzregimes logisch Sinn. Vom Standpunkt der internationalen Revolution stellt es nur ein Hindernis für die Einheit der ArbeiterInnenklasse dar.
Schluss
MigrantInnen sind ein zentraler Bestandteil der Arbeiterklasse. In etlichen Betrieben sind sie Teil der kämpfenden Vorhut. In der Gesellschaft – oft auch in den ArbeiterInnenorganisationen – sind sie jedoch BürgerInnen zweiter und dritter Klasse. Vielen von ihnen werden elementare demokratische Rechte vorenthalten, z. B. das Wahlrecht. An Schulen, Unis, in der Ausbildung werden sie benachteiligt. Auch bei gleicher Qualifikation sind sie härter von Arbeitslosigkeit und Armut bedroht.
Hinzu kommt rassistische Hetze nicht nur von Faschisten und Rechtsextremen, sondern auch aus der „Mitte“ der Gesellschaft von Hetzern wie Sarrazin und vom bürgerlichen Staat.
Die Frage eines Verständnisses der Wurzeln des Rassismus, seines Verhältnisses zum Klassenkampf und der notwendigen Taktiken zu seiner Bekämpfung sind daher heute Schlüsselfragen für die ArbeiterInnenbewegung und die radikale Linke. Die Einheit in der Aktion und der Aufbau einer bundesweiten antirassischen Massenbewegung sind heute zentrale Aufgaben, um den Rechtsruck zu bekämpfen und die Angriffe der Regierung zurückzuschlagen. Wie wir gezeigt haben, versteht sich das jedoch nicht von selbst. Ein richtiges Verständnis der Bewegung, die wir aufbauen wollen, erfordert auch eine Kritik an den Fehlern von ReformistInnen, Post-Autonomen, ZentristInnen. Nur auf Grundlage einer solchen Klärung wird es möglich sein, den anti-rassistischen Kampf mit dem gegen den Kapitalismus zu verbindenl.
Endnoten
(1) Marx/Engels, Manifest der Kommunistischen Partei, MEW 4, S. 472, Berlin 1964
(2) https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/fluechtlinge/zahlen-fakten
(4) Ebenda
(5) Ebenda
(6) Ebenda
(7) Ebenda
(8) Ebenda
(9) https://www.aufstehen-gegen-rassismus.de/3-september/
(10) Ebenda
(11) Ebenda
(12) https://www.aufstehen-gegen-rassismus.de/aktuelles/train-the-trainer-seminar-nord-ost/
(13) Ebenda
(14) http://www.interventionistische-linke.org/beitrag/grenzenlos-feministisch
(15) Ebenda
(16) Pegida – schon wieda?, http://www.interventionistische-linke.org/beitrag/pegida-schon-wieda
(17) http://www.interventionistische-linke.org/beitrag/grenzenlos-feministisch
(19) Ebenda
(20) https://umsganze.org/kampagnentext-2016/
(21) Ebenda
(22) Ebenda
(23) Ebenda
(24) Ebenda
(25) https://www.sozialismus.info/2013/01/kapitalismus-globalisierung-und-migration/