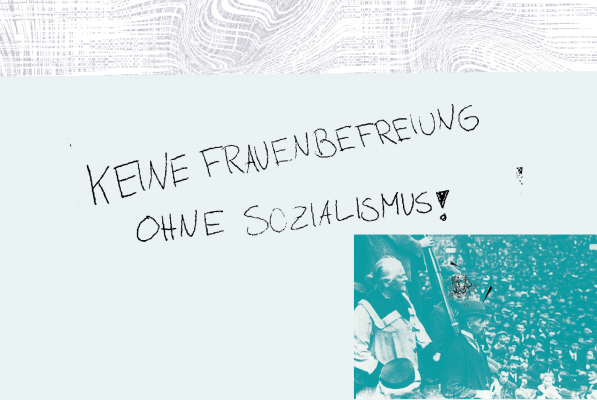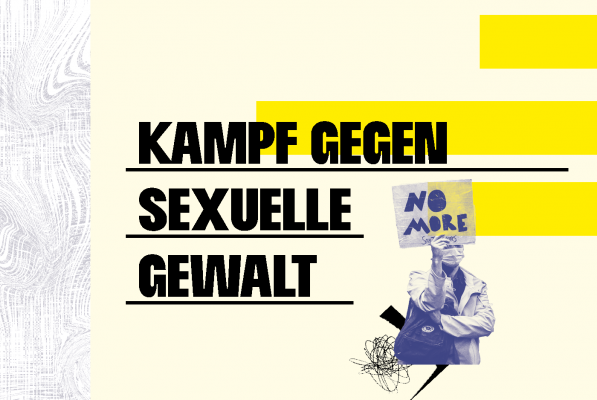Venezuela: Schluss mit der US-imperialistischen Einschüchterung!

Prensa Presidencial - Government of Venezuela, CC BY 3.0 , via Wikimedia Commons
Bruno Tesch, Neue Internationale 295, Oktober 2025
Ein US-Kriegskreuzer hat ein venezolanisches Fischerboot aufgebracht – wird da mit Kanonen auf Spatzen geschossen? Der Vorfall ist jedoch weder eine Bagatelle noch handelt es sich um einen Zufallskonflikt, in dem es um Gewässerhoheitszonen oder Fischereirechte geht. Vielmehr steckt dahinter eine länger schwelende Auseinandersetzung zwischen den Interessen des US-Imperialismus und denen einer Halbkolonie, die sich vor dem übermächtigen Herrscher nicht ohne weiteres in den Staub wirft. Ähnlich verhält es sich auch mit den Übergriffen der chinesischen Marine gegen philippinische Fischer:innen.
Die Begründung der US-Regierung für ihre Eskalation, die auch den Einsatz militärischer Mittel rechtfertigt, die „Bekämpfung von Drogenschmuggel“, ist natürlich hergeholt und durchsichtig. Die Angriffe von US-Kriegsschiffen auf venezolanische Boote stellen einen Akt der imperialistischen, terroristischen Aggression dar, die Trump auch im Inneren der USA fortsetzt, indem er Hunderttausende als angeblich Kriminelle deportieren lassen will. Und er droht auch gleich der venezolanischen Regierung mit Vergeltung, falls sie bei der rassistischen Unternehmung nicht kooperieren sollte.
Denn zwar wird der neuen Administration nachgesagt, sie stelle die bisherige Politik der USA auf den Kopf, doch in Wahrheit verfolgt sie den politischen Leitfaden ihrer Vorgängerregierungen. Dies gilt zumindest für ihre Prinzipien der Außenpolitik vor der eigenen Haustür. Lateinamerika wird seit jeher als gottgegebenes Einflussgebiet des US-amerikanischen Herrschaftsraums betrachtet.
US-Politik im halbkolonialen „Hinterhof“
Im Laufe der Zeit, als nationale Befreiungskämpfe auch in Lateinamerika aufflammten und antiimperialistische Züge annahmen, haben die USA mehrfach versucht, diese Entwicklungen einzudämmen und umzudrehen. Die gescheiterte Invasion auf Kuba 1961 ließ sie zumeist vorsichtiger und verdeckter agieren. Auf Grenada schien ihnen 1983 die Gelegenheit jedoch zu einer direkten militärischen Intervention günstig, zumal es sich um eine relativ isoliert liegende kleine Karibikinsel handelte, und sie machten kurzen Prozess mit einer demokratisch gewählten linken Regierung.
Oft aber bauten ihre Geheimdienste konterrevolutionäre Parteien und Bewegungen im jeweiligen Land auf, wie in Nicaragua, oder unterstützten Teile des traditionell konservativen Militärapparats und deren Putschpläne, wie in Chile. Wo es den USA nicht gelang, die politischen Verhältnisse in eine ihnen genehme Richtung umzulenken, setzten sie den Volkswirtschaften das Würgeisen von ökonomischen Pressionen an den Hals, die gegen Kuba seit 65 Jahren ungebrochen weiter bestehen.
Auf dem südamerikanischen Festland gilt ihnen seit der Machtübernahme des Regimes unter Hugo Chávez 1999 Venezuela als „Schurkenstaat“. Chávez verstieß v. a. durch seinen Verstaatlichungskurs des wichtigsten Wirtschaftsfaktors, der Erdölindustrie, gegen die geheiligte kapitalistische Ideologie und diametral gegen Interessen des US-Imperialismus. Das linksnationalistische Regime bekam dessen Feindschaft zu spüren durch wirtschaftlichen Sanktionsdruck und Versuche, es mit Hilfe von Attentaten und „Generalstreiks“ der Unternehmer:innenschaft des Landes zu stürzen, die allerdings allesamt misslangen. Chávez und sein Regime konnten dabei auf eine reale Unterstützung unter den Massen bauen, weil sie eine Reihe sozialer Reformen für die Armen in Gang setzten, die durch die Öleinnahmen des Landes finanziert wurden. Allerdings darf das nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch Chávez keine sozialistische Politik, sondern eine des Ausgleichs zwischen den Klassen betrieb, bei der sich der Präsident als oberster Vermittler und Garant des „Fortschritts“ präsentierte.
Auch das Regime von Chaves‘ Nachfolger Maduro steht auf der Liste der „Feindstaaten“. Dass die US-Regierung jetzt ihre Offensive gegen Venezuela noch mal verschärft, ist auch im Rahmen von Vorstößen zu sehen, mit denen nicht nur die eigene Macht demonstriert, sondern auch die Halbkolonien der südlichen Hemisphäre enger an die Kette gelegt werden sollen. Panama hat dies bereits wegen des US-Anspruchs auf den Kanal, die Wirtschaftsader des Landes, erfahren müssen.
Das Maduro-Regime
Seit 2013, nach Chavez‘ Tod im Amt, verfolgt es zwar auch eine klassenübergreifende bonapartistische Politik, die die Arbeiter:innenklasse, Armut, das Kleinbürger:innentum und die Verwaltung der Ölindustrie unter einen autokratischen Hut bringen will. Seine Machtbasis verengt sich jedoch seit Jahren auf die Staatsbürokratie und das Militär. Die Macht bröckelt jedoch zunehmend. Die rechte Opposition wirft Maduro Wahlbetrug bei den letzten Präsidentschaftswahlen vor. Etliche westliche Staaten haben dies zum willkommenden Anlass genommen, dem Regime die Legitimität abzusprechen und das Schattenkabinett seines bürgerlichen Gegenkandidaten González als Regierung anzuerkennen.
Neben den US-Sanktionen wirkt sich auch eine einseitige Wirtschaftspolitik, die sich auf Monopolsektoren wie Öl verlässt, das dem Preisverfall auf dem Weltmarkt ausgesetzt ist, und die Entwicklung anderer Industrien und landwirtschaftlichen Anbaus vernachlässigt, verhängnisvoll auf die allgemeine wirtschaftliche und soziale Lage aus. Hohe Inflation, grassierende Arbeitslosigkeit und chronische Korruption im Staatsapparat haben über eine Million Menschen zur Flucht in Nachbarländer veranlasst.
Zugleich haben sich viele der Träger:innen und Günstlinge des Regimes selbst massiv bereichert – und zwar im immer krasseren Gegensatz zur Lage der Massen. Die Löhne der Arbeiter:innen befinden sich im Weltvergleich auf einem katastrophal niedrigen Stand. Nulllohnrunden und gewerkschaftsfeindliche Maßnahmen entfremden die Arbeiter:innenklasse von dieser Regierung.
Für uns kein Grund, das Land und seine Bevölkerung gegen die imperialistische Bedrohung nicht bedingungslos zu verteidigen. Die Stellungnahme in einer Auseinandersetzung kann für Revolutionär:innen nicht vom Charakter der am Konflikt beteiligten Regime abhängig gemacht, sondern muss von den vorherrschenden weltpolitischen Konfliktlinien bestimmt werden. Wir verteidigen also in der Regel ein halbkoloniales Land gegen eine Bedrohung durch imperialistische Staaten.
Maduro hat eine Generalmobilmachung für den Ernstfall einer US-Intervention angekündigt. Geplant sei der Aufbau von 284 „Frentes de batalla“ (Volksverteidigungsfronten) im gesamten Land. Ziel des Konzepts ist es, alle strategisch wichtigen Punkte – darunter Küsten, Grenzen, Verkehrswege, Häfen, Flughäfen sowie Infrastrukturen wie Elektrizitäts- und Petrochemieanlagen – militärisch abzusichern und auf eine mögliche Konfrontation vorzubereiten. Einheiten der Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Streitkräfte Venezuelas) – unterstützt von der Miliz und sogenannten „Cuerpos Combatientes“ (bewaffnete Betriebskampfgruppen) – sollen entlang der gesamten Karibik- und Atlantikküste sowie im Landesinneren in Stellung gebracht werden. Bei einer Invasion wurde sogar die Taktik von langwierigen Guerillaaktionen ins Spiel gebracht.
Antworten der Arbeiter:innenbewegung auf die Provokationen
Können wir dieser Ankündigung trauen? – Nein. Gleichzeitig mit diesen martialischen Beschwörungen ließ der venezolanische Präsident nämlich durchblicken, dass er eine „diplomatische Lösung für möglich“ halte. Es kann sich nicht allein um die Verteidigung der Souveränität einer Nation oder noch abstrakter um die Wahrung von „Völkerrecht“ drehen. Auf dem Spiel steht die Lage der Arbeiter:innenklasse, die in der Auseinandersetzung ihre Unabhängigkeit erkämpfen kann und muss. Sie braucht dabei nicht nur Bundesgenoss:innen auf nationaler Ebene. Denn angesichts der militärischen Unterlegenheit gegenüber der imperialistischen Großmacht hat eine Abwehr aus der Isoliertheit eines Landes kaum Aussicht auf Erfolg.
Deshalb muss der Aufruf an die Arbeiter:innenbewegung und die Unterdrückten anderer Länder, vorzugsweise der Nachbarstaaten, gerichtet werden, um einen eigenständigen Befreiungskampf zu organisieren, der sich sowohl der imperialistischen Bedrohung entgegenstemmt wie auch in dem Zusammenhang der Unterdrückung durch die korrupte und arbeitendenfeindliche Regierung und dem Staatsapparat ein Ende setzen kann. Dazu muss sie eigene Klassenorgane, Räte und Milizen aufbauen.
- Nein zum imperialistischen Interventionismus und zum herrschenden Autoritarismus! Weder die Bürokratie von Maduro noch der Proimperialismus von offen rechten Vertreter:innen!
- Die Lateinamerikaner:innen und Karibikbewohner:innen müssen mit der Solidarität der Völker der Welt die Schikanen des US-Militärs in den venezolanischen Hoheitsgewässern oder die Einschüchterung anderer Nationen ablehnen, ohne die Regierung von Maduro zu unterstützen.
- Für internationale Solidarität mit Venezuela und seiner unterdrückten Bevölkerung, gegen die militärische Belagerung durch die USA und die prointerventionistische Rechte!