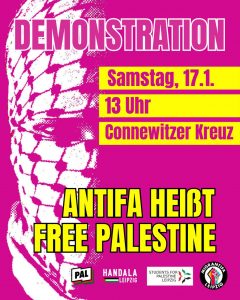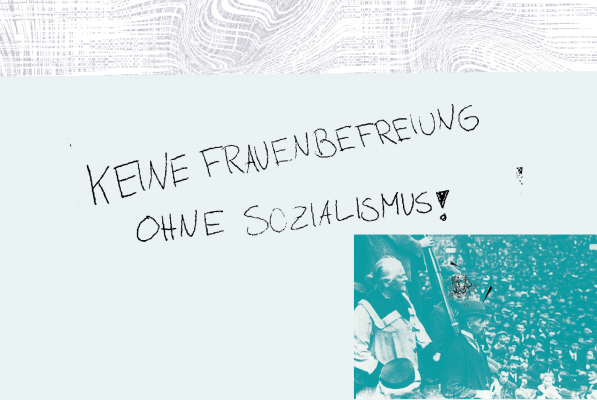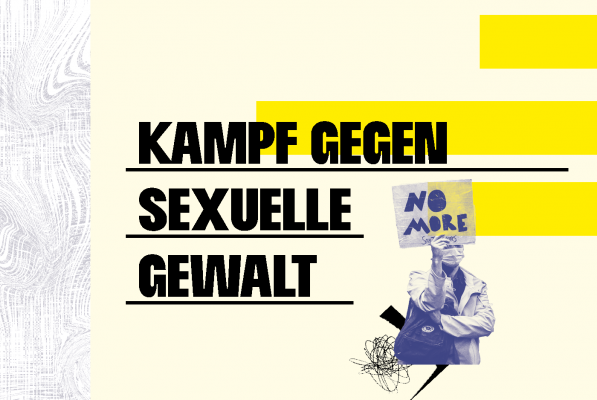Aus dem Archiv: Das Erbe von Che Guevara – eine kritische Betrachtung

Mark Abram, Arbetarmakt (Schweden), Infomail 1288, 1. August 2025
1997 hat Arbetarmakt eine Broschüre über Che Guevara rausgebracht. Es war eine kritische Untersuchung aus marxistischer und trotzkistischer Perspektive, in der wir die fatalen Grenzen einer aus der stalinistischen Tradition übernommenen Strategie für den Kampf diskutierten. Die Broschüre bestand aus zwei übersetzten Texten, von denen wir hier einen veröffentlichen, einen übersetzten Artikel aus einer Zeitschrift, die die internationale Organisation von Arbetarmakt damals herausgab. Nach einer Namensänderung heißt unsere internationale Organisation jetzt „ Liga für die Fünfte Internationale“, aber 1997 hießen wir noch „Liga für eine revolutionär-kommunistische Internationale“. Wir veröffentlichen das Vorwort zur Broschüre, auch wenn der andere erwähnte Text nicht in diesem Beitrag auf der Website veröffentlicht wird.
Die Redaktion
Vorwort
Ernesto Che Guevara ist auch jahrzehnte nach seinem Tod immer noch ein Symbol für den Aufstand gegen den Imperialismus und die Ungerechtigkeiten in der Welt. Aber die Politik, für die er stand, hat nicht zu gesunden Arbeiter:innenregimes geführt, sondern zu stalinistischen Diktaturen.
Wegen des offensichtlichen Widerspruchs zwischen Che Guevara als Symbol für Aufstand und Kampf einerseits und den aus Sicht der Arbeiter:innenklasse katastrophalen Ergebnissen seiner Politik andererseits gibt es allen Grund, die Diskussion zu beeinflussen, die 30 Jahre nach seiner Ermordung in Bolivien 1967 wieder aufflammen wird.
Die Broschüre besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil ist eine längere Rezension aus der Zeitschrift „Trotskyist International“ der FRKI. Das Buch, das rezensiert wird, ist von Jon Lee Anderson (Che Guevara. A Revolutionary Life, London 1997: Bantam Press).
Der zweite Teil ist aus dem Buch The Degenerated Revolution (London 1982) und enthält die grundlegende Analyse der FRKI zur Entstehung degenerierter Arbeiter:innenstaaten in einer Reihe von Ländern nach dem Zweiten Weltkrieg vor dem Hintergrund der russischen Oktoberrevolution. Der Abschnitt über Kuba geht auch auf die Revisionen des Trotzkismus ein, die die kubanische Revolution innerhalb des zentristischen „Trotzkismus“ ausgelöst hat.
Arbetarmakt, September 1997
Das Erbe von Che Guevara – eine kritische Betrachtung
Die Bedingungen für das Schreiben einer Biografie über Ernesto „Che“ Guevara haben sich seit 1989 dramatisch verbessert, wenn auch aus Gründen, die der Hauptdarsteller wohl kaum begrüßt hätte.
Der Sturz der herrschenden Bürokratie in Moskau hat viele stalinistische Funktionär:innen, Agent:innen und Diplomat:innen, die in kubanische Angelegenheiten verwickelt waren, von ihrer Schweigepflicht befreit. Auch in Kuba gibt es jetzt mehr Offenheit. Che Guevaras Freund:innen und Familie sind jetzt bereit, Dokumente und Erinnerungen auf eine früher undenkbare Weise zu teilen.
Andersons Buch nutzt dieses veränderte Klima, um einen faszinierenden Bericht über Ches Leben zusammenzustellen. Es füllt viele Lücken, lüftet den Schleier des Geheimnisses um einige wichtige politische Ereignisse und bringt neue Zeugnisse über wenig erforschte Seiten von Ches Charakter und Persönlichkeit ans Licht. Ohne sich in Personenkult zu ergehen, zeigt Andersons Buch die Kraft von Ches Persönlichkeit: ein treibender, selbstloser und extrem anspruchsvoller Charakter. Es ist das Porträt eines strengen Disziplinars, aber auch eines Mannes der Tat, der bemerkenswerte Zuneigung wecken konnte, nicht zuletzt durch seine Fähigkeit, die Behinderung durch eine schwere, lebenslange Asthmaerkrankung zu überwinden. Es wird auch deutlich, dass er sein ganzes Leben lang alle materiellen Privilegien abgelehnt hat, sowohl als Guerillaführer als auch als Minister im kubanischen Staat.
Es ist keine ikonoklastische Biografie und auch keine Kritik an Guevaras Ideen. Sie stellt weder Guevaras Schriften über den Guerillakrieg noch seine Position in der Debatte unter den kubanischen Führer:innen über den Übergang zum Sozialismus in Frage. Aber sie liefert neue Infos, die eine klarere Einschätzung von Guevaras Beziehung zu Fidel Castro, zum kubanischen Stalinismus und zu seinen sich wandelnden Ansichten über die Sowjetunion und China ermöglichen. Seine katastrophalen Kampagnen im Kongo und in Bolivien werden auf der Grundlage bisher unveröffentlichter Tagebücher und Berichte, vor allem von Leuten, die mit ihm zusammen waren, aber auch von denen, die für seinen Tod verantwortlich waren, genau beschrieben.
Seit 1967 hat Guevara für verschiedene Leute verschiedene Sachen bedeutet: Idol der kubanischen Revolution gegen Batista, Architekt der stalinistischen Konterrevolution in Kuba, unversöhnlicher antiimperialistischer Kämpfer, der bereit war, sein Leben für die Sache eines anderen Landes zu opfern, oder sogar der Mann, der wenige Tage vor seinem Tod in einem Scharmützel einen Band mit Trotzki-Schriften verlor, ein „unbewusster“ Verfechter der „permanenten Revolution“.
Andersons Buch ermöglicht es uns, sowohl den Menschen hinter dem „Guevarismus“ als auch dessen Ideologie und den Charakter des „Marxismus“, zu dem sich Che von Mitte der 1950er Jahre bis zu seinem Tod entwickelte, besser zu verstehen.
Vom Skeptiker zum Marxisten
Ernesto Guevara wurde am 14. Mai 1928 in Rosario, Argentinien, in eine kubanische Adelsfamilie geboren, die in finanzielle Schwierigkeiten geraten war. Aber sie hatten genug Geld, und Guevara wuchs in der Mittelschicht auf, etwas bohemistisch, aber ganz okay.
Als unersättlicher Leser und Debattierer war er sicher politisch bewusst, aber er hielt sich bis in seine Zwanziger hartnäckig von jeglichem Engagement fern. Wegen seiner scharfen Kommentare zu den Ansichten anderer bekam er den Spitznamen „der Scharfschütze“.
Er studierte Medizin und wurde mit 22 Jahren Arzt. Er unterbrach sein Studium, um zu reisen, zuerst durch Argentinien und dann durch ganz Süd- und Mittelamerika. Seine Tagebücher und Briefe zeigen ein allmählich wachsendes Bewusstsein für Ungerechtigkeit, Armut und Unterdrückung. In dieser Zeit las er auch viel, unter anderem Lenin, Marx, Engels, Stalin und Freud. Doch obwohl seine Jugend und seine frühen Erwachsenenjahre mit den „heroischen“ Jahren der peronistischen Bewegung in Argentinien (1944–52) zusammenfielen, stand er abseits jeglicher politischer Aktivität für oder gegen Juan und Eva Perón und ihre Bewegung.
Die Geschichte sollte dem jungen Arzt jedoch eine Gelegenheit bieten, Stellung zu beziehen. In Guatemala war Jacobo Árbenz, ein linksgerichteter Oberst, gerade zum Präsidenten gewählt worden. Er unterzeichnete 1952 ein Gesetz zur Landreform, verstaatlichte den Besitz des größten nordamerikanischen Unternehmens der Region – United Fruit – und griff den Landbesitz der lokalen Oligarchie an.
Als Guevara im Dezember 1953 zu einer Studienreise nach Guatemala kam, geriet er mitten in die Umwälzungen. Hunderte lateinamerikanische Linke kamen, um dieses „sozialistische Experiment“ mit eigenen Augen zu sehen.
Auf dem Weg nach Guatemala schrieb Guevara an seine Familie:
„Unterwegs hatte ich die Gelegenheit, durch die Ländereien von United Fruit zu fahren, was mich wieder daran erinnerte, wie schrecklich diese kapitalistischen Kraken sind. Ich habe vor einem Bild des alten und betrauerten Genossen Stalin geschworen, dass ich nicht ruhen werde, bevor ich diese kapitalistischen Kraken vernichtet gesehen habe.
In Guatemala werde ich mich selbst vervollkommnen und das erreichen, was nötig ist, um ein echter Revolutionär zu werden.“ (S. 126)
Das US-Außenministerium und die CIA verbrachten das Jahr 1953 damit, den Sturz von Árbenz zu planen. Eine Auseinandersetzung war unvermeidlich. Aber was sollte man dagegen tun? Guatemala war ein Schmelztiegel verschiedener Gruppen.
Guevara verurteilte die bürgerlich-nationalistischen Parteien wie die peruanische APRA und die bolivianische MNR für ihre Weigerung, die gewaltsame Revolution zu unterstützen. Obwohl er durch seine Lektüre bereits zu einem Bewunderer der „Erfolge“ der Sowjetunion geworden war, stand er den kommunistischen Parteien der Region kritisch gegenüber und behauptete, dass unter den gegenwärtigen Bedingungen keine Partei, die sich an den Wahlen in Lateinamerika beteiligte, wirklich revolutionär bleiben könne: „Er war kritisch gegenüber den kommunistischen Parteien, die sich seiner Meinung nach von den ‚arbeitenden Massen‘ entfernt hatten, indem sie taktische Bündnisse mit der Rechten eingegangen waren, um an die Macht zu kommen.“ (S. 132)
Deshalb weigerte er sich, der PGT (Kommunistische Partei Guatemalas) beizutreten, obwohl ihm das geholfen hätte, eine Stelle als Arzt in der Regierung von Árbenz zu bekommen.
Anderson merkt dazu an: „Zum ersten Mal in seinem Leben bekannte sich Ernesto offen zu einer politischen Sache. Er hatte sich, im Guten wie im Schlechten, für die linke Revolution in Guatemala entschieden.“ (S. 128)
In Randnotizen zu seinen Reisetagebüchern schrieb er über seine Entscheidung in etwas hysterischem Ton, der von einem langen Kampf eines Intellektuellen mit seinen eigenen Skrupeln zeugte:
„Ich, der ich eklektisch Doktrinen zerlege und Dogmen psychoanalysiere, heulend wie ein Besessener, werde Barrikaden oder Schützengräben stürmen, meine Waffe in Blut baden und, wahnsinnig vor Wut, jedem Feind, der mir in die Hände fällt, die Kehle durchschneiden.“ (S. 124)
Als die Aktivitäten der CIA zunahmen, kritisierte Che Árbenz dafür, dass er keine Volksmiliz zur Verteidigung der Regierung organisierte und bewaffnete. Kurz nach den Feierlichkeiten zu Ches 26. Geburtstag regnete es Bomben der US-Söldner:innen über Guatemala-Stadt und läutete den Beginn der Operation Erfolg ein; eine Invasionsstreitmacht marschierte aus Honduras in das Land ein. Che schloss sich tagsüber den Sanitätsbrigaden und nachts den Milizpatrouillen an. Ende Juni versuchte er, die Front zu erreichen, um in einem Krankenhaus zu helfen. Die ganze Zeit agitierte er dafür, dass Árbenz das Volk bewaffnen sollte, um den drohenden Verrat durch die Streitkräfte abzuwehren.
Am 3. Juli hatten die USA gewonnen und Árbenz trat zurück. Guevara versteckte sich in der argentinischen Botschaft, als die Jagd auf Linke begann. Mitte September konnte er ein Visum für Mexiko bekommen und Guatemala verlassen, um sich Tausenden anderen Flüchtlingen anzuschließen.
Im Dezember 1954 schrieb er seiner Mutter, um ihr seine Bekehrung zum Kommunismus zu erklären:
„Die Art und Weise, wie die Nordamerikaner … Amerika behandeln, hat in mir eine wachsende Empörung hervorgerufen, aber gleichzeitig habe ich die Theorie hinter den Ursachen ihres Handelns studiert und sie für wissenschaftlich fundiert befunden. Dann kam Guatemala.“ (S. 165)
Trotzdem hielt ihn seine Sehnsucht nach Abenteuern davon ab, sich einer Organisation anzuschließen: „Früher oder später werde ich der Partei beitreten; was mich derzeit mehr als alles andere davon abhält, ist, dass ich immer noch eine unglaublich starke Sehnsucht habe, Europa zu bereisen, und das kann ich nicht, wenn ich einer eisernen Disziplin unterworfen bin.“ (S. 165)
Che als kleinbürgerlicher Guerillakämpfer
In Mexiko-Stadt traf Guevara die Kubaner:innen, die er aus Guatemala kannte. Im Juli 1955 wurde er Raúl und Fidel Castro vorgestellt, die nach ihrer Freilassung aus dem Gefängnis in Kuba wegen ihrer Beteiligung am Angriff auf die Moncada-Kaserne 1953 nach Mexiko gekommen waren. Fidel Castro machte einen starken Eindruck auf Guevara, und als sie ihn einluden, sich ihrer Guerillabewegung als Arzt anzuschließen, nahm Che (der Spitzname, den er von den Kubaner:innen wegen seiner Gewohnheit, immer dieses Wort aus dem Guaraní für „Kumpel“ zu verwenden, erhielt) „sofort“ an. Von diesem Moment an bis zu seinem Tod 12 Jahre später unterwarf Che sich selbst und alle um ihn herum der „eisernen Disziplin“, die er zuvor gemieden hatte.
Von Anfang an war sich Che eines wichtigen Unterschieds zwischen sich und Fidel Castro bewusst. Für Guevara war „Politik ein Mechanismus für sozialen Wandel, und es war der soziale Wandel, nicht die Macht an sich, der ihn antrieb“ (S. 177), während Castros 26.-Juli-Bewegung keinerlei Einigkeit darüber hatte, welche grundlegenden sozialen Veränderungen in Kuba notwendig waren, wenn überhaupt. Sie wurde nur durch den Wunsch nach einem bewaffneten Kampf zum Sturz der von den USA unterstützten Diktatur von General Batista zusammengehalten.
Dieser Unterschied wurde im Juli 1956 deutlich, als die mexikanische Polizei die Kubaner:innen und Che festnahm. Bisher „sorgfältig gehütete Dokumente“ zeigen, dass Che während der Verhöre „jetzt offen seinen Kommunismus bekannte und seine Überzeugung von der Notwendigkeit eines bewaffneten revolutionären Kampfes nicht nur in Kuba, sondern in ganz Lateinamerika erklärte“. (S. 198)
Im November 1956 gipfelten 18 Monate der Vorbereitung und Ausbildung darin, dass Castro, Che und achtzig weitere auf der Granma nach Kuba in See stachen. Die Reise und die Landung in Kuba waren eine Katastrophe. Sie kamen zwei Tage zu spät an, und die Guerillagruppe, die auf sie wartete, hatte den Ort bereits verlassen. Sie gerieten in einen Hinterhalt, wurden beschossen und zerstreut. Che wurde verwundet, und nur achtzehn überlebten, um den Weg in die Berge der Sierra Maestra in der Nähe von Santiago zu finden. Erst Ende März konnten sie ihre zahlenmäßige Stärke wiedererlangen.
Ches Meinungsverschiedenheiten mit der Mehrheit der Bewegung des 26. Juli wurden bestätigt, sobald der Guerillakampf begann und Castro das zusammenbringen konnte, was Che als „diese jungen, meist aus der oberen Mittelschicht stammenden Stadtbewohner“ (S. 234) bezeichnete, die den Kern der Führung der Bewegung des 26. Juli bildeten. Anderson fasst zusammen:
„Im Allgemeinen betrachtete Che bereits Fidels Kollegen in der Bewegung des 26. Juli aufgrund ihrer Herkunft aus der Mittelschicht und ihrer privilegierten Ausbildung als hoffnungslos an bescheidene Vorstellungen davon gebunden, was ihr Kampf erreichen könnte, und er hatte Recht mit seiner Annahme, dass sie radikal abweichende Ansichten von seinen eigenen hatten. Da sie nicht seine marxistische Vorstellung von einer radikalen Umgestaltung der Gesellschaft teilten, sahen sich die meisten als Kämpfer für die Abschaffung einer korrupten Diktatur und deren Ersatz durch eine konventionelle westliche Demokratie …“ „Durch einzelne Gespräche“, schrieb er in seinem Tagebuch, „entdeckte ich die offensichtlichen antikommunistischen Neigungen der meisten von ihnen.“ (S. 235)
Angesichts des Kalten Krieges und der Geschichte des Katholizismus in Kuba waren auch die Basis-Mitglieder der Bewegung des 26. Juli (die hauptsächlich aus ländlichen Gebieten stammten) „überwiegend antikommunistisch“, und Castro weigerte sich aus diesem Grund, Che zum politischen Kommissar zu ernennen. Er wollte der US-Regierung und Batista keine Munition liefern.
Der zweijährige Guerillakrieg härtete Guevara und er schweißte eine gut trainierte, hochmotivierte Guerillagruppe zusammen. Er übernahm die gleichen Pflichten wie alle anderen und ertrug unendliche Leiden aufgrund seines Asthmas, das ihn oft bewegungsunfähig machte. Er scheute sich nicht, Verantwortung für die Durchsetzung einer strengen Disziplin zu übernehmen. Ein paar Tage nach Beginn der Kampagne schnappten die Rebell:innen einen Verräter, der als erster im Krieg hingerichtet wurde. Was „40 Jahre lang ein gut gehütetes Geheimnis“ war, wird in Ches privaten Tagebüchern enthüllt, nämlich dass „die Situation für die Leute und für E so unangenehm war, dass ich das Problem löste, indem ich ihm mit einer 32-Kaliber-Pistole in die rechte Seite des Kopfes schoss …“ (S. 237). Anderson kommentiert:
„Dieses Ereignis war der Ursprung für die Entstehung des Mythos um Che unter den Guerillakämpfern und Bauern in der Sierra Maestra. Von da an bekam er den Ruf, kaltblütig bereit zu sein, direkt gegen diejenigen vorzugehen, die die revolutionären Normen überschritten.“ (S. 238)
Die Unterstützung für die Guerillakämpfer aufzubauen, war entscheidend für den Erfolg des Krieges. Anfangs war die Unterstützung der Bäuer:innen für die Bewegung des 26. Juli zögerlich und unsicher und erfolgte aus reinem Eigeninteresse: Einige waren bezahlte Schmuggler:innen oder lieferten Lebensmittel gegen Geld. Aber Che nutzte seine medizinischen Kenntnisse, um Kliniken zu eröffnen, was dazu beitrug, die Unterstützung unter den Bäuer:innen zu erhöhen. Bald erkannte er auch, was noch wichtiger war, dass eine praktische, sofortige Landreform, wie in Maos chinesischer Revolution, entscheidend war.
Obwohl verschiedene Dekrete von der Rebellenarmee „erlassen“ wurden, wurde eine Landreform in der Praxis erst im Herbst 1957 mit den umfangreichen Viehdiebstählen von den Großgrundbesitzer:innen und der Verteilung des Viehs an die Bäuer:innen „eine der beliebtesten Maßnahmen der Rebellenarmee“ (S. 305) laut Anderson.
Ches „marxistische“ Überzeugung wurde im Laufe des Krieges immer stärker, was ihn zunehmend in Konflikt mit dem rechten Flügel der 26.-Juli-Bewegung brachte, der die Stadtzellen unterhalb der Berge („Llano“) dominierte. Gegen Ende des ersten Jahres kam es zu offenen Spannungen zwischen Che und den Anführer:innen des Llano. Armando Hart und „Daniel“ waren sauer, dass der radikale Marxist Che das Sagen über seine eigene Kolonne und seine eigenen Versorgungslinien in die Stadt hatte.
Der Konflikt gipfelte in einem heftigen Streit über den Pakt von Miami (November 1957), der von allen kubanischen Oppositionellen unterzeichnet worden war und der Bewegung des 26. Juli die Mehrheit der Führungspositionen in einer neuen kubanischen Befreiungsjunta zusicherte. Der rechte Flügel hatte ihn im Namen der Bewegung des 26. Juli unterschrieben, aber damit einen Pakt unterzeichnet, der die Auflösung der Bewegung des 26. Juli nach dem Sturz Batistas forderte und sich offen „an Washington wandte“.
In einem Brief an Daniel stellte Che klar: „Ich gehöre zu denen, die glauben, dass die Lösung der Probleme der Welt hinter dem sogenannten Eisernen Vorhang liegt, und ich sehe diese Bewegung als eine von vielen, die vom Wunsch der Bourgeoisie inspiriert sind, sich von den wirtschaftlichen Fesseln des Imperialismus zu befreien.“ (S. 757)
Daniel antwortete im Namen der Führung der Llano:
„Wir wollen ein starkes Amerika, Herr über sein eigenes Schicksal, ein Amerika, das stolz den Vereinigten Staaten, Russland, China oder jeder anderen Macht, die seine wirtschaftliche und politische Unabhängigkeit untergraben will, die Stirn bieten kann.
Auf der anderen Seite glauben diejenigen, die deinen ideologischen Hintergrund haben, dass die Lösung für unsere Probleme darin besteht, uns von der schädlichen ,Yankee-Dominanz’ mit Hilfe einer nicht weniger schädlichen ,sowjetischen Dominanz’ zu befreien.“ (S. 758)
Nachdem Castro den Miami-Pakt abgelehnt hatte, wurde Che offener in Bezug auf seinen „Marxismus“. Entgegen der offiziellen kubanischen Meinung, dass der Weg zu sozialistischen Ideen innerhalb der Bewegung des 26. Juli als Ergebnis einer „organischen Verschmelzung“ mit dem Leben der Massen während des Krieges entstanden sei, war klar, dass Che von Anfang an ein systematischer Propagandist seines Programms war. Im Sommer 1957 schickte die kubanische stalinistische Partei PSP einen jungen Kader, Pablo Ribalta, um mit Che zusammenzuarbeiten und eine Schule für politische Bildung in den Bergen aufzubauen.
Anderson merkt an, dass „die jungen Kämpfer unbeschriebene Blätter waren, auf die Che einen bleibenden Eindruck machte“, und ein junger Kämpfer erinnerte sich an ein Gespräch unter ihnen zu dieser Zeit: „Es gibt ein großes Geheimnis um seine Bücher, und sie lesen sie nachts in einem geschlossenen Kreis. So arbeitet er, zuerst rekrutiert er diejenigen, die ihm am nächsten stehen, und später verbreiten sie es unter den Truppen.“ (S. 298)
Castros Haltung zum Marxismus war zweideutig. Er war weder Kommunist noch Antikommunist. Während Che zu dieser Zeit ideologisch an das sowjetische Wirtschaftsmodell gebunden war, schrieb Castro Ende 1957 Artikel, in denen er die freie Marktwirtschaft verteidigte, gegen die Verstaatlichung argumentierte und sich für eine Junta aus Intellektuellen der Mittelschicht als Führung des neuen Kubas aussprach.
In einem Interview im Sommer 1958 erklärte Che einem Journalisten, Fidel sei ein „revolutionärer Nationalist“ und er selbst ein „Marxist“ (S. 309). Andererseits erkannte Castro, wie wichtig es war, mit den kubanischen Stalinist:innen zusammenzuarbeiten, da sie wichtige Gewerkschaften in den Städten kontrollierten und auch bei den Kleinbäuer:innen viel Unterstützung hatten.
Obwohl die PSP anfangs gegen den Guerillakrieg war, ging sie bald von Solidarität dazu über, aktiv mit der Bewegung des 26. Juli in den Llanos zusammenzuarbeiten und Mitglieder zum Kampf in die Rebellenarmee in der Sierra zu schicken.
Der rechte Flügel war aber gegen die Zusammenarbeit mit der PSP. Der Konflikt kam zu einem Höhepunkt, als der für April 1958 ausgerufene Generalstreik scheiterte, nicht zuletzt weil die Führung der Llanos sich weigerte, mit der PSP zusammenzuarbeiten.
Danach wandte sich Castro gegen die Llano-Führer:innen im Direktorium und schloss sie bei dessen Sitzung am 1. Mai aus. Castro erkannte, dass die politische Revolution gegen Batista nur gelingen konnte, wenn die Volksfront die PSP einschloss. Che nutzte das veränderte Kräfteverhältnis, um die Zusammenarbeit mit der PSP in den letzten Monaten des Krieges zu vertiefen. Im Herbst 1958 zog Ches Kolonne nach Las Villas und Escambray und knüpfte enge Beziehungen zu den Kolonnen der PSP, die zuvor von den Anführer:innen der Bewegung des 26. Juli gemieden worden waren. Es war Che, der die Rebellenarmee in der entscheidenden Schlacht um Santa Clara im Dezember 1958 anführte. Mit diesem Sieg brachen die kubanische Armee und der Staat zusammen.
Batista floh ins Ausland. Ein Generalstreik sorgte dafür, dass Havanna relativ leicht in die Hände der Rebellenarmee fiel.
Die Schaffung eines degenerierten Arbeiter:innenstaates in Kuba
Che kam am 2. Januar 1959 in der Hauptstadt an. In den folgenden 18 Monaten bestand die Regierung aus linksgerichteten Prostalinist:innen und landbesitzerfreundlichen Nationalist:innen. Eigentlich war es eine Volksfront. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Mehrheit der Anführer:innen der Bewegung des 26. Juli, einschließlich Castro, nicht die Absicht, den Kapitalismus in Kuba zu stürzen. Aber obwohl Castro Mitglieder des rechten Flügels in wichtige Ministerien berief und die USA das neue Regime sofort anerkannten, lag die Macht nicht bei diesen Minister:innen.
Sie lag bei der Rebellenarmee, und die Rebellen waren fest entschlossen, den Misserfolg von Árbenz in Kuba nicht zu wiederholen. Die USA-freundliche Rechte durfte nicht an der Macht teilhaben. In den ersten Monaten des Jahres 1959 waren Che und Raúl Castro dafür verantwortlich, den Wiederaufbau des Staatsapparats, insbesondere der Armee, zu überwachen.
Es gab große Säuberungen von Leuten, die nicht umerzogen und in die neuen Streitkräfte integriert werden konnten. Die G-2 wurde als neue Geheimpolizei gegründet, mit einem Mitglied des Politbüros der PSP als stellvertretendem Chef.
Che startete im März 1959 auch politische Schulungskurse in der kubanischen Armee, die sich mit der Gesellschaftsstruktur der Sowjetunion, dem Leben Lenins usw. befassten. Che war direkt an der Ausübung der revolutionären Gerechtigkeit gegenüber denjenigen beteiligt, die sich unter dem Batista-Regime der schlimmsten Verbrechen schuldig gemacht hatten. Mehr als 1.000 Kriegsgefangene wurden inhaftiert.
Gerichtsverfahren, die Anderson als „ehrliche, wenn auch summarische Veranstaltungen“ (S. 387) bezeichnet, wurden mit Verteidiger:innen und Staatsanwält:innen organisiert. Die Opfer durften bei keinem dieser Verfahren, die oft sechs bis acht Stunden dauerten, anwesend sein. Che war Oberstaatsanwalt im Berufungsgericht.
In den ersten Monaten wurden mehrere Hundert wegen ihrer Rolle bei Folter und Mord angeklagt und von Erschießungskommandos hingerichtet. Eduardo Galeano, ein uruguayischer Journalist, nannte Che den „Jakobiner der Revolution“ (S. 609). Der Wiederaufbau des Staatsapparats in Kuba ging mit einer Reihe von sozialen Reformen einher.
Che drängte von Anfang an auf radikalere Maßnahmen als die offizielle Regierungspolitik. In einer Rede am 27. Januar, „Die sozialen Pläne der Rebellenarmee“, forderte er eine radikalere Landreform, ein Programm zur Industrialisierung, Protektionismus und die Umorientierung der Märkte weg von den USA.
Er forderte die Verstaatlichung der kubanischen Bodenschätze, der Stromerzeugung und der US-amerikanischen Telekommunikationsgesellschaft (ITT). Er sprach sich auch für Maßnahmen wie die Verkürzung des Arbeitstages zur Steigerung der Beschäftigung aus, was Castro aber ablehnte.
Die im ersten Jahr umgesetzten Maßnahmen reichten jedoch aus, um große Spaltungen innerhalb der Volksfrontregierung zu verursachen. Im Sommer 1959 führte das Agrargesetz zu Unruhen innerhalb der Bewegung des 26. Juli und zu einer Polarisierung zwischen Castro und Huber Matos, wobei letzterer sich für die Sache der Landbesitzer:innen einsetzte. Castro erkannte, dass solche Maßnahmen notwendig waren, wenn er seine soziale Basis unter den Anhänger:innen der Bewegung des 26. Juli auf dem Land erhalten wollte.
Der Widerstand zwang Castro im Juni, eine Gruppe bürgerlicher Minister:innen zu entlassen. Im Juli provozierte Castro Streiks und Demonstrationen, bei denen der Rücktritt von Präsident Manuel Urrutia gefordert wurde, weil er die Vorwürfe der USA bezüglich einer „kommunistischen Unterwanderung“ akzeptiert hatte. Alle Minister:innen wurden durch Castro-treue Mitglieder der Bewegung des 26. Juli ersetzt.
Vorläufig ließ Castro die bürgerlichen Minister:innen weiterhin die Wirtschaftsressorts leiten. Eine weitere Runde von USA-inspirierten Angriffen und Kritik im Oktober und November zwang Castro jedoch, die Volksfrontregierung endgültig zu spalten. Er entließ alle bis auf einen der verbleibenden bürgerlichen Minister:innen.
Er räumte im Verteidigungsministerium auf und verkleinerte die Armee um die Hälfte. Che organisierte in der Zwischenzeit die erste Volksmiliz. Die neue Regierung, die sich um den linken Flügel der Bewegung des 26. Juli und die PSP bildete, war immer noch verpflichtet, den kubanischen Kapitalismus zu verteidigen, auch wenn sie die Großgrundbesitzer:innen und die aggressiven Interessen der USA angriff.
Sie führte eine Reihe radikaler Maßnahmen zur Umgestaltung des Landbesitzes durch. Im Januar 1960 enteignete die Regierung alle großen Viehzuchtbetriebe ohne Entschädigung und alle Zuckerrohrplantagen, einschließlich derjenigen in US-Besitz. Am 19. Januar wurden alle großen Landgüter übernommen.
Trotz ihrer Radikalität und ihrer Kontrolle über die Streitkräfte machte die Verpflichtung der Regierung zur Verteidigung des Kapitalismus sie zu einer linken Version dessen, was die revolutionäre Komintern als „bürgerliche Arbeiter:innenregierung“ bezeichnete. Aber die kubanische Revolution stand nun an einem Scheideweg. Diese Phase einer bürgerlichen Arbeiter:innenregierung war ein Wendepunkt zwischen Castros ursprünglichem Maximalprogramm und der radikaleren sozialen Umgestaltung, die Che von Anfang an im Sinn hatte.
Die Maßnahmen der USA in der ersten Hälfte des Jahres 1960 zwangen Castro, sich noch stärker in Ches Richtung zu bewegen. Versuche, Kubas Handelsbeziehungen zu diversifizieren, indem Zucker an die Sowjetunion verkauft und im Gegenzug Öl bezogen wurde, stießen auf Widerstand der USA. Als die Ölfirmen sich weigerten, das aus der Sowjetunion kommende Rohöl zu raffinieren, übernahm die Regierung am 29. Juni alle Ölraffinerien. Kurz darauf folgte im Juli ein Dekret, das die Verstaatlichung allen US-Eigentums in Kuba erlaubte. Zwischen August und Oktober wurden 166 US-Firmen sowie alle privaten kubanischen Industriebetriebe verstaatlicht. Bis zum Jahresende waren 80 Prozent der gesamten kubanischen Industrie in staatlicher Hand.
Zu keinem Zeitpunkt war die kubanische Arbeiter:innenklasse als eigenständige Kraft an diesem Prozess beteiligt. Zu keinem Zeitpunkt ging die Initiative für diese umfassenden Maßnahmen von den Organisationen der Arbeiter:innen aus. Es gab keine unabhängigen und demokratischen Arbeiter:innenräte, die die Revolution in Russland 1917 gemacht haben. In Kuba war die Rolle der Arbeiter:innenklasse auf eine Vorzeigearmee beschränkt, die auf die Aufforderung der Regierung reagierte, für die von den Führer:innen ergriffenen Maßnahmen zu demonstrieren.
Der Präzedenzfall für diese Entwicklung lag nicht in den Kategorien der Komintern für Arbeiter:innenregierungen und auch nicht in der russischen Revolution von 1917. Er lag in der stalinistischen bürokratischen „Revolution“, die nach dem Zweiten Weltkrieg folgte. Unter imperialistischem Druck waren die Stalinist:innen gezwungen, gegen den Kapitalismus vorzugehen, um ihr eigenes Überleben zu sichern. Aber ihr Sturz des Kapitalismus war ein bürokratischer Akt, der die Arbeiter:innenklasse komplett aus der politischen Macht ausschloss. Sie setzten das auf, was wir als bürokratische antikapitalistische Arbeiter:innenregierungen bezeichnet haben. Der gleiche Prozess spielte sich nun in Kuba ab.
Dass die Regierung im Sommer 1960 zu einer bürokratischen antikapitalistischen Arbeiter:innenregierung wurde, war nicht nur das Ergebnis der Feindseligkeit der USA. Das war über einen langen Zeitraum durch die Konsolidierung eines wiederaufgebauten Staatsapparats und einer Einparteienstruktur unter der Führung von Che und Raúl Castro vorbereitet worden.
Aber sie war auch möglich, weil die Sowjetunion immer mehr bereit war, den wirtschaftlichen, diplomatischen und militärischen Rahmen für Kuba zu schaffen, um ein degenerierter Arbeiter:innenstaat zu werden, sobald die Entscheidung getroffen war, kubanisches und nordamerikanisches kapitalistisches Eigentum zu enteignen.
Wieder stand Che im Mittelpunkt und schmiedete diese neue Verbindung zwischen der Sowjetunion und der kubanischen Regierung. Andersons Buch bringt neue Beweise dafür.
Die Einmischung der Sowjetunion
Anderson schreibt, dass „ein Rätsel, das sich über die Jahre gehalten hat, die Frage ist, wann sich die Sowjetunion in die kubanische Revolution eingemischt hat“.
Die offizielle Linie derjenigen, die zu dieser Zeit an der Kubapolitik des Kremls beteiligt waren, lautet nun, dass „der sowjetische Ball erst nach Castros Rebellen-Sieg ins Rollen kam“ (S. 414), obwohl erste informelle Kontakte zwischen Kreml-Agent:innen und Che bereits 1955 in Mexiko-Stadt stattfanden. Anderson behauptet aber, dass alle Beweise darauf hindeuten, dass der Kreml ab Mitte 1958, als der Sieg möglich schien, aktives Interesse am Schicksal der kubanischen Revolution zeigte, genau zu dem Zeitpunkt, als die PSP begann, ihr Gewicht hinter Castros Flügel der 26. Juli-Bewegung in der Sierra zu werfen.
Zu dieser Zeit war die Führung der KPdSU allerdings sehr „skeptisch“, weil „die Revolution nicht das Ergebnis der Strategie der PSP war, die Partei hatte keine Kontrolle darüber“ (S. 415).
Die Lateinamerika-Abteilung des Zentralkomitees der KPdSU sah darin natürlich eine bürgerliche Revolution, auch wenn sie deren USA-feindliche Haltung begrüßte. Als die PSP 1959 nach Moskau kam, um den Kreml davon zu überzeugen, dass für Kuba ein „sozialistischer Kurs“ möglich sei, ließ sich der Kreml nicht überzeugen.
Außerdem waren die Beziehungen zwischen den USA und der Sowjetunion zu dieser Zeit ziemlich stabil. Erst am 1. Oktober 1959 kam der erste Kreml-Vertreter und redete mit Che und Castro. Beide Seiten waren sich einig, die diplomatischen und Handelsbeziehungen zur Sowjetunion langsam zu öffnen. Vizepremier Mikojan besuchte Kuba im Februar 1960 auf einer Handelsreise, die zur Unterzeichnung eines neuen Zuckerabkommens und zu Kreditgarantien für die Industrialisierung führte. Mikojans Gespräche in Kuba deuteten laut Andersons Interviews darauf hin, dass sowohl Che als auch Castro „ein sozialistisches Kuba wollten und die Hilfe der Sowjetunion brauchten, um dies zu erreichen“.
Zu diesem Zeitpunkt baten sie noch nicht um militärische Hilfe, aber einen Monat später, als ein Schiff mit belgischen Waffen in Havanna gesprengt wurde, forderte Castro Waffen an. Chruschtschow stimmte zu, und kurz darauf wurden im Mai die diplomatischen Beziehungen wieder aufgenommen.
Zu diesem Zeitpunkt, mit militärischer Hilfe gesichert, fühlte sich Castros Regierung „stark genug, um es mit den Amerikanern aufzunehmen“ (S. 466). Im Sommer 1960, als jede Woche Waffen und Berater:innen eintrafen, begann die kubanische Regierung mit der Enteignung von US-amerikanischen und kubanischen Industriebetrieben.
Che festigte die neuen Verbindungen zwischen der kubanischen bürokratischen Arbeiter:innenregierung und dem Kreml, indem er an den Feierlichkeiten zum Jahrestag der Oktoberrevolution in Moskau teilnahm, gefolgt von einer zweimonatigen Reise durch Osteuropa und China im November und Dezember 1960.
Während des gesamten Jahres 1961 war Che an vorderster Front dabei, um die Konsolidierung eines Staates und eines Parteiapparats, der mit einem stalinistischen Einparteienstaat vergleichbar war, weiter zu überwachen: die Angriffe und die Unterdrückung der linksgerichteten trotzkistischen Kritiker:innen des Stalinismus; die Fusion der alten PSP und der 26. Juli-Bewegung zu einer neuen Partei (ORI, Organizaciones Revolucionarias Integradas; integrierte revolutionäre Organisationen) im Juli 1961. Che befehligte im April Truppen vor Havanna, als die neue Militärmaschine die Bedrohung durch die von den USA unterstützte Invasionsstreitmacht in der Schweinebucht abwehrte. Nach diesem Zusammenstoß war es Che, der immer wieder darauf drängte, sowjetische Raketen in Kuba zu stationieren, und zweimal nach Moskau reiste, um das Abkommen auszuhandeln.
Anderson verrät, dass Che im August 1961 während einer Reise nach Brasilien eine/n Mitarbeiter:in von Präsident Kennedy zu geheimen Gesprächen traf und schadenfroh darauf hinwies, dass das Fiasko in der Schweinebucht schließlich das Schicksal der kubanischen Revolution besiegelt habe – ihre Stalinisierung. Der/Die Mitarbeiter:in berichtete, Che hätte gesagt, dass „sie ein Einparteiensystem mit Fidel als Generalsekretär der Partei errichten werden. Ihre Verbindung zum Osten kommt von natürlichen Sympathien und gemeinsamen Ansichten über die Machtstruktur der Gesellschaft.“ (S. 518f)
Vor allem Che kontrollierte als Chef der Nationalbank und der INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria; nationales Institut für Agrarreform) die beiden entscheidenden Wirtschaftsorgane, die ab Anfang 1962 dazu beitrugen, einen gemeinsamen Wirtschaftsplan für die kubanische Wirtschaft vorzubereiten. Die Umsetzung dieses Plans markierte die letzte Handlung der bürokratischen Arbeiter:innenregierung in ihrer Aufgabe, einen degenerierten Arbeiter:innenstaat zu schaffen.
Ches Unterstützung für ein „Einparteiensystem“ in Kuba im Jahr 1961 zeigte seine stalinistische Einstellung zur Demokratie während des Übergangs zum Sozialismus. Castro lehnte es ab, über die Abhaltung irgendwelcher Wahlen zu diskutieren, und glaubte, dass jede demokratische Versammlung nur ein „Spiegel unserer Uneinigkeit“ wäre und den Feind:inneen der kubanischen Revolution helfen würde. „Einheit“ um Fidel als revolutionären Bonaparatisten sei der einzige und wesentliche Schutz der Revolution.
Che stimmte der Ablehnung von Wahlen zu. Aber er glaubte, dass der Übergang zum Sozialismus eine institutionalisierte Rolle für die Massen erforderte. Er sagte 1961 zu Maurice Zeitlin, einem US-Professor, dass „unsere Aufgabe darin besteht, die Demokratie innerhalb der Revolution so weit wie möglich auszubauen und … Kanäle für den Ausdruck des Volkswillens zu gewährleisten“.
Aber welche Art von „Ausdruck des Volkswillens“ stellte sich Che vor? Als Che 1961 die „Konferenz über die Produktion“ einberief, wurde, wie K. S. Karol in seinem Buch Guerillas in Power betont, drei Tage lang „von niemandem auch nur die Frage nach der Volksdemokratie oder der Arbeiter:innenkontrolle gestellt“.
Tatsächlich glaubte Che nicht an die Herrschaft der Arbeiter:innen in der Industrie oder daran, dass der Staat durch souveräne Arbeiter:innen- und Bäuer:innenräte unmittelbar und direkt gegenüber der Masse der Arbeiter:innen verantwortlich sein sollte. Sein Stalinismus führte zu der Überzeugung, dass die Interessen des Volkes und seines Staates identisch seien und dass die „Avantgarde“ – also die Führung – in der besten Position sei, diese Interessen zu interpretieren.
Aber Che glaubte tatsächlich an mehr als nur Überwachung durch die Geheimpolizei und gelegentliche Volksabstimmungen. Er trug dazu bei, von Anfang an verschiedene Formen des „Ausdrucks des Volkswillens“ zu schaffen. Die Nachbarschaftsgerichte und die Komitees zur Verteidigung der Revolution (CDR) waren Instrumente der Kontrolle und Überwachung, aber sie waren auch Foren des Dialogs. Allerdings war es ein Dialog zwischen der organisierten Führung und den unorganisierten und zersplitterten Massen. Ohne das Recht, Gruppen, Fraktionen und Parteien zu bilden, konnten die allmächtigen Führer:innen niemals ersetzt werden. Sie waren keine Organe der Macht und Kontrolle, sondern Kanäle für die Kommunikation von oben nach unten zu den Massen und Sicherheitsventile, um elementare Unzufriedenheit zu registrieren.
Als Che 1965 Kuba verließ, waren seine Ansichten über die Rolle der Massen in der Demokratie noch paternalistischer geworden. In „Der Mensch und der Sozialismus in Kuba“ gibt er ein Beispiel dafür, wie diese „direkte Demokratie“ funktionierte:
„Wir nutzen die fast intuitive Methode, unsere Ohren offen zu halten für die allgemeinen Reaktionen auf die Probleme, die sich stellen. Fidel Castro ist ein Meister darin … Bei den großen öffentlichen Versammlungen kann man etwas von dem Dialog zwischen zwei Stimmgabeln beobachten, deren Schwingungen neue Schwingungen beim anderen hervorrufen … eine dialektische Einheit, die zwischen dem Einzelnen und der Masse besteht.“
Diese herablassende Haltung gegenüber den kubanischen Massen, diese Weigerung, ihnen echte Macht über die Entscheidungen zu geben, die ihr Leben betreffen, ist einer der schlimmsten Aspekte des Erbes von Che Guevara.
Ches verlorene Illusionen über die Sowjetunion und seine Sympathien für den Maoismus
Im Gegensatz zu Che weigerte sich Castro vor 1961, sich als irgendeine Art Sozialist zu bezeichnen. Anderson deutet aber an, dass Castro wahrscheinlich schon kurz nach dem Sturz Batistas (wenn nicht sogar schon vorher) mit dem „sozialistischen Kurs“ der Revolution verbunden war, aber ein geschicktes Spiel spielte, um der kubanischen Revolution 1959–60 Zeit zu verschaffen, indem er versuchte, die USA zu beruhigen. So konnte er den Staatsapparat umstrukturieren und Kubas militärische Verteidigung aufbauen, bevor er (und nicht die USA) den unvermeidlichen Bruch mit Washington provozierte.
Eigentlich versuchte Castro zwei Jahre lang, das Programm der „olivgrünen“ Revolution und den „dritten Weg“ zwischen Kommunismus und Kapitalismus umzusetzen, bevor der Widerstand des nordamerikanischen und kubanischen Kapitals gegen das Programm der Bewegung des 26. Juli für eine radikale Landreform und diversifizierte Handelsbeziehungen Castro vor das Dilemma stellte: entweder aufzugeben oder weiter zu gehen, als er selbst wollte.
Er entschied sich für Letzteres und verkündete schließlich während der Invasion in der Schweinebucht im April 1961 den „sozialistischen“ Charakter der kubanischen Revolution. In den folgenden zwei Jahren übertraf Castro Che in seiner Loyalität gegenüber der Sowjetunion, während Che einen Prozess der Desillusionierung gegenüber dem „Sozialismus“ in der Sowjetunion durchlief und sympathisches Getöse um China machte.
Nach der öffentlichen chinesisch-sowjetischen Spaltung im Oktober 1961 nutzten die alten, Moskau-treuen Stalinist:innen der PSP ihren Einfluss, um ihre Leute in den Staatsapparat und die Partei Kubas zu bringen. Castro hatte nicht vor, sich zur Galionsfigur der kubanischen Stalinist:innen zu machen, um dann beiseite geschoben zu werden, wenn sie ihre Macht gefestigt hatten. Im März 1962 griff Castro das „Sektierertum“ der PSP-Führer:innen an und entließ den Parteichef Anibal Escalante. Che war darüber sehr erfreut, da er „die Heiliger-als-du-Apparatschiks in der Partei verabscheute, die ganz Kuba sich selbst und ihre eigenen ideologischen Richtlinien aufzwingen wollten“.
Schon während seines China-Besuchs im Dezember 1960 lobte Che die chinesische Revolution als Vorbild für Kuba, was seine sowjetischen Unterstützer:innen zu einer Zeit verärgerte, als sich eine Spaltung zwischen Moskau und Peking abzeichnete.
Die einzigen chinesischen Techniker:innen in Kuba waren tatsächlich diejenigen, die mit Ches Ministerium verbunden waren, und Che gab Leuten Arbeit, die wegen der Säuberungen der PSP ihren Job verloren hatten. Als Industrieminister war er schnell enttäuscht von der schlechten Qualität der sowjetischen technischen Hilfe und Ausrüstung. Schon bei seiner ersten Reise in die Sowjetunion war er schockiert und genervt von den Privilegien der russischen Bürokratie, und 1964 nannte er Russland wegen der Bedingungen, unter denen die Arbeiter:innen leben mussten, einen „Schweinestall“.
Die kubanische Raketenkrise im Oktober 1962, als der Kreml vor Kennedys Ultimatum zurückwich, war für Che ein Wendepunkt. Er forderte immer wieder den Einsatz der Raketen gegen die USA und betonte, dass er sie abgefeuert hätte, wenn er das Kommando gehabt hätte. Che verurteilte den Verrat des Kremls.
Die Differenzen zwischen Che und Castro waren 1963 erheblich geworden. Bei einem Besuch in Moskau im Frühjahr desselben Jahres stellte sich Castro eindeutig auf die Seite Moskaus in der chinesisch-sowjetischen Spaltung.
Anfang 1964 reiste Castro erneut nach Moskau und kehrte loyaler denn je gegenüber Moskau zurück und tat alles, um die „friedliche Koexistenz“ mit den USA zu loben. Che verurteilte hingegen die Strategie der „friedlichen Koexistenz“.
Anderson betont auch, dass Guevara in der Öffentlichkeit „äußerst kritisch gegenüber den westlichen kommunistischen Parteien war, weil sie die ‚friedliche parlamentarische Strategie zur Machtübernahme’ angenommen hatten. Er sagte, dass dies die Arbeiterklasse der herrschenden Klasse an Hände und Füße binden würde“ (S. 545).
Während Castro bis zu Ches Tod bereit war, Ches „Auslandsabenteuer“ aus taktischen Gründen als Verhandlungsinstrument gegenüber den USA zu unterstützen, war Che strategisch an ein allgemeines Programm antiimperialistischer Kriege gegen von den USA unterstützte Staaten gebunden. Mit diesem Ziel vor Augen verstärkte Che 1962 und 1963 seine Bemühungen, Guerillatruppen für den Krieg in Argentinien, Nicaragua, der Dominikanischen Republik, Bolivien und Peru zu organisieren. Das machte den Kreml nervös, weil sie nach der Raketenkrise weitere Zusammenstöße mit den USA vermeiden wollten und befürchteten, dass Ches Vision von Guerillakriegen in Lateinamerika genau das bewirken könnte.
Anderson schreibt:
„Für Che war der Begriff ‚friedliche Koexistenz‘ ein Gräuel, nicht viel mehr als eine Beschönigung des imperialistischen Systems in diplomatischer Sprache. Vorerst hielt er sich zurück, aber es gab keinen Zweifel mehr daran, dass sich seine und Fidels Wege zu trennen begannen.
Fidels Ziel war es, Kubas wirtschaftliches Wohlergehen und sein eigenes politisches Überleben zu sichern, und dafür war er zu Kompromissen bereit. Ches Aufgabe war es, die sozialistische Revolution zu verbreiten.“ (S. 587).
Castro startete im Sommer 1964 eine Versöhnungsoffensive, um den Ausgang der bevorstehenden Präsidentschaftswahlen in den USA zu beeinflussen. In einer Rede am 26. Juli bot er an, die Unterstützung anderer Revolutionär:innen einzustellen und sich an die „Normen des Völkerrechts“ zu halten (S. 602).
Er bot an, die Unterstützung für die revolutionären Bewegungen in Lateinamerika einzustellen, wenn die Feindseligkeiten gegenüber Kuba aufhörten. Che ignorierte das und hielt zur gleichen Zeit eine öffentliche Rede in Santa Clara, in der er behauptete, es sei die gemeinsame Pflicht aller Kubaner:innen, den Imperialismus „überall, wo er auftritt, und mit allen uns zur Verfügung stehenden Waffen“ zu bekämpfen. (S. 603). Am 15. August in Havanna sprach sich Che scharf gegen eine friedliche Koexistenz aus und forderte erneut einen Atomkrieg, wenn nötig, um den Imperialismus zu besiegen.
Bis zum Sommer 1964 war der Kreml natürlich sehr misstrauisch gegenüber Che:
„Im direkten Gegensatz zur Politik der ‚friedlichen Koexistenz‘ hatte er unermüdlich zum bewaffneten Kampf aufgerufen, seine Betonung des Guerillakampfes auf dem Land und seine hartnäckige Entschlossenheit, Oppositionelle in den kommunistischen Parteien – sogar Trotzkisten – trotz der Proteste ihrer nationalen Organisationen auszubilden, zu bewaffnen und zu finanzieren, hatten zu einem wachsenden Misstrauen in Moskau geführt, dass er an Maos Spiel beteiligt sei.“ (S. 579).
Schließlich reiste Metutsow, Mitglied des Zentralkomitees der KPdSU, nach Kuba und traf sich mit Che. Er kam zu dem Schluss, dass Che zwar ein gesunder „Marxist-Leninist“ sei, „man aber wirklich sagen kann, dass Che Guevara aufgrund seines maoistischen Slogans, dass das Gewehr die Macht schafft, vom Maoismus infiziert war. Und er kann sicherlich als Trotzkist betrachtet werden, da er nach Lateinamerika gereist ist, um die revolutionäre Bewegung anzuregen“ (S. 585).
Ches Beziehung zu seinem alten Kameraden Raúl Castro, der nun eng mit den Verteidigungschef:innen der Sowjetunion zusammenarbeitete, hatte sich 1964 „stetig verschlechtert, bis sie schließlich zu einer Feindschaft wurde“. (S. 597)
Die ideologische Spaltung zwischen Che und dem Kreml zeigte sich auch in den Debatten über Kubas Wirtschaftspolitik. Seit 1961 hatte Che als Chef der Nationalbank dafür plädiert, dass Kuba Sozialismus und Kommunismus gleichzeitig erreichen könne, indem es Industrie und Landwirtschaft nach einem einheitlichen Wirtschaftsplan organisiere. Er setzte sich für ein stark zentralisiertes und bürokratisiertes Planmodell ein, ein System der Haushaltsfinanzierung, das in seiner Struktur der Planwirtschaft der Sowjetunion unter Stalin in den 1930er Jahren ähnelte, jedoch mit einem großen Unterschied.
Guevara war sehr kritisch gegenüber der Verwendung materieller Anreize für die Arbeiter:innen als Hauptmittel zur Steigerung der Produktion und Leistung. Stattdessen behauptete er, wieder auf den Maoismus zurückgreifend, dass der „neue Mensch“ und das „kommunistische Bewusstsein“ nur erreicht werden könnten, wenn die Arbeiter:innenklasse die Idee der Aufopferung für das Wohl der Gemeinschaft verstehe und danach handle. Mit diesem Ziel führte Che samstags „freiwillige Arbeitsbrigaden“ ein.
In den Jahren 1962–64 tobte außerdem eine theoretische Debatte, die diese Frage widerspiegelte: nämlich ob das „Wertgesetz“ während des Übergangs zum Sozialismus funktionierte. Che brachte keine neuen Erkenntnisse in diese Debatte ein, hatte aber im Großen und Ganzen Recht mit seiner Kritik an den PSP-Ökonom:innen, die die stalinistische Auffassung vertraten, dass es das weiterhin gäbe und es unter dem Sozialismus nur „durchsichtiger“ und daher kontrollierbarer sei.
Eines von Ches letzten Werken (immer noch unveröffentlicht) war eine heftig kritische Sammlung von Randbemerkungen zu Stalins Lehrbuch über die politische Ökonomie der Sowjetunion. Che hat verstanden, dass dieser theoretische Fehler ein größeres Ziel hatte, nämlich die zunehmende Tendenz im Ostblock zu rechtfertigen, Marktindikatoren (wie Unternehmensgewinne) als Instrumente einer Wirtschaftspolitik zu nutzen, die laut Che zurück zum Kapitalismus führt.
Aber Ches eigene Ansichten über den Übergang zum Sozialismus waren insofern durch und durch stalinistisch, als sie auf dem stalinistischen Ausgangspunkt des Sozialismus in einem Land beruhten, was grundsätzlich unmöglich und für eine kleine und wenig entwickelte Insel wie Kuba wirklich absurd war. Aber wie Mao legte er einen starken voluntaristischen Akzent auf diesen Prozess. Che hat die Entwicklung des Bewusstseins von seiner materiellen Grundlage in der massiven Steigerung der Arbeitsproduktivität, die notwendig sein wird, um den allgemeinen Mangel an Gütern zu überwinden und gleichzeitig eine umfassende Verkürzung der Arbeitszeit zu ermöglichen, abgeschnitten. Die beiden letztgenannten Bedingungen sind entscheidend für jeden qualitativen Sprung im Gemeinschaftsdenken und in solidarischen Ideen und dafür, dass egoistische und selbstsüchtige wirtschaftliche Motive überflüssig und kontraproduktiv werden.
Ches Glaube, dass die Masse der Arbeiter:innen dies durch subjektives Engagement für Mehrarbeit überspringen könnte, hing ganz mit seiner allgemein abenteuerlichen, im Gegensatz zu einer routinemäßigen, bürokratischen Haltung gegenüber Führung und der Mobilisierungs- und Transformationskraft des Beispiels der Führung zusammen.
Ches Ideen gerieten 1964 innerhalb des kubanischen Staates zunehmend unter Beschuss, was die Kremlisierung der Ideologie und Struktur des bürokratischen Apparats widerspiegelte. Nach Castros Besuch in Moskau 1964 wurde Che klar, dass die materielle Grundlage für sein Übergangsprogramm – eine verstärkte Industrialisierung Kubas – zugunsten der weiteren Abhängigkeit Kubas vom Zucker aufgegeben wurde.
Che reiste im November 1964 in die Sowjetunion, um ein letztes Mal für antiimperialistische Kriege in Lateinamerika zu plädieren. Doch während der Kreml bereit war, geringfügige praktische Hilfe für Guerillakräfte in Ländern, in denen kommunistische Parteien verboten waren, zu tolerieren, wollte er eine allgemeine Strategie des Guerillakriegs, insbesondere im Hinterhof der USA, weder sanktionieren noch tolerieren.
Che wurde zu einem Treffen mit Witali G. Korionow, dem stellvertretenden Leiter der Abteilung für Amerika des Zentralkomitees, einbestellt und darüber informiert, dass die kommunistischen Parteien in Venezuela und Bolivien beim Kreml gegen Ches Stellvertreterkrieg protestiert hatten. Che blieb unnachgiebig, woraufhin Korionow zu dem Schluss kam:
„Der Argentinier war entschlossen, den bewaffneten Kampf in Lateinamerika fortzusetzen, er misstraute der Politik der friedlichen Koexistenz des Kremls und stand in der chinesisch-sowjetischen Spaltung auf der Seite Chinas.“ (S. 615)
Als er nach Havanna zurückkehrte, boykottierte Che den Kongress der lateinamerikanischen kommunistischen Parteien, der gerade stattfand, und hielt stattdessen Reden an anderen Orten in Kuba, in denen er die moderate Strategie für die Region scharf kritisierte. Laut Andersons Quellen in Kuba hatte Che bei seiner Rückkehr ins Land im November beschlossen, aus der Regierung auszutreten, „nachdem er zu dem Schluss gekommen war, dass der sowjetische Druck auf Fidel, das Kreml-Modell des Sozialismus in Kuba zu akzeptieren, zu groß war.“ (S. 616)
Ches letzte Kämpfe
In einem Abschiedsbrief an seine Eltern, geschrieben im März 1965, schrieb Che Guevara:
„Ich kehre mit meinem Schild auf dem Arm auf die Schiene zurück. Nichts Wesentliches hat sich geändert, außer dass ich bewusster bin, mein Marxismus tiefer und klarer geworden ist. Ich glaube an den bewaffneten Kampf als einzige Lösung für die Völker, die für ihre Freiheit kämpfen, und ich bin konsequent in meinen Überzeugungen.“ (S. 633)
Am 1. April 1965 verließ er Kuba und machte sich auf den Weg in den Kongo. Am 24. April kamen Che und dreizehn Kubaner:innen in dem zentralafrikanischen Staat an, um mit der von China unterstützten Kongolesischen Befreiungsarmee zu arbeiten.
Es dauerte nicht lange, bis Che merkte, dass die Armee echt schlecht diszipliniert, unmotiviert, schlecht geführt und schlecht ausgebildet war und die Bäuer:innen im „befreiten Gebiet“ am westlichen Teil des Tanganjikasees beleidigte.
Bei den wenigen Gelegenheiten, bei denen er die Befreiungsarmee dazu bringen konnte, den/die Feind:in anzugreifen, rannten die Soldat:innen oft davon oder schossen wahllos auf Freund:in und Feind:in. Es half auch nicht, dass es innerhalb der Armee zu internen Kämpfen kam, vor allem in Kairo und Daressalam (Tansania), die die Kommandeur:innen von der Front fernhielten.
Che war ziemlich abfällig gegenüber den Anführer:innen, die (wie Laurent Kabila) lieber in ihren Mercedes durch die Hauptstädte befreundeter afrikanischer Staaten fuhren, anstatt sich wirklich am Kampf zu beteiligen.
Im September war die Lage vor Ort ein Reinfall. Im Oktober gab Che die Hoffnung auf, die bestehende Rebellenarmee zu reformieren, und schlug vor, eine neue aufzubauen, die aus Bäuer:innen rekrutiert und von ihm befehligt werden sollte. Aber er wurde daran gehindert.
Im Oktober begann die Offensive der Regierung unter der Führung weißer Söldner:innen, die schnell an Boden gewann. Am 13. Oktober führte ein Putsch innerhalb der kongolesischen Regierung zu einem von der OAS (Organisation Amerikanischer Staaten) unterstützten Abkommen zwischen ihr und den Rebell:innen, das den Abzug ausländischer Truppen vorsah.
Noch wichtiger war, dass die tansanische Regierung im Licht des OAS-Abkommens ihre politische und logistische Unterstützung für die Rebellenarmee von der anderen Seite des Sees einstellte und der Kreml daraufhin die Kubaner:innen und Che aufforderte, ihre Intervention zu beenden. Che versuchte, Zeit zu gewinnen, aber am 24. Oktober wurde sein wichtigstes Lager überfallen. Der letzte Monat brachte weitere kubanische Tote und eine totale Niederlage, bevor sie am 22. November endgültig evakuiert wurden.
Nach dieser Katastrophe wurde Che drei Monate lang in der ostdeutschen Botschaft in Daressalam versteckt, wo er sein Tagebuch zu Ende schrieb. Dieses wurde erst kürzlich in Kuba zugänglich gemacht und Anderson nutzt es, um die Geschichte der Kampagne zusammenzusetzen. Die erste Seite stellt fest: „Dies ist die Geschichte eines Scheiterns.“ (S. 672)
Aber das erschütterte seinen Glauben an die von ihm gewählte Strategie nicht. Er beharrte darauf: „Ich bin mit größerem Glauben denn je an den Guerillakampf herangegangen.“ Er würde einen Versuch unternehmen, einen antiimperialistischen Krieg zu beginnen. Nachdem er sich weitere drei Monate in Prag versteckt gehalten hatte, kehrte Che im Juli 1966 heimlich nach Kuba zurück. Seine Anwesenheit wurde nie offiziell bestätigt, aber Castro ließ ihn sein letztes, schicksalhaftes Abenteuer vorbereiten.
Castro forderte Che auf, statt nach Peru nach Bolivien zu gehen, was Che bevorzugte. Als die bolivianische Kommunistische Partei davon erfuhr, beschwerte sie sich in Moskau, konnte Che jedoch nicht daran hindern, im November 1966 nach Bolivien aufzubrechen.
Am Silvesterabend 1965 hatte Che nur noch 24 Männer bei sich (neun Bolivianer). Guevaras Kampagne war fast von Anfang an von Pech, schlechtem Urteilsvermögen und offenem Verrat durch die lokale kommunistische Partei begleitet. In einer Aktion, die seine Frau als „bewusste Täuschung“ durch „den Mann, der ihren Mann verraten hat“ bezeichnete, versprach der stalinistische Chef Mario Monje zunächst Unterstützung für den Krieg, forderte dann aber alle Bolivianer in der Gruppe auf, zu gehen. Er stellte nie die versprochene logistische Unterstützung aus den Städten zur Verfügung.
Dann wurden der französische Journalist Régis Debray und der argentinische Guerillakämpfer Ciro Roberto Bustos Marcos, Ches Verbindungsleute zu Kuba und Argentinien, beim Verlassen des Regenwaldes verhaftet, wodurch die Guerillagruppe von jeglicher Hilfe von außen abgeschnitten war.
Che musste schließlich einen vorzeitigen Überlebenskampf führen, als die Kolonne von unsympathisch gesinnten Bäuer:innen entdeckt wurde. Als ob das nicht schon genug wäre, verurteilte die Kommunistische Partei der CSSR, als die Nachricht von Ches Kampagne international bekannt wurde, seine Aktivitäten in Bolivien. Als die Kommunistische Partei Ungarns daraufhin Che kritisierte und die Kommunistische Partei Chiles lobte, bezeichnete Che sie als „Feiglinge und Lakaien“.
In den letzten Wochen beging Che, hungernd, krank und mit Verlusten an Menschen und Ausrüstung, den fatalen Fehler, sich in ein ungeschütztes Gebiet am Fuße der Anden zu begeben. Die Guerillakämpfer bewegten sich tagsüber und die Armee wusste durch die Bäuer:innen, wo sie sich aufhielten.
Am 8. Oktober waren nur noch siebzehn Guerillakämpfer übrig, als der letzte Feuerkampf in einer kleinen Schlucht in der Nähe des Dorfes La Higuera losging. Die meisten aus Ches Kolonne wurden getötet. Che wurde überwältigt, als sein Maschinengewehr klemmte. Gefesselt und schmutzig wurde Che über Nacht in der Dorfschule festgehalten.
Ein CIA-Agent, Félix Rodríguez, der eingeflogen war, als er von Guevaras Gefangennahme erfuhr, erzählte Anderson, dass die CIA gegen Ches Hinrichtung war, weil sie ihn verhören und vor der Weltpresse vorführen wollte. Aber der bolivianische Generalstab in La Paz befahl die Hinrichtung.
Ein Feldwebel, Mario Terán, meldete sich freiwillig und betrat am 9. Oktober um 13:10 Uhr die Schule und schoss mit seinem Maschinengewehr auf Che.
Seine Leiche, ohne die Hände, die als Beweis und zur Überprüfung amputiert worden waren, wurde zwei Tage später schnell und heimlich in der Nähe einer kleinen Landebahn in der nahe gelegenen Stadt Vallegrande begraben. Ches Überreste sind bis heute nicht gefunden worden.
Anderson verrät, dass „in Kuba hinter vorgehaltener Hand zugegeben wird, dass Ches bolivianische Operation von Anfang bis Ende ein totaler Reinfall war“ (S. 767). Sogar Che soll seinen Entführer:innen gesagt haben, dass er „dank der effizienten Organisation von Barrientos (bolivianischer Präsient) politischer Partei, d. h. seiner Corregidores (Provinz-/Kantonsbeamt:innen) und politischen Bürgermeister, die dafür verantwortlich waren, die Armee über unsere Bewegungen zu informieren“, gescheitert sei (S. 767).
Offiziell gibt es in Kuba natürlich keine so direkten Eingeständnisse zum kongolesischen oder bolivianischen Fiasko, geschweige denn einen Versuch, eine Bilanz der Guerillakriegsführung als Strategie zu ziehen, warum sie in Kuba eine politische Revolution herbeiführen konnte und im Kongo und in Bolivien so kläglich scheiterte, ganz zu schweigen von den Misserfolgen anderer von Che unterstützter Guerilla-Interventionen in Argentinien, Nicaragua und der Dominikanischen Republik in den Jahren 1961–64.
Das Scheitern dieser Strategie ist offensichtlich, und sogar einige von Ches Anhänger:innen waren gegen seine „focistische“ Politik in überwiegend urbanen und proletarischen Gesellschaften wie Argentinien, wo Che darauf bestand, dass sie auch funktionieren würde. Der Focismus erhebt die kleine, mobile, ländlich geprägte Guerillagruppe – den Foco – zur absoluten Führung des Kampfes. Alle anderen Aspekte des Kampfes sind dem Foco untergeordnet und dienen in erster Linie dazu, ihn zu unterstützen. Massenaktionen werden vom Foco angeregt, der natürlich nicht den Massen gegenüber verantwortlich ist, die er zum Kampf anstacheln will. Der Foco ist „die Seele der Revolution“, wie Che es ausdrückte.
Die grundlegenden Probleme dieser Strategie wurden in Bolivien auf grausame Weise offenbart. Sie konnte in Bolivien nicht funktionieren, weil die Arbeiter:innenklasse, insbesondere die Arbeiter:innen in den Zinnminen, sich bereits als revolutionäre Avantgarde der Gesellschaft etabliert hatte, stark beeinflusst vom zentristischen Trotzkismus und dem Linksnationalismus in Form der MNR. Außerdem waren die Bäuer:innen durch die Landreformen nach der bolivianischen Revolution von 1952 zu einer Klasse von Kleinbäuer:innen geworden. Deshalb konnte der Foco keinen Bäuer:innenkrieg um Land anzetteln oder sich in die Politik einer stark organisierten und klassenbewussten Arbeiter:innenbewegung einmischen.
Revolutionäre Marxist:innen lehnen keine Form des Kampfes ab. Wenn sich der Klassenkampf zu einem Krieg um Territorien entwickelt, kann der Guerillakrieg vielleicht eine wichtige Rolle spielen, vor allem als defensive Störmanöver gegen eine/n stärkere/n Feind:in, wo ein offener Kampf gegen eine feindliche Militärmacht Selbstmord wäre.
Als Strategie zur Erlangung der politischen Macht hat der Guerillakrieg mit starker Unterstützung aus den Städten und ihrer Arbeiter:innenbewegung in der Nachkriegszeit zweimal einen verhassten Diktator in Lateinamerika gestürzt. Das waren Ausnahmen. Sowohl in Nicaragua als auch in Kuba hing dieser Erfolg von der auffälligen Schwäche des Staatsapparats ab, mit dem die Guerillakämpfer:innen konfrontiert waren, vom mangelnden Rückhalt der herrschenden Oligarchie durch den US-Imperialismus und von der Tatsache, dass der Großteil der nationalen Bourgeoisie zur Guerilla übergelaufen war.
Der kubanische Staat brach, wie Robin Blackburn feststellte, angesichts der Herausforderung durch weniger als 3.000 Guerillakämpfer im Januar 1959 zusammen, weil er bereits zuvor zerfallen war und „jede entscheidende Institution oder ideologische Struktur fehlte“.
Selbst dort, wo das Gelände für einen langwierigen Guerillakrieg am besten geeignet ist (leicht zu verteidigendes Gelände, in dem Bewegungen schwer zu entdecken sind), braucht es immer noch ein Mindestmaß an sozialen und politischen Bedingungen, damit er überleben und wachsen kann. Che selbst hat zugegeben, dass die Politik der MNR in Bolivien mit Landreform und der Organisation der Bäuer:innen eine Schicht geschaffen hat, die ihren sogenannten Befreier:innen misstraute.
Die erfolgreichen Guerilla-Armeen konnten bedeutende befreite Gebiete sichern, in denen die Armee des Staates verboten ist und daher keine nennenswerten Repressalien gegen die Bäuer:innen durchführen kann, weil sie die Guerilla unterstützen oder mit dem Nötigsten versorgen. In diesen Gebieten konnten sie außerdem das Vertrauen der Bäuer:innen gewinnen, weil sie ihnen durch Landreformen, medizinische Hilfe oder Alphabetisierungskampagnen echt bessere Lebensbedingungen gebracht haben.
Aus politischer Sicht kann der Guerillakrieg die Grundlagen des Staates nicht erschüttern in Gesellschaften, die im Wesentlichen urban und industrialisiert sind und in denen die Arbeiter:innenklasse und die Städte eine große soziale Macht haben oder in denen die nationale Bourgeoisie und soziale und ideologische Institutionen stark sind. Das Schicksal der EZLN in Mexiko heute beweist dies.
Aber trotz ihrer wenigen außergewöhnlichen „Erfolge“ (die kubanische Revolution ist auf dem gleichen Weg zu einem degenerierten Arbeiter:innenstaat verkommen, die nicaraguanische FSLN-Regierung hat den Kapitalismus nicht gestürzt, ihre soziale Basis demoralisiert und die Macht verloren) muss der Guerillakrieg als Strategie abgelehnt werden. Sie ist unvereinbar mit der Strategie einer sozialistischen Arbeiter:innenrevolution – einer Revolution, die von der Masse der Arbeiter:innen durch ihre eigenen demokratischen Organisationen, ihre eigenen Ratsorgane und ihre eigene Miliz und unter der Führung einer revolutionären Arbeiter:innenpartei durchgeführt wird.
Der Guerillakrieg ist zwangsläufig elitär, d. h. er ist eine Strategie zur Erlangung der politischen Macht, die selbst bei einem Erfolg wie in Nicaragua und Kuba die Massen – insbesondere die städtische Arbeiter:innenklasse, die den Sozialismus schaffen muss – von Anfang an politisch enteignet. Che selbst lieferte eine politische Erklärung dafür.
Che war sich immer darüber im Klaren, dass die kubanische Revolution für das Volk und nicht vom Volk durchgeführt wurde. In seiner Foco-Strategie wurden die Anführer:innen nicht gewählt, sondern aufgrund ihrer Taten ausgewählt. Sie initiieren den Kampf, kämpfen gegen die Übermacht und verdienen sich durch ihre Siege das Recht, begleitet und befolgt zu werden.
Che glaubte, dass die Massen hinter diese eng gefasste „Avantgarde“ gezogen werden könnten, aber da sie ihre Rückständigkeit und Unterdrückung erst im Übergang zum Sozialismus und nicht vorher überwinden konnten, konnte von der Arbeiter:innenklasse als Klasse nicht erwartet werden, dass sie sich ihrer historischen Mission unter dem Kapitalismus bewusst war. Sie musste daher an die Hand genommen werden. Eine solche Ideologie führt, auch wenn sie unter außergewöhnlichen Umständen der Guerilla-Armee politische Macht verschaffen kann, unweigerlich zu Bürokratisierung und Unterdrückung.
Guevaras Marxismus
Als Che am 2. Januar 1959 in Havanna einmarschierte, war er ein ehrlicher Antiimperialist. Er war auch ein überzeugter Verfechter der Guerillastrategie. In seiner grundlegenden Methode war er also revolutionär, wenn auch ein kleinbürgerlicher Revolutionär. Leider war er auch ein überzeugter Stalinist.
Er hatte aus der Ferne die „Erfolge“ der Sowjetunion unter Stalin bewundert und war entschlossen, diese nach der Machtübernahme in Kuba nachzuahmen. Aber er hatte schon lange die lateinamerikanischen kommunistischen Parteien für ihre Ablehnung des bewaffneten Kampfes kritisiert. Als Mitglied von Castros Rebellenarmee verband er seinen Stalinismus mit der revolutionären Tradition des kleinbürgerlichen Nationalismus, wie sie in Kuba durch José Martí verkörpert wurde.
Nach der Eroberung der politischen Macht wurde Che zum Architekten des degenerierten Arbeiter:innenstaates in Kuba, nachdem er eine der Schlüsselfiguren bei der Eingliederung Kubas in den wirtschaftlichen und militärischen Einflussbereich der Sowjetunion gewesen war.
Zusammen mit Raúl Castro war Che maßgeblich daran beteiligt, die PSP zunehmend in Führungspositionen des kubanischen Staats- und Wirtschaftsapparats zu bringen und 1961 unter Castros Führung Elemente der Bewegung des 26. Juli und der PSP zu einer neuen Partei zu verschmelzen.
Ähnlich wie Stalin nach 1924 glaubte Che an die Möglichkeit des „Sozialismus in einem Land“. Sein Programm konnte daher nicht zu einer erfolgreichen sozialistischen Arbeiter:innenrevolution auf der Grundlage souveräner Arbeiter:innenräte führen. Er lehnte die Idee ab, dass die politische Macht beim Volk selbst liegen sollte und nicht bei einer selbsternannten Avantgarde. Er war bereit, Kritik zu unterdrücken, und nachdem er die Feind:innen der kubanischen Revolution im rechten Flügel eliminiert hatte, ging er weiter und verfolgte und verhaftete die linke Avantgarde, wie zum Beispiel die kubanischen Trotzkist:innen 1962.
Aber trotz alledem war seine „sozialistische“ Strategie sowohl für Kuba als auch für den Rest der Welt nicht ganz im Einklang mit dem Programm und der Ideologie des russischen Stalinismus, wie sie sich nach 1933 in ihrer völlig konterrevolutionären Verkleidung zeigten.
Wichtige Meinungsverschiedenheiten blieben auch bestehen, als Guevara beim Aufbau eines stalinistischen Staates in Kuba half, und diese Meinungsverschiedenheiten vertieften sich in den Jahren 1961–64.
Der Kreml (genau wie Castro) war bereit, einen begrenzten bewaffneten Kampf zu tolerieren, um ein besseres Kräfteverhältnis im Rahmen der friedlichen Koexistenz zu erreichen. Guevara war ein Gegner dieser konterrevolutionären Strategie, die im Kern des Stalinismus steckte.
Im Kongo hat der Kreml eine Lösung unterstützt, die Che isoliert hat. In Bolivien hat die Kommunistische Partei einiges getan, um seine Bemühungen zu sabotieren, und muss einen Teil der Schuld für seinen Tod auf sich nehmen.
Sein Antiimperialismus kam nicht aus einem engen nationalistischen Kampf gegen den Imperialismus. Als kubanischer Kämpfer in fernen Ländern schlug er überall dort seine Zelte auf, wo es eine internationalistische Pflicht gab, gegen den Imperialismus und seine lokalen Handlanger:innen zu kämpfen.
Bleibt die Frage, ob er deshalb, in seiner Enttäuschung über die Politik des Kremls, einfach seine Loyalität nach Peking verlagert hat? Die Einflüsse des Maoismus sind für den/die, der/die sie sehen will, unübersehbar: die Lehren, die er aus Maos Guerillakrieg für seinen kubanischen Kampf und andere Kampagnen zog, seine Betonung moralischer Anreize beim Aufbau des Sozialismus, seine Sympathie für China in der chinesisch-sowjetischen Spaltung, seine Zusammenarbeit mit der von China unterstützten Rebellenarmee im Kongo und Pekings rhetorische Verurteilung der Außenpolitik des Kremls schienen mit Ches eigenem Hass auf die Doktrin der „friedlichen Koexistenz“ zusammenzufallen.
Aber Guevara war genauso wenig ein Vertreter der Außenpolitik der chinesischen Bürokratie wie der des Kremls oder gar der kubanischen Bürokratie. Als er mit dem Kreml brach, bewegte er sich nach links. Sein Antiimperialismus kollidierte mit den Zwängen der stalinistischen Außenpolitik. In dem Maße, in dem er dem antiimperialistischen Kampf überall, wo er geführt wurde, treu blieb, entwickelte er sich zu einer Form des Zentrismus.
Dieser war zwar nicht identisch mit dem Zentrismus Stalins in der zweiten Hälfte der 1920er Jahre, ähnelte aber dieser Form des „bürokratischen Zentrismus“, d. h. Ches Opportunismus zeigte sich in seiner Unterstützung für das Programm des Sozialismus in einem Land, aber sein Linksextremismus zeigte sich in seiner echten Überzeugung, dass man den Imperialismus mit revolutionären Mitteln bekämpfen muss. Und dieser Linksextremismus bedeutete einen teilweisen Bruch mit dem Stalinismus, wie er sich nach 1933 entwickelte.
Subjektiv wollte Che, wie Trotzki über Stalins Politik in der chinesischen Revolution von 1926 sagte, den Sieg der Revolutionen gegen den Imperialismus und seine lokalen Agent:innen. Che war nicht wie Breschnew oder Mao ein Konterrevolutionär, der bereit war, Revolutionen „im Ausland“ im Blut zu ertränken, um eine bürokratische Diktatur in einem Land zu schützen.
Che war wirklich ein unerbittlicher Gegner der Strategie der „friedlichen Koexistenz“, dem Hauptmerkmal des Stalinismus nach 1935. Er glaubte nicht nur nicht an wasserdichte Stufen zwischen der demokratischen und der sozialistischen Revolution, sondern unterschätzte auch die Bedeutung der demokratischen Aufgaben sogar in Lateinamerika.
Das macht Guevara aber nicht zu einem Trotzkisten und bedeutete auch nicht, dass er sich in Richtung Trotzkismus bewegte. Bestenfalls glaubte Che an eine „ununterbrochene“ Revolution, von der revolutionär-demokratischen, antiimperialistischen „Phase“ bis zum Kampf für einen bürokratisierten und degenerierten Arbeiter:innenstaat.
Die Kontinuität zwischen ihnen wurde von der Guerillaorganisation und ihrer Führung vertreten, nicht von den Massen, die bewusst für demokratische und antiimperialistische Ziele kämpfen und darüber hinausgehen, um sozialistische Ziele zu erreichen, und in diesem Kampf Organe für eine neue, höhere Form der Demokratie schaffen – Arbeiter:innenräte. Che hatte keine Ahnung von proletarischer Demokratie und stellte stattdessen eine Mischung aus paternalistischem Populismus und überwachten Institutionen für den „Volkswillen“ auf.
Die Mystik um Che besteht zum Teil darin, dass er im Kampf gegen einen brutalen Klassenfeind starb, zum Teil darin, dass er starb, bevor er ein fester Teil einer bestimmten sozialen Schicht – der Bürokratie in einem degenerierten Arbeiter:innenstaat – werden konnte. Er hat die russische Bürokratie für ihren privilegierten Lebensstil verspottet. In Kuba verzichtete er auf alle diese Privilegien für sich und seine Familie, obwohl er ein wichtiger Teil der Regierung war.
Aber sein Ruf bleibt auch deshalb bestehen, weil er nie mit einer von der Arbeiter:innenklasse geführten Revolution konfrontiert wurde. Hätte er das während einer seiner Kampagnen getan, hätte er aufgrund seiner Politik zum Zeitpunkt seines Todes eine solche Revolution bekämpfen und besiegen müssen. Entweder das, oder er hätte sich endgültig vom Stalinismus lossagen müssen.
Es ist möglich, dass er, wenn er weitergelebt und über die Misserfolge seiner Kampagnen im Kongo und in Bolivien nachgedacht hätte, dies getan hätte.
Vor allem hätte er erkennen müssen, dass der eigentliche Misserfolg seiner letzten Kampagnen darauf beruhte, dass er seine Strategie auf die falsche Klasse stützte.
Wie sollte die Geschichte über ihn urteilen?
Für Anderson ist Che „ein bleibendes Symbol für leidenschaftlichen Widerstand gegen einen festgefahrenen Status quo“. Das trifft zwar zweifellos einen Teil seiner zeitlosen Anziehungskraft auf rebellische junge Menschen, lenkt aber unsere Aufmerksamkeit davon ab, was wir aus Guevaras wechselnder Doktrin und seinen Handlungen lernen können.
Der mexikanische Soziologe Jorge Castañeda, der eine neue Biografie über Che veröffentlicht hat, betont, dass es in Lateinamerika heute ideologisch keinen Platz mehr für Ideen von bewaffnetem Kampf, vom Gemeinwohl oder gar von Opferbereitschaft gibt.
Für Castañeda bedeutet das Ende des Kalten Krieges und die oberflächliche „Demokratisierung“ der Staaten der Region, dass man, egal welche Verdienste Che gehabt haben mag, nichts gewinnen kann, wenn man Guevaras Leben studiert.
Aber er irrt sich. Der gewaltsame und unerbittliche Kampf gegen unterdrückerische und ausbeuterische Regime und das imperialistische Bündnissystem, das solche Regime stützt, ist so aktuell wie eh und je. Che mag eine falsche Strategie zur Eroberung der Macht gehabt haben, aber es gab kaum einen besseren Kritiker, der kein Trotzkist war, wenn es darum ging, die Verbrechen des Imperialismus anzuprangern. Er hat uns dazu aufgefordert, niemals Frieden mit dem Imperialismus zu schließen, da er uns so lange bekämpfen wird, bis wir ihn endgültig besiegt haben.
Sartre sagte, Che sei „der vollkommenste Mensch unserer Zeit“ gewesen. Wir brauchen nicht die Schmeichelei eines Philosophen, um einen Mann der Tat zu würdigen. Aber Trotzkist:innen, die grundsätzlich mit Ches Strategie und sogar mit seinem Ziel – einem bürokratisch degenerierten Arbeiter:innenstaat – nicht einverstanden sind, können seinen Charakter und seine Eigenschaften durchaus anerkennen und respektieren. Sein unerbittlicher Kampf gegen den Imperialismus, sein körperlicher Mut, seine völlige Selbstlosigkeit, die Breite seiner intellektuellen Neugier und seine Hingabe an seine Ideen, die er aus echter Überzeugung und nicht aus Dogmatismus vertrat, sind Eigenschaften, die jede/r Revolutionär:in anstreben muss.
Auch wenn Che Guevara nicht mit dem Stalinismus als Ideologie gebrochen hat, blieb er bis zum Schluss ein subjektiver Revolutionär und kein Bürokrat.