Marxismus, nationale Frage und Imperialismus
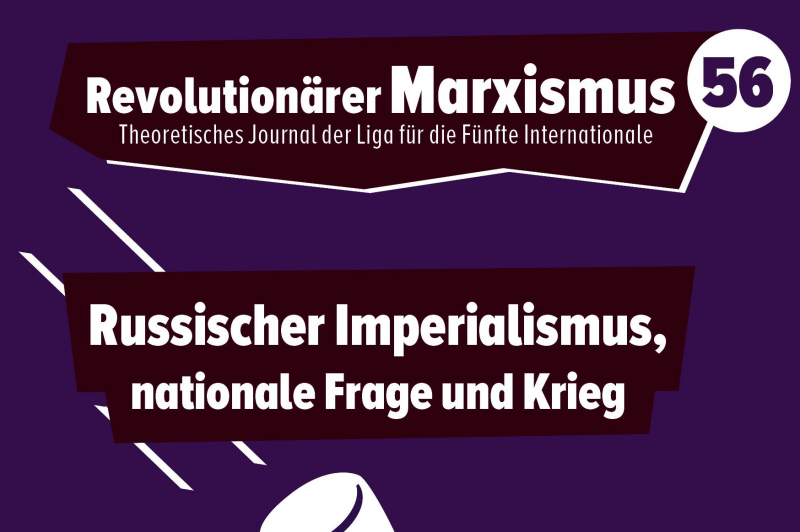
Martin Suchanek, Revolutionärer Marxismus 56, August 2025
Die Frage des Kampfes um die Herausbildung selbstständiger, moderner Nationalstaaten und das nationale Selbstbestimmungsrecht durchzieht die Geschichte des Kapitalismus. Bis heute stellt die Frage des Verhältnisses von revolutionärem Klassenkampf zur nationalen Frage einen zentralen Streitpunkt in der Linken und der Arbeiter:innenbewegung dar.
Die Bedeutung dieser Auseinandersetzung kann schwerlich unterschätzt werden, ist sie doch untrennbar mit der Geschichte des Kapitalismus im Allgemeinen und mit der imperialistischen Epoche im Besonderen verbunden. Eine Welt, die unter den großen Kapitalien der führenden Mächte und der ihnen angelagerten, kleineren imperialistischen Staaten ökonomisch aufgeteilt ist, eine Welt, in der die Reproduktion des Kapitals wesentlich auch auf der Aneignung von Extraprofiten aus den kolonialen oder halbkolonialen Ländern beruht, kann ohne nationale Unterdrückung (wie auch ohne Rassismus) nicht existieren.
Auch wenn diese Ordnung seit der Entkolonialisierung vor allem über ein System der formalen staatlichen Eigenständigkeit reproduziert wird, ändert das nichts an der Aufteilung der Welt in unterdrückende und unterdrückte Nationen. Gerade Perioden der Krisen und des Kampfes um die Neuaufteilung der Welt bringen notwendigerweise immer wieder Bewegungen der Unterdrückten, Aufstände, Massenaktionen der Arbeiter:innen und Bäuer:innen, Kriege und Bürger:innenkriege gegen eben diese Ordnung hervor.
Im Folgenden können wir nicht die gesamte Debatte der Arbeiter:innenbewegung zwischen Befürworter:innen des nationalen Selbstbestimmungsrechts (wie z. B. Lenin) und Gegner:innen (wie z. B. Luxemburg) darstellen, sondern wollen uns vielmehr auf Lenins wegweisenden Beitrag konzentrieren.[i] Davor müssen wir uns jedoch der Position von Marx und Engels zuwenden und ihre Entwicklung skizzieren, um auch verständlich zu machen, wo Lenin bei den beiden anknüpft und worin sein genuiner Beitrag zur Weiterentwicklung des Marxismus und zur systematischen Erfassung der nationalen Frage besteht.
Marx und Engels
1848 verknüpften Marx und Engels die Frage der nationalen Einigung Deutschlands wie auch der Unterstützung Polens und Ungarns eng mit der revolutionären Umwälzung im „Völkerfrühling“. Wie für alle anderen Marxist:innen stand dabei die Frage im Zentrum, wie die Revolution vorangetrieben werden könne. Der internationale Charakter der Bewegung war beiden nur zu bewusst, so dass sie die europäische Revolution als Verbindung einer sozialistischen Umwälzung in Britannien und ansatzweise in Frankreich mit der demokratischen Revolution in Deutschland betrachteten. Der Kampf der polnischen und ungarischen Nationalbewegung bildete für sie dabei einen untrennbaren Teil dieser strategischen Konzeption. Marx und Engels und unter ihrer Führung der Bund der Kommunisten traten daher für eine einheitliche demokratische Republik in Deutschland ein sowie für eine ganze Reihe von politischen und ökonomischen Forderungen im Interesse des Proletariats, der Bäuer:innenschaft und des städtischen Kleinbürger:innentums.[ii] Im Grunde handelt es sich dabei um eine Konkretisierung der Losungen, die Marx und Engels auch im Kommunistischen Manifest erhoben haben und die erste Formen einer Übergangsmethode darstellen.[iii]
Während der gesamten Revolution von 1848 traten die beiden für die nationale Unabhängigkeit Polens und Ungarns ein, denn diese sei ein integraler Teil der gesamteuropäischen Erhebung zum endgültigen Sturz der alten feudalen Ordnung einerseits und zum Kurs Richtung Übergang zur proletarischen Revolution andererseits. Allerdings waren Marx’ und Engels’ Ausführungen zur nationalen Frage nicht nur von revolutionärem Geist und berechtigten strategischen Überlegungen erfüllt. Ihnen haftete auch ein noch nicht überwundenes reaktionäres Erbe des Hegelianismus an, nämlich die Scheidung zwischen „geschichtlichen“ und „geschichtslosen“ Nationen.
In den „Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte“[iv] bestimmt Hegel die „weltgeschichtlichen“ Völker als solche, die für eine ganze Geschichtsperiode eine dauerhafte staatliche, prägende Existenz hervorbrächten. Als solche verkörperten sie ein Entwicklungsstadium der Selbstbewusstwerdung des absoluten Geistes, die sich für Hegel als Zusammenfassung der allgemeinen Sittlichkeit und des Rechts im Staat ausdrücken könne und müsse.
Marx und Engels entwickeln ihre materialistische Geschichtsauffassung von Beginn an in einer scharfen Kritik an Hegels idealistischem System und insbesondere auch an seiner Staats- und Rechtsphilosophie. Nichtsdestotrotz leben manche Begriffe wie jener der „geschichtslosen“ Völker fort, auch wenn, wie wir sehen werden, eine deutliche Absetzbewegung davon im Laufe ihres Lebens festzustellen ist.
In der Revolution 1848 gelten für Marx und Engels England, Frankreich, Deutschland, Polen, Italien oder Ungarn als „historische“ Nationen, nicht jedoch die Tschech:innen, Ukrainer:innen oder die Nationalitäten auf dem Balkan, die vor allem Engels des Öfteren als „Völkertrümmer“ bezeichnete, eine chauvinistische Übersteigerung noch des Begriffs der geschichtslosen Völker.
In seiner Schrift „Zur nationalen Frage. Friedrich Engels und das Problem der ‚geschichtslosen Völker‘“[v] unterzieht Roman Rosdolsky die Positionen von Marx und Engels, die sie in der Rheinischen Zeitung vertraten, einer gründlichen Kritik. Dabei weist er den beiden eine beschönigende Darstellung der Rolle der polnischen und ungarischen, zu einem bedeutenden Teil aus der Aristokratie stammenden, „demokratischen Freiheitskämpfer“ nach. Außerdem fänden sich nicht weniger problematische, chauvinistische und schlichtweg falsche Aussagen über die „geschichtslosen“ nationalen Minderheiten Osteuropas.[vi]
Es wäre jedoch verkürzt, die Positionen von Marx und Engels zu den „geschichtslosen Völkern“ nur einem unüberwundenen Erbe des Hegelianismus zuzuschreiben. Grundsätzlich betrachten sie die Entstehung und gewaltsame Durchsetzung des bürgerlichen Nationalstaates als unerlässlich für die Durchsetzung der kapitalistischen Produktionsweise, als Voraussetzung, Mittel und Folge der Konzentration und Zentralisation des Kapitals. Dies wird unter anderem im Kommunistischen Manifest besonders deutlich, wenn darauf verwiesen wird, dass „die Bourgeoisie (…) in der Geschichte eine höchst revolutionäre Rolle gespielt“[vii] hat.
„Die Bourgeoisie, wo sie zur Herrschaft gekommen, hat alle feudalen, patriarchalischen, idyllischen Verhältnisse zerstört. Sie hat die buntscheckigen Feudalbande, die den Menschen an seinen natürlichen Vorgesetzten knüpften, unbarmherzig zerrissen und kein anderes Band zwischen Mensch und Mensch übriggelassen als das nackte Interesse …“[viii]
Diese Mission geht untrennbar mit der Schaffung des Weltmarktes und der Umwälzung der Produktion auf dem gesamten Globus einher: „Die Bourgeoisie hat durch ihre Exploitation des Weltmarkts die Produktion und Konsumtion aller Länder kosmopolitisch gestaltet. Sie hat zum großen Bedauern der Reaktionäre den nationalen Boden der Industrie unter den Füßen weggezogen. Die uralten nationalen Industrien sind vernichtet worden und werden noch täglich vernichtet. Sie werden verdrängt durch neue Industrien, deren Einführung eine Lebensfrage für alle zivilisierten Nationen wird, durch Industrien, die nicht mehr einheimische Rohstoffe, sondern den entlegensten Zonen angehörige Rohstoffe verarbeiten und deren Fabrikate nicht nur im Lande selbst, sondern in allen Weltteilen zugleich verbraucht werden.“[ix]
Der Aufhebung der Zersplitterung der Produktionsmittel, der Schaffung von Verhältnissen, die dem Fortgang der Akkumulation entsprechen, entspricht auch die Schaffung einer bestimmten, zentralisierten staatlichen Form: „Die Bourgeoisie hebt mehr und mehr die Zersplitterung der Produktionsmittel, des Besitzes und der Bevölkerung auf. Sie hat die Bevölkerung agglomeriert, die Produktionsmittel zentralisiert und das Eigentum in wenigen Händen konzentriert. Die notwendige Folge hiervon war die politische Zentralisation. Unabhängige, fast nur verbündete Provinzen mit verschiedenen Interessen, Gesetzen, Regierungen und Zöllen wurden zusammengedrängt in eine Nation, eine Regierung, ein Gesetz, ein nationales Klasseninteresse, eine Douanenlinie.“[x]
Diese überaus treffenden Bemerkungen fassen den Kern des gesellschaftlichen und historischen Fortschritts der kapitalistischen Gesellschaftsformation, einer neuen Produktionsweise, zusammen, und sie verweisen im letzten Zitat auch darauf, dass diese Produktionsweise einer bestimmten Staatsform und somit der Herausbildung bürgerlicher Nationen bedarf.
Darüber hinaus begreifen Marx und Engels zu Recht die Überwindung von Kleinstaaterei, die Herausbildung größerer nationaler ökonomischer Einheiten mit gemeinsamer Währung, ohne innere Grenzen, mit einheitlichem Markt als Fortschritt, der nicht zuletzt auch die Entwicklung der Klassengegensätze fördert und damit objektive Voraussetzung der proletarischen Revolution schafft und befördert. In diesem Sinne ist natürlich auch eine größere staatliche Einheit der kleineren vorzuziehen. So erkennen Marx und Engels in der Herausbildung eines deutschen oder italienischen, aber auch eines polnischen oder ungarischen Staates einen Fortschritt, weil dies den günstigsten Rahmen für die Entwicklung der Produktivkräfte und damit auch der Arbeiter:innenklasse bildet. Den „geschichtslosen“ Völkern hingegen trauen sie einen eigenen überlebensfähigen bürgerlichen Nationalstaat nicht zu; ein solcher wäre vielmehr eine Farce und unter den Verhältnissen Mitte des 19. Jahrhunderts nur ein politischer Spielball und konterrevolutionärer Vorposten des zaristischen Russlands.
Marx’ und Engels’ Insistieren auf dem fortschrittlichen Charakter der kapitalistischen Expansion liegt auch ihrer Position zur kolonialen Expansion in Indien zugrunde. Beide waren keineswegs blind gegenüber der Barbarei der britischen Herrschaft, ja, sie verurteilten und denunzierten sie scharf. Aber in den frühen Schritten erkennt Marx in der Kolonisierung Indiens ein progressives Moment, insofern sie die vorkapitalistische, asiatische Produktionsweise gewaltsam zerstört und die Grundlage für die Durchdringung des Kapitalismus schafft. Auf die Entwicklung der Produktivkräfte verweist auch Engels, wenn er im Krieg zwischen den USA und Mexiko 1846–1848 um Texas und Kalifornien die Seite der USA ergreift.
In den 1850er Jahren modifiziert Marx seine Positionen, ohne jedoch wirklich methodisch zu einer Neubestimmung zu kommen. So kritisiert er 1857 die britische Intervention in China scharf als „in höchstem Grade ungerechten Krieg“[xi] Eine systematische Ausarbeitung der Position zur nationalen Frage, die mit dem Kolonialismus und dem späteren Eintritt in die imperialistische Epoche immer dringlicher wurde, entwickelten Marx und Engels jedoch nicht.
Aber in ihren Werken lassen sich mehrere Änderungen ihrer politischen Position und wissenschaftliche Arbeiten finden, die später von Revolutionär:innen wie Lenin nutzbar gemacht werden oder in die Richtung der Theorie der permanenten Revolution Trotzkis verweisen.
Beispielhaft wäre hier die Wiederherstellung Polens zu nennen. Zeit seines Lebens traten Marx und Engels für einen unabhängigen Staat Polen ein, der zwischen drei Großmächten, dem zaristischen Russland, dem Deutschen Reich und der Habsburger Monarchie, aufgeteilt war. So schreibt Marx in den „Instruktionen für die Delegierten des Provisorischen Zentralrats zu den einzelnen Fragen“ im Jahr 1867 unter Punkt 9 „Die polnische Frage“[xii], dass die Teilung Polens ein mächtiger Faktor der reaktionären Stabilisierung Europas sei, der nicht nur den Zarismus stärke, sondern auch Deutschland und Österreich-Ungarn an die „Heilige Allianz“, das Bündnis zwischen den drei Monarchien Russland, Preußen und Österreich, binde. In Deutschland würde zudem die Einverleibung Westpolens vor allem Preußen und den Bismarck’schen Bonapartismus stärken, also die „Verpreußung“ Deutschlands vorantreiben. Die Wiederherstellung Polens würde hingegen die demokratischen Elemente in Deutschland und damit auch die Arbeiter:innenklasse befördern.[xiii] Die Lohnabhängigen wie auch alle anderen antimonarchistischen Kräfte hätten daher nicht nur eine internationalistische Pflicht gegenüber den polnischen Massen, ihren Befreiungskampf zu unterstützen, sondern die Wiederherstellung Polens liege auch in ihrem eigenen Klasseninteresse.
Methodisch sehr viel weiter gehen jedoch die Positionen von Marx und Engels zur irischen Frage. Während Marx und Engels die Unabhängigkeit Irlands ursprünglich ablehnten, weil ein gemeinsamer Staat und eine gemeinsame Ökonomie günstigere Bedingungen für den Übergang zum Sozialismus schaffen würden, schreibt Marx in einem Brief an Engels: „Ich habe früher die Trennung Irlands von England für unmöglich gehalten. Ich halte sie jetzt für unvermeidlich, obgleich nach der Trennung Federation kommen mag.“[xiv]
Zu dieser Veränderung trugen der Austausch mit irischen Freiheitskämpfer:innen und die Erfahrungen des Klassenkampfes entscheidend bei. In einem Brief an Sigfrid Meyer und August Vogt vom 9. April 1870 fasst Marx zusammen:
„Und das Wichtigste! Alle industriellen und kommerziellen Zentren Englands besitzen jetzt eine Arbeiterklasse, die in zwei feindliche Lager gespalten ist: englische proletarians und irische proletarians. Der gewöhnliche englische Arbeiter haßt den irischen Arbeiter als einen Konkurrenten, welcher den standard of live (Lebensstandard; d. Red.) herabdrückt. Er fühlt sich ihm gegenüber als Glied der herrschenden Nation und macht sich eben deswegen zum Werkzeug seiner Aristokraten und Kapitalisten gegen Irland, befestigt damit deren Herrschaft über sich selbst. Er hegt religiöse, soziale und nationale Vorurteile gegen ihn. Er verhält sich ungefähr zu ihm wie die poor whites (armen Weißen; d. Red.) zu den niggers (verächtliches Schimpfwort dieser zu den Schwarzen; d. Red.) in den ehemaligen Sklavenstaaten der amerikanischen Union. Der Irländer pays him back with interest in his own money (zahlt es ihm mit gleicher Münze zurück; d. Red.). Er sieht zugleich in dem englischen Arbeiter den Mitschuldigen und das stupide Werkzeug der englischen Herrschaft in Irland.
Dieser Antagonismus wird künstlich wachgehalten und gesteigert durch die Presse, die Kanzel, die Witzblätter, kurz, alle den herrschenden Klassen zu Gebote stehenden Mittel. Dieser Antagonismus ist das Geheimnis der Ohnmacht der englischen Arbeiterklasse, trotz ihrer Organisation. Er ist das Geheimnis der Machterhaltung der Kapitalistenklasse. Letztere ist sich dessen völlig bewußt.“[xv]
Diese beiden Absätze verdeutlichen die Funktion der nationalen Unterdrückung (oder, analog dazu, auch der rassistischen) für die Durchsetzung und Reproduktion der Klassenverhältnisse. In England befestigt die Okkupation Irlands und die damit verbundene Spaltung der Arbeiter:innenklasse die Herrschaft von Aristokratie und Bourgeoisie. Solange die englischen Lohnabhängigen nicht aktiv gegen die Unterdrückung und für die Unabhängigkeit Irlands einträten, so Marx, würden sie politisch ohnmächtig bleiben müssen, selbst wenn sie über große gewerkschaftliche und politische Organisationen verfügen. Der Verweis darauf, dass, wie es Marx noch in den 1850er Jahren vertrat, eine Loslösung ökonomisch nachteilig oder gar unmöglich gewesen wäre, stellt eine falsche Abstraktion dar, weil sie vom Verhältnis zwischen der englischen Arbeiter:innenklasse und der unterdrückten irischen Nation und deren Arbeiter:innenklasse abstrahiert – und damit von den konkreten Bedingungen für die Herausbildung eines revolutionären Subjekts zur Umwälzung der Verhältnisse in beiden Ländern.
Damit die Spaltung der englischen und die irischen Lohnabhängigen überwunden werden kann, müssen die englischen Proletarier:innen in Wort und Tat beweisen, dass sie ein grundlegend anderes Verhältnis zum irischen Volk einnehmen als die britischen herrschenden Klassen. Das erfordert lt. Marx zwingend die Anerkennung des Selbstbestimmungsrechts und, in diesem konkreten Fall, das Eintreten für die Unabhängigkeit Irlands auf Seiten der englischen Lohnabhängigen. Ansonsten können sie sich in den Augen von Marx und Engels nie von ihrer eigenen Ausbeutung befreien und nie eine sozialistische Umwälzung durchführen. Vielmehr wären sie zur geistig-ideologischen Versklavung durch ihre eigene Bourgeoisie verdammt. In einem Brief an Engels bringt er das drastisch zum Ausdruck: „Die englische working class wird nie was ausrichten, before it has got rid of Ireland (bevor sie Irland nicht losgeworden ist; d. Red.).“[xvi] Und allgemeiner: „Das Volk, das ein anderes Volk unterjocht, schmiedet seine eigenen Ketten.“[xvii]
Mit den Schriften, Vorträgen und Resolutionen zur irischen Frage brechen Marx und Engels mit der Hegel’schen Vorstellung von den „geschichtslosen Völkern“, denn nach den Kriterien, die Marx und Engels selbst 1848 anlegten, müsste das irische Volk zweifellos auch zu den „geschichtslosen“ zählen. Allerdings verallgemeinerten Marx und Engels die Position Zeit ihres Lebens nicht zu einer allgemeinen Anerkennung des Selbstbestimmungsrechts der Nationen, weil sie den Kampf gegen das zaristische Russland, den Hort der europäischen Reaktion, als wichtiger als das Selbstbestimmungsrecht in Bezug auf die Völker Osteuropas und des Balkans betrachteten. Im Extremfall würde dieses unter der Ideologie des Panslawismus zu einem Bollwerk gegen die demokratische und soziale Revolution.
Gegen Ende seines Lebens modifizierte Engels seine Positionen zu den osteuropäischen Nationen wie den Ruthen:innen/Ukrainer:innen, Rumän:innen und den kleineren Völkern der Karpaten, wie in einem Brief an den rumänischen Sozialisten Nadejde gezeigt wird:
„Den Zarismus zu stürzen, diesen Alpdruck zu vernichten, der auf ganz Europa lastet, das ist in unseren Augen die erste Bedingung für die Emanzipation der Nationen Mittel-
und Osteuropas. Ist erst einmal der Zarismus gestürzt, wird die unheilvolle, heute durch Bismarck repräsentierte Macht, der dann die Hauptstütze genommen ist, zusammenbrechen; Österreich wird zerfallen, da es seine einzige Daseinsberechtigung verliert, nämlich durch seine Existenz den Zarismus daran zu hindern, sich die verstreuten Nationen der Karpaten und des Balkans einzuverleiben. Polen wird neu erstehen; Kleinrußland (alte, eigentlich chauvinistische Bezeichnung für die Ukraine; d. Red.) kann frei seine politischen Verbindungen wählen; die Rumänen, die Magyaren, die Südslawen werden frei von jeder fremden Einmischung ihre Angelegenheiten und ihre Grenzfragen unter sich regeln können; … “[xviii]
Den Hintergrund dafür bildete die Entstehung einer antizaristischen demokratischen und in Ansätzen auch sozialistischen Bewegung im zaristischen Russland, die eine Umwälzung im reaktionärsten Land der Heiligen Allianz möglich erscheinen ließ und, damit verbunden, auch eine in Deutschland und Österreich. Eine methodische Verallgemeinerung des Selbstbestimmungsrechts der Nationen kann daraus jedoch bei Engels nicht herausgelesen werden. Wesentliche Arbeiten in diese Richtung leisteten vielmehr Karl Kautsky. Auf diesen Arbeiten sollte später auch Lenin aufbauen.
Doch nicht nur die Position zur nationalen Frage durchlief wichtige Veränderungen. Marx’ Haltung zum Kolonialismus änderte sich ebenfalls. In „Die britische Herrschaft in Indien“ betrachtet er die bis über Jahrhunderte vorherrschende asiatische Produktionsweise als Hort der Stagnation ohne innere Dynamik. Die Durchdringung dieser, die Zerstörung der tradierten Dorfgemeinschaft und des orientalischen Despotismus betrachtet er als historischen Fortschritt:
„Gewiß war schnödester Eigennutz die einzige Triebfeder Englands, als es eine soziale Revolution in Indien auslöste, und die Art, wie es seine Interessen durchsetzte, war stupid. Aber nicht das ist hier die Frage. Die Frage ist, ob die Menschheit ihre Bestimmung erfüllen kann ohne radikale Revolutionierung der sozialen Verhältnisse in Asien. Wenn nicht, so war England, welche Verbrechen es auch begangen haben mag, doch das unbewusste Werkzeug der Geschichte, indem es diese Revolution zuwege brachte.“[xix]
Die Zerstörung der tradierten, asiatischen Produktionsweise stellt – darin ist ihm durchaus Recht zu geben – ähnlich wie die ursprüngliche Akkumulation in England eine barbarische, blutige Periode des Übergangs zum Kapitalismus und damit zur Entstehung einer modernen Arbeiter:innenklasse dar. Deren Herausbildung stellt einen weltgeschichtlichen Fortschritt dar, denn diese setzt die Loslösung der unterdrückten Klassen von den Fesseln der feudalen, asiatischen oder anderen vorkapitalistischen Produktionsformen voraus. Nur so kann eine Klasse doppelt freier Lohnarbeiter:innen überhaupt entstehen. Zugleich erwartete Marx zunächst jedoch für Indien (und andere asiatische Länder) nicht nur Zerstörung, sondern auch industrielle Entwicklung. Diese, das merkte er schon in den 1850er Jahren an, blieb aber aus. „England hat das ganze Gefüge der indischen Gesellschaft niedergerissen, ohne daß bisher auch nur die Spur eines Neuaufbaus sichtbar geworden wäre.“[xx]
Bei Marx finden wir eine Wegbewegung und Differenzierung von den überaus kategorischen Vorstellungen Ende der 1840er und Anfang der 1850er Jahre als Resultate seiner wissenschaftlichen Studien und Arbeiten am Kapital. So enthält z. B. das bekannte Kapitel über die „Formen, die der kapitalistischen Produktion vorhergehen“[xxi] in „Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie“ eine weitaus genauere und differenziertere Analyse von Produktionsweisen, die auf Gemeineigentum beruhen, und auch eine Analyse ihrer, wenn auch weitaus weniger dynamischen, inneren Gegensätze.
Diese Betrachtung vertieft er weiter in der Analyse der Dorfgemeinschaft im Russland des 19. Jahrhunderts in den Sassulitsch-Briefen. Auch wenn es dort nicht um Indien und den Kolonialismus geht, so findet sich im dritten Entwurf des Briefes eine viel negativere Bewertung der britischen Herrschaft als in den frühen Schriften: „Was zum Beispiel Ostindien anbelangt, so ist es aller Welt, mit Ausnahme von Sir H. Maine und anderen Leuten gleichen Schlags, nicht unbekannt, daß dort die gewaltsame Aufhebung des Gemeineigentums an Grund und Boden nur ein Akt des englischen Vandalismus war, der die Eingeborenen nicht nach vorn, sondern nach rückwärts stieß.“[xxii]
Wichtiger noch ist, dass Marx in den Sassulitsch-Briefen deutlich macht, dass es keineswegs notwendig und unvermeidlich sei, dass alle Länder den europäischen Entwicklungsweg zur Durchsetzung der kapitalistischen Produktionsweise nachzuvollziehen hätten, dass die Zerstörung der russischen, auf Gemeineigentum beruhenden Dorfgemeinde nicht notwendig sei, sondern dass diese unter „günstigen Bedingungen“, also einer sozialistischen Revolution in Europa und einer damit begonnenen in Russland, direkt in sozialistisches Eigentum übergehen könne. Diese Möglichkeit besteht in den Augen von Marx nicht an sich für diese Form des Grundeigentums, sondern unter der spezifischen Voraussetzung, dass sich in anderen Teilen Russlands und vor allem für die Weltwirtschaft insgesamt der Kapitalismus und die industrielle Produktion durchgesetzt haben. Marx nimmt hier wichtige Momente der Theorie der ungleichzeitigen und kombinierten Entwicklung wie auch der Theorie der permanenten Revolution vorweg. Und er beginnt auch zu erkennen, dass zumindest ab einem bestimmten Entwicklungsstadium des Weltmarktes und der kapitalistischen Weltordnung die später kapitalisierten Länder nicht einfach den Weg der entwickelteren Länder nachvollziehen können, sondern im Gegenteil in eine abhängige Rolle gezwungen werden.
Interessanterweise entwickelt Marx selbst im 20. Kapitel des ersten Bandes des Kapitals über „Nationale Verschiedenheit der Arbeitslöhne“[xxiii] eine Erklärung für dieses Phänomen. Marx legt dar, dass sich verschiedene Entwicklungsstufen der Durchschnittsproduktivität einer Nation auf dem Weltmarkt – also auch zwischen kolonialen Gebieten und dem „Mutterland“ – vorteilhaft für die entwickeltere kapitalistische Nation auswirken.
„Diese nationalen Durchschnitte bilden also eine Stufenleiter, deren Maßeinheit die Durchschnittseinheit der universellen Arbeit ist. Verglichen mit der weniger intensiven, produziert also die intensivere nationale Arbeit in gleicher Zeit mehr Wert, der sich in mehr Geld ausdrückt.
Noch mehr aber wird das Wertgesetz in seiner internationalen Anwendung dadurch modifiziert, daß auf dem Weltmarkt die produktivere nationale Arbeit ebenfalls als intensivere zählt, sooft die produktivere Nation nicht durch die Konkurrenz gezwungen wird, den Verkaufspreis ihrer Ware auf ihren Wert zu senken.
Im Maß, wie in einem Lande die kapitalistische Produktion entwickelt ist, im selben Maß erheben sich dort auch die nationale Intensität und Produktivität der Arbeit über das internationale Niveau. Die verschiedenen Warenquanta derselben Art, die in verschiedenen Ländern in gleicher Arbeitszeit produziert werden, haben also ungleiche internationale Werte, die sich in verschiedenen Preisen ausdrücken, d. h. in je nach den internationalen Werten verschiednen Geldsummen.“[xxiv]
Im Artikel „Marxistische Imperialismustheorie: Bestandsaufnahme und Aktualisierung“[xxv]haben wir diesen Ansatzpunkt von Marx aufgegriffen, um die Wirkung des Wertgesetzes auf dem Weltmarkt genauer zu behandeln und auch ökonomisch herauszuarbeiten, wie und warum die ungleichen Verhältnisse auf dem Weltmarkt permanent reproduziert werden und ein Werttransfer von den kolonialen oder halbkolonialen Ländern in die imperialistischen stattfindet. Es ist daher auch kein Zufall, dass die marxistischen Imperialismustheorien an zentralen Kategorien der Marx’schen Kapitalanalyse anknüpfen konnten, weil Marx selbst schon wichtige theoretische Ansätze in seiner Analyse aufnimmt, nämlich dass der Kapitalismus und die Bourgeoisie als Klasse an einem bestimmten Punkt selbst aufhören, eine fortschrittliche Rolle zu spielen, und das Privateigentum an den Produktionsmitteln selbst zu einem Hindernis für die weitere Entwicklung wird. Es ist aber dieser Epochenwechsel hin zum Imperialismus, den Marx und Engels nicht mehr erleben, wodurch auch eine Neubestimmung der nationalen Frage erforderlich wird. Bevor wir auf Lenins Beitrag eingehen, wollen wir kurz wesentliche Punkte zur nationalen Frage, zum Nationalstaat und zum Kapitalismus zusammenfassen.
Nation, Nationalstaat und Kapitalismus
Nationalstaat, Nationen und Nationalismus sind selbst Resultate wesentlicher historischer Verhältnisse. Ihre Entstehung, Herausbildung und Formierung sind untrennbar mit der des Kapitalismus und der bürgerlichen Gesellschaft verbunden und stellen keineswegs überhistorische Größen dar. Vielmehr entstehen sie im Übergang zum Kapitalismus, und ihre Herausbildung stellt dabei einen revolutionären und progressiven Faktor dar. Der Kampf um nationale Einheit bildet ein wesentliches Moment des Kampfes gegen die alte, vorkapitalistische Ordnung und Produktionsweise und führt somit dazu, eine neue revolutionäre Klasse, die Bourgeoisie, an die Herrschaft zu bringen. Die Herausbildung der Nationen darf man sich dabei selbstredend ebenso wenig als einen idyllischen, friedlichen Prozess vorstellen wie die Entstehung der neuen Produktionsweise, die ihre Basis bildet und der sie zugleich zum Durchbruch verhelfen. Ebenso wie die ursprüngliche Akkumulation des Kapitals durchzieht die Entstehungsgeschichte der modernen Nationen von Beginn an Gewalt, Blutvergießen und Brutalität.
Das historisch Progressive besteht wesentlich darin, dass ihre Herausbildung und die Schaffung eines bürgerlichen Staates miteinander einhergehen und den Rahmen für die Entwicklung der kapitalistischen Produktionsweise schaffen, einen nationalen Markt als Teil des sich entwickelnden Weltmarktes. Die im Übergang zum Kapitalismus geschaffene neue Staatsform fungiert als ideeller Gesamtkapitalist, als Garant der neuen Produktionsverhältnisse, auch wenn seine konkreten politischen Formen (z. B. neue Art von Monarchie, Republik, Bonapartismus etc.) höchst unterschiedlich sein mögen.
Der Entwicklung der modernen Nationen mit ihren Hauptklassen entsprechen sowohl die kapitalistische Produktionsweise als auch eine spezifische, neue Staatsform. Anders als den feudalen Staat, aber auch den despotischen der asiatischen Produktionsweise zeichnet den bürgerlichen die Trennung von Staat und Gesellschaft aus, von politischer und ökonomischer/sozialer Ordnung. Nur so kann und muss der Staat als scheinbar über den Klassen stehend als ideelle Verkörperung der gesamten Nation erscheinen.
Die Nation erscheint zugleich als imaginäre Gemeinschaft aller Staatsbürger:innen, da sich die Angehörigen der verschiedenen, antagonistischen Klassen einander als formal gleiche Warenbesitzer:innen gegenübertreten müssen. Anders als in jeder anderen Klassengesellschaft müssen die Hauptklassen der Gesellschaft, Lohnarbeit und Kapital, einander als formal Gleiche, als Käufer:innen und Verkäufer:innen von Arbeitskraft, gegenübertreten. Dies müssen sie, nebenbei bemerkt, nicht nur in der entwickelten bürgerlichen Demokratie, wo sich diese formale Gleichheit auch als gleiches Staatsbürger:innenrecht und gleiches Wahlrecht auf die politische Sphäre erstreckt, sondern auch in Diktaturen, unter bonapartistischen Herrschaftsformen und sogar im Faschismus. Auch dort bleiben die Arbeiter:innen der herrschenden Nation formal freie Lohnarbeiter:innen, die ihre Arbeitskraft „frei“ verkaufen können oder müssen, denn auch diese Gesellschaften sind in ihrem Wesen nach Formen der verallgemeinerten Warenproduktion, also kapitalistische Gesellschaftsformationen.
Zugleich kommt dieser formalen Gleichheit immer ein fiktiver Charakter zu, da ihr eine reale Ungleichheit zugrunde liegt, nämlich die Teilung der Gesellschaft in Klassen. Lohnarbeit und Kapital sind zwar beide Käufer:innen bzw. Verkäufer:innen von Waren. Aber das Kapital monopolisiert das Eigentum an den Produktionsmitteln, während die Lohnarbeiter:innen gezwungen sind, ihre Arbeitskraft zu verkaufen. Somit verschleiert die formale Gleichheit immer auch das Klassenverhältnis. Mehr noch: Im Kapitalismus reproduzieren sich Ungleichheit und Ausbeutungsverhältnis in der Zirkulationssphäre über die formale Gleichheit, denn Freiheit und Ungleichheit sind untrennbar mit der spezifisch kapitalistischen Ausbeutung verbunden (selbst wenn sogar diese formale Gleichheit, historisch betrachtet, erkämpft werden musste).
Anders verhält es sich natürlich, sobald die Arbeitskraft, also das lebendige Arbeitsvermögen der Lohnabhängigen, verkauft und Eigentum des Kapitals geworden ist. Im Betrieb verlassen wir die Sphäre der formalen Gleichheit und Freiheit. Hier bildet die Arbeitskraft selbst einen Teil des Kapitals und operiert unter dessen Regie, unter dessen Diktat. Dieser grundlegende Charakter ändert sich auch dann nicht, wenn die Lohnabhängigen in der Lage sind, diese Despotie durch erfolgreiche Klassenkämpfe zu beschränken (z. B. Beschränkung des Arbeitstages, Arbeitsschutzgesetze, Mindestlöhne) und diese Schranken der Ausbeutung über Tarifverträge oder Gesetze dem Kapital aufzuzwingen.
Generell gilt: Der bürgerliche Staat kann seine klassenspezifische Funktion umso verlässlicher erfüllen, als er als scheinbar über der Gesellschaft stehend erscheint. Das ergibt sich daraus, dass er nur auf diese Weise bestimmte für die Sicherung des Kapitalismus notwendige Funktionen erfüllen kann. Eine essenzielle, sein Wesen prägende Aufgabe besteht natürlich darin, die bestehende bürgerliche Klassenherrschaft gewaltsam nach innen wie nach außen zu sichern. Doch darin erschöpft sich seine Funktion nicht. Der bürgerliche Staat ist auch essenziell, um bestimmte allgemeine Voraussetzungen der Akkumulation zu gewährleisten, wie z. B. Geldstabilität und –zirkulation. Das Gesamtinteresse des Kapitals stellt dabei nicht einfach die Summe der Einzelinteressen der konkurrierenden Unternehmen dar, sondern dieses muss notfalls auch widerstreitenden Einzelkapitalien durch den Staat aufgezwungen werden. Eine direkte Regierung durch unmittelbare Vertreter:innen großer Einzelkapitale (siehe die „Regierung der Milliardäre“ in den USA) kann dabei eher disfunktional sein. Ökonomisch erfordert zudem die Konkurrenz der Kapitale untereinander, aber auch die Regelung des Warentausches zwischen allen Gesellschaftsmitgliedern (also auch zwischen Lohnarbeit und Kapital), dass innere Konflikte als Rechtsstreit geregelt werden. Auch dazu muss der Staat als scheinbar über allen stehende Instanz wirken.
Ähnlich wie das Klassenverhältnis von Lohnarbeit und Kapital eine Doppelung von Zirkulation und Produktion kennzeichnet, so erscheint der Staat zum einen als Zusammenfassung scheinbar gleicher Staatsbürger:innen. Andererseits stützt er sich jedoch notwendigerweise auf einen bürokratischen und militärischen Apparat, der eng und über Regierungs- und Regimewechsel hinaus untrennbar mit dem der herrschenden Klasse verbunden ist.
Die bürgerliche Nation ist sowohl die Geburtshelferin dieses kapitalistischen Staates als auch dessen ideelle Verkörperung. Idealtypisch zeichnet sie eine innere Klassenstruktur aus, deren Hauptantagonist:innen Lohnarbeit und Kapital bilden, die aber auch weitere Abstufungen kennt – Großgrundbesitz, ländliches und städtisches Kleinbürger:innentum, lohnabhängige Mittelschichten, Lumpenproletariat, Reste vorhergehender Klassengesellschaften (z. B. Kastenwesen, Adel …), die teilweise funktional ins kapitalistische System integriert werden.
Zweitens umfasst die moderne Nation ein gemeinsames ökonomisches und staatliches Gebiet sowie in der Regel auch eine oder mehrere gemeinsame Sprache(n), Kultur und historische Tradition. Ideologisch verdichtet sich dies zu einer nationalen Ideologie, zum Nationalismus, der sich auf Basis eines Staates herausbildet oder die Schaffung eines solchen anstrebt.
Diese Eigenschaften treffen auf die dominierenden bürgerlichen Staaten und Nationen zu, selbst wenn etliche keine Nationalstaaten im engen Sinne sind, die nur von einer Nation bewohnt werden. Etliche der ehemaligen Kolonien sowie alle noch immer kolonialisierten, innerhalb eines bestehenden Staates unterdrückten Nationen zeichnen sich dadurch aus, dass die Etablierung eines eigenen Staates nicht oder nur teilweise abgeschlossen ist. Das liegt daran, dass etliche der nach der Entkolonialisierung etablierten Staaten selbst Resultat kolonialer Grenzziehung sind und somit ganze Nationen willkürlich zwischen verschiedenen Staaten aufgeteilt und unterdrückt sind (z. B. Kaschmir, Belutschistan, Kurdistan) oder überhaupt vollständig unter Kolonialherrschaft leben bzw. als Vertriebene leben müssen (z. B. Palästina).
Der Nationalismus als vorherrschende bürgerliche Ideologie ist in jedem Fall untrennbar mit der Entstehung und Durchsetzung moderner Klassenverhältnisse, mit dem Aufstieg der Bourgeoisie als herrschender Klasse und der Festigung ihrer Herrschaft verbunden. In der nationalistischen Ideologie erscheinen die Angehörigen der Nation notwendigerweise als klassenübergreifende Gemeinschaft. Das betrifft sowohl die demokratisch-nationalistische Ideologie als auch alle anderen Ausprägungen des Nationalismus, z. B. den völkischen. Das kann sich auch in verschiedenen Begriffen von Nation widerspiegeln. In Frankreich wird der Begriff verstanden als die Bevölkerung eines Staates und unter „Nationalität“ Staatsangehörigkeit und/oder eine ethnische Gruppe. Im Deutschen beziehen sich beide Begriffe eher auf ethnische/sprachliche Gruppen („Volk“) bis hin zur völkischen Blut- und Boden-Ideologie. Marx und Engels benutzen den Begriff eher im Sinne der französischen bürgerlichen Revolution. In allen Fällen erscheinen die Angehörigen der verschiedenen Klassen als eine über allen anderen inneren Gegensätzen stehende Einheit, im Extremfall als Angehörige einer „nationalen Schicksalsgemeinschaft“.
Obwohl Nationen und Nationalismus selbst einer bestimmten historischen Epoche angehören, entspringt es den Klasseninteressen der Bourgeoisie und der ihr angelagerten Schichten, ihre eigene Vorherrschaft über die anderen Klassen zu verewigen. Daraus folgt bei allen auch noch so verschiedenen Nationalismen das innere Bedürfnis, die eigene Entstehung möglichst weit in die Vergangenheit zu verlagern. So begegnen wir den „ersten“ Italiener:innen im antiken Rom, den ersten Griech:innen in Sparta und Athen, den ersten Deutschen im Teutoburger Wald usw. Die Nation wird auf diese Weise als immer schon dagewesen imaginiert und das historische Verhältnis naturalisiert. Diese Tendenz, bürgerliche gesellschaftliche Verhältnisse und Institutionen als überhistorische Phänomene zu begreifen, als „natürliche“, scheinbar dem Wesen „des“ Menschen entspringende, immerwährende Größen zu setzen, begegnen wir bekanntlich nicht nur beim Nationalismus, sondern auch bei anderen Institutionen wie der Familie oder bei scheinbar „natürlichen“ Eigenschaften „der“ Menschen. Dabei wird der bürgerliche Mensch oder seine Ideologie in die Geschichte zurückprojiziert wie auch für alle Zukunft behauptet. So gab es z. B. immer schon „natürlicherweise“ Ungleichheit, oben und unten. Das Nationalgefühl gilt dabei als eine besonders tief sitzende, unveränderliche Kerneigenschaft aller menschlichen Gemeinschaften, die letztlich auch viel tiefer sitze als das Klassenbewusstsein und der Klassenkampf.
Diese Vorstellung unterschlägt damit auch gleich, dass der Nationalismus selbst keineswegs außerhalb und unabhängig von der Klassengesellschaft existiert, sondern im Kapitalismus eine der dominierenden, grundlegendsten bürgerlichen Ideologien darstellt, weil er untrennbar mit materiellen Kernmomenten der Produktion und Reproduktion des Kapitals verbunden ist. Dazu gehören die Herstellung und Sicherung des nationalen Rahmens für die Kapitalbewegung, die Bildung einer Durchschnittsprofitrate, eines nationalen Kapitals, die Regelung der Konkurrenz und Sicherung der allgemeinen Bedingungen der Akkumulation, die Vermittlung des Klassenverhältnisses selbst sowie die Sicherung der Konkurrenzfähigkeit auf dem Weltmarkt und der Stellung in der globalen Ordnung.
Anders gesagt: Wie jede prägende, grundlegende Ideologie der bürgerlichen Epoche hat auch der Nationalismus materielle Wurzeln. Er kann daher nicht einfach „abgeschafft“ oder „raus aus den Köpfen“ geschlagen werden, solange nicht die materiellen Verhältnisse, die ihn hervorbringen, bekämpft und überwunden werden. Erst recht können Nationen nicht einfach „abgeschafft“ werden (es sei denn auf ultrareaktionäre, barbarische Weise wie z. B. im Kolonialismus oder durch den Völkermord). Damit die Nationen und die mit ihnen verbundenen Bewusstseins- und Ideologieformen überwunden werden oder absterben können, muss die Klassenspaltung der Gesellschaft aufgehoben werden, die sie notwendigerweise hervorbringt.
Kautsky
Obige kurze Skizze wirft die Frage nach dem Verhältnis von nationaler Frage, und generell demokratischen Fragen, zur sozialistischen Revolution auf. Nach dem Tod von Marx und Engels entwickelte vor allem Karl Kautsky die Position zur nationalen Frage weiter. Sein Artikel „Die moderne Nationalität“ stellt einen bedeutenden Fortschritt dar und einen Bruch mit der Konzeption von Marx und Engels in der 1848er Revolution. Kautsky versteht darin unter Nation ein historisch-spezifisches ökonomisches, sprachliches und territoriales Gebilde, wobei er eine besonders starke Betonung auf die Sprache legt, da diese, ihre Verbreitung und ihre Entwicklung, ein Gradmesser für die Entwicklung der Produktivkräfte sei.
Das trifft in dieser Allgemeinheit durchaus zu, allerdings findet sich bei Kautsky eine Tendenz, die Assimilation der Nationen untereinander einseitig als die zentrale geschichtliche Tendenz des Kapitalismus in seinen verschiedenen Epochen auszumachen. Dies hängt eng mit seinem eigenen, vom Objektivismus der 2. Internationale und später auch von seiner revisionistischen Theorie des „Ultra-Imperialismus“ zusammen. Für Kautsky stellt der Imperialismus im Grunde einen Atavismus dar, einen eigentlich überholten Restbestand einer früheren Entwicklungsstufe des Kapitalismus, der vor allem auf den Interessen des Großgrundbesitzes basiere, nicht auf jenen des modernen industriellen, kommerziellen und zinstragenden Kapitals. Daher folgt für ihn auch logisch die Tendenz zum immer stärkeren Verschmelzen der Nationen, auch wenn er anerkennt, dass es zugleich auch ein Anwachsen des Nationalbewusstseins und ein Verlangen nach Bildung eigener Nationalstaaten gebe. Dem müssten Revolutionär:innen Rechnung tragen, weil die zwanghafte Einverleibung einer anderen Nation oder auch von Kolonien notwendigerweise Unterdrückung schaffe und daher die Verschmelzung der Nationen verhindere und erschwere.
Daher betonte Kautsky immer wieder (auch in seinen späteren Schriften) die Freiwilligkeit des Prozesses der Nationenbildung, und er trat für das nationale Selbstbestimmungsrecht ein. Diese Position wurde 1896 von der 2. Internationale angenommen, und er verteidigte sie gegen den Austromarxismus Bauers und Renners sowie die ultralinken Kritiken Luxemburgs und Pannekoeks.[xxvi]
Als erster Theoretiker der internationalen Arbeiter:innenbewegung erkannte Kautsky auch die Notwendigkeit einer Revision der Auffassungen von Marx’ und Engels’ Positionen: „Ich bin eben in der orientalischen wie der polnischen Frage der Ansicht, dass die alte Marx’sche Haltung unhaltbar geworden ist, wie ja auch seine Haltung zu den Tschechen. Es wäre ganz unmarxistisch, seine Augen vor den Tatsachen zu verschließen und am alten Marx’schen Standpunkt zu beharren.“[xxvii]
Auch wenn er, anders als später Rosdolsky, die Konzeption der geschichtslosen Völker nicht grundsätzlich kritisiert, so betont Kautsky in „Die Slawen und die Revolution“ (1902) und „Die nationalen Aufgaben der Sozialisten unter den Balkanslawen“ (1908) die Veränderung der Klassenstrukturen unter den slawischen Nationen, die Herausbildung einer modernen Arbeiter:innenklasse, damit auch die Entwicklung revolutionären Denkens und von revolutionären Parteien unter diesen.
Lenin vor dem Ersten Weltkrieg
Unschwer lässt sich in den Jahren bis vor dem Ersten Weltkrieg zeigen, dass Lenins Position zur nationalen Frage stark von Kautskys Arbeiten geprägt und beeinflusst war, so wie ihn umgekehrt Lenin und die Bolschewiki in der internationalen Sozialdemokratie gegen rechte und ultralinke Kritiken unterstützten.
Die Russische Sozialdemokratie nahm 1903 das Selbstbestimmungsrecht der Nationen in ihr Programm auf, was zum Scheitern der Vereinigungsverhandlungen mit der von Luxemburg und Jogiches geleiteten SDKPiL (Sozialdemokratie des Königreichs Polens und Litauens) führte.
In den Diskussionen im Zusammenhang mit dem 2. Parteitag legte Lenin in einer Polemik gegen den rechten Flügel der polnischen Sozialdemokratie, die PPS, seine Position dar. Im Programmentwurf und später auch im Programm der Russischen Sozialdemokratie heißt es: „Anerkennung des Selbstbestimmungsrechts aller Nationen, die dem Staat angehören.“ Die PPS lehnte diese Passage ab, weil darin nicht ausdrücklich die staatliche Loslösung der polnischen Nation gefordert wird. Im Artikel „Die nationale Frage in unserem Programm“[xxviii] hielt Lenin entgegen, dass die Anerkennung des Rechts auf Selbstbestimmung keineswegs immer und kategorisch bedeuten müsse, dass proletarische Revolutionär:innen für die Schaffung eines eigenen Staates eintreten:
„Die Sozialdemokratie wird stets jeden Versuch bekämpfen, durch Gewalt oder Ungerechtigkeit, welcher Art auch immer, die nationale Selbstbestimmung von außen her zu beeinflussen. Doch die bedingungslose Anerkennung des Kampfes für die Freiheit der Selbstbestimmung verpflichtet uns keineswegs, jede Forderung nach nationaler Selbstbestimmung zu unterstützen. Die Sozialdemokratie sieht als Partei des Proletariats ihre positive und wichtigste Hauptaufgabe darin, die Selbstbestimmung nicht der Völker und Nationen, sondern des Proletariats innerhalb jeder Nationalität zu fördern. Wir müssen stets und unbedingt die engste Vereinigung des Proletariats aller Nationalitäten anstreben, und nur in einzelnen Ausnahmefällen können wir Forderungen, die auf die Schaffung eines neuen Klassenstaates oder auf die Ersetzung der völligen politischen Einheit eines Staates durch eine lose föderative Einheit usw. hinauslaufen, aufstellen und aktiv unterstützen.“[xxix]
Lenin steht in dieser Phase auf dem Boden der von Kautsky und auch von Franz Mehring formulierten Position zur nationalen Frage. Er verteidigt grundsätzlich das Selbstbestimmungsrecht der Nationen und lehnt, wie auch in späteren Schriften, konsequent eine ideologische Anpassung an jeden Nationalismus, also auch den der Unterdrückten, ab. Allerdings verbleibt seine Vorstellung auch auf dem Boden der Konzeption der russischen Revolution als bürgerlich-demokratische rRevolution.
Zweitens steht Lenin 1903 auch auf dem Boden der von Kautsky geprägten Revolutionsvorstellung, die von einer stärkeren Tendenz zur Vereinheitlichung des Proletariats ausgeht, die durch die objektive kapitalistische Entwicklung vorangebracht würde. Lenin hatte zu dieser Zeit keine Imperialismustheorie entwickelt, daher fehlt auch der Bezug der nationalen Frage zum Imperialismus. Neben der Polemik gegen die PPS findet sich schon damals eine Abgrenzung zu den Positionen der SDKPiL, wenn auch weit weniger scharf akzentuiert als in späteren Jahren.
Am Beginn des 20. Jahrhunderts beschäftigt sich Lenin (in der Auseinandersetzung in der Arbeiter:innenbewegung) mit zwei weiteren wichtigen politischen Fragen. Erstens mit der Ablehnung der Forderung des Jüdischen Bundes, aber auch der PPS, nach einer politischen Alleinvertretung des jüdischen bzw. polnischen Proletariats innerhalb der Sozialdemokratie in Russland. Dies, so Lenin, laufe auf eine föderalistische Parteikonzeption hinaus, die die bestehende nationale Spaltung nicht zu bekämpfen und zu überwinden in der Lage sei, sondern vielmehr gewollt oder ungewollt reproduziere und vertiefe:
„Die fluchwürdige Geschichte der Selbstherrschaft hat uns eine sehr große Entfremdung der Arbeiterklassen der von dieser Selbstherrschaft unterdrückten verschiedenen Völkerschaften als Erbe hinterlassen. Diese Entfremdung ist das größte Übel, das größte Hindernis im Kampf gegen die Selbstherrschaft, und wir dürfen dieses Übel nicht zum Gesetz erheben, dürfen dieser Schmach nicht die Weihe geben durch irgendwelche ‚Prinzipien’ von getrennten Parteien oder einer ,föderativen‘ Partei. Es ist natürlich einfacher und leichter, den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen und jeden sich in seinem Winkel einrichten zu lassen nach der Regel: ,Die andern gehn mich nichts an’, wie es jetzt auch der ‚Bund‘ tun will. Je mehr wir die Notwendigkeit der Einheit erkennen, je fester wir von der Unmöglichkeit eines allgemeinen Ansturms auf die Selbstherrschaft ohne vollständige Einheit überzeugt sind, je stärker unter unseren politischen Verhältnissen die unbedingte Notwendigkeit einer zentralistischen Organisation des Kampfes hervortritt – desto weniger sind wir geneigt, uns mit einer ‚einfachen‘, aber nur scheinbaren und ihrem Wesen nach grundfalschen Lösung der Frage zufriedenzugeben.“[xxx]
Die Revolution, so die Grundauffassung von Lenin und des nach 1903 entstehenden Bolschewismus, erfordert in einem Land eine zentralisierte, einheitliche Kampfpartei der Arbeiter:innenklasse, die die Lohnabhängigen aller Nationen und Nationalitäten umfasst. Nur so könne sie jene Einheit und Führungsrolle übernehmen, die es ihr ermöglicht, alle Unterdrückten zum revolutionären Sturz der bestehenden Herrschaft zu führen.[xxxi] Eine föderative Partei, in der jede Nation innerhalb eines Staatsverbandes ihre eigene Politik autonom regeln könne, sei hingegen keine einheitliche Kraft, sondern vielmehr eine Reihe national-proletarischer Parteien, die allenfalls als Bündnis agieren, letztlich aber ihre nationalen Sonderinteressen über jene des gesamten Proletariats stellen würden. Dies bedeute notwendigerweise, die vorhandene Entfremdung und Spaltung der Arbeiter:innenklasse entlang nationaler Linien als unveränderlich hinzunehmen und zu reproduzieren. Auch wenn dies nicht gewollt sein mag, so führe eine solche Politik zu einer Anpassung an die verschiedenen Nationalismen innerhalb eines Landes.
Lenin ist sich dabei durchaus bewusst, dass in Großreichen wie dem zaristischen Russland oder in der Habsburger-Monarchie Chauvinismus, Nationalismus und Rassismus der herrschenden Nationen auch in der Arbeiter:innenklasse reproduziert werden – konkret am Beginn des 20. Jahrhunderts der großrussische und der deutsch-österreichische. Allerdings löst nicht die Föderation dieses Problem, sondern nur der Kampf der revolutionären Partei gegen alle Formen der Unterdrückung, einschließlich aller Formen der nationalen Unterdrückung. Das umfasst notwendigerweise auch den Kampf gegen jede Erscheinung des Chauvinismus und Nationalismus der Lohnabhängigen in der herrschenden Nation, einschließlich ihrer Reproduktion innerhalb der Arbeiter:innenbewegung oder auch der revolutionären Partei. Lenin war sich wie viele Vertreter:innen des linken Flügels der Zweiten Internationale dieses Problems sehr bewusst und hat zeit seines Lebens dagegen angeschrieben und angekämpft – nicht nur in Bezug auf Russland, sondern auch auf das Selbstbestimmungsrecht, die Frage der Migration und die Kolonialfrage.
Zweifellos war der Bolschewismus auch vor dem Ersten Weltkrieg nicht frei von chauvinistischen Einflüssen, aber die politische Konzeption Lenins begriff den Kampf gegen nationale Unterdrückung, gegen die zaristische Politik der Russifizierung sowie den Kampf gegen alle Formen der Unterdrückung als integralen Teil des Klassenkampfes. Die scharfe Ablehnung und Polemik gegen den damit zusammenhängenden Ökonomismus bedeutet auch, dass die Bolschewiki der nationalen Unterdrückung beständig Aufmerksamkeit schenkten und
diese als Teil des Klassenkampfes gegen den Zarismus, den Krieg und für die demokratische und später für die sozialistische Revolution begriffen.
Ein zweites zentrales Thema Lenins bildet die Kritik des Programms der „nationalkulturellen Autonomie“, wie es vom Austromarxismus vertreten und dem Recht auf nationale Selbstbestimmung entgegengesetzt wurde. Wie das zaristische Russland war auch das Habsburgerreich ein Völkergefängnis, doch die österreichische Sozialdemokratie entwickelte Ende des 19. Jahrhunderts eine den Bolschewiki entgegengesetzte Antwort auf die nationale Frage.
Auf dem Gründungsparteitag von Neudörfl im Jahr 1874 spricht das Parteiprogramm der österreichischen Sozialdemokratie noch vom „Selbstbestimmungsrecht der Völker als Grundsatz“, aber ohne diesen weiter zu konkretisieren. In den Jahren nach ihrer Gründung geht die österreichische Sozialdemokratie zudem noch davon aus, dass sich die Nationalitätenfrage mehr oder weniger von selbst erledigen und in der Arbeiter:innenklasse immer weniger Bedeutung haben würde. Doch dies erwies sich rasch als fatale Fehleinschätzung. Spätestens in den letzten beiden Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts traten die nationalen und wirtschaftlichen Gegensätze unter den Lohnabhängigen immer stärker hervor und wurden von den herrschenden Klassen bewusst geschürt. Unter der Führung von Victor Adler versuchte die Sozialdemokratie zuerst, dem Problem auszuweichen, und beschränkte sich auf allgemeine Erklärungen gegen Chauvinismus und nationale Vorurteile. Im Hainfelder Programm von 1888/89 beschränkte sie sich auf die Forderung einer „antifeudalen“ Modernisierung des Reiches, während das Selbstbestimmungsrecht der Nationen nicht mehr auftauchte. Auf die immer größer werdenden nationalen Gegensätze hatte sie damit überhaupt keine Antwort.
Die Partei beschritt 1897 den Weg, den die PPS und der jüdische „Bund“ für die russische Sozialdemokratie verfochten hatten – die österreichische Sozialdemokratie wandelte sich in eine Föderation nationaler Parteien um. 1899 beschloss die Sozialdemokratie das Brünner Nationalitätenprogramm. Dieses stand zwar nicht voll auf dem Boden der national-kulturellen Autonomie, aber darin wird versucht, das Habsburgerreich durch die Umgestaltung zu einem „demokratischen Nationalitätenbundesstaat“ zusammenzuhalten, in dem die Nationen jeweils eigene nationale Parlamente (Nationalkammern) bilden sollen.
Das eigentliche Programm der national-kulturellen Autonomie entwickelten hingegen Karl Renner und Otto Bauer. Renner versteht die Nation dabei ahistorisch als Personenverband, als „geschichtlich gewordene Sprach- und Kulturgemeinschaft“, als Gemeinschaft kraft der Natur und der Geschichte, die nicht an Territorien gebunden sei. So beginnt der Artikel „Das nationale Problem in der Verwaltung“ gleich mit einer nichtmarxistischen Definition:
„Die Nationalität als geschichtlich gewordene Sprach- und Kulturgemeinschaft ist vor dem modernen Staate, ist an sich eine Gemeinschaft kraft der Natur und Geschichte, sie besteht nicht von Rechts wegen. Das Band, das Millionen zu einer Nation verbindet, ist ein innerlich gewachsenes, nicht von außen angefügtes. Der Staat aber verbindet seine Bürger durch den äußeren Zwang des Rechtes. Man kann den Unterschied kurz so in eine Formel bringen: Die Nation ist Naturtatsache, der Staat rechtliche Tatsache; Die Nationalität ist vorstaatlich und vorrechtlich. Sie ist logisch und faktisch nicht aufgehoben und geändert, wenn wir den Staats- und Rechtsverband zerstört oder gewechselt denken (Eroberung, Auswanderung).“[xxxii]
Daher braucht das Habsburgerreich zu seinem Erhalt eine Demokratisierung und parallel zu einer territorialen Gliederung auch nationale Gliederungen (Nationalkammern), denen alle Mitglieder gemäß ihrer Nation zugeordnet werden sollten. So sollten sie ihre nationale Sprach- und Kulturgemeinschaft und ihre kulturellen Fragen autonom und parallel zur staatlichen Gliederung regeln. In Renners Vorstellung würde sich das vor allem auf Schulen und kulturelle Einrichtungen beziehen, wenn er vorschlägt, den Nationalgemeinden „in erster Linie alle Kompetenzen zuzuweisen, welche nach dem Reichsvolksschulgesetz und den sonstigen Schulgesetzen den Gemeinden zustehen“.[xxxiii]Renner spricht sich für national getrennte Schulen aus, eine Forderung, die Lenin zu Recht scharf kritisiert.
Eine über die Grenzen Österreichs weit mehr rezipierte Begründung der national-kulturellen Autonomie legt Otto Bauer vor. Anders als Marx, Engels, Lenin, Trotzki, Kautsky und fast alle Marxist:innen seiner Zeit begriff Bauer (ähnlich wie Renner) Nationen nicht als spezifisches Produkt der Entstehung und Durchsetzung des Kapitalismus. Nationen gab es seiner Auffassung zufolge auch in früheren Gesellschaftsformationen – so z. B. die „germanische Nation“, die aber verschwunden wäre. In „Die Nationalitätenfrage und die Sozialdemokratie“ aus dem Jahre 1907 geht Bauer folgendermaßen an das Problem heran: „Die Frage der Nation kann nur aufgerollt werden aus dem Begriff des Nationalcharakters.“[xxxiv] Diesen betrachtet Bauer zwar als durchaus veränderlich über Geschichtsperioden hinweg, er konstatiert aber eine gemeinsame Charaktereigenschaft, die die „Zugehörigen einer Nation während eines bestimmten Zeitalters“ verknüpft. Bauer illustriert dies gleich zu Beginn am scheinbar selbstverständlichen Beispiel: „Bringen wir den erstbesten Deutschen in ein fremdes Land, etwa mitten unter Engländer, und er wird sich sofort dessen bewusst: Das sind andere Menschen, Menschen mit einer anderen Art zu denken, zu fühlen, Menschen, die auf den gleichen äußeren Reiz anders reagieren als die gewohnte deutsche Umgebung.“
In einer bestimmten Periode sei die nationale Identität, der Nationalcharakter etwas Gegebenes. Daher auch die später entwickelte Definition Bauers: „Die Nation ist die Gesamtheit der durch Schicksalsgemeinschaft zu einer Charaktergemeinschaft verknüpften Menschen.“ Natürlich, so konstatiert er, gebe es auch andere, mit dem Nationalcharakter vergleichbare, ähnlich tief verwurzelte Identitäten von Menschen – z. B. die internationale gemeinsame Identität als Arbeiter:innen oder als Angehörige eines Berufes.
Nationen werden nicht als historisch spezifische Produkte der bürgerlichen Gesellschaft betrachtet, der gemeinsame Wirtschaftsraum, die Herausbildung und Spaltung der Gesellschaft in moderne Klassen bilden für Bauer nicht deren materielle Grundlage. Vielmehr bedauern er und andere Austromarxist:innen den tendenziellen Ausschluss der Arbeiter:innenklasse und bäuerlichen Massen vom Zugang zur nationalen Kultur. Auch wenn es Tendenzen zur Öffnung gegenüber diesen gebe und dafür aktiv gekämpft werden müsse, so könnten nach Ansicht Bauers erst im Sozialismus die nationale Kultur und der Nationalcharakter voll entfaltet werden.
Da Nationalkultur und Nationalcharakter nicht als Produkt der bürgerlichen Klassengesellschaft und damit als ideologischer Ausdruck der vorherrschenden bürgerlichen Klasse begriffen werden, vertritt der Austromarxismus ein affirmatives, bewahrendes Verhältnis zur Nationalkultur und letztlich auch zum nationalistischen Bewusstsein. Nicht das Selbstbestimmungsrecht, also eine Reihe politisch-demokratischer Rechte bis hin zum Recht auf Loslösung und eigene Staatsbildung, werden gefordert, um Formen der politischen Unterdrückung zu beseitigen. Vielmehr stehen eine weitgehende Autonomie und die Förderung der verschiedenen nationalen Kulturen in einem Staatsgebiet im Zentrum des Programms des Austromarxismus. Die nationalen „Schicksalsgemeinschaften“ werden als gegebene, letztlich feste Bestandteile des Staatsganzen begriffen, die, wo sie keinen eigenen Staat konstituieren, als nationale autonome Gemeinschaften in Erscheinung treten.
In der Zweiten Internationale polemisierten von Beginn an eine Reihe von Marxist:innen, darunter Kautsky und Pannekoek, gegen diesen offenkundig idealistischen Nationsbegriff. Lenin und die Bolschewki gehörten zu den wichtigsten und besten Kritiker:innen dieser Konzeption. So stellt z. B. Stalins „Marxismus und die nationale Frage“[xxxv] über weite Strecken eine Polemik gegen den Austromarxismus dar. Lenin greift diesen bzw. ähnliche Grundannahmen immer wieder scharf an. In „Kritische Bemerkungen zur nationalen Frage“ widmet er der „nationalen Kultur“ ein eigenes Kapital, wo er kategorisch und ganz im Gegensatz zu Bauer und Co. feststellt: „Die Losung der nationalen Kultur ist ein bürgerlicher Betrug (…). Unsere Losung ist die internationale Kultur des Demokratismus und der Arbeiterbewegung der ganzen Welt.“[xxxvi]
Das bedeutet nicht, dass es nicht auch in jeder Nation und somit auch in der nationalen Kultur progressive Elemente gebe, aber diese seien ein Resultat des Klassenkampfes der Unterdrückten, kein prägendes Moment der „nationalen Kultur“, die notwendigerweise von den herrschenden Klassen und Schichten geprägt sein müsse.
„In jeder nationalen Kultur gibt es – seien es auch unentwickelte – Elemente einer demokratischen und sozialistischen Kultur, denn in jeder Nation gibt es eine werktätige und ausgebeutete Masse, deren Lebensbedingungen unvermeidlich demokratische und sozialistische Ideologie erzeugen. In jeder Nation gibt es aber auch eine bürgerliche (und in den meisten Fällen noch dazu erzreaktionäre und klerikale) Kultur, und zwar nicht nur in Form von ,Elementen’, sondern als herrschende Kultur. Deshalb ist die ‚nationale Kultur‘ schlechthin die Kultur der Gutsbesitzer, der Pfaffen, der Bourgeoisie.“[xxxvii]
Schon hier wird der Gegensatz zum Austromarxismus deutlich. Die Lösung der national-kulturellen Autonomie stellt für Lenin eine Anpassung an den bürgerlichen Nationalismus dar, weil sie nationalistische Ideologie in der Arbeiter:innenklasse als etwas Gegebenes, nicht zu Überwindendes akzeptiert. Wie problematisch die Losung der „nationalen Kultur“ ist, wird bei einer herrschenden Nation leicht, geradezu automatisch deutlich. Ein großrussischer oder deutscher Marxist, der diese für sich annehme, gehöre, so Lenin, ins Lager des Nationalismus, nicht des Marxismus oder der revolutionären Arbeiter:innenbewegung. Doch auch bei den unterdrückten Nationen prägten Bourgeoisie und Kleinbürger:innentum das vorherrschende Bewusstsein; daher müsse der Marxismus auch in unterdrückten Nationen für den vollständigen Bruch der Arbeiter:innen mit dem Nationalismus eintreten. „Wer dem Proletariat dienen will, der muß die Arbeiter aller Nationen vereinigen und den bürgerlichen Nationalismus, sowohl den ‚eigenen‘ als auch den fremden, unentwegt bekämpfen. Wer die Losung der nationalen Kultur verficht, der gehört unter die nationalistischen Spießer, nicht aber unter die Marxisten.“[xxxviii]
Im Kapitel, das er der Kritik der „national-kulturellen Autonomie“ widmet, wendet sich Lenin scharf gegen die Forderungen nach national getrennten Schulen innerhalb eines Staates: „In den Aktiengesellschaften sitzen die Kapitalisten verschiedener Nationen einträchtig beisammen, sind ein Herz und eine Seele. In Fabriken arbeiten Arbeiter verschiedener Nationen zusammen. In jeder wirklich ernsten und tiefgreifenden politischen Frage erfolgt die Gruppierung nach Klassen und nicht nach Nationen. Das Schulwesen usw. ‚der Kompetenz des Staates zu entziehen‘ und den Nationen zu übergeben, ist gerade ein Versuch, das sozusagen am meisten ideologische Gebiet des gesellschaftlichen Lebens, wo die ‚reine‘ nationale Kultur oder die nationale Kultivierung des Klerikalismus und des Chauvinismus am leichtesten durchzuführen ist, von dem die Nationen verschmelzenden Wirtschaftsleben zu trennen.“[xxxix]
Im praktischen Leben würde die national-kulturelle Autonomie, wie sie von Renner und Bauer, aber in Russland auch von den Bundist:innen, von Sozialrevolutionär:innen und Teilen des Menschewismus neben einigen Liberalen vertreten wurde, auf die „Trennung des Schulwesens nach Nationalitäten, d. h. die Einführung nationaler Kurien im Schulwesen“ hinauslaufen. „Es genügt, sich dieses wahre Wesen des vielgerühmten bundistischen Planes klar vor Augen zu halten, um zu begreifen, wie völlig reaktionär dieser selbst vom Standpunkt der bürgerlichen Demokratie ist, ganz zu schweigen vom Standpunkt des proletarischen Klassenkampfes für den Sozialismus.“[xl]
In den „Kritischen Betrachtungen“ fasst Lenin zugleich das nationale Programm der Arbeiter:innenklasse zusammen, das sich entschieden an Forderungen gegen jedes Privileg einer Nation und einer Sprache orientiert. Es wendet sich gegen jede Form der Diskriminierung und jede Form zwanghafter Assimilierung und Unterdrückung nationaler Minderheiten (z. B. Russifizierung). So lehnen Lenin und die Bolschewiki die Forderung nach einer einheitlichen Staatssprache für Russland entschieden ab – nicht, weil sie nicht anerkennen, dass das Russische die wichtigste Verkehrssprache ist, sondern weil sie entschieden gegen die Zwangsrussifizierung und Assimilierung und damit auch gegen die nationale Unterdrückung auftreten. Vielmehr schließt Lenin den Artikel „Ist eine obligatorische Staatssprache notwendig?“ mit den Worten:
„Das ist der Grund, weshalb die russischen Marxisten sagen, es ist notwendig, daß keine obligatorische Staatssprache besteht, wobei der Bevölkerung Schulen zu gewährleisten sind mit Unterricht in allen regionalen Sprachen, und wobei ein grundlegendes Gesetz in die Verfassung aufzunehmen ist, wonach alle wie immer gearteten Privilegien der einen oder anderen Nation, alle wie immer gearteten Verstöße gegen die Rechte einer nationalen Minderheit für ungültig erklärt werden …“[xli]
Und er sieht das Selbstbestimmungsrecht bis hin zum Recht auf Loslösung vor. Lenin versucht damit, die nationale Frage auf die Bekämpfung nationaler Unterdrückung und Ungleichheit – und damit verbunden auf Fragen der politischen Demokratie – zu fokussieren.
„Kampf gegen jede nationale Unterdrückung – unbedingt ja. Kampf für jede nationale Entwicklung, für die ‚nationale Kultur’ schlechthin – unbedingt nein. Die wirtschaftliche Entwicklung der kapitalistischen Gesellschaft liefert uns in der ganzen Welt Beispiele nicht voll entwickelter nationaler Bewegungen, Beispiele für die Bildung großer Nationen aus einer Reihe kleinerer und zum Nachteil einiger kleinerer Nationen, Beispiele der Assimilation von Nationen. Der Grundsatz des bürgerlichen Nationalismus ist die Entwicklung der Nationalität schlechthin, daher die Ausschließlichkeit des bürgerlichen Nationalismus, daher der ausweglose Hader. Das Proletariat dagegen übernimmt es keineswegs, die nationale Entwicklung jeder Nation zu verteidigen, sondern im Gegenteil, es warnt die Massen vor solchen Illusionen, setzt sich für die vollste Freiheit des kapitalistischen Verkehrs ein und begrüßt jede Assimilation von Nationen mit Ausnahme der gewaltsam durchgeführten oder auf Privilegien gestützten.“[xlii]
In diesen Worten bekräftigt Lenin, dass sich die Arbeiter:innenklasse den progressiven, vereinheitlichenden Tendenzen des Weltmarktes und damit verbunden auch dem Verschmelzen, der Integration und auch dem Verschwinden von Nationen nicht entgegenstellt. Im Gegenteil, die sozialistische Weltrevolution selbst zielt mit der Abschaffung der Klassenspaltung der Gesellschaft notwendigerweise auch auf das Absterben und die perspektivische Verschmelzung aller Nationen.
Zugleich aber wendet sich Lenin schon vor dem Ersten Weltkrieg scharf gegen die mechanische Vorstellung der linken Gegner:innen des Selbstbestimmungsrechts der Nationen, wie z. B. Luxemburg oder auch Bucharin. So wirft Luxemburg Kautsky und auch den Bolschewiki vor, dass sie durch die Befürwortung des Rechts auf nationale Selbstbestimmung den Nationalismus der Bourgeoisie der unterdrückten Nation unterstützen würden.
Lenin entgegnet Luxemburg ausführlich in der Schrift „Über das Selbstbestimmungsrecht der Nationen“[xliii], indem er darauf hinweist, dass die Arbeiter:innenklasse zwei Tendenzen betrachten und unterscheiden muss: „Insofern die Bourgeoisie einer unterdrückten Nation gegen die unterdrückende kämpft, insofern sind wir stets und in jedem Fall entschlossener als alle anderen dafür, denn wir sind die kühnsten und konsequentesten Feinde der Unterdrückung. Sofern die Bourgeoisie einer unterdrückten Nation ihren bürgerlichen Nationalismus vertritt, sind wir dagegen. Kampf gegen die Privilegien und die Gewaltherrschaft der unterdrückenden Nation und keinerlei Begünstigung des Strebens nach Privilegien bei der unterdrückten Nation.“[xliv]
Und weiter: „Jeder bürgerliche Nationalismus einer unterdrückten Nation hat einen allgemein demokratischen Inhalt, der sich gegen die Unterdrückung richtet, und diesen Inhalt unterstützen wir unbedingt, wobei wir das Streben nach eigener nationaler Exklusivität streng ausschalten, das Bestreben des polnischen Bourgeois, den Juden zu unterdrücken usw. usf., bekämpfen.“[xlv]
Lenin verdeutlicht, dass wir zwischen dem Kampf gegen Unterdrückung, der einen demokratischen, fortschrittlichen Inhalt hat, und den Klassenzielen der Bourgeoisie (oder auch des Kleinbürger:innentums), das ihn führt, streng unterscheiden müssen. Nur ersteres unterstützen die Marxist:innen, zweiteres bekämpfen sie. Damit die Arbeiter:innenklasse der unterdrückten Nation die Führung, die Hegemonie im nationalen Befreiungskampf gegen eine unterdrückende Nation erlangen kann, muss sie beiden Tendenzen Rechnung tragen. Verzichtet man auf den Kampf gegen die nationalistische bürgerliche Ideologie der Bourgeoisie der unterdrückten Nation, sinkt man letztlich selbst auf den Nationalismus herab. Lehnt die Arbeiter:innenklasse den Kampf gegen die Unterdrückung, die die Lebensverhältnisse aller Klassen, also auch des Proletariats und der kleinbürgerlichen Massen, entscheidend prägt, ab, so überlässt man der Bourgeoisie oder dem Kleinbürger:innentum den Kampf gegen ein politisch wesentliches Unterdrückungsverhältnis und entwaffnet damit das Proletariat. Es kann seine Rolle als Vorreiterin des Kampfes gegen jede Unterdrückung nicht spielen.
Im Gegenteil. Wenn die Marxist:innen das Recht auf Loslösung der unterdrückten Nation nicht aufstellen und nicht konsequent verteidigen, „so werden wir nicht nur der Bourgeoisie, sondern auch den Feudalen und dem Absolutismus der unterdrückenden Nation in die Hände arbeiten. (…) Aus Furcht, der nationalistischen Bourgeoisie Polens zu ‚helfen‘, unterstützt Rosa Luxemburg dadurch, dass sie das Recht auf Loslösung im Programm der Marxisten Rußlands verneint, in Wirklichkeit die großrussischen Schwarzhunderter. Sie trägt in Wirklichkeit zur opportunistischen Aussöhnung mit den Privilegien (und mit Schlimmerem als den Privilegien) der Großrussen bei.“[xlvi]
Wer das Recht auf Loslösung einer unterdrückten Nation (wie auch der Kolonialländer) auf eigene staatliche Unabhängigkeit nicht anerkennt, verteidigt den Status quo und lehnt die formale Gleichheit der Nationen letztlich ab.
Erster Weltkrieg und die nationale Frage
Der Verrat der Zweiten Internationale und die Politik der Vaterlandsverteidigung durch fast alle ihrer Parteien führten in der revolutionären Arbeiter:innenbewegung zur Spaltung zwischen dem revolutionären internationalistischen Flügel, der klar gegen den imperialistischen Krieg auftrat, und dem opportunistischen. In „Sozialismus und Krieg“ verweist Lenin darauf, dass dieser Kampf die gesamte Existenz der Zweiten Internationale durchzog, jetzt aber zum unvermeidlichen, finalen Bruch geführt habe:
„Während der ganzen Epoche der II. Internationale spielte sich überall in den sozialdemokratischen Parteien ein Kampf zwischen dem revolutionären und dem opportunistischen Flügel ab. In einer Reihe von Ländern kam es darüber zur Spaltung (England, Italien, Holland, Bulgarien). Kein einziger Marxist zweifelte daran, daß der Opportunismus Ausdruck einer bürgerlichen Politik in der Arbeiterbewegung ist, daß er den Interessen des Kleinbürgertums und dem Bündnis einer geringfügigen Minderheit von verbürgerten Arbeitern mit ‚ihrer’ Bourgeoisie entspricht, einem Bündnis, das sich gegen die Interessen der Masse der Proletarier, der Masse der Unterdrückten richtet. (…)
Der Krieg beschleunigte die Entwicklung, indem er den Opportunismus zum Sozialchauvinismus und das geheime Bündnis der Opportunisten mit der Bourgeoisie zu einem offenen machte. Dazu kam noch, dass die Militärbehörden überall den Belagerungszustand verhängten und der Masse der Arbeiter einen Maulkorb anlegten, während die alten Arbeiterführer fast vollzählig ins Lager der Bourgeoisie überliefen.
Die ökonomische Grundlage des Opportunismus und des Sozialchauvinismus ist ein und dieselbe: die Interessen einer ganz geringfügigen Schicht von privilegierten Arbeitern und Kleinbürgern, die ihre privilegierte Stellung, ihr ,Recht’ auf Brocken vom Tische der Bourgeoisie verteidigen, auf Brocken von den Profiten, die ,ihre’ nationale Bourgeoisie durch die Ausplünderung fremder Nationen, durch die Vorteile ihrer Großmachtstellung usw. einstreicht.“[xlvii]
Mit dem imperialistischen Krieg wurden die Sozialchauvinist:innen daher zu Vaterlandsverteidiger:innen. Offen zeigte sich, was Revisionismus und Reformismus immer schon charakterisierte: Für sie bildet der Nationalstaat den eigentlichen Austragungsort des politischen und ökonomischen Klassenkampfes (sofern sie überhaupt davon sprechen). Internationalismus stellt für sie nur ein verbales Beiwerk einer im Kern nationalen Auseinandersetzung dar, gilt ihnen allenfalls als bloße Addition im Grunde nationaler Kämpfe.
Der Weg zum „Sozialismus“ oder zu einer anderen nichtkapitalistischen Gesellschaft kann dieser Vorstellung zufolge innerhalb des bestehenden Nationalstaats erfolgen. Darin besteht eine wesentliche ideologische Gemeinsamkeit von sozialdemokratischem Reformismus, Stalinismus, linkem pseudosozialistischen Populismus und auch von „Befreiungsnationalismus“ oder postkolonialen Ideologien.
Damit einher geht auch unvermeidlich die innere Logik zur Anpassung an den Nationalismus der eigenen Nation. Der revolutionäre Marxismus hingegen begreift den globalen Charakter der kapitalistischen Weltwirtschaft selbst als die Basis des proletarischen Internationalismus, wie Trotzki in der „Permanenten Revolution“, gewissermaßen als deren Grundlage, hervorhebt.
„Der Marxismus geht von der Weltwirtschaft aus nicht als einer Summe nationaler Teile, sondern als einer gewaltigen, selbständigen Realität, die durch internationale Arbeitsteilung und den Weltmarkt geschaffen wurde und in der gegenwärtigen Epoche über die nationalen Märkte herrscht. Die Produktivkräfte der kapitalistischen Gesellschaft sind längst über die nationalen Grenzen hinausgewachsen. Der imperialistische Krieg war eine der Äußerungen dieser Tatsache.“[xlviii]
Im imperialistischen Krieg, aber auch bei Kriegen eines imperialistischen Landes gegen eine Kolonie oder Halbkolonie, ergreift der Sozialchauvinismus Partei für „seine“ Bourgeoisie. Das entspricht der gesellschaftlich relativ privilegierten und abgehobenen Stellung der Arbeiter:innenaristokratie und der lohnabhängigen Mittelschichten, also der eigentlichen sozialen Basis des Reformismus und auch der Absonderung einer Arbeiter:innenbürokratie, die als Vermittler zwischen Lohnarbeit und Kapital fungiert.
Politisch-ideologisch wird die Vaterlandsverteidigung aller Seiten auch durch die Verteidigung des Selbstbestimmungsrechts kleinerer Nationen ideologisch gerechtfertigt. So bemühten die Sozialchauvinist:innen der Entente-Länder gern Serbien und Belgien und deren nationale Unabhängigkeit als Rechtfertigung ihrer Unterstützung Frankreichs, Großbritanniens und Russlands. Die Vaterlandsverteidiger:innen der Mittelmächte hingegen warfen sich für den Kampf gegen den Despotismus des zaristischen Russlands und auch für die Wiederherstellung Polens (genauer: des russischen Teils) ins Zeug. In all diesen Fällen wurde mit dem Verweis auf das Selbstbestimmungsrecht dieser Länder der reaktionäre, imperialistische Charakter des Krieges als Raubkrieg bemäntelt. In Wirklichkeit ging es jedoch allen Großmächten und den um sie gruppierten Allianzen um die Neuaufteilung der Welt, die Erweiterung ihrer Einflusssphären, darunter wesentlich die Möglichkeit der verstärkten Unterdrückung und Ausbeutung der Kolonialgebiete bzw. der inneren Kolonien.
Das nationale Selbstbestimmungsrecht in Ländern wie Belgien, Serbien, Polen oder auch in anderen kleineren Staaten musste in diesem Krieg – keinesfalls in jedem zukünftigen! – dem Kampf gegen den imperialistischen Krieg untergeordnet werden, weil alles andere bedeuten würde, die Interessen einer nationalen Arbeiter:innenklasse über jene des internationalen Proletariats zu stellen. Für Lenin bedeutet dies jedoch keineswegs, dass das Recht auf nationale Selbstbestimmung seine Bedeutung verloren hätte. Geändert hat sich aber die Rolle der Bourgeoisie, und zwar besonders in den ökonomisch fortgeschrittenen Ländern, weil der Kapitalismus in seinem imperialistischen Stadium insgesamt zu einer reaktionären Gesellschaftsformation geworden ist.
„Der Kapitalismus hat die Konzentration bis zu einem solchen Grade entwickelt, daß ganze Industriezweige von Syndikaten, Trusts, Verbänden kapitalistischer Milliardäre in Besitz genommen sind und daß nahezu der ganze Erdball unter diese ‚Kapitalgewaltigen‘ aufgeteilt ist, sei es in der Form von Kolonien, sei es durch die Umstrickung fremder Länder mit den tausendfachen Fäden finanzieller Ausbeutung. Der Freihandel und die freie Konkurrenz sind ersetzt durch das Streben nach Monopolen, nach Eroberung von Gebieten für Kapitalanlagen, als Rohstoffquellen usw. Aus einem Befreier der Nationen, der er in der Zeit des Ringens mit dem Feudalismus war, ist der Kapitalismus in der imperialistischen Epoche zum größten Unterdrücker der Nationen geworden. Früher fortschrittlich, ist der Kapitalismus jetzt reaktionär geworden, er hat die Produktivkräfte so weit entwickelt, daß der Menschheit entweder der Übergang zum Sozialismus oder aber ein jahre-, ja sogar jahrzehntelanger bewaffneter Kampf der ‚Groß’mächte um die künstliche Aufrechterhaltung des Kapitalismus mittels der Kolonien, Monopole, Privilegien und jeder Art von nationaler Unterdrückung bevorsteht.“[xlix]
Während die Bourgeoisie in der Entstehung des Kapitalismus eine progressive Rolle spielte, so ist diese nun erschöpft. Der Prozess der Nationenbildung ist in den fortgeschrittenen kapitalistischen Ländern weitgehend abgeschlossen. Der Weltmarkt ist zu einer umfassenden, globalen Realität geworden. Die Welt ist unter den Großmächten aufgeteilt, die sich im 19. Jahrhundert herausgebildet haben.
„Der Imperialismus ist die Epoche der fortschreitenden Unterdrückung der Nationen der ganzen Welt durch eine Handvoll ‚Groß’mächte, und darum ist der Kampf für die internationale sozialistische Revolution gegen den Imperialismus unmöglich ohne Anerkennung des Selbstbestimmungsrechts der Nationen. ,Ein Volk, das andre unterdrückt, kann sich nicht selbst emanzipieren.‘ (Marx und Engels.) Ein Proletariat, das sich auch nur mit dem kleinsten Gewaltakt ‚seiner’ Nation gegen andere Nationen abfindet, kann nicht sozialistisch sein.“[l]
Die Aufteilung der Welt bedeutet die Aufteilung in unterdrückende (imperialistische) Nationen und unterdrückte Nationen. Dieses Verhältnis stellt ein wesentliches Charakteristikum der imperialistischen Ordnung dar, auch wenn sich seine Form seit der Zeit Lenins geändert hat.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die koloniale Form des Imperialismus in den meisten Ländern durch eine halbkoloniale ersetzt, wobei Letztere einer entwickelten kapitalistischen Gesellschaftsformation eher entspricht. Damit einher geht natürlich, dass sich auch innerhalb der unterdrückten Nationen nationale Unterdrückung oft und systematisch manifestiert (z. B. Kurdistan).
Debatte um das nationale Selbstbestimmungsrecht in der revolutionären Linken
Schon vor dem Ersten Weltkrieg war, wie wir oben gesehen haben, das nationale Selbstbestimmungsrecht unter dem linken Flügel der Zweiten Internationale heftig umstritten. Mit dem Ersten Weltkrieg formierten sich Kräfte, die die Notwendigkeit eines Bruchs mit der sozialchauvinistischen Sozialdemokratie erkannten und auf eine neue, revolutionäre Internationale drängten. Dieser „linke Flügel“ stimmte vollständig darin überein, dass der Krieg ein imperialistischer sei, dass die Arbeiter:innenklasse den Klassenkampf gegen „ihre“ herrschende Klasse mit aller Entschlossenheit führen müsse und ein Ende des Krieges nur durch die revolutionäre Aktion des Proletariats und der Volksmassen herbeigeführt werden könne. Allerdings gab es innerhalb dieses revolutionären Flügels auch eine Reihe politischer Differenzen, die nicht zuletzt in Bezug auf die Klarheit des Programms gegen den Krieg und die Entschiedenheit des Bruchs mit den Vaterlandsverteidiger:innen wie auch mit dem Kautskyanismus und dem Sozialpazifismus bestanden.
Eine wesentliche Differenz bestand jedoch auch bezüglich der nationalen Frage fort. Eine Reihe unterschiedlicher Strömungen und Vertreter:innen der revolutionären Linken zogen aus dem imperialistischen Charakter des Krieges, dem Epochenwechsel und dem chauvinistischen Missbrauch des Selbstbestimmungsrechts den Schluss, dass der Kampf um nationale Selbstbestimmung im Krieg sowie in der gesamten neuen weltgeschichtlichen Epoche seine Rolle als fortschrittliche Lösung und Zielsetzung ausgespielt hätte. Wichtige Vertreter:innen dieser Position waren die holländischen Linksradikalen um Gorter, die polnische Linke sowie die Bremer Linksradikalen und auch der Spartakusbund. Innerhalb des Bolschewismus vertraten Genoss:innen wie Radek, Bucharin, Bosch und Kijewski (Pjatakow) diese Position.
So schreibt z. B. Rosa Luxemburg in These 5 des „Entwurfs zu den Junius-Thesen“, die später mit einigen kleineren Änderungen von Liebknecht 1916 als „Leitsätze über die Aufgaben der internationalen Sozialdemokratie“ von der Gruppe Internationale, besser bekannt als Spartakusbund, angenommen wurden: „Der Weltkrieg dient weder der nationalen Verteidigung noch den wirtschaftlichen oder politischen Interessen irgendwelcher Volksmassen, er ist lediglich eine Ausgeburt imperialistischer Rivalitäten zwischen den kapitalistischen Klassen verschiedener Länder um die Weltherrschaft und das Monopol in der Aussaugung und Auspowerung der letzten Reste der noch nicht vom Kapital beherrschten Welt.“[li]
So weit, so richtig, doch Luxemburg folgert daraus, über diesen Krieg hinausgehend: „In der Ära dieses entfesselten Imperialismus kann es keine nationalen Kriege mehr geben. Die nationalen Interessen dienen nur als Düpierungsmittel, um die arbeitenden Volksmassen ihrem Todfeind, dem Imperialismus, dienstbar zu machen.“[lii]
Für die bolschewistischen Gegner:innen des Selbstbestimmungsrechts formulierten Bucharin, Bosch und Pjatakow 1915: „Der Slogan ‚Selbstbestimmung der Nationen‘ ist in erster Linie utopisch, da er im Rahmen des Kapitalismus nicht verwirklicht werden kann. Er ist auch schädlich, da er Illusionen schürt. (…) Wir unterstützen unter keinen Umständen die Regierung einer Großmacht, die den Aufstand oder die Rebellion einer unterdrückten Nation unterdrückt. Gleichzeitig mobilisieren wir keine proletarischen Kräfte unter dem Slogan des ,Selbstbestimmungsrechts der Nationen’. Unsere Aufgabe besteht in diesem Fall darin, die Kräfte des Proletariats beider Nationen (gemeinsam mit anderen) unter dem Slogan des Bürger:innenkriegs, des Klassenkriegs und Klassenkampfs für den Sozialismus zu mobilisieren und gegen die Mobilisierung von Kräften unter dem Slogan des ‚Selbstbestimmungsrechts der Nationen’ zu propagieren.“[liii]
Kurz gesagt: Der Kampf um das nationale Selbstbestimmungsrecht wäre in der imperialistischen Epoche reaktionär und utopisch. Bezüglich der Perspektive nach der sozialistischen Revolution schieden sich die Geister von Lenins Kritiker:innen. Manche gestanden zu, dass das Problem des Selbstbestimmungsrechts allenfalls nach der sozialistischen Revolution verwirklicht werden könne, andere hielten es auch dann für reaktionär und vor allem unnötig. Daher tendierten auch viele Kritiker:innen in der Perspektive dazu, in einer Übergangsgesellschaft national-kulturelle Autonomie zuzugestehen, als Alternative zum Selbstbestimmungsrecht.
Lenins Kritik des „imperialistischen Ökonomismus“
Lenin antwortet auf diese Positionen ausführlich in verschiedenen Resolutionen und Polemiken in den Jahren 1915 und 1916. Diese politische Auseinandersetzung enthält einen enormen Fundus an grundlegenden wie auch taktisch detaillierten Betrachtungen zum Verhältnis von Imperialismus und demokratischen Fragen, zum Verständnis des revolutionären Kampfes. Daher wollen wir hier Lenins Antworten auf die wichtigsten Einwände seiner Kritiker:innen darlegen.
Für Lenin war in der imperialistischen Epoche der Kampf um nationale Selbstbestimmung wie um jede andere demokratische Frage nicht obsolet, sondern diese Kämpfe erforderten geradezu die Verbindung von Kampf für demokratische (und andere unmittelbare) Forderungen mit dem um die sozialistische Revolution. So führt er in „Die sozialistische Revolution und das Selbstbestimmungsrecht der Nationen“ aus:
„Die sozialistische Revolution ist kein einzelner Akt, keine einzelne Schlacht an einer Front, sondern eine ganze Epoche schärfster Klassenkonflikte, eine lange Reihe von Schlachten an allen Fronten, das heißt in allen Fragen der Ökonomie sowie der Politik, Schlachten, welche nur mit der Expropriation der Bourgeoisie enden können. Es wäre ein großer Irrtum zu glauben, daß der Kampf um die Demokratie imstande wäre, das Proletariat von der sozialistischen Revolution abzulenken oder auch nur diese Revolution in den Hintergrund zu schieben, zu verhüllen und dergleichen. Im Gegenteil, wie der siegreiche Sozialismus, der nicht die vollständige Demokratie verwirklicht, unmöglich ist, so kann das Proletariat, das den in jeder Hinsicht konsequenten, revolutionären Kampf um die Demokratie nicht führt, sich nicht zum Siege über die Bourgeoisie vorbereiten.“[liv]
Lenin bestreitet in seiner Argumentation keineswegs, dass in der imperialistischen Epoche die nationale Selbstbestimmung nur schwer und nur bedingt durchsetzbar ist, dass sie eine Reihe von entschlossen geführten Klassenkämpfen, nationalen Befreiungskriegen und Aufständen bis hin zu Revolutionen erfordert. Doch diese tendenzielle „Undurchführbarkeit“ oder nur bedingte, unvollkommene Realisierung betrifft keineswegs nur die Forderung nach nationaler Selbstbestimmung, sondern alle bürgerlich-demokratischen Forderungen. Diese bedeutet jedoch keineswegs, dass der Kampf um die Verteidigung und Ausweitung demokratischer Rechte weniger relevant wäre. Im Gegenteil: Gerade aufgrund der imperialistischen Ordnung erhalten Kämpfe um demokratische Fragen eine besondere Sprengkraft.
„Denn nicht nur das Selbstbestimmungsrecht der Nationen, sondern alle grundlegenden Forderungen der politischen Demokratie sind beim Imperialismus nur unvollständig, verstümmelt und als eine seltene Ausnahme (zum Beispiel die Abtrennung Norwegens von Schweden im Jahre 1905) ‚durchführbar’. Die Forderung der sofortigen Befreiung der Kolonien, die von allen revolutionären Sozialdemokraten aufgestellt wird, ist ebenfalls beim Kapitalismus ohne eine Reihe von Revolutionen ‚undurchführbar’. Aber daraus folgt keinesfalls der Verzicht der Sozialdemokratie auf den sofortigen und entschiedenen Kampf für alle diese Forderungen. Das wäre ja nur in die Hand der Bourgeoisie und Reaktion gespielt. Ganz im Gegenteil, man muß alle diese Forderungen nicht reformistisch, sondern entschieden revolutionär formulieren, sich nicht auf den Rahmen der bürgerlichen Legalität beschränken, sondern diesen Rahmen zerbrechen, sich nicht mit dem parlamentarischen Auftreten und äußerlichen Protesten begnügen, sondern die Massen mit in den aktiven Kampf hineinziehen, den Kampf um jede demokratische Forderung bis zum direkten Ansturm des Proletariats auf die Bourgeoisie verbreiten und anfachen, das heißt ihn zur sozialistischen Revolution, die die Bourgeoisie expropriiert, führen. Die sozialistische Revolution kann nicht nur aus einem großen Streik oder einer Straßendemonstration oder einem Hungeraufstand, einer Militärempörung oder einer Meuterei in den Kolonien, sondern aus einer beliebigen politischen Krise, wie der Dreyfus-Affäre oder dem Zaberninzident, oder im Zusammenhang mit dem Referendum in der Frage der Abtrennung der unterdrückten Nationen und ähnlichem mehr aufflammen.“[lv]
Gerade weil Imperialismus Reaktion auf der ganzen Linie bedeutet – darin stimmt Lenin mit seinen ultralinken Kritiker:innen überein –, ist deren Schlussfolgerung vollkommen verkehrt. Deren doktrinäre Ablehnung des Kampfes um nationale Selbstbestimmung wie um demokratische Forderungen folgt aus einem mechanischen, nicht dialektischen Verständnis von Imperialismus und Demokratie. Und sie führt zur Entstehung eines neuen Ökonomismus, einer ultraradikal verbrämten, in Wirklichkeit aber antirevolutionären Politik.
Der „alte“ Ökonomismus in der russischen Sozialdemokratie, gegen den Lenin und die Iskra erfolgreich gekämpft hatten, ging davon aus, dass der ökonomische Kampf der „eigentliche“ proletarische Klassenkampf wäre. Folglich sollte sich die Arbeiter:innenklasse auf diesen konzentrieren und nicht von Fragen außerhalb des unmittelbaren Lohnarbeit-Kapital-Verhältnisses ablenken lassen. Praktisch führte das jedoch notwendigerweise dazu, den politischen Kampf liberalen oder anderen bürgerlichen Kräften zu überlassen.
Der „neue“ imperialistische Ökonomismus geht Lenin zufolge im Grunde ähnlich vor, wenn auch mit einer Fetischisierung des Maximalprogramms: „Jetzt ist ein ‚neuer’ Ökonomismus im Entstehen begriffen, der in seiner Argumentation zwei analoge Saltos vollführt: ‚nach rechts’ – wir sind gegen das ‚Recht auf Selbstbestimmung’ (…). ,Nach links‘ – wir sind gegen das Minimalprogramm (d. h. Gegen den Kampf für Reformen und Demokratie), denn das ‚widerspricht‘ der sozialistischen Revolution.“[lvi]
Eine solche Politik bringt die Arbeiter:innenklasse nicht der sozialistischen Revolution näher, sondern führt wie jede Ablehnung des Kampfes um soziale Reformen und demokratische Forderungen nur dazu, dass die Arbeiter:innenklasse die Führung dieser Auseinandersetzungen kampflos und „freiwillig“ anderen Klassenkräften überlässt. Hier wird die Analogie zum „alten“ Ökonomismus besonders deutlich. Dieser beschränkte sich auf den Kampf um ökonomische Verbesserungen und trat damit die Führung aller darüber hinausgehenden politischen Fragen an andere Klassenkräfte ab. Der imperialistische Ökonomismus überlässt die Führung gerechtfertigter nationaler Kriege und Befreiungskämpfe anderen Klassenkräften, also der bestehenden bürgerlichen oder kleinbürgerlichen Führung.
Der Fehler des imperialistischen Ökonomismus besteht hier darin, dass dessen Vertreter:innen nicht nur den imperialistischen Krieg als reaktionär betrachten, sondern alle Kriege. Lenin führt die Problematik dieser Position an, indem er diese Haltung im Hinblick auf den Kampf gegen Annexionen betrachtet. So behaupteten beispielsweise die polnischen Linken: „Den Ausgangspunkt des Kampfes gegen Annexionen bildet die Ablehnung jeder Vaterlandsverteidigung.“[lvii]
Lenin entgegnet darauf, dass jeder nationale Krieg, jeder nationale Aufstand als „Vaterlandsverteidigung“ bezeichnet werden kann und auch so verstanden wird. Den Versuch mancher Linker seiner Zeit, Aufstände in annektierten Gebieten oder Kolonien nicht als Krieg zu bezeichnen, kann man in Lenins Augen zu Recht nicht ernst nehmen, da hier allenfalls nur terminologische Verwirrung statt politischer Klärung herbeigeführt wird. Die kategorische Ablehnung jedes nationalen Krieges, der Vaterlandsverteidigung des unterdrückten Landes wie des unterdrückenden Landes, bedeutet, dass die Ablehnung aller Annexionen auch auf die Ablehnung des nationalen Krieges, des nationalen Aufstandes der Annektierten hinausläuft – und damit, ob gewollt oder nicht, auf die Rechtfertigung der bestehenden Annexionen, ob nun im europäischen Krieg oder infolge des Kolonialismus!
Die Gazeta Robotnicza führte dazu noch weitere, auch in der heutigen Linken verbreitete Erwägungen an, die den bewaffneten Aufstand oder Krieg gegen Imperialismus und Kolonialismus als nationalistische Unternehmung kategorisch ablehnten, was Lenin auseinandernimmt. Das betrifft erstens die Behauptung, dass letztlich alle Kriege und nationalen Aufstände solche zur Unterdrückung anderer Völker wären. Dagegen hält Lenin fest:
„Die Verfasser der Thesen motivieren ihre … merkwürdige Behauptung damit, daß die Vaterlandsverteidigung ‚in der Ära des Imperialismus‘ eine Verteidigung der Rechte der eigenen Bourgeoisie auf die Unterdrückung fremder Völker sei. Aber das ist nur in bezug auf den imperialistischen Krieg richtig, d. h. den zwischen imperialistischen Mächten oder Mächtegruppen, wenn beide kriegführenden Seiten nicht nur ‚fremde Völker‘ unterdrücken, sondern darum Krieg führen, wer mehr fremde Völker unterdrücken soll!“[lviii]
Zweitens lehnte die Gazeta Robotnicza auch nationale Aufstände z. B. im zaristisch unterdrückten Armenien mit der Begründung ab, dass es in diesen unterdrückten, kolonisierten oder annektierten Ländern auch eine Bourgeoisie gibt, die, sollte sie zur Herrschaft kommen, in der Zukunft auch andere Völker unterdrücken könnte.
„Zur Beurteilung eines gegebenen Krieges oder eines gegebenen Aufstandes wird also nicht sein wirklicher sozialer Inhalt genommen (der Kampf der unterdrückten Nation gegen die unterdrückende für ihre Befreiung), sondern die Möglichkeit, daß die jetzt unterdrückte Bourgeoisie von ihrem ‚Recht auf Unterdrückung’ Gebrauch machen könnte.“[lix]
Der imperialistische Ökonomismus abstrahiert vom realen, konkreten Inhalt des Kampfes, indem er auf eine mögliche zukünftige Entwicklung nach einem erfolgreichen Kampf gegen Unterdrückung verweist. Niemand bestreitet, dass diese Möglichkeit besteht (und zwar nicht nur auf dem Gebiet des Kampfes gegen nationale Unterdrückung, sondern grundsätzlich bei allen Kämpfen, die von bürgerlichen, kleinbürgerlichen oder auch reformistischen Kräften geführt werden). Die Ablehnung eines Kampfes gegen nationale Unterdrückung aufgrund des Verweises auf eine mögliche, keineswegs unvermeidliche zukünftige Entwicklung bedeutet praktisch, auf die Seite der realen, gegenwärtigen Unterdrücker:innen zu wechseln. Die Behauptung, dass die heute Ausgebeuteten und Unterdrückten genauso handeln würden wie ihre Ausbeuter:innen und Unterdrücker:innen, gehört seit Jahrhunderten zum Standardrepertoire der Rechtfertigung der bestehenden Ordnung. Und sie wird nicht besser, wenn sie im „radikalen“ Deckmantel daherkommt.
„Von Marxismus, von revolutionärem Geist überhaupt ist in dieser Betrachtung keine Spur zu finden. Wollen wir den Sozialismus nicht preisgeben, so müssen wir jeden Aufstand gegen unseren Hauptfeind, die Bourgeoisie der Großmächte, unterstützen, wenn es nicht ein Aufstand einer reaktionären Klasse ist. Lehnen wir die Unterstützung eines Aufstands annektierter Gebiete ab, so werden wir – objektiv – zu Annexionisten. Gerade ,in der Ära des Imperialismus’, die die Ära der beginnenden sozialen Revolution ist, wird das Proletariat mit besonderer Energie heute den Aufstand der annektierten Gebiete unterstützen, um bereits morgen oder gar zur gleichen Zeit die durch einen solchen Aufstand geschwächte Bourgeoisie der ‚Groß’macht anzugreifen.“[lx]
Statt sich an die Spitze jedes berechtigten Kampfes gegen imperialistische Unterdrückung zu stellen, steht der imperialistische Ökonomismus auf einem für die imperialistische Epoche wesentlichen Gebiet auf Seiten der Unterdrücker:innen. Die Teilung der Welt in imperialistische und vom Imperialismus ausgebeutete Länder stellt ein Wesensmerkmal des Imperialismus dar, daher auch der Kampf gegen dieses Verhältnis.
„Umgekehrt sehen wir in China, Persien, Indien und in anderen abhängigen Ländern im Laufe der letzten Jahrzehnte eine Politik des Erwachens von Dutzenden und Hunderten Millionen Menschen zum nationalen Leben, ihrer Befreiung vom Joch der reaktionären ´Groß´mächte. Auf solchem historischen Boden kann der Krieg auch heute ein bürgerlich-fortschrittlicher, ein nationaler Befreiungskrieg sein.“[lxi]
Mit seiner Positionierung entwaffnet der imperialistische Ökonomismus ganz so wie seine Vorgänger:innen die Arbeiter:innenklasse politisch. Er betrachtet das Minimalprogramm und demokratische Forderungen als bloße Ablenkung und Irreführung vom „eigentlich“ revolutionären Kampf. Lenin weist immer wieder darauf hin, dass der reaktionäre Charakter des Imperialismus es ermöglicht, diese miteinander systematisch zu verbinden. Die Durchsetzung grundlegender demokratischer Aufgaben erfordert geradezu revolutionäre Methoden, erlaubt, diese systematisch in den Kampf um die sozialistische Revolution einzubinden, so wie Letztere zu ihrer Vorbereitung und Durchführung erfordert, dass Revolutionär:innen alle diese Fragen aktiv vorwärtstreibend aufgreifen.
Diese methodische Herangehensweise ist bis heute aktuell und unterscheidet revolutionäre Marxist:innen grundlegend von aktuellen Spielarten des imperialistischen Ökonomismus. In den Halbkolonien sind bis heute grundlegende Fragen der demokratischen Revolution (Agrarfrage, Unabhängigkeit vom Imperialismus, demokratische Rechte und Gleichheit) ungelöst oder allenfalls nur begrenzt erfüllt. Selbst die formale Gleichheit ist bis heute in zahlreichen Staaten der Welt nicht verwirklicht. So bilden z. B. der Kampf um gleiche Rechte von Frauen oder sexuell Unterdrückten in vielen Staaten eine der zentralen Fragen des politischen Klassenkampfes, die selbst – nehmen wir das Beispiel des Iran – zum Ausgangspunkt von Massenhebungen, ja potenziell einer Revolution werden können.
Das bedeutet aber nicht, dass im Rahmen des Kapitalismus Minimalforderungen nie erfüllt werden könnten und automatisch zu einer revolutionären Zuspitzung hin zur proletarischen Revolution führen müssten. Eine solche Vorstellung reduziert im Grunde die sozialistische Umwälzung oder den Kampf um eine bestimmte, bedeutende Forderung des Minimalprogramms auf einen automatischen, subjektlosen Prozess. Sie ist dem Marxismus fremd, der gerade die unverzichtbare Bedeutung der revolutionären Partei und Führung in der Revolution hervorhebt. Damit die revolutionäre Organisation wirklich ihre Rolle als Avantgarde der Revolution ausfüllen kann, muss sie alle Formen der Unterdrückung und Ausbeutung aktiv bekämpfen und darin um ihre Führung ringen. Lenin betont diesen Aspekt immer wieder und ganz ähnlich argumentiert Trotzki im Übergangsprogramm, wenn er das Verhältnis von Minimal- und Maximalforderungen bestimmt:
„Die IV. Internationale verwirft die Forderungen des alten ‚Minimalprogramms‘ nicht, soweit sie sich noch einige Lebenskraft bewahrt haben. Sie verteidigt unermüdlich die demokratischen Rechte und sozialen Errungenschaften der Arbeiter. Aber sie leistet diese Alltagsarbeit im Rahmen der richtigen, realen, das heißt revolutionären Perspektive. Sofern die alten ,minimalen’ Teilforderungen der Massen mit den zerstörerischen und entwürdigenden Tendenzen des verfallenden Kapitalismus zusammenstoßen – und diss geschieht auf Schritt und Tritt –, stellt die IV. Internationale ein System von Übergangsforderungen auf, deren Sinn darin besteht, dass sie sich immer offener und entschiedener gegen die Grundlagen der bürgerlichen Herrschaft selbst zu richten. Das alte ‚Minimalprogramm‘ wird aufgehoben vom Übergangsprogramm, dessen Aufgabe darin besteht, die Massen systematisch für die proletarische Revolution zu mobilisieren.“[lxii]
Grenzen des nationalen Selbstbestimmungsrechts
Wie jede demokratische, ja, im Grunde wie jede Einzelforderung des revolutionären Programms stellt auch die nach dem Selbstbestimmungsrecht nichts Absolutes dar.
Es gibt Situationen im Klassenkampf, in denen das Selbstbestimmungsrecht von Nationen, auch von unterdrückten, untergeordnet ist, zurückgestellt wird oder aktiv verletzt werden muss.
So war das Selbstbestimmungsrecht Serbiens oder Polens im Ersten Weltkrieg, um nur zwei Beispiele zu nennen, untergeordnet. Sollte es zu einem weiteren imperialistischen Krieg kommen, könnte sich das wiederholen. Dies wäre zum Beispiel in der aktuellen Situation der Fall, wenn der Krieg um die Ukraine zu einem offenen imperialistischen Krieg zwischen Russland und NATO würde und nicht „nur“ die Verteidigung des Selbstbestimmungsrechts der Ukraine vom imperialistischen Konflikt überlagert und mit diesem wechselhaft kombiniert wird, also einen „Doppelcharakter“ annimmt.
Lenin führt am Beispiel Polens in Übereinstimmung mit Rosa Luxemburg und der politischen Linken aus, dass während des imperialistischen Weltkrieges die Losung der Unabhängigkeit Polens von den polnischen Marxist:innen zu Recht nicht aufgestellt, sondern politisch bekämpft wurde. In diesem Gesamtzusammenhang hätte die Losung allenfalls zur Schaffung eines polnischen Rumpfstaates geführt, der faktisch Militärkolonie der einen oder anderen imperialistischen Mächtegruppe gewesen wäre. „Einzig und allein um der Wiederherstellung Polens willen für einen europäischen Krieg sein – das hieße ein Nationalist schlimmster Sorte sein, die Interessen der kleinen Anzahl von Polen höher stellen als die Interessen von Hunderten Millionen Menschen, die durch den Krieg leiden.“[lxiii]
Daher können die polnischen Revolutionär:innen in dieser Lage die Losung der Unabhängigkeit auf keinen Fall aufstellen. Umgekehrt dürfen die deutschen, österreichisch-ungarischen und russischen Arbeiter:innen auch im imperialistischen Krieg der Teilung Polens und Unterdrückung dieser Nation durch „ihre“ imperialistische Bourgeoisie nicht gleichgültig gegenüberstehen. Daher vertreten die Bolschewiki folgende Position, die den Erfordernissen des Internationalismus Rechnung trägt und die unterschiedliche Akzentuierung in den unterdrückenden und im unterdrückten Land erfordert:
„Die Lage ist zweifellos sehr verwirrt, aber es gibt aus ihr einen Ausweg, bei dem alle Beteiligten Internationalisten bleiben: die russischen und die deutschen Sozialdemokraten, indem sie die bedingungslose ‚Freiheit der Lostrennung‘ Polens verlangen, und die polnischen Sozialdemokraten, indem sie für die Einheit des proletarischen Kampfes in einem kleinen Lande und den großen Ländern kämpfen, ohne für die gegebene Epoche oder die gegebene Periode die Losung der Unabhängigkeit Polens aufzustellen.“[lxiv]
In all jenen Fällen, wo das Selbstbestimmungsrecht auch einer unterdrückten Nation aufgrund des Charakters der internationalen Lage (z. B. im Rahmen eines imperialistischen Krieges) untergeordnet ist, enthält der Kampf für diesen Zeitraum keinen progressiven Charakter – und zwar unabhängig vom Charakter der Führung des Kampfes. In dieser Situation wäre die Losung des Selbstbestimmungsrechts (z. B. Serbiens, Polens oder Belgiens im Ersten Weltkrieg) nur eine ideologische Formel zur Rechtfertigung eines anderen, dominanten Zieles einer imperialistischen Bourgeoisie und ihrer Unterstützer:innen unter der „nationalen“ Bourgeoisie.
Nicht nur in einem innerimperialistischen Konflikt, sondern auch in einem Bürger:innenkrieg oder in revolutionären Kriegen kann die Notwendigkeit zur Unterordnung des nationalen Selbstbestimmungsrechts keineswegs kategorisch ausgeschlossen werden. Es gibt hier kein Mittel, die konkrete Position unabhängig von der konkreten Analyse des konkreten Kriegs zu bestimmen. Die Haltung zum konkreten Krieg erfordert also immer die Bestimmung des Klassencharakters der Kriegsparteien und der Kriegsziele.
Dies ändert natürlich nichts daran, dass eine solche gerechtfertigte Unterordnung des Selbstbestimmungsrechts wie jede aus der Gesamtsituation notwendige und unvermeidbare Verletzung demokratischer Rechte einen politischen Preis hat. Sie führt tendenziell auch zu einer Entfremdung (von Teilen) der unterdrückten Nation, vor allem von deren politisch weniger klassenbewussten Teilen. Das trifft natürlich auch bei der Unterdrückung anderer demokratischer Forderungen/Rechte zu (z. B. Aufhebung demokratischer Rechte im Bürger:innenkrieg, im revolutionären Verteidigungskrieg oder anderen zugespitzten Klassenkampfsituationen). Daher müssen Revolutionär:innen bei Ende dieser Lage die Anerkennung des Selbstbestimmungsrechts wieder in Kraft setzen und so versuchen, verloren gegangenes Vertrauen unter den Massen der unterdrückten Nation zurückzugewinnen.
Schließlich müssen wir noch betonen, dass die allgemeine Bestimmung eines Krieges als imperialistischer Krieg keineswegs bedeutet, dass keine berechtigten nationalen oder kolonialen Aufstände möglich oder unterstützenswert sein können. Selbst im Ersten Weltkrieg traten die revolutionären Internationalist:innen nicht für die Unterordnung aller nationalen Aufstände oder Kriege ein. So unterstützten Lenin und die Bolschewiki den irischen Aufstand 1916, während z. B. Radek die irische nationale Frage für erledigt erklärte und den Aufstand als isolierten kleinbürgerlichen Putsch charakterisierte: „Diese Bewegung, die sich ‚Sinn Fein‘ nannte, war eine rein städtische kleinbürgerliche Bewegung, die – trotz des großen Lärms, den sie machte – wenig gesellschaftliche Unterstützung hatte. In der Hoffnung auf deutsche Hilfe ließ sich Sinn Fein zu einem Aufstand inspirieren, der nur zu einem Putsch führte, den die englische Regierung leicht bewältigen konnte.“[lxv] Trotzki unterstützte den Aufstand, allerdings mit der fragwürdigen, gewissermaßen gegenteiligen Vorstellung, dass der nationale Aufstand in der Praxis und seinem Wesen nach ein proletarischer Aufstand gewesen sei.[lxvi]
Lenin verteidigte den Aufstand als einen Vorboten der europäischen Revolution, der sich in Straßenkämpfen eines Teils des städtischen Kleinbürger:innentums und eines Teils der Arbeiter:innen manifestiert habe, ihrerseits ein Resultat der kolonialen Unterdrückung wie auch einer Geschichte des Widerstandes. Solche Bewegungen bildeten für Lenin einen notwendigen Bestandteil der internationalen Revolution. Wer auf eine chemisch reine proletarische Revolution hoffe, der würde nie eine sozialistische Revolution erleben:
„Denn zu glauben, daß die soziale Revolution denkbar ist ohne Aufstände kleiner Nationen in den Kolonien und in Europa, ohne revolutionäre Ausbrüche eines Teils des Kleinbürgertums mit allen seinen Vorurteilen, ohne die Bewegung unaufgeklärter proletarischer und halbproletarischer Massen gegen das Joch der Gutsbesitzer und der Kirche, gegen die monarchistische, nationale usw. Unterdrückung – das zu glauben heißt der sozialen Revolution entsagen.“[lxvii]
Die sozialistische Revolution in Europa wäre lt. Lenin einfach undenkbar ohne den Ausbruch des Massenkampfes aller und jeglicher Unterdrückten und Unzufriedenen. Die Tatsache, dass der deutsche Generalstab auch versuchte, den irischen Aufstand zu seinen Gunsten zu befördern und damit den Gegner zu schwächen, bedeutete keineswegs, dass der Aufstand keinen revolutionären Charakter gehabt hätte. So wie die verschiedenen Großmächte im Krieg versuchten, jede Schwäche der Gegenseite zu ihren Gunsten zu nutzen, so müsste das auch die Arbeiter:innenklasse tun.
„Wir wären sehr schlechte Revolutionäre, wenn wir es nicht verstünden, im großen Befreiungskampf für den Sozialismus jede Volksbewegung gegen die einzelnen Bedrängnisse des Imperialismus zur Verschärfung und Ausweitung der Krise auszunutzen.“[lxviii]
Die Tragödie des irischen Aufstandes bestand für Lenin nicht in seinem nationalen Charakter, sondern vielmehr darin, dass er isoliert blieb und der Kampf der Arbeiter:innenklasse in Europa noch lange nicht so entwickelt war, dass er durch Aufstände und revolutionäre Erhebungen begleitet worden wäre. So war er gewissermaßen zwar ein erster Vorbote eines Aufstandes im Krieg, der das Heranreifen der Revolution zeigte, führte aber in die Niederlage. Lenin weist dabei aber zu Recht darauf hin, dass man sich das Heranreifen und die Entwicklung der sozialistischen Revolution nicht als ein planmäßiges Unternehmen vorstellen dürfe, als ein Losschlagen, wenn man „gereift“ sei, sondern dass vielmehr die scheinbar verfrühten Aufstände, Massenkämpfe, Revolutionen und die damit verbundenen Niederlagen eine unvermeidliche und notwendige Vorbereitung der sozialistischen Umwälzung darstellten – sofern man bereit sei, diese historischen Erfahrungen theoretisch und programmatisch sowie strategisch und taktisch zu verarbeiten.
Politische oder ökonomische Kategorie?
So weit zum grundlegenden Verständnis der Bedeutung des Kampfes um nationale Befreiung. In seiner Kritik am imperialistischen Ökonomismus greift Lenin ein weiteres Problem auf, das die generelle Konfusion dieser Richtung erklärt. Sie kommt daher, dass beständig die Frage der ökonomischen und politischen Unmöglichkeit der nationalen Selbstbestimmung durcheinandergeworfen wird.
Betrachtet man das Selbstbestimmungsrecht auf dem ökonomischen Gebiet, so ist es, wie auch Lenin richtig betont, tatsächlich undurchführbar. Ganz grundsätzlich kann die Herrschaft des Finanzkapitals, ja, des Kapitals überhaupt, durch keine einzige Reform oder Umgestaltung auf dem Gebiet der politischen Demokratie aufgehoben oder überwunden werden. Das verdeutlichen die Entwicklung des Imperialismus nach dem Zweiten Weltkrieg und die Entkolonialisierung, also die Entstehung von formell unabhängigen bürgerlichen Staaten mit eigener Regierung, eigener Armee und eigenem politischen System. Solange diese kapitalistische Staaten bleiben, sind sie in die internationale Arbeitsteilung und in das System der imperialistischen Ausbeutung und Weltordnung fest eingebunden. Ihre Ökonomie, ihr wirtschaftlicher und indirekt auch ihr politischer Spielraum werden im Rahmen dieser Ordnung vom globalen, imperialistischen Großkapital und von den Großmächten sowie ihren ökonomischen Institutionen bestimmt.
Anders verhält es sich jedoch, wenn das Selbstbestimmungsrecht der Nationen korrekt als politische Kategorie betrachtet wird: „Das Selbstbestimmungsrecht bedeutet ausschließlich das Recht auf Unabhängigkeit im politischen Sinne, auf die Freiheit der konkreten Abtrennung von der unterdrückenden Nation. Konkret bedeutet diese Forderung der politischen Demokratie die volle Freiheit der Agitation für die Abtrennung und die Lösung der Frage über die Abtrennung durch das Referendum der betreffenden, d. h. der unterdrückten Nation, so daß diese Forderung nicht der Forderung der Abtrennung, der Zerstückelung, der Bildung kleiner Staaten gleich ist. Sie ist nur ein folgerichtiger Ausdruck für den Kampf gegen jegliche nationale Unterjochung.“[lxix]
In Kapitel 3 von „Über eine Karikatur auf den Marxismus“ zeigt Lenin, dass Kijewski (Pjatakow) durch das Vermischen von ökonomischer Kategorie (Weltmarkt, Herrschaft des Finanzkapitals) und politischer Kategorie (Herrschaftsform, Demokratie, Selbstbestimmung) die Frage verwirrt. Indem er und andere imperialistische Ökonomist:innen einmal das Selbstbestimmungsrecht als ökonomische Kategorie, ein anderes Mal als politische verwenden, weichen sie der Fragestellung aus, ob diese oder andere demokratische Forderungen in der imperialistischen Epoche realisiert werden können (wenn auch nur zeitweilig und beschränkt).
Die Verwirrung wird noch dadurch verstärkt, dass der Imperialismus generell auch zu einer Entdemokratisierung führt, dass der immer größeren Zentralisation und Konzentration des Kapitals, der Tendenz zum Monopol immer auch eine Tendenz zum Autoritarismus, zur Einschränkung bürgerlicher Freiheiten und Rechte entspricht. Das heißt, dass der Widerspruch zwischen ökonomischer Basis und demokratischen Formen größer wird. Das heißt aber nicht, dass die Realisierung von bürgerlich-demokratischen Rechten und Freiheiten an sich unmöglich wird. Pjatakow und andere haben außerdem die Tendenz, das Selbstbestimmungsrecht in einen willkürlichen Gegensatz zu anderen demokratischen Formen zu setzen, zur Republik zum Beispiel, wo Lenin zu Recht die Frage aufwirft, warum diese realisierbar sein soll, die Loslösung aber nicht.
Das Selbstbestimmungsrecht betrifft die politische Form der Klassenherrschaft, nicht die Klassenherrschaft selbst – so wie andere, breitere Formen der Demokratie keineswegs die kapitalistische Ausbeutung, Formen gesellschaftlicher Unterdrückung oder die internationale imperialistische Ordnung beseitigen, da diese tiefere Wurzeln in der ökonomischen Basis der Gesellschaft selbst schlagen.
Aber der Kampf um demokratische Rechte hilft, Spaltungen innerhalb der Arbeiter:innenklasse wie unter den Unterdrückten zu verringern, ihre Einheit im Kampf herzustellen und günstigere Kampfbedingungen zu schaffen. Je reiner, freier und demokratischer die Herrschaftsform ist, desto günstiger ist sie für den Klassenkampf, weil dieser reiner hervortritt.
Der fiktive Charakter der Demokratie (und damit auch der nationalen Selbstbestimmung im Sinne einer ökonomischen Selbstbestimmung) ändert nichts an deren politischer Bedeutung. Die bürgerliche Demokratie und alle demokratischen Forderungen tragen insofern einen „fiktiven“ Charakter, als sie auf formale Gleichheit zielen. Diese wird natürlich durch die reale Klassenspaltung, deren politische Hülle erstere darstellt, konterkariert. Dies zeigt sich beispielsweise bei der nationalen Unabhängigkeit, wenn sie errungen wird. Sie ändert nichts an der Abhängigkeit und Ausbeutung im Rahmen des imperialistischen Weltsystems. Das trifft aber auch auf die Erfüllung anderer demokratischer Forderungen zu, z. B. rechtliche Gleichheit für Frauen oder die Schaffung gleicher demokratischer Rechte für Migrant:innen.
Aber dieser Prozess durchläuft eine ganze geschichtliche Periode. Auch nach der Machteroberung der Arbeiterklasse findet nicht einfach der Übergang in den Kommunismus, ja in den Sozialismus statt. „Zwischen der kapitalistischen und der kommunistischen Gesellschaft liegt die Periode der revolutionären Umwälzung der einen in die andre. Der entspricht auch eine politische Übergangsperiode, deren Staat nichts andres sein kann als die revolutionäre Diktatur des Proletariats.“[lxx]
Gerade damit die nationale Unterdrückung aufgehoben werden kann, sich ein wirklich gleichberechtigtes Verhältnis zwischen Nationen etabliert und letztlich auch eine Verschmelzung unter den Nationen realisiert werden kann, ist Freiwilligkeit die Grundvoraussetzung. Das erfordert für die unterdrückten Nationen, dass jede Form nationaler Unterdrückung bekämpft wird und somit konsequenterweise die Anerkennung des Rechts auf Loslösung.
Lenin macht dabei mehrfach deutlich, dass die Loslösung keineswegs an sich ein Ziel ist. Im Gegenteil: Je mehr das Recht auf nationale Selbstbestimmung glaubhaft verteidigt wird, desto eher ist Trennung vermeidbar. Selbst die Föderation stellt kein Ziel an sich dar, wohl aber ein mögliches Mittel zur Überwindung, einen Schritt zur Verschmelzung. Daher auch sein Eintreten für eine föderative Verfassung der UdSSR. Auch die Lösung der Vereinigten Sozialistischen Staaten Europas wäre ein Beispiel für eine Übergangslösung, für eine Föderation auf dem Weg zu einem sozialistischen Europa, in dem die Nationen real verschmelzen können (einschließlich dem Recht auf Austritt, sofern sie dies wünschen).
Ein weiterer Aspekt der Diskussion um das nationale Selbstbestimmungsrecht, dem wir in den Auseinandersetzungen mit dem imperialistischen Ökonomismus und später auch in Sowjetrussland um das nationale Selbstbestimmungsrecht begegnen, besteht in der Frage, ob die Arbeiter:innenklasse oder die gesamte Nation darüber entscheiden soll. Wie bei allen demokratischen Rechten ist es ein, wenn auch durchaus verbreiteter, Fehler, diese nur für die Arbeiter:innenklasse zu fordern.
Dies wäre ein grundlegender Fehler, denn der gesamte Sinn und Zweck des Aufgreifens demokratischer Forderungen besteht ja gerade darin, dass sich die Arbeiter:innenklasse zur Vorkämpferin von berechtigten Kämpfen gegen Unterdrückung aller davon Betroffenen macht, und das gilt natürlich für alle demokratischen Forderungen. Es wird dabei auch deutlich, wie unsinnig eine Beschränkung auf die Lohnabhängigen wäre (z. B. Frauenrechte nur für Arbeiter:innen zu fordern).
Das Ziel des Kampfes um demokratische Forderungen (wie auch gegen nationale Unterdrückung) besteht gerade darin, (a) der Bourgeoisie und ihrem Staat Rechte für die Arbeiter:innen und alle Unterdrückten abzuringen, (b) die Arbeiter:innenklasse an die Spitze des Kampfes zu stellen; was sie aber nicht tun kann, wenn sie nur für sich kämpft.
Ein solcher Ökonomismus hat letztlich einen bornierten Charakter und verhindert gerade, dass die Arbeiter:innenklasse die Unterdrückung aller Teile und Schichten der Gesellschaft aufgreifen kann.
Verschiedene Aufgaben in unterdrückender und unterdrückter Nation
Weiter oben haben wir darauf hingewiesen, dass Lenin zur polnischen Frage im Ersten Weltkrieg verschiedene Lösungen und politische Schwerpunktsetzungen für die polnischen Marist:innen einerseits und für die deutschen und russischen andererseits vertrat. Die linksradikalen Anhänger:innen des imperialistischen Ökonomismus warfen Lenin daher einen „Dualismus“ vor. „Er (Pjatakow; d. Red.) erblickt unseren ‚Dualismus’ erstens darin, daß wir von den Arbeitern der unterdrückten Nationen in erster Linie nicht das verlangen – die Rede ist nur von der nationalen Frage –, was wir von den Arbeitern der Unterdrückernationen fordern.“[lxxi]
Lenin entgegnete darauf, dass sich die verschiedenen Aufgaben aus der unterschiedlichen Stellung des Proletariats in der unterdrückenden und der unterdrückten Nation ergäben, denn deren wirkliche Lage sei eben nicht identisch, sondern unterschiedlich. Worin besteht der Unterschied?
„1. Ökonomisch ist der Unterschied der, daß Teile der Arbeiterklasse in den Unterdrückerländern Brosamen von dem Extraprofit erhalten, den die Bourgeois der Unterdrückernationen einheimsen, indem sie den Arbeitern der unterdrückten Nationen das Fell stets zweimal über die Ohren ziehen. Die ökonomischen Daten besagen außerdem, daß aus den Arbeitern der Unterdrückernationen ein größerer Prozentsatz zu ,Zwischenmeistern’ aufsteigt als aus den Arbeitern der unterdrückten Nationen, daß ein größerer Prozentsatz zur Aristokratie der Arbeiterklasse emporsteigt. Das ist eine Tatsache. Die Arbeiter der unterdrückenden Nation sind bis zu einem gewissen Grade Teilhaber ihrer Bourgeoisie bei der Ausplünderung der Arbeiter (und der Masse der Bevölkerung) der unterdrückten Nation.
2. Politisch ist der Unterschied der, daß die Arbeiter der Unterdrückernationen auf einer ganzen Reihe von Gebieten des politischen Lebens eine im Vergleich zu den Arbeitern der unterdrückten Nation privilegierte Stellung einnehmen.
3. Ideologisch oder geistig ist der Unterschied der, daß die Arbeiter der Unterdrückernationen durch die Schule und das Leben stets im Geiste der Verachtung oder der Mißachtung der Arbeiter der unterdrückten Nationen erzogen werden. Dies hat z. B. jeder Großrusse, der unter Großrussen erzogen wurde oder unter ihnen gelebt hat, kennengelernt.“[lxxii]
Daraus folgert Lenin: „Damit die Aktion der Internationale, welche im realen Leben aus Arbeitern besteht, die durch ihre Zugehörigkeit zu unterdrückenden und unterdrückten Nationen gespalten sind, eine einheitliche Aktion sei, darf die Propaganda in dem ersten Fall nicht die gleiche sein wie im zweiten.“[lxxiii]
Arbeiter:innen der unterdrückenden Nation müssen eine Priorität auf das Selbstbestimmungsrecht der Unterdrückten legen, und zwar ohne daran politische Vorbedingungen bei dessen Realisierung zu stellen. Daher auch die Forderung nach bedingungsloser Unterstützung der Freiheit im Hinblick auf Loslösung. Lenin verweist hier auf die Trennung Norwegens von Schweden, über deren Sinn und Zweck sich Rosa Luxemburg mokiert, weil Norwegen nach der Loslösung eine Monarchie wurde, also überhaupt keine fortschrittlichere Herrschaftsform hervorbrachte als zuvor. Lenin hingegen verweist darauf, dass die schwedischen Arbeiter:innen einfach nur schwedische Chauvinist:innen gewesen wären, wenn sie die Unabhängigkeit Norwegens zwanghaft hätten verhindern wollen oder die Forderung gestellt hätten, dass diese hätte garantieren müssen, eine Republik zu errichten. In Wirklichkeit hätten sie so nur die schwedische Monarchie verteidigt und die Spaltung zum norwegischen Volk und insbesondere auch zur Arbeiter:innenklasse vertieft: „Wenn die schwedischen Arbeiter nicht bedingungslos für die Freiheit der Lostrennung der Norweger eingetreten wären, wären sie Chauvinisten gewesen, hätten sie sich am Chauvinismus der schwedischen Gutsbesitzer mitschuldig gemacht, die Norwegen mit Gewalt, durch einen Krieg, ‚zurückhalten’ wollten.“[lxxiv]
Die Arbeiter:innen der unterdrückten Nation müssen dazu eine andere Stellung einnehmen. Ob sie für oder gegen die konkrete Loslösung eintreten, ist für sie eine bedingte Frage. „Wenn die norwegischen Arbeiter die Frage der Lostrennung nicht bedingt gestellt hätten, d. h. so, daß auch Mitglieder der sozialdemokratischen Partei gegen die Lostrennung stimmen und Propaganda machen durften, dann hätten die norwegischen Arbeiter ihre Pflicht als Internationalisten verletzt und wären in einen engstirnigen, bürgerlichen norwegischen Nationalismus verfallen. Warum? Weil die Lostrennung von der Bourgeoisie vollzogen wurde und nicht vom Proletariat! Weil die norwegische Bourgeoisie (wie jede andere auch) stets bestrebt ist, die Arbeiter des eignen von den Arbeitern des ‚fremden‘ Landes zu trennen, sie zu spalten!“[lxxv]
Während Arbeiter:innen der unterdrückenden Nation das Selbstbestimmungsrecht bedingungslos verteidigen müssen, wäre es eine Form der Unterordnung unter die nationale Bourgeoisie der unterdrückten Nation, daraus ein unabhängig von den Umständen gültiges Prinzip zu machen, immer für die Unabhängigkeit einzutreten.
Das Selbstbestimmungsrecht bedeutet also, die Rechte von nationalen Minderheiten und unterdrückten Nationen konsequent zu verteidigen, bis hin zum Recht auf Loslösung. Es muss aber auch eine ganze Reihe anderer Forderungen zur Gleichstellung und gegen Unterdrückung umfassen – gleiche Staatsbürger:innenrechte, Gleichheit vor dem Gesetz, demokratische Forderungen bezüglich der Besetzung von Institutionen wie Gerichten und Behörden, Anerkennung der Sprache im öffentlichen Leben und an Schulen und das Recht auf freie Ausübung der eigenen Kultur. Solcherart kann die Verteidigung des nationalen Selbstbestimmungsrechts ermöglicht und gleichzeitig die nationalistische Ideologie der unterdrückenden wie der unterdrückten Nation bekämpft werden, um so die Basis für eine möglichst enge Kampfverbindung der Arbeiter:innenklasse zu legen.
In der imperialistischen Nation ist die Bourgeoisie zu einer reaktionären Kraft geworden. Natürlich schließt das nicht aus, dass auch bürgerliche Kräfte an gleichen Aktionen beteiligt sind (z. B. Umweltbewegung), aber das ist keine Einheitsfront im eigentlichen Sinn und wir suchen diese Allianz nicht. In der unterdrückten Nation kann auch die Bourgeoisie, z. B. im Krieg gegen eine imperialistische Großmacht, in Konflikt mit dem Imperialismus geraten, was die Basis für die Anwendung einer besonderen Taktik der Arbeiter:innenklasse, die antiimperialistische Einheitsfront, auch gegenüber der Bourgeoisie sein kann. Auch wenn diese Möglichkeit aufgrund der Einbindung der halbkolonialen Kapitalist:innenklasse in den Weltmarkt und die imperialistische Ordnung eher episodisch sein wird, so kann sie keineswegs ausgeschlossen werden. Immer besteht das Ziel dabei auch darin, deren verräterischen Charakter bloßzulegen. Denn der Zweck dieser Taktik besteht letztlich darin, die Hegemonie der Arbeiter:innenklasse im Kampf herzustellen.
Nationale Selbstbestimmung nach der Oktoberrevolution
Die nationale Frage war eine der Triebkräfte der Russischen Revolution im Jahr 1917. Lenin und die Bolschewiki hatten deren enorme Bedeutung und Sprengkraft schon lange vorher erkannt und eine konsequent demokratische Lösung auch bewusst ins Programm der Partei
aufgenommen. Die zentrifugale Bedeutung der erwachenden Nationalbewegungen manifestierte sich im Jahr 1917 und verstärkte die Krise der bürgerlichen Regierungen, die durch die Februarrevolution entstanden waren. Einerseits standen sie unter dem Druck der Massen – darunter auch der unterdrückten Nationalitäten. Andererseits sollte der imperialistische Krieg verstärkt fortgesetzt werden, was im Gegensatz zu allen Forderungen der Demokratie selbst stand. So wie die Arbeiter:innen in den Städten, die Bäuer:innen auf dem Land und die Soldaten in der Armee vertröstet werden mussten, so auch die unterdrückten Nationen, die die Mehrheit der Bevölkerung (rund 57 %) ausmachten. Dieser Bedeutung trägt Lenin in seiner Broschüre „Werden die Bolschewiki die Staatsmacht behaupten? “ vom November 1917 Rechnung:
„Die nationale Frage und die Agrarfrage sind für die kleinbürgerlichen Massen der Bevölkerung Russlands gegenwärtig die Kardinalfragen. Das ist unbestreitbar. In beiden Fragen nun ist das Proletariat ,nicht isoliert’, und das in einem Maße, wie es selten vorkommt. Es hat die Mehrheit des Volkes hinter sich. Es allein ist fähig, in beiden Fragen eine entschlossene, wirklich ‚revolutionär-demokratische’ Politik zu betreiben, die der proletarischen Staatsmacht nicht nur sofort die Unterstützung der Bevölkerungsmehrheit sichern, sondern auch einen wahren Sturm revolutionärer Begeisterung in den Massen auslösen würde, denn zum erstenmal würden es die Massen mit einer Regierung zu tun haben, die nicht die schonungslose Unterdrückung der Bauern durch die Gutsbesitzer, der Ukrainer durch die Großrussen fördert, wie unter dem Zarismus, die nicht, verhüllt durch hochtrabende Phrasen bestrebt ist, die gleiche Politik in der Republik fortzusetzen, die nicht zu Schikanen, Beleidigungen, Ränken, Verschleppungen, Behinderungen und Ausflüchten greift (all das, was Kerenski den Bauern und den unterdrückten Nationen beschert), die ihnen vielmehr durch Taten bewiesene aufrichtige Sympathien entgegenbringt, unverzüglich revolutionäre Maßnahmen gegen die Gutsbesitzer ergreift und sofort die volle Freiheit für Finnland, die Ukraine, Belorußland, für die Mohammedaner usw. wiederherstellt.“[lxxvi]
Lenin und die Bolschewiki strebten dabei keineswegs die Bildung möglichst vieler Nationalstaaten auf dem Gebiet des ehemaligen zaristischen Russlands an, aber es war ihnen bewusst, dass sie die Massen, vor allem die bäuerlichen, nur dann erfolgreich und möglichst konfliktfrei für die neue revolutionäre Ordnung gewinnen konnten, wenn sie ein anderes Verhältnis zu ihren nationalen Rechten einnahmen als der Zarismus und die Bourgeoisie:
„An Stelle des Wortes Selbstbestimmung, das oft zu falschen Auslegungen Anlaß bot, setze ich einen ganz präzisen Begriff: ‚Recht auf freie Lostrennung.‘ Nach den Erfahrungen der halbjährigen Revolution des Jahres 1917 kann wohl kaum bestritten werden, daß die Partei des revolutionären Proletariats Rußlands, eine Partei, die sich in ihrer Arbeit der großrussischen Sprache bedient, verpflichtet ist, das Recht auf Lostrennung anzuerkennen. Nachdem wir die Macht errungen haben, würden wir unbedingt Finnland, der Ukraine, Armenien, jeder vom Zarismus (und von der großrussischen Bourgeoisie) unterdrückten Nationalität unverzüglich dieses Recht zuerkennen. Doch wir unsererseits wollen die Lostrennung gar nicht. Wir wollen einen möglichst großen Staat, einen möglichst engen Bund einer möglichst großen Zahl von Nationen, die in Nachbarschaft der Großrussen leben; wir wollen das im Interesse der Demokratie und des Sozialismus, im Interesse der Einbeziehung einer möglichst großen Zahl von Werktätigen verschiedener Nationen in den Kampf des Proletariats. Wir wollen eine revolutionär-proletarische Einheit, Vereinigung, nicht Trennung. Wir wollen eine revolutionäre Vereinigung, und darum stellen wir nicht die Losung der Vereinigung all und jeder Staaten überhaupt auf, denn die soziale Revolution setzt auf die Tagesordnung nur die Vereinigung jener Staaten, die zum Sozialismus übergegangen sind und übergehen, der sich befreienden Kolonien usw. Wir wollen eine freie Vereinigung, und darum sind wir verpflichtet, das Recht auf Lostrennung anzuerkennen (ohne das Recht auf Lostrennung kann die Vereinigung nicht als frei bezeichnet werden). Wir sind umso mehr verpflichtet, das Recht auf Lostrennung anzuerkennen, als sich infolge der Unterdrückungsmaßnahmen des Zarismus und der großrussischen Bourgeoisie bei den benachbarten Nationen eine Unmenge Erbitterung und Mißtrauen gegen die Großrussen schlechthin angehäuft hat, und dieses Mißtrauen kann nur durch Taten und nicht durch Worte zerstreut werden.“[lxxvii]
In der Revolution bewährten sich diese revolutionären Positionen. Nach der Machtergreifung wurden sie jedoch von mehreren Faktoren auf die Probe gestellt. Erstens durch die internationale Lage, den Bürger:innenkrieg und, damit verbunden, auch viele tragische und längst nicht immer unumgängliche Verletzungen des Selbstbestimmungsrechts der Nationen. Zudem zeigte sich ferner, dass sich auch innerhalb des Bolschewismus eine immer wieder auftauchende Opposition gegen die Lenin’sche Politik entwickelte, eine Opposition, die sich einerseits aus den falschen Revolutionskonzepten vor den „Aprilthesen“ von 1917 und andererseits aus den Positionen Luxemburgs, Pjatakows, Bucharins und anderer Kritiker:innen der bolschewistischen Position zur nationalen Frage speiste.[lxxviii]
In Finnland hatte die Februarrevolution die Sozialdemokratie an die Macht gebracht. Doch diese weigerte sich, die Revolution voranzutreiben, während parallel die Kerenski-Regierung faktisch die finnische Bourgeoisie und deren Machtübernahme förderte. Am 18. Dezember 1917 sahen sich Lenin und die Bolschewiki gezwungen, die bürgerliche Regierung Finnlands bedingungslos anzuerkennen. Im Januar 1918 folgte die Übernahme der Macht durch die Arbeiter:innenklasse in allen größeren Städten Finnlands. Die Sozialdemokrat:innen bildeten eine „Arbeiter:innenregierung“ unter der Aufsicht eines zentralen Arbeiter:innenrats, die sofort von den Bolschewiki anerkannt wurde. Aber die Reformist:innen lehnten es ab, dass diese „Arbeiter:innenregierung“ die Diktatur des Proletariats errichten sollte.
Stattdessen verkündeten sie, dass sie „eine parlamentarische Demokratie, in der das Proletariat die führende Klasse ist“, wollten, und verschwendeten ihre Zeit damit, eine ultrademokratische parlamentarische Verfassung auszuarbeiten. Unterdessen sammelte und organisierte Mannerheim, ein ehemaliger General der russischen Armee, im Norden eine Armee aus Weißgardisten, Offiziersanwärtern und schwedischen Freiwilligen, um die „Arbeiter:innenregierung“ Finnlands im Blut zu ertränken. Im folgenden Bürger:innenkrieg siegte die Konterrevolution, rund 100.000 Arbeiter:innen wurden getötet, etwa ein Viertel des gesamten Proletariats!
Für Rosa Luxemburg führte die Anwendung des Selbstbestimmungsrechts nur zum nationalen Exzess der Bourgeoisien der „Randgebiete“ in Finnland, Polen oder der Ukraine, die ihr zufolge ohnehin niemals eine Nation oder einen Staat oder auch nur eine nationale Kultur gebildet hätten. Die Bolschewiki hätten mit ihrer Agrarpolitik und ihrer Nationalitätenpolitik gewissermaßen die Feind:innen großgezogen, die sie jetzt nicht mehr loswürden.
„Statt die Proletarier in den Randländern vor jeglichem Separatismus als vor rein bürgerlichem Fallstrick zu warnen und die separatistischen Bestrebungen mit eiserner Hand, deren Gebrauch in diesem Falle wahrhaft im Sinne und Geist der proletarischen Diktatur lag, im Keime zu ersticken, haben sie vielmehr die Massen in allen Randländern durch ihre Parole verwirrt und der Demagogie der bürgerlichen Klassen ausgeliefert. Sie haben durch diese Förderung des Nationalismus den Zerfall Rußlands selbst herbeigeführt, vorbereitet und so den eigenen Feinden das Messer in die Hand gedrückt, das sie der russischen Revolution ins Herz stoßen sollten.“[lxxix]
Notfalls hätten die unterdrückten Nationen, so Luxemburg, mit den Gewaltmitteln der proletarischen Diktatur in Sowjetrussland gehalten werden müssen. Sie verkennt damit vollständig, dass die nationalen Bestrebungen keineswegs auf bloßer Verwirrung und Einbildung fußen, die nur den reaktionären Kräften eigen wäre, sondern auf der realen, jahrhundertelangen Erfahrung der Unterdrückung beruhen. Diese trifft natürlich auch die Arbeiter:innenklasse. Hinzu ignoriert Luxemburg vollständig die Tatsache, dass in vielen Gebieten nationaler Minderheiten das Proletariat oft aus Großruss:innen bestand, die teilweise auch als Kolonist:innen migriert waren. Und schließlich verkennt sie, dass die proletarische Diktatur, gerade einer zahlenmäßig minoritären Klasse, ihre Herrschaft nur behaupten und festigen kann, wenn sie die demokratischen Aspirationen auch und gerade der kleinbürgerlichen und bäuerlichen Massen aufgreift.
Lenin hingegen verstand die Ungleichheit der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung im Zarenreich. Er erkannte, dass einige Gebiete noch in der Entwicklungsphase zum Kapitalismus steckten, auch wenn die Städte des Reiches die sozialistische Revolution durchführten.
Er war sich der Entwicklung der nationalen Identität als Mittel, durch das die bäuerlichen Massen die bürgerliche Kultur aufnahmen, bewusst, weil es einen großen Schritt vorwärts gegenüber der mittelalterlichen und klerikalen Rückständigkeit bedeutete. Aus diesem Grund nahm Lenin niemals eine feindselige oder gleichgültige Haltung gegenüber dem Nationalismus eines unterdrückten Volkes ein, egal wie schwach oder primitiv dessen soziale Entwicklung war.
Die Ukraine
Die Isolation der ukrainischen nationalistischen Intellektuellen von der Masse des ukrainischen Volkes war zum großen Teil auf die zaristische Polizeidiktatur zurückzuführen, so dass die Einführung der bürgerlichen und später der Arbeiter:innendemokratie gerade eine rasche Entwicklung der ukrainischen Sprache, Kultur und des Nationalismus ermöglichte. Diese verbreiteten sich weit über die Kreise der Intelligenz hinaus.
Revolutionär:innen tun nicht gut daran, die Gleichgültigkeit eines grausam unterdrückten Volkes gegenüber dem National Humphrey zu feiern. Es wäre ein schwacher und kränklicher Internationalismus, der auf dem Boden wächst, der durch nationale Unterdrückung, Diskriminierung und allgemeine kulturelle Verarmung „vorbereitet“ wurde. Sollten revolutionäre Internationalist:innen die Möglichkeit haben, die Massen aus ihrem politischen Schlaf zu wecken, haben sie die dringende Pflicht, sich mit der Frage der nationalen Unterdrückung auseinanderzusetzen, ohne selbst zu Nationalist:innen zu werden. Tun sie dies nicht, werden sie früher oder später von Letzteren hinweggefegt werden.
Die Ereignisse in der Ukraine ab 1917 wurden objektiv durch ihre strategische Bedeutung sowohl in der Endphase des imperialistischen Krieges als auch in den drei Jahren des russischen Bürgerkriegs bestimmt. Sie wurden nicht nur durch die Schwäche des ukrainischen kleinbürgerlichen Nationalismus geprägt, sondern auch durch die Konflikte innerhalb der bolschewistischen Reihen in Bezug auf den Umgang mit der nationalen Frage.
Bald nach der Februarrevolution wurde in Kiew eine ukrainische Versammlung – die Nationale Rada (Rat) – gebildet. Diese wurde von kleinbürgerlichen Nationalist:innen und halbmarxistischen Intellektuellen wie Mychajlo Hruschewskyj und Wladimir Winnitschenko dominiert. In den folgenden Monaten wuchs die Rada zu einer (nicht gewählten) Nationalversammlung mit etwa 600 Mitgliedern heran. Ursprünglich hatte sie sich nicht die Unabhängigkeit, sondern eine föderale Beziehung zum Rest Russlands zum Ziel gesetzt.
Im Juli richtete die Rada, verärgert über die Ausflüchte Kerenskis, mit Hilfe des Abenteurers Symon Petljura schließlich eine Verwaltung in der Ukraine ein. Am 19. November proklamierte die Rada eine Ukrainische Volksrepublik, ohne jedoch von dem Recht auf Sezession Gebrauch zu machen, das die Bolschewiki in der Erklärung der Rechte der Völker Russlands verkündet hatten. Lenins unmittelbare Reaktion war, die Notwendigkeit zu betonen, der Ukraine das Recht auf Sezession oder Föderation mit der Sowjetrepublik zu gewähren:
„Wir sehen jetzt eine nationale Bewegung in der Ukraine und sagen: Wir sind unbedingt für die volle und uneingeschränkte Freiheit des ukrainischen Volkes. Wir müssen mit jener alten, blutigen und schmutzigen Vergangenheit brechen, wo das Rußland der kapitalistischen Unterdrücker die Rolle des Henkers der anderen Völker spielte. Mit dieser Vergangenheit werden wir aufräumen, von dieser Vergangenheit werden wir keinen Stein auf dem andern lassen. (S t ü r m i s c h e r B e i f a l l).
Wir sagen den Ukrainern: ,Als Ukrainer könnt ihr euer Leben einrichten, wie ihr wollt.‘ Aber wir reichen den ukrainischen Arbeitern die Bruderhand und sagen ihnen: ,Mit euch zusammen werden wir gegen eure und unsere Bourgeoisie kämpfen. Nur ein sozialistisches Bündnis der Werktätigen aller Länder wird jeden Boden für nationale Hetze und nationalen Hader beseitigen. (S t ü r m i s c h e r B e i f a l l)“[lxxx]
Die kleinbürgerlichen Nationalist:innen standen dem Wachstum der Sowjets in der Ukraine und deren Versuchen, ihre eigene Macht zu etablieren, schnell feindselig gegenüber. Die Rada weigerte sich rundweg, diese Sowjetmacht anzuerkennen. Darüber hinaus begannen konterrevolutionäre Armeen unter der Führung von Kornilow und Kaledin, ukrainisches Territorium zu nutzen, um Krieg gegen die russische Regierung zu führen. Die Rada unternahm nichts, um dies zu verhindern, und ergriff sogar Maßnahmen, um die Roten Garden und revolutionären Regimenter zu entwaffnen, die gegen Kaledin kämpften.
Die Sowjetregierung antwortete mit einer Erklärung, die Lenin am 17. Dezember 1917 verfasste und in der sie die Anerkennung der Unabhängigkeit der Ukraine mit der Drohung verband, den Krieg zu erklären, sollte die Rada ihre feindlichen militärischen Aktionen und die Unterdrückung der ukrainischen Sowjets nicht einstellen:
„(…) bestätigt die sozialistische Regierung Rußlands, der Rat der Volkskommissare, erneut das Recht aller früher vom Zarismus und der großrussischen Bourgeoisie unterdrückten Nationen auf Selbstbestimmung, bis zum Recht dieser Nationen, sich von Rußland loszutrennen.
Daher erkennen wir, der Rat der Volkskommissare, die Ukrainische Volksrepublik sowie ihr Recht an, sich völlig von Rußland zu trennen oder mit der Russischen Republik einen Vertrag über föderative oder ähnliche Beziehungen einzugehen.
Alles, was die nationalen Rechte und die nationale Unabhängigkeit des ukrainischen Volkes betrifft, erkennen wir, der Rat der Volkskommissare, sofort, ohne jede Einschränkung und bedingungslos an.
Gegen die bürgerliche finnische Republik, die einstweilen eine bürgerliche Republik geblieben ist, haben wir keinen einzigen Schritt im Sinne einer Beschränkung der nationalen Rechte und der Unabhängigkeit des finnischen Volkes unternommen, und wir werden auch keinerlei Schritte unternehmen, die die nationale Unabhängigkeit irgendeiner der Nationen beschränken könnten, die der Russischen Republik angehören oder ihr angehören wollen.“[lxxxi]
Aber die Ereignisse in der Ukraine steuerten auf eine Entscheidung zwischen der Rada und den ukrainischen Bolschewiki zu. In Brest-Litowsk schlug sich die Vertretung der Rada auf die Seite des deutschen Imperialismus, und die nächsten zwei Jahre waren von einem brutalen Bürgerkrieg geprägt. Denikins Weiße, die „Russische Freiwilligenarmee“, die Rote Armee, die Truppen von Nestor Machno sowie die Rada von Petljura, die nun von der polnischen Regierung unter Piłsudski unterstützt wurde, kämpften alle um die Ukraine. Erst im August 1921 verließen die letzten antibolschewistischen Truppen das Land.
Obwohl die Bolschewiki vor dem Krieg kaum Fuß unter den ukrainischen bäuerlichen Massen gefasst hatten, sondern in erster Linie unter den russischstämmigen industriellen Arbeiter:innen im Osten des Landes verankert waren, konnten sie schließlich den Krieg gegen die verschiedenen konterrevolutionären und imperialistischen Kräfte gewinnen. Das lag, wie E. H. Carr in „The Bolshevik Revolution“ treffend zusammenfasst, daran, dass sie den Bäuer:innen als das „kleinste Übel“ verglichen mit dem Regime aller anderen Kräfte erschienen, die ihr Land ausgeblutet hatten.
Die Schwäche der verschiedenen ukrainischen nationalistischen Kräfte ermutigte einen Teil der Bolschewiki in der Ukraine, die nationale Frage zu vernachlässigen und sogar zu verunglimpfen. Es bedurfte beharrlicher Anstrengungen von Lenin und Trotzki in der Zentrale, um diese Linie zu korrigieren. Pjatakow, eine Schlüsselfigur in diesen Jahren, blieb der Selbstbestimmung feindlich gesinnt.
Pjatakow war zu dieser Zeit zusammen mit Bucharin ein linker Kommunist, der den Frieden von Brest-Litowsk vehement ablehnte und entschlossen war, den revolutionären Krieg um jeden Preis fortzusetzen. Im August 1918 rief er gegen den Rat Moskaus zu einem ukraineweiten Aufstand gegen Skoropadskyj, der nach dem Einmarsch deutscher und österreichisch-ungarischer Truppen im Februar 1918 als deren Marionette (Hetman) eingesetzt wurde, auf, der in einer völligen Katastrophe endete.
Die Intervention Moskaus 1918/1919 führte zu einem Führungswechsel, und Christian Rakowski wurde als Regierungschef nach Proklamation der Ukrainischen Sowjetrepublik im Januar 1919 entsandt. Auch Rakowski unterschätzte zunächst die nationale Frage, da er die Ukraine nicht als Nation betrachtete und sie für eine Erfindung der Intelligenz hielt. So verkündete er eine Politik der „sprachlichen Russifizierung“ und verfolgte darüber hinaus eine linke Agrarpolitik, die die mittleren Bäuer:innen entfremdete. Damit verstärkte Rakowski die Fehler Pjatakows.
Lenin in Moskau und Trotzki als Befehlshaber der Roten Armee waren gezwungen, einzugreifen. In diesen Jahren kämpfte die Revolution um ihr Überleben, und die Massen der Ukraine waren nicht in erster Linie mit der Frage der nationalen Unabhängigkeit beschäftigt. In diesem Zusammenhang war es möglich, ja, sogar notwendig, die gesamte Frage der Selbstbestimmung vorübergehend dem Sieg im Krieg unterzuordnen. Als jedoch die bolschewistischen Kräfte die Oberhand gewannen, wurde es notwendig, eine korrekte Haltung gegenüber den nationalen Gefühlen der ukrainischen Massen wiederherzustellen.
Als die Rote Armee im November 1919 wieder in die Ukraine einmarschierte, erteilte Trotzki den Truppen deutliche Befehle:
„Die Ukraine ist das Land der ukrainischen Arbeiter und Bauern. Sie allein haben das Recht, in der Ukraine zu herrschen, sie zu regieren und ein neues Leben aufzubauen. Behalten Sie dies fest im Auge. Ihre Aufgabe ist es nicht, die Ukraine zu erobern, sondern sie zu befreien. Wenn Denikins Banden zerschlagen sind, werden die arbeitenden Menschen der befreiten Ukraine selbst entscheiden, unter welchen Bedingungen sie mit Sowjetrussland leben wollen. Wir sind alle davon überzeugt und wissen, dass die arbeitenden Menschen der Ukraine sich für eine engste brüderliche Union mit uns erklären werden. … Lang lebe die freie und unabhängige Sowjetukraine!“[lxxxii]
Mit Lenins Hilfe und unter seinem Druck verfolgte die bolschewistische Führung in der Ukraine eine sensiblere und prinzipiellere Strategie in der nationalen Frage. Die Bedeutung der Verwendung der ukrainischen Sprache und der Achtung ihrer Kultur wurde betont. Dies trug dazu bei, die Borotbist:innen – eine Abspaltung der ukrainischen linken Sozialrevolutionär:innen – für die Kommunistische Partei der Ukraine zu gewinnen.
Ihre Gewinnung war wichtig, weil sie im Gegensatz zu den ukrainischen Bolschewiki tief in der Bäuer:innenschaft verwurzelt waren. Sie waren entschiedene Befürworter:innen einer unabhängigen Ukraine. Unter den Bedingungen des Bürgerkriegs lehnte Lenin zu Recht eine Spaltung der staatlichen Kräfte angesichts einer Vielzahl von Armeen der Weißen Garden und ausländischer Interventionist:innen ab. Lenin versprach den Borot’bist:innen jedoch, dass eine konstituierende Sowjetversammlung nach dem Sieg im Bürgerkrieg über die Zukunft der Ukraine entscheiden würde, ob für oder gegen die vollständige Unabhängigkeit. Leider begrub die akute Nachkriegskrise von 1921, insbesondere der Kronstädter Aufstand und die Bäuer:innenaufstände gegen den Kriegskommunismus, die Krise der gesamten bolschewistischen Partei, die zum Verbot von Fraktionen führte, und dann das rasche Wachstum der Bürokratie, dieses Versprechen.
Nationale Frage auf dem Parteikongress 1919
Mitten im Bürgerkrieg kehrten die Bolschewiki auf ihrem achten Kongress zur Debatte über den Programmentwurf zurück. Im März 1919 nahmen sie ihn schließlich an, und nach dem Kongress wurden Bucharin und Preobraschenski beauftragt, einen Kommentar dazu zu verfassen, der den Titel „Das ABC des Kommunismus“ erhielt. Auf dem achten Kongress der RKP(B) konfrontierte Lenin Bucharin erneut mit der Frage, die die Partei seit 1915 spaltete. Nun versuchte Bucharin, Lenin in die Flanke zu fallen, indem er vom Selbstbestimmungsrecht allein der arbeitenden Bevölkerung sprach.
Natürlich bildeten Arbeiter:innen und Bäuer:innen die überwiegende Mehrheit jeder Nation, und deshalb hatten Lenin und andere Bolschewiki oft gesagt, dass Revolutionär:innen nur dann die wahre Selbstbestimmung des Volkes anerkennen könnten, wenn diese Mehrheitsklassen der Nation wirklich und demokratisch konsultiert würden. Er lehnte jedoch die Idee ab, dass die Selbstbestimmung an die Vorbedingung geknüpft sein sollte, dass nur diese Klassen entscheiden könnten.
Lenin sah darin ein weiteres Beispiel dafür, dass Bucharin nicht verstanden hatte, dass die Anerkennung der Selbstbestimmung gerade dazu diente, die noch lange nicht vollendete Klassendifferenzierung innerhalb der jeweiligen Nation zu beschleunigen. Eine vorherige Klassendifferenzierung könne daher keine Bedingung für die Anerkennung der Selbstbestimmung sein. Mit seiner Widerlegung Bucharins erklärte und verteidigte er die gesamte Haltung der Bolschewiki seit 1917:
„Dasselbe muss ich hinsichtlich der nationalen Frage sagen. Auch hier nimmt Genosse Bucharin das Gewünschte für die Wirklichkeit. Er sagt, man dürfe das Selbstbestimmungsrecht der Nationen nicht anerkennen. Die Nation – das bedeute die Bourgeoisie mitsamt dem Proletariat. Wir Proletarier werden das Selbstbestimmungsrecht irgendeiner schnöden Bourgeoisie anerkennen! Das ist doch ganz und gar ungereimt! Nein, entschuldigen Sie, das reimt sich mit dem, was ist. Streichen Sie das, dann wird ein Phantasiegebilde herauskommen. Sie berufen sich auf den Differenzierungsprozeß, der sich innerhalb der Nation vollzieht, auf den Prozeß der Scheidung von Proletariat und Bourgeoisie. Aber wir werden noch sehen, wie diese Differenzierung verlaufen wird.“[lxxxiii]
Und weiter: „Die Selbstbestimmung der Nationen über Bord zu werfen und an ihre Stelle die Selbstbestimmung der Werktätigen setzen ist grundfalsch, denn eine solche Konzeption berücksichtigt nicht, unter welchen Schwierigkeiten, auf welchen verschlungenen Pfaden die Differenzierung innerhalb der Nationen vor sich geht. (…) Solange die Bourgeoisie oder das Kleinbürgertum oder auch nur ein Teil der deutschen Arbeiter beeinflußt werden von dem Schreckgespenst: ,Die Bolschewiki wollen gewaltsam ihre Ordnung einführen’ – solange wird die Formulierung ,Selbstbestimmung der Werktätigen’ die Lage nicht erleichtern. (…) Unser Programm darf nicht von Selbstbestimmung der Werktätigen sprechen, weil das falsch ist. Es muß aussprechen, was ist. Stehen die Nationen nun einmal auf verschiedenen Stufen des Weges vom Mittelalter zur bürgerlichen Demokratie und von der bürgerlichen zur proletarischen Demokratie, so ist dieser Satz unseres Programms vollkommen richtig. Auf diesem Wege gab es bei uns sehr viele Zickzackwendungen. Jede Nation muß das Selbstbestimmungsrecht erhalten, und das trägt zur Selbstbestimmung der Werktätigen bei. In Finnland zeigt der Prozeß der Scheidung des Proletariats von der Bourgeoisie eine bemerkenswerte Klarheit, Stärke und Tiefe. Jedenfalls wird dort nicht alles so verlaufen wie bei uns. Würden wir sagen, wir anerkennen keine finnländische Nation, sondern nur die werktätigen Massen, so wäre das hanebüchener Unsinn. Das, was ist, nicht anerkennen wollen, ist ein Unding: Es wird die Anerkennung selbst erzwingen.“[lxxxiv]
Auf dem achten Kongress der RKP(B) wandte Lenin genau dieselbe Methode auf Polen an. Wie überall im Jahr 1917 hatten die Bolschewiki sofort die Unabhängigkeit Polens anerkannt. Aber 1920 sollten sie einen taktischen Fehler begehen, der sie teuer zu stehen kam. Trotz erster Erfolge im Krieg drängte Trotzki während des Vormarsches der Roten Armee auf Warschau im Sommer 1920 zur Zurückhaltung. Lenin hingegen wollte unbedingt nach Polen, um der Revolution in Deutschland zur Hilfe zu kommen. Doch er unterschätzte die nationalen Gefühle. Auch die polnischen Arbeiter:innen wie Bäuer:innen fürchteten die Rote Armee, die sie als eine weitere Armee ihrer russischen Unterdrücker:innen betrachteten, und erhoben sich nicht gegen ihre inneren Klassenfeind:innen.
Es gab andere Beispiele, wo die Bolschewiki oder die Rote Armee militärisch in Staaten oder Republiken eingriffen und deren bürgerliche oder feudale reaktionäre Regierungen stürzten. Als die imperialistischen Mächte drohten, ein strategisch wichtiges Staatsgebiet zu besetzen, um ihren Angriff auf den Arbeiter:innenstaat zu erleichtern, oder als die innere Konterrevolution die Unabhängigkeit als Vorwand benutzte, um die Macht zu ergreifen und einen Übungsplatz für den Bürger:innenkrieg vorzubereiten, erwies sich eine Intervention als notwendig. Georgien war ein solcher Fall.
Georgien
Georgien – ein überwiegend bäuerliches Land ohne modernes Industrieproletariat – wurde von den Menschewiki beherrscht, die unter dem Zaren oder unter Kerenski wenig oder gar nichts über die Unabhängigkeit Georgiens gesagt hatten. Aber die Oktoberrevolution verwandelte sie über Nacht in fanatische georgische Nationalist:innen.
Am Ende des Bürger:innenkriegs, Anfang 1920, telegrafierte der georgische Bolschewik Ordschonikidse an Lenin: „Wir werden bis zum 15. Mai in Tiflis sein.“ Daraufhin erging ein scharfer Befehl, der jeden derartigen Versuch untersagte und darüber hinaus die sofortige Anerkennung der menschewistischen Regierung und der Unabhängigkeit Georgiens anordnete.
Die menschewistische Regierung begann dennoch Verhandlungen mit den imperialistischen Mächten über den Einmarsch ihrer Truppen in Georgien, um das Land zu „schützen“. Im Dezember 1920 akzeptierten die armenischen Nationalist:innen (die Daschnaks), die einen aussichtslosen Kampf gegen die Armee von Mustafa Kemal (Kemal Atatürk) geführt hatten, den sowjetischen Schutz, riefen eine sowjetische Republik Armenien aus und schlossen einen Bund mit Sowjetaserbaidschan und Russland. Georgien war damit von sowjetischem Territorium umgeben. Ordschonikidse begann, Moskau mit Forderungen nach Intervention zu bombardieren, wurde jedoch wiederholt angewiesen, korrekte Beziehungen zu Tiflis (Tbilissi) aufrechtzuerhalten.
Anfang Februar 1921 schlug Ordschonikidse die sofortige gewaltsame Sowjetisierung Georgiens durch die Rote Armee vor. Trotzki lehnte dies ab und befürwortete eine gewisse Vorbereitungsphase innerhalb Georgiens, um den Aufstand zu entwickeln und ihm dann zu Hilfe zu kommen. Lenin äußerte sich besorgt wegen der Unvorbereitetheit Georgiens auf die Sowjetherrschaft und beklagte auch den Mangel an seriösen Informationen. Dennoch organisierte Ordschonikidse in Absprache mit Stalin in Moskau kleinere Aufstände und Zusammenstöße im Grenzgebiet. Als am 14. Februar tatsächlich ein Aufstand ausbrach, willigte das Politbüro widerstrebend ein, die Rote Armee zur Unterstützung zu entsenden.
Im Wesentlichen war das Projekt das alleinige Werk Stalins und Ordschonikidses. Sie sahen keinen Grund, auf die politische Reifung der georgischen Arbeiter:innen und armen Bäuer:innen zu warten, und hatten nicht die geringste Sensibilität für die nationalen Gefühle ihrer Landsleute. Am 25. Februar floh die menschewistische Regierung aus Tiflis und gab drei Wochen später das georgische Territorium vollständig auf.
Zwar schwand die Popularität des menschewistischen Regimes aufgrund seiner unbefriedigenden Lösung der Landfrage, und unabhängige Beobachter:innen stellten eine Hinwendung der Arbeiter:innen, Soldaten und armen Bäuer:innen zu den Bolschewiki fest, doch hatten die beiden georgischen Bolschewiki wenig Interesse an oder Geduld für die Idee, die Reifung einer revolutionären Situation in Georgien zu unterstützen. Nach deren Durchführung mussten Lenin und Trotzki die Aktion verteidigen und verurteilten die Beschwerden der Menschewiki und der Zweiten Internationale scharf.
Trotzki verteidigte das Vorgehen der Bolschewiki unmittelbar nach den Ereignissen. Er formulierte seine Verteidigung jedoch anhand von Prinzipien, die seiner Meinung nach beachtet werden mussten, denen Stalin und Ordschonikidse jedoch, wie er später zugab, nicht im Geringsten folgten:
„Die Anerkennung des Rechtes auf Selbstbestimmung von Seiten eines Arbeiterstaates ist zugleich auch eine Anerkennung dessen, dass die revolutionäre Gewalt kein allmächtiger historischer Faktor ist. Die Sowjetrepublik beabsichtigt keinesfalls, die revolutionären Bemühungen des Proletariats anderer Länder durch ihre bewaffnete Macht zu ersetzen. Die Eroberung der Macht durch dasselbe muss aus seiner eigenen politischen Erfahrung herauswachsen. Das bedeutet nicht, dass die revolutionären Anstrengungen der Werktätigen, meinetwegen in demselben Georgien, keine bewaffnete Unterstützung von außen her finden könnten. Es ist nur notwendig, dass diese Unterstützung in einem solchen Moment eintritt, da das Bedürfnis nach ihr vorbereitet ist durch die vorhergehende Entwicklung und herangereift ist in dem Bewusstsein der revolutionären Avantgarde, die die Sympathie der Mehrheit der Werktätigen besitzt. Das sind Fragen der revolutionären Strategie, nicht aber des formal demokratischen Rituals.“[lxxxv]
Nationale Frage in Asien
Zentralasien und Sibirien waren Kolonialbesitz des Zarismus und der russischen imperialistischen Bourgeoisie. Ab den 1890er Jahren förderte die Regierung eine massive Kolonisierung. Nomadische oder halbnomadische Völker wie die Kasach:innen, Kalmück:innen und Baschkir:innen fanden ihre besten Weideflächen von russischen Bäuer:innen besetzt und von Kosakentruppen bewacht vor. Gegen diese Situation kam es 1916 zu einem großen Aufstand der Kasach:innen. Obwohl viele dieser Nomadenvölker noch keine oder nur eine geringe bürgerliche Klassenspaltung und damit auch keine Arbeiter:innenklasse hervorgebracht hatten, verpflichteten sich die Bolschewiki auch ihnen gegenüber, das Selbstbestimmungsrecht anzuerkennen. Das ABC des Kommunismus (der offizielle Kommentar zum Programm der Kommunistischen Partei Russlands) stellt das Problem wie folgt dar:
„Was soll mit den Nationen geschehen, die nicht nur kein Proletariat, sondern auch keine Bourgeoisie besitzen oder wo sie erst im Entstehen begriffen ist? Nehmen wir z. B. unsere Tungusen, Kalmücken, Burjaten, viele Kolonialvölker. Was soll getan werden, wenn diese Nationen z. B. die volle Trennung von den kulturell höherstehenden Nationen anstreben werden oder von Nationen, die bereits den Sozialismus verwirklicht haben? Wird dies nicht eine Stärkung der Barbarei auf Kosten der Zivilisation bedeuten? (…)
Das Proletariat, das nicht die Absicht hat, die Kolonien auszurauben, kann die ihm nötigen Rohstoffe von den Kolonien im Wege des Warenaustausches bekommen, indem es den Einheimischen überläßt, im Innern ihr Leben nach ihrem eigenem Willen zu gestalten. Um auf diese Weise mit allen Arten der nationalen Unterdrückung und Ungleichheit aufzuräumen, stellt die Kommunistische Partei die Forderung nach Selbstbestimmungsrecht der Nationen auf.“[lxxxvi]
Anfangs verbündeten sich die Bolschewiki, zumindest in den besiedelteren Regionen Zentralasiens, wo immer möglich mit der nationalistischen Intelligenz, mit reformerischen und modernisierenden Kräften. Viele von ihnen waren Kleinbürger:innen oder sogar Bourgeois, einige waren reformorientierte Islamist:innen, andere standen unter dem Einfluss pantürkischer oder panmongolischer Ideologien. Zentralasien und Sibirien wurden ebenso wie die Ukraine in den Bürgerkrieg hineingezogen.
So kam es zu zahlreichen groß angelegten und schnellen Manövern der roten und weißen Truppen in der offenen Steppe und zu entsprechenden Machtwechseln, die wenig Zeit ließen, um die Wünsche der Nationalitäten zu berücksichtigen. Die von der Roten Armee eingerichteten „Sowjets“ waren eher formaler Natur.
Schlimmer noch, sie wurden oft von den russischen Kolonist:innen dominiert, die sich weiterhin im Krieg mit den einheimischen Völkern befanden. Bolschewistische Dekrete verboten die Fortsetzung der Besiedlung und die Beschlagnahme von Weideland, aber es war schwierig, vergangenes Unrecht rückgängig zu machen, und in den späten 1920er und 1930er Jahren begann die „Kolonisierung“ von Neuem.
Ähnlich verhielt es sich mit den „nationalen“ Republiken und autonomen Regionen. Sie wurden mit einer Schnelligkeit gegründet, föderiert und sogar wieder aufgelöst, die ihre flachen sozialen und nationalen Wurzeln deutlich machte. Dies ist nicht verwunderlich, da die meisten Völker, die ethnischen und sprachlichen Gruppen Ostrusslands und Zentralasiens, noch nicht das Stadium eines massiven Nationalbewusstseins erreicht hatten. Es gab jedoch einige Ausnahmen.
Die Tatar:innen der unteren Wolga hatten eine kaufmännische Bourgeoisie, deren Führung sich schnell als den Bolschewiki feindlich gesinnt erwies. Dies führte zu verschiedenen Interventionen und einer Neuordnung der autonomen Regionen und Republiken mit anderen Minderheiten (z. B. den Baschkir:innen) von oben, um die Tatar:innen zu „kontrollieren“. Stalins Nationalitätenkommissariat nutzte diese administrativen Maßnahmen, um die ethnischen Gruppen zu fördern, die am formbarsten waren. Eine ähnliche Politik der Zersplitterung wurde gegen die mongolischen Völker in den chinesischen Grenzgebieten betrieben. Dies hinterließ ein Erbe des Misstrauens zwischen den größeren Völkern wie z. B. bei den Tatar:innen, das durch die Unterdrückung in den folgenden Jahrzehnten noch verschärft wurde.
In Südzentralasien stellten die sesshaften Bevölkerungsgruppen in Chiwa (Xiva; Usbekistan), Buchara (Buxoro; Usbekistan)und Turkestan ein weiteres Problem dar, nämlich den Einfluss des pantürkischen „Nationalismus“ und des Islam. Die Landbesitzer und Mullahs bildeten eine besitzende Klasse, die dem Kommunismus äußerst feindlich gesinnt war. Doch die russische Besiedlung führte dazu, dass in einer Reihe von Städten Sowjets existierten und sogar die Macht ergriffen. Dies führte Mitte 1918 zur Gründung einer autonomen sozialistischen Sowjetrepublik Turkestan.
Aber auch diese lokalen bolschewistischen Regime waren fast ausschließlich in der städtischen russischen Siedler:innenbevölkerung verwurzelt. Schließlich war es die Rote Armee, die die Khans (Chans) und Emirs der zentralasiatischen Staaten stürzte. Diese „erzwungene Sowjetisierung“ war, unabhängig von ihrer Rechtfertigung im Bürgerkrieg, kein Leitbild für Marxist:innen bei der Formulierung einer revolutionären Politik für Nationalitäten, selbst unter rückständigen Völkern. Die Ansätze zur kritischen Bewertung und Problematisierung dieser gesamten Politik waren kurzlebig und wurden schließlich mit der Stalinisierung vollständig zunichtegemacht.
Zentralisation und Föderation
Die Probleme der nationalen Frage in der Sowjetunion wurden zwar von den Bolschewiki unter Lenin angegangen und stellen ein wichtiges Arsenal auch für Lösungen dar, sie waren aber, wie oben gesehen, auch Austragungsort massiver innerer Gegensätze mit den ultralinken Kommunist:innen, ebenso wie mit der entstehenden Bürokratie und der damit einhergehenden Wiederbelebung und Stärkung des großrussischen Chauvinismus. Die Stärke Lenins bestand dabei nicht nur in der klaren Haltung und konsequenten Zurückweisung aller dieser Tendenzen. Er war auch bereit, tradierte marxistische Positionen im Lichte der Erfahrung neu zu überprüfen und zu relativieren, was sich in der Diskussion um die Sowjetverfassung zeigte. Vor dem Oktober befürwortete Lenin in Anlehnung an Marx und Engels einen einheitlichen und zentralisierten Staat:
„Die Marxisten stehen selbstverständlich der Föderation und der Dezentralisierung feindlich gegenüber, und zwar aus dem einfachen Grunde, weil der Kapitalismus für seine Entwicklung möglichst große und möglichst zentralisierte Staaten verlangt. Unter sonst gleichbleibenden Umständen wird das klassenbewußte Proletariat stets für einen größeren Staat eintreten. (…)
Aber solange und soweit verschiedene Nationen einen Einheitsstaat bilden, werden die Marxisten unter keinen Umständen das föderative Prinzip oder die Dezentralisierung propagieren. (…)
Es wäre jedoch unverzeihlich zu vergessen, daß wir, wenn wir den Zentralismus verfechten, ausschließlich den demokratischen Zentralismus verfechten. (…)
Der demokratische Zentralismus schließt die lokale Selbstverwaltung mit einer Autonomie für Gebiete, die sich durch besondere Wirtschafts- und Lebensbedingungen, durch eine besondere nationale Zusammensetzung der Bevölkerung usw. auszeichnen, keineswegs aus, er verlangt im Gegenteil notwendigerweise sowohl das eine als auch das andere.“[lxxxvii]
Doch nachdem das bolschewistische Regime im Januar 1918 an die Macht gekommen war, proklamierte es „eine Föderation von Sowjetrepubliken, gegründet auf dem Prinzip der freien Vereinigung der Völker Russlands“. Im Juli 1918 erklärte die erste Verfassung Russland zu einer Föderation. Die Arbeiter:innen und Bäuer:innen konnten, wo immer sie die Macht hatten, durch ihre Sowjetorganisationen ihren Beitritt dazu erklären.
Die Bedingungen eines langen und blutigen Bürgerkriegs, der über die weiten Gebiete des ehemaligen Zarenreichs hinweg wogte, waren jedoch nicht gerade geeignet, um die Ideale einer freiwilligen Föderation oder Trennung zu verwirklichen. Unabhängige Staaten, die von lokalen Eliten gebildet wurden, schwankten zwischen den Weißen und den Roten, wobei sie die Ersteren wegen ihres großrussischen Chauvinismus und Imperialismus und die Letzteren wegen ihres sozialen Radikalismus fürchteten.
Der Unionsvertrag von 1922 wurde als Ergebnis eines erbitterten Kampfes zwischen Lenin und Stalin um die nationale Frage verabschiedet. Zunächst wollte Stalin lediglich, dass alle nichtrussischen Republiken, die Ukraine, eine neue kaukasische Föderation sowie die Sowjetrepubliken Zentralasiens als autonome Republiken der Russischen Föderation beigetreten wären. Dies hätte einen erheblichen Verlust an „Unabhängigkeit“ bedeutet.
Bislang waren diese Staaten durch formal gleichberechtigte Verträge an die Föderation gebunden. Dieses „Autonomisierungsprojekt“ stieß insbesondere bei den ukrainischen und georgischen Führer:innen auf erbitterten Widerstand. Auch Lenin lehnte es entschieden ab. Er schlug stattdessen eine neue Föderation gleichberechtigter Republiken vor, mit einer von der Russischen Föderation getrennten und ihr übergeordneten Regierung und einem eigenen Sowjetkongress.
Stalin stimmte Lenins Plan zwar formal zu und nannte das neue Gebilde „Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken”, doch der Inhalt blieb im Wesentlichen derselbe. Lenin, der praktisch auf dem Sterbebett lag, startete einen weiteren Kampf. Seine Worte sollten Marxist:innen warnen, wie weit das Werk des Kommissariats für Nationalitäten unter Stalin (1917–1924) von einem revolutionären Modell entfernt war:
„Es scheint, ich habe mich vor den Arbeitern Rußlands sehr schuldig gemacht, weil ich mich nicht mit genügender Energie und Schärfe in die ominöse Frage der Autonomisierung eingemischt habe, die offiziell, glaube ich, als Frage der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken bezeichnet wird.“[lxxxviii]
In mehreren Aufzeichnungen zur Frage der Sowjetunion kritisiert Lenin scharf das massive Vordringen des großrussischen Chauvinismus, der aus der Freiwilligkeit der Föderation eine Farce macht. „Unter diesen Umständen ist es ganz natürlich, daß sich die ‚Freiheit des Austritts aus der Union‘, mit der wir uns rechtfertigen, als ein wertloser Fetzen Papier herausstellen wird, der völlig ungeeignet ist, die nichtrussischen Einwohner Rußlands vor der Invasion jenes echten Russen zu schützen, des großrussischen Chauvinisten, ja im Grunde Schurken und Gewalttäters, wie es der typische russische Bürokrat ist.“[lxxxix]
Lenin versuchte, das empfindliche Bündnis mit den Nationalitäten zu schützen, indem er gegen die großrussische Tyrannei und Bürokratie kämpfte. Sein Kampf war jedoch leider erfolglos. Der XII. Kongress der RKP(B) im April 1923 debattierte die nationale Frage nach dem Georgien-Zwischenfall und im Zusammenhang mit der anhaltenden Diskussion über die Union und die Verfassung erneut.
Christian Rakowski, damals Vorsitzender des Ukrainischen Rates der Volkskommissare, griff den wachsenden Bürokratismus des Parteiapparats an und brachte ihn mit der zentralistischen Schikanenpolitik Stalins in der Frage der zweiten Ebene der Allunionssowjets, der Nationalitäten, in Verbindung. Stalin war entschlossen, der Russischen Föderation in diesem Gremium eine überwältigende Mehrheit der Stimmen zuzuschreiben. Die Ukraine sollte vier Stimmen erhalten, während Russland zwischen 64 und 70 Stimmen bekommen sollte.
Rakowski griff die zentrale Bürokratie an und sagte: „Insbesondere in der nationalen Frage lassen sich unsere Parteigenossen nicht von einer proletarischen Parteipsychologie leiten, sondern von etwas, das man, gelinde gesagt, als engstirnige exekutive Bürokratiepsychologie bezeichnen könnte. Natürlich ist es mühsam, zwanzig Republiken zu verwalten. Wie bequem wäre es, wenn alle vereint wären und man nur einen Knopf drücken müsste, um das ganze Land zu verwalten! (…) Wir müssen neun Zehntel der Macht der Allunionskommissariate wegnehmen und sie den nationalen Republiken übergeben.“[xc]
Die Verfassung der UdSSR von 1924 war eine der ersten Früchte der thermidorianischen Reaktion. Tatsächlich hatten sich die Thermidorianer:innen um Stalin (Dzierżyński, Ordschonikidse) in der Bekämpfung des „Sozialnationalismus“ und des „nationalen Liberalismus“ ihre Sporen verdient. Der spätere Linksoppositionelle Christian Rakowski war voll in diesen Kampf involviert, aber Trotzki versäumte es, die Sache des gesundheitlich schwer angeschlagenen Lenin auf dem Parteitag aufzunehmen, obwohl er dazu aufgefordert worden war. Stalins Politik in der nationalen Frage bestand darin, jegliche politische Unabhängigkeit in der Praxis zu verweigern und die zentralisierte Bürokratie der Partei zu nutzen, um die Republiken und autonomen Regionen vollständig zu dominieren. Alle Gegner:innen wurden unter dem Vorwurf nationalistischer Abweichungen „herausgesäubert“.
Gleichzeitig verfolgte Stalin jedoch eine Politik der kulturellen Nationenbildung, der Korenisazija (Nativisierung, Einwurzelung). In vielen ihrer formalen Ziele griff sie Lenins Anliegen auf, die Ergebnisse der Bürgerkriegsphase zu korrigieren, in der großrussische Bolschewiki überall dort die Macht übernahmen, wo die Rote Armee siegreich war. Für die einheimische Bevölkerung sah dies deshalb wie ein erneuter Triumph der russischen Kolonisator:innen aus.
Die Korenisazija umfasste die Förderung der lokalen Sprachen als Staats- und Verwaltungssprachen, Alphabetisierungskampagnen, die Entwicklung neuer Schriftsprachen aus einem oder mehreren Dialekten sowie die Förderung von Kunst und Volkskultur.
Gleichzeitig war es in den 1920er Jahren charakteristisch, dass die Führungspositionen der republikanischen Parteien eher mit Angehörigen der jeweiligen Volksgruppen als mit Großruss:innen besetzt wurden. An sich waren die meisten dieser Maßnahmen sehr fortschrittlich, auch wenn sie von einem positiven Ethos der Nationsbildung begleitet waren, das Lenin fremd blieb.
Unter den Bedingungen zunehmender Ernennungen durch die zentrale Bürokratie und politischer Repression (einschließlich der Auflösung von Republiken wie Turkestan und der Zusammenlegung anderer) führten diese Maßnahmen ironischer Weise zu einer Erfüllung des austromarxistischen Programms der national-kulturellen Autonomie. Als Politik förderte sie die Entwicklung (bestimmter) nationaler Einheiten. In einigen Fällen schuf sie diese sogar. Gleichzeitig verneinte sie das Recht auf politische Selbstbestimmung, geschweige denn das auf Sezession. Damit gelang es nicht, das Gefühl der nationalen Einschränkung von Rechten und letztlich der Unterdrückung zu beseitigen.
Das Manövrieren, Neudefinieren, Spalten und Vereinigen von Nationen „von oben“ schürte nationale Ressentiments, insbesondere als von Mitte der 1930er bis Mitte der 1950er Jahre eine Welle von wütendem großrussischen Chauvinismus entfesselt wurde. Nicht zuletzt gab es die Unterdrückung des echten proletarischen Internationalismus als positives Ideal, das nur auf der Grundlage der sowjetischen Demokratie möglich gewesen wäre. Daher konnte Stalins Politik niemals hoffen, die nationale Frage zu lösen.
Die oben beschriebene Politik dauerte bis 1933/34 und war im Wesentlichen die nationale des sowjetischen Thermidors (der Periode der Konsolidierung von Stalins Macht). Danach wurde eine neue, härtere Politik eingeführt, die des sowjetischen Bonapartismus. Es war eine der offenen nationalen Unterdrückung, die die UdSSR wieder in den Status eines „Völkergefängnisses“ zurückversetzte.
Die schärfste Ausprägung der neuen Politik, der „Kampf gegen den Nationalismus“, war zuerst und am härtesten in der Ukraine zu spüren. Sie begann bereits 1930 mit Schauprozessen gegen ukrainische „Nationalist:innen“. Der ukrainische Nationalismus wurde zur „Hauptbedrohung“, zur „Speerspitze der kapitalistischen Restauration“ erklärt. 1933/34 wurden in einer massiven Säuberungsaktion die meisten ukrainischen Parteiführer:innen „entfernt“ und durch Moskauer Bürokrat:innen ersetzt. Diese Politik breitete sich rasch auf die anderen Republiken und Nationalitäten aus. In Tadschikistan wurde die gesamte Führung entfernt, und die durch die vorherige Politik geschaffene neue nationale Intelligenz wurde verfolgt und aufgerieben.
Eine als sowjetischer Patriotismus getarnte Verherrlichung der großrussischen Kultur und Geschichte triumphierte. Das großrussische Volk wurde zum „älteren Bruder und Führer“ der anderen Völker erklärt, und die nomadischen Bevölkerungsgruppen Zentralasiens wurden zwangsweise sesshaft gemacht, was zur Wiederaufnahme des Guerillakriegs und zu einem Bevölkerungsrückgang von 20 % unter den Kasach:innen führte, das mit über einer Million Haushalten in den 1920er Jahren zahlreichste Nomadenvolk. Kasachstan wurde mit Russ:innen und Ukrainer:innen besiedelt.
Die Großen Säuberungen von 1936–38 bedeuteten eine weitere Verschärfung der nationalen Unterdrückung. Unter den Opfern waren zahlreiche sogenannte „Trotzkist:innen-Nationalist:innen“. Die Säuberungen eliminierten den größten Teil der nach 1923 aufgebauten „alten“ stalinistischen Elite, einschließlich der Parteiführung und der während der gesamten Zeit der Korenisazija aufgebauten kulturellen Intelligenz.
Es fand ein kultureller Völkermord an den Völkern statt, die durch Stalins frühere Politik zum nationalen Leben „erweckt“ worden waren. Diese Verbrechen sollten nach 1989 schwer auf dem Arbeiter:innenstaat lasten und der nationalistischen Restauration des Kapitalismus eine mächtige politische Waffe liefern. Angesichts dieser explosiven Entladung brutaler nationaler Unterdrückung ist es nicht verwunderlich, dass die nationale Frage einer der Schlüsselfaktoren für die Sprengung der UdSSR war.
Fazit
Im Artikel haben wir versucht, die Entwicklung der marxistischen Position zur nationalen Frage bei Marx und Engels und dann bei Lenin nachzuzeichnen. Wir können uns hier nur dem Urteil Trotzkis über den Beitrag Lenins anschließen:
„Wie sich auch die weiteren Schicksale der Sowjetunion gestalten mögen – und sie ist noch sehr weit vom ruhigen Hafen entfernt –, Lenins Politik in der nationalen Frage wird für immer in das eherne Inventar der Menschheit eingehen.“[xci]
Wie wir gesehen haben, stellt die nationale Frage ein Kernproblem der imperialistischen Epoche, auch in ihrer Verbindung zum Krieg, dar.
Dabei begegnen wir, nicht nur unter Marxist:innen, zwei Hauptfehlern: Entweder der nationalen oder nationalistischen Anpassung oder dem falschen Schluss, dass mechanisch aus der historischen Überholtheit des Nationalstaates als einem Hindernis für die Entwicklung der Produktkräfte abgeleitet wird, dass damit auch der Kampf gegen nationale Unterdrückung seine geschichtliche Berechtigung verloren hätte.
In der imperialistischen Epoche stellt jedoch das Verhältnis zwischen Weltmarkt und den globalen Ordnung beherrschenden Großmächten für unterdrückte Nationen ein wesentliches Verhältnis der Ausbeutungsordnung dar. Ohne dieses wäre die ständige Aneignung von Extraprofiten unmöglich. Daher ist für das Verständnis der globalen Ordnung, der internationalen Konstellation und der Weltpolitik wichtig, dass es in den meisten Staaten der Erde von zentraler Bedeutung ist, zwischen unterdrückenden und unterdrückten Nationen zu unterscheiden.
Nationale Befreiung und das Selbstbestimmungsrecht der Nationen sind dabei für Marxist:innen – wie jede andere demokratische Forderung – zwar kein Ziel an sich, wohl aber ein integraler, unerlässlicher Bestandteil der Strategie und des Programms der permanenten Revolution.
Die Verteidigung des Selbstbestimmungsrechts und der Kampf darum stellen dabei ein entscheidendes Mittel dar, um die Grundlagen für die zukünftige Verschmelzung der Nationen zu legen – nicht um Nationen selbst zu verewigen. Das Eintreten für das nationale Selbstbestimmungsrecht hat daher nichts mit der Verteidigung des Nationalismus zu tun. Im Gegenteil: Es legt vielmehr eine Grundlage für den realen und möglichst umfassenden gemeinsamen Klassenkampf von Arbeiter:innen der unterdrückenden und unterdrückten Nationen und damit für die sozialistische Weltrevolution.
Endnoten
[i] Zu vertiefender Lektüre verweisen wir an dieser Stelle auf folgende Texte: Liga für eine revolutionär-kommunistische Internationale (LRKI), Nationalismus, Nationalstaat und nationale Befreiung, in: Revolutionärer Marxismus 45, S. 93–159, Berlin/Wien 2013; Arbeitsgruppe Marxismus (AGM), Marxismus 23, Nationale Frage und marxistische Theorie, Teil 1: Die „Klassiker“, Wien 2003; Arbeitsgruppe Marxismus (AGM), Marxismus 24, Nationale Frage und marxistische Theorie, Teil 2: Die sowjetische Erfahrung, Wien 2004
[ii] Zu den Forderungen am Beginn der Märzrevolution siehe: Marx/Engels, Forderungen der Kommunistischen Partei in Deutschland, in: MEW 5, Berlin/DDR 1973, S. 3–5
[iii] Im Manifest der Kommunistischen Partei leiten Marx und Engels 10 zentrale Forderungen mit einer Formulierung zum Charakter von Übergangsmaßregeln des zur Herrschaft gekommenen Proletariats ein, einer Form von Arbeiter:innenregierung:
„Das Proletariat wird seine politische Herrschaft dazu benutzen, der Bourgeoisie nach und nach alles Kapital zu entreißen, alle Produktionsinstrumente in den Händen des Staats, d. h. des als herrschende Klasse organisierten Proletariats, zu zentralisieren und die Masse der Produktionskräfte möglichst rasch zu vermehren.
Es kann dies natürlich zunächst nur geschehen vermittelst despotischer Eingriffe in das Eigentumsrecht und in die bürgerlichen Produktionsverhältnisse, durch Maßregeln also, die ökonomisch unzureichend und unhaltbar erscheinen, die aber im Lauf der Bewegung über sich selbst hinaustreiben und als Mittel zur Umwälzung der ganzen Produktionsweise unvermeidlich sind. Diese Maßregeln werden natürlich je nach den verschiedenen Ländern verschieden sein. (Marx/Engels, Manifest der Kommunistischen Partei, MEW 4, Berlin/DDR 1959, S. 481)
[iv] Hegel, Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, Werk in 12 Bänden, Band 12, Frankfurt/Main 1982
[v] Rosdolsky, Zur nationalen Frage. Friedrich Engels und das Problem der „geschichtslosen“ Völker, Olle & Wolter, Berlin/West 1979
[vi] Rosdolsky verweist auch zu Recht darauf, dass Marx und Engels in diesem Zusammenhang die Agrarfrage in Österreich-Ungarn nicht oder nur zuzureichend behandeln.
[vii] Marx/Engels, Manifest der Kommunistischen Partei, a. a. O., S. 464
[viii] Ebenda
[ix] Ebenda, S. 466
[x] Ebenda, S. 466/467
[xi] Marx, Englische Greueltaten in China, in: MEW 12, Berlin/DDR 1961, S. 164
[xii] Marx, Instruktionen für die Delegierten des Zentralrats, MEW 16, Berlin/DDR 1973, S. 198/199
[xiii] Diese Argumentation entwickelt Marx in einer Rede Anfang 1867, siehe: Marx, Rede auf dem Polenmeeting in London im 22. Januar 1867, MEW 16, a. a. O., S. 200–204
[xiv] Marx, Brief an Engels, 2. November 1867, MEW 31, Berlin/DDR 1974, S. 376
[xv] Marx, Brief an Sigfrid Meyer und August Vogt, 9. April 1870, MEW 32, Berlin/DDR 1974, S. 668 f.
[xvi] Marx, Brief an Engels vom 10. Dezember 1869, MEW 32, a. a. O., S. 415
[xvii] Marx, Konfidentielle Mitteilung, MEW 16, a. a. O., S. 417
[xviii] Engels, Brief an Ion Nadejde, 4. Januar 1888, MEW 37, Berlin/DDR 1967, S. 5
[xix] Marx, Die britische Herrschaft in Indien, in: MEW 9, Berlin/DDR 1975, S. 133
[xx] Ebenda, S. 129
[xxi] Formen, die der kapitalistischen Produktion vorhergehen, in: Marx: Grundrisse der politischen Ökonomie, MEW 42, Berlin/DDR 1983, S. 383–420
[xxii] Marx, Brief an V. I. Sassulitisch, Dritter Entwurf, MEW 19, Berlin/DDR 1974, S. 402
[xxiii] Marx, Das Kapital, Band1, MEW 23, Berlin/DDR 1971, S. 583–588
[xxiv] Ebenda, S. 584
[xxv] Martin Suchanek, Marxistische Imperialismustheorie: Bestandsaufnahme und Aktualisierung, in: Revolutionärer Marxismus 53, Berlin 2020, S. 11–128
[xxvi] Zur genaueren Darstellung vergleiche: Eric Wegner, Die Diskusion in der Zweiten Internationale in: AGM (Hrsg.), Nationale Frage und Marxistische Theorie, Teil 1: Die „Klassiker“, Marxismus 23, Wien 2003
[xxvii] Kautsky, Brief an Victor Adler vom 12. November 1896, Zitiert nach: Wegner, a. a. O., S. 109
[xxviii] Lenin, Die nationale Frage in unserem Programm, LW 6, Berlin/DDR 1956, S. 452–461
[xxix] Ebenda, S. 452
[xxx] Ebenda, S. 460
[xxxi] Im frühen Bolschewismus beinhaltete dies die Errichtung der demokratischen Diktatur der Arbeiter:innen und Bäuer:innen in der demokratischen Revolution, in der russischen Revolution brach Lenin mit dieser Vorstellung und formulierte in den Aprilthesen 1917 die Notwendigkeit von der sozialistischen Umwälzung, der Errichtung der Diktatur des Proletariats, gestützt auf die Bäuer:innenschaft. Unabhängig davon ist aber in beiden Fällen nach Lenins Auffassung eine zentralistische, politisch klare und einheitliche Partei notwendig, ohne die eine Revolution nie erfolgreich sein kann. Zur Entwicklung der bolschewistischen Konzeption siehe RM 49, Berlin 2017.
[xxxii] Karl Renner, Das nationale Problem in der Verwaltung, https://www.marxists.org/deutsch/archiv/renner/1907/10/verwaltung.htm
[xxxiii] Karl Renner, Nationale Minoritätsgemeinden (1908), https://www.marxists.org/deutsch/archiv/renner/1908/05/gemeinden.htm
[xxxiv] https://www.marxists.org/deutsch/archiv/bauer/1907/nationalitaet/01-charakter.html
[xxxv] J. W. Stalin, Marxismus und Nationale Frage, in: Stalin, Werke, Bd. 2, Berlin/DDR 1952, S. 266–333. Zweifellos stellt das einen der wenige Beiträge Stalins zu Fragen der marxistischen Theorie dar und eine über weite Teile richtige Polemik gegen den Austromarxismus. Allerdings enthält die Schrift auch etliche Schwächen und eine zu starre Fassung des Nationalitätenbegriffs. Zur Kritik siehe u. a.: Liga für eine revolutionär-kommunistische Internationale, Nationalismus, Nationalstaat und nationale Befreiung, in: Revolutionärer Marxismus 45, S. 93–159, Berlin/Wien 2013
[xxxvi] Lenin, Kritische Bemerkungen zur nationalen Frage, LW 20, Berlin/DDR 1961, S. 7 f.
[xxxvii] Ebenda, S. 8 f.
[xxxviii] Ebenda, S. 10
[xxxix] Ebenda, S. 21 f.
[xl] Ebenda, S. 22
[xli] Lenin, Ist eine obligatorische Staatssprache notwendig?, LW 20, a. a. O., S. 61
[xlii] Lenin, Kritische Bemerkungen zur nationalen Frage, a. a. O., S. 20
[xliii] Lenin, Über das Selbstbestimmungsrecht der Nationen, LW 20, a. a. O., S. 395–461
[xliv] Ebenda, S. 414 f.
[xlv] Ebenda, S. 415
[xlvi] Ebenda, S. 415
[xlvii] Lenin, Sozialismus und Krieg, LW 21, Berlin/DDR 1970, S. 310 f.
[xlviii] Trotzki, Die permanente Revolution, Vorwort zur deutschen Ausgabe, S. 7, in: Ders., Ergebnisse und Perspektiven – Die permanente Revolution, Frankfurt/M. 1971
[xlix] Lenin, Sozialismus und Krieg, a. a. O., S. 301 f.
[l] Ebenda, S. 318
[li] Luxemburg, Entwurf zu den Junius-Thesen, in: Gesammelte Werke, Bd. 4 , Berlin/DDR 1987, S. 44
[lii] Ebenda, S. 44
[liii] Georgy Pyatakov, Yevgenia Bosch, Nikolai Bukharin, Theses on the Right of Nations to Self-Determination, in: Lenin’s Struggle for a Revolutionary International, New York – London – Sydney, 1984, S. 363/364; eigene Übersetzung
[liv] Lenin, Die sozialistische Revolution und das Selbstbestimmungsrecht der Nationen, LW 22, Berlin/DDR 1972, S. 145
[lv] Ebenda, S. 146 f.
[lvi] Lenin, Über die aufkommende Richtung des „imperialistischen Ökonomismus“, LW 23, Berlin/DDR 1972, S. 1
[lvii] Redaktion der „Gazeta Robotnicza“, Thesen über Imperialismus und nationale Unterdrückung, zitiert nach: Lenin, Die Ergebnisse der Diskussion über die Selbstbestimmung, LW 22, a. a. O., S. 337
[lviii] Ebenda, S. 338
[lix] Ebenda, S. 339
[lx] Ebenda
[lxi] Lenin, Sozialismus und Krieg, a. a. O., S. 305
[lxii] Trotzki, Das Übergangsprogramm, Essen 1997, S. 87
[lxiii] Lenin, Die Ergebnisse der Diskussion über die Selbstbestimmung, a. a. O., S. 358
[lxiv] Ebenda, S. 359
[lxv] Karl Radek, The End of the Song, in: Lenin’s Struggle for a Revolutionary International, a. a. O., S. 375; eigene Übersetzung
[lxvi] Trotsky, Lessons of the Events in Dublin, in: Lenin’s Struggle for a Revolutionary International, a. a. O., S. 372; eigene Übersetzung
[lxvii] Lenin, Die Ergebnisse der Diskussion über die Selbstbestimmung, a. a. O., S. 363
[lxviii] Ebenda, S. 366
[lxix] Lenin, Die sozialistische Revolution und das Selbstbestimmungsrecht der Nationen, a. a. O., S. 147
[lxx] Marx, Randglossen zum Programm der deutschen Arbeiterpartei [Kritik des Gothaer Programms], MEW 19, a. a. O., S. 28
[lxxi] Lenin, Über eine Karikatur auf den Marxismus und über den „imperialistischen Ökonomismus“, LW 23, a. a. O., S. 48
[lxxii] Ebenda
[lxxiii] Ebenda, S. 49
[lxxiv] Ebenda
[lxxv] Ebenda
[lxxvi] Lenin, Werden die Bolschewiki die Staatsmacht behaupten?, LW 26, Berlin/DDR 1970, S. 81 f.
[lxxvii] Lenin, Zur Revision des Parteiprogramms, LW 26, a. a. O., S. 163
[lxxviii] Ausführlich zur Politik nach der Oktoberrevolution siehe: Arbeitsgruppe Marxismus (Hrsg.), National Frage und marxistische Theorie, Teil 2: Die sowjetische Erfahrung, a. a. O.
[lxxix] Luxemburg, Zur russischen Revolution, Gesammelte Werke, Band 4, a. a. O, S. 350 f.
[lxxx] Lenin, Rede auf dem Ersten Gesamtrussischen Kongreß der Kriegsflotte 22. November (5. Dezember) 1917, LW 26, a. a. O., S. 341
[lxxxi] Lenin, Manifest an das ukrainische Volk mit ultimativen Forderungen an die ukrainische Rada, LW 26, a. a. O., S. 358
[lxxxii] Zitiert in Z. Kowalewksi, For the Independence of Soviet Ukraine, in: International Marxist Review Vol 4, No 2, 1989, p 96; eigene Übersetzung
[lxxxiii] Lenin, VIII. Parteitag der KPR(B), 18.–23. März 1919, Bericht über das Parteiprogramm, 19. März, LW 29, Berlin/DDR 1971, S. 155
[lxxxiv] Ebenda, S. 158 f.
[lxxxv] Trotzki, Das Recht der nationalen Selbstbestimmung und die proletarische Revolution (1922), https://www.marxists.org/deutsch/archiv/trotzki/1922/xx/selbstb.htm
[lxxxvi] Bucharin/Preobraschenskij, Das ABC des Kommunismus, Manesse Verlag Zürich, o. J., Nachdruck der deutschsprachigen Erstausgabe Wien 1920, S. 351
[lxxxvii] Lenin, Kritische Bemerkungen zur nationalen Frage, a. a. O., S. 31 f.
[lxxxviii] Lenin, Zur Frage der Nationalitäten oder der „Autonomisierung“, LW 36, Berlin/DDR 1971, S. 590
[lxxxix] Ebenda, S. 591
[xc] Rakovsky, Speeches to the Twelfth Party Congress, in: Rakovsky, Selected Writings on Opposition in the USSR, 1923–30, London 1980, p 82–84; eigene Übersetzung
[xci]Trotzki, Geschichte der russischen Revolution, Band 2.2, Fischer Verlag, Frankfurt/Main 1982, S. 744




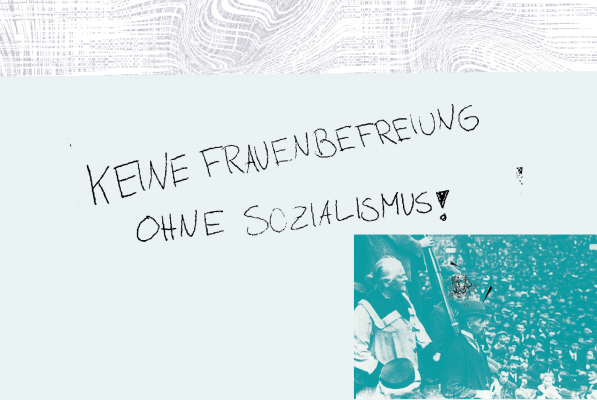

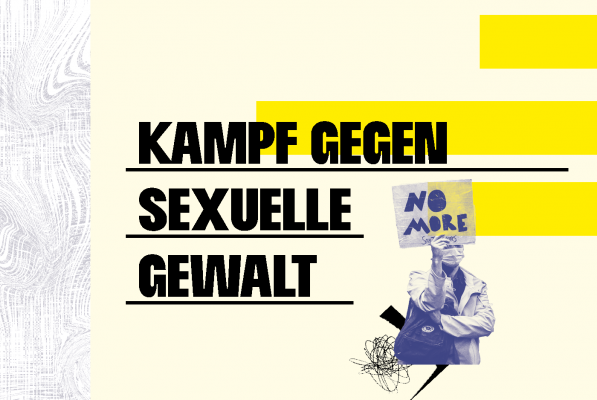


One thought on “Marxismus, nationale Frage und Imperialismus”