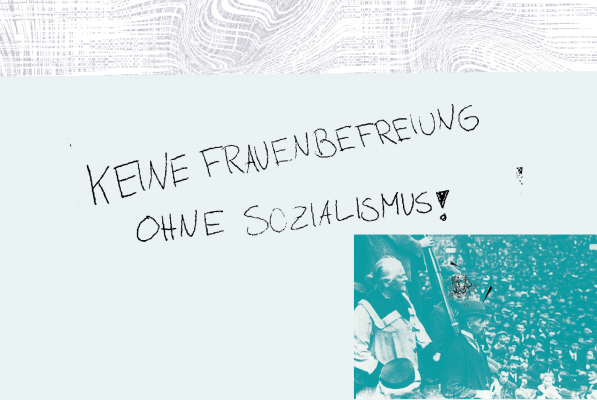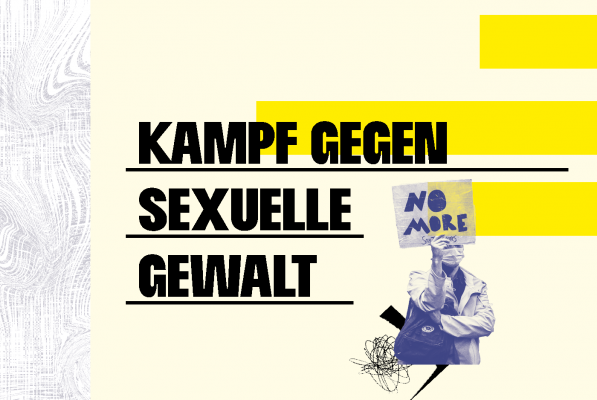Plan contra Markt

Ökonomie und Politik in der Übergangsperiode vom Kapitalismus zum Kommunismus
Liga für eine revolutionär-kommuistische Internationale, Revolutionärer Marxismus 19, Herbst/Winter 1996
Vorwort aus dem Jahr 1996
Diese Broschüre repräsentiert die kollektive Arbeit der LRKI während der letzten zwei Jahre an einem Thema von lebenswichtiger Bedeutung. Ungeachtet der ins Auge stechenden offensichtlichen Defizite des Wirkens der freien Marktwirtschaft vom afrikanischen Kontinent bis zu den städtischen Ghettos der USA befindet sich die Linke in der Frage der Ökonomie und Möglichkeit der sozialistischen Planwirtschaft in der Defensive.
Der Zusammenbruch der stalinistisch beherrschten Staaten seit 1989 ist nicht nur von denjenigen als katastrophale Niederlage empfunden worden, die in ihnen ‚real existierenden Sozialismus‘ sahen. Er hat auch jene Aktivisten politisch verwirrt, die, während sie gegen das politische Regime opponierten, in der Wirtschaftsmacht der Sowjetunion den Beweis für die Überlegenheit staatlicher Wirtschaftsplanung erblickten.
Der ökonomische Niedergang und schließlich der Paralyse der Ökonomien des ehemaligen Ostblocks hat nicht nur diese vorschnellen Hoffnungen enttäuscht, sondern viele dazu geführt, dem Ziel der Errichtung einer Planwirtschaft überhaupt den Rücken zuzukehren.
Zusätzlich verweisen Kritiker des Sozialismus darauf, daß öffentliches Eigentums und Verstaatlichung in kapitalistischen Gesellschaften nicht vermochten, Inflation und Massenarbeitslosigkeit abzuwenden. Viele Militante in der internationalen Arbeiterbewegung und unter der neuen Jugendgeneration sind von diesen Argumenten beeinflußt. Jene, die versuchen, den Kapitalismus durch eine Form von sozialistischer Gesellschaft zu ersetzen, sind in die Defensive gedrängt worden – politisch und ideologisch.
Tag für Tag beharrt die offizielle Propaganda darauf, daß alle, die versuchen, den Kapitalismus zu überwinden, eine Wirtschaftsordnung verteidigen würden, die zu Autoritarismus, gravierender Ineffizienz und Einschränkung der Wahlmöglichkeiten für die Konsumenten verdammt sei. Ein großer Teil der reformistischen und zentristischen Linken hat den Kern dieses Arguments akzeptiert. Sie sprechen sich nun für verschiedene Formen des ‚Marktsozialismus‘ aus, der dem Wesen der von den Befürwortern des ungezügelten freien Marktes erhobenen Sozialismuskritik nachgibt.
Zum Glück sind die Auswirkungen der Propagandamaschine der Anhänger des freien Marktes auf jene, die unter Auwirkungen ebendieser Marktgesetze zu leiden haben, nur begrenzt und keineswegs dauerhaft. Für eine wachsende Zahl sind die inhärenten Vorzüge des Markts über rationelle Wirtschaftsplanung überhaupt nicht leicht festzustellen. Selbst im Britannien gibt es – trotz 17 Jahren des Freimarktdogmas der Tories – wachsende Anzeichen, daß die Masse der Bevölkerung der Marktlogik gegenüber skeptisch ist.
In einer im September 1996 in The Guardian veröffentlichten Übersicht wurden die Beantworter gefragt, ob sie mit der Behauptung, „mehr sozialistische Planung sei der beste Weg, Britanniens Wirtschaftsprobleme zu lösen“, übereinstimmten oder nicht. 43% bejahten die Frage.
Die mächtigste bürgerliche Propagandamaschine kann angesichts Arbeitsplatzunsicherheit, massenhafter Jugendarbeitslosigkeit, Niedriglöhnen und negativ beschiedenem Wohnrecht zusammenbrechen. Dann kann das Argument siegen. Aber ein instinktives Verständnis, daß es eine Alternative zum Marktblödsinn geben muß, ist nicht genug.
Die revolutionäre Minderheit hat eine Verantwortung, die Vorhut um eine klare, zusammenhängende und wissenschaftliche Darlegung der politischen Ökonomie des Sozialismus herum zu sammeln, nicht als idealistische ‚Blaupause‘, die aus unserer Vorstellung geschaffen wurde, sondern wie sie aus den vorherrschenden Trends innerhalb des modernen Kapitalismus entsteht. Bei deren Entwicklung ist es nötig, die wirklichen Lehren aus der Geschichte, positive und negative, theoretische und programmatische, aus der Geschichte der Arbeiterstaaten mit einer herrschenden bürokratischen Kaste zu integrieren.
Diese Broschüre faßt die wesentlichen Komponenten einer solchen revolutionären Konzeption ökonomischer Planung zusammen. Beginnend mit einer kurzen Zusammenfassung des Vermächtnisses von Marx und Engels und der beschränkten Ausarbeitung ihrer Ideen durch die Theoretiker der Zweiten Internationale, behandelt sie anschließend das Experiment des jungen Sowjetstaats (UdSSR).
Die ersten zehn Jahre des Staats waren reich an praktischer und theoretischer Arbeit: von den anfänglichen Auffassungen der Entwicklung mithilfe der ‚Arbeiterkontrolle‘ über die oft utopischen Schemata der kriegskommunistischen Periode zu den großen Industrialisierungsdebatten der Neuen Ökonomischen Politik arbeiten wir die bleibenden theoretischen Fortschritte heraus, die im Konzept der ‚Übergangsperiode‘ zwischen der Ergreifung der Staatsmacht und der Eröffnung der ’sozialistischen‘ oder niederen Stufe des Kommunismus eingebettet sind.
Dieser Abschnitt endet mit der Systematisierung der polit-ökonomischen Konsequenzen, wenn dieser Übergang durch die von der stalinistischen Bürokratie durchgeführte Konterrevolution blockiert wird, nicht nur einschließlich des resultierenden Musters aufgeblähter Schwerindustrien, beschränktem Zugang zu Konsumgütern, stagnierender Landwirtschaft und entfremdeten Belegschaften, sondern auch der pro-marktwirtschaftlichen Versuche, diese Systeme wieder zu beleben.
Das zweite substantielle Element dieser Arbeit besteht aus einer Kritik der offenen wie versteckten Gegner der Planwirtschaft. Wir knacken die Argumente der Hauptrepräsentanten in der Zwischenkriegsdebatte über die Vernünftigkeit von Sozialismus – von Mises und Hayek gegen Lange und Taylor -, indem wir die abstrakte und ahistorische Methode ersterer und die unmarxistische und technokratische Sozialismusvision letzterer kritisieren. Die Ansichten zeitgenössischerer Autoren wie Alec Nove, Ota Sik und Ernest Mandel werden ebenfalls behandelt und einer Kritik unterzogen.
Der letzte Teil der Broschüre gibt eine positive genaue Ausführung – soweit so etwas möglich ist – der Haupteigenschaften des Übergangs zum Sozialismus, wenigstens in den industriell entwickelten kapitalistischen Ökonomien.
Jeder gesunde revolutionäre Arbeiterstaat wird dabei ebenso geleitet werden von der Freisetzung dessen, was rationell an den Methoden und Techniken des Kapitalismus ist, aus den sozialen Verhältnissen, in denen diese gefesselt sind, wie von theoretischen Verhaltensmaßregeln und Lehren, die aus den Erfahrungen der UdSSR und anderer degenerierter Arbeiterstaaten gezogen wurden.
Diese Arbeit ist natürlich nicht voraussetzungslos; sie ist durch die intellektuelle und politische Tradition geleitet, die von Leo Trotzki und der Internationalen Linksopposition in den 1920er und 1930er Jahren begründet worden ist. Die Linke Opposition hatte den fähigsten Wirtschaftswissenschaftler des russischen Bolschewismus der 1920er Jahre in ihren Reihen in Gestalt E. Preobraschenskis. Im Zentrum seiner Schriften zum Wertgesetz und dessen noch in der Übergangsperiode zum Sozialismus vorhandene Wirkungen steht seine Theorie der ursprünglichen sozialistischen Akkumulation .
Trotzkis Schriften zur politischen Ökonomie, insgesamt von weniger theoretisch, als vielmehr auf bestimmte politische Ziel orientiert, waren nicht weniger scharfsichtig – gleich zwingend in ihrer Anklage stalinistischer Kommandoplanung und in ihrer Verteidigung der Notwendigkeit eines demokratischen nichtmarktwirtschaftlich Sozialismus.
Zuletzt noch ein Wort zu der für diese Arbeit gewählten Darstellungsform. Diese Broschüre entstand in Form von Thesen, die die Argumente und Schlußfolgerungen aus der von der LRKI vollzogenen Forschung und Debatte zusammenfassen. Von Natur aus sind Thesen der vielen Quellenverweise, Fakten, Zahlen und Zitate, die das Argument illustrieren sollen, entkleidet.
Eine solche Darlegung hat jedoch den Vorteil, daß sie die Schlüsselargumente deutlich hervorhebt.
Diese Broschüre signalisiert nicht das Ende der Arbeit der LRKI am Thema. Es ist ein Beitrag zu einer Debatte, die eine unersetzliche Rolle dabei spielen wird, all jene Kräfte ausfindig zu machen und neu zusammenzutrommeln, die sich dem revolutionären Sturz des Kapitalismus verschrieben haben.
Als solcher ist es zentraler Bestandteil der Daseinsberechtigung der LRKI, die bestimmenden Charakteristika des revolutionären Marxismus für dieses Jahrtausend zu definieren und zu systematisieren. Es geschieht im Geist des Vorantreibens dieser Aufgabe, daß wir diesen Abriß unserer Arbeit heute der internationalen sozialistischen und Arbeiterbewegung zur Diskussion, Debatte und Polemik vorlegen.
Einleitung
Der Kapitalismus verlor schon vor langer Zeit seinen allgemein fortschrittlichen Charakter, weil die gesellschaftlichen Kosten, die für anhaltende Wirtschaftsentwicklung ertragen werden müssen, bei weitem den Nutzen übertreffen. Während des letzten Vierteljahrhunderts ist in allen kapitalistischen Wirtschaften die absolute Armut enorm angestiegen. Über eine Milliarde Menschen leben unterhalb des Existenzminimums; mehr als 100.000 Kinder sterben jede Woche an Unterernährung oder an anderen mit der Armut zusammenhängenden Krankheiten.
Während der Kapitalismus die Revolutionierung der Technik fortsetzt, kann er das nur auf Kosten produktiver Beschäftigung tun. Dutzende Millionen werden auf der Jagd nach Produktivität auf dem Land freigesetzt, während kapitalistische/r Industrie und Handel für sie woanders keine Beschäftigung finden können. Der Kapitalismus ist immer weniger in der Lage, jene zu entschädigen, die er marginalisiert, aus dem Heer der Beschäftigten Ausgestoßene oder jene, denen eine Eingliederung immer versagt war. Die Suche nach Profit gerät mit der Beibehaltung öffentlicher Ausgaben für Gesundheit, Bildung und Arbeitslosigkeit zunehmend in Konflikt.
Soziale Ungleichheit ist größer geworden, da der freie Markt sich voll gehen läßt. Eine Minderheit gedeiht dabei, indem sie sich unterbewertetes Staatsvermögen aneignet, zuvor geschützte Rohstoffe rücksichtsloser ausbeutet, Lohnniveaus drückt oder durch großzügige Steuerersparnis.
Immer mehr Arbeiter empfinden ihre Arbeitsbedingungen als untragbar. In einigen Teilen der Welt kann der Kapitalismus noch immer nicht ohne unfreie, vorkapitalistische Arbeitsverhältnisse überleben. Woanders werden Millionen der Arbeitsrechte beraubt und gezwungen, länger zu arbeiten. Millionen mehr ist die Vertragssicherheit genommen oder ausgehöhlt worden. Wiederum Millionen mehr sind für Arbeitsplätze ausgebildet worden, die einfach nicht existieren und aus Verzweiflung an andere gedrückt worden; kurz, Millionen sind von ihrer Arbeit entfremdet.
Parallel zu dieser Vergeudung menschlicher Schaffenskraft fährt der Kapitalismus fort, kostbare ökonomische Ressourcen zu verschwenden. Auf der Jagd nach Konkurrenzvorteilen wird moderne Maschinerie verschrottet, obwohl sie noch durchschnittlich rund die Hälfte nutzvoller Lebensdauer vor sich hat. Moderne Aktiengesellschaften verschleudern Milliarden in Mehrfachforschung.
Sogar größere Summen werden in unproduktiven Ausgaben veranlagt; Hunderte Milliarden Dollar werden jährlich verschwendet, um die Kapitalistenklasse vor ihrer eigenen Arbeiterklasse zu schützen – ob sie sich selbst hermetisch gegenüber den Auswirkungen der städtischen Alpträume, die sie selbst geschaffen hat, abschließt oder ihre Unterdrückerschergen trainiert und bewaffnet. Nochmals mehr wird ausgegeben, um rivalisierende kapitalistische Klassen vor den gegenseitigen Ansprüchen und Gegenforderungen zu schützen.
Die kapitalistische Konkurrenz läßt rivalisierende Unternehmer Aufwand treiben, Arbeitern die subtilen Unterschiede zwischen Produkten, die sie nicht benötigen, einzureden. Der endlose Lärm um modisch veranlaßte Eintagsfliegen, während grundlegende Bedürfnisse Dutzender von Millionen nach Wohnung und Essen aus Mangel an ‚effektiver Nachfrage‘ unberücksichtigt bleiben, liefert eine nachhaltige Widerlegung des Geprahles der Marktideologen, der Markt stelle optimale Zufriedenheit für eine maximale Zahl her.
Dies alles sind Resultate der Wirkungsweise des kapitalistischen Wertgesetzes. Doch bestehen entgegen allem Augenschein die gemieteten Marktapologeten darauf, daß dieser Markt die optimale Ressourcenallokation, die Gleichheit der am Tausch Beteiligten, freie Auswahl und gerechte Einkünfte der Produktionsfaktoren garantiere. Wenn diese Argumente versagen, zucken sie mit den Schultern und verweisen hartnäckig darauf, der Markt sei auf jeden Fall eine ewige oder natürliche Form der Regelung menschlicher Wirtschaftstätigkeit; was immer seine Defizite seien, es gebe anscheinend nur seine Spielregeln.
Unabhängig von dem, was die Ideologen der Bosse behaupten, war der Markt keine spontane Ausgeburt blinder ökonomischer Kräfte; er ist auch keine überhistorische Institution. Vielmehr tauchte der Markt im 16. Jahrhundert in Europa auf als qualitative Erweiterung der einfachen Warenproduktion, die als untergeordneter Bestandteil in allen Klassengesellschaften existiert hatte.
Insbesondere war es die Bildung eines Marktes für Arbeitskräfte, die die einfache Warenproduktion in verallgemeinerte Warenproduktion verwandelte. Dieser Arbeitsmarkt benötigte politische, v. a. staatliche Eingriffe, um althergebrachte Muster ökonomischer Aktivität aufzubrechen und existierende Bande, die Arbeiter an die Produktionsmittel und den Boden ketten, zu zerstören.
Alternative oder ergänzende Einkommensquellen außer dem Verkauf der Arbeitskraft mußten der Masse der direkten Produzenten in diesem Übergang zum Kapitalismus versagt werden. Es war auch kein einmaliger Akt in düsterer und entfernter Vergangenheit Europas. Er ist wiederholt worden auf immer größerer und brutalerer Stufenleiter, wo immer der Imperialismus Kolonien eroberte und den Kapitalismus und seine notwendigen Sozial- und Eigentumsverhältnisse verpflanzte.
Einmal gewalttätig etabliert, wurden die Marktgesetze im Bewußtsein der ihnen Unterworfenen verewigt. Die Hauptaufgabe bürgerlicher Politökonomie nach den 1840er Jahren lag darin, die natürliche, angeborene Überlegenheit und Unwiderlegbarkeit dieser Gesetze zu beweisen. Karl Marx jedoch enthüllte wissenschaftlich die wahre Wirkungsweise der Marktgesetze in seiner Neuausarbeitung der klassischen Arbeitswertlehre.
Er veranschaulichte, daß neben dem Reich der Gleichheit von Warenbesitzern in der Marktsphäre die despotische Herrschaft von Warenbesitzern über Arbeiter in der Fabrik existiert. Der Kauf der Arbeitskraft ist nur der erste Schritt zur unbarmherzigen Ausbeutung ihres Gebrauchswerts und dem Auspressen des durch ihren rücksichtslosen Gebrauch erzeugten Mehrwerts. Elend, Herabsetzung und Entfremdung resultieren alle aus der Tatsache des Wareneigentums, nachdem die Arbeitskraft selbst eine Ware geworden ist. Deshalb bringt die Verallgemeinerung des Markts die Lohnsklaverei mit sich.
Unter dem Kapitalismus wird die Allokation der wirtschaftlichen Ressourcen einschließlich der menschlichen Arbeit vom Wertgesetz geregelt: das bedeutet allgemeinen Tausch aller Waren gemäß der Menge gesellschaftlich notwendiger, in ihnen verausgabter Arbeit. Dieses Gesetz gilt auch für den Wert der Arbeitskraft selbst. Tatsächlich kann nur deshalb das Wertgesetz das Funktionieren der nationalen Volkswirtschaft als ganzes regulieren, weil die Bestimmung der Warenwerte auf einem gesellschaftlichen Durchschnittspreis beruht, der der an ihnen aufgewendeten Arbeit gegeben wird, etwas vor dem Kapitalismus Unmögliches.
Das Wertgesetz regelt dann die Produktion von Gütern und Dienstleistungen und die Verteilungs- und Austauschweise, die aus der Produktion hervorgeht. Es tut dies jedoch blind, als post festum Resultat der konkurrierenden und aufeinanderprallenden Operationen vieler unabhängiger und privater Kapitaleigner. Welche Produkte sozial nützlich sind, erscheint erst als Ergebnis eines blinden Prozesses, der viel Verschwendung, Anarchie und Überproduktion erzeugt.
Zu seiner Zeit war der blutige Triumph des Markts trotz der dadurch auferlegten Leiden geschichtlich progressiv, insoweit er den Weg für den Triumph der kapitalistischen Produktionsweise über alle vorhergegangenen oder parallelen Produktionsweisen ebnete. Einmal siegreich, revolutionierte der Markt das wirtschaftliche Leben und verlieh der Produktivität menschlicher Arbeit einen enormen und beispiellosen Anschub. Er errichtete der Reihe nach nationale Märkte, den internationalen Handel und schließlich eine globale Ökonomie.
Der Markt hat unvermeidlich verschiedene Ausdehnungen und Modifikationen in den letzten 250 Jahren durchlaufen. Frühe Formen des Schutzzollsystems (Merkantilismus) machten einem System größeren Freihandels in Industrie und Geschäftsverkehr Platz.
Da die freie Konkurrenz die Kapitalkonzentration förderte, schränkte sie Konkurrenzmärkte ein bzw. schaffte sie ab und brütete Monopole aus, die die Operation des Wertgesetzes beschnitten.
Die Vermehrung des Monopols im 20. Jahrhundert diente der Verlangsamung der Akkumulation, weil die Unternehmen eher ihre Anlagewerte zu erhalten trachteten, als sie durch Einführung neuer Investitionen entwertet zu sehen. So wirkte das Streben nach Profitmaximierung als Bremse auf Erneuerung und Produktivität. Krise, Depression und Massenarbeitslosigkeit folgten, weil Produktionsfaktoren und Arbeit nicht beschäftigt werden konnten.
Der Kapitalismus wurde aus seiner selbst verschuldeten Malaise nur durch den Krieg und die erzwungene Zerstörung und Entwertung des Kapitals, die er mit sich bringt, gerettet. Der Staat selbst beaufsichtigte diesen Prozeß, übernahm die Verantwortung für die Lenkung großer Teile der Kapitalakkumulation und führte sie sogar durch. Die Garantie von Märkten und Profiten als Ergebnis der schleichenden Sozialisierung von Produktion und Verteilung war selbst ein Verdammungsurteil über das Versagen des Markts im Kapitalismus.
Diese von den Monopolen veranlaßte Antwort auf die Krise schuf jedoch in der Folge eigene Probleme: Vollbeschäftigung und steigende Löhne gingen mit einer sinken Produktivität öffentlicher Investitionen einher, drückten so die Profite und damit die weitere Akkumulation. Die letzten 25 Jahre erlebten eine intensive Rückkehr zur freien Konkurrenz, nicht anstelle der Monopole, sondern zwischen ihnen und an ihrer Seite.
Aufhebung von Handelsbarrieren, Deregulierung des Arbeitsmarktes, Abschaffung von Kapitalkontrollen, Privatisierung (und Abwertung) von Staatsvermögen, all dieses hat darauf gezielt, Akkumulation und Produktivität einen Schub zu verleihen. Und mit welchen Ergebnissen für die Masse der Bevölkerung? Einem beispiellosen Anstieg sozialer Ungleichheit, absoluter Armut und Massenarbeitslosigkeit.
Jede dieser kapitalistischen Entwicklungsphasen ist eine Antwort auf die in der vorherigen Phase erzeugte Krise gewesen. Die marxistische Marktkritik entspringt nicht aus einem abstrakten humanistischen Wunsch nach Gleichheit, sondern vielmehr aus der Erkenntnis, daß der Kapitalismus Gesellschaftskrisen erzeugt, die nur durch die Abschaffung der Marktökonomie beendet werden können.
Krisen treten unausweichlich und regelmäßig wegen des Widerspruchs, der zwischen zunehmend gesellschaftlichen Produktivkräften und dem privaten Charakter der Aneignung existiert, auf den Plan. Weder irgendeine Gruppe von Kapitalisten noch irgendeine Regierung kann solchen Krisen auf Dauer zuvorkommen, da ihre Funktion die Lösung systematischer Disproportionen und Überproduktion, die durch die Operation des Markts gesetzt werden, ist. Die als Resultat des spontanen Wirkens der ‚Marktkräfte‘ zunehmend aus der Harmonie miteinander geratene Produktion und Konsumtion werden durch Zerstörung von Produkten, für die kein Käufer gefunden werden kann trotz des Faktums, daß viele dieser Waren benötigt werden, gewaltsam und wiederholt auf Linie gebracht.
Hinter den einzelnen Ausprägungen spezifischer Krisen innerhalb des Kapitalismus steckt der tendenzielle Fall der Profitrate. Dieser hat seine Ursachen im Verhältnis zwischen der generell steigenden organischen Zusammensetzung des Kapitals und der generell fallenden Mehrwertrate. Seine letztliche Konsequenz besteht darin, daß an einem gewissen Punkt neue Investitionen von den Kapitalisten zurückgehalten werden, weil sie keine Aussicht auf akzeptable Ertragsraten sehen.
Somit führen Privateigentum und Profitstreben zu Einschränkungen, ja sogar Einstellung der Produktion im einzelnen Sektor. Je größer die betroffene Kapitalformation ist, umso verheerender ihre Auswirkung auf die gesamte gesellschaftliche Produktion. Ähnlich führt der Investitionentransfer aus einem Sektor zum anderen, wieder auf der Suche nach größtem Profit, zu Disproportionalitäten zwischen den verschiedenen Sektoren der ganzen Volkswirtschaft. Von daher kann nur ein grobes und zeitweiliges Gleichgewicht zwischen Produktion und Konsumtion im Kapitalismus resultieren.
Mit seinen zahlreichen Versuchen, die Auswirkungen der Krise zu mildern, ist der Kapitalismus immer gezwungen gewesen, das Funktionieren des Wertgesetzes zu begrenzen oder sogar teilweise abzuschaffen; in dieser Beziehung nimmt er den Sozialismus vorweg und äfft ihn nach.
Er bereitet die Arbeiterklasse für die Aufgaben des sozialistischen Übergangs vor. Er hat eine zahlreiche und genügend gebildete Arbeiterklasse geschaffen, die die Funktionen des Managements in der Produktion selbst übernehmen kann.
Er hat Techniken der Marktregulierung und -manipulation geschaffen, die übernommen und erweitert werden können. Er hat Planungsinstrumente geschaffen, – partiell angewandt und unfähig zu dauerhaftem Effekt, solange Privateigentümer vorherrschen – mit denen der Kapitalismus die verschwenderischen Konsequenzen der Anarchie in der Produktion zu minimieren sucht. Diese nehmen so das Ende der Dominanz des Marktes über das Wirtschaftsleben vorweg.
Gerade wie der Markt jedoch nicht friedlich entstand, sondern Hindernisse auf seinem Weg zermalmen mußte, so wird auch das Ende des Markts in der Regelung des Wirtschaftslebens weder friedlich noch unverzüglich sein. Ein gewaltsamer Umsturz des Staates, der diesen Markt schützt und garantiert, ist ein essentieller erster Schritt, der die Enteignung des Reichtums und Kapitals der Minderheit gestattet und es in die Hände der Gesellschaft legt.
Die Ausrottung des Marktes als wirtschaftlichen Mechanismus‘ wird jedoch nicht unmittelbar danach stattfinden. Während seine Tyrannei über die Masse der direkten Produzenten schnell beendet werden kann, kann doch der Markt nicht einfach abgeschafft werden. Wie der Staat, so muß auch der Markt absterben.
Knappheit wird weiter existieren und die Verteilung knapper Ressourcen mag wohl, wenigstens zum Teil, durch Verkäufe auf dem Markt bewerkstelligt werden. Aber der Markt wird manipuliert werden müssen, da er ein abnehmender Faktor im ökonomischen Leben wird; er muß gezwungen werden, der Sache seiner eigenen Abschaffung zu dienen. Dies ist das Ziel der Übergangsperiode.
Das Erbe von Marx und Engels
Marx und Engels schrieben keine separate Arbeit über die politische Ökonomie des Sozialismus. Ihre Gedanken sind über theoretische, programmatische und polemische Bücher verstreut. Nichtsdestoweniger haben diese zusammengenommen die grundlegenden Konzepte entworfen, die seitdem die revolutionäre Bewegung anleiteten.
Zuerst bestanden Marx und Engels darauf, die künftige sozialistische Gesellschaft müsse ihren Startpunkt von den in der modernen Industrie verzeichneten Fortschritten nehmen, der modernen Technik und der Arbeitsteilung.
Der Sozialismus würde auf der Zentralisation der Industrie und den Elementen vergesellschafteten Eigentums an den Produktionsmitteln, die innerhalb der kapitalistischen Gesellschaft vorkommen (z. B. Aktiengesellschaften, Kooperativen), aufgebaut. In diesem Sinne traten sie gegen alle Schemata auf, die einen Rückschritt in der Technik oder sozialen Organisation gegenüber dem, was unter dem modernen Kapitalismus erreicht war, verkörperten.
Marx‘ und Engels‘ positive Bemerkungen über Sozialismus und Kommunismus begannen natürlich mit der Erkenntnis, daß die nachrevolutionäre Gesellschaft bewußt daran gehen würde, die den angeborenen Defiziten kapitalistischer Produktion und Verteilung zugrundeliegenden Widersprüche zu lösen. Der allgemeinste Widerspruch im Kapitalismus war der zwischen dem zunehmend gesellschaftlichen Charakter der Produktion und der privaten Natur der Aneignung des Wertprodukts. Dieser Widerspruch war vom Wesen der Warenproduktion ererbt:
„Was sind Waren? Produkte, erzeugt in einer Gesellschaft mehr oder weniger vereinzelter Privatproduzenten, also zunächst Privatprodukte. Aber diese Privatprodukte werden erst Waren, sobald sie nicht für den Selbstverbrauch, sondern für den Verbrauch durch andre, also für den gesellschaftlichen Verbrauch produziert werden; sie treten ein in den gesellschaftlichen Verbrauch durch den Austausch.“ (F. Engels, Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft, Berlin – Ost, 1979, S. 285)
Produkte werden ohne vorheriges Wissen hergestellt, ob es einen Markt für sie gibt. Ob die zu ihrer Erzeugung aufgebrachte Arbeit gesellschaftlich notwendig ist oder nicht, kann man deshalb erst wissen, nachdem sie zu Markte gebracht worden sind. Dieser einfache Charakterzug aller Warenproduktion, ob innerhalb des Kapitalismus oder nicht, gewährleistet die Anarchie der Produktion, da nicht garantiert werden kann, daß jeder hergestellte Gebrauchswert einen Käufer finden wird, für den er nützlich ist. Andauernd treten Überproduktion und Ungleichgewichte auf und mit ihnen Verschwendung und Ineffizienz.
Der Kapitalismus jedoch, der verallgemeinerte Warenproduktion darstellt (d. h. die Arbeitskraft wird selbst zur Ware, nicht allein die Arbeitsinstrumente und Rohmaterialien), fügt eine weitere Dimension hinzu. Produktion wird in größeren kooperativen Arbeitseinheiten unternommen, in denen eine Klasse von Kapitalisten einen großen Produktionsmittelumfang besitzt und eine Klasse von Arbeitern beschäftigt, die nichts außer ihrer Arbeitsfähigkeit besitzen.
Dem Kapitalisten gehört das Kapital, das zur Beschäftigung des Arbeiters gebraucht wird und erhält damit das Recht auf das Produkt des Arbeiters. Dieses Produkt enthält jedoch mehr Wert, als der Kapitalist in Gestalt von Maschinen, Rohstoffen und Arbeitskraft auslegen mußte.
Dies deshalb, weil die Arbeitshandlung mehr Wert schafft, als die Arbeitskraft selbst wert ist. Im Ergebnis eignet sich der Kapitalist den Mehrwert an. Die Aneignung immer mehr Mehrwerts wird für den Kapitalisten zum anspornenden Ziel. Dies führt zu einem Konflikt zwischen den zwei Klassen über die Produktion und Verteilung von Mehrwert.
Darüberhinaus wird im Streben nach immer größerer Produktivität immer mehr Maschinerie von immer weniger Arbeitern in Bewegung gesetzt, was zu struktureller Massenarbeitslosigkeit und deshalb andauernder Geringnutzung von Arbeit – der wichtigsten Hilfsquelle der Gesellschaft – führt.
Weitere Verschwendung wird vom Klassenkrieg selbst mit seiner unvermeidlichen Zerstreuung von Energie und Erfindungsgabe der Arbeiterklasse verursacht. Weil Arbeit unterdrückend wirkt, hört sie auf, ein essentieller Bestandteil der Entwicklung menschlicher Individualität zu sein und bewirkt eine weitere Vergeudung der produktiven Kapazität der Gesellschaft.
Obwohl der Arbeitsprozeß im Kapitalismus immer komplexer und die Arbeitsteilung immer zugespitzter wird, organisiert immer noch privates Kapital die Produktion. Produktion im Kapitalismus bleibt deshalb wesentlich Privatproduktion trotz auf gesellschaftlichen Nutzen angelegter Produktion. Die private Form kapitalistischer Produktion steht in antagonistischem Widerspruch zu ihrem gesellschaftlichen Inhalt. Und das gleiche gilt für die Arbeit; obwohl viel Arbeit in großen kapitalistischen Firmen und sogar Trusts als gesellschaftliche Aktivität erscheint, bleibt doch aus zwei Gründen die Lohnarbeit im Kapitalismus Privatarbeit.
Erstens, weil es eine Funktion des Privatkapitals, nicht der Gesellschaft ist; zweitens, weil der Arbeiter/die Arbeiterin vom sozialen Inhalt seiner/ihrer Arbeit entfremdet ist (und deshalb im wesentlichen ihm gegenüber gleichgültig). In welchem Ausmaß die privat verausgabte Arbeit gesellschaftliche Arbeit verkörpert, nachdem der Markt die betreffenden Preise für alle Waren und ob die Waren zu diesen Preisen verkauft werden können, enthüllt hat. Der Zirkulationsprozeß überträgt ein gewisses Ausmaß konkreter (privater) Arbeit in ein unterschiedliches Maß abstrakter (gesellschaftlicher) Arbeit. Die Übersetzungsbedingungen können im Vorhinein nicht bekannt sein. Im Kapitalismus bleibt die Arbeit bestenfalls indirekt vergesellschaftet, im schlechtesten Fall überhaupt nicht.
Das Überleben aller Einzelkapitale hängt vom Grad ab, bis zu dem in ihm verkörperte konkrete Arbeit (ihre Waren) wirklich abstrakte Arbeit darstellt, und dies hängt in letzter Instanz von der Produktivität ihres Kapitals ab. Jedes Kapital ist ständig zu akkumulieren gezwungen, um zu überleben, weil nur Akkumulation ein ständiges Produktivitätswachstum sicherstellen kann. Dies bedeutet am Ende, daß der Arbeiter, die Verkörperung der lebendigen Arbeit, systematisch der Akkumulation, d. h. der toten Arbeit, untergeordnet wird.
Kapitalistische Produktion dient keinem anderen Ziel als dem der Akkumulation. Sie ist ein quasi automatischer Prozeß, unabhängig vom menschlichen Willen. Es ist diese Monsternatur des Kapitalismus, den die Arbeiterklasse überwinden muß, um die Menschheit und den Planeten Erde zu retten. Marx‘ Kapitalismusanalyse macht eindeutig klar, daß es die private Form der Produktion und Arbeit ist, die Indirektheit (d. h. die Blindheit) der Vergesellschaftung von Arbeit, die im Kern den ganzen Skandal des Kapitalismus einschließt: die Diktatur des Kapitals über den Arbeiter.
Marx und Engels erwogen, daß diese Defizite in der verallgemeinerten Warenproduktion überwunden werden könnten, wenn Arbeit direkte gesellschaftliche wäre:
„Sobald die Gesellschaft sich in den Besitz der Produktionsmittel setzt und sie in unmittelbarer Vergesellschaftung zur Produktion verwendet, wird die Arbeit eines jeden, wie verschieden auch ihr spezifisch nützlicher Charakter sei, von vornherein und direkt gesellschaftliche Arbeit. Die in einem Produkt steckende Menge gesellschaftlicher Arbeit braucht dann nicht erst auf einem Umweg festgestellt zu werden; die tägliche Erfahrung zeigt direkt an, wieviel davon im Durchschnitt nötig ist. Allerdings wird auch dann die Gesellschaft wissen müssen, wieviel Arbeit jeder Gebrauchsgegenstand zu seiner Herstellung bedarf. Sie wird den Produktionsplan einzurichten haben nach den Produktionsmitteln, wozu besonders auch die Arbeitskräfte gehören. Die Nutzeffekte der verschiedenen Gebrauchsgegenstände, abgewogen untereinander und gegenüber den zu ihrer Herstellung nötigen Arbeitsmengen, werden den Plan schließlich bestimmen.“ (ebda., S. 288)
Der Plan ist ein bewußtes Instrument, der von der Gesellschaft angewandt wird, ‚um eine Beziehung zwischen dem Umfang gesellschaftlicher Arbeitszeit, die zur Produktion bestimmter Artikel verbraucht wird, und dem Ausmaß gesellschaftlichen Bedürfnisses, das durch diese Artikel befriedigt werden soll, zu etablieren‘. Die Produktion wird durch die sich verändernde Struktur und Ausweitung der Bedürfnisse geregelt. Aus diesem Konzept folgen weitere Konsequenzen. Erstens hören natürlich die Produkte auf, die Warenform anzunehmen, da sie nicht länger Tauschwerte darstellen, d. h. Güter und Dienstleistungen, deren gesellschaftlich notwendige Arbeit nur im Austauschakt selbst festgelegt wird. Vielmehr wird diese Entscheidung ex ante getroffen, Güter werden hergestellt, weil es gesellschaftlichen Bedarf nach ihnen gibt. Zweitens verliert Geld seinen besonderen Charakter als universelles Äquivalent für alle Tauschwerte. Stattdessen:
„Die Gesellschaft kann einfach berechnen, wieviel Arbeitsstunden in einer Dampfmaschine, einem Hektoliter Weizen der letzten Ernte, in hundert Quadratmeter Tuch von bestimmter Qualität stecken. Es kann ihr also nicht einfallen, die in den Produkten niedergelegten Arbeitsquanta , die sie alsdann direkt und absolut kennt, noch fernerhin in einem nur relativen, schwankenden, unzulänglichen, früher als Notbehelf unvermeidlichen Maß, in einem dritten Produkt auszudrücken und nicht in ihrem natürlichen, adäquaten, absoluten Maß, der Zeit. Die Gesellschaft schreibt also unter obigen Voraussetzungen den Produkten auch keine Werte zu.“ (ebda., S. 288)
Marx und Engels zogen in Erwägung, daß Arbeitsanteilsscheine das Geld ersetzen könnten; erstere seien direkter Ausdruck gesellschaftlich notwendiger Arbeit, die in nützlichen Produkten vergegenständlicht ist.
Wenn das Profitmotiv, das Verlangen, immer steigenden Mehrwert anzuhäufen, nicht länger leitendes Wirtschaftsprinzip ist, welches dann? Marx argumentiert, es ist ‚die Ökonomie der Zeit, auf die sich letztlich alle Ökonomie reduziert‘. Daher, ‚je weniger Zeit es der Gesellschaft erfordert, Weizen, Vieh etc. zu produzieren, gewinnt sie desto mehr Zeit für andere Produktion, materielle wie geistige.‘ Vom Zwang zur Steigerung der Surplusarbeit befreit, wird die Gesellschaft die Arbeitszeit verringern und die verfügbare, freie Zeit ausweiten können. Notwendige Arbeit wird auf ein Minimum eingeschränkt werden und damit die Trennung in ‚Kopf-‚ und ‚Handarbeiter‘ überwindbar.
Schließlich erkannten Marx und Engels, daß der Kommunismus nicht mit einem Mal oder über Nacht einträfe. Es sei nicht möglich, schnell aus dem Reich der Notwendigkeit in das der Freiheit zu gelangen; wirtschaftlich gesprochen, würde eine Situation relativer Knappheit eine Zeit lang andauern. Daher müsse sich die Gesellschaft einen Mechanismus für die Entscheidung über die Verteilung der Früchte der Arbeit unter ihre Mitglieder zu eigen machen. Sie argumentierten, daß im Sozialismus (der unteren Stufe des Kommunismus) jedes Mitglied, „ein Zertifikat von der Gesellschaft erhält, daß es so und so viel Arbeit geleistet hat“ und mit diesem Zertifikat bezieht es aus dem gesellschaftlichen Konsumtionsmittelfonds, soviel der gleiche Arbeitsaufwand kostet‘, nachdem gewisse Abzüge getätigt worden sind. Die Abzüge enthalten:
„Deckung zum Ersatz der verbrauchten Produktionsmittel“, zusätzlicher Teil für Ausdehnung der Produktion, „Reserve- oder Assekuranzfonds gegen Mißfälle, Störungen durch Naturereignisse usw“, die allgemeinen, nicht zur Produktion gehörigen Verwaltungskosten. „Was zur gemeinschaftlichen Befriedigung von Bedürfnissen bestimmt ist wie Schulen, Gesundheitsvorrichtungen usw. Fonds für Arbeitsunfähige usw.“ (K. Marx: Randglossen zum Programm der Deutschen Arbeiterpartei, Berlin/Leipzig 1922, S. 25)
Von daher existierte Ungleichheit, aber eine, die mit der Zeit abgebaut würde. Erst im Kommunismus würden sich die Verteilungskriterien ändern. Statt ‚jedem nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seiner Arbeitsleistung‘, sei die Gesellschaft in der Lage, sich ‚jedem nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen‘ anzueignen. Ein Überfluß aller notwendigen materiellen Güter und Dienstleistungen würde die Notwendigkeit jeder Form rationierten Zugangs zu den Erzeugnissen gesellschaftlicher Arbeit ausschalten.
Marx‘ und Engels‘ wissenschaftliche Perspektive entwickelte die Sache des Sozialismus aus den entdeckten Tendenzen innerhalb der kapitalistischen Gesellschaft und legte ihr keine Schemata auf. Sie schmähten den ‚kleinbürgerlichen‘ Sozialismus für seinen Wunsch, das Verhältnis Lohnarbeit – Kapital ungeschehen zu machen und alle direkten Produzenten aus Lohnsklaven wieder in Privateigentümer ihrer eigenen Produktionsmittel zu verwandeln (Handwerker).
Marx und Engels demonstrierten, daß die politische Ökonomie von Proudhons utopischem Sozialismus auf den Versuch gegründet war, ‚Sozialismus‘ mittels eines Systems konkurrierender kleiner Warenbesitzer zu schaffen. Diese Vormarxisten suchten nicht, den Sozialismus auf den Boden des Kriegs zwischen antagonistischen und unversöhnlichen Klassen über die Produktion des Mehrwerts zu stellen. Sie wollten die Warenverhältnisse ’säubern‘, Arbeiter und Kapitalisten zu Gleichen in der Produktion machen, so wie sie im Austausch erscheinen und ignorierten somit die grundlegende Natur kapitalistischer Produktion. Sie wollten Lohnarbeit/Kapital, Konkurrenz und Profit, aber ohne Ausbeutung, Ungleichheit und Arbeitslosigkeit; kurz, eine Utopie.
Soviel begründeten Marx und Engels an politischer Ökonomie des Sozialismus. Er wäre vernünftig, geplant, demokratisch. Er überwände die Anarchie und Ungleichgewichte kapitalistischer Produktion. Er würde der menschlichen Spezies die unterdrückerischen Auswirkungen entfremdeter Arbeit abnehmen und die Rundumentwicklung von Individualität gestatten, die im Gegenzug nur in einer Gesellschaft stattfinden könnte, die Freiheit von Dürftigkeit und Unterdrückung garantierte. Sie überwände die Geringnutzung und Vergeudung der Arbeit. Sie vermiede den nutzlosen Raubbau an der Natur und würde den zerstörerischen Gegensatz zwischen Stadt und Land beenden.
Sie trafen eine Anzahl von Annahmen über die politische Ökonomie des Sozialismus; nämlich, daß die Gesellschaft im Besitz aller Produktionsmittel sei; daß die Gesellschaft in der Lage sei, den direkt sozialen Charakter der in der Produktion eingebundenen Arbeit zu kalkulieren und als Resultat sich indirekter Maßstäbe (d. h. Wert und Geld, Preisen) vollständig entledigen könne. Sie schrieben wenig über die spezifischen Einrichtungen der Planung oder die Kalkulation der verhältnismäßigen Ergiebigkeit verschiedener Nutzweisen der Arbeit und anderer Vorprodukte, nachdem einmal Geld, Wert und Produktionspreis ihren früheren Charakter verlören.
Von daher begann die Schwierigkeit für die marxistische Tradition, als einige dieser Annahmen im Lichte geschichtlicher Entwicklungen neu durchdacht werden mußten, insbesondere der russischen Oktoberrevolution 1917 und der Versuchsschritte des ersten Arbeiterstaates in Richtung wirtschaftlicher Umgestaltung.
Ökonomischer Wiederaufbau im Arbeiter:innenstaat
Bolschewistische Politik der Machtergreifung
Marx und Engels bestanden darauf, daß es notwendig würde, die Produktionsmittel zu nationalisieren und zu konzentrieren, nachdem die Arbeiterklasse die Macht ergriffen hat. Nur auf dieser Grundlage konnte die Gesellschaft bewußt die Arbeitszeit auf die verschiedenen Sektoren der Wirtschaft verteilen, um gesellschaftliche Bedürfnisse optimal zu befriedigen.
Dieses allgemeine Konzept der post-kapitalistischen Ökonomie war auch in den marxistischen Programmen der Parteien der Zweiten Internationale einschließlich der russischen Sozialdemokratischen Arbeiterpartei zu finden. Hilferding fügte dem marxistischen Kanon die Idee hinzu, daß das Finanzkapital zum immer mächtigeren Gehirn und Organisationszentrum des produktiven Kapitals geworden war; eine Entwicklung, die die Wirtschaft objektiv auf den Sozialismus vorbereitete: ein fertiger ökonomischer Apparat brauchte vom neuen sozialistischen Staat nur in die Hand genommen zu werden.
Während des ersten Weltkriegs schien der Staatskapitalismus besonders in Deutschland für die Bolschewiki den praktischen Beweis von Hilferdings These darzustellen. Lenin stellte deshalb 1917 wiederholt die Wichtigkeit fest, die Banken zu nationalisieren, als bedeutendsten Schritt zur bewußten politischen Kontrolle der Wirtschaft zu.
Kein Theoretiker der Zweiten Internationale , sei er Bolschewist gewesen oder nicht, arbeitete jedoch an der Idee von „Planwirtschaft“ weiter als zu diesem Punkt. Besonders das Konzept einer zentralisierten und geplanten Verteilung der Arbeitszeit wurde nicht konkretisiert. Den Bolschewisten war klar, daß Rußlands Rückständigkeit zu Beginn nicht viel zentrale Planung gestatten würde. Diese Vorsicht war vernünftig und spiegelte sich in den ersten Wirtschaftsmaßnahmen der revolutionären Regierung der Volkskommissare wider.
Die theoretische Unterentwicklung des Bolschewismus wurde, was das betrifft, am wachsenden Einfluß der verworrenen Positionen der „Linkskommunisten“ innerhalb seiner Reihen offenbar. Ihr Einfluß war besonders 1920 stark, als sie argumentierten, daß die Notmaßnahmen, die später summarisch als „Kriegskommunismus“ bekannt wurden, die ersten Schritte im Übergang zum Sozialismus repräsentierten.
Die revolutionäre Wirtschaftspolitik ab Oktober 1917 zielte darauf ab, einen klaren Bruch mit der kapitalistischen Vergangenheit auf einigen Gebieten zu bewerkstelligen. So wurde am Tag nach der Machtergreifung durch die Sowjets das ganze Land nationalisiert, wurden effektiv alle Großgrundbesitzer enteignet. Als im Januar 1918 die Konstituierende Versammlung sich weigerte, diese Maßnahme zu bestätigen, entschieden die Bolschewiki, sie aufzulösen. Das darauffolgende Dekret „Über die Sozialisierung von Grund und Boden“ führte das Programm der Linken Sozialrevolutionäre durch, indem es festlegte, daß das verstaatlichte Land in gleichen Portionen auf die es Bearbeitenden verteilt und die hohen Steuern und Grundrenten abgeschafft werden sollte/n. Die meisten großen feudalen Ländereien wurden somit in kleinen und mittleren bäuerlichen Grundbesitz aufgelöst.
Im allgemeinen bezog die revolutionäre Regierung jedoch während der ersten sechs Monate eine relativ vorsichtige Haltung zum Industrie- und Finanzsektor. Das Dekret über Arbeiterkontrolle vom November 1917 war der zweite bedeutendere Programmpunkt der frühen sowjetischen Wirtschaftspolitik. Es gestattete den Unternehmern, weiterhin ihre Fabriken zu besitzen und zu leiten, aber jetzt unter Kontrolle der Arbeitervertreter. Die Entscheidungen der Arbeiterkontrollkomitees gaben den Ausschlag. Auf diese Weise, hoffte man, würden die Arbeiter lernen, wie die Produktion zu verwalten und zu organisieren sei, während sie sie gegen Störungen und Sabotage durch die Gegner der neuen Regierung schützten.
In Wirklichkeit führte es nicht zu sozialer Kooperation, geschweige denn Planung, sondern zu halbanarchistischem Betriebspartikularismus. Im Gegensatz zu dem, was man hätte erwarten mögen, griff die Regierung nicht auf umfassende Verstaatlichung zurück. Im Glauben, weder die Fabrikarbeiter noch der Arbeiterstaat hätten ausreichende Erfahrung, um die Produktion zu betreiben, unternahm die Regierung unter Lenin anfänglich selbst im Fall der Großindustrie keine Nationalisierung. Nur in Fällen, wo Kapitalisten die Entscheidungen der Arbeiterkontrollkomitees mißachteten, wurden Unternehmen strafenteignet.
Um die verschiedenen Bereiche zu koordinieren und die Produktion aufrechtzuerhalten, führte der Rat der Volkskommissare (Sownarkom) kurz- und langfristige Initiativen ein. Man erwartete damals, Verstaatlichungen und Kontrolle über die Banken reichten aus. Ende Dezember 1917 wurden alle Banken formell unter dem Dach einer Zentralbank vereinheitlicht. Um sie loyal mit der Regierung zusammenarbeiten zu lassen, mußten jedoch die meisten Bankmanager ersetzt oder unter strikte Regierungskontrolle gestellt werden.
Kredit und Geldpolitik mußten sich an strikte Kontrollen halten, um die Konvertibilität des Rubel sicherzustellen. Um dem Zentrum zu erlauben, langfristig eine umfassende ökonomische Kontrolle zu entfalten, wurde im Dezember 1917 ein neues Gremium geschaffen – der Oberste Volkswirtschaftsrat (Vesenka). Während seiner ersten sechs Monate war Vesenka nicht effektiv, sondern befaßte sich mit vorbereitender Tätigkeit. Die Idee bestand darin, vorsichtig eine zentrale Koordination der Einzelunternehmen speziell in der Industrie zu errichten, ohne sie notwendigerweise alle zu nationalisieren und unter ein detailliertes Zentralkommando zu stellen.
Kriegskommunismus
De Ausbruch eines alles einbeziehenden Bürgerkriegs und die westliche Militärintervention im Mai 1918 waren der Hauptgrund für einen größeren Schwenk in der Wirtschaftspolitik in der zweiten Hälfte von 1918. Produktion und Verteilung wurden jetzt auf das Ziel, den Krieg zu gewinnen, umorientiert, aber es gab ebensogut Druck von innen, besonders die Sabotage der Bourgeoisie, die den linken Parteiflügel gestärkt hatte.
Gerade vor Kriegsausbruch waren innenpolitische Faktoren eingetreten, die in vieler Hinsicht die Politik von Sownarkom ineffektiv gemacht hatten und die Argumente für eine Linkswende stützten. Arbeiter hatten spontan das Eigentum ihrer Bosse konfisziert und dadurch die Verantwortung der Zentralbank vergrößert, die alle verstaatlichten Unternehmungen finanzieren mußte. Der Kredit explodierte und die Gelddisziplin brach zusammen, als das Steueraufkommen abstürzte. All dies führte zu Inflation und Währungsabwertung.
Der Krieg machte eine Rückkehr zu ausgeglichenen Haushalten und fester Geldkontrolle noch unmöglicher. Die Argumente der „Linken“ (Smirnow, Ossinskij, Krestinsky u. a.) – der Staat sollte das ganze Geldwesen abschaffen, weil es von Natur aus bürgerlich sei und im Übergang zum Sozialismus nicht helfen könne – machten das Rennen. Lenins Appell vom April 1918, Rußland brauche eine verbesserte (finanzielle) Buchführung, größere Arbeitsdisziplin und höhere Arbeitsproduktivität, stieß auf taube Ohren.
In der Landwirtschaft bedeutete der Kriegskommunismus eine Wende zu Requirierungen. Im August 1918 wurden Arbeiterabteilungen bewaffnet und ermächtigt, sie durchzuführen. Dabei wurden sie von den neu gegründeten „Komitees der armen Bauernschaft“ unterstützt, die als Speerspitze des Klassenkampfs auf dem Lande ersonnen wurden. Gleichzeitig wurde Propaganda für kollektive und kooperative Landwirtschaft betrieben, obwohl wenige materielle Anreize verfügbar waren, sie zu ermutigen.
Als die Zahl der Staatsgüter gering blieb und die Requirierungen zur Verringerung der kultivierten Landfläche und Abneigung von Mittelbauern gegen die Revolution führten, löste Sownarkom 1919 die Komitees der Dorfarmut auf, um die Mittelbauern zu beruhigen. Nichtsdestotrotz fand immer mehr Korn seinen Weg auf den Schwarzmarkt und immer größere Landgebiete lagen brach. Als Antwort wurden die Eintreibemethoden brutaler.
1920 nahmen die Bauernaufstände zu, nicht zuletzt wegen weitverbreiteten Hungers und selbst Hungersnöten auf dem Land. Trotzdem versuchte der 8. Sowjetkongreß im Dezember 1920 den Bauernwiderstand durch Auferlegung einer Pflicht zur Aussaat zu ersticken. Erst mit Lenins Wechsel zur NÖP im Frühjahr 1921 akzeptierte die Partei endlich die Hoffnungslosigkeit solcher Vorstöße und erkannte die Notwendigkeit der Wiedereinführung von Geld und Markt in der Landwirtschaft an.
Zwischenzeitlich war die Industrie in eine einzige Versorgungseinrichtung für die Rote Armee verwandelt worden. Ein Dekret vom Juni 1918 hatte die ganze Großindustrie auf einen Schlag nationalisiert. Im Herbst war die städtische Kleinindustrie an der Reihe, und 1919 wurden sogar ländliche Handwerksbetriebe vom Staat übernommen.
Das Ausmaß an Verstaatlichungen war so hoch, daß nur 10% der 37000 Staatsfirmen wirklich zentral koordiniert werden konnten. Die staatlichen Unternehmen wurden in Trusts zusammengefaßt, die selbst unter Vesenka mit dem Ziel vereinigt wurden, den Ausstoß zu zentralisieren. Konzentration und Zentralisation der Industrie waren offensichtlich verständliche Maßnahmen im Bemühen, die Kriegsmaschine zu unterstützen, aber weil sie gleichfalls auf alle nichtmilitärischen Sektoren angewandt wurden, trugen sie erheblich zur Entstehung einer viel gehaßten Bürokratie bei.
Vesenka versuchte, die industrielle Entwicklung wesentlich zu lenken, indem sie Kredite zu den wichtigsten Kriegsindustrien hinleitete. Die Glavki waren nicht wirklich fähig, die ganze Produktion zu organisieren, noch weniger, sie zu planen, und so intervenierten sie oft in unsystematischer Form.
Austausch zwischen Staatsfirmen wurde zunehmend auf geldloser Basis durchgeführt, mit anderen Worten als Naturalientausch. Die ausgetauschten Mengen folgten keinen erkennbaren Marktregeln, sondern waren eher Ergebnis bürokratischer Eigenmächtigkeit. Gegen großen Widerstand seitens der Parteilinken und der Gewerkschaften konnte Lenin erfolgreich die Einmannleitung in den meisten Unternehmen und den Gebrauch bürgerlicher Spezialisten in Armee und Wirtschaft durchsetzen. Während letzteres als Zugeständnis an die russische Rückständigkeit gesehen wurde, wurde ersteres als Fortschritt gegenüber „rudimentärer“ Kollegialität dargestellt.
In der kriegskommunistischen Ideologie hörte die Arbeitskraft auf, eine Ware zu sein und wurde in einen „Dienst an der Gesellschaft“ verwandelt. Der Zweite Allrussische Gewerkschaftskongreß im Januar 1919 hatte das Prinzip der „Verstaatlichung“ der Gewerkschaften akzeptiert. Dies bedeutete einerseits, daß der Volkskommissar für Arbeit von den Gewerkschaften gewählt werden sollte, andererseits Arbeiterstreiks illegalisiert werden sollten.
Die Gewerkschaften sollten die ganze Volkswirtschaft verwalten und gleichzeitig die neue „sozialistische Arbeitsdisziplin“ herstellen. 1920 schlug Trotzki mit anfänglicher Unterstützung der Mehrheit der Parteiführer die „Militarisierung der Arbeit“ vor. Alle Eisenbahnbediensteten wurden als „für den Arbeitsdienst mobil gemacht“ erklärt und frühere Bataillone der Roten Armee wurden in „Arbeitsarmeen“ überführt.
Lenin und andere distanzierten sich zunehmend von dieser Politik, die zu ständigen Konflikten mit den Gewerkschaften führte, aber erst mit der Annahme der NÖP im März 1921 wurde die formale Verpflichtung zur „Militarisierung der Arbeit“ fallengelassen.
Gleichzeitig wurde der Verstaatlichungsplan der Gewerkschaften auf einen langfristigen Plan zurückverwiesen, der den Gewerkschaften einstweilen gestattete, die unmittelbaren Arbeiterinteressen in Konflikten mit ihrem eigenen Staat zu vertreten.
Die Nationalisierung der Banken schuf nicht, wie erhofft, ein effektives Instrumentarium für die Leitung der Industrie, und die Annullierung der Schulden des alten Regimes löste nicht das Problem der Finanzierung öffentlicher Ausgaben. Industrieverwaltung und bewußte Wirtschaftslenkung erforderten einen viel verfeinerteren Apparat, als die Banken bieten konnten, und so etwas wurde erst später teilweise mit dem Glavki – System aufgebaut. Gleichzeitig war ein effektives Maßsystem für die relative Ergiebigkeit und Produktivität erforderlich, als das zur Verfügung stehende alte System, das Geldwesen, aktiv untergraben wurde.
Da die verschiedenen Steuern keinen großen Haushaltsertrag erzielten, blieb als einzige bedeutendere Einkommensquelle für die Regierung die Druckerpresse. Als Resultat stieg die Inflation in einem solchen Ausmaß, daß viele mit Gütern zum Verkauf (besonders die Bauern) sich weigerten, weiterhin Papiergeld anzunehmen. Unter der Führung des früheren Linkskommunisten Krestinski, verfolgte die Zentralbank eine Politik der Hyperinflation als Steuer auf den Reichen, und um das bürgerliche Geldsystem zu zerrütten.
Unter der Wucht dieser Politik schaltete die Staatsindustrie so weit wie möglich auf Naturaltausch um; ein unter der offiziellen Parole „Für eine proletarische Naturalwirtschaft!“ gerechtfertigter Schwenk. Um 1919 wurden Arbeiter zunehmend in Sachleistungen bezahlt und 1920 wurden Basisgüter und -dienstleistungen umsonst zur Verfügung gestellt. Bezahlung für Kantinenmahlzeiten, Postdienste, Telefon, Wasser, Gas und Elektrizität wie auch Mieten wurden abgeschafft.
Jedoch existierten die materiellen Voraussetzungen für einen solchen Abkürzungsweg zum Sozialismus nicht. Dies wurde durch den gewaltigen Anstieg des Papiergeldvolumens deutlich, das für Verbraucher und Unternehmen notwendig blieb, um Güter vom Schwarzmarkt zu erhalten. So provozierte die späte Kriegskommunismuspolitik sowohl das Ressentiment von Arbeitern und Bauern, wie es auch die Ökonomie ohne irgendeine Möglichkeit zurückließ, ihre eigene Entwicklung zu messen oder festzulegen, wie sie sich unter Friedensbedingungen neu orientieren sollte.
Proletarische Planung im Sinne langfristigen und konstruktiven Unternehmens für den Übergang zum Sozialismus begann vor dem Bürgerkrieg mit einem Auftrag Lenins an die Akademie der Wissenschaften. Sie wurde gebeten, ‘so schnell wie möglich einen Plan für die Reorganisation der Industrie und die wirtschaftliche Wiederbelebung Rußlands auszuarbeiten’.
Ähnlich begann Vesenka durch sein „Komitee für öffentliche Arbeiten“, Anfang 1918 Projekte zu planen. Sie machte sich daran, eine 1700 km lange Eisenbahnlinie zu bauen, um das Kohlebecken von Kusnetzk mit den Industrien am Ural zu verbinden. Mit dem Ausbruch des Bürgerkrieges wurden alle diese Projekte aufgegeben, als die größte Verfügungsgewalt über Ressourcen in die Hände der „Außerordentlichen Kommission für die Versorgung der Roten Armee“ gelegt wurde.
Vesenka schaffte es nie, die „einheitliche zentrale wirtschaftliche Autorität“ zu werden, als die ihre Führer sie zu funktionieren wünschten. Ähnlich teilte die „Nutzbarmachungskommission“, die gegründet wurde, um Nutzungspläne für alle einzelnen Produkte aufzustellen, ihre Autorität mit den Beschaffungsabteilungen der Glavki. Im März 1920 schlug Trotzki die etwas auf Kosten der Glavki und der Nutzbarmachungskommission gehende Stärkung der regionalen Körperschaften und die Zentralisierung der Aufgabe nationaler Wirtschaftsplanung unter dem „Rat für Arbeit und Verteidigung“ (STO) vor, der alle Volkskommissare umfaßte, die mit ökonomischen Angelegenheiten befaßt waren. Sein Vorschlag wurde am 9. Parteitag angenommen.
1920 machte die Hyperinflation allen Fortschritt auf einen einheitlichen Wirtschaftsplan zu unmöglich, aber das Jahr erblickte bedeutende Teilpläne, z. B. Anordnung 1042, die Trotzkis Plan für die Reorganisation der Eisenbahnen war. Lenin billigte solche konkreten Pläne und favorisierte besonders die Kommission für die Elektrifizierung Rußlands (Goelro), die ein Zehnjahresprojekt für die Entwicklung eines „Netzwerks von Elektrizitätskraftwerken“ in Rußland umriß. Nicht eher als 1921 begann Gosplan seine Arbeit am einheitlichen Wirtschaftsplan und es sollte mehrere Jahre dauern, bis diese Arbeit effektiv werden konnte.
Der Kriegskommunismus bedeutete die plötzliche Abschaffung des Kapitalismus im Unterschied zu der in den ersten sechs Monaten der Revolution verfolgten Politik von Kontrolle und Unterordnung. Er unterdrückte das Wertgesetz in Schlüsselsektoren der Industrie durch die Aneignung politischer Kriterien für Preisbildung, Kreditzuteilung – und in seiner späteren Phase – Naturalientausch.
War das Planung? Ja, aber losgelöst vom Übergang zum Sozialismus. Es war eine kurzfristige und verzweifelte Form von Planung, um den Krieg zu gewinnen, aber keine proletarische Planung im Sinne des marxistischen Programms. Letztere war ausgelegt als eine Reihe von Schritten in Richtung einer sozialistischen (d. h. nichtstaatlichen) Ökonomie. Dies beinhaltete die Konstruktion eines Systems von Wirtschaftslenkung, das auf der Arbeitszeit basiert, effizient, durchschaubar und komplett von den Produzenten kontrolliert ist. Und dies schließt im Gegenzug ein Wachstum der Produktivkräfte und eine Abnahme sozialer Ungleichheit ein.
Die russische politische und militärische Situation zwischen Mitte 1918 und Anfang 1920 ließ das nicht zu. Natürlich rettete der Gewinn des Krieges die proletarische Diktatur und dadurch die Möglichkeit irgendeines Übergangs zum Sozialismus; deshalb war der Kriegskommunismus taktisch rationell und geschichtlich gerechtfertigt. Nichtsdestoweniger kann dies die Tatsache ändern, daß während der Periode des Kriegskommunismus die Wirtschaft wie die plebejischen Klassen enorm litten und dies einen riesigen Rückschlag für den Übergang zum Sozialismus darstellte.
Abgesehen von der – einfach gesagt – Zerstörung der Produktivkräfte und dem Schrumpfen der Arbeiterklasse (auf 1,3 Millionen Arbeiter 1921 von 3 Millionen 1917) war der Kriegskommunismus auch – im Gegensatz zu seinen Absichten – ein Regime zunehmender Ungleichheit. Die Privilegien der Spezialisten wurden nicht abgebaut, sondern gesteigert und Schwarzmarkthändler aller Art schlugen aus dieser Situation „verallgemeinerten Mangels“ enorme Profite.
Es war ein Fehler und Ausdruck theoretischer Unreife, daß die meisten Bolschewiki den Kriegskommunismus selbst als Teil des Übergangs zum Sozialismus ansahen. Dies war Bucharins Position in seiner Ökonomik der Transformationsperiode, einer Arbeit, die Lenin grundlegend bejahte.
Selbst Trotzkis Vorschläge von 1919/1920 legten nahe, daß der Kriegskommunismus der Ausgangspunkt für den Übergang zum Sozialismus sei. Im Februar 1920 skizzierte er drei Bedingungen dafür: a) eine Naturalsteuer für die Bauern, die ihnen gestatten würde, ihr Mehrprodukt gegen Industrieerzeugnisse zu einer vom Staat festgelegten Austauschrate zu handeln; b) die Militarisierung der Arbeit als Basis für jede zukünftige Arbeitszeitkalkulation; und c) die Beschneidung des ausufernden Bürokratismus“ des Glavki – Systems.
Mit anderen Worten, obwohl Lenin und Trotzki ursprünglich den Kriegskommunismus als pragmatische Antwort auf die Kriegssituation ansahen, gaben sie später der ultralinken Sichtweise nach, von dort zu starten, um zum Sozialismus zu kommen.
Aber gab es eine Alternative? Für die Dauer des totalen Bürgerkriegs, d. h. bis Anfang 1920, lautet die Antwort: wahrscheinlich nicht.
Mit einer klaren theoretischen Analyse der wirtschaftlichen Optionen wäre ein früherer Wechsel zur NÖP jedoch möglich gewesen. Das Jahr 1920 hätte genutzt werden können, um die NÖP vorzubereiten durch Stabilisierung des Geldangebots und die Einführung beschränkter Märkte auf dem Lande. Das hätte nicht nur Zeit gewonnen, sondern der Arbeiterklasse und den armen und mittleren Bauern die schlimmsten Aspekte des späten Kriegskommunismus erspart.
Neue ökonomische Politik
Lenins Neue Ökonomische Politik (NÖP) wurde von der Partei im März 1921 vor dem Hintergrund des Kronstädter Aufstands und der Bauernrevolte in der Region Tambow angenommen. Zwangsbeschaffung von Korn wurde abgeschafft und durch eine Steuer ersetzt, die niedriger als das vorhergehende Beschlagnahmeniveau war.
Was immer die Bauern behielten, konnten sie frei auf den lokalen Märkten handeln. Selbst der ursprünglich „auf lokale Märkte“ beschränkte Zugang wurde bald gelockert, weil die Versorgung der Städte ohne Zwischenhändler unmöglich war.
Gegen Oktober 1921 wurde klar, daß die NÖP nicht auf die Agrikultur beschränkt werden konnte; das neue Herangehen mußte auf alle Wirtschaftsbereiche ausgedehnt werden. Die Partei behielt die zentrale Kontrolle über die sogenannten „Kommandohöhen“ der Ökonomie, d. h. Bankensektor, Außenhandel, große Industrie und Transportwesen, aber die Gesamheit der Verhältnisse in der verstaatlichten Industrie wurde neu unter die Lupe genommen.
Tausende kleiner staatlicher Läden wurden an private Unternehmer verpachtet oder sogar verkauft. Später wurden sogar einige private Großunternehmen zugelassen; um 1924/25 waren etwa 18 Privatfirmen in Betrieb, die jede zwischen 200 und 1000 Arbeiter beschäftigten.
Ende 1921 war die Industrie komplett umstrukturiert. Unternehmen ähnlicher Art wurden in Trusts vereinigt und diese wurden angehalten, von Anfang 1922 an auf rein kommerzieller Grundlage zu operieren. Güter sollten dort verkauft werden, wo sie den höchsten Preis erzielten und Rohstoffe sollten von den billigstmöglichen Quellen gekauft werden. Der Staat würde nicht bedingungslos Kredite gewähren, sondern nur, wo es eine gute Chance gab, einen beachtlichen Gewinn zu sichern.
Das Volkskommissariat für Finanzen versuchte, den Rubel zu stabilisieren und deshalb mußte das Geldangebot bechränkt werden. Dies führte im Gegenzug zur Schließung einiger Fabriken und in anderen zur Verminderung der Belegschaft. Da die meisten Firmen keine Finanzreserven besaßen, waren sie zum Verkauf ihres Ausstoßes zu beinahe jedem Preis gezwungen. Weil die Nachfrage niedrig war, waren es auch die Industriepreise und die Arbeitslosigkeit stieg als Konsequenz.
Lenin verteidigte die Notwendigkeit dessen, was heute „Schocktherapie“ genannt werden könnte. Mehr noch, er argumentierte, es solle ausländischen Firmen erlaubt sein, russische Ölfelder auszubeuten und russisches Holz zu exportieren, weil dies Devisen einbrächte und dem Arbeiterstaat erlauben würde, essentielle Materialien und Technologien zu importieren. Praktisch stellte die Feindschaft der internationalen Bourgeoisie sicher, daß der Import von Auslandskapital wähernd der 1920er Jahre schwach blieb, obwohl der auswärtige Handel wieder zunahm und 1924/25 die Exporte neunfach höher als 1921/22 waren.
Während der NÖP wurden die meisten Preiskontrollen abgeschafft. Trotz der besten Absichten der Regierung gestattete das der Inflation, sich in die Höhe zu schrauben. Industriepreise waren folglich nur in relativen Begriffen niedrig, gemessen am Preis für Lebensmittel und Rohmaterialien. Aus diesem Grund gab die Sowjetregierung Mitte 1922 eine neue Währung heraus, den Tscherwonez. 1923 existierten Rubel und Tscherwonez nebeneinander, wobei der Tscherwonez stabil war, aber bei alltäglichen Transaktionen selten benutzt wurde und der Rubel täglich abgewertet wurde, als die Inflation zunahm.
Ohne die Wirtschaft absichtlich in eine vollständige Krise zu steuern, war es unmöglich, die Inflation sofort zum Stillstand zu bringen und erst im Februar 1924 konnte der Rubelkurs wieder umdrehen. Zu der Zeit war ein Tscherwonez 500 Milliarden Rubel von 1921 wert! Die vom Volkskommissar für Finanzen, Sokolnikow, eingeleiteten Maßnahmen griffen gut genug, so daß der Regierungshaushalt für 1924 einen kleinen Überschuß erzielte.
Während 1922 die Preise stark zugunsten der Bauern geschwankt hatten, war das Pendel im Herbst 1923 vollständig in die andere Richtung geschwungen. Industriepreise waren nun dreifach höher als Agrarpreise, verglichen mit den Relationen von 1913. Dies wurde mit Trotzkis denkwürdigem Satz als die „Scherenkrise“ bekannt: eine sich weitende Lücke zwischen steigenden Industriepreisen und sinkenden Agrarpreisen – gefährlich scharf wie eine Rasierklinge! Viele Bauern zögerten, bevor sie ihr Getreide in die Städte brachten. Dies bedrohte nicht nur die Lebensmittelversorgung der Städte, sondern auch die strategische Allianz im Herzen des politischen Systems – das Arbeiter- und Bauern – Bündnis (Smytschka).
Die Ursachen für die Änderung der relativen Preise waren ganz offensichtlich. Die Agronomie hatte sich viel schneller als die Industrie erholt, weil sie nicht soviel technologischer Erneuerung bedurfte und nicht so hart von der mangelhaften Transportinfrastruktur beeinträchtigt war. Zweitens hatte Vesenka den industriellen Wetbewerb zwischen den Trusts eingeschränkt, indem es viele von ihnen in einheitlichen „Syndikaten“ kombinierte. Dies gestattete den Trusts, Monopolpreise festzulegen. Schließlich wurde im Vergleich zu 1922 die Kreditpolitik wieder gelockert; dies hob den Druck auf die Unternehmen auf, zu herrschenden Marktpreisen zu verkaufen. Als Resultat füllten sich die Lager und viele Fabriken produzierten weit unter ihrer vollen Kapazität.
Ende 1923 wurden drastische Maßnahmen unternommen, um das Steigen der Industriepreise umzukehren. Preiskontrollen wurden eingeführt und Arbeiter entlassen, um Produktionskosten zu senken. Kredite zu erhalten, wurde erschwert, um die Firmen zu zwingen, ihre Lagervorräte zu verkaufen. Gleichzeitig wurde eine staatliche Handelsorganisation gegründet, die der Industrie erstmals erlaubte, ihre Produkte direkt an die Dörfer zu verkaufen. Dies machte viele NÖP-Zwischenhändler überflüssig und gestattete, die Ersparnisse an die Bauern in Gestalt niedrigerer Preise weiterzureichen. Durch diese miteinander verknüpften Maßnahmen gelang es der Regierung, bis April 1924 die relativen Industriepreise um mehr als die Hälfte zu kürzen.
1924 und 1925 waren die „besten Jahre“ der NÖP in dem Sinne, daß Landwirtschaft und Industrie verhältnismäßig harmonisch expandierten und das Vorkriegsniveau der Produktion wieder erreichten oder sogar übertrafen. Etwa 90% aller Industriearbeiter arbeiteten in Trusts, die Vesenka direkt oder indirekt untergeordnet waren. Die Fabriken waren weder souveräne ökonomische Einheiten noch legal unabhängig. Sie machten keine eigenen Finanzkonten auf; ihre Zahlen wurden dem Abschneiden des Gesamttrusts angepaßt.
Vesenkas Politik gegenüber verschiedenen Trusts variierte. In strategischen Sektoren erließ er detaillierte Anordnungen und überwachte ihre Durchführung. In der Leichtindustrie mußten die Trusts Produktionspläne entsprechend den vorherrschenden Marktbedingungen erstellen, und Vesenka intervenierte nur sporadisch. Es gab damals keine zentrale Planung. Verschiedene Planfunktionen waren nicht einmal in einer gesamtrussischen Institution zusammengefaßt. So wurde eine bruchstückhafte administrative Planung von Promplan, der Planabteilung des Vesenka, durchgeführt, wohingegen die Vorbereitung umfassender nationaler Planung in den Händen von Gosplan lag, einer Forschungs- und Koordinierungsstelle des STO (Rat für Arbeit und Verteidigung).
1925/26 veröffentlichte Gosplan erstmals „Kontrollzahlen“, die jede Wirtschaftsaktivität im Lande in den verschiedenen Branchen und in ihren entsprechenden Proportionen widergaben und darstellten. Zusätzlich enthielten sie eine Prognose über mögliche zukünftige Trends. Es gab eine gehörige Portion an Opposition in der aufstrebenden Bürokratie gegen wachsende Machtbefugnisse für Gosplan. So beklagte sich Krschischanowski, der Leiter von Gosplan, auf dem 15. Parteitag über den Mangel an Zusammenarbeit seitens anderer Verwaltungsgremien. Obwohl die Kontrollzahlen keine Plandirektiven waren, waren sie nichtsdestotrotz mehr als rein passive Vorhersagen. Sie waren eine Ansammlung von Richtlinien für strategische Investitionen und die Grundlage für eine Diskussion über wirtschaftliche Prioritäten.
Bis zur Scherenkrise befand sich der Handel, Einzel- wie Großhandel, fast ausschließlich in privater Hand. Von 1924 an war eine Staatshandelsorganisation tätig und das genossenschaftliche Handelssystem wurde verbessert. Obwohl der Anteil des Privatsektors am Einzelhandel 1925/26 auf 42% fiel und ein Jahr später auf 37%, wuchs der private Handel in absoluten Begriffen kontinuierlich an; der Handel war deshalb ein wichtiger Bereich, in dem sich eine „neue Bourgeoisie“ entwickeln konnte.
Während die große Industrie vorwiegend in Staatshand verblieb, war die Situation innerhalb der Kleinindustrie ganz verschieden. Weniger als 2% der in dieser Sparte beschäftigten Arbeiter arbeiteten in vom Staat betriebenen Firmen; der Rest gehörte zum privaten Industriesektor, der zu einer zweiten wichtigen Arena wurde, in der sich die neu entstehende kapitalistische Klasse kräftigen konnte. Natürlich waren die Privateigner in vielen Fällen stark vom Staatssektor abhängig, der deshalb eine gewisse Kontrolle über den Markt ausüben konnte. Andererseits kontrollierten die NÖP-Männer nicht nur die traditionellen Dorfgemeinden, sondern auch zunehmend die ländlichen Sowjets. Auf diese Weise wurden sie zu einer politischen Kraft, die auf den Arbeiterstaat Druck auszuüben suchte, größere Geschäftsfreiheit zu gewähren.
Die Landwirtschaft blieb während der ganzen NÖP-Periode überwiegend privat. 1927 wurden weniger als 2% des bewirtschafteten Landes von Staatsfarmen oder Kooperativen kultiviert. Tatsächlich hatte die Landreform nach 1917 die Anzahl kleiner Bauerngrundstücke angehoben (von 17 Mio. auf 25 Mio.), wohingegen die Durchschnittsgröße abnahm.
Die traditionelle russische Dorfgemeinde wurde gestärkt und dies bedeutete eine Erstarkung des ideologischen Zugriffs von Privateigentum und der Bourgeoisie. Natürlich gereichten Wachstum und Ausdehnung des Markts unter der NÖP nicht allen Bauern zum Wohl; im Gegenteil, sie trugen zu wachsender Klassendifferenzierung auf dem Land bei. Reichtum und Einfluß der reichen Bauern (Kulaken) nahmen zu. Ein Drittel aller Bauern heuerte Lohnarbeiter an. Andere pachteten zusätzliches Land von ärmeren Bauern, einige verliehen Geld zu exorbitanten Zinsraten oder Getreide an Klein- und Mittelbauern im Frühjahr, wenn diese ihre Rücklagen aufgebraucht hatten.
Die Kulaken selbst waren nicht gezwungen, all ihr Korn unmittelbar nach der Ernte zu verkaufen, sondern konnten es bis zum nächsten Frühling und Sommer einlagern, wenn sie einen Vorteil aus viel höheren Preisen ziehen konnten. Die Kulaken waren offensichtlich der Kern der russischen Bourgeoisie in den 1920ern. Sie identifizierten sich mit dem Standpunkt der neuen kommerziellen und kleinindustriellen Bourgeoisie. Zusammen führten sie einen Klassenkampf, um die Errungenschaften, die der Arbeiterklasse von der Oktoberrevolution gebracht worden waren, rückgängig zu machen.
Die Parteiführer gestanden diese Gefahren nicht ein; noch weniger mobilisierten sie die Kräfte des Arbeiterstaats, um sie auszuschalten.
Vor dem ersten Weltkrieg waren es die halbfeudalen Großgrundbesitzer und die Kulaken, die das meiste Getreide an die Städte lieferten. Nach der Parzellierung der großen Landgüter und ihrer Umverteilung an Millionen landloser Bauern 1918, stieg der Anteil des auf dem Lande selbst verbrauchten Korns, während der an die Städte gelieferte oder für den Export abgezweigte Umfang dramatisch sank.
Mitte der 1920er Jahre, als das Ausmaß an Saatfläche und geernteten Getreides wieder Vorkriegsniveau erreichte, umfaßte noch das des vermarkteten Korns nur die Hälfte der Menge von 1913. Dies traf hauptsächlich den Export, was im Gefolge die industrielle Entwicklungsrate verlangsamte, weil die Industrie vom Import von Kapitalgütern abhängig war. Die Getreideexporte erreichten 1913 mit 12 Mio. t ihren Höhepunkt, waren aber 1926 auf 2,1 Mio. gefallen.
1927 schrumpfte der Getreideexport weiter auf 0,3 Mio. t und die schon magere Versorgung der Städte geriet in Gefahr. Die Linke Opposition in der Kommunistischen Partei unter Führung von Leo Trotzki hatte lange vor dieser herannahenden Katastrophe gewarnt, die das voraussagbare Resultat der rechten Politik des herrschenden Blocks Bucharin/Stalin innerhalb der Partei und des Regierungsapparats war.
Eine Reihe „Spezialmaßnahmen“ wurde von der Regierung durchgezogen. Zusätzliche Industrielieferungen wurden schnell in die Kornanbaugebiete befördert; schwere Strafen wurden gegen Kornpreisspekulanten verhängt. Doch während des Jahrs vor dem Oktober 1928 fiel das Volumen des auf städtische Märkte verbrachten Getreides um weitere 14%. Die Städte standen kurz vor einer Hungersnot, obwohl genügend Angebot auf dem Land existierte. Mittlerweile wurde der Mangel an Industriegütern in den Dörfern auf die Höhe von 100 Mio. Rubel geschätzt.
Die Kulaken hatten den Einsatz bei ihrer Konfrontation mit der Regierung erhöht und brachten es fertig, alle Mittelbauern für ihre Seite zu gewinnen. Die Arbeiter- und Bauernallianz war an einer Bruchstelle angelangt, wenn nicht schon zerbrochen. Die Reaktion der Regierung auf diese Gefahr war widersprüchlich und spiegelte den Fraktionskampf in der Partei und die zentristische, schwankende Rolle der Bürokratie wider.
Schon 1926 hatte sich eine Fraktion der Bürokratie unter Sinowjew und Kamenjew von der pro-bürgerlichen Linie Bucharins angesichts wachsenden Drucks unzufriedener städtischer Arbeiter distanziert.
Sie schlossen sich mit der Linken Opposition zusammen, um die Vereinigte Opposition zu bilden. Stalin, der die Mittelfraktion der Bürokratie repräsentierte, blieb in seinem Block mit Bucharin, dem Führer der Rechtsopposition, die für die bessergestellten Bauern sprach. Für Stalin war die Niederlage der Linken die erste Priorität, weil sie allein die zunehmenden Privilegien der herrschenden Schicht abzuschaffen drohte.
Nichtsdestotrotz war Stalin gezwungen, der proletarischen antibucharinistischen Mißstimmung Lippendienste zu leisten. Gegen die immer schamloseren Aktivitäten der „Neureichen“ wurden einige Maßnahmen ergriffen; ihre Superprofite wurden einer Progressivsteuer unterworfen. Alles in allem jedoch leisteten diese Maßnahmen keinen entscheidenden Schlag, wie man an der Tatsache ersehen kann, daß der vom Privatsektor verdiente Anteil am Volkseinkommen zwischen 1926 und 1928 nur um 3% fiel und immer noch nahezu die Hälfte betrug.
Erst 1929 vollführte Stalin die entscheidende Wende zur Kollektivierung der Bauernschaft. Er setzte auch ein geschwindes Industrialisierungsprogramm in der Schwerindustrie durch, das unter Bedingungen ökonomischer Autarkie durchgeführt werden sollte.
Um es gegen jeden Widerstand durchzupeitschen, zentralisierte der stalinistische Apparat im Verlauf der nächsten paar Jahre die politische Macht weiter in seinen Händen und zerstörte die Überreste jedweder unabhängigen Organisationen (z. B. der Gewerkschaften), indem er sie mit der bürokratischen Staatsmaschine verschmolz. Die Wirtschaftslenkung wurde zur hyperzentralisierten Kommandoplanung von oben nach unten.
Die Debatte um Plan und Markt in der UdSSR in den 1920er und 1930er Jahren
Die Sowjetunion in den 1920er und 1930er Jahren war ein Laboratorium, in dem verschiedene Theorien über den Aufbau des Sozialismus auf den Prüfstand gestellt wurden. Marx und Engels hatten eine Handvoll andeutender Bemerkungen hinterlassen. Die Zweite Internationale hatte diese Einsichten wenig erweitert. Nun verlangten drängende praktische Probleme neue Antworten, Lösungen, die von mehr als vorübergehender akademischer Bedeutung waren. Das Schicksal von Revolutionen, die Geschicke von Dutzenden Millionen standen auf dem Spiel.
Die russische Oktoberrevolution von 1917 und die Erfahrungen der ökonomischen Transformation während der nachfolgenden zwei Jahrzehnte schieden scharf die Ansichten. Reformistische und offen bürgerliche Wirtschaftswissenschaftler verunglimpften allein die Idee des Übergangs zum Sozialismus als Utopie, wenn schon nicht generell, so doch mindestens in einem rückständigen Agrarland.
In diesen Jahren engagierten sich die Befürworter und Feinde des Sozialismus in Argumenten und Erwiderungen. Diese Debatte war in Rußland nicht weniger zugespitzt als außerhalb. Die Haupttheoretiker und Parteiführer des Bolschewismus beschäftigten sich mit Themen wie dem Charakter ökonomischer Kategorien in einer nachkapitalistischen Gesellschaft, dem relativen Gewicht von Marktmechanismen und geplanter Zuordnung in der Verteilung von Ressourcen, dem relativen Entwicklungstempo von Industrie und Agrarwirtschaft, der Funktion von Geld und Preisen, nachdem einmal das Wertgesetz nicht mehr länger souverän herrschte.
Bucharin
Da diese Debatte keine müßige akademische Übung war, drückten die Ideen natürlich mächtige soziale Kräfte aus, jede mit einem bedeutenden Anteil an der Ausrichtung der Wirtschaftspolitik nach der Revolution. Diese gesellschaftlichen Triebfedern fanden ihre Vertreter in leitenden Figuren innerhalb der Kommunistischen Partei. Nikolai Bucharin war während des Kriegskommunismus (1918 – 1920) ein Repräsentant des linken Flügels gewesen und hatte sich mehr als bereit gezeigt, administrativen Zwang einzusetzen, um ökonomische Ziele zu erreichen. Aber nach 1921/22 durchlebte er einen schnellen Wandel, zuerst in einen späten Konvertiten der NÖP und dann zum Führer des rechten Flügels in der Kommunistischen Partei.
Er argumentierte, die NÖP müsse für lange Zeit angewandt werden, wenigstens für eine ganze Generation. Jetzt sei Gewaltanwendung gegen die Bauernschaft unzulässig. Obwohl es politisch korrekter sein möge, die armen Bauern zu unterstützen, seien es die mittleren und reichen Landwirte, die das Getreide ablieferten und darum sei es wichtig, die Interessen dieser Schichten zu fördern. Jede andere Politik führe zu den alten Requirierungsmethoden zurück und zerstöre so das Arbeiter- und Bauernbündnis.
Bucharin war überzeugt, den Sozialismus entlang dieser Linie aufzubauen und es gehe nur um die Frage, welches Entwicklungstempo am besten sei. Nach Bucharins Auffassung war es unklug, schneller zum Sozialismus voranzuschreiten als die Bauernschaft bereit war; nach seinen berühmten Worten mußte Rußland ‘auf einer Bauernmähre zum Sozialismus reiten’. Er war sich sicher, daß selbst die Kulaken naturwüchsig dahin gelangen würden, den Sozialismus zu akzeptieren, wenn die Partei sie nicht entfremdete. Seine berühmte Aufforderung der Kulaken ‘Bereichert Euch!’ war nach seiner Ansicht nicht gegen den Sozialismus gerichtet, weil die sozialistische Industrie der Bauernwirtschaft immer und automatisch überlegen sei. Die Industrie brauche keine besondere Unterstützung durch den Staat.
Auf mehr theoretischer Ebene zog Bucharin den Schluß, daß das Wertgesetz ein universelles ökonomisches Gesetz sei, daß unter verschiedenen Gesellschaftsbedingungen nur verschiedene Erscheinungsformen annahm. Während des Übergangs von der einfachen Warenproduktion zum Kapitalismus hatte es sich verändert und es nehme im Übergang zum Sozialismus wieder eine andere Form an. Insbesondere würde es nicht in einer anarchischen, vom Markt geleiteten Weise wirken, sondern auf direkte und bewußte Art.
Er verstand den Plan lediglich als bewußte Vorwegnahme dessen, was andernfalls spontan erreicht würde. Bucharin erkannte natürlich an, daß der Plan der Gesellschaft ersparen könnte, Verschwendungsprojekte zu unternehmen und daß die Verteilung sicherlich gleichmäßiger sei. Nichtsdestoweniger sei die Produktionsstruktur im Grunde dieselbe und daraus folgte, daß das Wachstum des Markts keine grundlegende Bedrohung für den Arbeiterstaat aufwerfe.
Bucharins Konzeptionen verliehen der Anpassung von Schichten der Parteiführung an die kapitalistischen Elemente Ausdruck, die unter der NÖP stärker wurden. Sie leugneten explizit die Unvermeidlichkeit weiterer Klassenkämpfe unter der Diktatur des Proletariats. Doch es war dem Proletariat zunehmend klar geworden, daß, um die Macht zu behalten und weitere Fortschritte zu sichern, ein bewußter Kampf gegen das Bürgertum noch notwendig war.
Preobraschenski
Es fiel der Linken Opposition zu, die objektiven Interessen des Proletariats im Übergang zu formulieren, wohingegen die Bürokratie um Stalin herum in typischer Manier zwischen wechselndem Klassendruck herumlavierte, sich aber taktisch sehr früh mit dem rechten Flügel verbündete, weil sie sich zunehmend von der Bedrängnis seitens der Arbeiterklasse abkapseln wollte.
Hauptwirtschaftstheoretiker der Linken Opposition war Jewgeni Preobraschenski. Er betonte die Dringlichkeit für das Proletariat, die industrielle Wirtschaftsbasis des Arbeiterstaats zu entwickeln. Er lehnte die Idee, der Sozialismus könne im „Schneckentempo“ erreicht werden, vehement ab. Gefahren waren sowohl auf dem Welt- wie auf dem Binnenmarkt vorhanden. Wenn die sowjetische Industrialisierung nicht mit dem Westen Schritt halte und sich der Privatsektor schneller als der sozialistische Sektor entwickle, würde der Arbeiterstaat selbst von der besten Roten Armee nicht gerettet werden.
Das Tempo der sozialistischen Industrialisierung war entscheidend für ihn. Bei der ökonomischen Zielsetzung des Arbeiterstaats sollte ihm deshalb die höchste Priorität zukommen. Um die Geschwindigkeit der Industrialisierung zu steigern, mußte ein Teil des Agrarüberschusses abgeschöpft und in industrielle Investitionen umgelenkt werden und besonders, um ausländische Technologie zu erhalten. Das brächte eine breite Palette an Industrieerzeugnissen schneller auf das Land.
Der Mehrwerttransfer aus dem privaten landwirtschaftlichen zum staatlichen industriellen Sektor sollte sowohl über ungleichen Tausch (Preise für Industriegüter höher gesetzt als die Produktionskosten) wie eine Progressivsteuer erfolgen. Die reichen Bauern sollten die Hauptwucht dieser doppelten Steuerlast tragen, während den armen Bauern zu helfen sei und sie für die Produktion in Kooperativen durch billige Kredite und die Bereitstellung angemessener Technologie gewonnen werden sollten. Für Preobraschenski war es wichtig, das Bündnis mit den armen und mittleren Bauern zu stärken, aber es war eine Illusion, auf eine stabile Allianz mit den Kulaken zu hoffen.
Auf theoretischem Gebiet formulierte Preobraschenski ein spezifisches Wirtschaftsgesetz des sozialistischen Sektors in einer Übergangsgesellschaft. Dies nannte er das Gesetz der ursprünglichen sozialistischen Akkumulation, das in fundamentalen Konflikt mit dem Wertgesetz gerät, das im privaten Binnensektor und auf dem Weltmarkt vorherrscht.
Das Wertgesetz wurde von Preobraschenski nicht einfach als die kapitalistische Variante eines Universalgesetzes verstanden, das die Verausgabung von Arbeitszeit durch alle Geschichtsepochen hindurch regelt. Das eigentliche Wesen des Wertgesetzes beinhaltet die Unterordnung des lebenden Arbeiters unter das akkumulierte Kapital (d. h. die Maschinerie). Dieses Gesetz reproduziert zwangsläufig kapitalistische Produktionsverhältnisse und das auf stets erweiterter Stufenleiter, wenn es sich spontan entfalten kann.
Im Gegensatz dazu setzt das Gesetz der ursprünglichen sozialistischen Akkumulation spezielle Ziele für das Wachstum verschiedener Wirtschaftsbereiche. Darüberhinaus ist die Akkumulationsrate für die Gesamtökonomie durch die spezifischen Investitionsquoten, auf die man sich für den sozialistischen Sektor geeinigt hat, festgelegt. Teil des Gesetzes der ursprünglichen sozialistischen Akkumulation ist die eiserne Notwendigkeit des Surplustransfers vom privaten zum sozialistischen Sektor. Alles, was dieses Gesetz verletzt, bringt den Arbeiterstaat in Gefahr.
Kritiker haben mehrere Vorwürfe gegen Preobraschenski gerichtet, die unbegründet sind. Zuerst ist da die Frage seiner Analysemethode. Preobraschenski verteidigte, daß es ein wesentlicher erster Schritt sei (einer, den Marx selbst machte), die Ökonomie der Transformationsperiode in Abstraktion von der Politik zu analysieren. Dies bewog Bucharin, ihn dafür zu kritisieren, die kapitalistische Produktionsweise mit der nachkapitalistischen gleichzusetzen, eine in den 1970ern von maoistisch inspirierten Stalinisten, die argumentierten, der proletarische Staat sei nicht länger Teil des politischen Überbaus, sondern eine integrale Komponente der Produktionsverhältnisse selbst, wiederholte Anklage.
So, wurde entgegnet, sei es nicht möglich, von diesem Apparat selbst im ersten Stadium der ökonomischen Analyse zu abstrahieren. Preobraschenski wurde heftig kritisiert für seinen ‘ökonomistischen Irrtum’, der ihn, so sagte man, dahin führe, das Arbeiter- und Bauernbündnis unterzubewerten und im Ergebnis zu einer sektiererischen Politik gegenüber den Bauern.
Dieser Vorwurf ist ein kompletter Unsinn. Solange eine von der Zivilgesellschaft getrennte Staatsmaschine existiert (und dies ist auch für einen gesunden Arbeiterstaat der Fall, bis er abstirbt), werden die politischen Formen in letzter Analyse von der Wirtschaftsstruktur, auf denen sie beruhen, determiniert. Um den Rahmen, in dem Staatspolitik gemacht wird, und den Charakter der Institutionen, die sie ausführen, zu verstehen, ist es deshalb notwendig, die grundlegendsten Gesetze, die die Gesellschaft regieren, zuerst zu analysieren.
Mit dieser Kritik verknüpft ist der Einwand gegen den Gebrauch des Begriffs „Gesetz“, wenn man auf die Regulierung des nichtkapitalistischen, „sozialistischen“ Sektors anspielt. Zugegeben, eine solche Begrifflichkeit suggeriert, daß im Arbeiterstaat gleiche blinde Prozesse am Werk sind wie im Kapitalismus. Dies, so wird gesagt, würde die Bedeutung einer lebendig pulsierenden, bewußt artikulierten Arbeiterdemokratie in der Übergangsperiode unterbelichten und bereite damit den Weg für ein bürokratisches und administratives Regime.
Die Stalinisten konnten z. B. die Vorstellung von einem „objektiven ökonomischen Gesetz“ ausnutzen, um ihr Zermalmen der Arbeiterselbstverwaltung am Arbeitsplatz und der Sowjetdemokratie in der Gesellschaft zu legitimieren. Dieser Einwand gegen die „gesetzliche“ Natur der sozialistischen Akkumulation ist auch von Antistalinisten wie Cathárine Samary, einer führenden Theoretikerin des Vereinigten Sekretariats der Vierten Internationale, wiederholt worden, aber das ändert nichts daran, daß er falsch ist.
Jeder isolierte Arbeiterstaat wird intern von überlebenden kapitalistischen Elementen belastet und wird von einem feindlichen kapitalistischen Weltmarkt umgeben. Dies zwingt dem Arbeiterstaat eine Verpflichtung auf, ganz bestimmte Akkumulationsraten auf sich zu nehmen und spezifische Ziele für den Surplustransfer vom privaten zum staatlichen Sektor zu setzen. Dieser Zwang wird akkurat als Gesetz beschrieben. Dies schließt nicht aus, daß dieses Gesetz verstanden und bewußt gehandhabt wird. Aber es bleibt ein Gesetz.
Und was ist mit dem Internationalismus Preobraschenskis? Nahmen seine Ideen, die Geschwindigkeit der Industrialisierung in der Sowjetunion zu beschleunigen, Stalins „Linkswende“ 1928/29 vorweg? Sind sie im Wesen mit Stalins Theorie des „Sozialismus in einem Lande“ kompatibler als mit Trotzkis permanenter Revolution? Nein!
Von Preobraschenskis Frühschriften bis zu seinen Schriften in den frühen 1930ern, betonte er wiederholt die Notwendigkeit der internationalen Revolution als der einzigen Lösung für die ökonomischen Probleme der Sowjetunion. Er war ein führendes Mitglied der Linken Opposition und beachtete alle ihre internationalistischen Positionen treu. Es ist wahr, daß seinem Internationalismus die vollständige Konsistenz fehlte. Als 1928 die kommunistische Bewegung ausführlich die Perspektive für die chinesische Revolution diskutierte, stimmte Preobraschenski mit Trotzki nicht überein. Er empfand, daß China nur für eine bürgerliche Revolution reif sei. Das mißachtete natürlich das internationale Wesen des Klassenkampfs, zeigte einen Mangel an Verständnis vom imperialistischen System und hielt vor einem klaren Verständnis des Konzepts der permanenten Revolution an.
Preobraschenskis Position zu China war seine erste Kapitulation vor Stalin. Er distanzierte sich später (1929) ganz klar von Trotzki und denunzierte sogar andere Oppositionelle, die vor die stalinistischen Schauprozesse als Angeklagte zitiert wurden (1936 – 38). Was im Lauf seiner Entwicklung klar wurde, ist, daß er ein völlig unzureichendes Verständnis von der Natur der stalinistischen Bürokratie hatte.
Natürlich sah Trotzki selbst irrtümlich den Hauptfeind in den 1920ern im rechten Flügel und das stalinistische Zentrum nur als mehr oder weniger schwankende und instabile Kraft. Die Liquidierung der Linken Opposition 1927 schuf jedoch eine neue Situation. Die Bürokratie schloß sich als selbstbewußte Kaste mit eigenen Interessen gestärkt zusammen und begann, offen um die volle Macht zu kämpfen. Der Schlag Stalins gegen die Rechte mußte in diesem Zusammenhang gesehen werden. Er war nicht so sehr ein Zugeständnis an die Arbeiter und die Linke Opposition als ein Mittel, die ungeteilte bürokratische Macht zu sichern.
Preobraschenski nahm das nicht wahr oder akzeptierte es nicht. Mehr noch, sein Unvermögen, die Stadien der stalinistischen Konterrevolution zu verstehen, spiegelte sich insoweit in seinem Werk wider, als er nie die Bedeutung des proletarischen Bewußtseins bei der Durchführung des Gesetzes der ursprünglichen sozialistischen Akkumulation in einer Reihe spezifischer Aufgaben vollständig explizit machte. Dieses Gesetz kann sich nur positiv geltend machen durch die subjektive Tat der viele Millionen starken Arbeiterklasse; solche ein Bewußtsein kann durch bürokratischen Paternalismus nicht ersetzt werden. Klarheit über diesen Punkt scheidet den unverfälschten Trotzkismus vom wertvollen, aber uneinheitlichen Erbe Preobraschenskis.
Trotzki
Trotzkis Beiträge zum marxistischen Kanon über den Übergang zum Sozalismus entstanden nach 1921 durch eine Serie fraktioneller Debatten innerhalb der führenden Komitees der Russischen Kommunistischen Partei. Sie kann man eher in einer Reihe von Politikrezepten für die Überwindung der Isolierung und Rückständigkeit des kriegsgebeutelten Rußlands finden als in abstrakten theoretischen Texten.
Trotzdem sind Trotzkis Gedanken lehrreich, viele von ihnen in seinem Buch von 1936 ‘Die Verratene Revolution’ in ein System gebracht. Während der 1920er und 1930er verkörperten seine Vorstellungen eine realistische und praktische Perspektive für Wirtschaftswachstum in sozialistische Richtung. Sie standen in auffälligem Kontrast zu jenen, die eine Politik staatskapitalistischer Industrialisierung unter dem Diktat der Finanzen und mit von der Geschwindigkeit der landwirtschaftlichen Entwicklung bestimmten Schritten befürworteten wie auch zu denen, die für die Politik des „Sozialismus in einem Lande“ und ihre abenteuerlichen Industrialisierungsziele stimmten.
Trotzkis Beitrag zur politischen Ökonomie des Übergangs umfaßt fünf zusammenhängende Gebiete. Erstens beharrte er darauf, daß der Arbeiterstaat eine Anzahl ererbter ökonomischer Kategorien und Mechanismen (z. B. stabile Währung, Märkte) übernehmen und nutzen muß. Zum zweiten trat er für die geplante Industrialisierung der rückständigen russischen Wirtschaft ein, um die Arbeitsproduktivität zu erhöhen und die Arbeiterklasse zu stärken.
Als nächstes, argumentierte Trotzki, sollen das Industrialisierungstempo höher angesetzt sein als das der Agrarwirtschaft und die Finanzen in den Dienst der Industrie gestellt werden, nicht umgekehrt. Viertens sah er als drängend an, einen umfassenden Plan für alle Abschnitte des Finanzwesens, der Produktion und Verteilung zu formulieren, sobald es die materiellen Möglichkeiten zuließen, und somit den Markt unterzuordnen und zu manipulieren, so daß er den Aufgaben des sozialistischen Aufbaus diente.
Schließlich und entscheidend war Trotzki ein beständiger Fürsprecher für Arbeiterdemokratie (in Verbrauch und Produktion) als dem einzigen Weg, die Qualität der Produktion auf rationeller Basis zu verbessern, ein stimmiges Bild zu bekommen, welche Hilfsquellen der Gesellschaft zur Verfügung ständen, als einzigem Weg, die wirksame Erfüllung des Plans zu überschauen.
Trotzki und Lenin waren sich zusammen mit der überwältigenden Mehrheit der Kommunistischen Partei 1921 über die Wende zur NÖP einig. Die Verwüstung der Wirtschaft im Kriegskommunismus machte es notwendig und das Ende des Bürgerkrieges möglich, einen konzentrierten Versuch zu unternehmen, die Nahrungsmittelerzeugung wiederzubeleben. Die wurde gebraucht, um die Städte zu ernähren und einen Kornüberschuß für den Export zu bilden, der die für Kapitalimporte nötigen Devisen einbrächte. Die NÖP brachte eine Neubelebung des Privatsektors im Einzelhandel und in der Kleinindustrie wie auch materielle Anreize für die Bauern mit sich. Obwohl der Staat das Eigentum an den hauptsächlichen Produktions- und Kommunikationsmitteln behielt, war die Nationalisierung allein auf sich gestellt unzureichend, um die sozialistische Leitung des Wirtschaftsaufbaus zu garantieren. Die NÖP könnte nur eine Waffe für den Sozialismus sein, wenn sie einem umfassenden Plan untergeordnet sei; alles Andere würde sicherstellen, daß eine Marktstärkung die kapitalistische Entwicklung vertiefte.
Deshalb machte sich parallel zur NÖP im April 1921 Gosplan an die Arbeit. Im ersten Jahr bekämpfte Lenin viel zu ehrgeizige Schemata zur gesamtwirtschaftlichen Planung aus dem Grund, daß die materielle Basis dafür fehlte (d. h. ein ausreichender Anteil des Staatseigentums an der Wirtschaft, genügend Sachverstand). Konkrete Teilpläne für einzelne Teile der Wirtschaft wurden in Angriff genommen (z. B. Verkehr, Elektrizitätserzeugung). Im Lauf von 1922 und 1923 wurde jedoch solche Teilplanung ungenügend, ja in der Tat gefährlich.
Der Erfolg der NÖP mit der Steigerung des agrikulturellen Ausstoßes resultierte in einem Ungleichgewicht innerhalb der Gesamtökonomie; Lebensmittelbestände gab es im Überfluß und die Preise fielen. Gleichzeitig blieb die industrielle Erholung zurück aus Mangel an Kapitalinvestitionen. Kapazitätseinschränkungen führten zu Kürzungen und die Preise zogen an. Eine „Scherenkrise“ kam auf, wo die Bauern nicht an die Städte verkaufen konnten und die Industrie nicht aufs Land. Die Reaktion auf diese Krise definierte die alternativen Konzeptionen von sozialistischer Umwälzung innerhalb der russischen Kommunistischen Partei; eine Kette scharfer Fraktionskämpfe brach 1922 aus und endete 1925 mit dem Sieg derer, die für den „Sozialismus in einem Land“ eintraten.
Trotzki und die Linke Opposition (LO) waren die einzigen, die eine Politik eines zentralisierten nationalen Plans vorbrachten, der alle Wirtschaftssektoren (Finanzwesen, Herstellung und Distribution) in ein zusammenhängendes Ganzes einband, das auf dem Vorrang der Industrialisierung und der Erhaltung einer stabilen Währung fußte. Entsprechend kämpfte Trotzki dafür, Gosplans Arbeitsweisen weg von reinen Voraussagen für Gebiete der Wirtschaft auf die Aufstellung von Zielen und Richtlinien für Produktion und Finanzsphäre zu richten.
Die Industrialisierung sollte durch Besteuerung der Agroprofite, Auslandsanleihen und Einkünfte aus Getreideexporten finanziert werden. Die Betonung sollte auf der Leichtindustrie liegen, wo Investitionen eine kürzere Anlaufzeit hatten, und die die von den Bauern dringend benötigten Güter herstellen würde. Kapitalimporte sollten sich auf jene Maschinen konzentrieren, die die UdSSR am wenigsten selbst zu produzieren in der Lage war.
Eine solche Politik rechnete für ihren relativen Erfolg nicht kurzfristig auf den Erhalt von Hilfe seitens einer erfolgreichen sozialistischen Revolution im industrialisierten Europa, noch suchte sie, die UdSSR von den Wirtschaften des kapitalistischen Westens zu isolieren. Vielmehr versuchte sie, die ausländische Revolution zu ermutigen und anzufachen, während sie an das ökonomische Eigeninteresse Europas und der USA appellierte, die Märkte für ihre Erzeugnisse und Auslaßventile für ihr Kapital brauchten.
Während der Formulierung dieses Programms unterstrich Trotzki erstmals die Bedeutung, eine stabile Währung aufrechtzuerhalten. Gegen jene, die dachten, es sei möglich, bürgerliche Kategorien wie Geld und Preise „abzuschaffen“ und nur Umgang in physikalischen Größen zu haben, bestand Trotzki darauf, daß jeder Fortschritt auf der Bedingung beruhte, ein unabhängiges Qualitätsmaß an in verschiedenen Produkten vergegenständlichter Arbeitszeit zu erhalten. Tatsächlich argumentierte Trotzki, solchen Messungen ein größeres Anwendungsgebiet zu geben als bisher in einem großteils rückständigen Agrarland getan wurde. Solche Politik war wesentlich, wenn eine wirkliche Verbesserung der Arbeitsproduktivität mit der Zeit akkurat gemessen werden sollte und an jenen in der kapitalistischen Welt herrschenden Niveaus.
In den Jahren 1922 – 25 wurde Trotzki und der LO von verschiedenen Fraktionen entgegnet. Auf dem einen Extrem stand Sokolnikow als Kopf des Finanzministeriums (Narkomfin), der für Rußland objektiv eine Politik des Staatskapitalismus verfolgte. Narkomfin wollte die NÖP auf eine höhere Ebene heben. Es argumentierte, da die UdSSR eine große, rückständige Bauernwirtschaft habe, käme der beste Ertrag für einen gegebenen Investitionsumfang aus der Agrikultur. Die UdSSR sollte deshalb ihren komparativen Vorteil ausnutzen und Korn exportieren sowie gewerbliche Erzeugnisse importieren.
Bucharin argumentierte, das Wohlergehen der Bauern führe sie dazu, ihr Geld für Industriegüter in einem Tempo auszugeben, das von ihrer Ausgabebereitschaft bestimmt war. Später könnte importierte Maschinerie zur Weiterverarbeitung von Agrarerzeugnissen eingesetzt werden und eventuell eine Schwerindustrie finanziert werden. Diese Politik befehligte 1922/24 eine Mehrheit im Politbüro. Sie betonte die Autonomie von Finanz und Kredit von der Industrie und ordnete sogar an, daß der Kredit für die Planung nicht zugänglich sei. Der Kredit sollte eingeschränkt werden, um die Stärke des Rubel zu bewahren; dies möchte es für ausländische Investoren deshalb attraktiv machen, den Kreditrahmen für importierte Maschinerie zu erweitern.
Eine solche Sichtweise von Wirtschaftsentwicklung konnte unter Bedingungen der NÖP nur zur Schwächung der sozialistischen Elemente der Ökonomie führen. Dies wurde durch die Tatsache hervorgehoben, daß das Finanzministerium darin hart blieb, die Kredite an die Industrie einzuschränken oder zu streichen, damit die Fabriken zu zwingen, ihre Produkte zu Preisen zu verkaufen, die die Lager räumten, um die Bauernnachfrage nach Industriegütern knappen Angebots zufriedenzustellen. Unter den damals existierenden Bedingungen der NÖP (Anweisungen, einen Gewinn zu erzielen) führte diese Politik 1923/24 zu niedrigeren Preisen, verzögerten Lohnzahlungen und Arbeitslosigkeit. Im Gegenzug führte diese gegen die Arbeiterklasse gerichtete bauernfreundliche Politik zu einem Aufschwung an industrieller Unruhe und linken Oppositionskräften innerhalb der Sowjets und der Partei.
Landwirtschaft vor Industrie, Finanzen über die Industrie – das war die antisozialistische Politik der Rechten und des Zentrums der RKP. Diese Politik war keine alternative Strategie für den Sozialismus in einem zurückgebliebenen Agrarland, wie sie dachten, sondern eine objektiv die kapitalistischen Bewegungsgesetze kräftigende Politik. Trotzki baharrte darauf, daß es ökonomischer Selbstmord sei, die Industrialisierungsschritte von der allmählichen Anhäufung der Sparguthaben abhängig zu machen.
Die teilweise industrielle Erholung unter der NÖP hatte ihre Grenzen erreicht; brachliegende Kapazität war nutzbar gemacht worden und der Wiederaufbau war zu Ende. Große Kapitalinvestitionen waren nötig, andernfalls konnte es keine Aussicht geben, die bäuerliche Güternachfrage zu stillen. Sie würden ihren Ausstoß horten oder mehr davon verbrauchen oder ihn sogar vernichten, weil die Preise für einen profitablen Verkauf an die Städte zu niedrig waren. Aber um Investitionen zu finanzieren, mußte es Zwangsersparnis geben und ein nationaler, integrierter Plan war lebenswichtig, denn Investitionen lieferten die gewünschten Ergebnisse erst mehrere Jahre später.
Die LO täuschte nicht vor, ihre Politik des sozialistischen Übergangs sei ohne Widersprüche – wirkliche gesellschaftliche Widersprüche. Sie existierten natürlich. Erstens durfte die Rate industrieller Akkumulation nicht so hoch angesetzt werden, daß sie auf Kosten der Gesundheit und Arbeitsbedingungen der Arbeiterklasse ginge; dies war ein großer Unterschied zur kapitalistischen Akkumulation.
Zweitens würden geplante Industrieinvestitionen notwendigerweise für Arbeiter wie Bauern zurückgestellten Konsum bedeuten. Dies könnte Bauern dazu verleiten, ihr Angebot zurückzuhalten. Dies würde wiederum zur Nichterfüllung von Exportaufträgen führen. Der resultierende Einbruch der Exportverdienste würde zwangsläufig mit der Unfähigkeit enden, viele benötigte Kapitalimporte zu kaufen.
Solchen sozialen Widersprüchen mußte ins Auge gesehen werden. 1922/23 war Handeln notwendig, um später eine größere Krise zu vermeiden. Die einzige wirkliche Chance, die Widersprüche zu mildern, war, sich Hilfe aus dem industriell weiter entwickelten Westen zu verschaffen; daher der Vorrang für die Suche nach dem revolutionären Erfolg in den Nachbarstaaten der UdSSR.
Im Verlauf von 1925 brach der Block gegen Trotzki in Wirtschaftsfragen in zwei Lager auseinander. Trotzki bewahrte zu beiden Abstand. 1924 vollzog Stalin einen entscheidenden Schwenk zur Theorie vom Sozialismus in einem Lande. Nachdem man 1923 versagt hatte, aus der deutschen Revolution Kapital zu schlagen, bezog er jetzt die konservative Position, daß Rußland nicht auf Hilfe von außen rechnen konnte und sich auf seine eigenen Ressourcen verlassen mußte.
Bucharin stimmte mit der Theorie überein und argumentierte, daß diese inneren Hilfsquellen hauptsächlich in der ländlichen Ökonomie zu finden wären; von daher müsse der Sozialismus „im Schneckentempo“ vorwärtskriechen. Obwohl Stalin im Block mit Bucharin verblieb, begann er sich in der Wirtschaftspolitik abzusetzen mit dem Verweis, wie notwendig es sei, der Entwicklung der Schwerindustrie, die auf einem riesigen, inflationären Kreditzuwachs beruhte, mehr Aufmerksamkeit zu widmen.
Die Wiederkehr der Kornkrise im Herbst 1925 schlug eine Bresche in den anti-Trotzki Block. Die Bauern hielten aus Mangel an Tauschgütern in den Städten ihr Getreide zurück. Bucharin und Stalin gewährten den Bauern weitere Zugeständnisse. Sinowjew, Kamenjew und Sokolnikow brachen ihren Block mit Stalin und Bucharin und argumentierten, die Kulaken seien die größte Gefahr für den sozialistischen Aufbau. Trotzdem hob Sinowjew an der Seite Sokolnikows die Notwendigkeit von Finanzdisziplin über die von industrieller Akkumulation hervor und scheiterte daran, Trotzkis Alternative anzunehmen.
Dank des Versagens, die Politik der LO zu akzeptieren, spitzte sich die Getreidekrise einmal mehr im Herbst 1927 zu. Das Ausbleiben der Investitionen, um die Güterknappheit 1925 zu überwinden, führte direkt zu den abenteuerlichen und bürokratischen Versuchen, die Bauern als Gesellschaftsklasse nach 1927 auszuschalten. Alle Ersparnisse der Gesellschaft sollten für die Schwerindustrie mobilisiert werden. Trotzki argumentierte, das sei falsch. Investitionen sollten sich stattdessen auf die Leichtindustrie konzentrieren, um den Hunger nach Produkten zu lindern. Die Schwerindustrie, die die Sowjetunion am wenigsten in der Lage war, effektiv zu machen, sollte importiert werden. Stalins Politik würde sogar zu weiteren Produktknappheiten in den Dörfern führen.
Ein weiteres Opfer der Transformationsstrategie der Rechten und des Zentrums war der Plan selbst. Um 1925 bewegte sich Gosplan von seiner vorherigen passiven Rolle als Statistikensammler weg in Richtung einer maßgebenden Rolle als Formulierer integrierter, branchenübergreifender Wachstumspläne. Aber Gosplan setzte seine Ziele mit Bezug auf die jährlichen Wachstumsraten von 8% – 10%, die in Phasen kapitalistischen Aufschwungs typischerweise erreicht wurden.
Trotzki charakterisierte das richtigerweise als zögernd und argumentierte, daß Wachstumsraten von doppelter Größenordnung erzielt werden könnten durch die Mobilisierung und Einbeziehung der Arbeiter selbst in die Planung. Nach 1926/27 stellte Stalins abenteuerliche Superindustrialisierungspolitik die wissenschaftliche Arbeit von Gosplan allmählich in den Schatten. Gosplans Arbeit am ersten Fünfjahresplan wurde durch die fraktionelle Intervention Stalins entstellt. Nach dem KPdSU-Kongreß im Dezember 1927 wurden alle Fragen von Tempo und Proportionalität der Planung im Streben nach mehr absolutem Wachstum im schwerindustriellen Sektor beiseite geworfen. Stalin denunzierte von nun an jenen Hinweise auf gleichgewichtiges Wachstum als „bürgerliches Abweichlertum“.
Zuerst betrachtete Trotzki Stalins Schwenk zur Überindustrialisierung von Ende 1927 als eine bloße Episode, ein Vorspiel für einen weiteren Rechtsschwenk und mehr Zugeständnisse an die Kulaken. Dieser Irrtum in der Einschätzung war zwei Faktoren geschuldet. Erstens schätzte Trotzki ein, daß die Hauptgefahr für das sozialisierte Eigentum der UdSSR von der rechten Fraktion um Bucharin komme, die die Interessen der Kulaken zum Ausdruck bringe. Zweitens war Trotzki unter Druck geraten, die Industrialisierungspolitik der Linken Opposition von der Stalins abzugrenzen. 1928/29 argumentierten Oppositionelle wie Preobraschenski und Radek, daß es nun keine bedeutsamen Unterschiede zwischen der Politik der LO und der Stalins für den Übergang gebe.
Um 1930 sah sich Trotzki gezwungen, anzuerkennen, daß die Wende mehr als eine Episode oder ein Zickzack war. Er gelangte zu der Einsicht, daß sie eine bürokratische Zerstörung der sozialen Basis der Rechtsopposition gegen Stalins Fraktion und die Bildung einer Reihe ökonomischer Verhältnisse, die dem Regime einer dominanten Zentrumsfraktion entsprachen, nach sich zog. Diese Verhältnisse waren ebenso feindlich zur prokapitalistischen Logik von Marktreformen wie zur Wirtschaftskontrolle durch die Arbeiterklasse selbst.
Trotzki war jedoch vollständig und durchgängig im Recht, die Wirtschaftspolitik der LO und die des bürokratischen Abenteuers, auf das sich Stalin nun einließ, auseinanderzuhalten. Trotzki formulierte seine Einwände aus vier Gründen. Erstens war das in Gosplans Kontrollziffern angepeilte Wachstum industrieller Entwicklung (Investitionen) unrealistisch hoch. Die bereitgestellten Kredite waren folglich dem aktuellen Ausstoß weit voraus, führten zu massiver Inflation während des Planverlaufs, Währungsabwertung und machten die objektive Produktivitätsmessung zu einer nutzlosen Übung.
Zweitens war die vorgeschlagene Struktur der Industrieinvestitionen einseitig zugunsten der Schwerindustrie und gegen die Leichtindustrie ausgerichtet. Diese Disproportionalität wäre sowohl im Ergebnis ineffektiv (Investitionen in der Leichtindustrie wären produktiver) wie sie auch den existierenden Bedarf an Verbrauchs- und Leichtgütern, den die Arbeiter und Bauern spüren, verschlimmern würde. Deshalb war die Disproportionalität zwischen Agrikultur und Industrie eine natürliche Konsequenz dieses Abenteurertums.
Drittens wandte Trotzki ein, daß die bewußte wirtschaftliche Isolierungspolitik vom kapitalistischen Westen unnötig und ein Eigentor war. Eine energische Außenhandelspolitik und selektive Kapitalimporte wären effizienter und zeitigten schnellere Resultate.
Viertens verdammte Trotzki das Kollektivierungsprogramm, das die Bauern als soziale Klasse zu zerstören versuchte. Stalin war aufgrund des Versagens, in den Jahren 1924 – 27 ein realistisches Programm von Leichtindustrialisierung und Auslandsimporten zu akzeptieren, zu dieser administrativen Lösung getrieben worden. Die Kornkrise und das Horten spornten Stalin 1927 an, sich eine verzweifelte „Lösung“ aufzuhalsen.
Trotzki argumentierte richtig, daß die UdSSR damals einfach nicht die materiell-technische Basis für eine Politik allgemeiner und schneller Kollektivierung der Landwirtschaft besaß. Ein katastrophaler Abfall der Arbeitsproduktivität könnte nur verhindert werden, wenn der Staat die für die Großbewirtschaftung notwendige Maschinerie und Ausrüstung zur Verfügung stellen könnte. Dies konnte der Staat nicht tun, besonders da er sich weigerte, sie einzuführen. Deshalb würden die Bauern lieber ihren Viehbestand abschlachten, als ihn sich stehlen zu lassen und dies würde zu einem weiteren Absinken des Ausstoßes führen. 1932 wurden Trotzkis Argumente und Vorhersagen durch den weit verbreiteten Hunger in diesem Jahr als richtig bewiesen.
Im Laufe des ersten Fünfjahresplans (EFJP) stellte Trotzki dessen Auswirkungen dar. Vom Standpunkt des Sozialismus aus beurteilt, war er ein äußerster Fehlschlag. Trotzki führte aus, daß die Arbeiterklasse in ein Planobjekt und einen Produktionsfaktor verwandelt wurde, um wie alle anderen Komponenten des Arbeitsprozesses per Erlaß anzutreten. Im Ergebnis konnten keine Korrekturen des Plans im Licht seiner angestrebten Umsetzung entstehen; keine Qualitätskontrolle des Outputs konnte eingeführt werden; keine Information, die zu einer Modifikation des Plans führen könnte, war möglich.
Deshalb waren Engpässe und Disproportionen angeborene und unvermeidliche Elemente des Systems. Was die Bauernschaft betrifft, stand der Versuch, sie politisch als Klasse zu liquidieren, in vollständigem Widerspruch zu den Aufgaben des sozialistischen Übergangs. Marxisten faßten das allmähliche Verschwinden dieser Klasse ins Auge, mittels freiwilliger Vergenossenschaftlichung und ihrer Umwandlung in Proletarier. Sobald Kapital auf dem Land angewendet würde und die Produktivität zunähme, würde die Zahl der auf dem Land Beschäftigten, selbst als Lohnarbeiter, schrumpfen. Solch ein Vorgang würde das Bewußtsein aller Gesellschaftsschichten stärken und sie fest an den Sozialismus binden.
Trotzki war bewußt, daß vom Blickwinkel des Arbeitsprozesses her die rücksichtslose Zentralisierung und Kombination aller Produktionsfaktoren spektakuläre quantitative Ergebnisse in gewissen Abschnitten zeitigen könnten, selbst wenn die relativen Unwirtschaftlichkeiten nach Legionen zu zählen seien. Aber vom sozialen Standpunkt her entfremdeten die physische Vernichtung und Erschöpfung der Arbeiter und Bauern, allgemeiner Mangel und Nahrungsmittelvorräte von schlechter Qualität, verknüpft mit totaler politischer Unterdrückung, die Arbeiterklasse vom sozialistischen Transformationsprojekt.
Trotzkis Kritik der Kommandoplanung war kräftig und enthielt eine realistische Alternative. In den frühen 1930ern erkannte Trotzki, daß das Elend der Kommandoplanung so arg war, daß der kontrollierte, partielle Rückzug auf Marktbeziehungen und das Aufblühen der Rätedemokratie Vorbedingungen jeder substantiellen Wirtschaftsreform seien.
Marktkorrektive mußten mit Landwirtschaft und Geldstabilisierung beginnen. Trotzki forderte zum Stoppen der Kollektivierung und sogar zu ihrer Rückgängigmachung auf. Er regte an, 80% der Höfe an kommerzielle Familienunternehmen zu geben, dadurch die materiellen Anreize und ein korrektes Verhältnis zwischen der Form von Eigentümerschaft auf dem Lande und der technischen Basis für seine Ausbeutung wiederherzustellen. Trotzki begrüßte sogar Stalins Teilrückzug 1932 entlang dieser Linien unter dem Eindruck der verheerenden Resultate der Kollektivierung.
Als nächstes war die Stabilisierung des Geldmengenwachstums dringend, wenn der reale wirtschaftliche Fortschritt gemessen werden sollte. Drittens waren in diesem Übergangsstadium auf dem Markt beruhende materielle Anreize (höhere Löhne, Produktauswahl) notwendig, falls Verbesserungen der Arbeitsproduktivität aufrechterhalten werden sollten.
Viertens würde eine vollständige Umkehr der Tendenz zur ökonomischen Isolierung gebraucht. Integration in den Weltmarkt könnte die kurzfristig nötigen Kapitaleinfuhren liefern, die Flaschenhalssituationen überwinden könnten, die Durchführung notwendiger Reparaturen erlaubten und einige Bedürfnisse der Arbeiter in Stadt und Land befriedigten.
Als Grundlage all dessen drängte die Einführung der Sowjetdemokratie, wenn alle Verzerrungen, blockierte Informationskanäle und armselige Qualitätskontrollen ins Gegenteil verkehrt werden sollten. Natürlich verstand Trotzki mehr denn je, daß alle diese Maßnahmen nur hinhaltende seien. Sie konnten, falls durchgeführt, die inneren Widersprüche der Übergangswirtschaft der Sowjetunion „abschwächen“ und „regulieren“, aber nicht überwinden. In diesem Sinne fing für Trotzki die wahre sozialistische Umwälzung erst mit erfolgreichen Revolutionen in den industrialisierten Ländern des Westens an.
Trotzki wurde mit dem Ende des EFJP (1932/33) gewahr, daß die von der Wende zur Kommandoplanung erzeugte gesellschaftliche Umwälzung Ressentiments und Widerstand in der bürokratischen Kaste verursachte. Nach dem Parteitag der Sieger 1934 schien Stalins Position schwächer. Er hatte seinen Posten als Generalsekretär verloren und Kirow hatte die meisten Stimmen bei den Wahlen zur Parteiführung erhalten. Dies verlockte Trotzki zur Spekulation über die Möglichkeit, Stalin könne ganz entfernt und die LO zur Partei wieder zugelassen werden.
Nach der Ermordung Kirows im Dezember 1934 behauptete Stalin jedoch seine Kontrolle wieder und sicherte seine Stellung durch das Entfesseln der Großen Säuberung. 1936 schrieb Trotzki seine vollendetste Anklage gegen das System der stalinistischen Kommandoplanung, nahm dabei viele Ideen in Anspruch und systematisierte sie, die er in seinen Jahren des Exils skizzierte.
Trotzki bewies, daß der selbsternannte sozialistische Charakter der UdSSR nichts dergleichen war und schlußfolgerte, das soziale Wesen der UdSSR sei das einer Übergangsökonomie zwischen Kapitalismus und Sozialismus. Eine wesentliche Schlußfolgerung stand noch aus; Wirtschaftsreformen konnten begreiflicherweise nur durchgeführt werden unter einer Bedingung: die stalinistische Kaste mußte zuerst gewaltsam durch eine erneute proletarische Revolution gestürzt werden. Dies war eine absolute Vorbedingung für die Wiederinkraftsetzung des blockierten Übergangs zum Sozialismus. Alles andere würde zu weiteren Krisen führen, einer Erosion der Fundamente des Sozialismus und dem eventuellen Umsturz der vergesellschafteten Basis des Arbeiterstaats.
Nachdem wir den Werdegang der Sowjetunion und Osteuropas wie auch die intellektuelle Auseinandersetzung um Planung und Marktsozialismus zurückverfolgt haben, können wir nun die Frage, ‘war Trotzki ein Marktsozialist?’, negativ beantworten. Zentristen wie Ernest Mandel haben vorgebracht, daß Trotzki in gewissem Sinn die Marktreformbewegungen von Gorbatschow und anderen vorwegnahm.
Das ist bis ins Mark falsch, wenn wir einmal wahrnehmen, was das Wesen des Marktsozialismus ist. Was immer sonst sie trennt, alle Marktsozialisten bestehen auf der Notwendigkeit kapitalistischen Wettbewerbs zwischen Einzelunternehmen auf der Linie der Profitmacherei wie auch der Autonomie von Entscheidungsfindung, welche Produkte hergestellt werden. Trotzki bekämpfte solche Ideen besonders und legte nach 1933 dar, das Zerbrechen von Industrietrusts in konkurrierende Einheiten wäre ein Anzeichen von wirtschaftlicher Krise und Zusammenbruch innerhalb des Arbeiterstaats und zeichne eine Rückkehr zum Kapitalismus vor. Es konnte für Trotzki nur bedeuten, Ungleichgewichtigkeit und Anarchie in den Plan einzuschleusen.
Trotzkis Ansichten über die Rolle, die der Markt im Übergang spielen sollte, waren von einigen generellen Prinzipien und einigen konkreten Beobachtungen über den Startpunkt, wie er von der russischen Wirtschaft in den frühen 1920ern präsentiert wurde, geleitet. Es konnte keine Marktregulierung und verallgemeinerte Marktverhältnisse geben, weil dies einen Markt für Arbeitskraft und Ausbeutung nach sich zöge; dies widerspricht dem Übergang zum Sozialismus.
Nichtsdestotrotz war es am Beginn in keiner Gesellschaft möglich, den Markt auszuschalten, am wenigsten in Rußland. Deshalb mußte der Markt im Dienst der Stärkung der sozialistischen Natur der Wirtschaft anerkannt, geregelt und manipuliert werden. Solange allgemeine Knappheit existierte, wurde ein Mechanismus für die Regelung von knappen Gütern gebraucht. Dies betraf am meisten von allen die Verbrauchsgüter. Hier wäre der Einsatz von Geld und Preisen, die akkurat die aufgewandte gesellschaftliche Arbeitszeit ausdrückten, der beste Mechanismus zur Regulierung von Angebot und Nachfrage und Übermittlung von Verbraucherwünschen an die Produzenten.
Konkret erhielten in der Sowjetunion die Arbeiter die überwiegende Masse an Konsumgütern im privaten Sektor (von den Landwirten) und dies diktierte, daß Preise und Märkte der beste Weg für die Arbeiter seien, ihren Druck auf die ländliche Wirtschaft auszuüben.
Darüberhinaus dachte Trotzki angesichts des rückständigen Charakters von Rußland zu der Zeit, daß eine Ausdehnung von Markt und Warenbeziehungen auf große Teile Rußlands, bis dahin auf nichtmonetärem Austausch beruhende Verhältnisse, ein Schritt vorwärts sei. Gesellschaftliche Arbeit, mittels des Wertgesetzes meßbar, war der Subsistenz und halbfeudalen Ökonomien überlegen.
Doch der allgemeine Trend während der Übergangsphase muß für den Markt sein, mit der Zeit eliminiert zu werden. Besonders wenn die Landwirtschaft industrialisiert wurde und die Bauern in Lohnarbeiter verwandelt wären, würde der Plan die Produktion direkt beeinflussen und den Markt absorbieren, nicht einfach nur regulieren. Die Nutzung des Markts, ‘um die Ergebnisse des Plans zu überprüfen’ (Trotzki), war ein bestimmtes historisches Gesetz, das den vorwiegend privaten Charakter von in die Erzeugung von Verbrauchsgütern eingebundener Arbeit reflektierte.
Wenn dann auch in diesem Sektor gesellschaftliche Arbeit vorherrschen sollte, wären auch Kalkulationen von Gütern, die für den Endverbrauch bestimmt sind, a priori möglich. Das Bewußtsein würde in diesem Sektor in die Kommandorolle schlüpfen und der Widerspruch einer ‘geplanten Produktion für einen unbekannten Markt’ (Mandel) wäre ausgelöscht. Die Konstruktion eines dezentralisierten nationalen Plans, empfindlich für die sich wandelnden und vielfältigen Vorlieben der Masse der Arbeiter, würde die Bestätigung durch den Markt, d. h. Bestätigung post festum, nutzlos und verschwenderisch machen.
Ökonomik des blockierten Übergangs
Widersprüche der Kommandoplanung
Die Kommandowirtschaften der UdSSR und Osteuropas bestanden den Test der Geschichte nicht und ihre politischen Regime brachen unter der Anforderung zusammen. Anderswo (Kuba, China, Vietnam, Kambodscha) versucht die politische Führung ihre Macht zu behalten, indem sie die Umwälzung zum Kapitalismus leitet.
Das System der Kommandoplanung, das in der Sowjetunion in den späten 1920ern entstand, vermochte nicht, den Kapitalismus weltweit zu überholen. Dies war nicht irgendeiner „Erbsünde“ geschuldet, den Markt entthront zu haben. Es war dem Versuch zuzuschreiben, wirtschaftliche Ressourcen zu planen, während der Arbeiterklasse die Mittel zur Planfestlegung entrissen wurden. Es geschah dank der Entstellung geplanter Wirtschaftsverhältnisse durch eine allmächtige, bürokratisch parasitäre Kaste, die die Ökonomie zugunsten ihrer eigenen Bereicherung plünderte.
Die bürokratische Kommandoökonomie könnte nicht ohne den Sturz des Kapitalismus wie ohne die politische Niederlage der Arbeiterklasse, in deren Namen die Bürokratie lügnerisch zu sprechen behauptete, entstanden sein. Ob sich dies als Ergebnis der Degeneration eines gesunden Arbeiterstaats und einer politischen Konterrevolution wie in der UdSSR oder der Bildung eines von Geburt an degenerierten Arbeiterstaats wie überall woanders abspielte, ändert nicht die grundlegende Dynamik der ökonomischen Verhältnisse.
Obwohl es viele kulturell und historisch besondere Elemente in den Wirtschaftsexperimenten diverser stalinistischer Staaten gibt, existiert doch trotzdem eine darunterliegende Einheitlichkeit, eine Gesetzmäßigkeit, die im Herzen der Kommandoplanung zu erblcken ist. Jeder dieser Staaten setzte einige objektive Vorbedingungen für jeden Übergang zum Sozialismus, indem er das Privateigentum der Kapitalistenklasse enteignete, ein Außenhandelsmonopol errichtete und Dienststellen für die Koordinierung von Erzeugung und Verbrauch gründete.
Sie beendeten die Regulierung des Wirtschaftslebens mittels der Wirkweise des Wertgesetzes. Diese Maßnahmen waren alle geschichtlich progressiv und mußten vor dem Umsturz durch innere oder äußere Kräfte verteidigt werden.
Indem man jedoch der arbeitenden Klasse das Recht, direkt zu herrschen und die Produktion selbst zu verwalten, verweigerte, wurde der Übergang zum Sozialismus blockiert und dies unterhöhlte nach und nach die Effektivität der ursprünglichen Eroberungen. Die Arbeiterklasse wurde von ihren „eigenen“ Produktionsverhältnissen trotz eines gewissen anfänglichen Enthusiasmus“, das Erreichen der Wirtschaftsziele in Angriff zu nehmen, entfremdet.
Die Bewegungsgesetze der Kommandoplanung fließen aus der Entschiedenheit der Bürokratie, maximale Wirtschaftswachstumsraten unter selbstauferlegter Isolierung von der kapitalistischen Welt zu erzielen, während sie die verschiedenen Bestandteile der Ökonomie mittels administrativer Hebel koordiniert.
Alle Resultate der Kommandoplanwirtschaft stammen von den politischen Kalkulationen der herrschenden Kaste, in deren Zentrum die stalinistische Kommunistische Partei stand. Diese Partei war der Kitt, der alle Bestandteile des politischen und ökonomischen Apparats zusammenhielt trotz sektoraler und sogar fraktioneller Konflikte, die aufkamen.
Was erklärt die vorwärtstreibende Dynamik der bürokratisch geplanten Wirtschaft? Mit der Überwältigung des Kapitalismus hörte der Anreiz der Profitmaximierung seitens risikotragender privater Kapitaleigner auf zu funktionieren. Aber angesichts der politischen Niederlage, die der Arbeiterklasse von Stalin beigebracht wurde, konnten die Konsumbedürfnisse der Arbeiterklasse keine alternative Haupttriebfeder für die geplante Ökonomie abgeben. Vielmehr lieferte die Zwangslage für die Kaste, eine starke Wirtschaft aufzubauen, um sich selbst zu stärken und sogar in den Augen der Leute, die sie zu vertreten beanspruchte, zu rechtfertigen, die Triebkraft.
Die meisten degenerierten Arbeiterstaaten entstanden aus rückständigen kapitalistischen Ländern, umgeben von kapitalistischen Staaten. Die herrschenden Kasten entwarfen ihre Wirtschaftspläne mit Blick auf maximale Akkumulationsraten (Investitionen), auf Schwer- und Rüstungsindustrie orientiert. Daher hatten alle degenerierten Arbeiterstaaten beständig höhere Akkumulationsraten (als Anteil am Sozialprodukt) als kapitalistische Länder.
Das Investitionsprogramm wurde mittels eines zentralisierten Plans durchgeführt. Es gab viele verschiedene Planungstypen. Die wichtigsten waren die Jahres- und Fünfjahrespläne; für Einsatzzwecke war der Jahresplan am wichtigsten. Der Fünfjahresplan war mehr indikativ als verfügend außer für die neuen Investitionsprojekte, die mit der Eröffnung eines neuen Fünfjahresplans begannen.
Der bürokratische Plan hatte typischerweise sieben Teile. Zuerst wurden aggregierte Produktionsziffern für die Hauptproduktionsbereiche aufgestellt (Industrie, Landwirtschaft, Verkehr usw.). Zweitens wurden Ziele für vorrangige Produkte in Mengeneinheiten festgesetzt und ihre Verwendung bestimmt (z. B. Halbfertigerzeugnisse). Auf dieser Grundlage wurden dann materielle Bilanzen konstruiert; auf der einen Seite wurden alle Hilfsquellen und auf der anderen alle Nutzanwendungen aufgeführt. Dies lieferte die zentrale, leitende Methodologie der zentralen Planung – ein System materieller Bilanzen, wobei ein sorgfältiger, ständiger Verhandlungsprozeß zum Ausgleich der Bilanzen führen würde.
Drittens wurde der Arbeitskräftebedarf für alle Sektoren zusammen mit der Gesamtgröße des Lohnfonds aufgesetzt. Viertens wurde ein Investitionszeitplan sowohl insgesamt wie sektoral entworfen. Fünftens wurden Ziele für die technische Entwicklung definiert. Sechstens wurden Außenhandelspläne entworfen und zuletzt die Finanzziele festgelegt (Staatshaushalt, Preise, Geldmenge).
Einzelmitglieder wie Fraktionen der Bürokratie hingen in Rekrutierung, Förderung und Bereicherung vom Planerfolg ab. Sie genossen keine Eigentumstitel, die ihnen einen legalen Anteil an einer Portion vom Mehrprodukt verliehen. Ihr Erfolg und ihre Macht beruhten auf der Planerfüllung. So gab es eine immanente Tendenz für alle Bereiche der Bürokratie, die unter ihrer Kontrolle stehenden Produktivkräfte auf Mengenbasis und ohne Rücksicht auf Qualität auszudehnen.
Der Ausbau des Reichs brachte eine Vermehrung der Macht und des Umfangs der Belohnungen. Im Gegenzug brachte diese Hauptquelle des Wachstums einen bestimmenden Charakterzug der Kommandoplanung mit sich – permanenten Investitionshunger. Unausweichlich war das mit einem permanent niedergedrückten Kosumniveau der Arbeiterklasse verknüpft. Der laufende Verbrauch wurde immer als Abzug von möglichen Investitionen betrachtet.
Die Methode der Plankoordination und -formulierung war völlig bürokratisch. In einem gesunden Arbeiterstaat muß die Arbeiterklasse die subjektive Ausrichtung der Wirtschaft vorgeben. Im Kommandosystem der Planung behandelte die Bürokratie die Arbeiterklasse im Gegensatz als Objekt des Plans – gemeinsam mit den anderen Produktionsfaktoren.
Die subjektiven Wünsche (Nachfrage) der Masse der Produzenten und Konsumenten wurden ignoriert. Die zentralen Planer und Parteiführungen skizzierten die Planziele auf der Grundlage vergangener Planresultate, des Entstehens von Versorgungsengpässen und politischer Imperative (z. B. Kriegsbedarf, Antworten auf innere ökonomische/industrielle Unruhe, Fraktionsdruck in den Rängen der Bürokratie.
Planziele wurden dann von den unteren Ebenen des Apparats auseinandergedröselt und für jede Stufe hatte das erhaltene Ziel einen Kommandoeffekt. Alle Entscheidungen über Fabrikeröffnungen oder -schließungen, über Beförderungen und Ernennungen, über Prämien und Materialzuteilung wurden von einer nicht rechenschaftspflichtigen Bürokratie getroffen. Querverbindungen existierten, aber zwischen Sektoren der Bürokratie; ständige Koordination zwischen Direktorien, zwischen Unternehmen, die ein Produkt lieferten oder nutzten.
Dieses System geplanter Akkumulation funktionierte, aber nicht wirtschaftlich. Die wichtigsten Prioritäten wurden erreicht, aber nach vielen Verzögerungen und Unterbrechungen für andere Sektoren, die als nicht vorrangig eingeschätzt wurden. Wo immer Planen den direkten Bedürfnissen der Bürokratie diente (z. B. Verteidigung und verwandte Branchen), arbeitete sie am besten wie dort, wo Qualitätsaspekte am unwichtigsten waren.
Das System bürokratischer Planung besaß jedoch eingebaute Defizite, die in Abwesenheit von Konkurrenz und Marktkoordinierung nur durch die Verwaltung der Wirtschaft seitens der Arbeiterklasse behoben werden könnten. Darüberhinaus war nur dieser Handlungskurs mit dem Übergang zum Sozialismus kompatibel. Das war undenkbar für eine Kaste, die nur überlebte, indem sie der Arbeiterklasse die Fähigkeit, direkt zu herrschen, absprach und deren alleinige Existenz mit dem Sozialismus unverträglich war.
Die Bürokratie entpuppte sich nach beeindruckenden Anfangsresultaten mehr als Bürde denn als Ansporn für die geplanten Eigentumsverhältnisse. Anders als eine Klasse hatte sie im vorhandenen ökonomischen Regelungswerk keine notwendige Rolle zu spielen. Ihre Existenz sabotierte sicher den Kapitalismus, aber ihre Rolle als separate, über die direkten Produzenten erhobene Schicht war für die Formulierung und Ausführung des Plans nicht bedeutend.
Weil die Bürokratie keine einheitliche Klasse war, mußte sie sich selbst oft bonapartistischer Herrschaft unterwerfen, um sich selbst zusammenzuhalten. Dies hinderte die Formulierung und Durchführung eines rationalen Plans weiter. Im Verlauf der zwölf Fünfjahrpläne in der UdSSR (1928-90) und ähnlicher Pläne anderswo wurde das Bestehen der Bürokratie zunehmend schädlich für die Planerfüllung. Plan auf Plan registrierte abnehmende Wachstums- und Produktivitätsraten – beides direkt der Rolle der Bürokratie im Planwesen geschuldet.
Die wirtschaftlichen Anfangsresultate der Kommandoökonomien waren beeindruckend, da die Zentralisierung und Koordination der ökonomischen Ressourcen die Länder aus extremer Rückständigkeit rissen. Aber diese Ergebnisse erfolgten trotz, nicht wegen des Beitrags der Bürokratie. Es waren Dekaden extensiven Wachstums, d. h. wenn der Maschinenpark und Arbeiteranzahl absolut wachsen und der Ausstoß proportional dazu.
Zu Beginn der Planung gab es eine massive Arbeitslosigkeit, die absorbiert werden konnte, um immer mehr Leute ins Beschäftigtenheer zu ziehen; parallel dazu nahm die kultivierbare Landfläche zu. Die meisten Länder hatten am Anfang auch reiche natürliche Ressourcen auszubeuten. Zusätzlich wurde generell die Arbeitswoche verlängert – Arbeitskraft war reichlicher vorhanden als Fixkapitalausrüstung; die Anlagen konnten nur durch maximale Schichten am Funktionieren gehalten werden.
In diesen Jahren trug die koordinierende und zentralisierende Rolle der Administration – zusammen mit den enormen Naturressourcen, die zusammengefaßt und ausgebeutet werden konnten, und zweifelsohne dem Enthusiasmus der Massen (zumindest in der UdSSR) für den Wirtschaftsaufbau – zu den Erfolgen des Plans bei.
Als diese Arbeitsreserven und Rohmaterialien erschöpft waren oder wo die Kommandoplanwirtschaft auf eine schon entwickelte, sogar imperialistische Ökonomie (z. B. Tschechoslowakei) vom Start weg aufgepropft wurde, dann und dort hing das kontinuierliche Wachstum von der Steigerung der Produktivität der existierenden Produktionsfaktoren ab.
Das hätte ein System materieller und moralischer Anreize Seite an Seite mit technischen Verbesserungen des Arbeitsprozesses und der effektiveren Nutzung existierender Materialien erfordert. An diesem Punkt sollten die störenden und negativen Auswirkungen einer unhinterfragbaren Bürokratie entscheidend werden.
In allgemeinen Begriffen trug der grenzenlose Appetit auf Investitionen durch die Bürokratie zur ersten negativen Auswirkung auf die Produktivität bei. Der allgemeine Mangel an Investitionen stellte sicher, daß es de facto ein System vorrangiger Zulieferungen an Sektoren unter Kontrolle der vorherrschenden Fraktionen oder Abteilungen der Bürokratie gab. Im Gefolge sicherten sich diese Industriebereiche einen unverhältnismäßig großen Anteil an den verfügbaren Investitionen. Im Vergleich zur restlichen Wirtschaft stellte das Überakkumulation und vergeudete Investition dar und führte zu chronischen Ungleichgewichten in der ganzen Ökonomie. Dies führte wiederum zu Störungen, unvollendeten Projekten und niedrigerer Effizienz.
Innerhalb eines demokratischen Übergangs zum Sozialismus, wo die Arbeiterklasse direkt herrscht, entstünde das Problem nicht, weil die Investitionsrelationen danach bestimmt würden, was für die Gesamtwirtschaft optimal wäre. Das heißt, was die effektivste Kombination von Ressourcen wäre, die die Notwendigkeit ausgeglichenen Wachstums, steigenden Lebensstandards, der verschiedenen alternativen Nutzungen für die gleichen Produktionsfaktoren und die damit verbundenen gesellschaftlichen Kosten in Rechnung stellte.
Was die materiellen Anreize betrifft, so hat die Arbeiterklasse in der Übergangsperiode zum Sozialismus ein Interesse an der Ökonomisierung der Arbeitszeit, um die Arbeitswoche zu verkürzen und die für Bildung, Muße und politische Teilhabe verfügbare Zeit zu vergrößern. Dies spielte keine Rolle unter den Bedingungen der abgeblockten Transformation in einem degenerierten Arbeiterstaat.
Der strukturelle Anreiz fand nur Anwendung auf Mitglieder der Bürokratie (und eine kleine Schicht von Arbeiteraristokraten) und selbst dort schien er für verschiedene Schichten der Bürokratie unterschiedlich auszusehen. Die Zentralplaner und Parteiführer an der Spitze hatten ein Interesse daran, daß die Gesamtheit der Ziele für die Wirtschaft als Ganzes erfüllt werden. Dagegen waren Unternehmensmanager daran interessiert, ihren speziellen Fabrikzielen nachzukommen. Diese Schicht der Bürokratie behielt maximalen Raum für Manöver, indem sie ihren Bedarf an Investitionsquellen übertrieb und unzureichend berichtete, wo die Planziele übertroffen wurden. Insbesondere vermied sie, ihre Planvorgaben in der nächsten Runde nach oben „ausrasten“ zu sehen. All das hemmte die produktive Ressourcenanwendung.
Gleichfalls standen einer effektiveren Ausnutzung der Arbeit wirkliche Barrieren im Wege. In einem System, das von der Notwendigkeit einer maximalen Akkumulationsrate beherrscht wurde, wurde die Arbeitsangebotsknappheit (Vollbeschäftigung) bald dauerhaft und sogar ideologisch sanktioniert (Recht auf Arbeit). In der bürokratischen Planwirtschaft war die Arbeitskraft keine Ware, weil es keine Reservearmee der Arbeit gab und die Höhe des Gesamtlohns von vornherein festgelegt wurde (entsprechend der makro-ökonomischen Ziele für Investition und Verbrauch). Sie waren die am rigidesten beachteten Teile des Plans.
Eine gewisse Marktpreisbildung existierte, was das Lohnniveau für verschiedene Berufsgruppen oder Regionen des Landes innerhalb dieser allgemeinen Zuteilung des Lohnfonds begrifft. Arbeiter hatten das Recht, den Job zu wechseln, fanden aber viele Hindernisse in den Weg gestellt. Gleichzeitig hatten Unternehmensmanager ein Interesse daran, soviele Arbeiter wie möglich zu bekommen und achteten darauf, sie nicht zu verlieren. Diese generelle Situation gewährleistete geringes Arbeitsentgelt, relative Immobilität der Arbeit und geringfügige Entlassungsgefahr. Mangel an wirklichen Gewerkschaftsrechten machte auch politischere Protestformen unmöglich oder schwierig. Was dabei herauskam, war ein Regime mit niedriger Moral, geringer Arbeitsdisziplin und daraus resultierender schlechter Produktivität.
Es wurde auch nicht durch wirksameren Gebrauch von Materialien kompensiert. Es gab keine Belohnungen für den optimalen Umgang mit Ressourcen (oder umgekehrt Strafen), aber es gab viel zu gewinnen, wenn man sich große Gütervorräte anlegte, die gebraucht werden könnten (oder nicht), falls die Planvorgaben erhöht oder sich unvorhergesehene Störungen in der Planperiode ereignen würden. Weil es zum einen keine Marktdisziplin gab, zum anderen keinen täglichen Druck der Arbeiterklasse auf die Fabriken, Qualitätsprodukte zu sinkenden Durchschnittskosten zu liefern, ging dieser Prozeß unbeanstandet durch.
Trotzdem gab es im System der Kommandoplanwirtschaft eine Tendenz zur technischen Verbesserung des Arbeitsprozesses selbst. Unternehmen antworteten auf Arbeitskräfteknappheit (nicht wie unterm Kapitalismus, auf die ansteigenden relativen Arbeitskosten) durch Substitution von Arbeit durch Maschinerie. Technische Fortschritte wurden darum gemacht, aber gewöhnlich ahmten sie die kapitalistischen Innovationen nach und wurden nach langen Verzögerungen angewandt.
Eine allgemeine Tendenz zu verbesserter Produktivität würde eine verläßliche und konstante Art von Messung der Produktivitätsgewinne und daher von Kosten erfordern. Das vereitelte wieder das Selbstinteresse der Bürokratie. An erster Stelle beruhte Kommandoplanung im allgemeinen eher auf Mengenindizes (physische Einheiten) als auf Werteinheiten. Jene waren für die Kaste nicht nur leichter zu kontrollieren und durchs System hindurch zu verfolgen, sondern sie entsprachen auch ihren Kasteninteressen. Quantitative Erweiterung führte zu einem stetigen Anstieg in der Organisation und an der Zahl von Bürokraten. Auf qualitativen Produktivitätsverbesserungen beruhende Expansion hätte zu Beschneidungen und zu Verringerungen des Managements geführt – etwas ihren Interessen direkt Abträgliches.
Diese Fixierung auf quantitative Wachstums- und Erfolgsziffern erlaubte keinen realen Vergleich der Kosten alternativer Nutzweisen der Produktionsfaktoren, noch konnte sie ermitteln, ob abnehmende oder wachsende Mengen gesellschaftlich nützlicher Arbeit in der selben Anzahl physischer Produkte (Gebrauchswerte) vergegenständlicht waren. Die wahre Besessenheit von quantitativen Ergebnissen führte auch zur Vernachlässigung der Produktqualität (Funktioniert es gut? Funktioniert es überhaupt?), was unmitelbare Auswirkungen auf die allgemeine Produktivität hätte, wenn das Erzeugnis aus dem Kapitalgütersektor für uns bestimmt wäre.
Das Preissystem im bürokratischen Plan verstärkte das. Preise waren administrative Verrechnungseinheiten und gaben nicht die wahren Produktionskosten wieder (d. h. die in ihnen verkörperte gesellschaftliche Arbeitszeit). Teilweise deshalb, weil die Bürokratie das Preisniveau jahrzehntelang aus Furcht vor Inflation niederhielt und sich selbst weigerte, es sich in Linie mit Anstieg oder Sinken der Kosten bewegen zu lassen. Preise folgten den Produktmengen als finanzielle Reflexion des Systems materieller Bilanzen passiv durchs Planungssystem.
Dann litt das bürokratische Plansystem an einem säkularen Produktivitätsverfall; aber innerhalb dieses Niedergangs ist es möglich, zyklische Schwankungen zu beobachten. Erstens stieg die Arbeitsgeschwindigkeit gegen Ende einer Planperiode (besonders beim Jahresplan) dank des mit der Jahresplanerfüllung verknüpften Anreizsystems. Gleichzeitig litt die Qualität am Ende einer Planperiode, die der Produktionseile geopfert wurde. Als Ausgleich erfolgten oft Investitionen zum Start der nächsten Planperiode in einem Versuch, unvollendete Projekte im Bündel fertigzustellen.
Innerhalb der Planperiode gab es eine natürliche Tendenz, die Investitionspläne mindestens zum Teil zu Beginn zu erfüllen. Aber, wenn klar wurde, daß der Plan die Kapazitäten und Reserven in der Wirtschaft grob überschätzt hatte, traten Engpässe ein. Der zentrale Apparat reagierte, indem er Ressourcen aus Sektoren geringer in Sektoren hoher Priorität umschichtete mit den unausweichlich resultierenden Effekten: nicht beendete Projekte, lange Verzögerungen und die daraus folgenden Ungleichgewichte.
Im Wesentlichen war der Ursprung des Kreislaufs dem im Kapitalismus entgegengesetzt. Im Kapitalismus gibt es einen Zyklus aus Ausdehnung und Schrumpfen, der der Überproduktion von Kapital und Waren geschuldet ist. Dies bewirkt als Folge eine zerstörerische Rivalität zwischen Warenbesitzern, die zur Ausschaltung einiger von ihnen führt. In der Kommandowirtschaft war es eine Krise überschießenden Bedarfs (Investitionen), der in einem gewissen Moment nicht erfüllt werden konnte, die Einschnitte und Umverteilungen verursachte. Da jede Plananpassung schlagende Auswirkungen an anderer Stelle im Plan hatte, führte der allgemeine Effekt zum Bruch.
Wie beherrschend auch immer die Planwünsche und wie bürokratisch und rigide ihre Umsetzung, die vom bürokratischen Plan erzeugte echte Strukturkrise rief nach Marktmechanismen, um die von einem teilweise fehlgeschlagenen Plan hinterlassenen Lücken zu stopfen. Manchmal war das ein berechtigter Sektor von Privatherstellern (z. B. kleine Bauern, Anbieter persönlicher Dienstleistungen), öfter war es ein Netzwerk schwarzer oder grauer Märkte. Materalien im knappen Angebot konnten durch persönliche Kontakte ausfindig gemacht, durch Schmiergelder oder Tauschgeschäfte abgeschlossen werden. Obwohl nicht im Wesen des Systems vorgesehen, wurden diese oft institutionalisiert und ein Teil der Arbeitskräfte (in der Sowjetunion die Tolkatschi) wurde sogar dafür abgestellt, sich auf diese Aufgabe zu spezialisieren.
In Abwesenheit demokratischer Verantwortlichkeit, mußte man sich auf halboffizielle Marktkorrektive verlassen, um die Fehler des „allwissenden Wesens“, das der zentrale Planungsapparat war, zu berichtigen. Mit der Zeit verbanden sich die Defizite im Plansystem und der Druck von inner- und außerhalb des Apparats auf Reform und zwangen die Bürokratie, offiziell mit weitreichenderen Marktreformen als Versuch, die Ökonomie zu dynamisieren, zu experimentieren.
Marktreformen der Kommandoplanung: Ungarn und Jugoslawien
Der erste Anlauf, den Plan mit Marktmechanismen zu beleben, kam in Jugoslawien in den frühen 1950ern. Weitere Versionen marktsozalistischer Reform kamen in der Tschechoslowakei (1958), DDR (1963), UdSSR (1965), wiederum Tschechoslowakei (1968), Polen (1960er) und Ungarn (1968). Endlich wurde 1985 in der UdSSR ein weiterer und letzter Versuch unternommen. Politischer Widerstand von Fraktionen der herrschenden Partei oder Unternehmensmanagern brachen die meisten dieser Reformen abrupt ab. Nur in Ungarn und Jugoslawien schlugen die Reformen Wurzeln.
Der Neue Ökonomische Mechanismus (NÖM) in Ungarn fing 1968 an und dauerte bis in die späten 1980er an. Das Reformmotiv war nicht wie in Jugoslawien (oder der Tschechoslowakei), ein „neues Sozialismusmodell“ zu ersinnen, sondern einfach die wirtschaftliche Effizienz zu steigern. Die Reformen enthielten mehrere Komponenten.
Neue Eigentumsformen wurden zugelassen, einschließlich privater Kooperativen und kleiner Unternehmen; verbindliche Zentralplanziele wurden gemeinsam mit der physischen Allokation von Output und Input abgeschafft; Firmen wurde gestattet, gegenseitige bindende Vertragsbeziehungen einzugehen und auf der Basis der Profitmaximierung zu operieren; deshalb waren sie für die Kontrolle ihrer eigenen Kosten und Preisfestsetzung verantwortlich.
Konkurrenz war dazu ausersehen, zu Neuerungen und gestiegener Wirtschaftlichkeit zu führen. Die makro-ökonomischen Resultate dieser Reformen waren nicht signifikant verschieden von jenen in den Ländern, die keine bedeutenden Marktreformen einführten. Das Bruttoinlandprodukt wuchs zwischen 1968 und 1975, eine Verbesserung gegenüber der ersten Hälfte der 1960er, aber zwischen 1975 und 1985 setzten Wachstumsabfall und sogar Stagnation ein. Produktivitätsverbesserungen und -rückgänge spiegelten diese allgemeinen Wachstumsveränderungen wider.
Die Reformen mündeten in eine merkliche Zunahme der Einkommensungleichheiten wie auch des Umfangs an Konsumgütern und größerer Abwechslung unter ihnen. Als Resultat des späteren Nachlassens im Wachstum und der Fortdauer der Einkommensungleichheit in Ungarn nach 1975 war eine viel längere Arbeitswoche (d. h. zwei Jobs) üblich als sonstwo in Osteuropa.
Die Reformen verfehlten dann ihr wesentliches Ziel verbesserter Wirtschaftlichkeit. Dies deshalb, weil die Marktreformen sowohl zuviel wie zuwenig darstellten. Die Reformen übergaben nicht die Wirtschaftskontrolle an die Arbeiterklasse, so daß Produktivität und Erneuerung daraus fließen könnte.
Aber sie erlaubten der Konkurrenz der Unternehmen auch nicht, sich bis zu dem Punkt zu entwickeln, wo die Effizienz gesamtwirtschaftlich dadurch verallgemeinert wird, daß das am geringsten produktive aus dem Geschäft geschmissen wird; oder bis zu dem Punkt, wo der Produktmarkt auf Kapitalgüter (oder Kapital) ausgeweitet wird, so daß die Dynamik alle Wirtschaftsbereiche durchdringen könnte.
Stattdessen blieben in einem System „dualer Abhängigkeit“ (von Markt und Plan) die entscheidenden Schlüsselelemente die zentralen Planagenturen; direkte bürokratische Kontrolle wich der indirekten. Statt zwingende Vorgaben zu setzen, die physische Ziffern gebrauchen, benutzen die Planer finanzielle Instrumente, um den Plan auszuführen.
Diese zentrale Kontrolle wurde auch auf anderen Wegen bewerkstelligt. Auf Unternehmensebene müssen die Manager, obwohl formal Herren ihres eigenen Outputs, „Bitten“ nachgeben, um Anforderungen für den Export oder sogar die Inlandsnachfrage zu erfüllen. Zusätzlich setzte ein System von Quoten und Lizenzen Parameter, innerhalb derer das Angebot „frei“ erworben werden konnte.
Während das Preissystem liberalisiert wurde, blieb eine gewisse direkte Preisfestlegung immer erhalten und beabsichtigte Preisänderungen mußten den Zentralbehörden angezeigt werden. Entscheidend war, daß die Beschäftigungsniveaus in den Fabriken und der Kreditzugang für die Finanzierung von Anlageinvestitionen politischer Verhandlung zwischen Unternehmensmanagern und der Zentralbehörde unterworfen waren. Die wirkliche Verfügungsmacht über den Akkumulationsprozeß verblieb bei den Planern..
Während auf dem Markt beruhende Kriterien für den Output eingeführt wurden (z. B. Profitabilität), war die endgültige Marktdisziplin lasch oder existierte nicht, weil am Ende systematisches Erwirtschaften von Verlusten nicht automatisch zur Schließung führte, ebensowenig wie langfristiger Erfolg hinlangte, die Profite behalten zu können.
Steuerwesen und Haushaltsmaßnahmen wurden als makro-ökonomische Hebel von den zentralen Planern angewandt, um auf mikro-ökonomischer Ebene verursachten Erfolg und Mißerfolg neu zu verteilen.
Jugoslawien
Zwischen 1952 und 1965 organisierte der jugoslawische Arbeiterstaat seine Wirtschaft um eine Mischung aus Plan und Markt herum, die in vielem so war, wie oben am Fall von Ungarn unter der NÖM beschrieben. Zwischen 1965 und den frühen 1970ern ging die jugoslawische Bürokratie jedoch den Weg der Marktreformen viel weiter als irgendeine herrschende Kaste vorher oder nachher. In gewisser Beziehung wies die ‘weder Plan noch Markt’ – Mischung, die sich in jenen Jahren (vor der teilweisen Rezentralisierung nach 1971) durchsetzte, tatsächlich Ähnlichkeiten mit der politischen Ökonomie der moribunden Arbeiterstaaten in Osteuropa und der Ex-UdSSR nach 1989 auf.
Nach 1965 gab es in Jugoslawien drei zusätzliche Schlüsselreformen. Erstens gaben die zentralen staatlichen Planämter die direkte Kontrolle über die Banken und die Zuteilung von Investivmitteln auf (außer einer übriggebliebenen Funktion in der Zuweisung von Fonds an unterentwickelte Regionen).
An ihrer Stelle wurden autonome Banken errichtet mit den Unternehmen selbst als größten Konteninhabern und stimmberechtigten Direktoren.
Zweitens verfügte der Staat, daß der Brennpunkt aller ökonomischen Entscheidungsfindung über Produktion (und Verteilung der Einnahmen aus ihr) die selbstverwalteten Unternehmen seien. Diese seien vollkommen frei, Verträge zu schließen mit wem auch immer sie wollten.
Alle Investitionsentscheidungen (einschließlich Investitionen in anderen Unternehmen in anderen jugoslawischen Republiken) sollten von den Unternehmen in Abhängigkeit vom verfügbaren Kapital, das von den Banken verliehen wurde, getroffen werden.
Zum dritten gab der Bundesstaat das staatliche Außenhandelsmonopol auf, was zu einem riesigen Anstieg der Wareneinfuhren, gemeinsamen Unternehmungen mit dem Imperialismus und der Auswanderung jugoslawischer Arbeiter führte. Preise von Importen wie einheimischen Gütern wurden freigegeben, worauf sie auf Weltmarktniveau kletterten.
Diese Maßnahmen sollten zusammen mit der Währungsabwertung und dem resultierenden Exportanstieg den hauptsächlichen Stimulus für Expansion und Wirtschaftlichkeit bilden.
Ergebnis dieser Reformen war, daß es überhaupt keine wirksame Koordination von Herstellung und Verteilung durch eine Bundesbehörde gab. Einerseits führten die Bankreformen zu einer Explosion verfügbaren Investivkapitals.
Da die Unternehmem Haupteigner der Banken waren und es eine Obergrenze des Zinsfußes gab, schuf das durch einen anderen Mechanismus die permanente Nachfrage nach Investitionen, die typisch für bürokratisch geplante Wirtschaften war.
Andererseits schloß das System selbstverwalteter Unternehmen das Recht auf Arbeit ein und machte es praktisch unmöglich, Arbeiter zu entlassen oder eine Fabrik zu schließen. Unter diesen Bedingungen bauten sich massive Überkapazitäten auf, wie auch Geschäftsverluste.
Die Marktreformen in Jugoslawien taten selbst verglichen mit anderswo überhaupt nichts, um die Produktivität zu steigern. In 20 Reformjahren sank die Produktivitätszuwachsrate um die Hälfte, hauptsächlich der geringen Effektivität neuer Kapitalinvestitionen wegen.
Die Inflation kletterte im Ergebnis der Marktreformen von weniger als 4% in der Periode 1952 – 1962 auf fast 30% in den frühen 80ern. Dies trat ein wegen der ausufernden Kreditexpansion, um die Produktion zu finanzieren. Angesichts steigender Inflation suchten die Arbeiter in den selbstverwalteten Unternehmen Schutz, indem sie eine beträchtliche Portion des Nettoeinkommens eher den Löhnen als den Investitionen widmeten und dadurch den Bedarf nach externem Kredit erhöhten.
Die Arbeitslosigkeit schoß in die Höhe, weil der Bundesstaat seine Verantwortung für die Arbeitsfindung aufgab und die existierenden Betriebe sträubten sich, neue Arbeitskräfte, die auf den Markt drängten, aufzunehmen (besonders Bauern vom Lande) aus Angst, den Lohnfonds zu dünn über eine vergrößerte Belegschaft verteilen zu müssen. Daraus resultierte eine Massenauswanderung.
Endlich führten die Reformen zu groben regionalen Ungleichheiten, da die Investitionen in die entwickelteren Regionen gingen; sie führten zur wirtschaftlichen Unordnung des Landes und bereiteten dem Auseinanderbrechen Jugoslawiens in den späten 1980ern den Weg.
Indem sie jede direkte und manche indirekte bürokratische Regulierung der Ökonomie aufgaben, trugen die bundesstaatlichen Stalinisten in Jugoslawien viel zur Desorganisation und zum Chaos im Lande bei.
Die Marktreformen – im Kontext der verbleibenden Beschränkungen von Betriebsschließungen und Entlassungen, der Abschreckung von wirtschaftlichem Investitionsmittelgebrauch und der Abwesenheit rationeller Preisbildung von Kapitalgütern (einschließlich des Kapitalpreises) – dienten nur dazu, die Wirtschaft weiter zu destabilisieren.
Die Reformen führten große regionale Unterschiede, Massenarbeitslosigkeit, Emigration und zügellose Inflation ein. Schließlich steigerten sie den in der bürokratischen Planwirtschaft inhärenten säkularen Niedergang des Produktivitätszuwachses eher, als ihn umzukehren – so durchkreuzten sie den eigentlichen, an erster Stelle stehenden Sinn, die Marktreformen durchzuführen.
Die durch die Reformen nach 1965 ausgelöste soziale und ökonomische Krise löste riesigen gesellschaftlichen Unmut aus (1968 – 1971), Studentenproteste und Arbeitersolidarität. Der Zusammenhanglosigkeit der Reformen konnte man nicht gestatten, weiter Bestand zu haben.
Entweder mußte der Weg zum vollen Kapitalismus durch Privatisierung, Beendigung der Arbeiterselbstverwaltung, Liquidierung der hauptsächlichen Verlustbringer, eine deflationäre Geldstabilitäts- und kommerzielle Kreditpolitik genommen werden, oder es mußte eine gewisse Umkehr und Rezentralisierung des Plans geben.
Mitte der 1970er Jahre wurde ein Element von Zentralisierung wieder aufgelegt, um die Rutschpartie zum Stillstand zu bringen. Das Zentrum übernahm mehr Verantwortung für die Rationierung der Investitionsfonds. Die Bundes- und Republiksregierungen stellten auch ein Vertragssystem zwischen Betrieben und verschiedenen Staatskörperschaften auf, um der Produktion etwas Lenkung zurückzugeben.
Aber der Schaden war da. Ein großes Ausmaß an Abhängigkeit vom internationalen Handel mit dem Kapitalismus, ein wachsender Schuldendienst und weitere regionale Ungleichheit sorgten dafür, daß es kein Ende der Wirtschaftskrise gab. Als der Stalinismus nach 1989 zusammenbrach, waren Staaten wie Slowenien und Kroatien unter den ersten in der Schlange, die die volle kapitalistische Restauration verlangten.
Ist Sozialismus möglich?
Die neoliberale Kritik am Sozialismus
In den Zwischenkriegsjahren wurde von der österreichischen Schule neoliberaler bürgerlicher Wirtschaftswissenschaftler (z. B. von Mises, Hayek) eine Attacke auf die politische Ökonomie des Sozialismus inszeniert. In kurzer Folge auf das Experiment des Kriegskommunismus argumentierten Hayek und von Mises, es sei unmöglich, ein rationelles Wirtschaftssystem ohne vollen Gebrauch von Geld, konkurrierenden Märkten und Preisen zu organisieren.
Hayek legte dar, der Sozialismus biete keine ökonomische Antwort „auf das allgemeine Problem, das überall entsteht, wo eine Vielzahl von Zwecken um eine begrenzte Anzahl an Mitteln konkurriert“. Für Hayek kann dieses Problem nur auf blinde Art gelöst werden, als Ergebnis der ungeplanten Folgen konkurrierender Entscheidungen seitens einzelner und atomisierter Produzenten und Konsumenten am Markt.
Da für Hayek „Wert“ keine objektive Grundlage in der Arbeit hat, kann er nur in der subjektiven Nutzenbewertung eines Erzeugnisses für verschiedene konkurrierende Hersteller und Verbraucher existieren. Diese kollidierenden Wertschätzungen werden durch das System der Marktpreise koordiniert, das Signale über den relativen Wert von Gütern an alle Produzenten und Konsumenten sendet. Infolgedessen kann ein zentraler Plan, der eines solchen Preissystems und Markts beraubt ist, nicht ermitteln, was der vernünftigste Nutzen für knappe ökonomische Ressourcen ist.
Ein System von Privateigentum an den Produktionsmitteln wurde von der österreichischen Schule für unerläßlich gehalten, so daß die Profitchance auf der einen Seite und das Risiko der Fehlschlags auf der anderen Entscheidungen vorwärtstreiben konnten. Diese allein könnten zu Innovationen anregen und die Arbeitsproduktivität verbessern.
Hayeks Kritik war ursprünglich von theoretischer Natur. In den frühen 30er Jahren folgerte er jedoch, daß das Experiment der Sowjetunion bis zu dieser Zeit sein Argument unterstützte. Er behauptete, daß die UdSSR gemessen an der Höhe der Ersparnisse chronisch unter Unterkonsumtion litt und daß ein kapitalistisches System in Rußland mit diesem Niveau an Rücklagen einen höheren Standard im Endverbrauch geboten hätte. Weiter schlußfolgerte er, daß das Scheitern des Kriegskommunismus und die anschließende Akzeptanz von Märkten unter der NÖP, gefolgt von der Schwierigkeit, die Ziele des ersten Fünfjahresplans zu verwirklichen, alles die Unfähigkeit irgendeines zentralen Plans aufzeigte, eine vernünftige Alternative zu den Märkten zu liefern.
Die Österreicher bestanden auch darauf, daß Planung nicht in der Lage sei, das ‚Informationsproblem‘ zu lösen, das von Märkten automatisch gelöst wurde. Die Millionen existierender Güter waren alle voneinander verschieden; selbst Güter der gleichen Art befanden sich in verschiedenen Verschleißzuständen. Darüber hinaus erfolgten technische Verbesserungen zunehmend und wiederholt. Kurz, ein zentraler Plan konnte unmöglich die notwendige Information zusammentragen und koordinieren, um einen Plan im Betrieb funktionieren zu lassen. Selbst wenn die Information gesammelt werden könnte, würde es eine Reihe an Gleichungen von solcher Größenordnung erfordern, daß es außerhalb des Horizonts der Mathematikwissenschaft bliebe, eine Plan zu formulieren. Jeder Versuch in dieser Richtung würde notwendigerweise zu einer Senkung der Arbeitsproduktivität im Vergleich zum Kapitalismus führen.
Im Verlauf der Debatte verschob Hayek die Gewichtung seiner Ausführungen, um die Vorstellung zu erwecken, daß ein System disharmonischen Wettbewerbs zwischen rivalisierenden Privateigentümern der einzige Weg sei, auf notwendig fragmentierte Kenntnis von Produktverbesserungen, Nachfrage und ähnliche Faktoren zu reagieren. Er akzeptierte, daß es in einem statischen System von Nachfrage und Angebot sowie Gleichgewichtspreisen (eine Annahme neoklassischer bürgerlicher Wirtschaftswissenschaftler und, so behauptete er, sozialistischer Ökonomen) möglich sein könnte, das Informationsproblem zu lösen. In einem dynamischen, sich stets wandelnden und konkurrierenden System bliebe das Problem jedoch unlösbar.
In diesem Sinne dreht sich das österreichische Argument nicht darum, ob Informationen gesammelt werden können, um eine Allokation zu ermöglichen, sondern vielmehr darum, daß Konkurrenz und Rivalität (und die sich wandelnde Kenntnis, die daher rührt und letztlich über das Preissystem zusammengetragen wird) der einzige Weg sei, um Unternehmertum und wirtschaftlichen Fortschritt zu erreichen.
Die marxistische Antwort auf diese ultra-freimarktlichen Ansichten der österreichischen Schule muß von einer Kritik ihrer methodischen Annahmen über das Wesen des Wirtschaftslebens aus starten. Hayek bezieht den Standpunkt des extremen Individualismus‘ und Subjektivismus‘. Mehr noch, Konsumbedürfnisse werden als Triebkraft jeder Ökonomie betrachtet. Alles im Wirtschaftsleben wird reduziert auf Markttauschvorgänge zwischen freien und gleichen Privateigentümern.
Marxisten leugnen nicht die Bedeutung von Marktbeziehungen im ökonomischen Alltag, aber es ist einfach falsch, zu suggerieren, daß Tauschprozesse am Markt für die hauptsächliche Dynamik verantwortlich sind, die die Zuteilung von ökonomischen Hilfsquellen in einer kapitalistischen Warenwirtschaft. Der Marxismus stellt eine andere Rechnung von Wirtschaft zur Verfügung, die auf dem geschichtlichen und relativen Charakter ökonomischer Bewegungsgesetze beharrt, nicht auf ihrer zeitlosen und unhistorischen Anwendung.
Hayeks extrem subjektivistische Erklärung ökonomischer Antriebskräfte kollidiert natürlich mit der Wirklichkeit kapitalistischer Entwicklung. Für Hayek enthalten Marktpreise alle nötigen Informationen für private Warenbesitzer, um rationelle Entscheidungen über Ressourcenallokationen zu fällen, aber das steht offenkundig im Streit mit der Art und Weise, wie der Kapitalismus funktioniert.
Preise sind nicht für alle Verbraucher Parameter (d. h. gegeben und unabänderlich). Viele Produktionen (z. B. Rüstungsbeschaffung) werden erst nach Ausschreibungen aufgenommen, bei denen Beschaffenheits- und Qualitätsbewertungen der Ware entscheidend sind, und der Preis wird dann für diese Anforderungen gebildet. Noch mehr, Vertrag, Markenname und Lieferzeit bestimmen die Verbraucherwahl genauso, wenn nicht mehr, als der Preis. Was Hayeks Unterstellung angeht, die unternehmerische Risikobereitschaft erzeuge die hauptsächliche Dynamik für wirtschaftlichen Fortschritt im Kapitalismus, so ist es nur notwendig, die wahre Natur von Erneuerungen und technischem Fortschritt mit Hayeks Karikatur auf das 19. Jahrhundert zu kontrastieren.
Unter der Ägide imperialistischer multinationaler Konzerne findet Innovation vorrangig innerhalb der Grenzen riesiger monopolistischer Aktiengesellschaften statt. Zuweilen unterdrücken sie Neuerungen, wenn diese die Profitmargen von Marktanteilen für etablierte Erzeugnisse bedrohen; Forschung und Entwicklung zielen immer darauf, das Risiko zu minimieren und der Konkurrenz zuvorzukommen.
Hayek hantiert mit einem absurd unrealistischen Konzept perfekten Wettbewerbs, wo es freien und unbehinderten Zutritt zu und Ausstieg aus Märkten für die Hersteller gibt und jeder Unternehmer über alle elementar notwendige Kenntnis verfügt, um eine vernünftige Entscheidung über die wirtschaftlich beste Auswahl zu treffen, wenigstens für sich selbst.
In Wirklichkeit ist das bruchstückhafte Wissen des Individuums am Markt nur ein unvollständiger und unangemessener Wegweiser. Es ist für jedes Individuum unmöglich, sich wichtige und möglicherweise entscheidende öffentliche und gesellschaftliche Tatsachen zu vergegenwärtigen, die die Vernunft seiner eigenen rationellen Entscheidungen tangiert. Die Auswirkung einer Entscheidung über die Plazierung öffentlicher Infrastrukturmaßnahmen in der Nähe einer Stadt oder einer Fabrik können nicht vorhergesehen werden. Die individuellen Auswirkungen einer durch andere gefällten Entscheidung mögen in der Folge die Mutmaßungen ändern, unter denen erstere Entscheidung gefaßt wurde.
Insbesondere kann der Wettbewerb zwischen selbstsüchtigen Rivalen auf dem Markt, durch aktuelle Preise gesteuert, nicht zu optimalem Nutzen der gesellschaftlichen Potentiale führen, wenn denn die Reihe an Investitionen und Akkumulation gerät, d. h. zukünftige Erzeugung, da es jenseits der Macht jedes Individuums steht, zukünftige Preisbewegungen vorwegzukalkulieren, die erst gegenwärtige Entscheidungen über Investitionen in rationelle verwandeln werden oder nicht.
Somit können die bruchstückhafte Art des Wissens und seine unvorhergesehenen transindividuellen oder sozialen Kosten Wirtschaftsentscheidungen zu verschwenderischen machen dadurch, daß Kapazitäten unnötigerweise vermehrt werden oder daß der Ausstoß keine Endabnehmer findet. Atomisierte Entscheidungsfindungen sind deshalb irrational, weil sie den wirtschaftlichen Fortschritt hemmen. Alle diese Kritiken an Hayeks ökonomischem Modell kommen auf denselben Punkt zurück: er abstrahiert falsch (idealistisch) vom Kern des Wirtschaftslebens und unternimmt dies eher denn aus Verallgemeinerungen aus dem wahren Klassencharakter der Produktion uim Kapitalismus als aus der einseitig aufgefaßten Art von Individuen im Austauschprozeß heraus.
Es sei hinzugefügt, daß Hayek auch einer idealistischen Abstraktion über das allgemeine menschliche Wesen für schuldig befunden werden kann, die in vollem Widerspruch zu allen Resultaten moderner Psychologie und anderer Wissenschaften steht. Hayek porträtiert menschliche Individuen wesentlich als voll entwickelte Bürger: unabhängig von anderen Individuen; souverän in ihren Entscheidungen; alle menschlichen Beziehungen nur gemäß dem Tauschwert, über den andere verfügen, beurteilend; allein eigene materielle Interessen im Handeln verfolgend.
Direkte menschliche Beziehungen (im Gegensatz zu austauschorientierten), die auf Vertrauen, Liebe, Solidarität beruhen, scheinen in diesem Konzept nicht auf oder sind mindestens vollständig von der ‚ökonomischen Sphäre‘ getrennt. Deshalb paßt für Hayek der Kapitalismus nicht nur zur menschlichen Natur, sondern ist nichts weniger als deren Verwirklichung.
Daraus fließt logisch, daß es kein anderes Gesellschaftssystem geben kann, das perfekter als der Kapitalismus der menschlichen Art entspricht. Natürlich ist es richtig, daß der Kapitalismus, seine Ethik und Moral, tief in die gesellschaftliche und psychologische Erscheinungsform von Individuen hinein Wurzeln treiben. Darüber hinaus befinden sich zwischenmenschliche Verhältnisse im Kapitalismus unter Druck, sich dem Tauschbeziehungsmodell anzupassen. Es stimmt jedoch nicht, daß alles dieses mit dem menschlichen Charakter harmoniert.
Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall. Menschliche Lebewesen brauchen direkte soziale Beziehungen, wenn sie ihre Persönlichkeitspotentiale so voll wie möglich verwirklichen sollen. Sie brauchen gesellschaftliche Verhältnisse, die die volle Bandbreite menschlicher Gefühle und Qualitäten ausdrücken, nicht nur die verengte Konzeption von menschlichem ‚Wert‘, wie sie vom Geldzusammenhang des Markts etabliert wird. Dies ist natürlich im Fall bürgerlicher Besitzer nicht so beeinträchtigend, da die (erfolgreichen) Kapitalisten ihre psychische Stärke und Gesundheit auf der sozialen Macht aufbauen, die ihr Kapital darstellt. Weil die gesellschaftliche Stärke durch die unbezahlte Arbeit ihrer Arbeiter vergrößert wird, finden die Kapitalisten sich selbst für die kapitalistische Entfremdung entschädigt.
Im Gegensatz dazu wird den Arbeitern die Gelegenheit vorenthalten, zur gesellschaftlichen und geschichtlichen Entwicklung beizutragen. Ihre Persönlichkeiten sind durch Ausbeutung und Unterdrückung verarmt. Das zunehmende Ausmaß psychischer und psychosomatischer Unpäßlichkeiten innerhalb der Arbeiterklasse ist in letzter Instanz das Ergebnis der zerstörerischen Auswirkung des Kapitalismus auf menschliche Verhältnisse.
Marktsozialismus: Neue Utopien für das Jahrtausend
Die Frühphasen kapitalistischer Entwicklung in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts erzeugten Ideologien, die die Auswirkungen des neuen Systems kritisierten, ohne an seine Wurzeln heranzugehen. Im Grunde repräsentierten diese Ideologien den Klassenstandpunkt des Kleinbürgertums, aber in Ermangelung einer wissenschaftlichen Alternative fielen ihnen auch breite Schichten der Arbeiterklasse und die aufkommende Arbeiterbewegung zum Opfer. Dies war das Zeitalter des utopischen Sozialismus, der nach dem Ableben der französischen Revolution einflußreicher wurde. Owenismus, Proudhonismus und die deutschen Wahren Sozialisten konzentrierten ihre Attacke auf das Geldsystem, die Einführung von Papiergeld, die Ausweitung des Kredits und den Skandal der Zinsabzahlungen oder sie kritisierten einfach die grassierende Ungleichheit und Ungerechtigkeit.
Utopische Schemata für Arbeitszeitzertifikate oder Arbeiterbanken wurden entworfen, aber das Wesen des Kapitalismus, der Austausch privat produzierter Waren einschließlich der Arbeitskraft und das Gesetz der Selbstverwertung des Werts, das daraus entsteht, wurden niemals verstanden und konnten es auch nicht. Die Autoren dieser frühen Versionen von ‚Marktsozialismus‘ waren ‚Freunde der Arbeit‘, verteidigten aber klar die Privateigentümerklassen. Owen begrüßte z. B. „die Militärmacht der französischen Regierung“, die Pariser Junirevolution 1848 niedergeschlagen zu haben. Proudhon unterstützte den Schlächter der französischen Arbeiter, Cavaignac, in den Dezemberwahlen 1848 und applaudierte später dem Staatsstreich Louis Bonapartes.
Drum hat der ‚Marktsozialismus‘ eine lange intellektuelle Tradition. In diesem Jahrhundert tauchte er als Kritik an der Wirtschaftsplanung in der UdSSR wieder auf. Die ersten Schreiber argumentierten korrekt, daß frühe sowjetische Annahmen in Bezug auf Planung und die Versuche, Preise und Geldkalkulation vom Beginn des sozialistischen Übergangs an abzuschaffen, falsch waren. Im Gegenteil, diese Marktindikatoren konnten nicht durch ’natürliche‘ Meßzahlen des Gebrauchs gesellschaftlicher Arbeit ersetzt werden (z. B. Kalorienverbrauch).
In Polemiken mit den Freimarktanhängern konzentrierten sich Marktsozialisten wie Oskar Lange in den 1930er Jahren darauf, wie Preise für alle möglichen Güter in Abwesenheit eines Markts bestimmt werden konnten.
Die Antwort war, daß der Markt für Investitionsgüter imitiert werden mußte (Preissetzung durch die Planstäbe nach dem System von Versuch und Irrtum) und für die Bildung von Preisen für Arbeitskraft und Konsumgüter der Markt selbst ausgenutzt werden mußte.
Das nächste Stadium der marktsozialistischen Debatte erwuchs aus Versuchen, die bürokratische Kommandoplanung in den degenerierten Arbeiterstaaten zu reformieren (z. B. die späteren Schriften von Lange, die Ideen von Brus in Polen und Sik in der Tschechoslowakei, die Selbstverwaltungserfahrung in Jugoslawien von 1965 – 1971 oder der Neue Ökonomische Mechanismus in Ungarn nach 1968; in Britannien die Argumente von Alec Nove). Diesen Theorien ist das Eintreten für Marktmechanismen wie Unternehmensautonomie oder profitmaximierendes Verhalten, um die zunehmend durchscheinenden Tendenzen zur Stagnation, eingeschränkten Konsumauswahl und schlechten Bilanz technischer Erneuerungen zu berichtigen, gemeinsam.
Schließlich haben die aktuellsten Entwicklungen in der Debatte den weitgehendsten Marktgebrauch befürwortet und das eigentliche Konzept von ‚Sozialismus‘ bis zur Bruchstelle strapaziert. Diese westlichen sozialdemokratischen Wirtschaftswissenschaftler und sonstigen Akademiker sind sowohl vom Niedergang und Zusammenbruch stalinistischer Planung wie auch der geistigen und politischen Hegemonie neoliberaler Ökonomen während der 1980er und 1990er Jahre in Europa und Nordamerika beeinflußt worden (z. B. Roemer, Millar, Le Grand).
Im Extremfall haben diese Schriftsteller jede Rolle für zentrale staatliche Regulierung in irgendeinem Herstellungstyp (oder sogar Arbeiterselbstverwaltung des Unternehmens) einschließlich der Investitionsgüter aufgegeben. Statt dessen plädieren sie für einen freien Wettbewerbsmarkt bei der Festlegung von Preisen (und dadurch von Angebot und Nachfrage) aller Güter und Dienstleistungen (einschließlich der Arbeitskraft). Der Anspruch darauf, überhaupt ein ’sozialistisches‘ Modell darzustellen, beruht auf dem Bekenntnis zu einer bestimmten Form öffentlichen Eigentums (Bürgereigentum an Aktiengesellschaften) und dadurch zur gleichmäßigen Verteilung von Profiten.
Obwohl das Lager der Marktsozialisten eine große Bandbreite besonderer politischer Rezepte und institutioneller Arrangements umfaßt, kann von ihnen allgemein gesagt werden, daß sie akzeptieren, daß Konkurrenzmärkte für eine Reihe Güter und ein gewisser Grad an Unternehmensautonomie von zentralen Plandirektiven wesentlich sind, wenn Effizienz und Demokratie sichergestellt sein sollen. Marktsozialisten akzeptieren, daß es kein konzentriertes Privateigentum an den hauptsächlichen Produktionsmitteln geben darf – es muß ‚Gesellschaftseigentum‘ existieren.
Auf makroökonomischer Ebene sollte eine zentrale oder nationale Planungsagentur (wenigstens einige vorschlagsweise) Entscheidungen über größere Investitionen treffen. Auf der anderen Seite erklären Marktsozialisten, daß Arbeitsplätze und die meisten Verbrauchsgüter auf dem Weg über einen Wettbewerbermarkt alloziert werden sollten. Zusätzlich bestehen sie darauf, daß alltägliche Entscheidungen über Output und Preise, effektiv alle Entscheidungen, die die Ausnutzung existierender Kapazitäten berühren, von den Einzelunternehmen gefällt werden sollten. Einige argumentieren, daß die meisten oder alle Investitionsentscheidungen auch auf Unternehmensebene erfolgen sollten außer für öffentliche Infrastrukturprojekte (Verkehr, Kommunikation, Erziehungswesen).
Für Marktsozialisten stellen einzelne Firmen unabhängige Produktionseinheiten dar. Sie entscheiden autonom und verkaufen ihre Erzeugnisse auf offenen Märkten. Der utopische Charakter dieses Schemas wird an der Tatsache erhellt, daß der moderne Kapitalismus – der Ausgangspunkt zum Sozialismus – nicht eine Gesellschaft verhältnismäßig selbstgenügsamer einfacher Warenproduzenten ist, die ihren geringen Überschuß auf dem Markt verkaufen und dann jene Produkte einkaufen, die sie nicht selbst herstellen können. Der Sozialismus wird vielmehr eine komplizierte Arbeitsteilung ererben, innerhalb derer die Ausgangsprodukte einer Firma die Eingangsprodukte anderer ausmachen.
Die gegenseitigen Abhängigkeiten zwischen selbstverwalteten Unternehmungen verlangen nach einem koordinierenden, zentralen Mechanismus – der direkten Assoziation aller Produzenten und Konsumenten.
Die ganze geschichtliche Erfahrung (Ungarns NÖM, Jugoslawiens Selbstverwaltung) zeigt, daß, wenn die Zügel an der Unternehmensautonomie zu bedeutend sind (z. B. das Unvermögen, Investitionen für Zusatzkapazitäten zu genehmigen, den Handel einzustellen oder Arbeiter zu entlassen), diese nicht effektiv dazu führt, Konkurrenzmärkte nachzuahmen und das System ins Chaos abgleitet.
Marktsozialismus ist eine inhärent widersprüchliche Kombination wirtschaftlicher Logiken und Regulierungen. Kapitalistische Wettbewerbsmärkte erfordern eine Vielzahl von privaten Kapitaleigentümern, von denen jeder für Riskoentscheidungen über das Investitionsmuster verantwortlich ist, über die Struktur der Produktionskapazität. Diese Entscheidungen müssen individuell getroffen werden, in völliger Unkenntnis von den Entscheidungen der anderen Produzenten und motiviert von dem Wunsch, langfristig Profite zu maximieren. Nur das Zusammenspiel dieser blinden unpersönlichen Marktkräfte begründet Gleichgewichtsniveaus von Beschäftigung, Preisen und Zinsraten, die alle Privatkapitalisten konfrontieren.
Im Gegensatz dazu ist keine Art sozialistischen Übergangs möglich, wenn das gesellschaftliche Verhältnis zwischen Lohnarbeit und Kapital nicht abgeschafft worden ist und wenn die Arbeitskraft weiterhin eine Ware ist, wenn Lohn- und Beschäftigungshöhen auf einem Wettbewerbsmarkt festgelegt werden.
Zentrale, von Planbehörden ausgegebene Anweisungen bezüglich Einkommen und Beschäftigung würden andauernd von den Entscheidungen, die von autonomen Unternehmen gefällt werden, welche ihrerseits in ihren mikroökonomischen Entscheidungen von Erwägungen über Profitmaximierung geleitet werden, unterhöhlt.
In letzterem Fall wären natürlich Unternehmen unterschiedlich erfolgreich. Welche Reaktion sollte dann aus dem Zentrum kommen, wenn einige Unternehmen bei diesem Wettlauf verlören? Was, wenn die Güter unprofitabel wären, aber ein gesellschaftliches Minderheitsbedürfnis erfüllten? Was, wenn eine Firma anstrebte, Arbeitsplätze einzusparen oder einen Teil ihrer Produktion stillzulegen, um wieder schwarze Zahlen zu schreiben?
Von Anfang an wäre es wahrscheinlich, daß solch unvorhergesehene Entwicklung sofort Teile des Plans überflüssig machen würde und den Rest des Plans aus dem Gleichgewicht würfe. Desweiteren würde jedes Versagen, Arbeitslosigkeit oder Einkommensungleichheiten zu stoppen, der vom nationalen Plan beabsichtigten Nachfragestruktur widersprechen und wäre mit der egalitären Moral des Übergangs unvereinbar.
Selbst die schwächste Ausdrucksform von ‚Sozialismus‘, die Wettbewerbsmärkten völlig die Zügel ließe, um Produktions- und Preishöhen festzulegen, hätte immer noch einen Defekt im Kern; nämlich, daß die kollektive, egalitäre Form der Verteilung von Profit und gemeinsamen Eigentumsrechten mit der Produktionsweise jener Profite in Konflikt käme.
‚Marktsozialismus‘ ist darum eine Form kleinbürgerlichen Sozialismus‘ im späten zwanzigsten Jahrhundert, die mit den Worten des Programms der Russischen Kommunistischen Partei von 1919 „gegen das Großkapital protestiert, aber im Namen der ‚Freiheit‘ für Kleinunternehmen“ (ABC des Kommunismus, London, 1927, S. 78 f.).
Im neunzehnten Jahrhundert war dieses Kleinunternehmen von Handwerksart. Heutige Marktsozialisten predigen die Freiheit der selbstverwalteten oder genossenschaftlich betriebenen Unternehmung; Freiheit nicht nur vom Großkapital (d. h. Monopolen und Banken), sondern auch von zentralen Planrichtlinien. Wir wenden uns jetzt der detaillierten Untersuchung der Argumente und Trugschlüsse von Schlüsselrepräsentanten der marktsozialistischen Ideologie jeden Stadiums zu.
Oscar Lange und Fred Taylor
Die frühen Verfechter der Vernünftigkeit des Sozialismus, die auf die Kritiken von Hayek u. a. antworteten, starteten ihre Verteidigung aus der bürgerlichen Wirtschaftswissenschaft heraus und lehnten die marxistische Politökonomie und die Arbeitswertlehre ab. Natürlich konnte ihre Verteidigung deshalb nicht konsistent sein, noch können wir uns mit ihr identifizieren.
Taylor und Lange gingen ihre Verteidigung fast ganz vom Standpunkt der Effektivität des Sozialismus aus an. Sie hatte wiederum zwei Bestandteile. Erstens sollte Wirtschaftlichkeit den kostengünstigsten Umgang mit verfügbaren Ressourcen bedeuten; zweitens mußte der Preismechanismus genutzt werden, um Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage zu garantieren.
Für sie war ‚Sozialismus‘ nicht mehr öffentliches Eigentum an Produktionsmitteln und gleiche Einkommensverteilung. Sie mutmaßten, politische Demokratie sei dem bürgerlichen Parlamentarismus ähnlich, aber sie glaubten, ihr Wirtschaftsmodell sei auch mit politischer autoritärer Diktatur, wie sie in der UdSSR existierte, verträglich.
Lange akzeptierte, daß der Marxismus die gesellschaftliche Evolution von einem Klassensystem zu einem anderen erklären konnte, führte aber aus, daß er nicht die ‚Alltagswirklichkeit‘ erklären könne. Für ihn „verstand“ die bürgerliche Volkswirtschaftslehre „ein statisches ökonomisches Gleichgewicht unter einem System konstanter Daten, und die Mechanismen, durch welche produzierte Preise und Mengen sich an diese Daten anpassen“. Während der Marxismus die Klassenentwicklung in der Produktion erklären konnte, konnte die Arbeitswertlehre nicht die Verteilung von Gütern und Dienstleistungen zwischen einzelnen Verbrauchern und Firmen erklären.
Dafür beriefen sie sich auf die neoklassische Grenznutzentheorie, ein Zweig der bürgerlichen Wirtschaftswissenschaft, der aus den 1870er Jahren herstammte und dessen Wesen darin bestand, die Wirkweise von Angebot und Nachfrage am Markt von der Produktion zu trennen. Als wirtschaftswissenschaftliche Schule drehte sie sich um die subjektive Einschätzung des Werts (Nutzens) von Gütern für das Individuum. So ersetzte die Studie der subjektiven Wertschätzung eines Gegenstands für eine Person das objektive Studium gesellschaftlicher Verhältnisse von Menschen in der Produktion und im Warentausch. Diese Theorie gab die Studie ‚realer Kosten‘, die in der Produktion stecken, auf, um den ‚Nutzen‘ zu erforschen.
Trotzdem wurden Taylors „Die Lenkung der Produktion im sozialistischen Staat“ und Langes „Über die Wirtschaftstheorie des Sozialismus“ vor dem Krieg als vollständigste Widerlegung der österreichischen Behauptung angesehen, Wirtschaftsrechnung sei im Sozialismus unmöglich. Sie gingen davon aus, die Produktionsmittel befänden sich im Gemeinbesitz, aber es gäbe eine völlig freie Auswahl beim Verbrauch und bei der Arbeitsplatzsuche. Taylor erörterte, die Methode der Güterzuteilung solle wesentlich die gleiche wie im Kapitalismus sein. Der Staat besäße die Produktionsmittel und wäre für die Einkommensverteilung entsprechend den Erfordernissen sozialer Gerechtigkeit verantwortlich. Die Herstellung würde von Verbraucherwünschen gelenkt, aber diese Vorlieben würden am Markt in ‚Nachfragepreisen‘ ausgedrückt.
Gemäß Lange sollte die Erzeugung von unabhängigen und konkurrierenden Firmen durchgeführt werden, aber sie müßten unter zwei ‚Grundregeln‘ produzieren, die von der Zentralen Planbehörde (ZPB) aufgestellt wurden. Die erste dieser Regeln ist, daß die Auswahl von Faktorkombinationen die durchschnittlichen Produktionskosten senken muß, so daß die Grenzproduktivität der Faktoren egalisiert wird. (Grenzproduktivität ist die Produktivität, die von der Hinzufügung einer Extrafaktoreinheit zur Produktion herrührt.) Zweitens sollte die Ausstoßmenge von dem Niveau bestimmt werden, auf dem die Grenzkosten dem Produktpreis gleichkommen; das bedeutet, wenn die Kosten einer zusätzliche Outputeinheit dem Preis entsprechen, falls der Preis als Durchschnittskosten plus Durchschnittsprofit festgesetzt wird. Wenn die Firmen entsprechend dieser Regeln vorgehen, werden die Preise von Arbeitskraft und Verbrauchsgütern durch den Markt festgelegt.
Preise für Produktionsgüter sollten anfangs von der ZPB auf Grundlage einer Kostenkalkulation für eine Reihe von Alternativen gesetzt werden. Dann wären die angebotenen und nachgefragten Mengen determiniert. Wenn es sich herausstellte, daß die von der ZPB diktierten Preise Angebot und Nachfrage nicht entsprechen, dann würden die Preise nach dem System ‚Versuch und Irrtum‘ angepaßt, bis sie es tun. So, durch die Nachahmung des Wettbewerbsmarkts, gelangte die ZPB zu Schemata für Angebot und Nachfrage aller Güter und Dienstleistungen.
Es gibt viele Kritiken an der Lösung Langes, deren meiste aus seinem Beharren resultieren, das Produktionssystem von der Distribution abzusondern. In diesem ‚Sozialismusmodell‘ kann es keine Möglichkeit geben, entfremdete Arbeit oder den Warenfetischismus zu überwinden. Menschliche Arbeit und ihre allseitige Entwicklung sind nicht Ausgangspunkt für Lange, sondern eher die Wirtschaftlichkeit in der Produktion und die Balance zwischen Angebot und Nachfrage. Deshalb wird Arbeit wie ein Produktionsfaktor behandelt, dessen Preis auf dem offenen Markt ermittelt wird, auf einer von Firmen etablierten Ebene, die gemäß parametrischer Vorschriften arbeiten, die die Effizienz diktieren.
Mehr noch, die Freiheit und Souveränität des Verbrauchers sind tatsächlich hohl und begrenzt. Der Konsument wird auf religiöse Art von seiner oder ihrer Rolle als Arbeiter getrennt und kann deshalb die Herstellung von Produktionsgütern vor der Produktion nicht beeinflussen oder Entscheidungen über die Einführung neuer Güter fällen. Der Verbraucher ist lediglich ein Preisnehmer für eine begrenzte Konsumgüterauswahl, die er ‚frei‘ kaufen kann oder auch nicht. Die Tatsache, daß eine Ware auf dem Markt plaziert wird zu einem Preis, der ihre Produktionskosten deckt, ist kein Beweis, daß sie die Ware ist, die der Konsument vorgezogen hätte, wenn ihm volle Kenntnis der möglichen Alternativen vor der Erzeugung gegeben wäre.
Darüber hinaus ist die Prozedur von ‚Versuch und Irrtum‘ für die Imitation von Konkurrenzmarkt und die Erlangung von Gleichgewichtspreisen ein gänzlich überzeugungsloses Modell der Weise, wie Preise entstehen. Als System basiert es auf Walras‘ Gleichgewichtstheorie. Dieses Modell macht die komplett unrealistische Annahme, daß Inidividuen ihre Pläne, zu produzieren oder konsumieren, als Reaktion auf Preissignale anpassen können, bevor sie tatsächlich kaufen oder verkaufen. In diesem Modell enthüllen wiederholte Antworten auf verschiedene Preissignale die Verbrauchervorlieben, und der Auktionator (d. h. die ZPB) koordiniert den Vorgang.
Die ZPB ruft eine Ansammlung von Preisen aus, und jedermann entscheidet, der zu diesen Preisen zu erwerben oder zu verkaufen wünscht. Diese Information wird dann vom Auktionator verarbeitet und dann werden Preise neu justiert, um Angebot und Nachfrage auf Linie zu bringen. Erst dann finden Käufe und Verkäufe statt. Die atomisierten, aufeinander folgenden Entscheidungsfindungen assoziierten Probleme werden in diesem Prozeß sauber vermieden. Kurz, dieser Vorgang abstrahiert (fälschlich) von der wirklichen Zeit und daher der Realität. Das Modell präsentiert gleichzeitig ein nicht funktionierendes Marktkonzept im Kapitalismus und eine technokratische und sozialdemokratische Sozialismusvision.
Ota Sik
Einer der prominentesten marktsozialistischen Theoretiker nach dem zweiten Weltkrieg war der tschechische Ökonom Ota Sik. In seiner Arbeit von 1965 „Plan und Markt im Sozialismus“ steckte er seine Theorie sozialistischer Warenverhältnisse ab. In dieser Arbeit focht er die aus dem Werk von Marx und Engels abgeleitete Idee an, daß die Warenproduktion von Geburt an mit dem Privateigentum verknüpft war und parallel zum Ende des Privateigentums mit ihm verschwinden wird. Er legte dar, daß Lenins Anerkennung der Unvermeidlichkeit von Warenverhältnissen während des Übergangs zum Sozialismus, so lange wie eine umfangreiche private Bauernwirtschaft existierte, eine unzureichende Bestätigung der Rolle war, die Marktverhältnisse beim Aufbau des Sozialismus spielen müssen.
Sik war ein scharfsichtiger Kritiker der Fehler der Kommandoplanung. Um sie zu berichtigen, war es jedoch wichtig, zuerst die Notwendigkeit sozialistischer Marktbeziehungen zu theoretisieren, d. h. ein optimales Verhältnis zwischen Plan und Markt. Er behauptete, daß das Argument einiger Reformer, daß Marktbeziehungen notwendig seien, um das Manko an Information und Wissen in der Kommandoplanung zu korrigieren, falsch war.
Prinzipiell konnten Verfeinerung der Planungstechniken und Überwindung des Bürokratismus dieses Problem lösen. Vielmehr gründete er die Verteidigung des Markts auf der Basis eines Interessenkonflikts, der, so behauptete er, zwischen Individuum und Plan existiere; ein gesellschaftlicher Widerspruch, der nicht durch bessere Kenntnisse ausgeschaltet werden konnte.
Die Wesensnatur dieses Widerspruchs lag im Mangel an ausreichendem Interesse des einzelnen Arbeiters an der Entwicklung gesellschaftlicher Arbeit. Die Erfordernisse des gesellschaftlichen Plans gebieten ein optimales Entwicklungstempo der Produktion, einen vernünftigen Gebrauch knapper Hilfsquellen, der Mengen- und Qualitätsbetrachtungen im Arbeitsprozeß ausbalanciert. Arbeiter und Manager sind nur an der einseitigen Entwicklung der Erzeugung interessiert, nicht an optimaler sozialer Entwicklung.
Die Kommandoplanung bündelte die Aufmerksamkeit auf rein quantitative Entwicklungen und Ziele; technische oder qualitative Entwicklungen wurden vernachlässigt oder ignoriert, weil diese unausweichlich kurzfristige Entgleisungen bei den Mengenzielen nach sich zogen. Allgemein gab es eine eingefleischte Tendenz im Planwesen, daß die verausgabte konkrete Arbeit von der sozial notwendigen Entwicklung abwich.
Die Arbeiter müssen ein Interesse an der optimalen Produktionsentwicklung haben. Aber wie? Moralische Anreize sind für die Arbeitermassen ungenügend und die technische Grundlage der Arbeit war für die meisten Arbeiter so, daß es keine kurzfristige Möglichkeit gab, die Routine und den öden Charakter der meisten Arbeit kurzfristig zu überwinden. Daher konnte man nicht erwarten, daß die schöpferische Natur des Arbeitsprozesses das Zusammentreffen zwischen den Interessen des Individuums und denen gesellschaftlicher Entwicklung sicherstellt. Es war kein böser Wille oder Bürokratismus als solcher, sondern „die objektiven Bedingungen der Verausgabung von Arbeit im Sozialismus“, die garantierten, daß es einen Interessenkonflikt gab.
Von daher müssen die Produzenten ein Verhältnis haben, wo jeder die Auswirkungen seiner Entscheidungen aufeinander fühlt:
„Jeder Produzent, der eine einseitige Entscheidung auf Kosten der Verbraucher trifft, sollte die negative Folgewirkung auf ihn selbst als Konsument spüren.“
Solcherart waren die sozialistischen Geld-Ware Beziehungen:
„Dies sind die Verhältnisse, mithilfe derer die Interessen der Leute als Verbraucher die Interessen von Leuten als Produzenten dauerhaft beeinflussen können und wirtschaftlichen Anreiz liefern, die Erzeugung auf optimale Weise zu entwickeln“. Materielle Konsumanreize sind die Antwort: „…es wird notwendig, die wirtschaftlichen Bedingungen zu schaffen, unter denen ihre eigenen materiellen Interessen Unternehmen drängen, die optimale Produktionsentfaltung zu sichern. Dies müssen Verhältnisse sein, unter denen die Belohnungsfonds aufgestockt werden, wann immer die Arbeit sich der gesellschaftlich notwendigen Arbeit oder Optimumproduktion annähert“.
Für Sik helfen darum die Marktverhältnisse, abzusichern, daß die in den Unternehmen konkret aufgewendete Arbeit gesellschaftlich notwendig zu sein bestrebt ist. Wenn ein Unternehmen scheitert, seine Erzeugnisse zu gegebenen Preisen zu verkaufen, dann muß der Lohnfonds entsprechend betroffen sein, um so Veränderungen im Arbeitsprozeß des Unternehmens zu erzwingen. Sik hielt diese Beziehung nicht nur zwischen Firmen, die Konsumgüter herstellen, und der Arbeiterklasse für erforderlich, sondern in Verhältnissen zwischen Firmen, die Kapitalgüter erzeugen.
Obwohl in marxistischen Kategorien ausgegeben, muß Siks geistreicher Versuch, die Erforderlichkeit des Markts zu theoretisieren, zurückgewiesen werden. Im Grunde ist er wenig mehr als Adam Smiths ‚unsichtbare Hand‘ (alle, die ihre eigenen Interessen verfolgen,tragen unbewußt zum allgemeinen Interesse bei), für den Übergang zum Sozialismus neu aufbereitet.
Er leidet an einem allen marktsozialistischen Rezepten gemeinsamen Fehler: das post-festum Urteil des Markts, was als gesellschaftlich nützliche Arbeit zählt, gerät in Konflikt mit den a priori Ansichten, was gesellschaftlich notwendige Arbeit ist, wie im nationalen Plan entworfen.
Wenn der Markt Schiedsrichter über das sein soll, was als gesellschaftliche Arbeit rechnet, werden die Planziele zur Bedeutungslosigkeit verwandelt oder suspekt, weil diese Planziffern, wenn man demokratisch zu ihnen hin gelangt, bereits ein Urteil über den gesellschaftlichen Charakter der Arbeit ex ante aussprechen.
Sik sieht in der Übergangsphase einen Konflikt zwischen ‚Unternehmen‘ und ‚Konsumenten‘ enthalten. In jedem Unternehmen, so führt er aus, haben Arbeiter und Manager ein Interesse daran, den Profit zu maximieren, den sie sich dann teilen können. Dies kann entweder geschehen, indem aus einer Monopolposition ein Vorteil gezogen wird oder indem Arbeit und Rohstoffe in der vorteilhaftesten Kombination angewandt werden. Auf jeden Fall werden Entscheidungen unabhängig davon gefällt, ob sie dem Verbraucher nutzen. Die Gegenüberstellung von Herstellung und Verbrauch ist falsch. In der Übergangsperiode ist die Arbeiterklasse beides – Produzentin und Konsumentin. Sik glaubt, daß nur Marktdisziplin garantieren kann, daß der Produzent macht, was der Konsument wünscht, aber bei einem demokratischen Plan braucht es einen solchen Konflikt nicht zu geben.
Sik starrt auf das falsche Problem; es ist natürlich möglich, ja sogar unvermeidlich, daß konkrete Arbeit im Unternehmen von gesellschaftlicher Arbeit abweichen wird. Bei der Kommandoplanung war das Problem, daß die Bestimmung dessen, was gesellschaftlich nützliche Arbeit ist, hoffnungslos vom Bestehen der Bürokratie auf einem Informationsmonopol und ihres Ignorierens der Verbraucherwünsche verdreht war. Optimale ökonomische Entwicklung wurde für willkürliche, überstürzte, rein quantitative (d. h. Gebrauchswert-) Sollvorgaben geopfert. Damit wurde der gesellschaftliche Charakter der Arbeit (d. h. verkörpert sie gesellschaftlich notwendige Arbeit oder nicht?) mehr als lieb sein konnte in endemischen Engpässen enthüllt, die zu vertanen und unvollständigen Projekten führten; oder zu Gütern, die die Arbeiter zu kaufen sich weigerten.
In einem demokratischen Plansystem wird der Plan Zielübereinkünfte betreffs Verbesserungen in der Arbeitsproduktivität und des schonenden Umgangs mit knappen Ressourcen widerspiegeln. Daher wird, ob konkrete Arbeit der gesellschaftlichen Arbeit entspricht oder nicht, davon abhängen, ob die Planziele erfüllt werden. Falls nicht, können die demokratischen Planüberwachungsgremien – wenn nötig – Sanktionen verhängen; oder es können Anpassungen der Zuteilung von Hilfsmitteln vorgenommen werden.
In Siks Schema wird nicht berücksichtigt, was zu tun ist, falls die konkrete Arbeit ohne Schuld der Arbeiter im Unternehmen die Optimumentwicklung verfehlt. Warum sollte ihre Vergütung gekappt werden? Wieder einmal sucht Sik eine Antwort beim Markt, wo das was benötigt wird, bewußte Klassenführung im Planverfahren ist.
Mehr noch, Siks Eintreten für Lohnerhöhungen für Arbeiter in einer Unternehmung, erfolgreicher als andere abschneidet, wäre für den Übergang zum Sozialismus verheerend; es würde die Solidarität untergraben und die Ungleichheit steigern. Im Gegenteil, alle Arbeiter müssen aus gestiegener Produktivität einen Nutzen als Ergebnis der Preissenkung für Gebrauchsartikel ziehen – ein kollektiver, klassenweiter Nutzen und einer, der akkurater die Tatsache wiedergibt, daß Produktivitätsgewinne eher Resultate nationaler, kollektiver Entscheidungen über Investitionen in Anlagen und Ausrüstungen als der Anstrengungen einzelner Arbeiter sind.
Alec Nove
Mitte der 1980er Jahre, als die Kinnock-Führung die Labour Party unter den Parolen vom ’neuen Realismus‘ nach rechts drückte, veröffentlichte Alec Nove seine Ökonomie des durchführbaren Sozialismus .Es wurde die Bibel der linksreformistischen Intelligenz, die versuchte, die Machbarkeit des ‚Sozialismus‘ gegen den Neoliberalismus zu verteidigen, indem sie ihn jedes marxistischen Inhalts entkleideten. Der Versuch, ‚Sozialismus‘ und Markt in Einklang zu bringen, war letztlich der alte Wunsch, die Klassenantagonismen des Kapitalismus unter der Schirmherrschaft des Kleinbürgertums auszusöhnen: dem ‚Großkapital‘ sollte seine Macht entzogen werden, aber die Arbeiterklasse soll nicht herrschen. Das Ergebnis ist eine Utopie.
Nove läßt alle angeblich ‚utopischen‘ Elemente im marxistischen Sozialismus fallen, z. B. das Absterben des Staats oder das Konzept von ‚Überfluß‘ im Kommunismus. Er erklärt die parlamentarische Demokratie zur bestmöglichen Staatsform und weist jeden alternativen Staat, der auf einem System von Arbeiterräten beruht, zurück. Er beansprucht, ein Realist zu sein, und schlägt als ebensolcher vor, daß fünf Eigentumstypen existieren sollten, entsprechend ihrer jeweiligen Vorzüge für die Umsetzung verschiedener Aufgaben.
In erster Instanz sollten staatliche Körperschaften die strategischen Teile von Industrie, Dienstleistungs- und Finanzsektor leiten. Sie wären nicht von den Belegschaften verwaltet, sondern verwaltungstechnisch und finanziell zentralisiert. Danach würden die ’sozialisierten Betriebe‘, also in Staatsbesitz befindliche Unternehmen, die volle Autonomie und ein der Belegschaft verantwortliches Management besitzen.
Sie wären Firmen mittlerer Größe und sollten das Gros gesellschaftlicher Produktion und Dienstleistungen abdecken. Sie würden unter ‚milden Konkurrenzbedingungen‘ arbeiten, was bei ihm die Bedeutung annimmt, daß Markterfolg die Verdienste von Managern und Arbeitern beeinflussen würde, aber die Produktionsmittel könnten nicht veräußert oder gekauft werden und der Staat behielte ein Mitspracherecht im Fall eines drohenden Bankrotts.
Als nächstes wären kleine Genossenschaftsbetriebe im Privatbesitz der Belegschaften selbstverwaltet und voll verantwortlich für ihren eigenen Erfolg oder Mißerfolg. Viertens gäbe es Bestimmungen für kleine Privatunternehmen, daß den Kapitalisten z. B. nicht gestattet, mehr als zehn Arbeiter zu beschäftigen. Schließlich könnten sich Individuen (z. B. freischaffende Journalisten, Klempner, Handwerker) als selbstarbeitende Geschäfte niederlassen.
Nove denkt auch, daß zentrale Planung per se ineffektiv ist wegen der damit verbundenen unlösbaren Informationsprobleme. Somit würde das ‚Zentrum‘ nicht versuchen, die ganze Wirtschaft zu planen, aber gewisse Funktionen beibehalten.
In erster Linie Entscheidungen, die strategische Investitionen berühren (z. B. den Bau neuer Fabriken, Straßen, Telekommunikation). Die Staatsbanken würden auch dezentrale Investitionen beobachten, aber nur dort intervenieren, wo es wahrscheinlich unnötig doppelte Investitionen durch verschiedene Betriebe des Privatsektors gäbe.
Die nationale Regierung würde natürlich die zentralen staatlichen Korporationen betreiben und die Marktregeln für die sozialisierten und privaten Unternehmungen erlassen – in Ausnahmefällen in diesem Sektor sogar einschreiten. Schließlich würde der Staat den Umweltschutz fördern, die Verkehrsplanung überschauen und wissenschaftliche Forschung sowie Regionalentwicklung subventionieren.
Planung beschränkte sich auf langfristige Empfehlungen für die Outputseite der sozialisierten Betriebe und auf das Steuersystem, das gebraucht wird, um Einkommen und Reichtum zwischen Akkumulation und Konsum zu verteilen.
Nove ist sich sehr im Klaren darüber, daß eine solche Rolle für das Zentrum den überwältigenden Teil der Ökonomie der Herrschaft des Marktes überläßt. Genossenschaftliche und private Geschäfte sollten bankrott gehen dürfen. In den sozialisierten Unternehmen hätte gleichfalls die Belegschaft „die Verantwortung für die Verwaltung zu übernehmen“ (und würde im Bankrottfall arbeitslos!) außer in Fällen, wo die Gesellschaft ein starkes und demokratisch ausgedrücktes Interesse hegt, einen besonderen Betrieb zu schützen.
Es gäbe wenige staatlich geregelte Preise für Infrastrukturdienste, aber die meisten wären Marktpreise. Profite sind für Nove nur problematisch, falls sie privat angeeignet werden, aber für die sozialisierten Firmen sind sie schlicht ein Signal für Wirtschaftlichkeit und Erfolg. Die allgemeine Profitrate für jeden Sektor beruht jedoch offensichtlich auf dem Lohnniveau, welches für Nove von politischen und nicht ökonomischen Erwägungen bestimmt werden sollte.
In diesem System gäbe es keine Ausbeutung, sagt Nove, weil die Macht, über Profite zu verfügen, hauptsächlich in gesellschaftlicher Hand bleibt (d. h. des Parlaments). Löhne sollten eng mit der Produktivität korreliert sein, aber gleichzeitig sollten legale Grenzen für Lohnunterschiede existieren. Für Nove ist ein Arbeitsmarkt unverzichtbar, weil nur Lohnunterschiede die Arbeitskraft zugunsten ihrer wirtschaftlichsten Ausnutzung kanalisieren können. Freiwillige Arbeitsverteilung überschätzt nicht nur den menschlichen Altruismus, sondern der einzelne Arbeiter hätte auch die unmöglich tragbare Verantwortung, zu wissen, wo der gesellschaftlich sinnvollste Arbeitsplatz für ihn oder sie zu finden ist.
Alle Erfahrungen mit der Selbstverwaltung zeigen, daß ein Mangel an Interesse für das langfristige Wohlergehen des Unternehmens entsteht, wo es kein Eigentumsverhältnis zwischen dem Geschäft und seiner Belegschaft gibt. Noves Lösung ist, daß es einen Unternehmensfonds geben sollte, der allen Angestellten gleichermaßen gehören sollte und gemäß der geschäftlichen Entwicklung zunimmt oder schrumpft. Jeder neue Arbeiter muß daraus einen Fondsanteil kaufen (zur Not auf Kredit), und jene, die aufhören, erhalten ihren gesunkenen oder gestiegenen Anteil je nach Sachlage.
Mittels dieses Mechanismus, glaubt Nove, werden die Arbeiter den nötigen Unternehmergeist entwickeln, um die Produktion im Falle steigender Marktpreise zu erhöhen (statt sie zu reduzieren, um aus zeitweilig gestiegenen Einkommen einen Vorteil zu ziehen), weil andernfalls ihr Unternehmen Marktanteile verlieren wird, die Einkommen sinken werden, falls die Preise fallen, und auf lange Frist das zu einer Abwertung des Geschäftsfonds führen wird. Um die erfolgreichsten Firmen daran zu hindern, eine Monopolposition zu erreichen und dadurch den Konkurrenzansporn zu liquidieren, schlägt Nove vor, daß Antitrustgesetze notwendig seien.
Laut Nove können Konjunkturzyklen abgewendet werden, die in vom Markt geregelten Wirtschaften unvermeidlich sind. Er denkt, daß Kreditpolitik, strategische Investitionen, Preiskontrollen im zentralisierten Staatssektor, Einkommenspolitik und das Steuerwesen die Hebel sind, die für die Ausschaltung des Konjunkturzyklus gebraucht werden können.
Nove glaubt, sein Sozialismusmodell sei das einzige, das in den nächsten 50 – 70 Jahren in einer Anzahl von Ländern realistischerweise wirksam greifen kann. In zukünftigen Jahrhunderten sei selbst eine vollständig ’sozialistische‘ Welt möglich, internationale Planwirtschaft aber nicht. Der Außenhandel wird für Nove immer auf Grundlage des Marktes funktionieren.
Nach der kurzen Zusammenfassung von Noves Hauptideen ist es klar, daß er Gesellschaftseigentum an den Hauptproduktionsmitteln und demokratische Kontrolle über strategische Investitionen sowie die Akkumulationsrate auf der einen mit Marktregulierung von Erzeugung und Verteilung auf der anderen Seite kombinieren möchte. Er denkt, das sei eine harmonische Kombination, und sieht nicht, daß innerhalb dieses Schemas ein scharfer Widerspruch haust. Zwei ökonomische Regelweisen werden in Bewegung gesetzt, die jeweils verschiedenen Klassen dienen. Diese Art Mischwirtschaft würde einen intensiven Klassenkampf gebären.
Das Konkurrenzprinzip würde ständig die politisch bestimmten Investitionsgrößen untergraben, weil das Überleben der meisten Geschäfte (und Arbeitsplätze) von ihrem Investitionsniveau abhinge. Die Konkurrenz würde auch die Lohnhöhen unterhöhlen, weil sie den Akkumulationstrieb unwiderstehlich machen würde, was folglich bedeutete, daß ihm die Arbeiterinteressen systematisch untergeordnet wären. In Noves Modell von ‚Sozialismus‘ entstände eine spontane Tendenz in Richtung offenen Privateigentums.
Ebenso würde der Geschäftsfonds zum Embryo des Privateigentums an den Produktionsmitteln. Die Manager würden argumentieren (v. a. in erfolgreichen Betrieben, die möglicherweise von ihren Arbeitern unterstützt werden), daß sie ihren Unternehmensfonds zu investieren wünschten, um das fixe Kapital ihrer Firma zu erweitern oder zu verbessern, und damit den Prozeß zu starten, Eigentumsrechte an ihr herauszubilden.
Andere Manager würden für das Recht kämpfen, ihren betrieblichen Fonds als Quelle für Außeninvestitionen oder als Leihkapital für andere Unternehmen einzusetzen. Wo Firmen nicht in der Lage wären, solche Leihsummen zurückzuzahlen, wäre die Umwandlung der Schulden in Anteilsscheine eine offensichtliche Option für das finanzierende Unternehmen. Diese würden sich politisch für diese Ziele organisieren, wahrscheinlich gemeinsam mit den kleinen Kapitalisten und Genossenschaften, die eine Aufhebung der Grenzen, die dem Umfang des privaten Kapitals auferlegt sind, verlangen würden. Mit anderen Worten, eine neue Bourgeoisie, die aus der Schicht der leitenden Angestellten aufstrebt, würde anfänglich für mehr Rechte, aber dann für ihre uneingeschränkte Klassenherrschaft kämpfen.
Auf der anderen Seite würden die Arbeiter der erfolglosen Unternehmen, die durch Niedriglöhne und Arbeitslosigkeit bedroht wären, staatliches Einschreiten fordern. Sie würden argumentieren, daß der Fehlschlag ihres Geschäfts nicht ihre Schuld sei, sondern vielmehr dem objektiven Wandel der Marktbedingungen zuzuschreiben sei (z. B. überlegene Konkurrenz seitens einer viel größeren Aktiengesellschaft, der mehr Investitionsmittel zugeteilt worden waren oder aus einem entwickelteren Land), der ihren Erfolg verunmöglichte.
Obwohl Nove glaubt, daß Staatsintervention Rezessionen verhindern könnte, würde das wirkliche Leben demonstrieren, daß die Marktdynamik stärker ist und geschäftliche Fehlschläge einfach Ergebnis sinkender allgemeiner Nachfrage sind. Warum sollten einige Arbeiter unter den Konsequenzen des ‚Systemfehlers‘ leiden und andere nicht? Natürlich würden sich diese Arbeiter auch politisch organisieren, um für eine Verallgemeinerung staatlichen Eigentums zu kämpfen und folgerichtig für durchgreifende zentrale Planung.
Ein weiterer Faktor würde zur Verschärfung des Klassenkampfes beitragen. Unter Marktvoraussetzungen wird in der Gesamtwirtschaft eine Durchschnittsprofitrate gebildet. Da die Profitrate den Profitanteil pro Einheit an vorgestrecktem Kapital darstellt, ist sie unabhängig vom besonderen Ausmaß an Arbeitszeit, das sich auf Einzelbetriebe erstreckt.
Das bedeutet, daß Unternehmen mit der gleichen Arbeiteranzahl völlig unterschiedliche Profitmassen ‚verdienen‘ können, abhängig vom Wertanteil des konstanten Kapitals der betreffenden Unternehmung. Wenn die Arbeiterverdienste oder das Ausmaß des Betriebsfonds auf irgendeine Art mit dem Unternehmensprofit gekoppelt ist, gibt es weit variierende Löhne und/oder Fondsanteile. Offensichtlich wären jene, die von einem solchen System auf die Gewinnerseite gestellt würden, geneigt, es politisch zu verteidigen, während jene, die daran verlören, in Opposition zu ihm ständen.
Das Konkurrenzprinzip würde andauernd die politisch festgelegten Investitionsniveaus unterhöhlen, weil das wirtschaftliche Überleben von Betrieben (und Arbeitern) von ihrem ‚eigenen‘ Investitionslevel abhinge. Die Konkurrenz würde deshalb auch die Lohnstandards untergraben. Aus einem solchen System heraus würde sicher keine Gleichheit entstehen.
Noves ‚Sozialismus‘ ist vom Konzept her unstabil, weil es eine Art Doppelmachtsituation darstellt. Der unvermeidbare politische Kampf zu Beginn einer solchen Doppelmacht müßte mit dem entscheidenden Sieg einer Seite über die andere enden. Entweder würde die Freiheit des Privateigentums restauriert und der Kapitalismus seine vollen Freiheiten wiedergewinnen oder die Arbeiter würden zu Herren über den Markt.
Ernest Mandel
Ernest Mandel umriß zuerst sein Konzept von Wirtschaft unter den Bedingungen des Übergangs zum Sozialismus in den frühen 1960er Jahren (Marxistische Wirtschaftstheorie), entwickelte es in den späten 1980er Jahren durch seine Kritik an den Ideen Alec Noves weiter.
Er begann seine Verteidigung der sozialistischen Planwirtschaft (New Left Review 159, Sept./Okt. 1986), indem er auf die „zunehmende objektive Vergesellschaftung der Arbeit“ im ‚Spätkapitalismus‘ verwies. Konzentration und Zentralisation der Produktion haben das Ausmaß an Arbeit, das vom Markt zugeteilt wird, drastisch verkleinert und den Anteil der direkt allozierten Arbeit gesteigert.
Ähnlich hat der Kapitalismus selbst beständig das Planelement in der Wirtschaft ausgedehnt. Nove hat nicht Recht, wenn er sagt, daß nur der Markt die Millionen von erzeugten Gütern verteilen kann und daß jeder geplante Versuch, das zu bewerkstelligen, unabänderlich unwirtschaftlich und bürokratisch wäre. In Wahrheit vergleichen und bewerten private Verbraucher niemals ‚Millionen Güter‘, sondern höchstens ein paar tausend während ihres ganzen Lebens.
Zweitens werden eine Menge an Zwischenprodukten auf Bestellung gefertigt und nicht auf Märkten erstanden. Drittens werden die meisten Produktionsmittel nicht für einen anonymen Markt hergestellt, sondern gemäß vorbestimmter Merkmale in Folge einer erfolgreichen Bewerbung auf eine Ausschreibung hin. Schließlich gibt die heutige Produktion ein lang feststehendes Verbrauchsmuster wider, das sich langsam und nur langfristig wandelt.
Mandel wies Noves Erkenntnis zurück, daß nur der Preismechanismus die relative Intensität verschiedener Bedürfnisse bestimmen könne. Mandels Bedürfnistheorie legt nahe, daß es unter ihnen eine objektive Hierarchie gibt: es gibt Grundbedürfnisse, zweitrangige und entlegene (oder Luxus-) Bedürfnisse. Zur ersten Gruppe zählen Grundnahrungsmittel, Kleidung, Wohnung, Ausbildung und Gesundheitsfürsorge, Verkehrswesen und Freizeit.
Die zweite Gruppe deckt einen engeren Rahmen an Lebensmitteln, Getränken, Bekleidung, Haushaltsgeräten, gehobeneren kulturellen und Erholungsdienstleistungen wie auch Privatautos ab. Alles andere ist Luxus. Die Nachfrage nach dem Grundbedarf ist verhältnismäßig stabil und steigt mit wachsendem Einkommen nicht an; im Gegenteil, sie neigt dazu, zu fallen. Mandel behauptete damit, Noves Annahme einer endlosen Bedürfniszunahme widerlegt zu haben. Vernünftiges Verbraucherverhalten würde einen vorgeblichen instinktiven Wunsch, das Konsumniveau dauernd zu erhöhen, ersetzen. Mandel zog daraus zwei gewichtigere Schlußfolgerungen.
Erstens, parallel zu steigender Produktivität, würde die Rolle des Gelds in der Gesellschaft geringer, da immer mehr Güter frei verteilt werden könnten, ohne die Nachfrage nach ihnen zu erhöhen. Geld ist nicht notwendig, um zwischen Bedürfnissen und ihrer Erfüllung zu vermitteln; per Marktforschung könnten Leute schlicht gefragt werden, was sie wünschten.
Zweitens würde die subjektive Basis für Warenproduktion und Geldzirkulation entfallen. Konkurrenz bliebe nur in der Sphäre der Luxusgüterproduktion bestehen und wäre weniger intensiv als heute. Eine gewisse ‚Bedürfnistyrannei‘ würde im Sozialismus weiter existieren, solange sekundäre und Grenzbedürfnisse nicht vollkommen zufriedengestellt werden konnten, aber eine solche ‚Tyrannei‘ wäre gerechtfertigter als die im Kapitalismus herrschende.
Mandel argumentierte, daß weder Kapitalismus noch bürokratische Planwirtschaft jemals hätten funktionieren können, wenn es nicht die von ihm so genannte ‚objektive informelle Kooperation‘ gegeben hätte. Verbraucher reagieren bei ihrer Kaufentscheidung nicht einfach nur auf Preissignale. Weder Kauflustige noch Firmen wechseln den Laden oder Vertragspartner jeweils einfach nur wegen kleiner Preisbewegungen.
Etablierte Muster an Zusammenarbeit sind ganz entscheidend. Gleichzeitig gibt es selbst im Kapitalismus Beispiele (z. B. Elektrizitätswerke in vielen Ländern), wo weder Produktion noch Verteilung durch Preise geregelt werden. Die Nachfrage ist in diesen Fällen stark vorhersagbar, die Erzeugung gründlich monopolisiert und Preise werden kalkuliert als Kostpreise plus vorherbestimmte Gewinnspannen. Die freie Verteilung unterm Sozialismus würde sogar im Vergleich zum Kapitalismus an Bürokratie einsparen. Hiermit legte Mandel dar, daß ein dritter Weg zwischen blindem Markt und einer riesigen Bürokratie möglich sei.
Mandel sprach auch die Frage an, ob seine Betonung auf ‚objektiv informeller Kooperation‘ nicht zur Einrichtung von Routine und Gewohnheit verführt und dadurch Kreativität und Neuerertum unterdrückt. Er war überzeugt, daß das Interesse der direkten Produzenten an der Erleichterung ihrer Arbeitslast und Verbesserung ihrer Umwelt genug wäre, um als Anreiz zu fungieren, Kosten zu senken und Unwirtschaftlichkeit im Zaum zu halten.
Die Leute würden wahrscheinlich eine kürzere Arbeitswoche haben und deshalb würden einige nicht nötige Güter nicht hergestellt, aber das würde kein Problem ausmachen. Sozialismus zeichnet sich nicht einfach durch Verbrauchsanstieg aus, sondern durch gehobene Zivilisation. Mandel hat auf die Tatsache hingewiesen, daß viele Erfindungen und Entdeckungen ohne kommerziellen Anreiz getätigt wurden.
Konkurrenz ist kein notwendiges Element von Neuerungen. Die tieferen Impulse für technischen Fortschritt und andere Novitäten stammen aus der natürlichen Neigung der direkten Produzenten, Arbeitszeit einzusparen, und aus menschlicher Neugier im Allgemeinen. Gleichheit ist keine Schranke für wirtschaftliche Effektivität. Mandel bezog sich in diesem Zusammenhang auf das Experiment der israelischen Kibbuze, wo die Arbeitsergiebigkeit höher als in der umgebenden Marktwirtschaft ist.
Mandel hat in seine Darstellung ein Modell eingeschlossen, wie er sich denkt, daß eine sozialistische Wirtschaft funktionieren könne. Jährliche nationale und internationale Kongresse der Arbeiterräte würden über die zentralsten Nöte der Gesellschaft entscheiden, über die Akkumulationsrate wie die Verteilung der Ressourcen zwischen verschiedenen Sektoren wie auch über die Länge der Arbeitswoche. Gleichzeitig würde die Skala der erhältlichen Ressourcen, die über den Markt verteilt werden sollen, festgelegt auf ’nicht lebensnotwendige Güter und Dienstleistungen‘.
Auf dieser Grundlage würde ein Generalplan entwickelt, der die notwendigen In- und Outputs aufeinander bezöge. Er enthielte jedoch keine besonderen Betonungen für einzelne Sektoren oder Regionen. Statt dessen würden die Selbstverwaltungskörperschaften jener Sektoren und Regionen (d. h. die entsprechenden Arbeiterräte) den Plan konkretisieren und spezielle Aufgaben an einzelne Wirtschaftseinheiten delegieren.
In Abteilung I (Produktionsgüter) wäre die Produktzusammensetzung hauptsächlich von früheren Entscheidungen abgeleitet. In Abteilung II (Verbrauchsgüter) würden die Produktlinien und der Produktionsumfang in Zusammenarbeit mit den zuständigen demokratisch gewählten Verbrauchergesellschaften festgelegt. Entscheidungen würden mithilfe von Modellen und Prototypen gefällt. Marktforschung könnte die Form annehmen, daß Verbraucher jene Erzeugnisse unter einer Palette an Alternativen ausfindig machen, die ihre Vorstellungen am besten treffen. Die Ergebnisse würden dann die Herstellung lenken. Natürlich gäbe es auch ein bißchen geplante Überproduktion, um Nachfrageschwankungen in den Ansatz einzubeziehen.
Die Fabrikarbeiterräte wären frei, über die Arbeitsmethoden entsprechend den Wünschen der Arbeiter zu entscheiden. Verbesserungen der Arbeitsproduktivität würden den Arbeitern unmittelbar nützen, solange die Qualitätsanforderungen der Verbraucherkontrollgremien erfüllt werden.
Mandels Modell nahm an, daß den Arbeitern gewisse Güter und Dienstleistungen gratis als ‚Soziallohn‘ garantiert werden. Individuelle Geldeinkommen über dieses Maß hinaus hingen von Qualitätskennziffern und Arbeitsbelastungskoeffizienten ab. Es gäbe kein Hindernis für akkurate Informationsflüsse z. B. über Produktqualität und -zuverlässigkeit, weil die selbstverwaltete Arbeiterklasse nichts von Fehlinformationen zu gewinnen hätte.
Mandel behauptete, ein solches System beinhalte einen mächtigen Mechanismus von Selbstkorrektur, weil die Entscheidungsträger (d. h. die Arbeiter) sofort die Konsequenzen falscher Entscheidungen spüren und deshalb schnell Schwächen und Fehler diagnostizieren und beseitigen würden.
Mandels Arbeit ist ein wichtiger Beitrag zur Sache der Planung und gegen Marktsozialismus. Er hat absolut Recht, zu sagen, daß die „zunehmende objektive Vergesellschaftung der Arbeit“ bedeutet, daß selbst im Kapitalismus immer größere Anteile der Wirtschaft nach gewissen Plänen organisiert sind. Selbst die neoliberale Privatisierungs- und Deregulierungspolitik der 1980er und 1990er Jahre konnte diesen historischen Trend nicht umkehren.
Obwohl die Staatsintervention in einigen Ländern zurückgedrängt worden ist, haben auf der ganzen Welt neue Wellen von Kapitalkonzentration stattgefunden und den Monopolisierungsgrad der kapitalistischen Ökonomie noch mehr erhöht. Die großen Wirtschaftsimperien der transnationalen Aktiengesellschaften funktionieren intern nicht nach Marktkriterien, trotz aller Neueinführungen von ‚Profitzentren‘ und ‚Auslagerungen‘ unprofitabler Komponenten. Mit strategischen Investitionen, Forschung und Entwicklung neuer Produkte gibt es noch ein zunehmendes Planelement in der ‚Politik‘ der großen Unternehmensgesellschaften.
Obwohl es gewisse Deregulierungen nationaler nichttarifärer Hemmnisse gab und in einigen Sektoren der weltweiten kapitalistischen Wirtschaft Marktmechanismen eingeführt wurden, ist dies alles nicht genug gewesen, um die Ansicht des Marxismus zu widerlegen, daß es eine langfristige Tendenz auf Monopolisierung und Marktmanipulation hin gibt.
Trotz der Ideologie des Neoliberalismus ist die Deregulierung in strikten Grenzen verblieben. Erstens, wenn einige nichttarifäre Hindernisse beiseite geräumt werden, entstehen andere. Der permanente Trend zum Handelskrieg zwischen den großen imperialistischen Blöcken ist eine Auswirkung davon. Zweitens gab es schon vor dem gegenwärtigen Zug in Richtung ‚Globalisierung‘ weltweite monopolistische Strukturen auf einigen Gebieten und dort konnte Konkurrenz offensichtlich nicht einfach per Dekret erzeugt werden.
Drittens, selbst wo Konkurrenz geschaffen worden ist, wird ihre unausweichliche Folge – wie immer – sein, daß erfolgreiche Gesellschaften erfolglose herausdrängen oder übernehmen werden. Was sich geändert hat, ist, daß das jetzt genau wegen der ‚Öffnung neuer Märkte‘ auf noch globalerer Stufenleiter stattfindet als in der Vergangenheit. Mandel befindet sich deshalb ganz im Recht, zu sagen, daß der geschichtliche Trend durch die Wiedergeburt des Neoliberalismus in den letzten 15 Jahren bestenfalls verlangsamt worden ist.
Gleichfalls stellt Mandel korrekt die vermeintlich zentrale Bedeutung von Marktpreisen für den einzelnen Verbraucher in Frage. In zahllosen Fällen würde sich die ‚objektiv informelle Zusammenarbeit‘ über Preissignale hinwegsetzen. Sowohl die zunehmende Vergesellschaftung der Arbeit wie auch informelle Kooperation sind bedeutende Ausgangspunkte für jede sozialistische Wirtschaft, die sich schon im Kapitalismus herausbilden. Sozialismus ist nicht nur eine Idee oder ein Bauplan, die in den Köpfen von Intellektuellen entstehen, sondern stützt sich auf objektive Trends innerhalb des Kapitalismus, die unter der Diktatur des Proletariats weiterentwickelt und verallgemeinert werden.
Schließlich stimmen wir Mandel zu, daß Gewinne und Löhne keineswegs die einzig vorstellbaren Anreize für ökonomische Effizienz und Innovation sind. Tatsächlich würde in einer sozialistischen Gesellschaft die ’soziale Dividende‘, d. h. anerkannter Fortschritt für die ganze Gesellschaft zur Hauptquelle für Wirtschaftsaktivitäten werden. In einer völlig klassenlosen Gesellschaft würde der Fortschritt fürs ganze zugleich Fortschritt fürs Individuum bedeuten. Erstmals seit dem primitiven Kommunismus gäbe es keinen Widerspruch zwischen beidem.
Nichtsdestoweniger würde das ein enorm hohes Bewußtseinsniveau voraussetzen, das alle individualistischen und partikularistischen Beschränkungen überwindet. Nove erhob gegen Mandel den Einwand, daß es für das Individuum selbst mit bestem Willen unmöglich zu sehen ist, was das ‚Allgemeingut‘ unter allen einzelnen Umständen sein könnte.
Dem Individuum mangelt es immer an Information oder Motivation. Auf dieses Argument entgegnete Mandel nur ungenügend. Für ihn ist es die organisierte Selbstverwaltung der Arbeiter, die die objektive Vergesellschaftung der Arbeit in subjektive verwandeln würde und somit ein Bewußtsein, das auf das Wohlergehen der ganzen Gesellschaft ausgerichtet ist, schüfe.
In Mandels Sozialismuskonzept würde der blinde Mechanismus des Wertgesetzes durch die organisierte Arbeiterselbstverwaltung ersetzt. Märkte, Geld und Preise würden nur in einem kleinen, untergeordneten Sektor überleben. Alle anderen Güter, besonders die zur Befriedigung grundlegender und zweitrangiger Bedürfnisse würden umsonst abgegeben. Die Frage, wieviel von was hergestellt werden soll, würde von der Forschung beantwortet und davon würden Investitionsschemata abgeleitet.
Das ist unangemessen, weil es die Tatsache ignoriert, daß sozialistische Planung einen quantitativen Standard braucht, mit dem die Produktivität von Technologien und Typen der Arbeitsorganisation gemessen, Proportionen berechnet und mögliche Verbrauchsniveaus bestimmt werden müssen. Sozialistische Akkumulation wird noch gewissen ökonomischen Gesetzen entsprechen müssen, z. B. dem Gesetz der Optimumproportionalität.
Mandel akzeptiert, daß Geld und Preise eine Rolle in der Übergangsgesellschaft spielen, aber er scheint vorzugreifen, daß sie im Sozialismus einfach von ‚Gebrauchswerten‘ ersetzt würden. Jeder rationelle Plan muß jedoch konkrete Gebrauchswerte auf den zu ihrer Erzeugung notwendigen Arbeitsaufwand beziehen. Schließlich sollte menschliche Arbeit so schonend wie möglich genutzt werden und das bringt das Bedürfnis mit sich, die Arbeitszeit zu verkürzen. Um die Entwicklung in diese Richtung leiten zu können, können Geld und Preise sich nicht einfach ins Nichts auflösen.
Obwohl wahr ist, daß die Funktion von Geld für einzelne Erwerbszwecke abnehmen wird, weil die sozialistische Gesellschaft die Sphäre sozialer Vorsorge ausdehnt, wird es noch ein Bestreben geben, Arbeitszeit als quantitativen und abstrakten (d. h. statistischen) Spiegel des konkreten Produktionsprozesses zu kalkulieren. Diese Wiedergabe wird einzelnen Arbeitern nicht nur erlauben, ihren eigenen Beitrag innerhalb des übergreifenden Zusammenhangs zu sehen, sondern sie ist die Vorbedingung, damit demokratische Arbeiterkongresse vernünftig über Proportionen, Vorrangigkeiten und Aussichten entscheiden können.
Im Widerspruch zum Kapitalismus gäbe es keinen Gegensatz zwischen abstrakter und konkreter Arbeit. Darum wäre die Arbeitszeitrechnung nicht das Wertgesetz in anderer Form; sie erhöbe weder die Surplusproduktion noch Arbeitszeitverkürzung zu einem abstrakten, übergeordneten und automatischen Prinzip. Im Gegenteil, die lebendige Arbeit würde innerhalb des Wirtschaftsablaufs souverän werden und Arbeitszeitrechnung wäre das Instrument, mit dem die Arbeiter befähigt würden, ihre Ökonomie in Einklang mit den Gesetzen der sozialistischen Akkumulation vorwärtszutreiben.
Jede ausgesuchte Priorität hat Konsequenzen in anderen Bereichen und diese Wirkungen können nur durch Kalkulation der erforderlichen Arbeitszeit, um die vorrangigen Ziele zu erreichen, abgeschätzt werden. Durch Arbeitszeitrechnung und Bestimmung von Schwerpunkten für den Gebrauch der verfügbaren Arbeitszeit wird die sozialistische Gesellschaft in die Lage versetzt, zu den Zielen von Ausgewogenheit und Gleichheit zu gelangen.
Letztlich wird die Arbeitszeit auch eine Rolle bei der Verteilung nebensächlicher Güter spielen. Unterhalb des kommunistischen Überflusses hat die (niedrigere) sozialistische Epoche die Aufgabe, die gesamte Welt auf vergleichbare Entwicklungsniveaus und Lebensstandards zu hieven. Dies setzt eine enorme Produktivitätssteigerung voraus, die nur über einen merklich langen Zeitraum erreicht werden kann. Solange das Güterangebot für ’sekundäre Zwecke‘ hinter der Nachfrage zurückbleibt und bis zu dem Ausmaß, das die Gesellschaft für das Zulassen ‚freier Verbraucherauswahl‘ möchte, gibt es einen Bedarf an ‚Arbeitszeitcoupons‘, um den Zugang zu diesen Gütern zu regeln.
Zusammenfassend schlußfolgern wir, daß Mandel wie viele andere bedeutende Zentristen vor ihm einen positiven Beitrag zur Debatte über die politische Ökonomie des Sozialismus leistete. Dies trifft besonders auf seine Hervorhebung der objektiven Tendenzen innerhalb des Kapitalismus zu, die gleichzeitig den Weg für dessen Abgang bahnen wie die Voraussetzungen der zukünftigen Gesellschaft legen.
Gleichzeitig vereinfachte Mandel die Probleme der sozialistischen Wirtschaftsorganisation und gab somit das sozialistische Projekt für bürgerliche Kritik frei. Er versäumte, sich von utopischen Sozialismuskonzeptionen wie der einer ‚Gebrauchswertökonomie‘ – oder wie Varga es 1919 formulierte – „einem System von Naturalwirtschaft“ abzugrenzen.
Mit dem berechtigten Streich sowohl gegen den neoklassischen Angriff auf den Sozialismus wie die marktsozialistische Kapitulation vor ihm kippte Mandel das Kind mit dem Bade aus. Während er Recht hatte, die ewigen Rollen für Wert, Preis und Geld abzustreiten, ignorierte er fälschlich die Notwendigkeit quantitativer Standards für den sozialistischen Plan. Er erklärte nicht, wie der Widerspruch zwischen abstrakter und konkreter Arbeit unterm Kapitalismus in eine korrespondierende Beziehung zwischen ihnen im Sozialismus transformiert werden sollte. So bliebt Mandels Erwiderung auf die Marktsozialisten unvollständig.
Der Übergang zum Sozialismus
Für Adam Smith war Arbeit „Adam’s Fluch“. Die klassische Ökonomie setzt Glück und Freiheit damit gleich, vom Zwang zum Arbeiten frei zu sein. Die Vorstellung, daß die Arbeit eine befreiende Tätigkeit und nicht, wie es unter kapitalistischen Verhältnissen für die meisten Leute der Fall ist, eine von außen auferlegte Notwendigkeit sein könnte, war für die bürgerliche politische Ökonomie ein Unding. Nicht so für Marx:
„Als Bildnerin von Gebrauchswerten, als nützliche Arbeit, ist die Arbeit daher eine von allen Gesellschaftsformen unabhängige Existenzbedingung des Menschen, ewige Naturnotwendigkeit, um den Stoffwechsel zwischen Mensch und Natur, also das menschliche Leben zu vermitteln.“ (Kapital, Bd. 1, S. 57)
Die Arbeit, die zweckbestimmte Umwandlung der Natur stellt das Wesen der Menschheit dar. Als solche kann sie durch die Aufhebung der kapitalistischen Produktionsweise grundlegend transformiert, aber nicht vermieden oder abgeschafft werden – ein unmögliches und utopisches Unterfangen.
Die sozialistische Revolution bedeutet den Übergang der politischen Macht in die halb-staatlichen Institutionen des Proletariats (Räte, Arbeitermiliz) und die zeitgleiche Durchführung grundlegender ökonomischer Maßnahmen. Es ist dabei nicht wahrscheinlich, daß ein neu geschaffener Arbeiterstaat sofort alle Privateigner von Produktionsmitteln expropriieren wird. Ein Arbeiterstaat wird jedoch mit der Enteignung der großen Banken, der Kreditinstitute, der Fabriken und Handelsorganisationen beginnen.
Gleichzeitig wird der Staat damit beginnen, eine Wirtschaftsverwaltung und Planungsmechanismen zu schaffen, deren Wirkungsbereich nach und nach ausgedehnt werden. Die Zeit, in der die große Masse der Produktionsmittel nationalisiert werden wird, wird vom Entwicklungsstand des Landes abhängen. In diesem Prozeß wird die Ausbeutung einer Klasse mehr und mehr beseitigt und die private Aneignung von Mehrarbeit abgeschafft.
Vom Beginn dieses Übergangs an wird die große Masse des Mehrprodukts der Gesellschaft, das heißt der demokratischen Assoziation der Produzenten, gehören. Daher wird die Entfremdung des Arbeiters vom Produkt seiner Arbeit verschwinden. Die Arbeit wird nicht mehr durch den Tausch auf einem anonymen Markt gesellschaftlich, d.h. hinter dem Rücken der Produzenten, sondern in unmittelbarer und direkter Form und selbst Gegenstand demokratischer Diskussion und Debatte.
Gleichzeitig werden die Arbeiter aufhören, vom Arbeitsprozeß entfremdet zu sein. Sie werden nicht mehr das Objekt der Ausbeutung und Unterdrückung am Arbeitsplatz sein, der Despotie des Kapitals und seiner Agenten. Die Maschinerie wird nicht mehr dem Arbeiter das Tempo vorschreiben, sondern umgekehrt. Gleichzeitig werden die Produzenten nicht mehr auf eine bestimmte Art der Tätigkeit für ihr ganzes Leben beschränkt sein. Der Zugang zu Ausbildung und Erziehung wird nicht mehr von der Klassenherkunft- und zugehörigkeit geprängt sein. Eine solche Ausbildung wird die Entwicklung vielfältiger Fähigkeit ermöglichen, die jeden Menschen in die Lage versetzen, während seines oder ihres Lebens verschiedene Tätigkeiten auszuüben.
Eine solche Gesellschaft, die sich zum Sozialismus entwickelt, wird sicherstellen, daß die Möglichkeiten jeder Person im größtmöglichen Ausmaß geweckt und entwickelt werden – frei von der Unterdrückung , die sich heute aus der Geschlechtszugehörigkeit, der Klassenherkunft, der Ethnie oder der sexuellen Orientierung ergibt. Nervtötende, langwierige und monotone Arbeit wird, so weit möglich, automatisiert werden, die Teilung zwischen Hand- und Kopfarbeit und ihre Verfestigung in bestimmten Berufen Schritt für Schritt überwunden werden. Schließlich wird die Teilung zwischen Arbeit und Freizeit selbst mehr und mehr aufgehoben. All diese Überlegungen und Zielvorstellungen bestimmten die marxistische Vorstellung vom Sozialismus bzw. vom Übergang zu dieser Gesellschaftsformation: Aufhebung der Entfremdung und des Warenfetischismus, die Schaffung der Möglichkeit wirklicher Freiheit mit dem Ende der Vorgeschichte der Menschheit.
Auch wenn Marxisten die Notwendigkeit des Sozialismus nicht einfach mit dem Verweis auf seine größere ökonomische Effektivität (im Vergleich mit dem Kapitalismus) begründen, so ändert das nichts daran, daß Sozialismus eine bestimmte Produktionsweise ist. Jeder Schüler, der zum ersten Mal von wirtschaftlichen Problemen hört, wird schnell mit „dem“ ökonomischen Problem konfrontiert werden, dem sich bisher jede Gesellschaft stellen mußte: Wie kann eine scheinbar grenzenlose Masse von Bedürfnissen mit, in Relation dazu begrenzten Ressourcen befriedigt werden?
Die Produktion und Konsumtion dieser Güter fand bislang im Rahmen einer Reihe von Klassengesellschaften statt. Jede Produktionsweise (asiatische, antike, feudale und kapitalistische) hat in der Regel zu einer Steigerung der Produktivität der Arbeit im Rahmen antagonistischer und widersprüchlicher Produktionsverhältnisse geführt. Der Sozialismus wird die erste progressive, nicht-klassenantagonistische Produktionsweise sein und dadurch in der Lage sein, die Produktivität der menschlichen Arbeit enorm zu steigern.
Nichtsdestotrotz wird oben genanntes „ökonomisches Problem“ in den ersten Phasen des Übergangs fortbestehen. Was soll angesichts eines bestimmten Mangels produziert werden? Unter welchen Bedingungen und in welchen Proportionen? Wie werden Produktion und Konsumtion ins Gleichgewicht gebracht? Demokratie und Macht allein reichen nicht aus, um auf ökonomischer Ebene zum Sozialismus fortzuschreiten.
Wirtschaftliche Ziele und Regulation
Nachdem Freiheit die Einsicht in die Notwendigkeit ist, wird auch das Wirtschaftsleben in der Phase des Übergangs zum Sozialismus durch die bewußte Anwendung einer Reihe von Entwicklungsgesetzen bestimmt werden, die Produktion und Konsumtion regulieren, die Gleichgewicht und Expansion der Ökonomie sichern. Daher weisen wir die Vorstellung Bucharins zurück, daß es keine politische Ökonomie des Übergangs, sondern nur eine Art „Sozialtechnik“ gebe. Wir lehnen uns vielmehr an die weiter gefaßte Definition der „politischen Ökonomie“ an, die Engels gibt:
„Die politische Ökonomie, im weitesten Sinn, ist die Wissenschaft von den Gesetzen, welche die Produktion und den Austausch des materiellen Lebensunterhaltes in der menschlichen Gesellschaft beherrschen.“ (MEW, Bd. 20, S. 136)
Heißt das, daß das Wertgesetz auf die eine oder andere Art weiter den Übergang zum Sozialismus reguliert oder daß es „transparent“ und „transformiert“ wird, sobald die Produktionsmittel nicht mehr in der Hand von Privateigentümern sind (wie Stalin argumentierte)? Nein, keines von beiden!
Für Marx und Engels war das Wertgesetz eine ökonomische Kategorie, die „die ausgedehnteste Unterordnung der Produzenten unter ihre Produkte ausdrückt“. Im Sozialismus können sich die Beziehungen zwischen den Individuen, die gemeinschaftlich arbeiten, nicht in der Form des „Werts“ der „Sachen“ ausdrücken, also auch nicht von einer Art „Wertgesetz“ bestimmt werden. Sobald die Arbeitskraft aufhört, eine Ware zu sein, kann auch kein „Ding“, das von dieser Arbeit produziert wird, dem Wertgesetz untergeordnet sein.
Wir leugnen damit keineswegs, daß das Wertgesetz in der Übergangsphase zum Sozialismus als untergeordneter und in seiner Bedeutung geringer werdender Regulator existiert. Solange Warenproduktion und -tausch existieren, wird das Wertgesetz existieren. In industriell rückständigen Ländern mit einem hohen Anteil an privater agrarischer Produktion und Austausch wird die Diktatur des Proletariats die Akkumulation in der Industrie zum Teil durch die Manipulation des Wertgesetzes im Privatsektor voranzutreiben versuchen. Das war die Grundlage des Gesetzes der ursprünglichen sozialistischen Akkumulation, das von Preobrazenskij in den 1920er Jahren in der UdSSR entwickelt wurde. Es wird auch weiter dort zur Anwendung kommen, wo die technische oder politische Basis für die freiwillige Kollektivierung der Landwirtschaft fehlt.
Diese Situation wird wahrscheinlich in keinem OECD-Land eintreten. Dort ist es unwahrscheinlich, daß es (außer der Bereitstellung von persönlichen Diensten, bei der keine Lohnarbeiter beschäftigt wird) ein signifikantes Ausmaß an Warenproduktion geben wird. Aber zumindest die ersten Phasen des Übergangs zum Sozialismus werden per definitionem einen mehr oder weniger systematischen Austausch von Gütern und Diensten zwischen Arbeiterstaaten und kapitalistischen Ländern mit sich bringen.
Daher wird das Wertgesetz, unter dessen Herrschaft die Waren in den kapitalistischen Ländern produziert werden, auf verschiedene Weise auch die Arbeiterstaaten tangieren. Erstens wird es die Entscheidung beeinflussen, ob Ressourcen auf die Produktion bisher importierter Güter verwendet werden sollen oder ob diese weiter eingeführt werden.
Zweitens wird ein Arbeiterstaat, sobald er mit kapitalistischen Unternehmen konkurriert, um Exporteinkünfte zu erzielen, durch eben diese Konkurrenz gezwungen sein, die Produktivität der Produktion auf Weltmarktniveau zu halten oder zu heben. Dieser Schritt ist gerade heute, angesichts des hohen Grades der Internationalisierung des modernen Kapitalismus, notwendig. Die Konsequenzen eines totalen Rückzugs vom internationalen Handel wären für jedes Industrieland, in dem die Herrschaft des Kapitals gebrochen ist, katastrophal.
Drittens kann es für eine bestimmte Periode notwendig sein, ausländischen Unternehmen Konzessionen zur Ausbeutung von Arbeitskraft im Austausch für einen Teil der Profite zu machen, um eine Unterauslastung ökonomischer Ressourcen zu vermeiden. Das Wertgesetz wird erst im Sozialismus aufhören, irgendeine Rolle zu spielen.
Unter Sozialismus verstehen wir ein weltweites System der Produktion, das von einem einzigen, wenn auch dezentral strukturierten, ökonomischen Mechanismus organisiert wird. Bis zu diesem Zeitpunkt können einzelne Arbeiterstaaten nur versuchen, das Wertgesetz zur sozialistischen Akkumulation zu nutzen und zu manipulieren.
Die Rolle des Geldes beim Übergang zum Sozialismus
Im Kapitalismus sind die Preise Erscheinungsformen des Werts der Waren, d.h. des Quantums der gesellschaftlich notwendigen Arbeit, die sie beinhalten. Obwohl der Wert jeder individuellen Ware sowohl dem Kapitalisten als auch dem Arbeiter unbekannt ist, da die Produktion selbst von den Wünschen und Bedürfnissen der Gesellschaft getrennt ist, werden am Markt die in den Waren verkörperten Werte, wenn auch indirekt, verglichen. Der Tauschwert ist keine natürliche Eigenschaft, sondern ein gesellschaftliches Verhältnis. Die Tatsache, daß die Warenproduzenten nicht wissen können, wieviel gesellschaftlich notwendige Arbeit in ihnen vergegenständlicht ist, resultiert selbst aus dem privaten Charakter der Aneignung der Produktion. Der Wert kann nur annähernd über den Marktpreis aufscheinen.
Marx zeigt in Band 1 und 3 des Kapitals außerdem, daß der Marktpreis nicht nur vom Wert abweichen kann, sondern sogar muß. Abgesehen von Verzerrungen des Marktes und der Oszillation der Preise muß dieses Phänomen als Resultat einer die ganze Gesellschaft durchziehenden Ausgleichsbewegung der Profitraten eintreten. Aufgrund sehr unterschiedlicher organischer Zusammensetzungen der Kapitale, wie sie in allen entwickelten Industrieländern existieren, produzieren verschiedene Unternehmen und verschiedene Branchen spontan mit unterschiedlichen Profitraten.
Millionen von Tauschakten bringen sie der Tendenz nach zur Ausgleichung und transformieren damit die Warenwerte zu Produktionspreisen. Die Marktmechanismen führen dann dazu, daß die Marktpreise um die Produktionspreise, nicht um die Warenwerte oszillieren. Das findet im Kapitalismus systematisch statt und ist eine wichtiger Grund, warum die kapitalistische Produktionsweise einer Preiseinheit bedarf, die formell vom Wert komplett unabhängig ist.
Das Geldsystem ist daher nicht nur historisch an den Kapitalismus gebunden, sondern auch eng mit der Herrschaft der toten über die lebendige Arbeit verbunden. Es reflektiert nicht nur die Unsichtbarkeit des Wertes, sondern verfügt auch über die nötige Flexibilität, um die systematische Abweichung der Preise von den Werten zu reflektieren. Die Ausgleichung der Profitraten stellt sicher, daß die Kapitale mit höherer organischer Zusammensetzung einen Extra-Mehrwert über dem Mehrwert, den „ihre“ eigenen Arbeitskräfte schaffen, realisieren. Das ist eine andere Ausdrucksform der Diktatur des Kapitals über die Arbeit, bei der das Geld als das Schmieröl der kapitalistischen Maschinerie fungiert.
In der Übergangsökonomie eines Arbeiterstaates führt die Abschaffung des Privateigentums an den Produktionsmitteln sofort zu wichtigen Veränderungen der Rolle von Geld und Preisen. Aber beide sind noch weit davon entfernt, „abgeschafft“ zu sein. Im Gegenteil. Diese vom Kapitalismus geerbten Instrumente müssen in der Übergangsperiode so lange verwendet werden, wie Warenproduktion und Austausch existieren, sei es innerhalb des Arbeiterstaats oder mit kapitalistischen Ländern. Der Markt und das Geld sind in der ersten Phase der Diktatur des Proletariats die einzigen Methoden zur Bemessung von Ressourcen und verbleiben daher in dieser Phase die Basis der wirtschaftlichen Kalkulation.
Die Planung wird mit bestimmten zentralen Projekten beginnen und in der Folge in immer mehr Branchen verallgemeinert werden. Im Frühstadium werden sich daher die Planungsergebnisse mit den Standards des Marktes messen.
„Zwei Hebel müssen der Regulierung und Anpassung der Pläne dienen: ein politischer – die reale Beteiligung der interessierten Massen selbst an der Leitung, die ohne Sowjetdemokratie undenkbar ist – und ein finanzieller – die reale Prüfung der apriorischen Berechnungen mit Hilfe eines allgemeinen Äquivalents, was ohne stabiles Geldsystem undenkbar ist.“ (Trotzki, Verratene Revolution, in: Trotzki, Schriften, 1.2., S. 761)“
Daher wird ein Arbeiterstaat in der ersten Phase der Entwicklung der Planung Geld als Wertmaßstab verwenden. Das Wertgesetz wird in den Sektoren dominieren, die nicht von der Planung erfaßt sind, und es wird in der gesamten Ökonomie eine wichtige, wenn auch beschränkte und kontrollierte, Rolle spielen.
Dennoch wird es schon von Beginn an Veränderungen der Funktion des Geldes geben. Im Kapitalismus stellen die Marktpreise einen Indikator dafür dar, in welchem Verhältnis verschiedene Güter am Markt ausgetauscht werden. Das stellt eine sehr eingeschränkte Information dar. Beim Übergang zum Sozialismus müssen daher Preise konstruiert werden, die die Kosten alternativer Formen der Nutzung der gesellschaftlichen Arbeit ausdrücken. Ohne diese wäre es unmöglich, Produktivitätsfortschritte zu messen oder über alternative Investitionsmöglichkeiten rational zu urteilen.
Private Warenproduzenten sind an einer Reihe „externer“ (d.h. gesellschaftlicher) Kosten nicht interessiert. Ebensowenig interessiert sie normalerweise der langfristige Effekt ihrer Entscheidungen. Wirkliche „Kostpreise“ in der Übergangsgesellschaft können die verschiedenen gesellschaftlichen Kosten, die über den Rahmen der einzelnen Firma hinausgehen, einbeziehen. Während die durchschnittlichen Kostpreise in der technisch fortgeschrittenen kapitalistischen Welt einen Vergleichsmaßstab für die Kostpreise in der Übergangsgesellschaft geben sollten, so werden nach-kapitalistische Gesellschaften Kostpreise für Güter und Dienstleistungen konstruieren müssen, die die kurz- und langfristigen Kosten dieser „externen Faktoren“ (z.B. Zerstörung der Umwelt, Kosten von Importproduktion) mitreflektieren.
Mit Hilfe von simultanen Gleichungen werden Preise entwickelt werden, die eine Reihe von Variablen aufgreifen können (wie veränderte Investitionsraten in verschiedenen Sektoren über einen bestimmten Zeitraum), die kapitalistische Marktpreise nicht widerspiegeln können.
Ein solches System wird sich nicht nur von Geldpreisen im Kapitalismus unterscheiden, sondern auch von der Verwendung der Preise in der bürokratischen Planwirtschaft. Versuche, künstliche, ja willkürliche Preise zu schaffen (z.B. der Brotpreis in vielen bürokratischen Planwirtschaften), um die Nachfrage zu stimulieren, sollten unterlassen werden. Diese Methode hat nicht nur den Nachteil, daß die Preise die wirklichen Kosten der Gesellschaft nicht reflektieren, sondern sie fördert auch die Verschwendung (z.B. indem „billiges“ Brot an Schweine verfüttert wird). Auch wenn ein Arbeiterstaat in seinen ersten Entwicklungsphasen die Nachfrage nach bestimmten Konsumgütern und Dienstleistungen durch steuerliche Maßnahmen und durch Subventionen beinflussen wird, wird es noch immer notwendig sein, die wirklichen Arbeitskosten (d.h. die Arbeitzeit) in bestimmten Gütern und Dienstleistungen genau zu messen. Natürlich werden auch solche Unterstützungsleistungen überflüssig werden, je mehr eine egalitäre Einkommensverteilung realisiert ist.
Als Tauschmittel wird die Bedeutung des Geldes beim Übergang zum Sozialismus mehr und mehr verschwinden. (Geld wird jedoch seine Funktion als Tauschmittel im internationalen Handel mit kapitalistischen Ländern in der Übergangsperiode beibehalten, was die Existenz eines international anerkannten Geldes notwendig macht.) Das heißt erstens, daß viele Produkte von der Gesellschaft als notwendige Güter anerkannt werden, die zu erhalten ein Recht aller Gesellschaftsmitglieder ist und die direkt aus dem Mehrprodukt gezahlt werden (z.B. ein bestimmtes Mindestniveau an Wohnraum, Kleidung und Nahrungsmitteln). Es gibt keinen Grund, daß dieser Güter nicht direkt an die Konsumenten verteilt werden. Sie müssen weder gekauft noch verkauft werden und Geld ist für diese Transaktion nicht notwendig.
In der kapitalistischen Gesellschaft konsumieren die meisten Menschen nur einige tausend verschiedene Waren während ihres ganzen Lebens. Mit der Zeit werden mehr und mehr von diesen Gütern automatisch verteilt. Mit der Steigerung der Arbeitsproduktivität werden die Preise dieser Produkte gegen Null gehen. Sie werden so billig werden, daß es sich nicht mehr lohnt, ihren Preis zu kassieren, und daher zu einer Ausdehnung der nicht-monetären Sphäre führen. Auf dem Weg zum Kommunismus wird die Rolle des Geldes (als unabhängiger physischer Ausdruck verschiedener Mengen gesellschaftlicher Arbeit) verschwinden und durch reine Rechnungseinheiten wie z.B. Einheiten für die gesellschaftliche Arbeit ersetzt werden.
In den späteren Phasen des Übergangs zum Sozialismus, die wahrscheinlich in den hoch industrialisierten Ländern früher als in den rückständigen erreicht wird, werden auch neue „sozialistische“ Methoden der Kalkulation entstehen. Wir müssen uns dabei vor Augen halten, daß im planwirtschaftichen („sozialistischen“) Sektor die Kategorie des Wertes in dem Maß ihre Bedeutung verlieren wird, in dem der Plan tatsächlich zur Verteilung der Arbeitskraft nach gesellschaftlichen Bedürfnissen führt. Der „Wert“ (d.h. abstrakte Arbeit) als etwas von der Menge der konkreten Arbeit, die auf ein bestimmtes Produkt verwandt wird, geschiedenes wird im Ausmaß verschwinden, in dem die Arbeit direkt gesellschaftlich wird.
Daher besteht die Aufgabe auch nicht darin, solche Geldpreise zu konstruieren, die den Wert möglichst extakt, d.h. genauer als der Marktmechanismus, wiedergeben. In dem Ausmaß, in dem der Markt durch die Planung zurückgedrängt wird, kann er auch nicht mehr die Rolle eines Korrektivs spielen. Daher würden am Wert orientierte Geldpreise mehr und mehr verzerrend wirken. Daher muß eine andere Methode der wirtschaftlichen Messung etabliert werden.
Innerhalb des planwirtschaftlichen Sektors der Ökonomie eines Arbeitstaates ist kein Mechanismus notwendig, der zu einer Ausgleichung von Profitraten und zur Entstehung von Produktionspreisen führt. Es wird keinen automatischen Mechanismus geben, der produktiveren Unternehmen eine zusätzliche Premierung in Form von Extra-Profiten gibt. Entscheidungen darüber, wo investiert, welche Produktion ausgeweitet und welche eingeschränkt werden soll, werden die Arbeiterräte auf der Basis sozialer und ökologischer Erwägungen sowie der Kenntnis der vorhandenen gesellschaftlichen Arbeit fällen.
Natürlich existiert auch dann eine Differenz zwischen der Menge konkreter Arbeit, die zur Produktion eines bestimmten Produktes im allgemeinen, d.h. im Durchschnitt, notwendig ist, und der Menge, die dazu an einer bestimmten Produktionsstätte aufgewandt werden muß. Erstere Information ist für jede nationale oder globale Planung notwendig, während letztere die Basis für die individuelle Konsumtion darstellt. Es ist daher sinnvoll, zwischen dem individuellen und dem gesellschaftlichen „Arbeitswert“ jeder Produktion zu unterscheiden. „Arbeitswert“ hat in diesem Zusammenhang nichts mit dem Wert in der Warenproduktion zu tun. Er ist vielmehr mit der konkreten Arbeitszeit identisch und daher ex ante bekannt.
Arbeitscoupons werden das Geld auch dort mehr und mehr ersetzen, wo der Tausch zwischen Löhnen und Konsumgütern noch immer stattfindet. Solche Coupons, d.h. Zertifikate über das geleistete Quantum an Arbeitsstunden nach Abzug der Kosten für gesellschaftliche Leistungen, werden für alle jene Produkte und Dienstleistungen nicht notwendig sein, auf die alle Gesellschaftsmitglieder automatisch Anspruch haben. Hier kommt es nur darauf an, über die Gesamtmasse und einzelne Güter, den Fluß von Produkten aus Departement I nach II bis hin zum Konsum dieser Produkte Buch zu führen.
Die Arbeitscoupons werden den Arbeitern im Gegenzug zur Arbeit, die sie verausgabt haben, gegeben und stellen ein bestimmtes Quantum Arbeitszeit dar. Die Coupons können gegen Güter getauscht werden, die dasselbe Quantum Arbeitszeit verkörpern. In diesem Fall ist der Coupon eine rein passive Repräsentation derselben Menge gesellschaftlich notwendiger Arbeit, wenn auch in verschiedener Form.
Der Coupon kann allerdings unter bestimmten Bedingungen auch als Geld fungieren, nämlich dann, wenn sich der vorausgeplante „Wert“ eines Produkts als falsch erweist. Wenn z.B. der geplante „Wert“ zwei Stunden gesellschaftlich notwendiger Arbeiter wäre, die Arbeiter jedoch wegen zu geringen Angebots bereit wären, dafür Coupons im Wert von drei Stunden zu bezahlen, so würde auf diese Weise ein Fehler in der Planung (zu wenig Ressourcen, dh. gesellschaftlich notwendige Arbeit auf die Produktion eines bestimmten Gutes verwendet zu haben) aufgezeigt werden. Dieser übrig gebliebene Marktmechanismus würde, in den Worten Trotzkis, dazu dienen, den „Plan zu verifizieren“. In diesem Fall wäre der Tauschakt nicht bloß passiv, sondern würde post festum die Menge gesellschaftlich notwendiger Arbeit determinieren, die in diesem Produkt vergegenständlicht ist. Klarerweise wäre ein solcher Fall ein Zeichen dafür, daß der Plan korregiert, d.h. das Angebot für diese Produkte erhöht werden müßte.
Regulation durch Arbeitszeit
Der Aufbau einer Planwirtschaft schließt notwendigerweise die bewußte Allokation von Ressourcen ein, um bestimmte Ziele zu erreichen. Obwohl die Kalkulation auf Basis der Arbeitszeit das Mittel und das Maß zu dieser Allokation bereitstellt, so reguliert sie nicht selbst das Funktionieren der Ökonomie in der Weise, wie das Wertgesetz im Kapitalismus. Die wirtschaftliche Regulation folgt statt dessen aus den Entscheidungen im politischen System des Arbeiterstaates.
Ziel der gesellschaftlichen Produktion muß es sein, die Arbeitsproduktivität mit der Zeit zu steigern, indem alle Produktionsfaktoren optimal (nicht notwendigerweise maximal) genutzt werden. Unter einem optimalen Niveau des outputs verstehen wir hier ein solches, das mit anderen Zielen wie Verkürzung der Arbeitszeit, Ausdehnung der Zeit für Erziehung und Erholung ebenso vereinbar ist wie mit einer rationalen Nutzung nicht erneuerbarer Rohmaterialien und der Reproduktion erneuerbarer Ressourcen.
Ohne eine immer größere Ausdehnung der frei disponiblen Zeit jedes Gesellschaftsmitglieds wird es für die Arbeiter und Arbeiterinnen unmöglich sein, sich als Individuen frei und allseitig zu entfalten. Bildung und Ausübung einer Vielzahl von Tätigkeiten werden eine notwendige Voraussetzungen für die aktive Teilnahme an einem enorm ausgedehnten Entscheidungsprozeß sein, der ein Merkmal der Übergangsperiode darstellt. Es erfordert Zeit und Studium, gemeinschaftlich das eigene Leben am Arbeitsplatz und in der örtlichen Gemeinde zu kontrollieren und zu bestimmen sowie am vielschichtigen wirtschaftlichen und politischen Entscheidungsprozeß teilzunehmen.
Daraus folgt, daß die Gesellschaft wahrscheinlich versuchen wird, Produktivitätsverbesserungen auf jene Industrien zu konzentrieren, die der Herstellung von Konsumgütern dienen, um die notwendige Arbeitszeit zur Reproduktion der Arbeitskräfte zu reduzieren. Das Ziel dieser Reduktion ist jedoch nicht, wie im Kapitalismus, die Maximierung der Mehrarbeitszeit. Es ist vielmehr die Ausweitung der disponiblen Zeit. Mit anderen Wort: Die Mehrarbeitszeit ist nicht die unabhängige Variable, die um jeden Preis ausgeweitet werden muß, sondern eine abhängige Variable.
Ist einmal eine bestimmte durchschnittliche Arbeitzeit (die Dauer des Arbeitstages) festgelegt – und damit auch das Ausmaß der disponiblen Zeit -, stellt sich klarerweise die Frage nach dem Umfang und der Struktur der materiellen Produktion. Das Ziel der Produktion ist nun nicht mehr Produktion um ihrer selbst Willen, zur Maximierung des Profits. Vielmehr muß die Produktion der Konsumtion, den Bedürfnissen der assoziierten Produzenten dienen.
Im Kapitalismus sind die einzigen „Bedürfnisse“, die als legitim anerkannt werden, jene, die über den Austausch am Markt erscheinen und für die bezahlt werden kann. Die einzigen Bedürfnisse die daher als „rational“ anerkannt werden, sind jene, die am Markt existieren. Das ist selbst dann der Fall, wenn Nahrungsmittel aus Hungerregionen exportiert werden oder wo Ferienparadiese der Reichen neben Slums und Obdachlosigkeit existieren. Im Gegensatz dazu bezieht sich ein rationales „Bedürfnis“ vom sozialistischen Standpunkt auf die Garantie von Lebensmitteln, Wohnung, Kleidung und den Zugang zu Bildung und Erholung.
Um das zu erreichen, wird es notwendig sein, die Produktivkräfte massiv zu steigern. In diesem Sinne ist die Produktion durch das Gesetz der sozialistischen Akkumulation bestimmt. Es wird notwendig sein, die Akkumulationsrate (besonders bei Investitionen in die modernste Industrie) Hand in Hand mit dem Konsumtionsvolumen zu steigern. Das kann durch eine Reihe von Maßnahmen erreicht werden.
Erstens wird die Reorganisation der Arbeitsteilung im internationalen und nationalen Maßstab zu einer Steigerung der Skalenerträge und einer Effektivierung der Produktion führen. Das schließt sowohl die Vorteile ein, die aus der Beseitigung kostspieliger Handelsbarrieren erwachsen, als auch die zügige und rationale Weitergabe technischer Innovationen in der gesamten Industrie, die nicht länger durch das Privateigentum verhindert wird.
Zweitens wird die massive Reduktion unproduktiver Ausgaben (z.B. Waffen, Bürokratie des kapitalistischen Staates und der Unternehmen, Vermarkungskosten der meisten Produkte, verschwenderische und sozial nachteilige „Luxus“ausgaben) eine Umverteilung der gesellschaftlichen Arbeit zur produktiven Nutzung ermöglichen. Drittens wird die Expropriation der Privateigner an den Produktionsmitteln die Beschäftigung aller Arbeitskräfte und somit eine massive Steigerung der Produktion von Gütern und Dienstleistungen ermöglichen.
Viertens kann eine massive Zunahme der Arbeitsproduktivität von der Aufhebung des unterdrückerischen und erzwungenen Charakters der Lohnarbeit erwartet werden. Der Initiative und Kreativität der gemeinschaftlichen Arbeit werden sich neue Dimensionen eröffnen. Fünftens wird ein revolutionäres Programm der Landreform in vielen Ländern ebenfalls zu Steigerungen der Produktion führen.
Die Produktion muß so expandieren, daß sichergestellt ist, daß verschiedene Güter und Dienste in solchen Proportionen hergestellt werden, daß ein Gleichgewicht zwischen den verschiedenen Sektoren der Produktion und zwischen Produktion und Konsumtion sichergestellt ist, um Engpässe wie auch Überangebote zu vermeiden. Dazu ist Wissen über die Struktur der vorhandenen und zu befriedigenden Bedürfnisse der Konsumenten erforderlich, um über Rate und Struktur der Investionen zu entscheiden.
Die Struktur der zu befriedigenden Bedürfnisse wird die Zusammenstellung der zu produzierenden Produktionsmittel und Konsumgüter bestimmen und die Investionsentscheidungen werden auch bewußt festlegen, welche Konsumtionsgüter in einer später Produktionsperiode hergestellt werden, um die zukünftigen Konsumtionsmöglichkeiten auszuweiten. Eine geplante Überschußproduktion wird notwendigerweise ein Teil solcher Kalkulationen sein, um für die Befriedigung im ursprünglichen Plan nicht einberechneter, plötzlich gestiegener Nachfrage vorzusorgen.
Wenn solche Entscheidungen gefällt werden, müssen auch objektive ökonomische Kriterien einbezogen werden. Eine Übergangsökonomie würde versuchen, ihre Investionsprogramme bis zu dem Punkt zu steigern, wo keine weiteren Produktivitätsgewinne mehr möglich sind durch die Ersetzung lebendiger Arbeit durch Arbeit, die in Produktionsmitteln vergegenständlicht ist, und der gesamte Nettooutput für die Konsumtion verwendet wird.
Die Investitionsrate wird von den Bedingungen bestimmt werden, die in der Zeit des Übergangs herrschen. Klarerweise können gegenwärtige Bedürfnisse nur bis zu einem bestimmten Punkt zugunsten künftiger aufgeschoben werden. Dieser Punkt würde überschritten werden, wenn die momentane Konsumtion eingeschränkt oder eingefroren und alle Ressourcen dazu verwendete würden, möglichst rasch ein maximales Produktivitätsniveau zu erreichen.
Es kann jedoch ganz im Gegenteil notwendig sein, kurzfristig die Investitionsrate zu drosseln, um den Lebensstandard rascher zu erhöhen. Anderseits kann es gerade in Ländern mit einem geringen Industrialisierungsgrad zu Beginn notwendig sein, einen Kompromiß zwischen letzteren Bedrüfnissen und einer relativ hohen Investionsrate zu finden, da ein bestimmtes Mindestniveau an Industrialisierung eine notwendige Voraussetzung für die Entwicklung eines zentralen Wirtschaftsplans für das ganze Land darstellt.
Eine Föderation von Arbeiterstaaten (und noch viel mehr eine weltweite sozialistische Föderation) würde versuchen, den Industrialisierungsgrad dieser Länder möglichst rasch anzugleichen. Das schließt auch ein bestimmtes Maß an Verlagerung von Ressourcen aus den industrialisierten Teilen der Erde in die Länder der sog. „Dritten Welt“ ein, um die vom Imperialismus geschaffenen Zustände zu überwinden.
Das bedeutet aber nicht, daß der Lebensstandard in den entwickelteren Ländern in dieser Phase sinken wird. Er würde nur langsamer wachsen, als das ohne diese internationale Kooperation der Fall wäre. Zweitens soll das Tempo der industriellen Entwicklung in den rückständigeren Ländern nur so hoch sein, daß die Veränderung der Kultur ohne Zwang und Unterdrückung Schritt halten kann. Eine vernünftige Umverteilung der Ressourcen muß durch die Organe der Arbeiterdemokratie bestimmt werden.
Ökonomische Effizienz
Eine rationale Reorganisation der Produktion und Konsumtion wird nur die ersten Erfolge bringen. Mit dem Fortschreiten zum Sozialismus wird die Produktivität systematisch gesteigert werden müssen. Es wird notwendig sein, die Arbeit zu ökonomisieren, effektiver zu werden. An dieser Stelle griffen schon die frühesten Kritiker des Sozialismus den Marxismus an.
Marxisten haben immer behauptet, daß die Reduktion der Länge des Arbeitstages und die Ausdehnung der disponiblen Zeit ausreichende Motive zur Steigerung der Effektivität der Ökonomie sind. Aber in diesem Jahrhundert sind verschiedene Kritiker weiter gegangen und haben behauptet, daß der Sozialismus nach der Abschaffung der Regulation durch den Markt über kein zuverlässiges Instrument zur Messung wirtschaftlicher Effektivität verfüge. Die Wiener Schule (von Mises, Hayek) argumentierte, daß der Sozialismus aufgrund des Fehlens eines Systems von auf dem Markt gebildeten Preisen keinen Mechanismus hätte, um die Verteilung der produktiven Ressourcen auf verschiedene Funktionen rational zu kalkulieren. Es wäre unmöglich, zu bestimmen, welche von zwei beliebigen Produktionsmethoden „ökonomischer“ wäre, da jeder Vergleich ihrer Kosten hinsichtlich ihrer Wert-Produktivität unmöglich wäre.
Es stimmt, daß qualitativ verschiedene Güter auf gemeinsame quantitative Maßstäbe reduziert werden müssen, um die Effektivität unterschiedlicher Verwendung von Ressourcen zu vergleichen. Aber es ist falsch, daß diese Kalkulation nur mit Marktpreisen gemacht werden könnte. Daran stimmt nur, daß die Bewegung der Preise für Zwischen- und Endprodukte in einer atomisierten und auf individueller Konkurrenz beruhenden Wirtschaft das einzige Mittel ist, um das Problem der Verteilung der Ressourcen zu lösen. Die Unternehmen müssen sich diesen von außen aufgezwungenen Bedingungen gemäß verhalten.
Aber das ist nur ein Mittel, das Problem zu lösen. In der Übergangsperiode zum Sozialismus wird die Reduktion qualitativ verschiedener Produkte auf ein gemeinsames Maß zum quantitativen Vergleich durch die Berechnung der in den verschiedenen Produkten und Dienstleistungen verkörperten Arbeitszeit erfolgen.
Alle Gegner des Marxismus (einschließlich der sogenannten Markt-Sozialisten) gehen davon aus, daß das unmöglich sei. Von Mises, Tugan Baranowsky und Böhm-Bawerk wiesen die Arbeitswerttheorie in ihrer Gesamtheit zurück und damit auch die Möglichkeit, ökonomische Berechnungen auf Basis der Arbeitszeit durchzuführen. Selbst Karl Kautsky glaubte, daß es in der Praxis unmöglich wäre, das Quantum der in einer bestimmten Ware verkörperten gesellschaftlich notwendigen Arbeit zu bestimmen.
Im Gegensatz dazu stand die Marxsche Auffassung:
„Die Arbeitszeit würde also eine doppelte Rolle spielen. Ihre gesellschaftlich planmäßige Verteilung regelt die richtige Proportion der verschiednen Arbeitsfunktionen zu den verschiednen Bedürfnissen. Andrerseits dient die Arbeitszeit zugleich als Maß des individuellen Anteils des Produzenten an der Gemeinarbeit und daher auch an dem individuell verzehrbaren Teil des Gemeinprodukts.“ (Marx, Kapital Bd. 1, S. 93)
Verteilung der Produktion gemäß der Arbeitszeit
Die Arbeitszeit dient sowohl der Allokation der gesellschaftlichen Arbeit auf die verschiedenen Spären der Produktion wie auch der Verteilung der Konsumtionsmittel auf die Bevölkerung als Basis der Kostenkalkulation. Wenden wir uns zuerst der Verteilung der Ressourcen auf die gesellschaftliche Produktion zu.
Zuerst müssen wir bestimmen, auf welche Arbeitszeit wir uns beziehen. Mit der kapitalistischen Produktionsweise ist die Scheidung von konkreter und abstrakter Arbeit verbunden. Der Tauschakt selbst reduziert im Kapitalismus jede konkrete Arbeit auf ein bestimmtes Quantum abstrakter Arbeit – den Wert. Dieser Wert kann wiederum nur in der Form eines Tauschverhältnisses (des Tauschwertes) zwischen einem bestimmten Quantum einer Ware und dem bestimmten Quantum einer anderen Ware erscheinen. Geld ist eine Verkörperung dieses Tauschwertes.
Im Kapitalismus bildet sich infolge des permanenten Tausches auf dem Markt und der Konkurrenz eine klare Vorstellung heraus, welche Arbeit in einer Industrie Arbeit durchschnittlicher Intensität, d.h. gesellschaftlich notwendige Arbeit, darstellt. In der Übergangsperiode zum Sozialismus wird diese „blinde“, d.h. im Nachhinein stattfindende Bestimmung gesellschaftlich notwendiger Arbeit im Zuge der Aufhebung der Warenproduktion eliminiert. Diese Bestimmung erfolgt nun bewußt und direkt durch die Gesellschaft.
Was als Richtmaß für Arbeit von durchschnittlicher Intensität gilt, wird dann durch die Organe der Arbeiterdemokratie bestimmt und kontrolliert werden müssen. Die Diskussion über diese Standards wird offenkundig Vergleiche mit dem Kapitalismus einschließen, aber sie wird sich keinesfalls sklavisch an ihnen orientieren.
Die wissenschaftlich festgelegten Standards der Arbeitsintensität werden sowohl physische wie psychologische Elemente zur Bestimmung von Streß und Anstrengung einschließen. Falls z.B. eine bestimmte Art der Arbeit mit besonders hoher Anstrengung und Erschöpfung verbunden ist, sollte das noch nicht als „mehr Wert“ schaffend betrachtet werden. Vielmehr sollte diese konkrete Arbeit der Arbeit durchschnittlicher Intensität dadurch angeglichen werden, indem z.B. zusätzliche Ruhepausen in die kalkulierte Arbeitszeit einbezogen werden.
Die Bestimmung der Arbeitszeit, die in einem bestimmten Produkt vergegenständlicht ist, wird Aufgabe der Arbeitskräfte sein, die sie produzieren. Dazu müssen die Arbeiter nur die voraussichtlichen Arbeitsstunden, die ihre Brigade oder ihr Team dazu brauchen wird, mit der Summe der Arbeitsstunden addieren, die in den zu verwendenden Rohmaterialien und Vorprodukten vergegenständlich sind. Dazu kommen die Zahlen für den Verschleiß der Maschinen, den Energieverbrauch usw. Die Gesamtsumme wird dann mit den entsprechenden Zahlen aller Unternehmen, die dasselbe Produkt erzeugen, verglichen.
Die durchschnittlich notwendige Arbeitszeit repräsentiert den gesellschaftlichen Arbeitswert, der vom individuellen Arbeitswert in beide Richtungen abweichen kann. Die erstere Größe stellt eine wichtige Grundlage für die Planungsstellen dar. Die Arbeitscoupons (Scheine) werden im Verhältnis zu den geleisteten indivuellen Arbeitsstunden verteilt, aber die wirtschaftlichen Berechnungen werden sich an den gesellschaftlichen Arbeitswerten orientieren müssen. Diese Kalkulationen (und damit auch die Entscheidungen, die auf ihnen basieren) werden allen Arbeitern leicht verständlich in Arbeitszeiteinheiten ausgedrückt werden.
Dieses System wird die Grundlage der Kostenberechnung und der Verteilung der Ressourcen auf verschiedene Gebiete sein. Der „Preis“ der Güter und Dienstleistungen wird in Arbeitszeiteinheiten gemessen werden. Der Preis von Produktions- und Konsumgütern setzt sich aus den Produktionskosten (Rohmaterialien, Abnutzung der Maschinerie, …) und den Arbeitskosten (ebenfalls in Arbeitszeiteinheiten gemessen, die zur Herstellung der Güter zur Reproduktion der Arbeitskraft zu einem bestimmten Mindeststandard notwendig sind) zusammen. Die Zeit für die Mehrarbeit über diesen Kostpreis hinaus wird von der Gesellschaft gemäß einer bestimmten Investitionsrate festgelegt.
Sobald eine Prioritätenliste von den Produzenten nach einer kollektiven Debatte festgelegt wurde, muß die Produktivität der Ressourcen in den verschiedenen Branchen berechnet werden. Dazu ist es nicht notwendig, zuerst die „Kosten“ der Ressourcen zu bestimmen und dann ihre relative Produktivität herauszufinden. Die Planungsorgane würden im voraus wissen, wieviele Arbeitsstunden notwendig wären, um z.B. eine weitere Tonne Stoff zu produzieren, oder wieviele Autos durch den Einsatz von derselben Anzahl Arbeitsstunden fabriziert werden können.
Dadurch wäre es möglich herauszuarbeiten, mit welcher Verteilung der Gesamtarbeit die größte Nettoproduktivität zu erzielen ist. Außerdem würden Vergleiche mit den unmittelbar zurückliegenden Produktionsperioden herangezogen werden. Diese können, ein entsprechendes Informationssystem vorausgesetzt, von landesweiter bis hin zur betrieblichen oder gar Abteilungsebene durchgeführt werden. Der „Geld“- oder „Preis“-Ausdruck dieser relativen Produktivitätsgrößen wäre ganz und gar sekundär. Der wichtige Aspekt besteht vielmehr darin, daß jeder Vergleichsmaßstab stabil und auf die ganze Ökonomie anwendbar sein muß.
Verteilung der Konsumgüter gemäß der Arbeitszeit
Das Prinzip, das die Verteilung des gesellschaftlichen Produkts unter den Arbeitern reguliert, wird von der Gesellschaft der unmittelbaren Produzenten selbst konkret ausgearbeitet werden müssen. Marx und Engels legen folgendes Prinzip nahe:
„Demgemäß erhält der einzelne Produzent – nach den Abzügen – exakt zurück, was er ihr (der Gesellschaft, Anm. der Red.) gibt. Was er ihr gegeben hat, ist sein individuelles Arbeitsquantum. Z.B. der gesellschaftliche Arbeitstag besteht aus der Summe der individuellen Arbeitsstunden. Der individuelle Arbeitstag des einzelnen Produzenten ist der von ihm gelieferte Teil des gesellschaftlichen Arbeitstags, sein Anteil daran. Er erhält von der Gesellschaft einen Schein, daß er soundso viel Arbeit geliefert (nach Abzug seiner Arbeit für die gemeinschaftlichen Fonds), und zieht mit diesem Schein aus dem gesellschaftlichen Vorrat an Konsumtionsmitteln soviel heraus, als gleich viel Arbeit kostet.“ (Karl Marx, Kritik des Gothaer Programms, MEW 19, S. 20)
Marx sprach sich für dieses Prinzip aus, da er die Unmöglichkeit erkannte, unmittelbar zu einer Gesellschaft ohne verallgemeinerten Mangel und damit ohne die Notwendigkeit, die Verteilung begrenzter Ressourcen zu regulieren, überzugehen. Er war sich schon darüber im klaren, daß die konkreten Verteilungsnormen- und methoden der Konsumtionsgüter vom Entwicklungsstand der Produktionskräfte der Gesellschaft abhängen.
Je entwickelter eine Ökonomie am Beginn des Übergangs zum Sozialismus, desto mehr wird sie die Bedürfnisse der Bevölkerung direkt zum Ausgangspunkt machen. Es ist daher in den entwickelten kapitalistischen Ländern wahrscheinlich, daß die sozialistische Transformation mit einem recht hohen Niveau garantierten ,d.h. einem von der individuellen Arbeitsleistung unabhängigen, Zugangs zu den Konsumgütern beginnen wird.
Obwohl das für all jene Güter unmittelbar angewandt werden kann, die ohnehin von Branchen mit sehr hoher Produktivität erzeugt werden und wo auch die freie Verteilung die Nachfrage nicht über die Produktionskapazitäten steigern würde, so sollte man nicht erwarten, daß das für die Mehrzahl der Güter in naher Zukunft möglich ist. Wenn wir uns den Sozialismus als weltweites System vorstellen, dann wird die Nachfrage (d.h. die Bedürfnisse der Bevölkerung, nicht die Fähigkeit zu zahlen) nach Gütern über Jahrzehnte so groß sein, daß sie die Produktionskapitazitäten übersteigt, selbst wenn wir ein beschleunigtes Wachstum für die meiste Zeit der Existenz eines Arbeiterstaates annehmen.
Das impliziert die Tatsache, daß Arbeits-Coupons entsprechend der von einem Individuum geleisteten Arbeit verteilt werden, daß ein bestimmtes Ausmaß an sozialer Ungleichheit in der Übergangsperiode existiert. Diese Ungleichheit wird unter anderem die Notwendigkeit widerspiegeln, gesellschaftliche Anreize zur Durchführung bestimmter Aufgaben (anstrengende oder eintönige Arbeit, Nachtarbeit, …) zu schaffen.
In anderen Fällen werden es Arbeiter vorziehen, zusätzlich disponible Zeit gegen Arbeits-Coupons zu tauschen. Diesen Tendenzen zur Ungleichheit müssen Grenzen gezogen werden und, wo möglich, sollen andere Möglichkeiten entwickelt werden, um dieselben Ziele mit anderen Mitteln zu erreichen. So kann z.B. eine regelmäßige Jobrotation – was eine Ausbildung voraussetzt, die die Ausübung sehr verschiedener Tätigkeiten im Laufe eines Lebens ermöglicht – dazu führen, daß alle Arbeiter für eine befristete Zeitspanne bestimmte „unbeliebte“, besonders anstregende oder eintönige Aufgaben als gesellschaftliche Verpflichtung verrichten müssen, womit nicht mehr eine Minderheit für ihr ganzes Leben zur Ausübung ebendieser Tätigkeit gezwungen wäre.
Marxisten lehnen von vornherein die Vorstellung ab, daß die Arbeiter Lohnzuschläge für Produktivitätzuwächse ihres Unternehmens erhalten sollten. Erstens sollten verschiedene Produktiviätsniveaus generell nicht die Grundlage für verschiedene individuelle Entschädigungen sein, da die Produktivitätsunterschiede selbst das Resultat makro-ökonomischer Investitionsentscheidungen der gesamten Gesellschaft sind. Produktivitätszuwächse sollen nicht nur individuellen Arbeitern oder Unternehmen, sondern der Gesellschaft insgesamt in Form niedrigerer Preise, höherer Qualitität und Auswahl an Produkten zugute kommen. So hat jeder Arbeiter dasselbe, kollektive Interesse an einer, in ihrer Gesamtheit möglichst effektiven Ökonomie, um so die Kosten der Produkte möglichst zu reduzieren. Die Arbeiter als Konsumenten werden daher direkt von ihren Errungenschaften als Arbeiter in der Produktion profitieren.
Das Problem der qualifizierten Arbeit
Alle Formen konkreter menschlicher Arbeit, egal ob qualifiziert oder nicht, sind von einander qualitativ verschieden und als konkrete Arbeit nicht durch ein gemeinsames Maß vergleichbar. Das ist auch der Grund, warum im Kapitalismus jede konkrete Arbeit, einschließlich der qualifizierten, aus über den Tausch auf abstrakte Arbeit reduziert wird.
Marx betrachtete die qualifizierte oder „komplizierte“ Arbeit als ein Vielfaches der einfachen Durchschnittsarbeit. Heißt das, daß die qualifizierte Arbeit im Sozialismus höher entlohnt werden soll oder daß sie mehr Wert als die einfache Arbeit produziert?
Im Kapitalismus, wo die Kosten der Ausbildung und Reproduktion der qualifizierten Arbeit privat getragen werden müssen, erhält die qualifizierte Arbeit höhere Löhne. In der Übergangsperiode zum Sozialismus ist das immer weniger der Fall. Dazu Engels:
„In der sozialistisch organisierten Gesellschaft bestreitet die Gesellschaft diese Kosten, ihr gehören daher auch die Früchte, die erzeugten größern Werte der zusammengesetzten Arbeit. Der Arbeiter selbst hat keinen Mehranspruch.“ (Friedrich Engels, Anti-Dührung, MEW 20, S. 187)
Die Bezahlung der qualifizierten Arbeit muß also dieselbe wie für alle Arbeit sein. Der Egalitarismus ist das leitende Prinzip. Es besteht auch keine Grund dafür, diese Sicht mit Hinweis auf (angeblichen) größeren physischen oder geistigen Verschleiß der qualifizierten Arbeit zu relativieren.
Ebensowenig schafft die qualifizierte Arbeit mehr Wert pro Arbeitsstunde. Dies würde einer Verwechselung des Tauschwerts einer Ware mit ihrem Gebrauchswert gleichkommen. Ihr „Tauschwert“ mag aufgrund höherer Reproduktionskosten höher sein, aber das schafft noch keine mysteriöse Kraft, mehr Wert zu schaffen als die einfache Arbeit. Aber die höheren Reproduktionskosten müssen im Planung und Kalkulation während der Übergangsperiode eingehen.
Nehmen wir z.B. eine Projekt, das für 10 Tage Arbeit von 100 Arbeitern erfordert, von denen 10 eine spezielle Ausbildung brauchen, die insgesamt 200 Arbeitstagen entspricht. In diesem Fall muß die Gesellschaft die 200 Tage in Rechnung stellen und das Projekt verkörpert daher 1200 Arbeitsstunden. Daher verkörpert die qualifizierte Arbeit in diesem Sinne ähnlich dem konstanten Kapital im Kapitalismus eine Proportion vergegenständlichter Arbeit, die auf den Wert des Endprodukts übertragen wird, obwohl sie nicht mehr Wert als die unqualifizierte Arbeit schafft.
Wahl
Es wurde immmer wieder behauptet, daß die Auswahl an Produkten und Dienstleistungen ebenso wie die Zufriedenheit der Konsumente abnehmen würde, sobald die Waren nicht über den Markt verteilt würden. Selbst die Markt-Sozialisten meinen, daß der Markt und das Preissystem die besten Mechanismen wären, um die riesigen Informationsmengen über die Bedürfnisse und Wünsche der Konsumenten zu verarbeiten. Ihrer Ansicht nach ist es unmöglich, diese Informationen in einem planwirtschaftlichen System zu verarbeiten, ohne sie zu verfälschen. Daher könne der Plan nicht sicherstellen, daß die Produktion der (immer wieder wechselnden) Bedürfnisstruktur entspreche.
In Wirklichkeit wird die Befriedigung der Konsumenten im Kapitalismus angebotsseitig durch das Streben nach Profitmaximierung und die Konkurrenz, nachfrageseitig durch die Einkommensstruktur eingeschränkt. Zum ersten ist der Konsument (im modernen Kapitalismus) wegen der enormen Distributionskosten zur Vermarktung jeder Ware (einschließlich der Werbung) gezwungen, die Produkte über ihren Produktionskosten zu kaufen. Überlicherweise machen diese um die 50% des Marktpreises aus. In der Übergangsperiode werden diese Kosten eliminiert oder auf ein Bruchteil reduziert werden, um eine Reihe von Verkaufsstellen und Informationszentren für die Konsumenten zu schaffen.
Zweitens werden im Kapitalismus die Konsumgewohnheiten nicht von den Konsumenten, sondern von den Produzenten bestimmt. Die zunehmende Monopolisierung der Produktion ermöglicht den Unternehmen z.B. Produkte mit geringeren Profitspannenen durch solche mit höheren zu ersetzten, was gleichzeitig mit einer Verringerung der Wahlmöglichkeiten für die Konsumenten einhergeht (z.B. die Ersetzung der LP durch die CD). Die Bekleidungsindustrie bestimmt die Saisonmoden nach den Bedürfnissen der Unternehmen, ihren Umsatz zu erhöhen.
Andererseits ist die Wahlmöglichkeit für den Konsumenten irrelevant, solange er über kein entsprechendes Einkommen verfügt. Der Wohnungsmarkt z.B., eine wichtiger Sektor der modernen Industrie- und Dienstleistungsbranchen, expandiert aufgrund der Nachfrage einer ganzen Schicht von Zweitwohnungs- bzw. hausbesitzern, während die Obdachlosigkeit wächst. Die Vorstellung, daß die Marktpreise ein adäquates, ja gar das beste Mittel wären, um die Konsumentenwünsche aufzuzweigen, ist daher grotesk. Alles was sie zeigen ist eine bestimmte Einkommensstruktur, die durch Ausbeutung und kapitalistische Eigentumsverhältnisse bestimmt ist.
In der Übergangsperiode zum Sozialismus wird die Befriedigung der Bedürfnisse sowohl hinsichtlich ihrer gesellschaftlichen Breite, d.h. hin zu den heute Verarmten, wie auch hinsichtlich ihrer Vielfältigkeit und Qualitität massiv ausgeweitet werden (z.B. durch die Herstellung von Produkten, die den Bedürfnissen einer Minderheit der Konsumenten entsprechen und die bisher nicht profitabel gewesen ist).
Die Lösung des Informationsproblems
Das Problem, wie Veränderungen der Konsumbedürfnisse in einem sozialistischen Verteilungssystem behandelt würden, führt eine Reihe bürgerlicher Ökonomen (besonders Hayek) zur Behauptung, daß kein sozialistisches Planungsorgan jemals ein hinreichend komplexes Gesamtbild der vereinzelten Konsumentenbedürfnisse erlangen könnte, um für wechselnde Bedürfnisse kreative Lösungen hervorzubringen.
Demgegenüber verweisen wir erstens darauf, daß „konstruierte Preise“ in der ersten Phase des Übergangs notwendig sind und diese leicht als Signal verwendet werden können, das bestimmte Schwankungen der Konsumnachfrage widerspiegelt. Daher kann auf Veränderungen des Lagerbestandes folgendermaßen reagiert werden: (a) durch Preisbewegungen, die ein kurzfristiges Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage kompensieren und (b) durch Veränderungen in den jeweiligen Produktionsabläufen. Das Wertgesetz würde in keinem Fall eine Rolle spielen, da sich höhere Preise nicht in Extra-Profite verwandeln und dadurch den Produktionsprozeß regulieren könnten.
In einem späteren Stadium des Übergangs, wenn der Sozialismus schon in greifbare Nähe gerückt und elektronische Arbeitscoupons verwendet werden, um den Zugang zu den verbleibenden Konsumgütern zu regulieren, die noch nicht im Überfluß vorhanden sind, wird die computergestützte Verarbeitung der Informationen über die Lagerbestände in den meisten Fällen ausreichen, um möglichen Güterengpässe noch vor ihrem Auftreten entgegenzuwirken. Daher werden in diesem Stadium keine „Preisschwankungen“ mehr notwendig sein, um Angebot und Nachfrage zu regulieren.
Hinsichtlich des allgemeinen „Informationsproblems“, das von Hayek und andere ausgemacht haben, ist noch anzumerken, daß sich kein gesunder Arbeiterstaat auf ein überzentralisiertes Planungssystem stützen würde. Die Überzentralisierung und die chronischen Verwerfungen des Planungssystems in den degenerierten Arbeiterstaaten spiegelten die Bedürfnisse der parasitären Bürokratie wider und kein „Prinzip“. Im Gegenteil: die Planung in einem proletarischen Staat muß gleichzeit zentralisiert und dezentralisiert sein.
Wie kann das erreicht werden?
Die proletarische Planung impliziert eine Hierarchie der Entscheidungsprozesse. Jede Entscheidung sollte auf der Ebene getroffen werden, die am besten zu ihrer Durchführung geeignet ist bzw. die von ihr betroffen ist. Mit anderen Worten: jede Entscheidung soll auf einer Ebene getroffen werden, die so hoch wie notwendig und so niedrig wie möglich ist. Daher würde z.B. eine Einscheidung über Verbesserung des Produktemix einer bestimmten Fabrik auf lokaler (d.h. betrieblicher) Ebene gefällt werden, wenn sie die gesamte regionale oder staatliche Produktionsstruktur nicht grundlegend tangiert. Das vor Ort vorhandene Wissen kann so genutzt werden, um diese Entscheidungsfindung zu optimieren.
Andererseits wird eine übergeordnete (regionale, nationale oder internationale) Ebene zur Entscheidungsfindung dann am günstigsten sein, wenn technologische oder ökologische Entwicklungen eine bestimmte Anpassung der Produktionsabläufe in einer Reihe von Fabriken erfordern. Im Prinzip existiert keine Schwierigkeit damit, die Entscheidungsfindung auf den Problemen angemesse Ebenen zu übertragen, solange es keine Bürokratie gibt, die versucht, die (zentrale) Macht in ihrer Hand zu konzentrieren und solange keine embryonische Bourgeoisie existiert, die die ökonomische Entscheidungfindungen in ihren privaten Händen dezentralisieren will.
Innovation und Wettbewerb
Viele Autoren, die einer zentralisierten Planung wohlwollend gegenüberstehen (z.B. Itoh, Elson), und alle Marktsozialisten argumentieren, daß eine dezentralisierte Planwirtschaft Schwierigkeiten hätte, die Innovation zu stimulieren, wenn es keinen Wettbewerb zwischen den Unternehmen gäbe. Sie treten dafür ein, die Verbesserung der Technik aber auch der Qualität der Produkte dadurch zu stimulieren, daß es den Unternehmen gestattet wird, über eine Art „Monopolprofit“ zu verfügen, wenn sie eine neue Produktionsreihe oder neue Produktionsprozesse entwickeln.
Diese Sicht muß zurückgewiesen werden. Statt individuelle und gesellschaftliche Bedürfnisse miteinander in Ausgleich zu bringen, bringt sie sie miteinander in Konflikt. Es würde, wenn nicht de jure, so doch de facto bedeuten, das Privateigentum anzuerkennen (z.B. an einem Patent für ein neues Produkt oder einer neuen Technik). Es würde die schnelle Verbreitung neuer Erfindungen in der gesamten Gesellschaft bremsen und einen Teil der Industrie zu Ineffektivität und relativer Rückständigkeit verurteilen.
Ähnlich wie in der „Lohn“frage muß die Innovation so belohnt werden, daß die gesamte Bevölkerung davon profitiert, einschließlich des Teils, der sie hervorbringt. Darüberhinaus werden Forschung und Entwicklung mehr und mehr aufhören, die Aufgabe eines spezialisierten Teils der gesellschaftlichen Arbeitskraft zu sein, und Teil der Arbeit aller Beschäftigten werden.
Nichtsdestotrotz kann der „sozialistische Wettbewerb“ eine kreative Rolle spielen. Nicht alle Formen der Konkurrenz sind destruktiv und unterminieren die Solidarität der Produzenten.
Planung in der Übergangsperiode: Das Beste vom Kapitalismus übernehmen und verbessern
Das Ziel der Regulation der Ökomomie muß darin bestehen, „das Planungsprinzip über den ganzen Markt auszudehnen, ihn dadurch zurückzudrängen und zu eliminieren“ (Trotzki 1923). Im Grunde ist die Erfahrung des Kapitalismus im zwanzigsten Jahrhundert das beste Argument für den Übergang zum Sozialismus. Es ist wichtig, diese Entwicklung zum Ausgangspunkt unserer Überlegungen zu machen.
Die inneren Tendenzen der kapitalistischen Produktionsweise selbst beweisen die Möglichkeit der Planung auf immer umfassenderer Stufenleiter und demonstrieren zugleich die Notwendigkeit, das Privateigentum an Produktionsmitteln zu zerstören, um die inneren Möglichkeiten der Planung zu entfesseln.
In den letzten 20 Jahren fanden im Rahmen der globalen kapitalistischen Produktion Entwicklungen statt, die unter dem Namen „Qualitätsrevolution“ bekannt wurden und überhaupt erst die sogenannte „schlanke Produktion“ möglich gemacht haben. Der Erfolg des japanischen Kapitals in den 1970er Jahren aufgrund dieser Technik und die zunehmende Konkurrenz am Weltmarkt in den 1980er Jahren zwangen diese Technologien allen Produzenten auf.
Die „Qualitätsrevolution“ basiert darauf, den Arbeitern mehr Kontrolle über den Produktionsprozeß zu geben. Die bis dahin seit den 1920er Jahren vorherrschende Produktionsmethode war das Fließband. Diese Produktionstechnik reduzierte die Arbeiter auf einfache Handgriffe, die von Band bestimmt waren.
Während das Fließband die Produktivität enorm erhöhte, so tat sie das auf Basis einer geringen Qualität der Produktion. Qualitätskontrollen mußten am Ende der Bänder installiert werden, um Fehler zu korregieren, die durch diese geisttötende und verschleißende Produktionsmethode verursacht wurden. Im Rahmen der Fließbandproduktion wurden die Arbeiter auf Automaten reduziert, ohne Kontrolle über den Produktionsprozeß oder gar das Arbeitstempo.
Die „Qualitätsrevolution“ mußte versuchen, eine der spezifischen Entfremdungseffekte des Fließbandes zu überwinden. Die Arbeiter werden nun in Teams organisiert, die eine größere Bandbreite unterschiedlicher Aufgaben erfüllen. Vor allem sind sie jetzt für die Qualität der Produkte verantwortlich und das bedeutet auch, daß sie mehr gehört werden und größere Kontrolle über den unmittelbaren Arbeitsprozeß ausüben.
Aber die größere Kontrolle der Arbeiter über den Arbeitsprozeß erfordert gleichzeitig erhöhte Loyalität zum „eigenen Betrieb“, da sie ansonsten zu einer Gefahr für den Kapitalismus selbst wird. Sie erfordert eine Harmonie der Klassen in der Produktion. Angesichts des Klassenkampfes infolge wirtschaftlicher Krisen bricht diese auf. Die Qualitätsproduktion gerät im Kapitalismus in Widerspruch zur Konkurrenz und zum anarchischen Charakter des Kapitalismus.
Die Qualitätsrevolution trägt auch zur Überwindung der Trennung von Hand- und Kopfarbeit bei. In der Vergangenheit wurden Produkte ohne viel Rücksicht auf den Produktionsprozeß entworfen. Sie wurden dann von den Ingenieuren modifiziert, um mit existierenden Maschinen produziert zu werden.
Bei der „Qualitätsproduktion“ werden die Arbeiter schon im Entwicklungsstadium einbezogen. Die Produkte werden so entworfen, daß sie von der Planung weg fehlerfrei sind. Das ist nur möglich, wenn Konstruktion, Entwicklung und Produktion als gemeinsames Team zusammenarbeiten. Das hat auch die traditionellen Herrschaftsbereiche der Manager zum Einsturz gebracht. Früher mußte in jeder Phase eine Reihe von Abteilungen durchlaufen werden, von denen jede irgendetwas zu sagen hatte, um ihre Existenz zu rechtfertigen. Als Resultat der neuen Methoden konnte nicht nur der Entwicklungszeitraum der wichtigsten Produkte halbiert werden – sie sind auch besser konstruiert und für die Arbeiter leichter zu produzieren.
In ihrer entwickeltsten Form nimmt diese Integration die Form der gleichzeitigen (simultanen) Konstruktion an, die zeigt, daß der Kapitalismus gezwungen ist, die von der gesellschaftlichen Teilung der Arbeit verursachten Störungen zu minimieren. Bei der gleichzeitigen Konstruktion werden die Probleme von Planung, Entwicklung und Produktion simultan behandelt. Die Entwicklung wird gleichzeitig mit den Produktionsmethoden zu ihrer Realisierung betrachtet, womit sich beide wechselseitig beeinflussen. Das erfordert die Integration von Entwicklung, Materialbeschaffung und Produktionstechnik. Es erfordert immer engere Kooperation zwischen den Planungszentren, den Zulieferfirmen und unterstützenden Dienstleistungen.
So wie die „Qualitätsproduktion“ und die „schlanke Produktion“ die zunehmende Vergesellschaftung des Arbeitsprozesses im Rahmen der Fabrik oder des Unternehmens beinhalten, so tendieren sie auch zur Vergesellschaftung der Produktion zwischen den Fabriken, den Zulieferern und allen anderen Vertragspartnern, die sie unterstützen.
Die Produktionsunternehmen verlangen nicht nur fehlerfreie, sondern auch die Bedürfnisse der Produktion möglichst nicht übersteigende Zulieferungen – just in time-Lieferungen. Die besten japanischen Fabriken lagern nur Bestandteile für zwei Stunden im voraus. Um dieses Effektivitätsniveau zu erreichen, müssen die Zulieferer an die Computer der Produzenten angeschlossen sein, den Produktionsfluß und damit die angeforderten Teilprodukte kennen und sicherstellen.
Das nächste Ziel des kapitalistischen Arbeitsprozesses ist die computerintegrierte Produktion (CIM). Diese- die automatisierte Fabrikhalle, die elektronisch mit Kauf, Verkauf und Lagerhaltung verbunden ist – ist bis heute nicht realisiert. Das eigentliche Problem dabei stellt die Komplexität dieser Aufgaben dar – und diese Komplexität resultiert aus der Anarchie des Marktes. Falls die Käufe und Verkäufe im voraus bestimmt werden könnten, wäre CIM durchführbar. Ihre volle Realisierung erfordert das Ende des Konjunkturzyklus – eine Unmöglichkeit im Kapitalismus.
Selbst die Millionen, die Unternehmen in die Marktforschung und Vermarktung der Produkte stecken, um die Konsumentenwünsche vorauszusehen, können diese Schwierigkeit nicht lösen, da das eigentliche Problem nicht in den Wünschen der Konsumenten, sondern in ihrer Kaufkraft besteht. Dieses Element ist das unberechenbarste von allen, da es selbst vom Konjunkturzyklus und der Akkumulationsbewegung abhängt. Je mehr sich die Veränderungen des Arbeitsprozesses weiterentwickeln, um so mehr erfordert ihre effektive weitere Entwicklung die Überwindung des Widerspruchs zwischen privater Aneignung und gesellschaftlicher Produktion.
Planungsstrukturen und der Halb-Staat
Die Einwände gegen die Planwirtschaft haben mehrere Ausgangspunkte. Während einige von der Behauptung ausgehen, daß Innovation und Effektivität mit diesem Wirtschaftssystem unvereinbar wären, insistieren andere darauf, daß es ohne Markt unmöglich wäre, die notwendigen Informationen über Konsumentenbedürfnisse zu aggregieren, da die Zentralisation, die mit dem Staatseigentum einhergeht, den Informationsfluß behindert und eine besondere Funktionärsschicht erzeugt, die eigene Interessen entwickelt und die Operation des Plans behindert.
Dieser Einwand beruht auf einem Unverständnis des Charakters des Staates in der Übergangsperiode. Dieser Staat ist ein Halb-Staat. Als solcher behält er charakteristische Züge aller Staaten bei: eine zentralisierte bewaffnete Macht, um die Revolution gegen innere Gegner und äußere Drohungen zu verteidigen. So lange es Mangel und Ungleichheit gibt, wird die eine oder andere Form notwendig sein, die die Distributionssphäre reguliert.
Doch dieser Staat ist nicht länger „außer Kontrolle“, nicht mehr von der Gesellschaft gesondert und ihr entgegengestellt. Es ist nun vielmehr ein Staat, der mit der Gesellschaft verbunden und ihr nicht mehr gegenübergestellt ist. So sind z.B. die Staatsbediensteten keine permanente Kaste mehr, sondern besehen nun aus Individuen, die für bestimmte Aufgaben ausgebildet sind und in diesen Funkionen rotieren müssen. Darüber hinaus sind sie der Bevölkerung verantwortlich und von ihr jederzeit abberufbar, womit die Möglichkeiten zur Entwicklung irgendwelcher Sonderinteressen, die denen der Masse der Produzenten und Konsumenten entgegenstehen, sehr wirksam eingeschränkt sind.
Kurz gesagt, der Prozeß politischen und wirtschaftlichen Austausches zwischen Staat und Gesellschaft ist flüssig. Selbst die Marktsozialisten können sich einen derartig demokratischen Staat nicht ausmalen. Alle von ihnen vertreten ein System der parlamentarischen Demokratie und die Trennung der politischen Sphäre vom Management der Wirtschaft. Damit verteidigen sie die Notwendigkeit einer Bürokratie, die zwischen Staat und Gesellschaft vermittelt.
Die Strukturen des Planungsapparats arbeiten nach dem Prinzip der gewählten repräsentativen Demokratie. Mitglieder der Arbeiterverwaltungskomitees und Vertreter der Konsumentenassoziationen bilden auf allen Ebenen (lokal, regional, national) gemeinsame Ausschüsse. Die nationalen Planungskommissionen sind für die Entwicklung allgemeiner Parameter für die gesamte Investion und Konsumtion verantwortlich, einschließlich der geplanten Proportionen zwischen verschiedenen Sektoren (z.B. Transport, Produktion, Dienstleistungen).
Diese werden zur Diskussion und Detailbetrachtung an regionale und lokale Komitees wie auch an die einzelnen Sektoren weitergeleitet. Die Verwaltungskomitees in den Fabriken, in der Landwirtschaft und den Büros werden dann die Implikationen dieser allgemeinen Planungsziele für ihren Bereich diskutieren.
Auf regionaler und lokaler Ebene werden die Organisationen bestimmte Ziele für einzelne Industrien ausarbeiten, darunter Vorschläge für den Produktenmix für den Endverbrauch. Diese Vorschläge gehen dann an die zentralen Institutionen zurück, wo ihre Implikationen für die Herstellung von Halb-Fertigprodukten und Rohstoffen herausgearbeitet werden.
Der Plan sollte so dezentralisiert wie möglich sein. Das heißt, daß bindende Entscheidungen auf der untersten Ebene, die für ein bestimmtes Problem sinnvoll ist, fallen sollen. So kann z.B. dieselbe Menge Holz zur Befriedigung einer Reihe verschiedener Konsumbedürfnisse verwendet werden. Die Fabriken, die das Holz verarbeiten, verfügen über Maschinen, um eine ganze Reihe verschiedener Produkte aus diesem Rohstoff herzustellen. Welche Gebrauchswerte mit diesen von einem bestimmten Quantum menschlicher Arbeitskraft hergestellt werden, sollte so weit wie möglich von den Endverbrauchern bestimmt werden.
Klarerweise haben aber die Bedürfnisse des Endverbrauchs Auswirkungen auf davor liegende Schritte der Produktion und damit auf die Planung. Der Aufwand für Transport, Lagerhaltung, Verpackung usw. wird je nach Entscheid über die zu produzierenden Gebrauchswerte wechseln und das wird daher mit den dazu notwendigen Unternehmen abgesprochen und verhandelt werden müssen, bevor eine endgültige Entscheidung gefällt wird.
Der Grund für die Dezentralisierung liegt darin, daß das Zentrum nicht allwissend ist. Die notwendige Information zur Entscheidung über die Allokation der Ressourcen können angesichts des Charakters ebendieser Informationen und des Tempos, mit dem gehandelt werden muß, prinziell nicht vom Zentrum gewußt werden.
Selbst der beste Plan der Welt, der mit vollkommenen freier Information, ohne jedes bürokratische Eigeninteresse und mit den besten Computern ausführt wird, bleibt eine Annäherung an die tatsächliche Tätigkeit, eine Hypothese.
Er bedarf permanenter Kontrolle und Anpassung. In letzter Instanz ist die Ökonomie der Übergangsperiode von den Bedürfnissen der Konsumenten bestimmt, d.h. die Akkumulation wird durch die Wünsche und demokratischen Entscheidungen der Masse der Arbeiter, den Konsumenten ihrer eigenen Produkte, gesteuert. Die Konsumenten müssen daher auch die Resultate des Plans beurteilen.
Es gibt viele Wege, wie der Plan verifiziert und korregiert werden kann. Einige Produkte werden ohne große technische Probleme durch Qualitätskontrollen tagtäglich als ganzes oder in Teilen verbessert und an die Bedürfnisse angepaßt werden können. CIM-Technologie und die Kontrolle der Lagerbestände können dazu verwendet werden, die Produktion mit der Nachfrage in Einklang zu bringen, auch wenn das nicht vollständig mit den ursprünglichen Planvorhaben übereinstimmt.
Auch der Markt (d.h. der Austausch von Konsumgütern gegen Löhne) wird hier am Beginn eine Rolle spielen. Dafür gibt es zwei Gründe. Erstens fällen Konsumenten tagtäglich eine Reihe von Entscheidungen (z.B. bezüglich der Nahrungsmittel). Diese Wahlmöglichkeit muß auch weiter sichergestellt werden. Aber es wird hier nur möglich sein, in Trendgrößen zu planen, d.h. gestützt auf die Erforschung der Konsumentenwünsche und vergangenen Konsums. Doch klarerweise müssen die Arbeiter das Recht und die Möglichkeit haben, ihre Konsumbedürfnisse täglich zu ändern (und zu befriedigen).
Außerdem ist es möglich, daß sich die Konsumwünsche für bestimmte Produktarten in der Periode zwischen der Planformulierung und der Fertigstellung ändern.
Hinzu kommt, daß die Kontrolle der Lagerbestände und just-in-time-Produktionstechniken bei manchen Produkten die Herstellung nur mittel- oder langfristig mit der Nachfrage in Deckung bringen kann.
In diesen Fällen müssen sich die Konsumenten entscheiden, ob sie die Produkte zu dem Preis, der den Produktionskosten entspricht, kaufen wollen. Falls sie das nicht tun, müßte der Preis der Nachfrage angepaßt werden.
Da der Plan bereits auf der Basis einer erwarteten Nachfrage und dementsprechender Produktionsketten ausgearbeitet wurde, kann es nur eine Veränderung im Rahmen dieser Nachfragestruktur geben. Die Preise würden dann über den Kostpreis steigen bzw. unter diesen fallen, um die Produkte an die Verbraucher zu bringen.
Diese Phänomene können dann zur Erstellung der Planungsvorgaben für die nächste Periode in Rechnung gestellt werden. Marktpreise müssen in diesem Kontext Preise sein, die dazu dienen, den Markt zu bereinigen.
Sie dürfen – anders als bei den Markt-Sozialisten – nicht zu automatischen Produktionssteigerungen als Folge erhöhter Profitabilität eines Unternehmens führen. Falls das gestattet wäre, würde es zu beachtlichen Störungen des gesamten Plansystems und zu Disproportionen in der Ökonomie kommen. Daher müssen für die nächste Planungsperiode immer Überlegungen, die von der Gebrauchswertsseite und der Kalkulation der Arbeitszeit ausgehen, zentral sein.
Nachsatz: Der Triumph des Sozialismus und der Übergang zum Kommunismus
Der Sieg des Sozialismus – des niederen Stadiums des Kommunismus – kann unmöglich in einem Land errungen werden. Er wird auf globaler Ebene entstehen oder gar nicht. Der Sozialismus setzt schon voraus, daß ein bestimmtes grundlegendes Niveau der Befriedigung ökonomischer und kultureller Bedürfnisse für die gesamte Weltbevölkerung durch die Anwendung der oben dargestellten Mittel erreicht wurde.
Im Kommunismus geht die politische Ökonomie in die Verwaltung von Sachen über. Es gibt dann keinen Bedarf für eine gesonderte Sphäre der Politik mehr – die Demokratie selbst hat sich überlebt. Die Gebrauchsgüter existieren in einem derartigen Überfluß und werden mit so wenig menschlicher Arbeit hergestellt, daß die Menschen ihre Persönlichkeit in anderen Formen kreativer Verausgabung frei entfalten können.
In der Linken ist es üblich geworden, die marxistische Konzeption des Überfluß als den üblichen Zustand auf dem Sektor der Güterproduktion im Kommunismus lächerlich zu machen.
Das alte Argument, daß die menschlichen Ziele und Wünsche prinzipiell unbegrenzt und daher niemals voll befriedigbar sind, wird gegen die Möglichkeit des Überflußes in der kommunistischen Gesellschaft ins Treffen geführt.
Dieses Argument geht fälschlicherweise davon aus, daß die sozialistische Gesellschaft einfach die im Kapitalismus vorherrschenden Konsumgewohnheiten fortschreiben wird. Erstens wird die kommunistische Gesellschaft die Arbeitsproduktivität so sehr erhöht haben, daß nicht nur die grundlegenden Bedürfnisse aller, sondern auch ein gut Teil der darüber hinausgehenden für jedermann befriedigt werden können. Das wird eine Vertiefung der menschlichen Beziehungen erlauben, neue Formen des kulturellen Ausdrucks werden entstehen. Der Entwicklung der menschlichen Persönlichkeit wird generell mehr Gewicht zukommen.
Zweitens werden die langfristigen Veränderungen der Sozialstruktur im Kommunismus auch eine ganz und gar andere Psychologie der Menschen hervorbringen. Mit dem Verschwinden des Warenfetischs, der allgemeinen Konkurrenz und der heute bestehenden Notwendigkeit materieller Kompensation für die Entfremdung wird auch die heute mit den materiellen Produkten verbundene Wichtigkeit (Prestige etc.) verschwinden.
Drittens ermöglicht die bewußte Selbstverwaltung der Gesellschaft im Kommunismus die Schaffung eines langfristigen Gleichgewichts zwischen der Menschheit und der restlichen Natur.
Es wird für alle einsichtig sein, daß der Ausdehnung der Industrie (zumindest in dem Sinn, wie sie heute verstanden wird) aus ökologischen Gründen bestimmte Grenzen gesetzt werden müssen. Diese drei Elemente werden zusammengenommen eine Situation schaffen, wo der materielle Reichtum, selbst wenn es keinen absoluten Überfluß gibt, ein Niveau erreicht, wo die Akkumulation aufhört, der Motor der Gesellschaft zu sein. Statt dessen wird die menschliche Entwicklung wesentlich sozial, kulturell und psychologisch bestimmt sein.