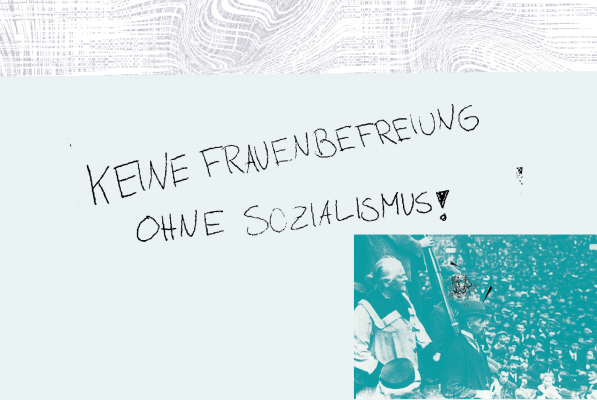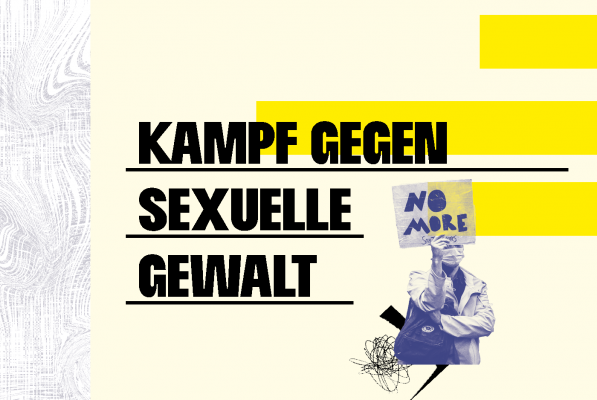Queers im revolutionären Russland

Yorrick F., Revolution Deutschland, Gruppe Arbeiter:innenmacht, Fight! Revolutionäre Frauenzeitung 13, März 2025
Für Revolutionär:innen stellt sich die Frage, wie queere Befreiung als Teil einer sozialen Revolution erreicht werden kann. Ein Blick auf die Oktoberrevolution lohnt sich – und zwar nicht, weil sie eine vollendete sexuelle Befreiung erreichte, sondern weil wir aus ihren teils fatalen Fehlern essenzielle Erkenntnisse für unsere eigene Arbeit ziehen können. Dafür haben wir uns das Buch „Homosexual Desire in Revolutionary Russia: The Regulation of Sexual and Gender Dissent“ (dt.: „Homosexuelle Wünsche im revolutionären Russland – der Umgang mit abweichender sexueller Neigung und Geschlechterzugehörigkeit“) des Autors Dan Healey (University of Chicago Press, 2001) angeschaut. Dieser ist Slawistikwissenschaftler und bekannt dafür, dass er als Erster Homosexualität im revolutionären Russland beleuchtete.
Vor der Oktoberrevolution
Um die Lage queerer Menschen im revolutionären Russland zu verstehen, muss man bei ihrer Situation im Zarenreich beginnen. Im frühen 19. Jahrhundert war gleichgeschlechtlicher Sex unter Männern nicht selten, oft aber mit Machtdynamiken verknüpft – etwa zwischen Gutsherren und Dienern oder in erschwinglicher Prostitution in Badehäusern. Zwar stigmatisiert, wurde er dennoch praktiziert, oft unter dem Deckmantel der Beichte und kirchlicher Verdammung als „Sünde“. Einvernehmliche sexuelle Handlungen zwischen Männern fanden oft in öffentlich zugänglichen, aber nicht einsehbaren Räumen statt, wie z. B. Badehäusern. Ab 1832 wurde männliche Homosexualität offiziell durch Paragraph 995 des zaristischen Gesetzbuches kriminalisiert. Schwule entwickelten geheime Codes und Treffpunkte, woraus ein homosexuelles Selbstverständnis entstand. Strafen für „Sodomie“ reichten bis zur Verbannung nach Sibirien.
Während männliche Homosexualität gut dokumentiert ist, beispielsweise durch Polizeiakten oder Gerichtsprotokolle, wurde lesbische Liebe im zaristischen Gesetz schlichtweg ignoriert, da Frauen nicht als eigenständige sexuelle Subjekte galten. Dennoch gab es geheime Zirkel, und Berichte deuten auf gleichgeschlechtliche Beziehungen in Bordellen hin. Natürlich fanden diese auch anderswo statt – nur ist dies nicht gut dokumentiert.
Die Lage für queere Personen blieb also lange prekär. Erste Öffnungen – zumindest im öffentlichen Diskurs – taten sich erst mit der Revolution 1905 auf, die im Zuge der Einführung der Staatsduma (gesamtrussisches Parlament, welches in großer Abhängigkeit vom Zaren stand) repressive Maßnahmen gegen männliche Homosexuelle zunächst in der Praxis vorübergehend lockerte. Repressionen blieben jedoch trotzdem in ihrer Härte bestehen. Die Revolution öffnete aber Möglichkeiten für queere Intellektuelle und Schriftsteller:innen, sich überhaupt erst in die zaghaft stattfindenden Debatten rund um Sexualität und Geschlechterrollen einzubringen. Auch der Fakt, dass die Bolschewiki 1905 nicht für das Frauenwahlrecht eintraten, was Lenin 1906 allerdings als Fehler wertete, zeigt, dass Fragen der geschlechtlichen und sexuellen Unterdrückung bis dato wenig Aufmerksamkeit bekamen.
Weiterhin sorgte die Februarrevolution 1917 ebenso nicht für eine Befreiung queerer Personen vom Joch der Kriminalisierung. Zwar taten sich teilweise Freiräume durch rechtliche Grauzonen unter der Doppelherrschaft auf, jedoch legte erst die von den Bolschewiki geführte Oktoberrevolution im selben Jahr den Grundstein für eine zumindest vorübergehend mögliche queere Befreiung. Vor der Oktoberrevolution spielte diese also nur eine marginale Rolle, wenngleich Homosexualität hinter verschlossenen Türen stattfand und auch entsprechend dem Gesetzbuch des Zarenreichs kriminalisiert wurde.
Die Oktoberrevolution und der Aufschwung (sexueller) Freiheit
Mit der Zerschlagung der Doppelherrschaft und der beginnenden Errichtung einer Räterepublik wurden das zaristische Gesetzbuch und der Paragraph 995 abgeschafft. Das erste Strafgesetzbuch von 1922 enthielt keinen vergleichbaren Straftatbestand. Kritiker:innen werfen den Bolschewiki vor, dies sei zufällig geschehen. Dies ist jedoch unbegründet, da die Haltung gegenüber Sexualität als Ganzer war, dass diese nun zur Privatsache erklärt wurde. Männliche Homosexualität wurde damit formal legalisiert, und die Sowjetunion war der erste Staat, der sie vollständig entkriminalisierte. Auch wenn dies als enorm großer Fortschritt und eine Errungenschaft der Oktoberrevolution zu betrachten ist, so kann hier nicht von einer tatsächlichen Befreiung von Queers durch die Oktoberrevolution gesprochen werden.
Zum einen betraf die Befreiung nur schwule Männer, aufgrund dessen, dass die Bolschewiki die sexuelle Befreiung generell eher als Nebenprodukt denn als ein tatsächliches politisches Anliegen betrachteten. Damit war die Entkriminalisierung an sich nicht weniger fortschrittlich, aber sie berücksichtigte weder homosexuelle Frauen noch trans Personen, die nicht unter das zaristische Gesetz fielen. Auch blieb Homosexualität in weiten Teilen der Sowjetunion, insbesondere in ländlichen, agrarisch geprägten Regionen, weiterhin durch bestehende bürgerliche und kirchliche Moralvorstellungen in weiten Teilen der Bevölkerung sozial geächtet und stigmatisiert. In einigen Fällen verstärkten dies lokale Agitator:innen der Bolschewiki sogar selbst, indem sie versuchten, Würdenträger der orthodoxen Kirche unter der Bevölkerung mit Verweis auf deren (vermeintliche) Homosexualität zu diskreditieren.
Auch wenn diese von den Gesetzen nicht ganz direkt betroffen waren, so öffneten sich durch die Revolution auch rechtliche Freiräume für trans Personen, welche zumindest in einigen Fällen relativ unkompliziert ihren Namen und Geschlechtseintrag in offiziellen Dokumenten ändern konnten. 1926 ermöglichte der sowjetische Staat schließlich, auf Anfrage die Änderung des Geschlechtseintrags in Pässen und anderen offiziellen Dokumenten vorzunehmen, ohne dass chirurgische Eingriffe, psychologische Gutachten oder ähnliche Anforderungen erforderlich waren. Zudem wurde staatlich finanzierte Forschung zur Frage der Intersexualität initiiert. Einige trans Personen wurden auch zu relevanten, anerkannten Persönlichkeiten innerhalb der jungen Sowjetunion, wie zum Beispiel Jewgeni Fjodorowitsch M. Bis zur Oktoberrevolution kämpfte er mit seiner sexuellen Identität und der fehlenden Unterstützung durch seine Familie. Erst die Oktoberrevolution ermöglichte es ihm, als Mann zu leben. In seiner Rolle als politischer Referent, weit weg von seinem Heimatort, zog er schließlich vor Gericht und heiratete eine Frau, die nur als „S.“ bekannt ist.
Ungenügender Kampf für queere Befreiung
Der fehlende Fokus auf sexuelle Befreiung ist besonders fatal, da es in Teilen der internationalen Arbeiter:innenbewegung bereits Beispiele gab, wie eine progressive Position in dieser Frage aussehen kann. So trat August Bebel, nach anfänglicher Homophobie, für die Streichung des Paragraphen 175 im deutschen Kaiserreich ein und arbeitete mit Magnus Hirschfeld zusammen, der die Rechte von Queeren unterstützte und mit seinem Institut für Sexualforschung eine Vorreiterrolle einnahm.
Dieser versäumte Fokus erklärt sich teilweise aus fehlenden bzw. falschen Positionen der Bolschewiki zur sexuellen Befreiung. In der Auseinandersetzung von Lenin mit Clara Zektin wird deutlich, dass Lenin eine konservative Einstellung zur Entdeckung und Auslebung einer neuen, „kommunistischen” Sexualität hatte. Für ihn stellte der stetige Wunsch nach Auseinandersetzung seitens der Jugend und Frauen mit diesem Thema eine Abgleitfläche ins bürgerliche Bewusstsein dar. Eine Überbetonung von sexuellen Fragestellungen und Auslebungen sei bürgerliche Dekadenz, ein Bedürfnis nach Rausch, das die Jugend vom revolutionären Kampf ablenken würde. Das würde nicht mit dem Ideal der kommunistischen Jugend und revolutionären Arbeiter:innenklasse zusammenpassen und die Jugend sei dadurch verdorben worden. Für Lenin war die Auseinandersetzung mit Sexualität eine Abgleitfläche in kleinbürgerliche Selbstverwirklichung. Auch wenn seine konservativen Aspekte später von der stalinistischen Rekriminalisierung überbetont wurden, war seine Haltung keineswegs fortschrittlich, denn für die Lage der Jugend waren wohl soziale Mängel der jungen Sowjetunion, wie fehlende Kinderheime oder medizinische Versorgung, entscheidender als eine eigenständige Auseinandersetzung mit Sexualität.
Dafür gibt es mehrere Gründe. Zum einen sorgte wohl die späte Übersetzung von Engels’ „Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staates”, welches die erste und grundlegende marxistische Analyse von der Rolle von Familie, Geschlecht und Sexualität für Klassengesellschaften lieferte, und damit die Notwendigkeit der genauen Beachtung dieser durch Sozialist:innen für fehlende theoretische Grundlagen. Zum anderen wurde mit der Entkriminalisierung zwar ein positiver Schritt geschaffen, aber die vorhandenen ökonomischen Bedingungen in der Anfangsphase der Sowjetunion verhinderten das Voranschreiten der Vergesellschaftung reproduktiver Tätigkeiten. Dies sorgte dafür, dass engere Familieneinheiten und somit geschlechtliche Arbeitsteilung weiter aufrechterhalten wurden. Das heißt, die materiellen Bedingungen, LGBTIA+-Diskriminierung und Frauenunterdrückung vollständig aufzulösen, waren nur mäßig gegeben. Kleinere Schritte wurden zwar begangen, wie die positive Quotierung von Frauen in Betrieben, das Errichten von Waschküchen etc., aber – und hier greift wieder fehlende theoretische Grundlage – wurden diese Schritte nicht weitergetrieben, als Kapazitäten dazu frei wurden. Gleichzeitig gab es während des Bürgerkriegs und der drohenden Konterrevolution drängende Fragen, mit welchen sich die Bolschewiki zwangsläufig eher beschäftigen mussten. Das ist verständlich, dennoch zeigen die Quellen, dass ein großes Bedürfnis innerhalb der Arbeiter:innenklasse, Jugend und Frauenbewegung danach bestand und die Unterbindung dessen einen Fehler darstellt.
Auch der Umgang von Lenin, der KPD und Clara Zetkin mit Ruth Fischer (auch unter dem Namen Elfriede Friedländer bekannt), die das Buch „Sexualethik des Kommunismus” veröffentlicht hatte, zeigt, dass diese Fragestellungen nicht ernst genommen und Kommunist:innen, die sich damit auseinandersetzten, allenfalls belächelt wurden. Wenngleich ihre Ausarbeitungen sicher nicht methodisch korrekt waren, so gab es jedoch interessante Ansätze: Sie wollte mit den Vorurteilen der monogamen Zwangsgemeinschaft und der Verteufelung der gleichgeschlechtlichen Liebe aufräumen. „Die Mehrheit der Menschen lebt polygam“ und „Homosexualität ist natürlich, ist angeboren.“
Zetkin, die in der Diskussion mit Lenin eigentlich eine progressive Position einnahm, konstatierte gegenüber Ruth Fischer, die Schrift sei „eine Liebhaberei der Intellektuellen und der ihnen nahestehenden Schichten“. Unter den klassenbewussten Proletarier:innen sei jedoch kein Platz für eine derartige „Laienstümperei“. Dies zeigt auf, wie wenig sich die kommunistische Bewegung auch außerhalb der Sowjetunion mit den Fragen der Sexualität auseinandersetzen wollte, und führte dazu, dass einige Bolschewiki Homosexualität fälschlicherweise als dekadente, bürgerliche Perversion ansahen, welche im Rahmen der stalinistischen Rekriminalisierung sogar teilweise mit dem Faschismus identifiziert wurde. So sagte 1934 Maxim Gorki: „Zerstört die Homosexuellen – und der Faschismus wird verschwinden.“ Obwohl dies nicht aktiv von den Bolschewiki vorangetrieben wurde, öffnete sich in der Forschung zu Geschlecht und Sexualität Raum für progressive Ergebnisse, wie die von Grigorii Batkis, der Sexualität und Geschlecht als Spektrum betrachtete. Queere, insbesondere trans Personen, wurden jedoch weiterhin stigmatisiert und pathologisiert. Auch sah die Forschung sie meist als Forschungsobjekt, nicht jedoch als vollwertiges Subjekt an.
Degeneration der Revolution und Rekriminalisierung unter Stalin
Mit Lenins Tod und Stalins Machtübernahme als Ausdruck der Degeneration der Sowjetunion zu einem degenerierten Arbeiter:innenstaat änderte sich die sowjetische Politik gegenüber queeren Personen grundlegend: Homosexualität wurde erneut kriminalisiert und geächtet.
Kurz nach Stalins Amtsbeginn wurde Homosexualität schrittweise immer weiter, auch von öffentlich auftretenden Parteimitgliedern, stigmatisiert und vermehrt zu einer bürgerlich dekadenten Abnormalität erklärt. Dies gipfelte 1934 in der Rekriminalisierung von Homosexualität durch einen neuen Paragraphen in der RSFSR (Russische Sozialistische Föderative Sowjetrepublik), welcher bis zu 5 Jahre Haftstrafe für sog. „Sodomie“ veranschlagte. Dies war jedoch kein einfaches „Zurückkehren“ zu der Zeit vor 1917, sondern vielmehr ein Ausdruck und eine Vermengung mit anderen Elementen der stalinistischen Degeneration.
Die ausbleibende Revolution in Westeuropa (z. B. Deutschland 1918/23), Isolation der Sowjetunion, Bürgerkrieg und ökonomische Krise führten zur Herausbildung einer Bürokrat:innenkaste mit Stalin an der Spitze. Diese leitete einen politischen Kurswechsel ein und zerschlug die linke Opposition unter Trotzki. Statt die Sowjetunion als Keimzelle der permanenten Weltrevolution zu sehen und damit den Fokus auf die Unterstützung der Siege der Arbeiter:innenbewegungen international zu lenken, fokussierte man sich auf eine Koexistenz mit den imperialistischen Staaten und sah etwa die Internationale eher als verlängerten Arm sowjetischer Außenpolitik an als als ein der Sowjetunion untergeordnetes Organ der internationalen Arbeiter:innenbewegung. Diese degenerativen Entwicklungen wurden auch durch einige revisionistische Schwankungen der offiziellen Ideologie wie etwa der „Theorie des Sozialismus in einem Land“ theoretisch nachträglich gerechtfertigt. Im Zuge der nun entstehenden Notwendigkeit für die Sowjetunion, auch mit den imperialistischen Staaten im Weltmarkt und in der Politik wettbewerbsfähig zu bleiben, sowie der Vorbereitung auf drohende Kriege wurde die Familienpolitik geändert. Vor diesem Hintergrund wurden Homosexuelle kriminalisiert und gesellschaftlich geächtet. Die Sowjetunion wollte mit imperialistischen Staaten konkurrieren und bereitete sich auf Kriege vor, was eine Änderung der Familienpolitik mit sich brachte: Frauen wurden ins Private gedrängt, ihre Rolle als Mutter wurde betont, Abtreibung wurde verboten.
Diese Propagierung der bürgerlichen Kleinfamilie war nicht gleichzeitig möglich mit der Anerkennung und Nichtkriminalisierung von queeren Personen. Diese wurden nicht nur wieder kriminalisiert, sie waren auch öffentlich wieder verstärkt sozial geächtet und galten als westlich-bürgerlicher Einfluss und damit als mögliche „konterrevolutionäre Elemente“. Dies ging so weit, dass man den deutschen Faschismus durch angenommene sexuelle Orientierungen von z. B. Ernst Röhm anzugreifen versuchte.
Der Rekriminalisierung fielen – als Opfer von halböffentlichen Schauprozessen zur Einschüchterung der queeren Szene in den Städten und anderer juristischer Verurteilungen, welche bis zur Arbeitslagerhaft reichten – mindestens acht- bis zehntausend Personen zum Opfer. Natürlich ist die Dunkelziffer viel höher, insbesondere deshalb, da die gesellschaftliche Ächtung und Zurückdrängung aus der Öffentlichkeit nicht in Zahlen bemessen werden kann. Auch queere Personen in anderen degenerierten Arbeiter:innenstaaten müssen zu ihnen gezählt werden, da auch diese – zumindest zeitweise – von der stalinistischen Kriminalisierung betroffen waren. So etwa in Kuba, wo durch stalinistischen Einfluss nach der Revolution antihomosexuelle Gesetze eingeführt wurden, die es vorher in der Form nicht gab. Auch noch in den 1980er Jahren wurden Homosexuelle teilweise verfolgt unter dem Vorwurf der „Korrumpierung der Jugend“. Homosexualität wurde erst nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 wieder formell legalisiert.
Was können wir daraus lernen?
Die Oktoberrevolution zeigt also kein Bild vollständiger queerer Befreiung. Dennoch bleibt sie im Kampf für sexuelle Befreiung und Gerechtigkeit eine der größten Errungenschaften des letzten Jahrhunderts. Sie zeigt, dass – selbst unter dem Einfluss eines falschen Bewusstseins bezüglich des Charakters von Sexualität und Geschlecht – der Sozialismus die materielle Basis schaffen kann, auf welcher queere Befreiung stattfinden kann. Um für die größte Errungenschaft dieses Jahrhunderts selbst sorgen zu können, müssen wir aus den Erfahrungen der Vergangenheit lernen und analysieren, was es gebraucht hätte. Hierfür zu nennen wären neben dem konsequenten Kampf gegen die Bürokratie und die Degeneration des sich aufbauenden Arbeiter:innenstaates (was wir unter diesem verstehen, ist in der Kürze dieses Artikels nicht zu beantworten) der bewusste Kampf für sexuelle Befreiung sowie die Vergesellschaftung der Hausarbeit. Insbesondere die Verbindung aus Homosexuellen- und Frauenbewegung war sehr lose und nicht mit der proletarischen Frauenbewegung verknüpft. Dies hätten auch die Bolschewiki erkennen müssen: Die fehlende Übersetzung von wichtigen marxistischen Grundlagentexten sowie das teils in diesen Fragen sehr reaktionäre Klima im zaristischen Russland – und damit zwangsläufig auch als Überbleibsel in einigen Köpfen der Bolschewiki – standen dem jedoch im Weg. Wie wir insbesondere bei der Rekriminalisierung sowohl von Abtreibungen als auch von Homosexualität gesehen haben, hängen beide Kämpfe jedoch untrennbar miteinander zusammen, damals wie heute. Den Kampf für eine befreite Gesellschaft müssen wir dabei bewusst auch gegen bestehende Diskriminierungen führen, sie schaffen sich nicht automatisch, von allein ab!