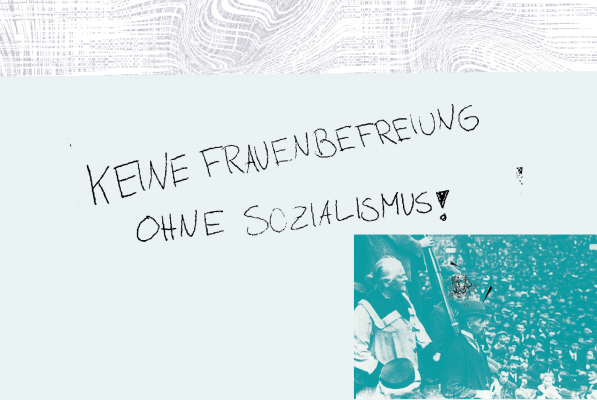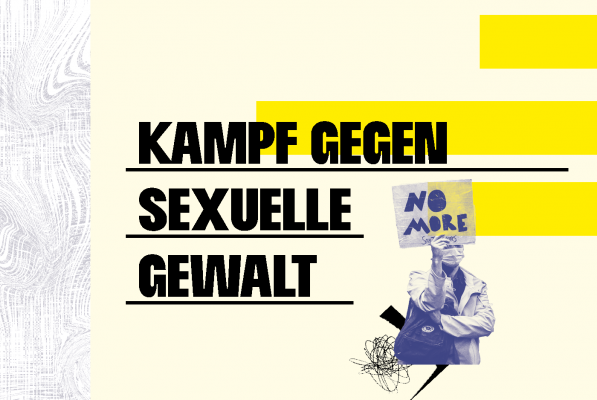Berliner Haushalt: Sparzwang geht weiter
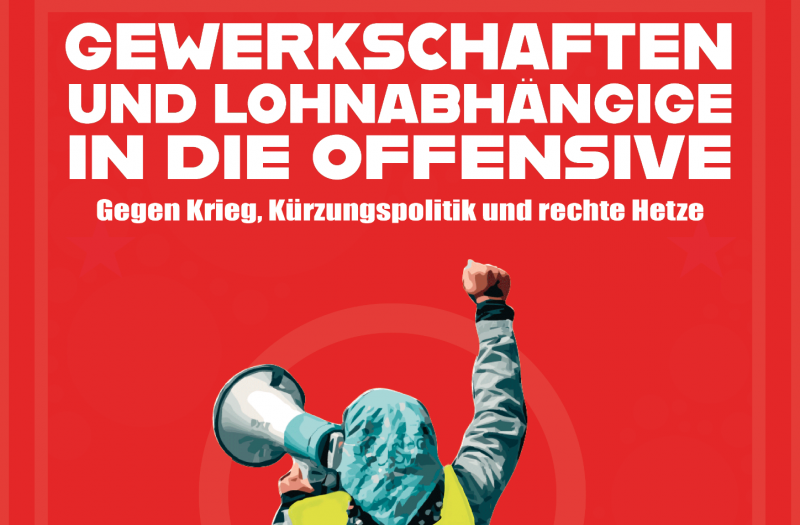
Jaqueline Katherina Singh, Neue Internationale 295, Oktober 2025
Nachdem für 2025 ein Nachtragshaushalt mit drei Milliarden Euro Einsparungen beschlossen wurde, wird nun über den Doppelhaushalt 2026/27 diskutiert. Während in den letzten Monaten deutlich seitens der Schwarz-Roten Koalition gesagt wurde, dass der Etat nicht viel besser werden wird, versucht man nun, die Lage schönzureden. Der Wahlkampf steht ja vor der Tür – und das Land Berlin will laut dem Senatsentwurf in den beiden Jahren rund 44 Milliarden Euro ausgeben – etwa 4 Milliarden mehr als im laufenden Jahr. Das sind rund 10 % mehr – möglich durch gelockerte Schuldenbremse und weitere Kredite. So kommt es zu Schlagzeilen wie „Neue Rekordausgaben und mehr Schulden“.
Damit wird unterschwellig vermittelt, dass die Kürzungen gar nicht so schlimm sein können – schließlich wird ja mehr Geld ausgegeben. Doch diese Darstellung stimmt nicht. Denn faktisch muss die Berliner Politik 2026 und 2027 laut den bisherigen Planungen mit insgesamt rund 1,6 Milliarden Euro weniger auskommen. Doch Wirrwarr entsteht vor allem auch darum, weil es gar nicht im Interesse der Regierung liegt, einen klaren Überblick zu geben. Wie tief werden die Einschnitte 2026/2027 sein – und wie viel bleibt erhalten, wenn Widerstand nicht laut wird?
Einschnitte im Haushalt 2025
Im November 2024 beschloss der Berliner Senat den Nachtragshaushalt 2025. Seine 3 Milliarden Euro Einsparungen haben besonders folgende Bereiche getroffen:
- Verkehr und Umwelt: Einsparungen um 18,5 % des Etats = 660 Millionen;
- Jugend und Familie: Einsparungen um „nur“ 7 % = 369 Millionen;
- Kultur: etwa 130 Millionen.
- Hochschulen sind betroffen, ebenso wie Projekte der kulturellen Bildung und Teilhabe. Einrichtungen, die oft ohnehin schon mit knappen Budgets arbeiten, müssen sich auf Ausfälle einstellen.
Während der Senat für Inneres wenig Geld opfern musste, wurde natürlich an Infrastruktur, Kultur und Sozialem gespart. Ganze Felder sozialer Arbeit, Prävention und Kultur laufen Gefahr, zurückgefahren oder gar eingestellt zu werden. Wen diese Kürzungen in erster Linie treffen, ist klar: die Arbeiter:innenklasse. Denn es sind nicht Kinder von Professor:innen oder Bossen, die sich den Eintritt in Museen, Theater oder Konzertsäle nicht mehr leisten können. Auch ist der Ärzt:innen- oder Lehrer:innenmangel vor allem in ärmeren Bezirken groß, während es andernorts einen Überschuss gibt. Die Arbeiter:innenklasse ist daher dauerhaft unterversorgt, denn die Reichen können sich private Gesundheitsversorgung oder teure Privatschulen leisten. Durch die Sparmaßnahmen ist also eine Kultur des Elitären und Autoritären in der Mache.
Der aktuelle Plan
Der Senat hat den Entwurf für den Doppelhaushalt im Juli beschlossen. Im Dezember will das Abgeordnetenhaus darüber abstimmen. Die Pressemitteilung vom 22.07.2025 beginnt schon mit dem geheuchelten Titel „Zielgerichtete Investitionen und Stabilisierung des Haushalts haben Priorität“. Dann wird verkündet, dass das Haushaltsvolumen für 2026 knapp 44,4 Milliarden Euro und für 2027 rund 45,3 Milliarden Euro beträgt. In bereinigter Form sind das Ausgaben in Höhe von rund 43,8 Milliarden Euro für das Jahr 2026 und 44,6 Milliarden Euro für das Jahr 2027. Damit ist dies der Haushalt mit dem größten Volumen in den letzten Jahren – obwohl sich der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) in der Vergangenheit über die Misswirtschaft der vergangenen Regierungen beschwerte. Begründung: „Ein wesentlicher Ausgabentreiber sind die stark steigenden Transferausgaben. Hinzu kommen deutlich höhere Ausgaben für die Wohnungsbauförderung des Landes.“ In der Praxis bedeutet dies, dass der Haushalt wächst, aber frei verfügbare Mittel schrumpfen. Viel Geld geht automatisch in „Pflichtausgaben“. Für „freiwillige Leistungen“ wie Kultur, Jugendprojekte, Stadtteilzentren, Teilhabe oder Umwelt bleibt daher weniger Spielraum – auch wenn die Gesamtsumme des Haushalts größer aussieht.
Oder anders gesagt: Das Geld fließt in Posten wie „Modernisierung der Ausstattung bei Polizei und Feuerwehr“ oder in das unzureichende Wohnungsbauförderungsprogramm, was die Berliner Wohnungskrise in keiner Form lösen wird. Diese werden vorgeschoben, um die Kürzungen in anderen Bereichen zu rechtfertigen. Gleichzeitig gibt es dann noch ein paar Vorzeigeprojekte wie das der Charité, um zuzusagen, dass diese ein neues Krankenhausinformationssystem anschaffen kann, oder das der BVG, um Busse zu kaufen.
Verwirrungstaktik: Was kommt nun?
Wo wirklich der Rotstift angesetzt wird, ist nicht klar kommuniziert. Man kann aus dem Dokument des Landeshaushalts z. B. unter dem Punkt Jugendarbeit nicht herausfinden, welche Träger konkret von Kürzungen betroffen sein werden. So können betroffene Projekte schwer Widerstand organisieren, eine perfide Hinhalte- und Verwirrungstaktik wie schon beim letzten Haushalt. Dort wurden im September die ersten Kürzungspläne bekannt – und die Spaltung begann. Während sich die großen kulturellen Institutionen versuchten, selber zu retten, trafen so die Kürzungen vor allem kleinere Projekte.
Letzten Endes ist im ganzen Zahlenwirrwarr nicht klar, was genau betroffen ist. Dabei bräuchte es eine klare Auflistung, was der aktuelle Haushalt an Einschnitten bedeutet – für alle Bereiche. Beispielsweise heißt es in der Erklärung Der Linken Berlin bezüglich der Kürzungen bei Umwelt- und Klimaschutz, dass der Reparaturbonus sowie das Parkläufer:innen-Projekt ersatzlos wegfallen und beim Kleingewässerprogramm, essenziell für die Artenvielfalt, die Mittel von 4 Millionen auf nur noch 800.000 Euro gekürzt werden. Insgesamt bedeutet die geplante Kürzung des Berliner Energie- und Klimaschutzprogramms (BEK) um bis zu 80 Prozent dessen weitgehende Abschaffung. Umweltschutz wird so zum Papiertiger degradiert. Aus Artikeln des rbb geht hervor, dass das Sozialticket (seit April 2025 19 Euro teuer, davor 9 Euro) 27,50 Euro kosten soll – wieder so viel 2022.
Unklarheit wird genutzt, um Widerstand zu schwächen – und zusätzlich spielen sich Projekte und Ressorts gegeneinander aus. Und auch mit anderen Tricks wird sich geholfen: Von nun an bekommen einzelne Senatsverwaltungen feste Budgets für ihre Bereiche und müssen – anders als bisher – für ihre Bereiche auch Lohnsteigerungen, etwa durch neue Tarifabschlüsse, selber finanzieren. So scheint es, dass einzelnen Ressorts damit zunächst mehr Geld zugeteilt wird – aber nur, weil sie mehr Personal beschäftigen. Beispielsweise die Senatsverwaltung für Bildung: Mit all ihren Lehrkräften hat sie auf dem Papier in diesem Jahr 5,4 Milliarden Euro zur Verfügung, 2027 dann sogar knapp 5,5 Milliarden Euro. In Wirklichkeit ist das nur durch Personalabbau ausreichend.
Kein isoliertes Problem
Der Nachtragshaushalt 24/25 sah vor, Einnahmen zu schaffen – etwa durch die Erhöhung der Vergnügungs-, der Zweitwohnungs- und der Übernachtungssteuer. Was daraus bleiben wird, ist unklar – zeigt aber auch eine Doppelmoral der Kürzungsdebatte auf. Denn während Wegner letztes Jahr von der Misswirtschaft des rot-rot-grünen Senats sprach und den Rotstift so ansetzte, dass überwiegend bei Sozialleistungen und Kultur weggestrichen wird, bleiben 1 Milliarde nicht eingetriebene Steuerrückstände. Ebenso liegt die Grunderwerbsteuer niedriger als in Brandenburg. Die Abgeordnetendiäten betragen 7.249 Euro plus steuerpflichtige Kostenpauschale von 3.184 Euro obendrauf – pro Monat.
Die Kürzungen bilden einen politischen Angriff auf die (kleinen) Errungenschaften der R2G-Koalitionen und stimmen darauf ein, was uns im Bundesgebiet mit einer schwarz-roten Regierung erwartet. Das Motto lautet: „Die fetten Jahre sind vorbei.“ Genauer trifft die Formulierung: Sie sind für die Herrschenden vorbei und jetzt, wo ihre Profite sinken, wird angefangen, noch mehr zu knausern. Das, was jetzt passiert, ist also nur der Anfang, zeigt aber auf, dass es Zugeständnisse nicht so einfach geben wird. Wenn wir Kürzungen abwehren wollen, brauchen wir also eine hohe Kampfkraft – und müssen verstehen, dass die kommenden Tarifrunden wie der TV-L oder die Auseinandersetzungen bei der BVG auch einen politischen Charakter tragen müssen!
In den Medien können wir lesen, dass die deutsche Wirtschaft schwächelt. Deswegen soll bei uns gekürzt werden, um zu ermöglichen, dass 1. die Profite der Reichen aufrechterhalten und 2. Geld in massive Aufrüstungsprogramme gesteckt werden kann. Beides verfolgt den Zweck, den deutschen Imperialismus in der internationalen Konkurrenz in eine bessere Stellung zu bringen – jedoch auf dem Rücken der Arbeiter:innen und Unterdrückten. So ein Generalangriff ist somit nicht in unserem Interesse, sondern in dem der Herrschenden. Wir haben nichts zu gewinnen in Kriegen, die um Einflusssphären geführt werden, oder wenn die Reichen immer reicher werden. Deswegen können die Angriffe, auch wenn sie vielleicht nicht alle gleichzeitig auftreten, nicht als individuelle verstanden werden. Was also tun?