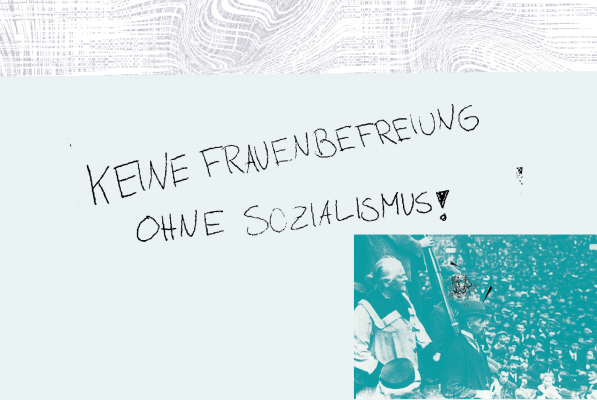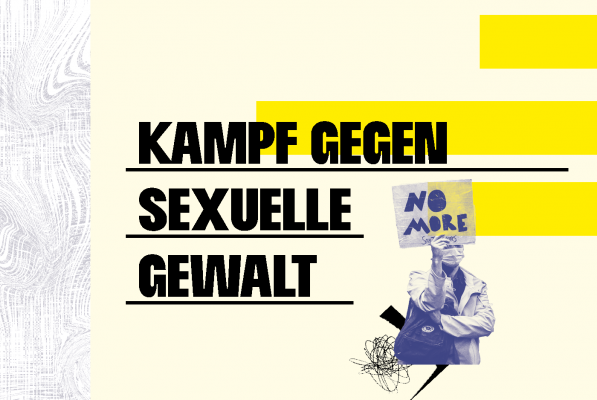Behinderung und Kapitalismus

Matthew Smyth/Andy Yorke, Infomail 1288, 24. Juli 2025
Eine marxistische Analyse zeigt, dass die Marginalisierung und Diskriminierung von Menschen mit Behinderung untrennbar mit dem Kapitalismus selbst und der Ausbeutung der Arbeiter:innenklasse als Ganzes verbunden ist. Diese Situation hat sich historisch entwickelt, und in den letzten Jahrzehnten hat es dank der Kampagnen von Verbänden behinderter Menschen einen grundlegenden Wandel gegeben: von der Segregation in oft barbarischen Einrichtungen wie Anstalten hin zu einem unabhängigen Leben in der Gemeinschaft und einer begrenzten Integration in die Arbeitswelt, unter einem System von Sozialleistungen und profitorientierten Pflegeanbieter:innen.
Dieses System war von Anfang an unterfinanziert und unzureichend und seit jeher von Kürzungen bedroht. Die britische Regierung Starmer droht nun mit einer weiteren Kürzungsrunde und behauptet, solche Maßnahmen seien „nicht nachhaltig“ und würden „Arbeitsanreize verringern“.
Der Kapitalismus hat die Bedingungen, die Infrastruktur, den Reichtum und die Wissenschaft geschaffen, um Menschen mit Behinderungen sowie Frauen und andere unterdrückte Gruppen zu befreien, aber seine Grundlagen wie Privateigentum, Profit und die kontinuierliche Akkumulation von Kapital verhindern dies. Das jetzige Zeitalter des Niedergangs des Kapitalismus als Produktionsweise mit jahrzehntelang stagnierenden oder sinkenden Profitraten in der Produktion hat zu einer Verschärfung der Krise, zu Sparmaßnahmen und Reaktionen geführt, da vergangene Errungenschaften untergraben oder rückgängig gemacht werden.
Eine wirtschaftliche Analyse der Beziehung von Menschen mit Behinderung zum Kapital ermöglicht es uns, die zugrunde liegenden Beziehungen zu verstehen, die die Politik und die Einstellungen bis heute geprägt haben, und zeigt, dass der Weg zur wahren Befreiung von Menschen mit Behinderung nicht über Stückwerkreformen des Kapitalismus führen kann, sondern nur über eine sozialistische Revolution.
Die Mobilisierung zur Verteidigung der bereits errungenen Rechte ist Teil des Kampfes für den Wiederaufbau der Arbeiter:innenbewegung auf der Grundlage eines Übergangsprogramms, das von den heutigen Kämpfen – einschließlich der Rechte von Menschen mit Behinderung auf Arbeit, auf gleiche Bezahlung oder Leistungen in Höhe des Vollzeitmindestlohns und zur Deckung der zusätzlichen Lebenshaltungskosten – zum Sturz des Kapitalismus und zur Schaffung einer sozialistischen Gesellschaft führt.
Was ist Behinderung?
In der öffentlichen Wahrnehmung wird Behinderung meist auf die extremsten oder offensichtlichsten Formen beschränkt, die oft die Arbeitsfähigkeit einschränken oder gar ausschließen: körperliche Behinderungen, Blindheit und Gehörlosigkeit oder schwere, langfristige psychische Erkrankungen wie Schizophrenie. In Wirklichkeit gibt es jedoch ein Spektrum von Behinderungen, darunter auch „versteckte“, und diese Zustände stellen den Punkt dar, an dem eine zunehmende Beeinträchtigung die Grenze zur Arbeitsunfähigkeit überschreitet, zumindest ohne umfangreiche und kostspielige Anpassungen.
Dieses Konzept lässt Verletzungen und Zustände außer Acht, die semipermanent, langfristig und unterstützungsbedürftig sind, unabhängig davon, ob sie angeboren, durch das Arbeitsleben entstanden sind oder mit zunehmendem Alter auftreten. In jüngerer Zeit ist das Bewusstsein für häufige kognitive Beeinträchtigungen gewachsen, die einfach normale menschliche Unterschiede widerspiegeln können: Etwa 1,5 Millionen Menschen im Vereinigten Königreich haben eine Lernschwäche; 700.000 (mehr als eine/r von 100) sind autistisch. Neben dieser Form der Neurodiversität gibt es eine weitere „unsichtbare“ Beeinträchtigung, nämlich die zunehmende Zahl von Menschen, die vom chronischen Erschöpfungssyndrom (Myalgische Enzephalomyelitis/Chronisches Fatigue-Syndrom; ME/CFS) betroffen sind, schätzungsweise 250.000 Erwachsene und Kinder.
In Großbritannien fallen lohnabhängig Beschäftigte (sowie Bewerber:innen, Auftragnehmer:innen und Selbstständige) unter das Gleichstellungsgesetz von 2010 (Equality Act 2010; EA), das Menschen mit einer Vielzahl von Beeinträchtigungen abdeckt, von angeborenen Behinderungen bis hin zu langfristigen Erkrankungen oder Verletzungen, die die Arbeitsfähigkeit beeinträchtigen. Diese weit gefasste rechtliche Definition bedeutet, dass laut den neuesten Zahlen des DWP (Department for Work & Pensions; staatliche Arbeitsvermittlung und Rentenversicherung) 24 % der britischen Bevölkerung oder 16,1 Millionen Menschen eine Behinderung haben. Die Ausgaben für Behindertenleistungen sind seit der Pandemie um ein Drittel auf 48 Milliarden Pfund gestiegen und werden laut dem thatcheristischen, neoliberalen Wirtschaftsforschungsinstitut Institute for Fiscal Studies (IFS) bis 2028/2029 voraussichtlich erneut auf 63 Milliarden Pfund ansteigen.
Der Anstieg der registrierten Behinderungen wird häufig auf die höhere Lebenserwartung und altersbedingte Erkrankungen wie Alzheimer zurückgeführt. Weitere Faktoren sind jedoch die höhere Lebenserwartung von Babys mit schweren Behinderungen, die steigende Zahl von Menschen mit Behinderungen im erwerbsfähigen Alter und die stark zunehmenden psychischen Belastungen.
Für viele dieser Erkrankungen, wie Zwergwuchs, Downsyndrom und Gehunfähigkeit, ist das Stigma, das mit ihrer Sichtbarkeit verbunden ist, größer als der Grad der Beeinträchtigung. Diese Erkrankungen existieren auf einem Spektrum, das in das übergeht, was als „nicht behindert“ angesehen wird. Die Grenze liegt in der Abhängigkeit von Sozialleistungen aufgrund von Arbeitsunfähigkeit oder Arbeitsanpassungen, d. h. in den sozialen Produktionsverhältnissen des Kapitalismus.
Wo endet also die menschliche Vielfalt und wo beginnt Behinderung? Handelt es sich lediglich um ein soziales Konstrukt, das durch den Kampf um Sozialleistungen und eine Änderung der Einstellungen der Menschen abgeschafft werden kann? Eine marxistische Analyse weist darauf hin, dass Behinderung eine Form der systematischen Diskriminierung ist, die grundlegend im Kapitalismus verwurzelt ist und aus seinen Produktionsverhältnissen hervorgeht.
Kapitalismus und Behinderung
Im Kapitalismus ist alles, was produziert wird, eine Ware, sogar die Arbeitskraft. Wie Marx entdeckte, diszipliniert das durch den Wettbewerb verwirklichte Wertgesetz alle Kapitalist:innen, wobei der Wert einer Ware durch die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit bestimmt wird, die zu ihrer Herstellung erforderlich ist. Diese basiert wiederum auf einem/r durchschnittlichen Arbeiter:in, der/die mit einer typischen Maschinenausstattung, einer durchschnittlichen Arbeitsintensität und einem durchschnittlichen Qualifikationsniveau arbeitet.
Einige Kapitalist:innen können diesen Durchschnitt „übertreffen“, indem sie in bessere Maschinen investieren und die Produktivität ihrer Arbeiter:innen erhöhen, andere bleiben hinter dem Durchschnitt zurück, verlieren Gewinne und gehen bankrott. Einige kleine Firmen zu Beginn der industriellen Revolution wurden zu riesigen Monopolen, dann zu multinationalen Konzernen, da sich das Kapital durch diesen Prozess konzentrierte und zentralisierte, der in der neoliberalen „Globalisierungsphase“ wie nie zuvor weltweit stattfand.
Die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit ist der Prüfstein des Kapitals in all seinen Beziehungen zu den Arbeiter:innen. Sie umfasst nicht nur die Zeit, die notwendig ist, um den Wert zu produzieren, der zur Bezahlung der Arbeiter:innen dient, sondern im Gegensatz zu jeder anderen Ware sind die Arbeiter:innen in der Lage, neuen Wert zu produzieren, einen „Mehrwert“, der über ihren Lohn hinausgeht (der unser Wert für den/die Kapitalist:in ist, der Preis, den wir erhalten und der vom Arbeitsmarkt bestimmt wird). Dieser Mehrwert ist die Quelle des Profits der Kapitalist:innen.
Die Konkurrenz zwischen Kapitalist:innen und letztlich kapitalistischen Staaten zwingt sie, ihre notwendige Arbeitszeit zu senken, um die Mehrarbeitszeit zu erhöhen, die Mehrwert produzieren kann. Daher erhöht die Beschäftigung von Lohnabhängigen, die länger brauchen oder mehr Anpassungen des Fixkapitals benötigen, um einen ihren Löhnen entsprechenden Wert zu produzieren (oder von denen dies angenommen wird), die notwendige Arbeitszeit dieses bestimmten Unternehmens oder dieser bestimmten Nation. Daher wollen alle Kapitalist:innen, dass ihre Regierungen Arbeiter:innen mit Behinderungen saus der Produktion ausschließen, um ihre Profite zu schützen.
Historisch gesehen wurden Arbeiter:innen, die über ein bestimmtes Mindestmaß hinaus krank oder noch schlimmer verletzt und dauerhaft arbeitsunfähig waren, entlassen. Das Gesetz zwingt die Unternehmen nun, Krankheit bis zu einem gewissen Grad zu tolerieren, weshalb Chef:innen diesen Aspekt der Arbeit streng überwachen.
Es gibt einen ständigen Kampf der Unternehmer:innen, sich ihren Verpflichtungen zu entziehen und Entlassungen, Kontrollen von krankheitsbedingten Fehlzeiten, „Leistungsbeurteilungen“ sowie Schikanen und Mobbing einzusetzen, um Arbeiter:innen mit Behinderungen loszuwerden. Um diese zusätzlichen Kosten zu umgehen, haben sich Null-Stunden-Verträge und andere Formen prekärer Arbeit entwickelt.
Nach dem Gleichstellungsgesetz kann ein/e Arbeitgeber:in eine verletzte oder psychisch kranke Arbeitskraft erst nach einigen Monaten entlassen, wenn keine „angemessenen Anpassungen“ (rechtlich gesehen eine sehr niedrige Hürde) möglich sind, d. h., wenn diese zu sehr zulasten der Profite gehen. Britische Firmen rebellieren derzeit gegen das sehr moderate Employment Rights Bill (Beschäftigungsrechtsgesetz) der Labourpartei, das vorsieht, das Recht auf Krankengeld ab dem ersten Arbeitstag auszuweiten, auch wenn dieses auf dem Niveau des gesetzlichen Mindestkrankengeldes bleibt.
Ein/e Arbeiter:in, der/die aufgrund einer Verletzung oder psychischen Erkrankung häufig fehlt, ist ein Risiko, das der/die Kapitalist:in angesichts der Nachfrage nach Arbeitskräften und der nun gesetzlichen Rechte kalkuliert – oft ist eine Langzeiterkrankung ein Vorwand, um eine/n ältere/n Beschäftigte/n oder ein Gewerkschaftsmitglied loszuwerden. Menschen mit einer dauerhaften Behinderung, von denen der/die Kapitalist:in weiß, dass sie niemals zum Durchschnittslohn arbeiten können – oder diejenigen, die überhaupt nicht arbeiten können und darüber hinaus staatliche Unterstützung benötigen, die als Steuern von ihren/seinen Profiten abgezogen wird –, wurden jedoch schon immer als reine Belastung angesehen.
Trotz der vielen verschiedenen Formen von Behinderung, von Gehörlosigkeit bis Lähmung, von Depression bis Demenz, werden alle nach diesen beiden gnadenlosen Kriterien beurteilt: Mehrwertproduktion oder Steuerbelastung für Kapitalist:innen. Daher werden in der unternehmensfreundlichen Presse und unter den politischen Parteien ganz offen die unmenschlichsten, an Barbarei grenzenden Maßnahmen gegenüber Menschen mit Behinderung diskutiert und in bestimmten Zeiten umgesetzt, was die in der Gesellschaft tief verwurzelten Vorurteile noch verstärkt.
In früheren Produktionsweisen gab es keine solche Identität oder Bezeichnung von Behinderung. Sie entstand ganz natürlich aus der kapitalistischen Ideologie des isolierten, selbstständigen „Individuums“, das auf Eigentum und der Teilnahme am anonymen Markt basiert, mit der Familie als Konsumeinheit, deren unbezahlte weibliche Hausarbeit in privaten Häusern verborgen bleibt.
Im Kapitalismus wird Behinderung einfach als individuelles Merkmal angesehen, das in den Genen, der Psyche oder den Verletzungen einer Person liegt. In Wirklichkeit wird sie jedoch in viel größerem Maße durch das Eigentums- und Profitstreben des kapitalistischen Systems bestimmt, dessen soziale Beziehungen, Institutionen und herrschende Ideologie die Einstellungen der Bevölkerung prägen und untermauern.
Im Gegensatz dazu betrachten Gesellschaften wie die Massai-Hirt:innen im Urkommunismus Menschen mit einer Behinderung nicht als eine einheitliche Kategorie, der sie mit standardisierten Verhaltensweisen begegnen. Menschen mit einer angeborenen Behinderung oder einer erworbenen Beeinträchtigung, wie beispielsweise einer Jagdverletzung, sind in der Regel etwas benachteiligt, werden jedoch bis zu einem gewissen Grad von der Großfamilie oder der Verwandtschaft geschützt. In vorkapitalistischen Klassengesellschaften gab es ebenfalls keine einheitliche Bezeichnung, aber zumindest unter den Eliten scheinen Stigmatisierung und Bloßstellung bei sichtbaren, schweren Behinderungen sowohl in Griechenland als auch in Rom weit verbreitet gewesen zu sein.
In der Bäuer:innenschaft gab es kooperativere Formen der Produktion aller lebensnotwendigen Güter auf der Grundlage des Haushalts, sodass Menschen mit Beeinträchtigungen immer eine Beschäftigung finden konnten und somit eine nützliche Rolle spielten. Dies schließt Kindesmord, Vernachlässigung, Vorurteile oder Mobbing nicht aus, und natürlich starben viele Menschen aufgrund ihrer Behinderung in der Kindheit, die heute ein Erwachsenenleben führen würden.
Unter dem Kapitalismus wurde die Unterdrückung von Menschen mit Behinderung jedoch systematisiert, wobei der Schwerpunkt auf dem/r einzelnen, an den/die Kapitalist:in gebundenen Arbeiter:in liegt, deren/dessen Produktivität anhand der eisernen Regel der gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit gemessen wird. Die kapitalistische Ideologie stigmatisiert diejenigen, die nicht arbeiten (außer den Reichen!), und die Kernfamilie ist zu schwach, um jemanden zu unterstützen, der/die nicht arbeiten kann, selbst mit der unbezahlten Arbeit der Frauen. Beides trägt dazu bei, Vorurteile und Stigmatisierung in der Arbeiter:innenklasse zu verbreiten.
Seit den Anfängen des Kapitalismus gilt außerdem der Grundsatz, dass diejenigen, die nicht arbeiten, weniger als den Lohn der am schlechtesten bezahlten Arbeit erhalten müssen – sei es in Armenhäusern oder in Form moderner Sozialleistungen –, da dies sonst die Disziplin untergraben und die Menschen von der Arbeit „abhalten“ würde. Der Niedergang des Kapitalismus bedeutet nun, dass die Arbeiter:innenschaft erneut diszipliniert und die Sozialleistungen gekürzt werden, um die Profitraten zu steigern, was die Position behinderter Menschen in der Gesellschaft weiter schwächt und ihre Diskrimierung und Ausgrenzung vertieft.
Vom Armenhaus zum Proletariat
Der Kapitalismus hat im Laufe von Hunderten von Jahren verschiedene Entwicklungsstadien durchlaufen, von der primitiven Kapitalakkumulation auf der Grundlage von Sklaverei, Enclosure (Einhegung des Gemeindelandes und seine Verwandlung in Privatbesitz, Vertreibung der Bäuer:innenschaft von ihrer Scholle, also deren Enteignung zwecks Schaffung eines Proletariats) und Kolonialisierung bis hin zur industriellen Revolution und zum Imperialismus. Dies hat die Art und Weise verändert, wie der Kapitalismus mit den Ansprüchen und Rechten von Menschen mit Behinderung umgeht.
Mit der Entwicklung des Kapitalismus wurden die Armengesetze aus der Tudor-Zeit zu einem Hindernis, um die Landbevölkerung, deren Land enteignet worden war, zur Arbeit oder Abwanderung zu zwingen, was durch brutale Gesetze gegen Landstreicherei noch verschärft wurde. Ende des 17. Jahrhunderts entstanden Armen- oder Arbeitshäuser, um die arbeitsunfähigen Armen unterzubringen, darunter „die Kranken, die Geisteskranken, die Behinderten und die Alten und Gebrechlichen“, wie es damals hieß. Die „Reformen“ des Armenrechts von 1834 verbanden „Hilfe“ (in Wirklichkeit eine Ration) ausdrücklich mit dem Eintritt in ein Arbeitshaus und der Unterwerfung unter dessen Disziplin, die „die Armen mit unglaublicher Grausamkeit behandelte“ (Engels). Mit der industriellen Revolution wurde diese Institution jedoch an den Rand gedrängt.
Pauline Morris schreibt in ihrer einflussreichen Geschichte der Institutionalisierung „Put Away – Institutions for the Mentally Retarded“, dass „die Funktionsweise des Arbeitsmarktes im 19. Jahrhundert Menschen mit Behinderungen aller Art effektiv an den unteren Rand des Marktes drängte, und es ist klar, dass unter den Heerscharen von Mittellosen und Landstreicher:innen, die im viktorianischen England existierten, viele waren, die in die Kategorie der ‚Schwachsinnigen‘ fielen“ (1. Auflage New York 1969).
Neben Arbeitshäusern und Gefängnissen wurden mit dem County Asylums Act von 1808 die ersten öffentlichen Anstalten geschaffen, in denen bis 1900 über 74.000 Menschen oft für den größten Teil ihres Lebens eingesperrt waren. Das Grundprinzip jeder Fürsorge war es, „gesunde Simulant:innen“ davon abzuhalten, Sozialleistungen zu nutzen, um sich der Lohnarbeit zu entziehen.
Eine Umfrage unter städtischen Arbeitshäusern, die Mitte der 1860er Jahre von der medizinischen Fachzeitschrift „The Lancet“ durchgeführt wurde, ergab, dass „ein hartes und abstoßendes Regime zur Unterdrückung von Faulheit und Betrug gegenüber Menschen mit akuten Krankheiten, dauerhaften Behinderungen oder im hohen Alter angewendet wurde und immer noch angewendet wird“, von denen viele direkt auf Verletzungen oder Krankheiten am Arbeitsplatz zurückzuführen waren. In „Das Kapital“ deckte Marx die „Menschenopfer“ für den Profit auf und katalogisierte, wie industrielle Prozesse die Arbeitskräfte vergifteten, verstümmelten und töteten. Er kam zu dem Schluss:
„Die kapitalistische Produktion […] geht mit der in den Waren enthaltenen verdinglichten Arbeit sehr sparsam um. Aber sie verschwendet mehr als jede andere Produktionsweise Menschenleben, lebendige Arbeit, und zwar nicht nur Blut und Fleisch, sondern auch Nerven und Hirn.“
Ursprünglich wurden sie als Teil der armen und arbeitslosen Bevölkerung in Arbeitshäuser gesteckt, wo sie nicht von ihren Familien versorgt wurden. Im späten 19. Jahrhundert kam es dann zur Institutionalisierung in Sanatorien und Anstalten, totalen Einrichtungen, die auf der Segregation von Menschen mit Behinderung in schrecklichen Regimes der Vernachlässigung und Brutalität beruhten.
Der Beginn des 20. Jahrhunderts sah die Entwicklung einer imperialistischen Weltordnung, die sich auf riesige Kolonialreiche einer Handvoll Großmächte und einen Kampf um halbkoloniale Einflusssphären in den Staaten außerhalb dieser formellen Reiche konzentrierte. Dies führte zu zunehmendem Rassismus, Nationalismus und Militarismus sowie zu einer Sorge um die Gesundheit der männlichen Bevölkerung als potenzielle Soldaten für die Schützengräben der kommenden Weltkriege. Auch die Unterdrückung von Menschen mit Behinderung nahm zu.
Winston Churchill verdeutlichte diesen Trend 1910 in einem Brief an Premierminister Asquith (Herbert Henry A.: liberaler Premierminister 1908–1916; d. Red.): „Das unnatürliche und immer schneller voranschreitende Wachstum der geistig Behinderten und Geisteskranken, verbunden mit einer stetigen Einschränkung aller sparsamen, tatkräftigen und überlegenen Bevölkerungsgruppen, stellt eine nationale und rassische Gefahr dar, die man nicht überbewerten kann.“ Der Mental Deficiency Act von 1913 lehnte zwar Sterilisationen ab, legalisierte jedoch die lebenslange Internierung von „Schwachsinnigen“ und „Geistig Behinderten“.
Zusammen mit „sozialdarwinistischen“ Ideologien zur Rechtfertigung des Kapitalismus, des Kolonialismus und des Reichtums und der Herrschaft der Elite verhärtete sich die Haltung gegenüber Menschen mit Behinderung zu einem bösartigen Diskurs, wonach sie eine „Last“ und „Parasit:innen“ seien oder die Degeneration der Rasse und der Nation repräsentierten, was oft von Parlamentsabgeordneten und Gewerkschaftsführer:innen in den Arbeiter:innenbewegungen unterstützt wurde.
Dies löste ideologische Bewegungen von breitem Einfluss für „Eugenik“ aus, die insbesondere in den USA und Skandinavien zur Anwendung von Sterilisationsmaßnahmen führten. In der „Mitternacht des Jahrhunderts“ mündete dies unter den Nazis in die regelrechte Vernichtung. Die legendäre Labour-Regierung von 1945, die den NHS (Nationaler Gesundheitsdienst) und den modernen „Wohlfahrtsstaat“ ins Leben rief, schloss Menschen mit Behinderung aus, wobei die einzigen Leistungen, die speziell für Menschen mit Behinderung bestimmt waren, im Zusammenhang mit Arbeits- oder Kriegsverletzungen standen. Sie wurden bewusst auf das Existenzminimum festgelegt, um Arbeitsanreize nicht zu untergraben und das beitragsfinanzierte Prinzip der Sozialversicherung aufrechtzuerhalten. Mit der Segregation gingen stigmatisierende Gesetze und Ideologien einher, von „Ugly Laws“ („Scheußliche Gesetze“) in den USA, die „Entstellte“ aus dem öffentlichen Raum verbannen, bis hin zu Zwangssterilisierungen, denen bis 1958 vor allem 60.000 Frauen zum Opfer fielen.
Die aufkommende „Eugenik“-Bewegung am Beginn des 20. Jahrhunderts war besonders besorgt um die „biologische Qualität“ der arbeitenden Bevölkerung, um den Bedarf des Kapitalismus an einer großen, ausreichend gesunden Arbeiter:innenschaft und, mit Beginn des Imperialismus, an Soldaten zu decken. Der Burenkrieg von 1898 zeigte, wie viele junge Männer aus Slums für den Militärdienst ungeeignet waren, während das Militär im Ersten Weltkrieg feststellte, dass fast 50.000 Männer bei der Arbeit in Friedenszeiten Gliedmaßen verloren hatten.
Der Wirtschaftsboom nach dem Zweiten Weltkrieg und der neue Wirtschaftskonsens führten zu einer Ausweitung des „Sozialstaats“, und die sozialen und Klassenbewegungen der 1960er und 1970er Jahre umfassten eine wachsende, oft militante Bewegung von Menschen mit Behinderungen und Aktivist:innen gegen Institutionalisierung und für soziale Inklusion, die die moderne Politik des „unabhängigen Lebens in der Gemeinschaft“ und der Unterstützung für die Ermöglichung von Arbeit, wo immer möglich, sowie der Pflege für diejenigen, die dazu nicht in der Lage sind, schuf.
Wie Marx feststellte, wenn er die Kosten für die Unterstützung der „Armen“ im viktorianischen England betrachtete, darunter „die Demoralisierten, die Zerlumpten und die Arbeitsunfähigen“: „weiß das Kapital in der Regel, wie es diese Kosten von seinen eigenen Schultern auf die der Arbeiter:innenklasse und der Kleinbourgeoisie abwälzen kann.“
Die Kampagnen trugen dazu bei, eine Reihe von Missbrauchsskandalen aufzudecken, das öffentliche Bewusstsein zu schärfen und in den 1990er Jahren zu gesetzlichen Rechten für Menschen mit Behinderungen zu führen, die 1995 im Disability Discrimination Act (Gesetz über Diskriminierung aufgrund von Behinderung; dem Vorläufer des EA, das alle Gleichstellungsrechte zusammenfasste) verankert wurden. Außerdem halfen sie 1984 bei der Einrichtung der ersten Zentren für unabhängiges Leben. Diese wurden von der Regierungspolitik unterstützt und von der konservativen Regierung als Chance für den privaten Sektor angesehen.
Unter der New Labour-Regierung von Blair wurde die Behindertenrechtsbewegung vom Staat kooptiert, wobei Wohltätigkeitsorganisationen und NGOs die eigenen Organisationen der Bewegung verdrängten, während unzureichende Investitionen dazu führten, dass das System der Langzeitkrankenhäuser intakt blieb. Dies führte zu einem Rückgang der unabhängigen Lebenszentren zugunsten einer immer stärker individualisierten Versorgung.
Insgesamt ermöglichte der Nachkriegsboom den imperialistischen Ländern den Aufbau eines „Wohlfahrtsstaates“ und die Ausweitung der Rechte, angetrieben von einer stark gewerkschaftlich organisierten Arbeiter:innenklasse und ab den 1960er Jahren von den Revolten und Bewegungen der Unterdrückten.
Der Prozess der Ausweitung der Definition von Behinderung auf beispielsweise psychische Gesundheit sowie die Bemühungen um Deinstitutionalisierung und soziale Inklusion sind in der halbkolonialen Welt trotz Veränderungen im Diskurs und in der Politik auf Ebene der UNO und anderer imperialistisch kontrollierter Institutionen nur teilweise oder gar nicht vorangekommen.
Behinderung und Sozialismus
Die Russische Revolution zeigt die Alternative zu Reformen von oben und ihrem individualistischen, isolierenden Sozialsystem, das durch krisengetriebene Sparpolitik angegriffen wird. Wir müssen bestehende Rechte und Sozialleistungen verteidigen und ausbauen und gleichzeitig ein Programm diskutieren, wie wir diese in einen wirklich sozialistischen, integrierten Wohlfahrtsstaat für alle umwandeln können. Die systematische Diskriminierung von Behinderten ist ein grundlegender Bestandteil des Kapitalismus und kann nur durch dessen Sturz und die Ersetzung durch ein sozialistisches System überwunden werden, das auf den Bedürfnissen der Menschen statt auf der Forderung nach immer höheren Profiten basiert.
Nur ein Arbeiter:innenstaat, der auf Arbeiter:innenräten und demokratischer Planung basiert, könnte Menschen mit Behinderungen so weit wie möglich in die Arbeit und das gesellschaftliche Leben integrieren. Neben einem integrierten allgemein und psychischen Gesundheits- und Sozialsystem würden Bildung und Empowerment (Stärkung des [Selbst-]Bewusstseins) gefördert werden und Vorurteile und Stigmatisierung beseitigen.
Arbeiter:innendemokratie, demokratische Planung und Arbeiter:innenkontrolle über die Produktion würden dafür sorgen, dass notwendige Anpassungen am Arbeitsplatz vorgenommen werden, um die uneingeschränkte Teilhabe aller zu ermöglichen, während sichere Arbeitsplätze Behinderungen reduzieren würden.
Die Enteignung der Pharmaindustrie und die Umwidmung ihrer Ressourcen für menschliche Bedürfnisse würden dazu führen, dass der Schwerpunkt auf die Überwindung von Krankheiten und genetisch bedingten Beeinträchtigungen gelegt würde, anstatt Milliarden in die Optimierung lukrativer Medikamente zu investieren, um deren Patente zu verlängern. Der sozialistische Übergang würde dazu führen, dass „Behinderung“ als Kategorie der Unterdrückung und Diskrimierung verschwindet und eine kommunistische Gesellschaft entsteht, die auf dem Prinzip „Jede/r nach ihren/seinen Fähigkeiten, jedem/r nach ihren/seinen Bedürfnissen“ basiert.