4 Punkte für den Kampf gegen die Kürzungen in Berlin

Jaqueline Katherina Singh, Neue Internationale 295, Oktober 2025
Trotz Rotstifst im letzten Haushalt müssen wir ehrlich sein: Der Gegenprotest schaffte es weder, eine breite Masse an Berliner:innen dauerhaft auf die Straße zu bringen, noch schlagkräftig gegen die Kürzungen zu wirken. Die größte Demonstration organisierte das Bündnis „Wir sind #unkürzbar – Ein Berlin für Alle!“. Gemeinsam wurden 6.000 auf die Straße gebracht. Angesichts der kurzen Zeit ein Erfolg, aber unzureichend, um die Kürzungen abzuwenden. Mit dabei waren die GEW Berlin sowie, besser vertreten, die ver.di-Strukturen „Netzwerk freie Träger“ und „Betriebsgruppe Kulturräume“. Die gewerkschaftlichen Strukturen mobilisierten bewusster an anderer Stelle. Einmal zu einer kleineren Kundgebung vor dem Roten Rathaus sowie mehrere Tausend zusammen mit den Berliner Hochschulen am Tag der Kürzungen selber. Was braucht es dagegen, um die Kürzungen erfolgreich abzuwehren?
1. Informationen aufbereiten – verständlich und massenhaft!
Beim ganzen Zahlenwirrwarr ist es schwer, sich die Konsequenzen der Kürzungen komplett vorzustellen. Doch klar ist: Wir brauchen einen gemeinsamen Kampf! Das heißt, dass alle betroffenen Bereiche gemeinsam kämpfen müssen, anstatt vereinzelt Aktionen zu organisieren. Um möglichst viele Kolleg:innen in diese Kämpfe einzubinden, ist es wichtig, in den einzelnen Betrieben zu intervenieren, und gleichzeitig die Perspektive des gesamten Kampfes aufzuzeigen. Insbesondere an Universitäten oder bei Menschen, die Dienstleistungen der sozialen Hilfseinrichtungen in Anspruch nehmen, ist oft nicht klar, inwiefern sie die aktuellen Kürzungen direkt betreffen. Selbst in den Betrieben ist dies nicht allen Kolleg:innen bewusst. Wir müssen deswegen Betriebs- und Vollversammlungen organisieren, die klarmachen, wie unsere Einrichtungen von den Kürzungen betroffen sind, um möglichst viele zu informieren und in Bewegung zu bringen! Klar muss sein: Das Kürzungspaket ist keine abstrakte Finanzentscheidung. Es geht um Geld, das direkt verwendet wird, um unsere Löhne und Gehälter zu zahlen. Es sind unsere Arbeitsplätze und damit Angebote, welche ohnehin schon knapp sind, die vollständig wegfallen oder reduziert werden. Deswegen brauchen wir Materialien wie Flyer, um auf Kolleg:innen, aber auch Besucher:innen und Nutzer:innen (Studierende, Jugendliche der Einrichtungen der Jugendhilfe, Eltern) zuzugehen und diese in den Kampf einzubeziehen, der auch in ihrem Interesse geführt wird. Demonstrationen und Veranstaltungen werden nicht ausreichen, um die Entscheidung des Senats zu kippen.
2. Keine Spaltung, nein zu Hinhaltetaktik und Verwirrspielchen!
Letztes Jahr wurde der Protest von Anfang an gespalten. So wurde beispielsweise mit den großen Bühnen verhandelt, während kleinere Projekte dem Kürzungswahn überlassen wurden. Ebenso zeigte sich der Senat bei manchen Bereichen verhandlungswillig. Die Hoffnung, dass „der eigene Bereich“ besser wegkommt, wenn man nur genügend Lobbyarbeit betreibe, hilft aber dem Protest gegen das Gesamtpaket nicht. Das Resultat bleibt an vielen Stellen das Gleiche: Deutliche Abstriche bei Kultur, Bildung und Gesundheit, Preiserhöhungen und Einschränkungen in allen Bereichen.
Anstatt Deals auszuhandeln, damit der eigene Job oder das eigene Projekt bestehen bleibt, während andere ans Messer geliefert werden, sollten wir verstehen, dass wir uns nicht auf Kosten anderer retten können und die Auswirkung jeder Kürzung uns alle trifft. Dem kommenden Sozialkahlschlag, der wahrscheinlich erst einen Sektor oder ein Bundesland trifft und sich dann Stück für Stück auf andere ausweitet, muss somit geeint entgegengetreten werden. Das heißt, es braucht eine Koordination aller Anstrengungen gegen die Offensive auf nationaler Ebene, ein bundesweites Aktionsbündnis anstatt mehrerer kleinerer Bündnisse, die unterschiedliche Bereiche vertreten! Dabei muss klar sein: Wir lassen uns nicht auf die Hinhalte- und Spaltungstaktik des Senats ein!
- Keine Kürzungen, nirgendwo! Erstreiken wir uns unsere Zukunft! Gemeinsam auf die Straße – für ein großes Aktionsbündnis und flächendeckende Mobilisierungen der Gewerkschaften!
3. Protest ausweiten, Tarifrunden politisieren!
Wenn GEW, ver.di, IG BAU und IG Metall gemeinsam zu Aktionen mobilisieren, dann müssen sie auch gemeinsam Veranstaltungen an Unis und in Betrieben organisieren und gemeinsame Strategien besprechen und verfolgen. Uneinigkeit und die Weigerung, die Aktionen der jeweils anderen Gewerkschaft zu unterstützen, wie zuletzt beim TV-L, spielen jenen, die kürzen, in die Hände. Dabei ist auch essenziell, in Bereiche vorzudringen, wo es noch keine starke gewerkschaftliche Organisierung gibt. Das heißt, dass wir Schulungen und Material brauchen, die Fragen beantworten wie: „Wie kämpfe ich gegen Kürzungen an meinem Arbeitsplatz, meiner Schule, meiner Uni?“ Wie sprechen wir mehr Kolleg:innen an? Wie komme ich zu einer Betriebsversammlung?
Es gibt Unwillen und Ängste, überhaupt stark zu mobilisieren oder gar zu streiken. Deswegen müssen wir uns auch politisch organisieren, um in den Gewerkschaften effektiv Druck auszuüben und die Frage des Streiks auf die Tagesordnung zu setzen – gegen die Idee der Sozialpartner:innenschaft und des „Wirtschaftsstandorts Deutschlands“. Das Berliner Beispiel zeigt uns: Wenn wir unsere Arbeitsplätze und Löhne verteidigen wollen, dann müssen wir zum Mittel des Streiks greifen. Dafür ist es nötig, die künstliche Trennung von wirtschaftlichen und politischen Forderungen zu durchbrechen – vor allem bei den kommenden Tarifrunden wie bei der BVG oder beim TV-L. Wenn der Topf, aus dem meine Stelle bezahlt wird, beispielsweise vom Abgeordnetenhaus beschlossen wird, dann ist die Forderung eine wirtschaftliche, eine tarifliche und damit eine legitime, für die gestreikt werden darf. Gleichzeitig sind die Finanzierung des Staatshaushaltes und die Frage, wer welche Steuern zahlt, schließlich auch politische. Deshalb ist die Vorstellung, es sei nicht legitim, gegen Kürzungen politisch streiken zu dürfen, geradezu absurd! Natürlich darf nicht nur gestreikt werden – es muss!
Es geht nicht nur um die Frage, ob es richtig oder falsch ist, dass Streiks sich ausschließlich auf tarifliche Forderungen beschränken müssen. Die Gerichte verbieten bereits unsere Streiks, obwohl sie „nur“ tariflich sind, wie wir am Kitabeispiel sehen konnten. Solche Entscheidungen werden häufiger, während gleichzeitig der Druck von den öffentlichen und privaten Arbeit„geber“:innen zunehmen wird. Wir müssen dies durchbrechen, wenn wir solche Einschränkungen verhindern wollen.
4. Nicht nur gegen etwas kämpfen, sondern für etwas!
Wenn wir nicht wollen, dass mehr und mehr weggekürzt wird, müssen wir a) nicht nur gegen die Kürzungen, sondern auch für konkrete Verbesserungen eintreten wie einen höheren Mindestlohn, kürzere Arbeitszeit oder besseren Personalschlüssel; b) konkret aufzeigen, wer dafür zahlen soll: die Reichen und Unternehmer:innen; und c) sehr deutlich machen, dass wir uns gegen jegliche Form der rassistischen Spaltung, jeden Ausbau der staatlichen Überwachung und Repression und jede Militarisierung stellen.
Denn es sind weder Migrant:innen noch Bürgergeldempfänger:innen und Kolleg:innen mit zu vielen Krankentagen das Problem, sondern der Kapitalismus, genauer gesagt, das Schwächeln des deutschen Imperialismus im Zuge der internationalen Konkurrenz. Der Kampf gegen die Kürzungen bringt unmittelbar die Frage auf den Tisch: Was soll staatlich finanziert werden, in welcher Höhe und zu welchem Zweck? Und vor allem: Wer soll dafür bezahlen?
- Krankenhäuser auf dem Land sollen geschlossen werden? Nicht mit uns! Wir sagen: Weg mit Fallpauschalen und Personalnot, für die Verstaatlichung des Gesundheitssystems unter Kontrolle der Beschäftigten und Nutzenden!
- Stellenstreichungen und Sparzwang im öffentlichen Dienst? Lassen wir nicht weiter zu. Wir wollen das Ende der Schuldenbremse und Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich!
- Zwangsräumungen und hohe Mieten? Schluss damit! Lasst uns für einen bundesweiten Mietendeckel kämpfen sowie die entschädigungslose Enteignung von Vonovia & Co.!
- Wir zahlen Krieg und Krise nicht: Für die sofortige Wiedereinführung der Vermögensteuer! 115 Mrd. Euro jährlich durch progressive Besteuerung!
- Hauptstadtzulage statt Einsparungen, massive Investitionen in soziale Infrastruktur statt hunderte Milliarden für den deutschen Kriegskurs!





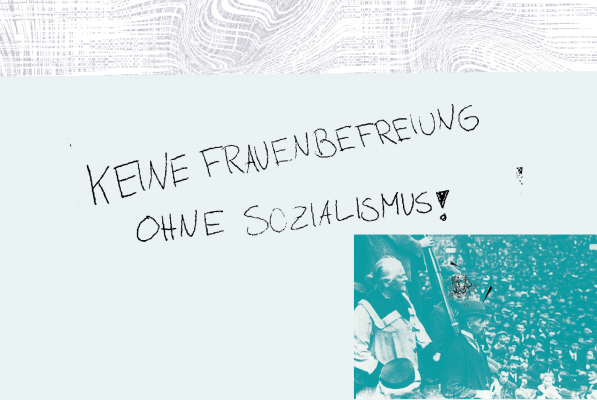
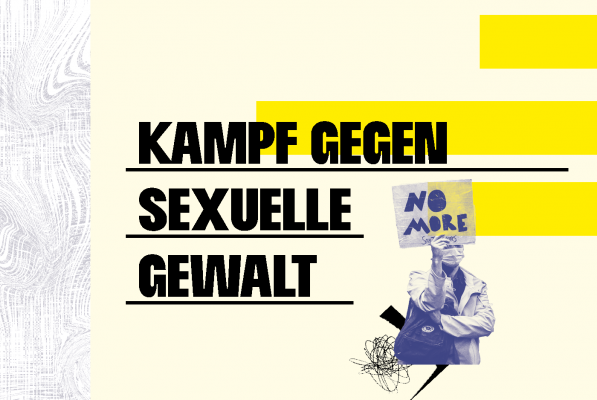

One thought on “4 Punkte für den Kampf gegen die Kürzungen in Berlin”