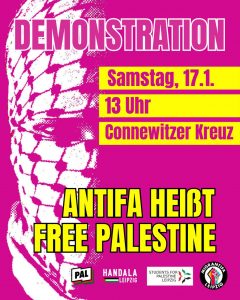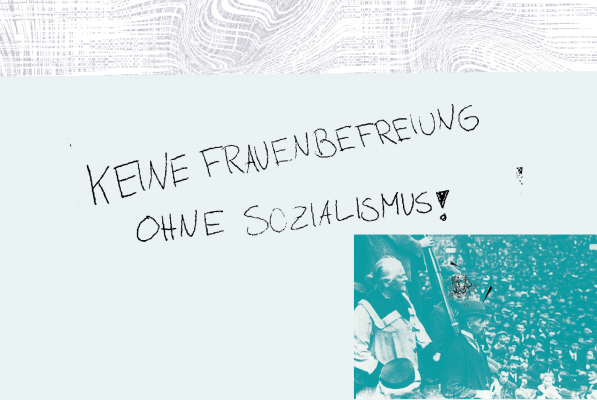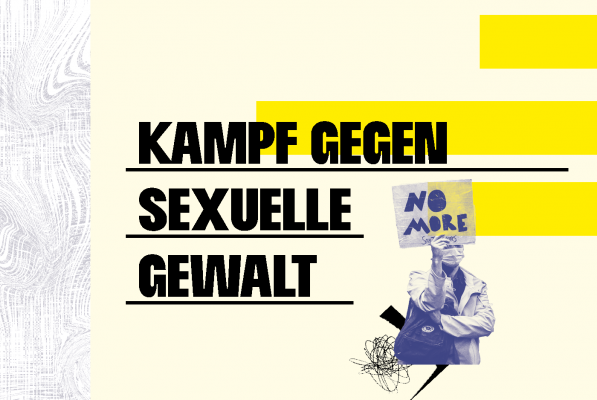Zollpolitik: Die Verhandlungen zwischen den Imperialismen gehen auf Kosten der Lohnabhängigen

Partido Comunista die Lavoratori (PCL, Italien), Infomail 1288, 6. August 2025
Der US-Imperialismus wälzt seinen Niedergang auf rivalisierende Imperialismen ab, angefangen bei den „Verbündeten“. Das Zollabkommen zwischen Trump und von der Leyen ist Teil dieses allgemeinen Rahmens.
Die Wiederbelebung des Protektionismus in großem Stil durch die neue amerikanische Regierung verfolgt mehrere Ziele: neue Ressourcen zu erschließen, um die amerikanischen Kapitalist:innen zu finanzieren, und vor allem die in den goldenen Jahren der Globalisierung ins Ausland verlagerte produzierende Industrie in die USA zurückzuholen – die verarbeitende Industrie, die in den goldenen Jahren der Globalisierung abgewandert ist.
Es ist ein Plan, die materiellen Grundlagen des US-Imperialismus angesichts der zunehmenden imperialistischen Konkurrenz durch China wiederzubeleben. „Make America great again“ hat Protektionismus als Credo.
Die protektionistische Politik der USA wird weltweit unter einer skrupellosen Verhandlungslogik umgesetzt. Sie erstreckt sich nicht nur auf Amerika – über Kanada und Mexiko im Namen des alten Slogans „Amerika für die Amerikaner:innen“ –, sondern auch auf Asien, wo selbst die traditionellen Verbündeten der USA nicht verschont bleiben. Dazu gehören Japan und Südkorea, trotz des strategischen Interesses der USA an einer Eindämmung Chinas (was noch immer ungelöste Fragen zur Prioritätenhierarchie des Trumpismus aufwirft).
Es ist jedoch offensichtlich, dass die Union der europäischen Imperialismen auf der Weltbühne sozusagen eine Sonderbehandlung von Trump erhalten hat. Ähnlich wie die, die dem japanischen Imperialismus zuteil wird. Und belastender als die, die dem alten britischen Imperialismus angeboten wird.
Das Abkommen unterliegt noch schwankenden Interpretationen, aber sein Charakter ist auf den ersten Blick offensichtlich: ein skandalös unausgewogenes Abkommen zugunsten der amerikanischen Kapitalist:innen und der US-Regierung.
Der Referenzzoll von 15 % wird 70 % der europäischen Exporte in die USA betreffen (die sich insgesamt auf 531 Milliarden Euro belaufen) und kommt zu dem „informellen Zoll“, der Abwertung des US-Dollars um 15 %, hinzu.
Gleichzeitig verpflichtet sich die EU, in den verbleibenden drei Jahren der Amtszeit von Trump amerikanische Energieprodukte im Wert von 750 Milliarden US-Dollar (im Wesentlichen Gas und Öl) zu kaufen und 600 Milliarden US-Dollar von europäischen Unternehmen in den USA zu investieren sowie die Lieferungen der amerikanischen Kriegsindustrie, deren Aktienkurse in die Höhe geschossen sind, zu erhöhen.
Auch wenn letztere Punkte selbst recht unverbindlich und ungewiss sind, so besteht die einzige Gegenleistung für die EU im (vorübergehenden) Verzicht der USA, die Zölle auf 30 % anzuheben.
Ein großer Teil der europäischen bürgerlichen Presse ist demoralisiert: „Um einen Krieg zu vermeiden, haben wir die Kapitulation akzeptiert.“ Insbesondere die unterwürfige Haltung der Präsidentin der Europäischen Kommission während der Verhandlungen war häufig Gegenstand von Kritik und Spott. Das ist verständlich. Aber hinter der szenischen Oberfläche muss man den Dingen auf den Grund gehen.
Die Krise der Europäischen Union
Die Verhandlungsschwäche der Europäischen Union spiegelt ihre materielle Basis wider. Es gibt einen amerikanischen Imperialismus, einen chinesischen Imperialismus, einen russischen Imperialismus. Es gibt keinen europäischen Imperialismus. Anstatt dessen existiert eine Union nationalimperialistischer Staaten unterschiedlicher Größe, die seit langem am globalen Wettbewerb benachteiligt und durch divergierende und widersprüchliche Interessen gespalten sind. Nationale Imperialismen, die durch einen Wettlauf um die niedrigsten Unternehmenssteuern für ausländische Investitionen konkurrieren; die unterschiedliche Energiesysteme haben; die sich um die Stahlmärkte, die Pharmaindustrie und die kontinentale Rüstungsindustrie streiten; die erbittert um europäische Gelder für Landwirtschaft und Industrie ringen; die um Einflussgebiete in Europa, auf dem Balkan, in Nordafrika und im Nahen Osten sowie um Marktanteile in China, Indien und Lateinamerika wetteifern.
Der Fall der Berliner Mauer, dann die große Krise von 2008 und schließlich die gemeinsame und aggressive Konkurrenz anderer imperialistischer Mächte (vor allem der USA und Chinas) haben die europäischen Imperialismen dazu gebracht, ihre Union zuerst zu schaffen und dann zu erhalten. Aber noch nie waren die unterschiedlichen nationalen Interessen so gegensätzlich.
Der Streit zwischen Deutschland und Frankreich um die Vorherrschaft in Europa, der latente Konflikt zwischen Frankreich und Italien in Nordafrika, die Konkurrenz zwischen Italien und Deutschland auf dem Balkan und die endlosen Auseinandersetzungen über die Haushaltspolitik (sowohl auf nationaler als auch auf Gemeinschaftsebene) sind Ausdruck davon. Der sogenannte „föderale Aufbau“ der EU ist über die Schwelle der gemeinsamen Währung (2000) nicht hinausgekommen und stagniert seit mehr als zwanzig Jahren.
Der außergewöhnliche Rückgriff auf gemeinsame Verschuldung als Reaktion auf die Pandemie (2020) hat keine Fortsetzung gefunden. Der kürzlich verabschiedete Aufrüstungsplan entspricht vor allem – und nicht zufällig – den Haushaltskapazitäten der verschiedenen Nationalstaaten, was deren Unterschiede (angefangen bei den deutsch-französischen) verschärft.
Europäische Verhandlungen, nationale Interessen
Das Handelsabkommen zwischen der EU und den USA und sein Ergebnis können nicht losgelöst von diesem allgemeinen Kontext verstanden werden. Formal war und ist die Europäische Union durch ihre Kommission Trägerin der Handelsverhandlungen. Aber hinter den Kulissen der kontinentalen Verhandlungen brodeln unterschiedliche nationale Interessen.
Berlin hat vor allem versucht, seine Autoindustrie zu schützen. Rom hat versucht, seine Agrar- und Pharmaindustrie zu verteidigen. Paris fühlt sich durch ein Abkommen bedroht, das ihm in wichtigen Bereichen seiner Militär- und Energieindustrie schadet, und protestiert („die dunkle Stunde der Unterwerfung“).
Kommissionspräsidentin von der Leyen hat für alle und für niemanden verhandelt. So bedauern nun alle verschiedenen nationalen und/oder sektoralen Interessengruppen die Kluft zwischen den Ergebnissen und ihren Erwartungen, zwischen dem Ergebnis und ihrem „Mandat“, das überwiegend national ist.
Andererseits sind Verhandlungen über Handelsabkommen niemals nur kommerziell, noch weniger im aktuellen Kontext. Die allgemeinen Machtverhältnisse auf imperialistischer Ebene spielen eine Rolle.
In den letzten Monaten hat der US-Imperialismus seine unbestreitbare militärische Vorherrschaft (NATO), die Stärke seines Energiesektors und das Gewicht seiner großen Technologiemonopole auf den Tisch gelegt.
Die Verpflichtungen Europas, Waffen, Gas und Öl aus den USA zu kaufen und massiv auf dem US-Territorium zu investieren, sind das Ergebnis des materiellen Drucks des US-Imperialismus und heute insbesondere der nationalistischen Wende seiner neuen politischen Führung.
Auffällig ist die „Verpflichtung“ Europas, 750 Milliarden Euro für amerikanisches Gas und Öl auszugeben, wenn die gesamten US-Exporte in diesem Sektor 141 Milliarden Euro betragen. Ebenso überraschend ist die Verpflichtung europäischer Unternehmen, 600 Milliarden Euro in den USA zu investieren, wenn es um private Investitionen geht, die kaum vorhersehbar oder quantifizierbar sind.
Möglicherweise sind in dieser Zahl auch die Käufe von US-Staatsanleihen enthalten, die derzeit unter anderem aufgrund der drohenden Teilveräußerung durch China in Schwierigkeiten geraten sind. Aber jenseits aller Unbekannten und Widersprüche bleibt die wesentliche Tatsache bestehen: Die Union der europäischen Imperialismen hat sich dem Druck des amerikanischen Imperialismus gebeugt.
Für die Klassenunabhängigkeit der europäischen Lohnabhängigen
Jetzt fordern alle Bourgeoisien des Kontinents „Entschädigungen“. Mit anderen Worten: einen neuen Berg von Milliarden, um die europäischen Kapitalist:innen für die amerikanischen Zölle zu entschädigen – dieselben Kapitalist:innen, die als Reaktion auf diese Zölle erwägen, ihre Produktion in die USA zu verlagern!
Einerseits fordern die Arbeit„geber“:innenverbände Geld von ihren jeweiligen Regierungen, indem sie die Rechnung für die erlittenen Schäden vorlegen (22,6 Milliarden allein laut der italienischen Unternehmer:innenverbände Confindustria) und Ausnahmen von den europäischen Regeln für staatliche Beihilfen geltend machen. Andererseits wenden sie sich direkt an die EU und fordern die Aussetzung des Stabilitätspakts und sogar eine neue Inanspruchnahme der Gemeinschaftsschulden (wogegen sich Deutschland weiterhin wehrt).
In allen Fällen wird die Fahne des gemeinsamen Interesses von Arbeit„geber“:innen und Arbeit„nehmer“:innen gehisst. Sei es mit dem nationalistischen Diskurs vom „nationalen Interesse“ gegen ein „stiefmütterliches“ Europa oder mit der liberal-europäischen Erzählung vom „europäischen Interesse“ angesichts der Arroganz Trumps.
Diese betrügerische Operation muss abgelehnt werden. Es dürfen nicht die Lohnabhängigen die Kosten der Konkurrenz zwischen Kapitalist:innen, ihren Staaten und ihren Gewerkschaften tragen.
Angesichts der angekündigten Verlagerungen sollte die Verstaatlichung der betroffenen Unternehmen ohne Entschädigung und unter Arbeiter:innenkontrolle gefordert werden. In Anbetracht neuer Schuldentransaktionen ist es notwendig, eine außerordentliche und progressive Besteuerung von hohen Gewinnen und Vermögen sowie den Erlass der Staatsschulden bei den Banken zu fordern.
Angesichts neuer Kürzungen bei den Sozialausgaben (vielleicht um die Rüstungsausgaben Europas oder der USA zu finanzieren) ist ein großer Plan für öffentliche Investitionen in Gesundheit, Bildung, soziale Dienste, Umweltsanierung und Energiewende nötig – letzteres sogar offiziell verraten durch die Verpflichtung zum Kauf von amerikanischem Gas und Öl –, und zwar auf Kosten der Kapitalist:innen.
Wegen jeglicher Vortäuschung eines gemeinsamen Interesses zwischen den Klassen ist es notwendig, ein internationales Bündnis der europäischen Lohnabhängigen und dieses mit dem amerikanischen Proletariat zu fordern und aufzubauen, das gleichermaßen von der tödlichen Kombination aus Inflation und Sozialkürzungen getroffen ist.
Für eine europäische sozialistische Föderation
Was geschehen ist, erfordert auch eine breitere strategische Reflexion über die Zukunft Europas und seine Rolle in der Welt.
Heute wird der historische Niedergang der USA auf Europa abgewälzt, das immer mehr zu einem Spielball der großen Weltmächte wird.
Die liberalen bürgerlichen Kreise, die im Namen einer Nachahmung der alten amerikanischen Föderation eine europäische Einheit auf föderaler Basis fordern, ignorieren die unüberwindbaren nationalen Widersprüche zwischen den verschiedenen imperialistischen Staaten des alten Kontinents: Ihre Union wurde nicht nur gegen die europäischen Arbeiter:innen aufgebaut, sondern stellt ein festgefahrenes und gescheitertes Projekt dar.
Die national-souveränen Kreise, die die Auflösung der Europäischen Union und/oder ein Bündnis mit dem russischen oder chinesischen Imperialismus fordern, schlagen in Wirklichkeit eine neue Unterordnung Europas vor, wenn auch in eine andere Richtung, nämlich gegenüber anderen aufstrebenden imperialistischen Mächten. Nichts davon entspricht den Interessen der europäischen Arbeiter:innen.
Nur eine sozialistische Revolution kann Europa auf einer fortschrittlichen Grundlage vereinen. Nur eine Arbeiter:innenregierung in jedem Land und auf kontinentaler Ebene kann Europa eine neue historische Perspektive geben.
Für eine europäische sozialistische Föderation! Für die Vereinigten Sozialistischen Staaten von Europa!
Das ist die Parole der Internationalen Sozialistischen Liga, der als italienische Sektion die PCL angehört.