Finanzmarktkrise – Rückblick und Ausblick
Markus Lehner, Revolutionärer Marxismus 41, Februar 2010
Im Sommer 2008 brachten wir den RM 39 mit dem Titel „Finanzmarktkrise und fallende Profitraten“ heraus. Darin vertraten wir die These, dass sich mit den Turbulenzen auf den Finanzmärkten die „Globalisierungsperiode“ nach 1990/91 endgültig als 20 Jahre Scheinblüte herausgestellt habe und dass das Platzen der Spekulationsblase die Krisenabschwächungseffekte der „neo-liberalen Reformen“ dieser Periode mit einem Schlag zunichte machen würde – und dass die Kosten dafür natürlich auf die Arbeiterklasse abgewälzt werden würden. Nach dem Erscheinen des RM 39 wurden wir mit diesen Aussagen noch als „Katastrophisten“ belächelt. Noch bis kurz vor dem Zusammenbruch der Investment Bank „Lehman Brothers“ glaubten auch viele Linke (mehr oder weniger insgeheim), dass der Globalisierungs-Kreislauf „China-Billigware“ in Kombination mit „US-Schuldenökonomie“ gemanaged durch FED/US-Regierung und chinesische Bürokratie die globalen Finanzmarktturbulenzen nach dem Platzen der US-Immobilienblase aussteuern könne. Der „Abgrund“, der sich nach dem Lehman-Crash auftat, auf den gleich der Zusammenbruch des Finanzversicherungs-Giganten AIG zu folgen drohte, hat den Blick auf die tatsächlichen Verhältnisse der kapitalistischen Scheinwelt weit geöffnet.
In diesem Artikel ergänzen wir die Ausführungen des Artikels „Finanzkapital, Imperialismus und die langfristigen Tendenzen der Kapitalakkumulation“ aus dem RM 39 um die Erfahrungen der Entfaltung der Krise der letzten anderthalb Jahre, sowie die daraus zu ziehenden Schlüsse für die weitere Entwicklung.
Kritik der bürgerlichen Krisen-Ökonomie
Heute ist es ein Gemeinplatz auch in der bürgerlichen Presse, dass das globale Finanzsystem spätestens seit 1990 sich in ein gigantisches Kartenhaus entwickelt hat. Man braucht nur als Beispiel zu erwähnen, dass der nominelle Wert der Kreditderivate (eine Art Kettenwette auf Kreditausfall) im zweiten Halbjahr 2005 das 18-fache der Preissumme aller an der New Yorker Börse gehandelten Papiere im selben Zeitraum betrug, um sich an die absurden Dimensionen dieses Kartenhauses zu erinnern. In diesem Finanzkasino konnten Gewinne in Ausmaßen gemacht werden, die in keinem anderen kapitalistischen Business zu erzielen waren – aber natürlich auch Verluste in unvorstellbarem Ausmaß. Letzteres ließ sich in den Bilanzen der großen Finanzjongleure bis 2007 jedoch mehr oder weniger verbergen. Es schien, als ob diese Profitmaschine vom Rest der „realen“ Ökonomie abgeschottet und gesichert sei. Letztlich stellte sich natürlich heraus, dass das Geld, das sich hier verdienen lies, rückgebunden ist an die Liquidität und die Zahlungsströme aus dem Rest der Ökonomie; dass die Zahlungsprobleme, die zuerst auf dem US-Immobilienmarkt und in Folge auf den bombastischen Märkten für „gebündelte Verbriefungen“ auftraten, zu Liquiditätsproblemen im gesamten Finanzsystem führten; dass schließlich mit dem Lehman-Crash eine der Stützen des globalen Kartenhauses einbrach, also das ganze fragile Gebilde vor einer Kettenreaktion stand.
Nur die massive staatliche Intervention aller imperialistischer Mächte mitsamt einer Reihe der mehr entwickelten Halbkolonien konnte die Katastrophe aufhalten und die „systemrelevanten“ Finanzhäuser retten. Eine Zeitlang schien es sogar, als ob der „Keynsianismus“ wieder offizielle Staatsdoktrin werden würde. Heute sind die meisten großen Spieler im globalen Kasino wieder wohl auf und zurück im Spiel um gigantische Finanzprofite, die Verursacher der Krise kassieren wieder milliardenschwere Boni – während der Preis für die vorangegangenen Rettungsaktionen von den ArbeiterInnenn der ruinierten „realen“ Firmen gezahlt wird und von allen, die von den massiven sozialen Kürzungen betroffen sein werden, die mit der Staatsdefizit-Sanierung der nächsten Jahre unweigerlich kommen werden.
Die Funktion des Finanzsystems im kapitalistischen Gesamtsystem lässt sich vergleichen mit dem Blutkreislauf im Körper, der notwendig für die Versorgung der Zellen mit Blut und für den Abtransport der Stoffwechselprodukte ist. Dem Finanzkapital wurde nun der real-existierende kapitalistische „Körper“ für seine Profiterwartungen zu mickrig – es schuf sich einen parallelen virtuellen Körper, der eine vielfach gesteigerte Operationsbasis versprach. Für diesen bombastischen Körper wurde der Blutkreislauf gewaltig gesteigert und beschleunigt. Damit arbeitet das „Herz“ des kapitalistischen Körpers immer weniger für seinen ursprünglichen Zweck, sondern für mehr und mehr abgehobene Ziele, die für den Rest des Körpers zur enormen Plage werden. Dies ist nicht nur eine Belastung an sich, sondern zusätzlich ist das Zentrum des Systems labil wie ein Kartenhaus und droht also den Rest des Körpers mit ins Verderben zu reißen. Jede Rettungsoperation am Herzen des Kapitalismus muss so also auch seinen parasitischen Charakter wiederherstellen, will sie nicht den ökonomischen Zusammenbruch riskieren. Die auch vom kapitalistischen Standpunkt zunehmend irrsinnige Funktionsweise des Finanzkapitals hält den Rest der Ökonomie in Geiselhaft – sie muss in einer noch so schweren Finanzkrise bei Strafe des Untergangs vom Rest des Kapitals ertragen und in ihren wesentlichen Strukturen gerettet werden.
So ist es nicht verwunderlich, dass alles Gerede der großen Staatenlenker von „wesentlichen Regeländerungen“, von einem „Ende des Finanzsystems, wie wir es kannten“, von einem „Vorrang der Realwirtschaft“ etc sich längst in Schall und Rauch aufgelöst hat. Kleinere kosmetische Operationen in bezug auf Bonus-Systeme und unbedeutende Besteuerungen bestimmter Spekulationsgewinne mögen überleben, jedoch ist nichts in Sicht, was die wesentlichen Funktionsmechanismen des Finanzsystems anfasst. Selbst die erwähnten Maßnahmen ergeben sich aus der falschen Analyse, dass die Probleme des Finanzsystems aus „Übertreibungen“ eines an sich gesunden Systems stammten und vor allem von einigen besonders „gierigen“, „unmoralischen“ Individuen verursacht seien, die man gesetzlich in Schranken weisen könne.
Dies führt zum nächsten damit zusammen hängenden Thema: dem völligen Unverständnis der bürgerlichen Ökonomie und Öffentlichkeit für die Krise. Zu Beginn der Krise wurde das Ausmaß und die Bedeutung der Probleme vor allem erst einmal klein geredet, selbst als die auf uns zurollende Flutwelle ziemlich deutlich zu sehen war. Um nur ein spektakuläres Beispiel zu geben: noch im Sommer 2008 erklärte der hochbezahlte Sachverständigenrat der Bundesregierung – mit dem „wissenschaftlichen“ Hintergrund von fünf großen Forschungsinstituten -, dass keine bedeutsamen Auswirkungen der Finanzmarktkrise auf die deutsche Wirtschaft zu erwarten seien und dass sich der Aufschwung der ersten Monate 2008 fortsetzen würde, mit geringer Wachstumsabschwächung im Jahre 2009 (1). Nur zwei Monate nach dieser Prognose war dann plötzlich alles ganz anders – ein Institut überbot das andere im Ausmalen von Schreckensszenarien und Wachstumseinbrüchen. Den Vogel schoss schließlich DIW-Chef Zimmermann ab, als er feststellte, dass die hochbezahlten „Wirtschaftsexperten“ eigentlich gar nicht wüssten, was da gerade passiert und man besser sämtliches Prognostizieren einstellen solle. Auf diesen „Meistern der Wissenschaft“ hatte übrigens Gerhard Schröder seine Agenda-Politik und die folgende Implosion der SPD aufgebaut, denn als er 2003 diese Politik als alternativlos bezeichnet hatte, da „Politik nicht die fundamentalen Wahrheiten der geballten ökonomischen Wissenschaften ignorieren kann“ – sprach er vom eben genannten „Sachverständigenrat“ und seinen Prognosen!
Als die besagten Sachverständigen nun ihre Fehler im Folgejahr analysierten, stellten sie in ihrem Frühjahrsgutachten 2009 fest: „Eine Ursache für den großen Fehler liegt darin, dass die Wechselwirkungen zwischen Finanzmärkten und Gütermärkten sowie die Ursachen und Abläufe von Finanzkrisen in der Ökonomie insgesamt nicht soweit verstanden sind, dass Situationen wie die gegenwärtige genau prognostiziert werden können“ (2).
Im Kern ist dies ist nichts anderes als eine Bankrotterklärung der bürgerlichen Wirtschaftswissenschaft. Es wird nicht nur festgestellt, dass diese „Wissenschaft“ die Gesetze nicht versteht, die die Wechselwirkungen zwischen den Finanzmärkten und der Realökonomie bestimmen. Sondern dies ist auch aufs engste verknüpft mit dem Verständnis des Kapitalismus als monetärem System, d.h. mit dem Verständnis von Geld, Warenproduktion, Profit, Zins, etc. und deren Wechselwirkungen. Vor allem aber drückt sich darin das Nicht-Verstehen der wesentlichen Krisenhaftigkeit dieser Wechselwirkungen und des kapitalistischen Gesamtsystems durch die bürgerliche Ökonomie aus.
Vor dem Crash 2008 war es ein Gemeinplatz der bürgerlichen Ökonomie, dass deregulierte Märkte die perfekten Instrumente zur Verarbeitung der gigantischen wirtschaftlichen Informationsmengen seien. Dass es irrational und anmaßend sei, die „Richtigkeit“ von Marktpreisen in Frage zu stellen, die durch die Entscheidungen von Millionen Käufern und Verkäufern zustande kämen – und die daher die tatsächlichen Bedürfnisse und Werte in wesentlich genauerer Weise widerspiegeln würden als dies jegliches menschliches Planen und Festsetzen je erreichen könne. Daher wäre es lächerlich die Marktpreise z.B. auf den Finanzmärkten in Frage zu stellen, diese als Spekulations-Blasen zu verunglimpfen, von spekulativen Übertreibungen der Bewertung von Finanzanlagen zu sprechen oder gar – Gott sei bei uns – staatliche Eingriffe in diese Märkte zu fordern. Und selbst wenn es zu Schwierigkeiten und Turbulenzen käme, wären die modernen, wissenschaftlich beratenen, Institutionen wie Zentralbanken, Finanzministerien, IWF etc in der Lage in kürzester Zeit wieder für Ruhe zu sorgen. Eine Situation wie 1929 könne nie mehr auftreten!
Nachdem die „neo-liberale“ Doktrin zumindest in Bezug auf die Effizienz der Finanzmärkte gegenwärtig etwas erschüttert ist, wird als ihre Schwäche angeführt, dass sie zu stark auf die Rationalität der Marktteilnehmer bauen würde und dass sie die irrationalen Ausschläge z.B. in Richtung übertriebener Erwartungen, Wunderglauben bezüglich bestimmter Märkte oder Produkte, Herdentriebe etc übersehen hätte – kurz, dass die von den Wirtschaftswissenschaften nicht vorausgesehene Krise auf deren mangelnder Berücksichtigung der „Psychologie der Märkte“ beruhe, ja dass die Krise zum Großteil eigentlich ein Problem der Psychologie sei.
Im Gegensatz dazu zeigt die marxistische Kritik der politischen Ökonomie, dass im Kapitalismus eine systematische Abweichung der Marktpreise von den Werten genauso wie der Verwertungsbedürfnisse von den Verwertungsbedingungen des Kapitals die Regel ist, dass also Krisen und ihre Bewältigung keine Abweichung, Ausnahmen oder Übertreibungen sind, sondern wesentliche Achsen, um die sich die jeweilige Entwicklungsperiode des Kapitalismus jeweils bewegt. Entgegen der neoklassischen Theorie ist es nicht die „unsichtbare Hand“ der perfekten, im Gleichgewicht befindlichen Märkte, die die Gesetzmäßigkeiten des Kapitalismus verstehen lässt – sondern ähnlich wie es in der physikalischen Raum-Zeit die schwarzen Löcher oder ähnliche Singularitäten sind, sind es die systembedrohenden Krisen, die den jeweiligen kapitalistischen Perioden ihre Struktur in Raum und Zeit geben. Es sind die während der Krise und in ihrem Verlauf erfolgenden Umwälzungen, angefangen von Produktionsmethoden, Klassenkampfbeziehungen, Marktverhältnissen, institutionellen Veränderungen, Verschiebungen in den Welthandelsbeziehungen bis hin zum ideologischen Rahmen, die bestimmte Phasen der kapitalistischen Entwicklung jeweils von den vorhergehenden abheben – wodurch eben die Kritik der Ökonomie wesentlich zu einer historischen, gesellschaftlichen Wissenschaft wird.
Das marxistische Verständnis von Finanzkrise gründet sich auf der widersprüchlichen Natur der kapitalistischen Warenproduktion als der Ursache für die krisenhafte Natur des Kapitalismus als monetäres System. Es zeigt auf, dass die Ursache für die massive Entwicklung des parasitischen Finanzmarktsystems in den Grenzen der kapitalistischen Akkumulation selbst liegt. D.h. dieser Akkumulationsprozess ist nicht fähig zum „Gleichgewicht“, sondern zerrissen zwischen dem Zwang zur maßlosen Ausdehnung und der Beschränktheit der Verwertungsbedingungen (tendenzieller Fall der Profitrate). Von daher muss Profitwachstum zumindest auf den Finanzmärkten fortgesetzt werden, wenn es schon real lange nicht mehr die gewünschten Renditesteigerungen gibt. Die Finanzkrise ist somit in den allgemeinen Krisentendenzen der Kapitalakkumulation angelegt und keine Ausnahme oder Übertreibung gegenüber der „normalen“ kapitalistischen Entwicklung. Mit seiner dominierenden Rolle im kapitalistischen Gesamtsystem charakterisiert das Finanzkapital schließlich die gesamte gegenwärtige Epoche des Kapitalismus als eine von Parasitismus und Stagnation, gefolgt von stürmisch-fieberhaften Booms und Aufschwüngen, die letztlich wieder durch dramatische Kriseneinbrüche beendet werden – dies ist das Entwicklungsmuster der imperialistischen Epoche, die der Durchsetzungsepoche des Kapitalismus Ende des 19.Jahrhunderts folgte.
Dies ist auch die Epoche, in welcher schwerwiegende Krisen jeweils die Frage des Zusammenbruchs des Gesamtsystems auf die Tagesordnung setzen. So ist es kein Wunder, dass eine Menge bürgerlicher Ökonomen und „Vordenker“ unmittelbar nach dem Crash 2008 von der Notwendigkeit sprachen, die „Regeln des Spiels“ grundlegend zu ändern – anderenfalls würde die Krise unweigerlich noch schwerwiegender wiederkehren und „unsere gesamte Existenz bedrohen“ (3). Offensichtlich ist das Kapital aber zu einer solchen Regeländerung nicht in der Lage: die eingeleiteten Rettungsoperationen haben die Kasino-Spieler gerettet, ihnen ihr Spielgeld wiederbeschafft und dabei die Verschuldungslast der öffentlichen Haushalte nochmals unvorstellbar gesteigert. „Keynsianismus“ ohne Finanzmarktregulierung ist schlichtweg die Begründung einer neuen Blasenökonomie. Auf diese Weise ist die nächste schwerwiegende Krise keine Frage von Jahrzehnten, sondern von Jahren – und ihre Bedrohlichkeit für das System ist sicherlich nochmals gesteigert. Dies signalisiert umso mehr die unmittelbare historische Notwendigkeit die Wurzel dieses krisenhaften, parasitischen Systems, die kapitalistischen Produktionsverhältnisse selbst, zu überwinden und durch eine geplante, sozialistische Ökonomie zu ersetzen. Erst dann wird die Krise aufhören das wesentliche Moment der historischen Veränderung zu sein.
Grenzen der Kreditgeldexpansion und die marxistische Analyse des Geldes
Was ist eigentlich Geld? Diese scheinbar theoretische Frage wurde in der Finanzmarktkrise für eine Menge an Akteuren zu einer drängenden praktischen. Waren die diversen Kontoeinträge in diversen Fonds-Accounts oder die Verbriefung irgendwelcher Geldansprüche noch etwas wert, oder einfach nur Futter für den elektronischen Papierkorb?
Tatsächlich erscheint es seit der Marginalisierung der Golddeckung des Geldes (dem Übergang zu einer sogenannten Fiat-Währung) so, als sei das Geld völlig losgelöst von jeglicher Warennatur, selbst ohne Wert und nur als Wertzeichen für die Erleichterung des Warentausches im Umlauf. Probleme des Wertmaßstabes, der mit Geld als Preis verbunden ist, seien durch die Geldmengensteuerung von Zentralbanken rein technischer Natur.
Dabei ist auch Geld in der Fiat-Währung zurückgebunden an die Funktion des Geldes als Zahlungsmittel: es kommt in den Umlauf durch den Kredit der Zentralbanken an die Geschäftsbanken. Diese wiederum können (bei Berücksichtigung von Mindestreserveanforderungen) dieses Kreditgeld wiederum zur Deckung eines noch wesentlich höheren Umfangs an „Buchgeld“ verwenden. Der Großteil dieses Buchgeldes muss gar nicht in Zentralbankgeld (= Schuldschein bei der Zentralbank) ausgezahlt werden, sondern Geschäft und Gegengeschäft gleichen sich zumeist aus. Es ist jedoch klar, dass das so in Umlauf gebrachte Geld als Schuldschein nur dann seinen Wert behalten kann, wenn die zugrundeliegenden Kreditgeschäfte auch gelingen. Wenn also die mit dem „neuen Geld“ getätigten Geschäfte, die gekauften Waren, die finanzierten Produktionsprozesse etc letztlich auch termingerecht zu Verkäufen führen, die die Begleichung der Schuld ermöglichen. Die Umkehrung der „natürlichen“ Reihenfolge der Warenzirkulation W-G-W, d.h. von Verkauf vor Kauf, zum Kauf „auf Schuldschein“ vor Verkauf zur Schuldbegleichung, lässt die Geldware mehr und mehr aus der Zirkulationssphäre entweichen.
Sobald jedoch die Kreditkette zu reißen droht und wesentliche Teile der ausstehenden Schulden von den Banken abgeschrieben werden müssen, gerät der Schein der Irrelevanz der Geldware (des „Eigenwerts“ des Geldes) ins Wanken: Schulden müssen mit Geld als Zahlungsmittel beglichen werden, es wird also verzweifelt nach „hartem Geld“ gejagt – das Kreditsystem schlägt plötzlich in das Monetärsystem um (4). Neues Kreditgeld G muss im Prozess G-W-G‘ tatsächlich auch der Ausweitung des Wertprodukts entsprechen – aber nicht nur das, sondern diese Ausweitung muss in einer solchen Verteilung erfolgen, dass sie einen Rückfluss an die Schöpfer des Kreditgeldes ermöglicht. Das setzt also eine beständig gesteigerte Form von gesellschaftlicher Produktion voraus, die immer wieder durch die private Aneignung des produzierten Reichtums vermittelt werden muss. „Der Kredit als ebenfalls gesellschaftliche Form des Reichtums verdrängt das Geld und usurpiert seine Stelle. Es ist das Vertrauen in den gesellschaftlichen Charakter der Produktion, welches die Geldform der Produkte als etwas nur Verschwindendes und Ideales, als bloße Vorstellung erscheinen lässt“ (5). Genauso unvermeidlich muss in der Krise die dingliche Form, die Geldform des gesellschaftlichen Reichtums wieder manifest werden: Hier „tritt also der Umstand, dass die Produktion nicht wirklich als gesellschaftliche Produktion der gesellschaftlichen Kontrolle unterworfen ist, schlagend hervor in der Form, dass die gesellschaftliche Form des Reichtums als ein Ding außer ihm existiert“ (6).
Mag also in normalen Kreditgeldzeiten die dingliche Form des Geldes als etwas Imaginäres, bloß Virtuelles erscheinen, so bleibt sie doch immer Bezugspunkt der Geldform, um sich in der Krise auch wieder real geltend zu machen (als das „Liquiditätsproblem“). Diese oszillierende Wirkungsweise der Geldform liegt in der Widersprüchlichkeit der Warenform unter den Bedingungen der verallgemeinerten Warenproduktion (d.h. der kapitalistischen Produktionsverhältnisse) selbst. Geht es in dieser um die Aneignung des Tauschwertes der Ware, so ist der nur durch tatsächliche konkret-nützliche Arbeit zu erzeugen, soweit sich in dieser wertbildende, „abstrakte Arbeit“ vergegenständlicht in einer Ware, die sich wiederum als Gebrauchswert für jemanden erweisen muss.
Dreh- und Angelpunkt dieses Widerspruchsprozesses (wechselseitige Begründung von Gegensatzverhältnissen) ist, dass er nur gelingen kann durch den unmittelbar gesellschaftlichen Charakter von „abstrakter Arbeit“, „Arbeit an sich“. Arbeit, abgesehen von jedem Inhalt und Zweck, als bloße Verausgabung von Arbeitskraft ist Teil der gesellschaftlichen Arbeit, wirkt „wertbildend“ und stellt einen proportionalen Teil des gesellschaftlichen Wertprodukts dar, das sich erst nachträglich auf dem Warenmarkt als real zu bewähren hat. Dieser im Produktionsprozess begründete, aber noch nicht realisierte gesellschaftliche Wert muss sich in einer verselbständigten, dinglichen Form darstellen – eine Ware muss ausgesondert werden, um den Wert aller anderen Waren darzustellen. So ist die Geldform sowohl notwendiges Produkt des widersprüchlichen Charakters der Ware, als auch durch diesen Ursprung selbst von Widersprüchen bestimmt. Sie ist einerseits dingliches Äquivalent des gesellschaftlichen Reichtums als „ungeheure Warenansammlung“, Repräsentant der geleisteten „Arbeit an sich“ (Geld als Maßstab der Werte); in der realisierten Preissumme dagegen repräsentiert sie die sich als real gesellschaftlich nützlich erwiesene Arbeit (Geld als Zirkulationsmittel); schließlich erlaubt sie als „Wertspeicher“ im Sparen oder Verleihen die zeitliche Verschiebung seiner Nutzung als Äquivalent (Geld als Zahlungsmittel). Durch die Beziehung zur Wertsumme aller Waren, modifiziert durch die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes als Zirkulationsmittel einerseits und die Sparquote (Bestimmung der Masse der Zahlungsmittel) andererseits erweist sich das Geld als Maß der Werte entweder als „überbewertet“ oder als „unterbewertet“ (Inflation oder Deflation).
Dabei ist der Geldwert als Vergleichsmaßstab zu dem so bestimmten Warenäquivalent im Zeitalter des Kreditgeldes nicht mehr einfach durch das Verhältnis von Banknoten zur Golddeckung und den Goldpreis bestimmt. Vielmehr ist die gesellschaftliche „Liquidität“, das Verhältnis der in Umlauf gebrachten Kreditgeldmenge zur wahrscheinlichen Kreditausfallhäufigkeit wesentlich für die Frage, inwieweit Geldentwertung stattfindet oder nicht. So ist der Geldwert heute kaum mehr von einem in realen Depots gelagerten vergoldeten Warenberg abhängig, sondern bestimmt durch eine sehr viel weniger greifbare Warenmenge, die jeweils zufällig für die Liquidität der Geldschöpfer zu unterschiedlichsten Zeitpunkten wesentlich wird.
Von daher wird verständlich, dass die mit der Kreditkrise seit 2007 auftretenden Turbulenzen natürlich wesentliche Auswirkungen auf das Geldsystem selbst hatten und haben. Die schwerwiegendste davon ist das Auftreten des „Sturms auf die Bank“ – ein Phänomen, das sich anders als in den klassischen Finanzkrisen diesmal meist wenig sichtbar, dafür aber viel heftiger, auf elektronischem Weg abspielte. Dabei versuchen Inhaber unsicherer „Geldzeichen“ diese in möglichst hartes Geld umzuwandeln – und dies in für die Reserven der Banken bedrohlichen Maßen. Dies setzt sich fort in der Umwandlung auch von hartem Zentralbankgeld in noch härtere „Geldware“, wie Edelmetalle, Rohstoffe und ähnliches. Schließlich muss der Geldwert durch Staat und Zentralbanken gesichert werden durch Rettung der Bankenliquidität auf Kosten von Staatsverschuldung und massiver Ausweitung der Geldmenge (als Zentralbankgeld).
Die Bankenrettungspakete und die Politik des offenen Geldhahns der Zentralbanken waren tatsächlich nach dem Crash im September 2008 für das kapitalistische Geldsystem „lebensnotwendig“. Andernfalls hätte die Entwertung von mehr und mehr Kreditgeldsegmenten zu einem immer umfassenderen Zusammenbruch von Wegen des Zahlungsverkehrs geführt, der letztlich weite Teile des Welthandels gefährdet hätte. Da die meisten größeren Geschäfte auf Kreditgeldbasis ausgeführt werden (G-W vorgezogen, W-G nachgeordnet oder mit Gegengeschäften verrechnet), muss der Vertrauensverlust in das G als Kreditgeld zum Zusammenbruch des normalen Geschäftsbetriebes führen. Auf dem Höhepunkt der Krise 2008 brach so auch eines der wichtigsten Finanzierungsmittel des Welthandels, der „Akkreditiv“, zusammen (7). Plötzlich konnten Käufer von Importgütern ihre Geschäfte nicht mehr zu Ende führen, und Schiffe wurden stillgelegt: innerhalb kurzer Zeit fiel der Baltic Dry Index, ein Index, der die Frachtraten der Seeschifffahrt erfasst, um 89%.
Hierin drückt sich aus, dass in der Funktion des Geldes in der Warenmetamorphose die Möglichkeit der Krise selbst angelegt ist: „Die Zirkulation sprengt die zeitlichen, örtlichen und individuellen Schranken des Produktenaustausches eben dadurch, dass sie die hier vorhandene unmittelbare Identität zwischen dem Austausch des eigenen und dem Eintausch des fremden Arbeitsprodukts in den Gegensatz von Verkauf und Kauf spaltet. Dass die selbständig einander gegenübertretenden Prozesse eine innere Einheit bilden, heißt ebenso, dass ihre Einheit sich in äußeren Gegensätzen bewegt. Geht die äußerliche Verselbständigung der innerlich Unselbständigen, weil einander ergänzenden, bis zu einem gewissen Punkt fort, so macht sich die Einheit gewaltsam geltend durch eine – Krise. Der der Ware immanente (…) Widerspruch erhält in den Gegensätzen der Warenmetamorphose seine entwickelten Bewegungsformen. Diese Formen schließen daher die Möglichkeit, aber auch nur die Möglichkeit der Krisen ein“ (8). Insbesondere mit der Bewegungsform des Kreditgeldes entwickelt sich die Krise zur Geldkrise, in der die Warenmetamorphose ohne das Wiederauftauchen von „harter Geldware“ auf äußerste in Frage gestellt ist: „Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit seine (des krisen-getroffenen Bürgers, d.A.) Seele nach Geld, dem einzigen Reichtum. In der Krise wird der Gegensatz zwischen der Ware und ihrer Wertgestalt, dem Geld, bis zum absoluten Widerspruch gesteigert“ (9).
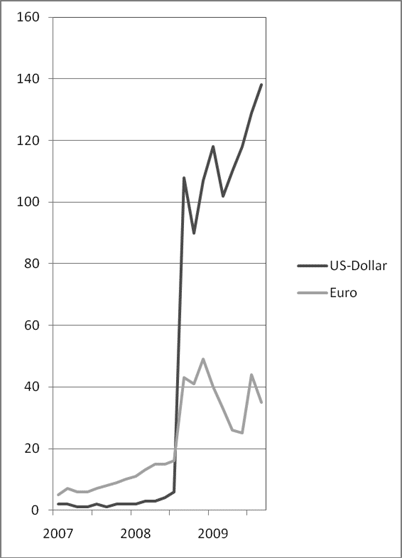
Abbildung 1: Entwicklung der Geldmenge – USA und Eurozone 2007-2009 (10)
Insofern war es tatsächlich „systemrelevant“, dass die am Abgrund torkelnden Finanzkapitale in der Krisenperiode Herbst/Winter 2008/2009 mit einer waren Sintflut von Geld vollgepumpt wurden. Um nur an die Aktivitäten der US-Zentralbank zu erinnern:
Um die 300 Milliarden Dollar kaufte die FED US-Regierungsanleihen auf (eine Umschreibung für „Geld drucken“ im Kreditgeldzeitalter).
Für 1 Billion Dollar übernahm die FED „faule“ Immobilienkredite.
Die Absenkung der Leitzinsrate auf fast 0% führte zu einem Abrufen von über einer weiteren Billion Dollar durch die Banken, zum Teil mit für Zentralbankkredite ungewöhnlich langen Laufzeiten (z.B. Einjahreskredite).
Das Ergebnis dieses Geldsegens war eine Ausweitung der Geldmenge von Anfang 2007 bis Mitte 2009 um 138% in den USA – und mit ähnlichen Mitteln um fast bescheidene 35% in der Euro-Zone (siehe Abbildung 1: Entwicklung der Geldmenge – USA und Eurozone 2007-2009).
Diese Ausweitung der Geldmenge nach dem September 2008 ging einher mit einem scharfen Einbruch der Wirtschaftsleistung – das US-BIP sank nach dem Horrorjahr 2008 nochmals um 2,6%, während das deutsche BIP um 5% einbrach. Normalerweise ist eine solche Auseinanderentwicklung von Geldmenge und Wirtschaftswachstum notwendigerweise mit Inflation verbunden. Nicht so 2009: Denn während die Banken wie Vampire heftig Geld von den Zentralbanken und Regierungen saugten, fiel ihr Kreditvolumen an ihre eigenen Kunden dramatisch. Sowohl US- als auch Euro-Banken reduzierten ihre Umsätze (d.h. ihr Kreditgeschäft) um zweistellige Prozentsätze. Weil sie faule Papiere an den Staat abgeben und durch günstiges Zentralbankgeld die Verluste auffangen konnten, die durch die Abschreibung von Kreditausfällen entstanden waren, konnte eine großer Teil der Banken trotz Krise Bilanzgewinne verbuchen. Der Zweck der Operation, Bankenanstürme zu vermeiden und Spekulationswellen gegen „systemrelevante“ Banken zu verhindern, wurde erreicht.
Diese in höchstem Maße widersprüchliche Situation von enormer Kreditgeldausweitung auf Seiten der Zentralbanken und Kreditgeldschrumpfung auf der Seite der Nicht-Finanzwirtschaft bedeutet, dass sich in der rezessiven Nicht-Finanzwirtschaft „Geldmangel“, Nachfrageschwäche, ja sogar Deflationsgefahr breit macht. Dies wird noch durch die typischen Merkmale der „neoliberalen Globalisierung“ verstärkt: Lohndumping, niederpreisige Importware, wachsende Sparquote in den „Exportnationen“, etc.. Auf der anderen Seite findet sich eine wahre Sintflut von Geld in der „Liquiditätsfalle“ des Finanzkapitals – eine Erscheinung, die John M. Keynes als Charakteristik für die Zeit nach dem Crash 1929 und Auslöser für die Depression in den 30er-Jahren analysiert hat (11). Keynes zog die Konsequenz, dass nur Staatsintervention, sprich Konjunkturpakete und staatliche Einflussnahme auf die Kreditvergabe (z.B. durch Verstaatlichungen) aus dieser Liquiditätsfalle führen können – und so zum „Anspringen“ des kapitalistischen Motors führen. Im Wesentlichen wurde dieser Teil seiner Ratschläge befolgt, was zumindest ab der zweiten Hälfte 2009 zu einem gewissen Wiederanspringen der Konjunktur in den G20-Ländern geführt hat. Insgesamt wurde von den G20-Ländern staatlicherseits etwa 1,5 Billionen Dollar in Konjunkturpakete und ähnliches investiert – mit dem Ergebnis von im Vergleich zu den dramatischen Einbrüchen schwächlichen Wachstumsraten. Trotzdem birgt dieser „Aufschwung“ eine neue Gefahr: die enorme in den Banken aufgehäufte Geldmenge drängt in gewinnbringende Anlagen. Bei den mickrigen Margen in der Realwirtschaft sind die „Aufschwungserwartungen“ eine willkommene Grundlage für neue Spekulationsblasen.
Zusätzlich birgt die anziehende Nachfrage, die sich wieder ausweitende Kreditierung auch der „Real-Wirtschaft“ und der verstärkte Bedarf an Rohstoffen, in Kombination mit der weiter andauernden Geldentwertung durch Kreditausfälle auch die Gefahr, dass sich die Ausweitung der Geldmenge auch tatsächlich in Inflation auswirkt. Schon vor dem Crash 2008 drohten Kreditausfälle und spekulatives Hochtreiben der Rohstoffpreise die Rezession mit Inflation zu paaren – ein Schreckensszenario, das nun den schwachen Aufschwung im Keim ersticken könnte (wenn die Zentralbanken ihre Geldpolitik aufgrund von Inflationsgefahr völlig umpolen müssten).
Die Grenzen der expansiven Geld- und Finanzpolitik, d.h. von Kreditexpansion und Staatsverschuldung sind sicherlich erreicht. Die Liquiditätsprobleme der Privatbanken und ihre „Risiken“ wurden im Großen und Ganzen auf die Staatshaushalte verschoben. Nunmehr droht neben Inflation und durch Haushaltskürzungen gedrückte Konjunktur vor allem auch die Gefahr, dass ganze Staaten am Rande des finanziellen Abgrunds stehen. Das Beispiel Griechenlands zeigt, wie sich jetzt die Liquiditätskrise vom Bankensektor auf die Staaten verlagert hat, die ihre kurzfristigen Verbindlichkeiten nur noch erfüllen können, indem sie horrende Renditen für Staatsanleihen versprechen – doch selbst dafür immer weniger Geld auftreiben können. Wenn der Staat nicht mehr in der Lage ist durch Expansion seines Kreditgeldes für Liquidität zu sorgen, dann muss diese Rolle offensichtlich vom „Geld als Weltgeld“ erfüllt werden. Im Falle von Griechenland wird so ein ganzes Land unter die Kontrolle des Euro-Finanzkapitals gestellt (der Euro ist heute neben dem Dollar zum Bestandteil des Weltgeldes geworden). Im Fall von Dubai waren es die Petro-Dollars der Nachbarstaaten. Spanien, Portugal, Irland und Italien werden als nächste in der Reihe in Europa genannt, während in den USA der größte Bundesstaat Kalifornien unter Schuldenverwaltung steht. Für eine Vielzahl anderer, vor allem halbkolonialer, Länder (auch in Europa) ist wiederum das IWF-Schuldenmanagement am Werk. In jedem Fall ist eine große Zahl weiterer Staaten auf dem Weg in diese Richtung – und damit ist auch ein neues Spekulationsgeschäft eröffnet, das horrende Gewinne verspricht. Zusätzlich ermöglicht die finanzielle Notlage der Staaten nunmehr dem Finanzkapital diesen Staaten eine weitere Welle an Privatisierungen und Deregulierungen aufzuzwingen.
Unter diesen Bedingungen suchen die Zentralbanken und Finanzministerien der imperialistischen Zentren seit einiger Zeit nach der sogenannten „Exit-Strategie“. Es geht um die Frage, wie sich die enorme Geldmenge und die Verstrickung der Staaten (bzw. vor allem ihrer Haushalte) in die Finanzinstitutionen zurückfahren lässt – ohne dass dadurch der nächste Crash ausgelöst wird. Als erstes hat China hier eine Kehrtwende vollzogen, als Mitte Januar 2010 die Zinsen erhöht und die Kreditvergabe stark gebremst wurde. Nicht zufällig führte dies zusammen mit den Problemen in der Euro-Zone zu einem Abbruch der bis dahin seit März 2009 andauernden stetigen Aufwärtsbewegung an den internationalen Börsen. Inwieweit die Exit-Strategien in den imperialistischen Zentren im Laufe der nächsten 1-2 Jahre zu einem neuen Crash führen werden oder nicht – auf jeden Fall werden sie massive Einbrüche in der Realwirtschaft (Austeritätspolitik, Kreditklemmen, keine Hilfen mehr bei Firmenzusammenbrüchen,…) zur Folge haben, die das wahre Ausmaß der Krise für die Arbeiterklasse weiter fühlbar machen werden.
Zinsen, fiktives Kapital und die Auswirkungen auf die „Realwirtschaft“
Im RM 39-Artikel zum Finanzkapital wurde in ausführlicher Form das zinstragende Kapital werttheoretisch aus dem allgemeinen Kapitalbegriff abgeleitet. Hier sei noch einmal an die wesentlichen Punkte erinnert: In der Marx’schen Analyse des Zinses ist dieser nicht etwa der Wert einer besonderen Kapital-Ware (dies ist vielmehr eine der Fetischformen des Kapitals), sondern er ist Verkaufspreis des Eigentumstitels an Kapital, das einem fungierenden Kapitalisten zur Aneignung von Mehrwert dient, mit dessen Realisierung auch die Begleichung des Zinses möglich ist (G-G-W-G‘-G‘). Über den Ausgleich der Profitraten zur Durchschnittsprofitrate für das produzierende Kapital ist damit ein allgemeiner Kapitalzinssatz möglich, der unabhängig von der speziellen Art des fungierenden Kapitals rein auf Grund von Angebot und Nachfrage auf dem Kapitalmarkt gebildet wird.
Im zinstragenden Kapital sind sämtliche seiner Voraussetzungen verschleiert: die Genese von Waren- und Geldform; die Verwandlung aller Produktionsbedingungen in Warenkapital, welches durch Lohnarbeit verwertet wird; die Verwandlung von Geld in Geldkapital; die Einheit von Produktions- und Zirkulationsprozess als Akkumulationsprozess des Kapitals; die Herausbildung einer gesellschaftlichen Durchschnittsprofitrate, sowie seiner langfristigen und konjunkturellen Entwicklungstendenzen. Trotzdem sind alle diese Bedingungen in den Bewegungsformen des zinstragenden Kapitals wirksam (aufgehoben) und mit ihm aufs engste verwoben – und nur in ihrem Zusammenhang lassen sie sich auch analysieren. Letztlich basieren sie alle auf dem Eigentum an vergegenständlichter fremder Arbeit (und dessen Reproduktion) als Grundlage der Aneignung von mehr fremder Arbeit auf erweiterter Stufenleiter. Zins ist eine Form der Aufteilung des Profits, ein Mittel zur Aneignung fremder Arbeit, ohne selbst den Prozess der industriellen oder kommerziellen Profitwirtschaft durchlaufen zu müssen. Ohne entsprechende Entwicklung der Profite muss daher auch der Zins nachgeben – auch wenn er, abgeleitet vom Durchschnittsprofit, mehr zeitliche und räumliche Bewegungsfreiheit hat als industrielles oder kommerzielles Kapital.
Als abgeleitete Größe – abhängig von den längerfristigen und untergründig vor sich gehenden Ausgleichungstendenzen der Profitraten – hat das zinstragende Kapital keinen eigenständigen Wert oder „natürlichen Zins“. Der Zins bildet sich zu gegebenen Zeitpunkten (stündlich, täglich, monatlich…) auch immer entsprechend dem Verhältnis von Angebot und Nachfrage in der willkürlichen Spanne zwischen Null und den durch die Profitratenbewegungen bestimmten Grenzen. Er ist somit im Gegensatz zu den sonstigen Warenmärkten wirklich ein Beispiel für das Gesetz von Angebot und Nachfrage (ohne Schwankung um einen tatsächlichen Wert). Aufgrund seiner zeitlich fixierbaren Festlegung in Kursbewegungen von Raten erscheint der Zins an der Oberfläche als die Erscheinungsform der Durchschnittsprofitrate: „Die Durchschnittsprofitrate erscheint nicht als unmittelbar gegebene Tatsache, sondern als erst durch Untersuchung festzustellendes Endresultat der Ausgleichung entgegengesetzter Schwankungen. Anders der Zinssatz. Er ist in seiner, wenigstens lokalen, Allgemeingültigkeit ein täglich fixiertes Faktum, das dem industriellen und merkantilen Kapital sogar als Voraussetzung und Posten bei seinen Operationen dient“ (12).
Diese Erscheinungsform ist Grundlage einer weiteren „Wertillusion“: Mithilfe des Zinses lässt sich ein sogenannter „Kapitalwert“ bestimmen – das ursprünglich investierte Geld mitsamt Verzinsung über die gesamte Laufzeit. Durch Diskontierung des Kapitalwerts auf jeglichen Zeitpunkt zwischen Investition und Kapitalrückfluss, lässt sich der „Kapitalwert“ als variable Größe auch zu diesen Zeitpunkten berechnen. Auf diese Weise kann jegliche Kapitalanlage (bezeichnenderweise vielfach „Risiko“ genannt) auch mehr oder weniger jederzeit „kapitalisiert“, verbrieft und als Wertpapier gehandelt werden. Mit dem Kapitalwert wird die Bewegungsform des zinstragenden Kapitals um die des fiktiven Kapitals erweitert – Kapital hat sich endgültig in (nur fiktiv Wert tragenden) Eigentumstitel und reales, fungierendes Kapital geteilt. Aufgrund seiner Genese verhält sich der Wertpapierkurs in umgekehrtem Verhältnis zum Zins (13) – de facto wird sich der Wertpapierkurs gegenüber dem Zinssatz jedoch verselbständigen und selbst von Angebot und Nachfrage abhängen. Nur in letzter Instanz werden Zinssatz und Wertpapierkurs mehr oder weniger gewaltsam in Gleichgewicht zur tatsächlichen Ausgleichung der Profitraten tendieren. Mit der Einberechnung des fiktiven Kapitals (mit seinem „aktuellem Kapitalwert“) in die Bilanzen von Unternehmen und Volkswirtschaften lebt auch die politisch-ökonomische Wahrnehmung der Realität in fiktiven Welten, um nur kurzfristig während der Krisen auf den Boden der Realität geholt zu werden. Da die Bewertung des fiktiven Kapitals auf Erwartungen in zukünftigen Profitrückfluss beruht, wird ein immer größer werdender Teil der Gesamtökonomie von Spekulationen auf ungewisse räumlich-zeitliche Tendenzen der Profitratenentwicklung abhängig. Da die reale Tendenz der Profitratenentwicklung zumeist keine großen Spielräume erlaubt, muss sich diese positive Kapitalwert-Erwartung mehr und mehr selbst auf spekulative Anlagefelder beziehen.
Mit Blick auf die Entwicklung der gegenwärtigen Finanzkrise ergeben sich aus diesen Überlegungen unter anderem folgende Fragen: Welche Tendenzen lassen sich aus der Zinsratenentwicklung ablesen? Inwiefern wurde das fiktive Kapital „berichtigt“? Wie stellt sich die Rückwirkung des Finanzsektors auf die Realwirtschaft dar?
Zunächst sollte noch klar sein, dass es „die Zinsrate“ natürlich nicht gibt – auch wenn ihre verschiedenen Ausprägungen auf der Durchschnittsprofitrate beruhen. Gerade ihre starke Marktabhängigkeit bedeutet, dass sich die Zinsrate in verschiedensten Raten darstellt: langfristige/kurzfristige, Zinsen für Kredite an unterschiedlich „bewertete“ Gläubiger (gute Bonität = „prime“ = „AAA“,…; schlechte Bonität = „sub-prime“ = „B“, etc.), Zinsen für verschiedene Anlagetypen (z.B. Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, etc.), Zinsen für verschiedene Kreditinstitute (z.B. Geschäftsbanken, Inter-Bankenkredite, Zentralbanken) – und dies auch noch in verschiedensten Kombinationen. Genauso differenziert ist natürlich auch der Wertpapiermarkt, der über die verschiedensten Arten von Termingeschäften und über „Strukturierung“ von Wertpapieren eine ganze Stufenleiter von „abgeleiteten“ Wertpapiermärkten erlaubt (z.B. Derivate zur Absicherung von Kursverlusten).
In Abbildung 2 wird die Entwicklung wichtiger Zinsarten in den USA seit den 50er-Jahren veranschaulicht anhand des Leitzinses (FED Rate), dem Zins für AAA-geratete Unternehmensanleihen, sowie dem normalen Geschäftsbankzins und dem Zins für 10-jährige Staatsanleihen. Dabei ist wichtig, dass speziell der Zins für die prime-gerateten Unternehmensanleihen für Kapitalwertberechnungen von Investitionen oder z.B. Rentenwerten dient. So wird auch deutlich, dass die Bewegung des Leitzinses nicht gleichbedeutend ist mit der Zinsentwicklung. Er ist wesentlich für den Geschäftsbankzins, aber nicht unbedingt für Unternehmensanleihen und langfristige Anlagen.
Natürlich stellen Leitzinssenkungen immer eine Möglichkeit zur Steigerung der Gewinnspanne der Banken dar. Deutlich wird an der Abbildung, dass es nach dem sogenannten Volcker-Schock der frühen 80er-Jahre (Reagans FED-Chef Volcker erhöhte angesichts der Inflationstendenzen der 70er-Jahre gemäß monetaristischer Lehre die Zinsen schockartig) zu einem tendenziellen Absinken des Zinsniveaus kam. Die fallenden Zinsen insbesondere ab den 90er-Jahren waren jeweils eng verknüpft mit spekulativen Bewegungen im Wertpapiersektor (insbesondere wenn die Zinsen trotz Rezession niedrig bleiben!). Die jeweils kurzen Zwischenerhöhungen sind nicht zufällig mit dem Auftreten von Finanzkrisen verknüpft: Tequila-Krise/Mexiko 94/95, Asienkrise 97, Dotcom-Blase/Argentinien 99/2000, schließlich die Subprime-Krise nach 2005.
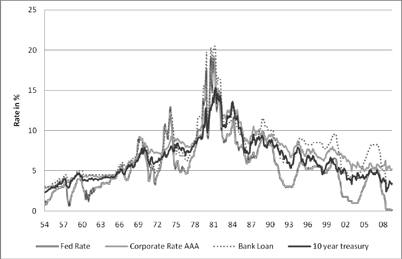
Abbildung 2: Zinsratenentwicklung USA 1954-2008 (Quelle: FED-Website)
Mit dem Crash 2008 wurde der Leitzinssatz fast gegen Null gesenkt. Natürlich hat dies mitsamt den anderen schon geschilderten Maßnahmen zur Öffnung der „Geldschleusen“ eine Wiederbelebung von spekulativen Wertpapiergeschäften zur Folge. Es ist so kein Wunder, dass der Dow Jones von März 2009 bis Jahresende um fast 20% stieg, während das BIP um 2,5% sank (beim DAX sind die Verhältnisse sogar noch extremer). Ebenfalls drohten im Herbst 2008 bis zum Gegensteuern der Zentralbank die Zinsen für Unternehmensanleihen (AAA) von ihrem stabilen Niveau um 5,4% in die Höhe zu schnellen. Tatsächlich schnellten Kreditzinsen für nicht-prime Unternehmen sogar über die 10%-Marke. Auch wenn sich in Folge die Zinsen für AAA-Unternehmen stabilisieren ließen, bleiben die Zinsen für die schlechter bewerteten Unternehmen auf hohem Niveau (um die 9%).
Da viele Firmen, die nicht zu den ganz großen Unternehmen gehören(bei denen Liquiditätsprobleme zumeist zu Staatshilfen führen, wie bei GM zu sehen), in Zeiten der Rezession schnell vom Absinken ihrer Eigenkapitalquote betroffen sind, bedeutet dies für viele dieser Unternehmen schnell auch „Kreditunwürdigkeit“, also nicht leistbare Kreditkonditionen, Zahlungsschwierigkeiten, bis hin zur Insolvenz. Insofern bedeutet diese Spreizung zwischen niedrigen Zentralbankzinsen und hohen Kreditzinsen für „Normalunternehmen“ einerseits eine Sanierung der Bankengewinne, andererseits eine massive Welle von Firmenzusammenbrüchen gerade in Industrie und Handel aufgrund der „Kreditklemme“. Bleibt zu erwähnen, dass die Zinsgewinne der Banken sich letztlich aus den Profiten von Industrie und Handel ableiten. Derzeit drückt sich dies in einem mit der Gewinnstabilisierung einhergehenden Schrumpfen des Umsatzes der Banken aus. Gleichzeitig ist die Rate der Kreditausfälle jedoch weiterhin hoch (auch wegen der Insolvenzen) und kann daher verzögert wiederum zum Gewinneinbruch bei den Banken führen. Es gibt keinen Münchhausen-Trick für das Finanzkapital, wenn die Konjunktur nicht wirklich kräftig anspringt.
Zur Frage des fiktiven Kapitals. Das Ausmaß der aktuellen Fehlbewertung von fiktivem Kapital wird sicherlich an der Subprime-Krise am deutlichsten. Die Literatur (14) zu dieser Krise ist inzwischen sehr umfangreich und gibt gute Einblicke in die Bewegungsformen von fiktivem Kapital. Gerade die höheren Zinsraten für US-Häuslebauer mit geringer Bonität ermöglichten bei sinkenden Zinsen die gewinnbringende Kapitalisierung der entsprechenden Schuldverschreibungen. Solange die Zinsen fielen (und die Schuldner sich so immer wieder refinanzieren konnten) und die Immobilienpreise stiegen, waren somit gerade diese Subprime-Papiere äußerst lukrativ. Zudem konnten die „Risiken“ durch die Unterbringung dieser Papiere in strukturieren Fondspapieren mit AAA-Bewertung breit gestreut werden – tatsächlich stellte sich heraus, dass diese Streuung fast die ganze Welt und Finanzwirtschaft umfasst.
Der Umfang dieser Scheinblüte wird klar, wenn man bedenkt, dass in den Jahren 2002 bis 2005 mehr als die Hälfte aller neu geschaffenen Jobs in den USA mit dem Bau- und Immobilienboom zu tun hatte. Der gesamte Zuwachs des privaten Konsums in den USA in diesem Zeitraum wird von der FED auf dieses Segment zurückgeführt. Allein die Provisionen, die Investmentbanken noch 2006 mit Securitization erzielen konnten, hatten sich in fünf Jahren auf 5,6 Milliarden Dollar verdreifacht, die Hälfte davon im Hypothekenbereich. Im Jahr 2003, dem Höhepunkt der Spekulationswelle wurden allein 4 Billiarden US-Dollar mit Hypotheken umgesetzt (15). Bis Ende 2006 war dies auf 2,5 Billiarden zurückgegangen, im Hypothekengeschäft brachen die Margen wegen Überkapazitäten und beginnendem Kreditausfall weg. Die Pioniere der Branche wie Bear Stearns und Goldman Sachs waren die ersten, die sich rechtzeitig aus dem Geschäft zurückzogen.
Tatsächlich ist der Wertpapiermarkt – anders als vielfach behauptet – kein Nullsummenspiel, bei dem die Verluste der einen die Gewinne der anderen sind. Denn sobald die dem Wertpapier zu Grunde liegenden Werte ausfallen, stehen die Verluste der Besitzer des Eigentumstitels in keinem Verhältnis mehr zu den Gewinnen derjenigen, die rechtzeitig verkauft haben. Zusätzlich gibt es die unmittelbar vom Wertverlust Betroffenen, also z.B. die delogierten Immobilienbesitzer. Mit dem Ausbruch der Subprime-Krise waren also nicht bloß die unmittelbaren Eigner solcher Papiere oder davon abgeleiteter Fondspapiere betroffen, sondern die Masse der Vermögensverluste betraf die Zahlungsfähigkeit eines großen Teils der Gläubiger der Finanzwirtschaft – womit ein Domino-Effekt von Liquiditätsproblemen eintrat, der auch Gewinner der Subprime-Aktion, wie Bear Stearns heftig treffen konnte. Nur Goldman Sachs, die rechtzeitig zusätzlich in das Geschäft mit Baisse-Spekulation (Derivate auf fallende Kurse, Verluste, Firmenzusammenbrüche,… – jeweils ihrer eigenen Kunden!) eingestiegen war, konnte im Großen und Ganzen unbeschadet durch die Krise tauchen. Daher hat sich ihr CEO, Lloyd Blankfein, seine Rekord-Boni mitten in der Finanzkrise auch redlich verdient (2007: 67,9 Millionen Dollar). „Ich bin bloß ein Banker, der Gottes Werk verrichtet“, äußerte er dazu bescheiden jüngst in einem Interview (16).
Die Maximalkosten der durch die Krise ausgelösten Zahlungsprobleme berechnete der Sonderbeauftragte der US-Regierung für das Bankenrettungsprogramm TARP, Neil Barofsky, mit 23,7 Billionen Dollar (17). Dazu zählen 6,8 Billionen Hilfen für wackelnde Finanzfirmen, 2,3 Billionen für die Einlagesicherung, 7,4 Billionen für die Stabilisierungsprogramme des Finanzministeriums, 7,2 Billionen für die Stützung von Hypothekenfinanzierern, vor allem Fannie Mae und Freddie Mac. Macht zusammen etwa das Achtfache eines US-Jahreshaushaltes.
Dies ist sicherlich eine ganz gute Schätzung für den Umfang der Überbewertung von fiktivem Kapital im Gefolge der Subprime-Blase. Wie viel davon tatsächlich „sozialisiert“ gerettet wird und wie viel an Überkapazität durch die Krise vernichtet wird, lässt sich dagegen bisher schwer sagen. Die Indikatoren, wie Größe der Kreditabschreibungen, Delogierungen, Firmenpleiten, Anstieg der Arbeitslosigkeit, sind für die betroffenen US-ArbeiterInnen bestürzend – zeigen in ihrem Ausmaß im Vergleich zum Problem jedoch, dass die Kapitalvernichtung bisher wohl nicht die für die kapitalistische Krisenbewältigung notwendigen Ausmaße angenommen hat. Dazu passt, dass die sogenannten „toxischen Papiere“ aus der Immobilienkrise an der Wall Street längst wieder in neue Anlageformen verpackt werden – die sogenannten Re-Remic („Resecuritization of Realestate Mortgage Investment Conduit“) (18): die alten, unverkäuflichen Wertpapiere werden neu aufgeschnürt, die darin enthaltenen Hypotheken neu sortiert, so dass die vermeintlich „guten“ nun wieder das AAA bekommen. Und nicht nur hier beginnt „das Spiel“ von neuem.
Längst fließen die Milliarden wieder zurück an die Wertpapiermärkte, aus denen sie in Panik abgezogen worden waren. Über 200 Millionen riskieren die Händler von Goldman Sachs schon wieder pro Tag. Schon wurden in einigen Ländern auch hoch-riskante Geschäfte, die nach dem Crash 2008 verboten worden waren, wieder zugelassen: So hat jüngst das Finanzministerium den ungedeckten Leerverkauf für Finanztitel wieder freigegeben – sehr zur Freude aller Hedge-Fonds, die sich wieder munter tummeln. War im Herbst 2008 noch das Ende solcher Fonds und der Investmentbanken vorhergesagt worden, so sind sie heute die ersten, die wieder Rekordgewinne und Expansion vermelden können. Die Turbulenzen nach der Ankündigung von US-Präsident Obama, dass er eine strengere Regulierung gerade solcher Geschäfte anstreben würde, sind mehr als gespielt: so sehr wie gerade die Obama-Administration mit Lobbyisten von Goldman Sachs und Co durchsetzt ist, ist nicht zu erwarten, dass diese „Reform“ zu deren Schaden sein wird.
Zur Frage der Auswirkungen auf das Realkapital. Es wurden in diesem Artikel schon eine Reihe dieser Auswirkungen analysiert: die Probleme für die Abwicklung des Welthandels in Finanzkrisen; die Kreditklemme für die Realwirtschaft (wenn auch nach Sektoren unterschiedlich); die Schwierigkeit der Finanzierung von Großgeschäften. Dazu kommt die Bedeutung des Finanzsektors für die Finanzierung von Großinvestitionen gerade am Beginn von Konjunkturzyklen, sowie seine Bedeutung bei der Zentralisation und Konzentration von Kapital (siehe detailliert im RM 39-Artikel). Gerade im Monopolkapitalismus ist die Kapitalaufbringung für Neugeschäfte die gewinnbringendste Aktivität des Finanzkapitals („Gründergewinn“ bei Hilferding), die Dividenden oder Zinsen bei weitem in den Schatten stellt.
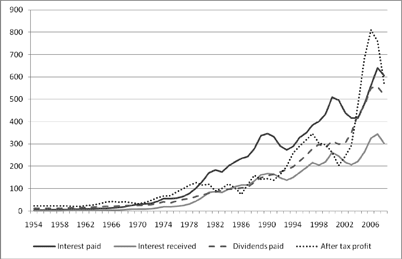
Abbildung 3: Komponenten des Profits von nicht-finanziellen US-Unternehmen (Mrd. US Dollar) (19)
Abbildung 3 zeigt die Entwicklung von Unternehmensgewinn im Verhältnis zu den Lasten der Finanzwirtschaft auf das nicht-finanzielle Kapital in den USA von 1954 bis 2007. Es wird deutlich, dass die re-investierbaren Unternehmensgewinne seit den 70er-Jahren deutlich hinter den Zins- und Dividenden-Verpflichtungen hinterher hinken. Nach einer gewissen Entspannung zwischen 1991 und 1996, gefolgt von einem erneuten Rückschlag um den Jahrtausendwechsel, schienen sich die Probleme der Profitabilität während der Subprime-Blase gelöst zu haben. Offensichtlich wurden auch bei vielen Nicht-Finanz-Unternehmen die Bilanzen mit „wertgestiegenen“ Papieren aufgefrischt. Somit hat die Finanzkrise auch unmittelbare Auswirkungen auf die Gewinnsituation dieser Unternehmen. Mit den steigenden Zinslasten wird so die Finanzierungsproblematik für die Unternehmen nochmals verschärft.
Andererseits ist auch bekannt, dass mit der seit den 80er-Jahren gesteigerten Abgabenquote des produktiven Kapitals an das Finanzkapital, der Druck auf Absenkung der „Steuer- und Abgabenlasten“ gegenüber dem Staat immer größer wird. Mitsamt den Einbrüchen bei den Steuereinnahmen durch die Krise wird dies die Haushaltsprobleme der sowieso schon durch die Rettungspakete hoch verschuldeten Staatshaushalte nochmals verschärfen. Die Kabarett-Einlage der deutschen Bundesregierung mit der Verkündung von Steuersenkungen mitten in der Finanzkrise ist hier nur ein dilettantischer Vorbote eines drängenden Widerspruchs der nächsten Jahre.
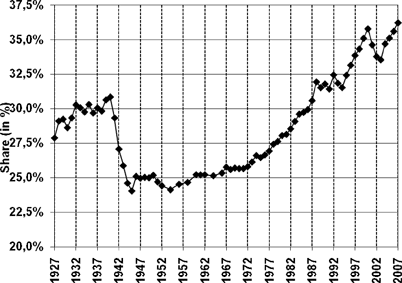
Abbildung 4: Anteil der Top 10% Gehaltsempfänger am US-Lohneinkommen (Quelle: Piketty/Saez)
Abbildung 4 zeigt, dass der tatsächlich in den Bilanzen ausgewiesene Unternehmensgewinn nicht den tatsächlich vom fungierenden Kapital angeeigneten Gewinn wiedergibt. Der Teil der als „lohnabhängig“ geführten Top-Verdiener ist in den USA besonders seit den 90er-Jahren extrem angestiegen. Diese „oberen 10%“, mit einem Jahres-Durchschnittsverdienst von 250.000 Dollar, arbeiten im Management, in Aufsichts- und Finanzpositionen, die einen großen Teil ihrer Einkünfte als „Funktionäre des Kapitals“ über Gewinnbeteiligungen, Boni, Aktienoptionen oder ähnliches beziehen. Der Anstieg der Verdienste dieser Beschäftigten auf über ein Drittel der Gesamtverdienste zeigt, dass die absolute Mehrwertrate weitaus stärker gesteigert wurde, als der 3% Rückgang der Lohnquote seit den frühen 90er-Jahren andeutet. Das bedeutet auch, dass diese Schicht von Beschäftigten aufs engste mit dem Finanzkapital verbunden ist und natürlich auch selbst beträchtliche Investoren stellt. Außerdem zeigen die Daten, dass es für sie kaum Einschnitte während der Finanzkrise gab.
Insgesamt wird das produktive Kapital auf diese Weise immer mehr von einem parasitären System überlagert – ob außer- oder innerhalb des fungierenden Kapitals ist hier ganz egal. Es gibt also kein positives, nicht-parasitäres „schaffendes Kapital“, das vom „reinen Finanzkapital“ erdrückt wird. Das System des Kapitalismus in seiner gegenwärtigen Epoche ist insgesamt vom Kopf her parasitär.
Die Notwendigkeit von Bankenkrisen und Spekulationsblasen in der Epoche des Finanzkapitals
Das zinstragende Kapital erreicht seine enorme Wirkkraft im Kapitalismus durch seine Konzentration in eignen Finanzinstitutionen. Erst durch diese geballte Konzentration von Geldkapital ist Akkumulation auf immer größerer Stufenleiter möglich. Die Finanzinstitutionen konzentrieren die Akkumulations- und Reservefonds des fungierenden Kapitals, die Rücklagen und Versicherungen, die Ersparnisse aus Profiten, Löhnen, Renten, etc um sie für Anlagen verschiedenster Art und Größe zu bündeln. Nebenbei organisieren sie dabei große Teile der Zirkulation, des Zahlungsverkehrs selbst (historisch gesehen ist das die Wurzel des Bankwesens), und senken durch die Ökonomie der Skalenerträge die Zirkulationskosten (auch wenn sie dies durch Gebühren großteils selbst einbehalten).
Entsprechend den unterschiedlichen Funktionen (Anlage/Investitionen, Zahlungsverkehr, Handel von fiktivem Kapital,…), Anlagearten (Hypotheken, Versicherungen, Investitionen,…), dem Umfang und der Dauer etc, gibt es eine große Fülle von Finanzinstitutionen (Geschäftsbanken, Investmentbanken, Fondsgesellschaften, Versicherungen, Finanzmakler,…). Zusätzlich setzt sich, wie überall im Kapitalismus, die Trennung zwischen Kapitaleigentum und fungierendem Kapital durch. So ist das Finanzkapital (als Eigentümer) einer seiner größten Anleger (in sein fungierendes Kapital) selbst, während seine Top-Angestellten ihrerseits Zentralfiguren des Systems darstellen (seine „Charaktermaske“ tragen). Schließlich ist das Finanzkapital, sowohl was seine Eigentümer, als auch was das fungierende Personal betrifft, aufs engste mit dem Kapital der Großkonzerne in Industrie und Handel verschmolzen. Dieses „Monopolkapital“ – wie wir es auf der Grundlage von Lenins Analyse im RM 39 ausführlich entwickelt haben – ist weiterhin das bestimmende Moment der gegenwärtigen Epoche, der Epoche des imperialistischen Monopolkapitals.
Wie kommen nun die Gewinne der Finanzwirtschaft (im Folgenden verkürzt „Banken“ genannt), die oft jedes Maß zu sprengen scheinen, zustande? Wie schon dargelegt, basieren diese Gewinne letztlich auf der Aneignung eines beträchtlichen Teils der Profite des produktiven Kapitals. Diese Aneignung wird in der Zirkulationssphäre vermittelt über den sogenannten „Hebeleffekt“:
Im Wesentlichen ist das Geschäft der Banken dort besonders gewinnbringend, wo es ähnlich funktioniert wie die jetzt so anrüchigen „Leerverkäufe“: man leiht sich kurzfristiges Geld auf Basis geringerer Zinssätze, um langfristige Kredite mit höherem Zinssatz zu finanzieren. Durch die Masse solcher Geschäfte und ihre Zeitverteilung gibt es gewöhnlich genug Rückfluss aus den Krediten um selber die kurzfristigen Verbindlichkeiten zu erfüllen, so dass nur eine kleine eigene Rückstellung zur Absicherung der Verbindlichkeiten notwendig ist („Eigenkapitaldeckung“). Dieser kleine Kapitaleinsatz wird so zum „Hebel“, mit dem große Kreditgeschäfte finanziert werden können, die weitaus mehr Zinsgewinn abwerfen, als die eigenen Finanzierungszinsen (für die „Einlagen“). Diese Bewegungsform lässt sich in folgender Formel für das Bankkapital zusammenfassen:
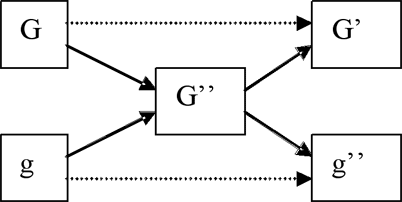
Hier stellt G das Einlagekapital der Gläubiger der Bank dar, während g das Eigenkapital der Bank symbolisiert. Im Prozess des Bankkapitals ist die Formel des zinstragenden Kapitals enthalten: G-G‘ und (G+g)-G“. Durch die besondere Rolle des Kredits in der Akkumulation ist es nun möglich, dass große Geldmengen weitaus mehr Profit und damit auch Zins abwerfen können als Kleingeld, woraus sich real der Zinsunterschied zwischen dem „normalen“ Zins (G‘) und dem „Hebel-Zins“ (G“) ergibt. Während die Einleger so nur ihr Kapital zum normalen Einlagezins (G‘) zurückerhalten, erhält die Bank das gehebelte Eigenkapital g“=G“-G‘, das bei weitem höher als die normale Verzinsung von g sein wird.
Nehmen wir als Beispiel eine Bank, in die Anleger 1.000.000 Dollar zum Zinssatz von 5% eingelegt haben, und die nun diese Anlage zusammen mit 100.000 Dollar Eigenkapital in eine Investition steckt, die 10% Zinsgewinn verspricht. Wenn das Geschäft gelingt, werden die 110.000 Dollar Zinsgewinn so aufgeteilt: 50.000 Dollar (5% auf die Einlage) fließen an die Anleger der Bank, die restlichen 60.000 jedoch an die Bank selbst – satte 60% Zinsgewinn auf die riskierte Eigenkapitalsumme! Da die Verzinsung des eigenen Kapitals 10% gebracht hätte, wurde durch die Aufstockung des eigenen Kapitals dieser Zinsgewinn um weitere +50% aufgehebelt.
Sei L (für „Leverage“, engl. Hebel) das Verhältnis von Bank-Verpflichtungen zum Bank-Eigenkapital, NIM („net interest margin“ = Nettozinsgewinn) die Differenz von G“ zu G‘ (also die durchschnittliche Differenz von Eingangs- und Ausgangszinsen der Banken) und sei FIM („financial interest margin“ = Finanzzinsgewinn) die Rate der bei großen Finanzinvestments zu erzielenden Zinsgewinne (G“), so ergibt sich als Formel für die Eigenkapitalrendite (engl. „return on equity) RoE:
RoE = FIM + L * NIM
Im obigen Beispiel: 60 (% Eigenkapitalrendite) = 10 (% Finanzgewinn) plus 10 (Hebelwirkung) mal 5 (% Differenz von Finanzgewinn zu Anlegerzins).
Dies bedeutet, dass so lange es eine für das Finanzkapital vorteilhafte Spreizung der Zinssätze gibt, seine Eigenkapitalrendite um so höher sein wird, je höher der Hebel ist, d.h. das Verhältnis von Bankschulden gegenüber dem Eigenkapital der Bank gesteigert wird. Daher ist es eine ganz natürliche spekulative Tendenz des Finanzkapitals diesen Hebel höher und höher zu treiben, und so die „Kapitaldeckung“ zu verringern (engl. „capital ratio“ – das Verhältnis zwischen dem Eigenkapital zum Anlagekapital der Bank, bestehend aus Fremd- und Eigenkapital).
Je mehr sich die Kapitaldeckung in den einstelligen Prozentbereich bewegt, desto mehr stellt sich natürlich die Frage der Liquidität der Bank. Wenn z.B. eine größere langfristige Investition „abgeschrieben“ werden muss, so könnte es geschehen, dass die Bank einen Großteil ihres Eigenkapitals zur Bedienung der kurzfristigen Verbindlichkeiten aufbraucht. Dies wiederum führt zu einem „Vertrauensverlust“ der Anleger und kann zu einem plötzlichen massiven Zurückziehen von Einlagen führen – dem sogenannten „Bankenansturm“. In so einer Situation kann eine Bank innerhalb kürzester Zeit vom Unternehmen mit „Milliardengewinnen“ zum Bankrotteur abstürzen.
Tatsächlich sind solche spekulativen Hebel-Booms mit gefährlichen Kapitaldeckungstendenzen gefolgt von Bankanstürmen und -zusammenbrüchen in der Geschichte des Kapitalismus nicht nur nicht ungewöhnlich, sondern sogar eine notwendige Konsequenz der Bewegungsform des Finanzkapitals. Nach den meisten dieser Crashs wurden dann „Regulationen“ entwickelt, die angeblich das System sicherer machen würden. So etwa der Glass-Steagal Act von 1933 in den USA, dessen Aufweichung in den 90er-Jahren nun als Krisenursache ausgemacht wird. Solche Regulationen beziehen sich etwa auf die Mindesteinlageregelungen (in Bezug auf Zentralbankgeld), untere Grenzen für die Kapitaldeckung (zumindest für Geschäftsbanken), Gewichtung und Bewertung von Risiken (zur Bestimmung von Deckungsgrenzen).
Des Weiteren wurden Institutionen geschaffen, z.B. zur Bankenaufsicht, zur Bewertung von Kreditwürdigkeit (z.B. mit Standards für Abstufungen wie AAA-, subprime, etc.), zur Einlagensicherung (z.B. in den USA die FDIC = „Federal Deposit Insurance Corporation“). Viele dieser Regelungen wurden internationalisiert in den sogenannten „Abkommen von Basel“, mit der „Bank für internationalen Zahlungsverkehr (BIS)“ als zentraler Agentur. Allerdings wurde „Basel II“ von den USA bis heute nicht umgesetzt. Außerdem wurde, wie gesagt, 1999 der Glass Stegal Act aufgehoben. Dieser verbot Banken andere Finanzdienstleistungen zu verkaufen, beispielsweise Maklerdienste oder Versicherungen. Insbesondere sollte mit diesem Gesetz das Geschäft von normalen Einlagebanken (mit Konten hautsächlich für Zahlungsverkehr, z.B. Girokonten) von dem der Investmentbanken (mit Einlagen, die primär für Investitionen gedacht sind), getrennt werden. Für letztere wurde schon unter Reagen 1980/82 in den „Banking Acts“ die Regulierung weitgehend aufgeweicht.
Mit diesen Deregulierungen im Bankensektor und entsprechenden Deregulierungen für internationale Kapitalanlagen („Deregulierung der internationalen Finanzmärkte“) in den 90er-Jahren eröffnete sich ein weites Feld für „Schattenbanken“, „Nichtbanken-Banken“, kurz Banken für Anlage-Arten, die von keiner Regulierung in nationalen Gesetzen oder vom Basel-Abkommen betroffen waren. Diese Institutionen operierten zumeist im Umfeld der großen „Investment-Banken“, zum Teil als unmittelbare Töchter, zum Teil als „Partner“, wenn nötig auch als eingegliederte Einheit. Ihr Hauptzweck bestand üblicherweise in der Transformation von kurzfristigen „Risiken“ (d.h. Schuldenmachen) in hoch-profitable Großinvestitionen, unter Erzielung von schwindelerregenden „Hebelwirkungen“.
So war etwa Lehman Brothers seit 1984 auf das Geschäft mit „Auction Rate Securities“ (20) spezialisiert: Sie boten zinsgünstige langfristige Kredite für große Institutionen an(z.B. dem Hafen von New York); diese Kredite wurden verbrieft und auf wöchentlichen Auktionen gehandelt; da sich immer wieder Käufer fanden, konnten Kurzfrist-Anleger höhere Zinsen als gewöhnlich erzielen, während für Lehmans immer noch eine Zinsdifferenz heraussprang. Im Jahr 2007 war das ARS ein 400 Milliarden Dollar Markt – und natürlich gab es keine FDIC, BIS oder eine sonstige Institution, die auf irgendwelche Mindestreserven oder sonstige Regeln prüfte. Und die ARS waren nur ein sehr kleines „Instrument“ in einer Masse von „innovativen, neuen Finanzprodukten“. Im Jahr 2007 handelten die 5 großen US-Investmentbanken in diesen Sektoren mit einem Kapital, das zwei Drittel des Anlagekapitals aller US-Geschäftsbanken umfasste.
In Abbildung 5 wird der erzielte Hebel („Leverage“) einer typischen Investmentbank – nicht zufällig Lehman Brothers – und den „normalen“ US-Geschäftsbanken in den Jahren 2003-2009 dargestellt. (Lehmans muss dabei leider im 3.Quartal 2008 beendet werden) (Quelle: FDIC)
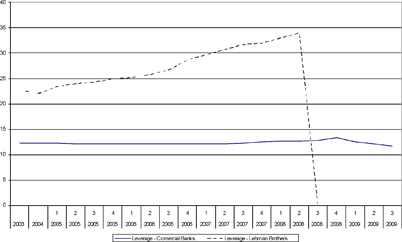
Abbildung 5: Verhältnis von Fremd- zu Eigenkapital Lehman Brothers im Vergleich zu US-Geschäftsbanken (Quelle: FDIC Website)
Es wird deutlich, dass Lehmans am Ende mit einem Kapital operierte, das mehr als 30 mal so groß wie sein eigenes war, (dabei wurde Lehmans von anderen Investmentbanken, z.B. Bear Stearns noch übertroffen!) und damit noch 2007 Rekordgewinne erzielte. Dies ist zu vergleichen mit den Geschäftsbanken, die bloß 12-mal mehr als ihr Eigenkapital bewegten, was einer Kapitaldeckung von 8% entspricht, die damit noch oberhalb der Regulationsgrenzen (6%) liegen. Auch die Kurve der Geschäftsbanken geht Ende 2008 nach oben, da die Turbulenzen nach dem Kollaps von Lehmans, und die folgenden „Bankanstürme“ auch die Eigenkapitaldeckung aller anderen Banken wackeln ließ. Ohne die massiven Hilfen von US-Regierung und FED zur Sicherung der Eigenkapitaldeckung im letzten Quartal 2008 wäre diese Kurve wohl für alle Banken in die Höhe geschnellt – Zeichen für den allgemeinen Bankenansturm.
Tatsächlich erlitten hat das „Schattenbank-System“ diesen Ansturm auf seine „neuen, innovativen Finanzprodukte“. So kollabierte z.B. der ARS-Markt 2008 innerhalb weniger Wochen. Als es immer weniger Käufer für ARS-Papiere auf dem Markt gab, schnellten die Zinsraten für die Papiere in unermessliche Höhen – die Zinsdifferenz wurde für Lehmans negativ, und man verlor eine wichtige Finanzierungsquelle für kurzfristige Verbindlichkeiten. Der Markt für ARS ist verschwunden – wie für viele andere damals „moderne“ Instrumente – nur um heute wieder unter neuen Namen wieder auf zu erstehen.
Die Krise des Schattenbank-Systems ist daher eine logische Fortsetzung der Subprime-Krise: Die großen Profite waren durch das leveraging möglich geworden, durch die enorme Spreizung zwischen „Normalzinsen“ und den in speziellen „hoch-profitablen“ Anlagen erzielbaren Zinsen. Als sich herausstellte, dass ein Großteil dieser „hoch-profitablen“ Anlagen sich tatsächlich in der Spekulationsblase des Marktes für Subprime-Kredite befand, drehte die Zinsspreizung ins Negative – aus dem Hebel für enorme Gewinne, wurde ein Hebel für enorme Verluste („deleveraging“).

Abbildung 6: Kerndaten der US-Geschäftsbanken 2004-2009 (1: nur bis 9/2008; 2: nur die ersten 3 Quartale) (Quelle: FDIC Website)
In der Abbildung 6 können die Auswirkungen der Finanzkrise auf die US Geschäftsbanken studiert werden (Quelle: FDIC). Während sich die Eigenkapitalrendite stabilisiert hat (wenn auch auf niedrigem Niveau gegenüber 2006/2007!) und auch die Kapitaldeckung sogar über dem Wert von 2006 liegt, wird deutlich, dass einerseits immer noch hoher Kreditausfall (2,38% im Vergleich zum Anlagekapital!) auftritt, andererseits auch das Anlagekapital durch Drosselung der Kreditvergabe weiter sinkt (-2,4%). Dieser Gegensatz drückt die Tatsache aus, dass die Bankenrettungsgelder vornehmlich zur Eigenkapitalsicherung verwendet wurden, während sie nicht verhindern konnten, dass die Banken mit der Vergabe von Krediten und deren Konditionen sehr geizig geworden sind. Hinter den -2,4% steht etwa ein zweistelliger Rückgang des Kreditvolumens an die Industrie und vor allem an die Bauwirtschaft (bis zu -20%). Außerdem ist die Situation der Banken sehr unterschiedlich, was Kreditausfall- und Deckungsprobleme betrifft. Während 2008 nur 25 Geschäftsbanken zusammenbrachen (d.h. von der FDIC übernommen und abgewickelt wurden), waren es bis Ende 2009 über 100! Nachdem weitere 552 Banken von der FDIC als „problematisch“ bezüglich der Regulationskriterien eingestuft werden (das sind über 6% der Banken), ist ein Ende der Finanzkrise in den USA damit noch lange nicht in Sicht.
Als die Regierungen der G20-Staaten im Herbst 2008 zur „Rettung der Welt“ einschritten, ihre Bankenrettungs- und Konjunkturpakete ins Rollen brachten und mit Billionenbeträgen den Absturz des Finanzsystems erst einmal verhinderten, gab es allenthalben große Reden über radikale Veränderungen in Bezug auf Banken und Spekulanten. Das „Ende der Finanzwelt wie wir sie kennen“ wurde ebenso beschworen, wie der Spruch „die Steuerzahler werden nicht für das Desaster der Finanz-Hasardeure zahlen“. Zumindest aber wurde eine „entschiedene Regulierung der Finanzmärkte“ als unumgänglich verkündet. Nur etwas mehr als ein Jahr danach können wir feststellen, dass der Machtkampf in der Bourgeoisie (sofern es ihn denn gegeben hat), selbst unter diesen Umständen vom Finanzkapital gewonnen wurde- was nicht verwunderlich ist, sofern nicht die einzige Klasse in diesem System, die eine Alternative durchsetzen kann, das Proletariat, der Bourgeoisie etwas anderes aufzwingt.
Bis heute sind weder der Glass-Steagal-Act oder ähnliche Regulierungen wieder in Kraft, noch sind die Reformen von Basel II irgendwie von der Stelle gekommen. Regulationen in diesem Abkommen wurden für die nächsten 10 Jahre angekündigt. Genug Zeit, um neue Wege für das Schattenbanksystem zu finden. Selbst der „radikalste“ Regulierungsschritt war sehr beschränkter Art: das Verbot von ungedeckten Leerverkäufen auf Finanzwerte. Hierbei verkaufen Banken Aktien, die sie gar nicht besitzen – mit der Vorgabe, sie zu einem bestimmten zukünftigen Termin zu liefern; dabei wird darauf spekuliert, dass bis dahin der Kurs gefallen ist, zu dem man dann die schon teurer verkauften Aktien zur Übergabe beschafft; die Kursdifferenz (minus Gebühren) ist dann der Gewinn. Da diese Spekulation auf Kursverfall von Bankaktien die schlingernden Banken ausgerechnet während der Rettungsaktionen durch Kapitalerhöhungen extrem gefährdeten (viele der Rettungsgelder, die über Aktienkäufe an die Banken fließen sollten, landeten so schlicht bei den Spekulanten), mussten die Finanzbehörden sie verbieten, sollte nicht das ganze Rettungspaket gefährdet werden. Selbst diese logische Maßnahme führte zum „Sozialismus“-Aufheulen der Hedgefonds-Manager und ihrer Lobbyisten – und wie wir heute sehen mit Erfolg. Inzwischen, so meint man in den Regierungen, sei die „Volatilität“ aus den Märkten verschwunden und für solche „Überregulationen“ kein Bedarf mehr (21). Die Finanzwelt ist im Großen und Ganzen schon wieder so wie zuvor. Während die „normalen“ Banken und Unternehmen noch mit den Folgen der Finanzkrise zu kämpfen haben, sind es gerade die „Master of Desaster“, die Investmentbanken, die ihre profitablen Hebelgeschäfte in die Höhe schrauben und Rekordgewinne vermelden. Goldman Sachs verfünffachte seinen Jahresgewinn 2009 gegenüber dem Vorjahr auf 9,5 Milliarden Euro – bei 50,8 Milliarden Euro Eigenkapital also immerhin wieder über 18% Eigenkapitalrendite und einem Leverage um die 14 (man vergleiche dies mit den gewöhnlichen Geschäftsbanken!). Der nächste Crash kann also kommen – und die Akteure werden dann wieder auf Rettung ihrer „systemrelevanten“ Spekulationsmasse rechnen können.
Auch Spekulationsblasen sind im Kapitalismus nichts ungewöhnliches, sondern ergeben sich aus der Bewegungsform des fiktiven Kapitals. Die Grundlage aller Spekulationsblasen bildet die schon beschriebene Kapitalwertbildung – d.h. die aktuelle (verkaufbare, verbriefte) Wertfestsetzung einer erst in Zukunft erzielbaren Kapitaleinkunft. Auf diese Weise können Unternehmungen heftige Gewinne ausweisen, ohne auch nur eine produktive oder sonstige Aktivität vollbracht zu haben, nur aufgrund der Tatsache, dass sie irgendwelche Papiere besitzen, die enorm „an Wert“ gewonnen haben. Mit dieser Wertsteigerung kann nun dieses Unternehmen seinerseits Wertpapiere in den Umlauf bringen, die ebenso an Wert gewinnen. Ähnlich wie beim Pyramidenspiel lässt sich so mit Hilfe des Kapitalwerts ein Kartenhaus aus fiktiven, wachsenden Werten aufbauen, die alle darauf basieren, dass der Wert des ursprünglichen Papiers auch tatsächlich in erwarteter Höhe realisiert wird – etwaige Verluste werden auf das Ende der Kette gestreut.
Um ein Beispiel für die „Mutter aller Finanzspekulation“ zu geben, für den „Gründungsgewinn“, speziell für die Gründung einer Bank:
Nehmen wir zwei Banken X und Y, die jede mit je 5 Milliarden Startkapital beginnen. Die Banken werden als Aktiengesellschaften mit Eingangspreis 1 Euro pro Aktie gegründet. Nun geben sich beide Banken gegenseitig je einen Kredit von 10 Milliarden Euro, mit Verzinsung von 10% über 20 Jahre. Nun sinkt wegen einer allgemein schlechten Lage der allgemeine Zinssatz auf 5%. Damit steigt der Kapitalwert der verbrieften Kredite von X und Y enorm: die Differenz ihres Kredit zu 10% gegenüber dem allgemeinen Kapitalwert zu 5% erscheint als 50%-tiger Gewinn in den Büchern der Banken, also als zusätzliche 5 Milliarden – ohne dass die Banken irgendetwas machen mussten! Sie können diesen nun z.B. zur Hälfte (2,5 Milliarden) an die Gründungs-Aktionäre ausschütten. Diese Dividende und die enorme Eigenkapitalrendite (100%) haben nun natürlich profunde Wirkung auf dem Aktienmarkt, auf dem nun Aktien im ursprünglichen Wert von 1,5 Milliarden angeboten werden. Rentenfonds und andere Kapitalgesellschaften, die nach profitabler Anlage um jeden Preis suchen, reißen sich um die Aktien von X und Y, so dass ein Preis von 2 Euro pro Aktie erzielt wird (was sogar eine angemessene Kurssteigerung im Vergleich zur Gewinnsteigerung darstellt). Damit erzielen die Gründer nun je Bank eine Einnahme von 3 Milliarden – zusammen mit der Dividendenausschüttung also 5,5 Milliarden. Damit haben die Gründer bereits 10% Gewinn gemacht, ohne auch nur eine wesentliche Geschäftsoperation vollzogen zu haben. Selbst wenn die Bank in Zukunft Verlust machen sollte, werden die Gründer noch Gewinn gemacht haben. Das Verlustrisiko liegt nun ganz bei den Kapitalen, die den spektakulären Gründungsgewinnen gefolgt sind (die nur auf Kapitalwertverschiebungen beruhten) und davon zur Investition angeregt wurden. Nicht nur das: auf die beschriebene Weise wurden in Wirklichkeit bereits 5,5 Milliarden Euro für Gründungsgewinn unproduktiv verbraucht, die tatsächlich erst durch die zukünftigen realen Geschäfte herein kommen müssen. Nachdem die außergewöhnlichen Kursgewinne auf spektakulären Wertzuwächsen, d.h. entsprechenden Gewinnerwartungen auf die Zukunft, beruhten, sind die nachfolgenden Investoren in der Gefahr, mit einem Rückgang der Eigenkapitalrendite auf geringere (im Vergleich zur Restökonomie auch noch hohe) Margen und durch Kursrückgänge sofort Verluste zu machen.
Dieses Beispiel erklärt Verschiedenes: einerseits wird deutlich, dass Investmentbanken, die ihre Gewinne auf solche Art von „Gründungsgeschäften“ bauen, selbst zumeist nicht die Verluste zu tragen haben, sondern diese an Investment-, Rentenfonds, Geschäftsbanken, deutsche Landesbanken etc weiterreichen können. Weiter erklärt es den Zwang, den letztere Institute ausüben, schon sehr hohe Eigenkapitalrenditen um jeden Preis weiter in die Höhe zu treiben (Shareholder-Value). Vor allem aber erklärt es die Suche nach Feldern, in denen sich solche Renditen erzielen lassen, und sei es auf dem Weg, die fiktiven Anfangsgewinne durch weitere neue „Gründungen“ fortzusetzen. Wie in dem Beispiel gezeigt, wird dadurch immer mehr Gründungsgewinn angehäuft, der erst von den letzten Gliedern in der Kette der Eigentümer der Kapitaltitel dann realisiert werden muss.
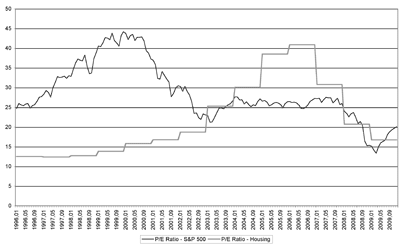
Abbildung 7: Kurs-Gewinn-Verhältnis für den S&P-Aktienindex und für den US-Immobiliensektor (22)
In Abbildung 7 wird deutlich, wie sich solche Spekulationsblasen im Verhältnis der Kurse (Kapitalwert) zu den entsprechenden Realwerten (tatsächlich erzielten Gewinnen) darstellen. Es ist deutlich, dass zunächst Ende der 90er-Jahre die Aktienkurse, gemessen am Standard&Poors-Index von Top-500 US-Unternehmen, gegenüber den tatsächlich erzielten Gewinnen dieser Unternehmen in irreale Höhen schnellten (die Zahl 15 entspricht etwa dem Erzielen des Normalzinses, alles drüber ist weitaus schlechter als Zinsanlage): die Illusion zukünftig zu erwartender enormer Gewinne, z.B. im Internetbereich, war Grundlage für ein scheinbar von der Realwirtschaft abhebendes, garantiertes Kurswachstum. Ein Gründungsgewinn nach dem anderen konnte eingestrichen werden – bis die ersten Gründungen zahlungsunfähig waren. Die Blase platze ziemlich schnell und eindrucksvoll, um an ihren Tiefpunkt das neue Investitionsfeld „Immobilien“ zu finden. Auch hier entwickelten sich Immobilienpreise und Gewinne aus Investitionen in Immobilien in pyramiden-artiger Ungleichmäßigkeit. Die Wertsteigerung von Immobilien und verbrieften Hypothekenkrediten wurde wiederum zur Quelle von Gründungsgewinnen spekulativer Immobiliengesellschaften – und wiederum waren es die Investmentbanken, die sich als erste rechtzeitig wieder aus der Pyramide verabschiedeten. Das Platzen der Blase Ende 2006 bis Anfang 2007 ist deutlich zu sehen.
Bisher konnte, wie an Abbildung 7 sichtbar, die geplatzte Immobilienblase nicht durch eine neuerliche Blase im Aktienmarkt ersetzt werden. Allerdings ist der Anstieg der Aktienindizes seit März 2009 „blasenverdächtig“. Immerhin liegen ihm nur „zukünftige Gewinnerwartungen“ zugrunde, die mit den realen Gewinnen (eher Verlustbewältigungen) der zugrundeliegenden Werte kaum etwas zu tun haben. Daher ist auch seit März 2009 in Abbildung 7 ein deutlicher Anstieg des Aktien-KGV zu sehen.
Ein anderes Feld für Spekulationsblasen hat sich seit 2008 herausgebildet, ohne noch die Ausmaße von Aktien- und Immobilienmarkt zu besitzen: das der Rohstoffmärkte, speziell für Edelmetalle, Öl, Kupfer und Lebensmittel, die an Terminbörsen gehandelt werden. Speziell Mitte 2008 erwiesen sich die Kurssteigerung auf diesen Märkten als rezessions-verstärkend und speziell für Halbkolonien als katastrophal inflationär (speziell was die Nahrungsmittelversorgung betraf). Durch die Weltrezession Ende 2008 setzte hier zunächst eine leichte Beruhigung ein. Sobald jedoch die Hoffnungen auf eine „Erholung“ wieder einsetzte, war die Spekulation in diese Werte auch schon wieder da. Ein besonders absurdes Beispiel ist die „Warteschlange“ von Öltankern im Ärmelkanal vor dem Hafen von Rotterdam, die sich nur im Rhythmus der Kursschwankungen des Ölpreises langsam auflöst. Im Jahr 2009 ist auf diese Weise der Kupferpreis um 133%, der Ölpreis um 112% und der Zuckerpreis um 79% gestiegen – um nur einige Beispiele zu nennen. Natürlich entspricht diese Kurssteigerung nirgends dem tatsächlichen Anstieg der Nachfrage, sondern vor allem den Erwartungen auf eine solche. Auf der anderen Seite werden die darauf aufbauenden Spekulationsgewinne in die tatsächlichen Preise einberechnet und müssen so letztlich von Produzenten und Konsumenten bezahlt werden. Sie sind somit eine schwere Last für die Konjunktur und inflationstreibend.
Natürlich ist keiner dieser Spekulationsmärkte nach der Finanzkrise geschlossen oder nennenswert „reguliert“ worden. Wie könnte das auch sein – das Geschäft mit den spekulativen Gründungen gehört zum Kerngeschäft des Monopolkapitals. Und dieses wird immer Wege finden es auch umzusetzen, solange ihm nicht endgültig das Handwerk gelegt wird.
Finanzkapital und strukturelle Überakkumulation
Im RM 39 wurde ausführlich der Zusammenhang von langfristigen Krisentendenzen der kapitalistischen Akkumulation (strukturelle Überakkumulation) und der Modifikation der Bewegungen des Konjunkturzyklus durch das monopolistische Finanzkapital mit den Bedingungen für Finanzmarktkrisen dargestellt. Offensichtlich sind seit Ende des „langen Booms“ 1948-1973/74 Finanzmarktkrisen mehr und mehr wieder zur Normalität geworden. Gerade aufgrund der strukturellen Überakkumulation wurde die „Ersatz-Expansion“ auf den Finanzmärkten zur Basis der anfangs erwähnten, finanzkapitalistischen Kartenhäuser, die in schöner Regelmäßigkeit ins Rutschen kommen. In den vorherigen Abschnitten haben wir mit der Analyse der Entwicklung der jetzigen Finanzmarktkrise gezeigt, dass hierbei eine neue Qualität erreicht worden ist. Die jetzige Finanzkrise ist tiefergehender, sie stellt die ganze Periode der finanzkapitalistischen Scheinblüten nach 73/74 auf den Prüfstand – kurz, sie begründet eine neue historische Periode im Rahmen der imperialistischen Epoche. Deswegen wollen wir hier diese Krise in die historische Perspektive dieses Umbruches stellen, um die Frage der weiteren Entwicklung besser beantworten zu können.
Die Periode der beschleunigten Akkumulation nach 1948 endete mit den weltweit synchronisierten Rezessionen von 1973/74. Fast zur selben Zeit, angekündigt durch den Zusammenbruch des Weltwährungssystems von Bretton-Woods, wurden die internationalen Finanzmärkte immer weiter dereguliert und immer umfangreicher. Für mehrere Jahrzehnte konnte die Finanzmarkt-Akkumulation die Illusion einer Fortsetzung des Nachkriegsbooms aufrechterhalten, oder gar sich als „neue Form“ von Kapitalismus (neues „Regulationsregime“) darstellen. Damit wurde die Verschärfung der Widersprüche übertüncht, um zu verbergen, dass der Nachkriegsboom an sich auf besonderen Bedingungen beruhte und eine Ausnahmeerscheinung in der von Stagnation geprägten imperialistischen Epoche darstellte (und keine wiederholbare Aufschwungbewegung einer „langen Welle“). Er beruhte auf außergewöhnlichen historischen Ereignissen und Bedingungen, die sich in der Periode nach 73/74 keineswegs in dieser Tiefe wiederholt haben.
Die Voraussetzung für den für die imperialistische Epoche außergewöhnlichen Boom 1948-1974 war die historische Niederlage der Arbeiterklasse, die sie in der Periode zwischen Oktoberrevolution und der konterrevolutionären Lösung der Krisenperiode der Nachkriegszeit bis 1948/49 erlitten hatte. Diese Periode beinhaltete nicht nur die Konsequenzen des Faschismus (sowohl in Bezug auf die allgemeinen politischen und ökonomischen Niederlagen der Arbeiterklasse, als auch in Bezug auf die physische Vernichtung großer Teile der kommunistischen Avantgarde). Sie beinhaltete auch die desaströsen Ergebnisse der Konterrevolution in der Sowjetunion in den 1920er-Jahren durch die bürokratische Degeneration im Stalinismus, die durch den Fortbestand und die Ausdehnung des Stalinismus nach 1945 fortgesetzt wurden. Das Überleben des Stalinismus war nicht nur ein weiteres Element in der Zerstörung oder Degeneration der revolutionären Avantgarde, sondern auch, damit natürlich in Verbindung, ein wesentliches Element der Stabilisierung der imperialistischen Weltordnung in der „Blockkonfrontation“ – zusammen mit der noch weiter getriebenen Integration der reformistisch/sozialdemokratischen Bürokratien des „Westens“ in den imperialistischen Staats- und Herrschaftsapparat. Beides war ein wesentlicher Faktor für die Niederhaltung von Arbeiterwiderstand und von Eindämmung des Klassenkampfes in den Rahmen der „fordistischen Regulation“ bzw. seiner repressiven Unterdrückung im System der stalinistischen Arbeitsordnung.
Daher stellte der Zusammenbruch des Stalinismus um 1990 keineswegs eine historische Niederlage wie 1927 oder 1948/49 dar, sondern war ein letztes Echo dieser Niederlagen. Tatsächlich war die Todeskrise der degenerierten Arbeiterstaaten selbst ein Effekt der seit 1973/74 eröffneten Krisenperiode, in der die Marktöffnungen die sowieso schon stagnierenden bürokratischen Planwirtschaften durch die Folgen der weltweiten Krisenerscheinungen nur umso mehr erschütterten (Inflation, Schattenwirtschaft, Devisenknappheit, Mangelwirtschaft, etc). Mit dem Zusammenbruch des Stalinismus erschloss sich der Imperialismus nicht nur neue Märkte und Arbeitskräftereserven, die ihm vorher nur sehr vermittelt zugänglich waren, sondern er verlor auf der anderen Seite auch eine wichtige Säule der Nachkriegsordnung. Auch wenn die ersteren Faktoren anfänglich eine anregende Wirkung auf die Akkumulation in den 90er-Jahren hatten (zusätzliche billige Arbeitskräfte, neue Absatzmärkte, Wegfall der Blockkonfrontationskosten), fügte auf lange Sicht das Restaurationsgebiet dem sowieso schon überakkumulierten Kapital weitere weltweite Überkapazitäten hinzu (nach dem Ende der Destruktionsphase in den nach-stalinistischen Ökonomien). Damit heizte dies den internationalen Verdrängungswettbewerb, die imperialistische Konkurrenz wie auch neue spekulative Anlageblasen an – und nicht zuletzt bringt es neue Herausforderer für die US-Hegemonie auf den Plan, an vorderster Stelle China.
Dies untergräbt die zweite, sowieso schon geschwächte, zentrale Voraussetzung des langen Booms: Nach 1948 war die lange, von offenen Widersprüchen geprägte Periode eindeutig zu Ende, in der es keinen klaren Welthegemon des Kapitalismus gab – was sich in zwei Weltkriegen und heftigen inter-imperialistischen Konflikten geäußert hatte. Mit der Etablierung der USA als der ökonomischen, politischen und militärischen Supermacht – in „Blockkonkurrenz“ zur Sowjetunion -, war ein klarer und umfassender Rahmen für die beschleunigte Akkumulation in der imperialistischen Sphäre gegeben. Dies umfasste nicht nur von den USA bestimmte Regeln des Welthandels, sondern auch die internationale Finanzordnung, wie sie in den Abkommen von Bretton-Woods in den 40er-Jahren festgelegt wurde (inklusive Etablierung von IWF und Weltbank). Damit war der Dollar als „Weltgeld“ etabliert.
Schon während des langen Booms führte die gewaltige Last dieser Rolle zusammen mit der Überhitzung der Konjunktur zu wachsenden Verschuldungsproblemen der USA, die die Belastbarkeit der Gold-Bindung des US Dollars weit überdehnten. Daher war der Zusammenbruch dieser Goldbindung 1971 das erste Zeichen der wachsenden ökonomischen Kosten der Welthegemonie für die USA selbst. Es bedeutete auch die Eröffnung einer Periode der Fortsetzung der US Hegemonie und des Dollars als Weltgeld unter der Bedingung einer immer willkürlicher werdenden US Geld- und Zinspolitik.
Die dritte Grundlage des langen Booms war natürlich die massive Zerstörung von Kapital während der Depressionsjahre vor dem zweiten Weltkrieg, gefolgt von den zerstörerischen Effekten im Krieg und in der unmittelbaren Nachkriegszeit. Dies war eine wichtige Voraussetzung für einen gewaltigen, US-finanzierten Investitionsboom in der Aufschwungsphase in den imperialistischen Kernländern selbst. Massive Kapitalvernichtung, repressive Durchsetzung einer gesteigerten Ausbeutungsrate und die Etablierung einer klaren imperialistischen Weltordnung, mit einem Hegemon, der sich für die Finanzierung des Booms über Jahre verschulden kann, – das war eine nachhaltige Lösung der Vorkriegskrise und die Grundlage für eine außergewöhnliche Erholungsphase unter Bedingungen der imperialistischen Epoche. Diese historischen Bedingungen für eine Erholung nach 1973/74 wurden in gleichem Ausmaß zu keiner Zeit erreicht – weder in den 90er-Jahren und schon gar nicht im Gefolge der jetzigen Finanzmarktkrise.
Von dieser historischen Perspektive aus soll hier auf die Finanzmarktzyklen seit 73/74 zurück geblickt werden.
Mit dem Beginn der strukturellen Überakkumulation von Kapital in den scharfen, synchronisierten Rezessionen der 70er-Jahre kam es zunächst zu einer massiven Ausweitung der öffentlichen Verschuldung, der Geldmengen und einer ersten spekulativen Welle von Finanzkapital (“Petro-Dollars”). Dies änderte letztlich nichts an den fundamentalen Problemen, sondern verschärfte sie sogar zur Stagflation und zu einer weiteren weltweit synchronisierten Rezession zu Beginn der 80er-Jahre.
Anders als in der Boom-Periode und in den 70er-Jahren machte die US-Geldpolitik nun eine Kehrtwende zum “knappen Geld”, zur massiven Zinserhöhungen und einem teuren Dollar (“Volcker shock”). Dies war eine bewusste Politik des US-Finanzkapitals zur Umverteilung von Finanzströmen und damit von Profit in seine Richtung. Auf der einen Seite bedeutete dies das Massaker der „Schuldenkrise“ in der halb-kolonialen Welt und damit einer (gegenüber dem langen Boom) gestiegenen Bedeutung der Kapitaltransfers aus diesen in die imperialistischen Zentren. Andererseits bedeutete der hohe Dollar ein Erholungsprogramm für die deutschen und japanischen Exportindustrien. Nach der Entspannung der Zinsschraube und der Aufrechterhaltung niedriger Zinsen nun sogar in einer Abschwungsphase – auch im Gegensatz zur „klassischen“ Konjunkturtheorie – wurde in der Mitte der 80er-Jahre eine weitere spekulative Welle, diesmal auf den Aktienmärkten, losgetreten. Diese mündete in die erste Finanzmarktkrise der Nachkriegszeit im Jahr 1987. Diese Krise beschleunigte die schon Anfang der 80er-Jahre begonnenen Deregulierungen der Finanzmärkte und führte so zum Beginn einer Folge von Finanzmarktzyklen, mit ihrem eigenen – von industriellen Zyklen scheinbar unabhängigem – Rhythmus von Aufschwüngen, gefolgt von einer Phase des Crashs, der in eine zeitweilige Beruhigungsphase bis zur nächsten Spekulationswelle übergeht. Der Crash 1987 führte zu einer massiven Welle von Zusammenbrüchen von Banken und Firmen in den USA, die in eine scharfe, bereinigende Rezession Ende der 80er-Jahre ebendort mündete.
Daraus konnte die US-Ökonomie zu Beginn der 90er-Jahre gestärkt gegenüber ihren Weltmarktkonkurrenten hervorgehen. Die zeitweilige Erholung der Profitabilität der US-Wirtschaft in den 90er-Jahren wurde daher begleitet von einem starken Niedergang der japanischen Ökonomie (Beginn einer Depressionsentwicklung) und einer stagnativen Entwicklung der deutschen und kontinental-europäischen Ökonomien. Die Deregulierungen im Rahmen der Entschuldungsprogramme der 80er-Jahre öffneten zusätzlich wesentliche asiatische und latein-amerikanische Länder für ein enormes Eindringen und Wachstum an Finanzinvestitionen. Die US-Aufschwungsblase der 90er-Jahre war daher eng verknüpft mit einer durch die US-Finanzmärkte vermittelten Kapitalexportwelle in die ASEAN-Staaten und nach Lateinamerika.
Mit dem Zusammenbruch dieser ersten spekulativen Welle der „Globalisierung“ in Tequila- und „Asienkrise“ bis 1997 wurde ein großer Teil der hier in Gang gesetzten Finanzströme wieder in die USA zurück gelenkt. Zunächst über attraktivere Zinsen, später durch die sich entwickelnde neue Blase an den Aktienmärkten, die Dotcom-Episode zum Jahrtausendwechsel. Trotz des Platzens dieser Blase und dem Einsetzen einer Rezession um 2001, konnten die USA ihre Zinsen weiter niedrig halten, ohne dass dies zu größerem Kapitalabfluss führte. Wie aus Abbildung 2 entnommen werden kann, wurde der US-Leitzinssatz sogar während dieser Rezession gar nicht erhöht – ein Faktor der wesentlich zur Überführung der Aktienblase in die nächste spekulative Blase, die Subprime-Spekulation beitrug.
Seit dem Ende der 90er-Jahre war vor allem China das Land, das in der Lage war, die Rolle der schwächelnden „Asiatischen Tiger“ und der latein-amerikanischen „Schwellenländer“ zu übernehmen und zum Billigimporteur für den US-Markt zu werden. Unter den genannten Bedingungen von US-Geldpolitik konnte dies nur über steigende Ansammlung von US-Dollars in den chinesischen Währungsdepots – zu an sich ungünstigen Zinsbedingungen – finanziert werden. Selbst die Erschütterungen von 2001 konnten diese neue welt-ökonomische Achse zwischen USA und China nicht unterminieren. Es gab einfach keine alternativen Finanzmärkte (bis auf das britische Anhängsel), in welche spekulatives Finanzkapital fließen konnte: Japan, China und Kontinentaleuropa waren alle, jeweils unter ihren speziellen Bedingungen, zur Stützung der US-Schulden und -Blasenökonomie verdammt. Dies erklärt die Besonderheit der US-Zinspolitik in der Rezession 2001 und die fast ungebremste Fortsetzung der Finanzspekulation in ihrem Gefolge. Zudem konnte die US-Staatsverschuldung wieder heftig angezogen werden, speziell im Rahmen des „Krieges gegen den Terror“, der sich so als weiteres Konjunkturprogramm hinzufügte. Dabei blieben trotz lockerer Geld- und Finanzpolitik die Inflationstendenzen dank der billigen Importwaren gering.
Die Kehrseite dieser 15 Jahre dauernden Schein-Prosperität der US-Ökonomie waren eine massive Verschuldung der privaten Haushalte, des Staates und der Firmen, eine enorm aufgeblähte Masse an Kreditgeld, mit massiven Dollar-Hortungen in China, Japan und der EU erkauft, und eine weitere Schrumpfung der produktiven industriellen Basis des US-Kapitals zugunsten eines parasitären Finanzsektors. Die Hoffnung des FED-Chefs Alan Greenspan, dass sich diese „Prosperität auf Pump“ (von ihm feiner ausgedrückt : „Vermögensinflation“) zu einer neuen ökonomischen Weltordnung stabilisieren lasse, in der die US-Verschuldung den Rest der Weltökonomie in einen langen Boom trage, ist mit der Finanzmarktkrise 2007-2009 wie Schaum zerplatzt. Die Bedingungen von 2001 hatten eben doch nichts mit den Bedingungen von 1948 gemein.
Nach dem September 2008 – Ausblick
Mit dem Platzen der Immobilienblase um das Jahr 2007 konnte das Problem der Unterkapitalisierung von Realakkumulation und Überkapitalisierung der Geldkapitalakkumulation nicht mehr so einfach gelöst werden wie 2001. Alle Mechanismen, die zuvor so gut funktioniert hatten – wie eine Zinssenkung nach der anderen durch die FED, die Einführung spezieller Kreditmechanismen, die Verteilung von Steuergeschenken durch die US-Regierung, etc – stellten sich nun als völlig wirkungslos heraus. Geldgeschenke an notleidende Banken wurden sofort wieder durch Spekulationen gegen diese Banken verbrannt. Das ganze Ausmaß an Abschreibungen der Finanzinstitutionen weltweit, der Zusammenbruch von Zahlungsketten und die panische Gier nach Liquidität bedeuteten, dass die tatsächlichen Zinsraten (zwischen Banken und gegenüber der Real-Wirtschaft) in die Höhe gingen, während die allseits gegenüber den Geschäftsbanken für große Finanzierungsgeschäfte immer mehr genutzten Instrumente der „Schattenbanken“ eine nach der anderem im „virtuellen Bankensturm“ unterging. In der Konsequenz standen im Herbst 2008 alle wichtigen Investmentbanken (die „masters of the universe“) vor dem Zusammenbruch.
Tatsächlich getroffen wurde nur Lehman Brothers: Als Anfang September die Zahlungsprobleme nicht mehr durch Stützungsaktionen zu lösen waren, war die Not-Übernahme durch die britische Barclays-Bank in letzter Sekunde daran gescheitert, dass das britische Finanzministerium die notwendige Bürgschaft verweigerte. Die Erklärung des britischen Finanzministers, dass seine Steuerzahler nicht für die Spekulationsgeschäfte der Wallstreet ihren Kopf hinhalten werden, wurde später vom damaligen US-Finanzminister Paulson in seinen gerade erschienenen Memoiren als „historischer Verrat der Briten“ aufgebauscht. Mit dem Lehman-Zusammenbruch am 15.9.2008 (Beantragung des Gläubigerschutzes) drohte der Zusammenbruch des Kreditversicherungsgeschäftes von AIG, und damit das Ende auch der anderen Investmentbanken. Kurze Zeit später befanden sich Dollar und Aktienkurse im freien Fall und die Terminbörsen für Waren wie Öl und Metalle ließen die Rohstoffpreise in die Höhe schnellen. Kurz: die Finanzmarktkrise wurde zum Herzinfarkt für die industriellen Zyklen weltweit, zum unmittelbaren Katalysator einer weltweit synchronisierten Rezession mit dem letzten Quartal 2008. Die Rezession und die schier unaufhaltsame Dynamik des Finanzcrashs ließen die Schatten von 1929 vor den Augen des US-Finanzkapital und seinen politischen Repräsentanten wieder auferstehen.
In diesem Moment war klar, dass der Welt-Hegemon USA, repräsentiert durch US-Regierung, FED und seine Finanzinstitutionen, nicht mehr unilateral die Lösung diktieren konnte, dass die Zeiten vorbei waren, in denen er mit seinen Zinsentscheidungen, „Plaza Abkommen“, G7-Erklärungen etc dem Rest der Welt sein jeweiliges Krisenmanagement und die Verteilung der „Lokomotivrollen“ in der Weltwirtschaft aufzwingen konnte. Im Herbst 2008 musste ein international koordiniertes Handeln zwischen den USA, den anderen imperialistischen Staaten und selbst einiger „Schwellenländer“, wie China, Indien und Brasilien vereinbart werden. Nur massive, koordinierte Staatsintervention, vom Verbot der Leerverkäufe von Finanzwerten, über koordinierte Bankensicherungsfonds bis hin zu Konjunkturpaketen (von denen dasjenige in China sicherlich das umfangreichste war), konnte die Weltökonomie vor dem Abrutschen in ein Depressionsszenario in der Art von 1929-1932 bewahren.
Wie zuvor beschrieben handelt es sich dabei jedoch nur um einen zeitlichen Aufschub, der die wesentlichen Probleme nicht gelöst hat. Auch wenn es in absoluten Zahlen große Abschreibungen von fiktivem Kapital und auch von realem Kapital in Industrie und Handel gab, so verhinderte das Krisenmanagement ja gerade die für die Funktion kapitalistischer Krisen notwendige Zerstörung von überakkumuliertem Kapital im Verhältnis zu den vorhandenen Profitabilitätsbedingungen des Realkapitals. Daher ist es nicht nur so, dass inzwischen die großen Finanzkapitale wieder als die großen Gewinner der Krise gegenüber geschwächten Staaten und Real-Konzernen da stehen: Kapital für Kapital, Staat für Staat stehen sich verstärkt als Konkurrenten in einem härter gewordenen Vernichtungskampf gegenüber, der je zu Lasten der Kapitale der anderen Nationen ausgetragen werden soll (ganz deutliches Beispiel: Die internationale Automobilindustrie).
Während also die Realökonomie nur langsam und unter ungünstigen Konkurrenzbedingungen wieder aus der Krise kommt, mehr und mehr Staaten mit dem aus der Krise folgenden extremen Verschuldungsproblem zu kämpfen haben (Griechenland!), ist also die Hebel-Arbeit der Finanzwirtschaft wieder voll am wirken und wirft neuerlich Rekordgewinne ab. In verschiedenen Sektoren werden neue Spekulationsblasen angepustet. Staatsanleihen und Spekulation auf deren Ausfall stellen sich als lukratives Geschäft heraus – und noch dazu ist durch die staatliche Geldpolitik und die Risikoabsicherungen diese neue spekulative Welle durch die in Geiselhaft genommenen Staaten voll abgesichert. Wer der eindeutige Gewinner der Krise ist, ist also nur zu offensichtlich – genauso wie die Machtlosigkeit aller derer, die nur davon sprechen, dass das „Finanzkapital selbst für seine Krise zahlen soll“. Jegliche „Reform“, jegliches rasche „Exit“ der Regierungen aus der jetzt für das Finanzkapital so profitablen Situation, droht sofort den nächsten Crash auszulösen – wovor alle Reformer noch mehr Angst haben als vor dem Zahlen weiteren „Lösegelds“.
Auf diese Weise wird die Last der Finanzkapitale den „Aufschwung“ noch stagnativer machen als die schon nicht besonders dynamischen zyklischen Erholungen der letzten zwei Jahrzehnte – natürlich wiederum aufgebauscht um die beschönigenden Zahlen der Ausdehnung fiktivem Kapitals. Daneben ist natürlich immer noch möglich, dass die Probleme der Staatsfinanzen oder ein zu heftiges „Exit“ aus der staatlichen Konjunktur- und Bankenstützung rasch zum nächsten Einbruch führen könnten (zur sogenannten „double dip“-Rezession). Früher oder später sind in beiden Szenarien sowohl die Staaten zu massiven Kürzungen ihrer Haushalte gezwungen, als auch in der Realwirtschaft massive Zerstörung von Kapital (sprich Arbeitsplatzabbau und weitere Angriffe auf die Bedingungen der Arbeiterklasse) angesagt.
Zusammengefasst ist die Periode der illusionären Fortsetzung des langen Nachkriegs-Booms über 1973/74 hinaus vorbei, die sich vor allem über die Erscheinungsform des Finanzmarktzyklus und der damit verbundenen Umverteilung zugunsten bestimmter imperialistischer Kapitale und zu Lasten der Weltarbeiterklasse herstellen ließ. Es gibt keine magischen Tricks mehr, mit denen das Finanzkapital seine destruktive und parasitäre Weltherrschaft als wachstums- und wohlstandsfördernd für alle darstellen kann. Mit der Geiselhaft, in die das Finanzkapital den Rest der Gesellschaft mit der Finanzkrise genommen hat, wird offensichtlich, dass für den Profit einer verschwindenden Minderheit die Verarmung der enormen Mehrheit der Menschheit erzwungen wird. Für alle wesentlichen Menschheitsprobleme – Umwelt, Ernährung, Überbevölkerung, regionale Konflikte etc – wird deutlich, dass das Finanzkapital nicht die Lösung darstellt, sondern sich im Kern des Problems befindet.
Zur selben Zeit, spätestens mit den Rettungsaktionen Ende 2008, ist die Rolle der USA als Welt-Hegemon ernsthaft auf der Kippe. Während US Dollar und die US Finanzmärkte weiterhin als zentrale Instrumente des imperialistischen Finanzkapitals ohne Alternative sind, sind die Kosten dieser Führungsrolle, zusammen mit der Rolle als politisch-militärischer Hegemon für die US-Wirtschaft mehr und mehr Belastung.
Auf diese Weise sind alle Säulen der Nachkriegsordnung im Wanken, ohne dass die Bedingungen für eine vergleichbare Ordnung und für einen neuen außergewöhnlichen Boom gegeben wären. Das kann nur bedeuten, dass wir in eine Periode des Kapitalismus eintreten, in der die Zukunft des Kapitalismus und der weiteren Entwicklung der Menschheit als Ganzes auf der Tagesordnung stehen und nach einer fundamentalen Antwort verlangen wird. Nachdem die destruktive, durch Krisen bestimmte und vorangetriebene Rolle des imperialistischen Finanzkapitals für uns keine Antwort mehr zu bieten hat als noch mehr Desaster und Katastrophen, kann für uns die Antwort nur der Sozialismus sein.
Dabei bleibt es ein zentrales Element des Programms der sozialistischen Revolution, dass die Diktatur des Proletariats und die Vorbereitung des Übergangs zur Planwirtschaft nur gelingen kann, wenn mit der sozialistischen Umwälzung das Finanzkapital enteignet wird und die verschiedenen Typen von Finanzinstitutionen und -märkten in eine zentralisierte Staatsbank überführt werden. Solange die monetäre Form von ökonomischen Beziehungen nicht durch höhere Formen der Selbstorganisation der Produzenten ersetzt werden kann, ist dies der einzige Weg, um die Verzerrungen, krisenausbrütenden und entfremdenden Effekte von Geld und Kredit einzudämmen, zu kontrollieren und der Auflösung entgegen zu führen. Zusätzlich kann der Wirkung des international agierenden Finanzkapitals nur durch ein entsprechend einheitliches und an den Außengrenzen kontrolliertes Monetär- und Kreditsystem aller sozialistischen Staaten entgegen getreten werden. Ein solches internationales, demokratisches und transparentes Finanz- und Kreditsystem ist wesentliche Voraussetzung für die Durchsetzung einer demokratischen Planwirtschaft als Alternative zum Kapitalismus.
Anmerkungen und Fußnoten
(1) Siehe dazu: Lisa Neuhaus, „Die Blindgänger. Warum die Ökonomen auch künftige Krisen nicht erkennen werden“. Campus Verlag, 2009. Hier finden sich noch eine Reihe weiterer Beispiele zum Thema Unverständnis der bürgerlichen Wirtschaftswissenschaften und Krise. Allerdings ist die Ursachenforschung der FAZ-WirtschaftsjournalistInnen mehr als mangelhaft – was wiederum auch nicht so überraschend ist (die Funktion der bürgerlichen Wirtschaftsjournalistik bleibt natürlich ebenso unterbelichtet).
(2) Ebd., S.96
(3) Z.B.: Wolfgang Eichhorn/Dirk Solte, „Das Kartenhaus Weltfinanzsystem. Rückblick – Analyse – Ausblick“, Fischer 2009, S.28.
(4) Marx, Das Kapital, Band 1, S.152 (MEW 23).
(5) Marx, Das Kapital, Band 3, S.588 (MEW 25).
(6) Ebd., S.589.
(7) Siehe: Paul Krugman, Die neue Weltwirtschaftskrise, Campus Verlag, Frankfurt/New York, 2009, S. 215.
(8) Marx, Das Kapital, Band 1, S.127f.
(9) Ebd., S.152.
(10) Siehe: Der Spiegel, Wahnsinn 2.0. Warum nach der Jahrhundertkrise schon die nächste droht. 13.11.09. S.78.
(11) Siehe: John Maynard Keynes, The General Theory of Employment, Interest and Money, Prometheus Books (1936), S.194 f.
(12) Karl Marx, Das Kapital, Band 3, S.380).
(13) Bei einem Wertpapier verspricht ein Gläubiger zu einem bestimmten Zeitpunkt eine bestimmte Summe zu zahlen. Dieses Wertpapier wird also immer zu einem niedrigeren Preis gehandelt, die Differenz entspricht dem Zins, den der jeweilige Käufer für sein eingesetztes Kapital = dem Kaufpreis erwartet. Beispiel: wenn der Zinssatz steigt, fällt der Kurs eines Wertpapiers: das in ihm angelegte Geld könnte anderswo eine höhere Rendite erzielen.
(14) Siehe z.B.: Rainer Sommer, Die Subprime-Krise und ihre Folgen. Von faulen US-Krediten bis zur Kernschmelze des internationalen Finanzsystems. Heise. 2009.
(15) Ebd., S. 107.
(16) Siehe: Der Spiegel, Wahnsinn 2.0. Warum nach der Jahrhundertkrise schon die nächste droht. 13.11.09. S.73.
(17) Siehe: Le Monde diplomatique, Atlas der Globalisierung 2009, S.50.
(18) Der Spiegel. Wahnsinn 2.0. S.78.
(19) Quelle: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung der USA, veröffentlicht auf der Website des DoC (Department of Commerce).
(20) Siehe: Krugman, Weltwirtschaftskrise, S.186f..
(21) Siehe: FAZ. Leerverkäufe von Bankaktien wieder erlaubt. 2.2.2010. S.17.
(22) Quelle: P/E-ratio für Immobilien berechnet auf Grundlage des Case-Shiller-Index (Preis) und der Ertragsstatistik des DoC. P/E für Aktien des S&P500-Index ist den Webseiten von S&P entnommen. Die Idee der Berechnung stammt jeweils von Paul Krugman, Die neue Weltwirtschaftskrise, S.171


