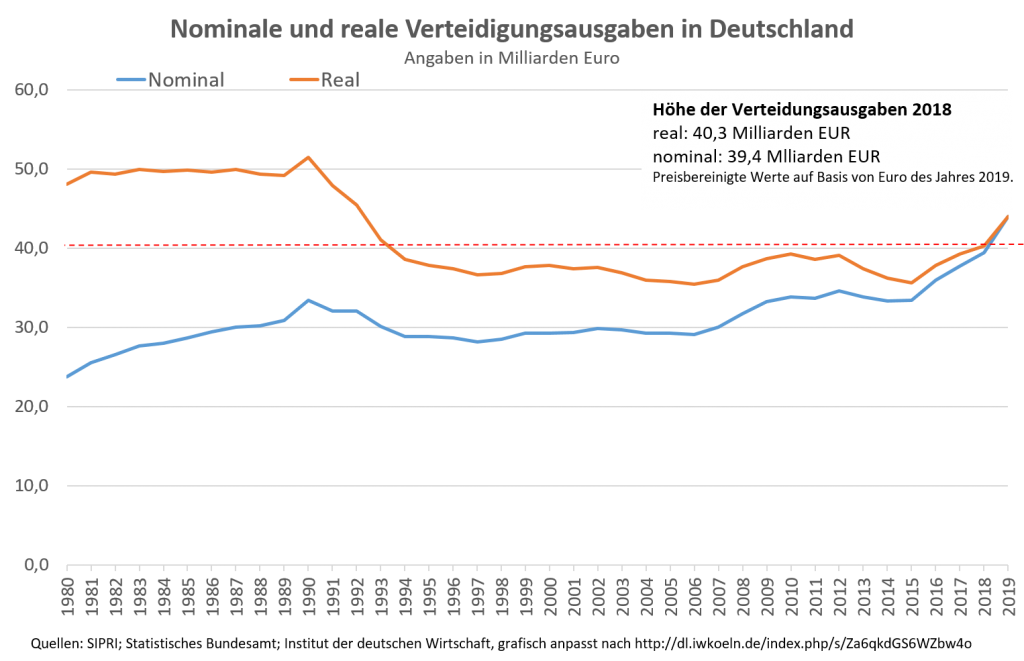Gleicher Abschluss für alle! Solidarität mit der Berliner Krankenhausbewegung!
Flugblatt der Gruppe ArbeiterInnenmacht, Infomail 1166, 9. Oktober 2021
Vollstreik bringt Bewegung. Nach einem Monat Arbeitskampf bei Charité, Vivantes und den Vivantes-Töchtern beginnt die Front der sog. ArbeitgeberInnen zu bröckeln. Vor dem Streik galt ein Tarifvertrag Entlastung als unverhandelbar oder gar nicht tariffähig; die Angleichung der Einkommen bei den Vivantes-Töchtern sei ganz und gar unmöglich.
Teilerfolg
Nun machen die Klinkleitungen erste Zugeständnisse. Unter dem Druck der Bewegung unterzeichnete die Charité-Führung gemeinsam mit ver.di ein Eckpunktepapier für einen zukünftigen Tarifvertrag Entlastung. Unter anderem sieht es Mindestbesetzungsregelungen für alle Bereiche, darunter Stationen, OP-Säle und Notaufnahmen/Rettungsstellen, eine Regelung für Belastungsausgleich und eine Verbesserung der Ausbildungsbedingungen vor. Außerdem sollen in den kommenden 3 Jahren 700 zusätzliche PflegemitarbeiterInnen eingestellt werden.
Doch dieser Teilerfolg an der Charité geht mit weiterem Stillstand bei Vivantes einher. Bei den Tochtergesellschaften hat sich der Senat eingeschaltet und den ehemaligen Brandenburger SPD-Ministerpräsidenten Platzeck als „Mediator“ aus dem Hut gezaubert. Die Vivantes-Leitung selbst spielt auf Zeit.
Doch selbst ein Eckpunktpapier ist noch lange kein Tarifvertrag; eine Mediation schon gar nicht. Wie ein Abschuss genau aussieht, wird davon abhängigen, ob und wie viel Druck wir weiter gemeinsam aufrechterhalten werden.
Einheit ist unsere Stärke
Mit dem Arbeitskampf und mit der Berliner Krankenhausbewegung haben die Beschäftigten und alle UnterstützerInnen sehr viel erreicht. Tausende sind in den letzten Monaten ver.di beigetreten und haben sich den Aktionen angeschlossen. Die große Mehrheit der PatientInnen und der Berliner Bevölkerung hat längst erkannt, dass der Streik auch ihre Angelegenheit ist.
Vor diesem Hintergrund haben die Arbeit„geber“Innen ihre Taktik zu ändern begonnen. Nachdem über Monate Gewerkschaftsmitglieder und Streikende v. a. bei Vivantes lächerlich gemacht, gemobbt oder eingeschüchtert wurden, merken die Klinikleitungen, dass sie damit nicht durchkommen. Mit diesen schäbigen Methoden konnten sie weder den Arbeitskampf noch die Moral der Beschäftigten brechen. Daher versuchen sie es jetzt mit anderen Taktiken.
Die Charité-Leitung sucht Zuflucht in einem möglichen eigenen Haustarif. Bei den Vivantes-Töchtern soll der Streik während Platzecks Mediation ausgesetzt bleiben. Beim Vivantes-Konzern hofft das Management wohl, dass die Beschäftigten nach einem Abschluss an der Charité allein weiterkämpfen müssen und ihnen die Kraft fehlt, den gleichen Tarifvertrag durchzusetzen.
Kurzum, sie hoffen, unsere Einheit durch getrennte Verhandlungen, durch verschiedene Tarife, durch Mediationen, Schlichtungen und durch ein Aussetzen der Streiks zu schwächen und zu unterlaufen.
Das dürfen wir nicht zulassen!
Aber wie können wir dieser Gefahr begegnen? Liegt es nicht in der Logik eines Kampfes um Haustarife, dass Klinken zu verschiedenen Abschlüssen kommen? Letzteres Problem besteht zweifellos und ist auch ein, wenn auch ungewolltes Resultat der Taktik von ver.di, die Tarifverträge für Entlastung in einzelnen Häuserkämpfen und nicht im Rahmen eines bundesweiten Tarifvertrages anzugehen.
Aber die Beschäftigten bei Vivantes müssen nicht allein weiterkämpfen, nur weil es ein erstes Eckpunktepapier an der Charité gibt. Im Gegenteil, wenn wir unseren Druck aufrechterhalten wollen, dürfen wir sie und die KollegInnen bei den Tochterunternehmen nicht im Regen stehen lassen.
Dazu brauchen wir keine Mediation und keine Schlichtung, denn unsere Forderungen sind klar und wir sollten uns nicht von Leuten wie Platzeck hinter verschlossenen Türen über den Tisch ziehen lassen. Vielmehr müssen alle Verhandlungen und Gespräche offen und für alle Beschäftigten und Streikenden transparent geführt, am besten, indem sie öffentlich übertragen werden.
Während etwaiger Verhandlungen kann und muss der Streik aufrechterhalten werden. Die letzten vier Wochen haben gezeigt, dass die unbefristete gemeinsame Arbeitsniederlegung das beste Mittel ist, sie alle in die Knie zwingen. Steter Tropfen höhlt bekanntlich den Stein – und genau nach diesem Motto müssen wir vorgehen.
Das Angebot der Charité und das Eckpunktepapier müssen nicht nur von allen auf Streikversammlungen diskutiert werden. Es darf keinen Abschluss, kein Aussetzen der Aktionen ohne vorherige Diskussion und Zustimmung durch die Kämpfenden geben. Außerdem müssen wir fordern, dass das Eckpunktepapier und ein eventueller Tarifvertrag vollumfänglich von Vivantes übernommen wird. Sollte die dortige Klinikleitung dazu nicht bereit sein, müssen wir mit den Streiks, mit Demonstrationen und der Mobilisierung anderer Gewerkschaften und aller UnterstützerInnen aus der Berliner Bevölkerung vom Senat fordern, dass ein solcher Abschluss – sollte er die Zustimmung der Belegschaft erhalten – ohne Abstriche übernommen wird.
Dasselbe gilt für die Beschäftigten bei den Vivantes-Töchern. Die Mobilisierung der Belegschaften von Charité und Vivantes soll solange aufrechterhalten bleiben, bis es die Angeleichung an den TVöD gibt. Auch hier müssen wir nicht nur die Kliniken, sondern auch den Senat unter Druck setzen. SPD, Grüne und Linkspartei wurden zwar im Wahlkampf nicht müde, um unsere Stimmen zu werben und zu erzählen, wie wichtig doch die Beschäftigten an den Krankenhäusern wären. Allein, wir wollen keine wohlfeilen Worte mehr hören, sondern Taten sehen!
- Unbefristeter Vollstreik bis zur Erfüllung der Forderungen! Öffentliche, von der Basis kontrollierbare Verhandlungen! Keine Aussetzung des Streiks ohne Abstimmung unter den Streikenden! Keine Teilabschlüsse in einem Krankenhaus oder der Tochtergesellschaften, sondern nur gemeinsamer Abschluss!
Berliner Vorbild bundesweit nachahmen!
Der Kampf in den Berliner Krankenhäusern ist weit mehr als einer für einzelne Verbesserungen. Er kann auch als Katalysator für eine bundesweite Bewegung für Entlastung und Angleichung an den TVöD wirken. Christian Hoßbach, DGB-Vorsitzender Berlin-Brandenburg, redet zu Recht nur von einem wichtigen Teilerfolg bei der Charité und verweist auf die Brandenburger Asklepios-Kliniken, wo Beschäftigte bis zu 11 Tagen pro Jahr bei bis zu 21 % weniger Entgelt als ihre KollegInnen in Westdeutschland arbeiten. Sie traten genauso in den Warnstreik für Angleichung an den TVöD-L wie Beschäftigte der Berliner AWO und am letzten Mittwoch Berliner GEW-LehrerInnen für Klassenobergrenzen (TV Gesundheit). Am 6. Oktober gingen die Berliner GEW-LehrerInnen in einen Arbeitskampf für Klassenobergrenzen (TV Gesundheit).
In der anstehenden Tarifrunde im öffentlichen Dienst der Länder müssen die Anliegen dieser KollegInnen vollständig aufgenommen werden wie die der Uni- und psychiatrischen Kliniken. Da die Uni-Kliniken bundesweit im TV-Länder sind, könnten sie sofort die Gehaltsforderungen mit dem Kampf für eine Personalbemessung verbinden. Doch ver.di plant lediglich eine Gehaltsrunde. Die Interessen der Pflegekräfte an Entlastung werden an einem bedeutungslosen Gesundheits(katzen)tisch vorgetragen, die der LehrerInnen gar nicht – aber sie müssen zum Verhandlungsgegenstand und streikfähig gemacht werden! Kollege Hoßbach, setzt Du Dich auch dafür ein und lässt Deinen Worten Taten folgen?
Sich an die Seite der streikenden KollegInnen zu stellen und dafür alle Beschäftigten, die ein Interesse an einem gut funktionierenden Gesundheitssystem unter guten Arbeitsbedingungen hegen, an Eurer Seite zu mobilisieren, wäre die Aufgabe aller DGB-Gewerkschaften. Mit einer solchen Mobilisierung – aus streikenden KollegInnen in den Krankenhäusern und KollegInnen aus allen Betrieben, einem politischen Streik – würden die Regierenden in die Knie gezwungen werden können. Dies wäre der Weg für einen erfolgreichen Kampf gegen Privatisierungen und mangelnde personelle und finanzielle Ausstattung des gesamten Gesundheitssektors.
Für ein Gesundheitswesen im Interesse der 99 %!
Nicht erst die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass dieses System ständig am Rande des Zusammenbruchs funktioniert. Damit muss Schluss sein, wenn wir ein menschenwürdiges Gesundheitssystem aufbauen wollen! Der Markt richtet nichts, jedenfalls nicht für die Masse der Bevölkerung.
- Entschädigungslose Enteignung privater und privatisierter Krankenhäuser unter Kontrolle der Beschäftigten und der Gewerkschaften! Entschädigungslose Enteignung der Pharma- und Medizintechnikkonzerne! Freigabe der Patente auf Impfstoffe!
- Für ein ausreichendes Pflegepersonalgesetz in allen Sektoren, auch der Altenpflege! Personalbedarf für die PatientInnenversorgung, errechnet durch die Beschäftigten sowie PatientInnen und ihre Organisationen selber! Laufende Personalbesetzungs- und Betriebsregelungen unter ArbeiterInnenkontrolle!
- Weg mit Beitragsbemessungsgrenzen, Befreiungs- und Ausstiegsmöglichkeiten von der gesetzlichen Krankenversicherung! Für weitere Finanzierung des Plans durch progressive Steuern auf Kapital, Gewinne und Vermögen!
- Plan- statt Marktwirtschaft: Erstellung eines Plans für ein integriertes Gesundheits-, Rettungs-, Kur- und Rehabilitationswesen von unten!