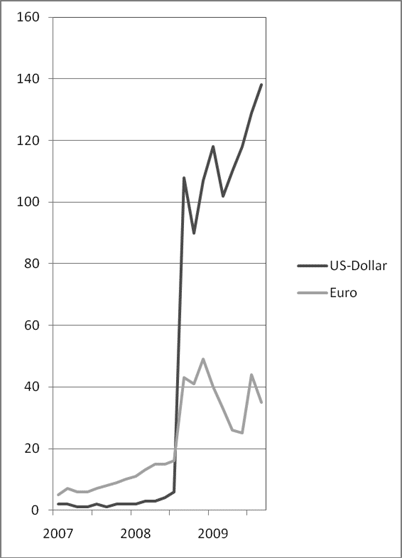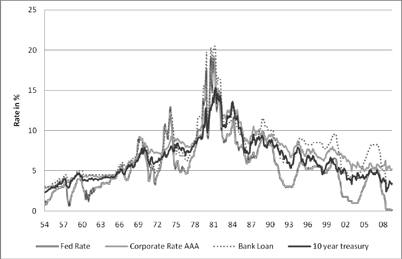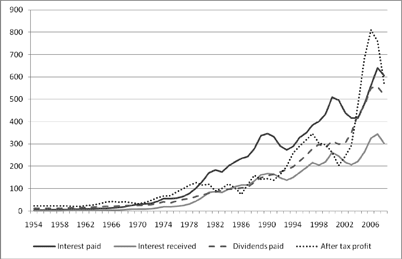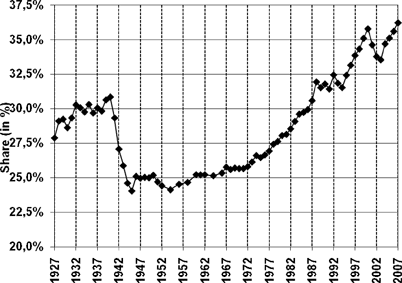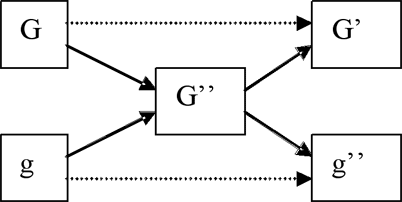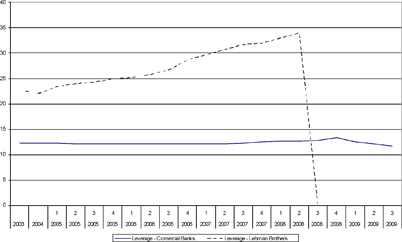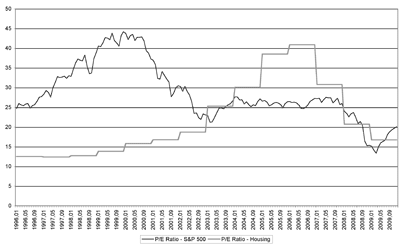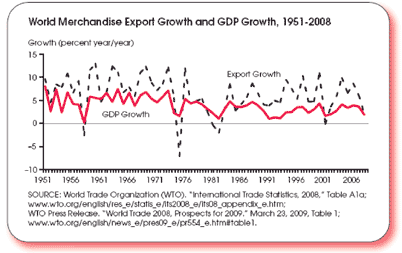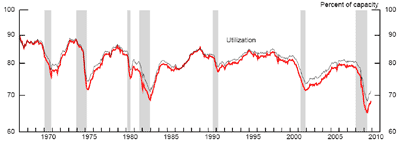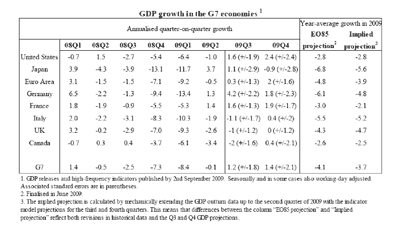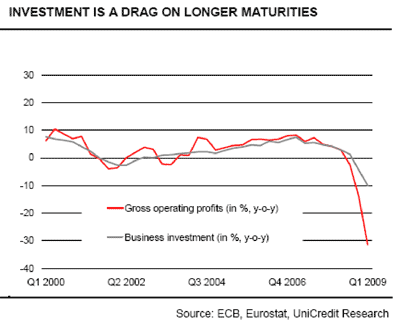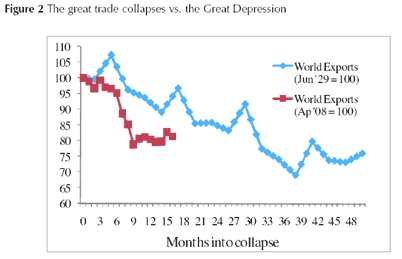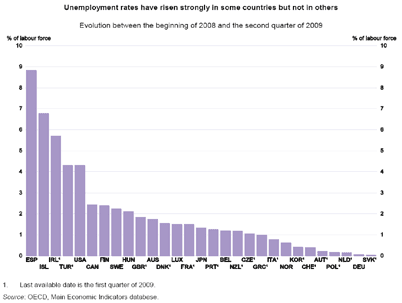Martin Suchanek, Revolutionärer Marxismus 41, Februar 2010
I. Warum dieser Artikel?
Totgesagte leben länger. Dieser Satz ließe sich auch trefflich auf die autonome Bewegung in der BRD und in ganz Europa, ja weltweit anwenden. Ob bei den griechischen Aufständen 2008, an den Unis Italiens, dem Antifamilieu in Deutschland, bei Kämpfen in Frankreich oder in der Anti-G8-Mobilisierung in Heiligendamm 2007: Die Autonomen erscheinen gerade Jugendlichen – v.a. SchülerInnen und StudentInnen – als radikale Alternative zum Reformismus.
Dabei schien nach dem Zusammenbruch des „real existierenden Sozialismus“ und der kapitalistischen Wiedervereinigung auch die Stunde der Autonomen geschlagen zu haben. Wie für die gesamte Linke stand auch in diesem Spektrum die Frage nach der „Krise der eigenen Bewegung“. Der Autonomen-Kongress 1995 – er sollte für über 10 Jahre der letzte sein – stellte bezeichnenderweise die Frage „Was trennt uns, was verbindet uns?“ ins Zentrum seiner Tagung (1). Allein das zeigt, wie „verunsichert“ die Autonomen hinsichtlich ihre eigenen Existenzberechtigung waren.
Zugleich darf dabei aber nicht übersehen werden, dass in der „autonomen Bewegung“ die Frage, was eigentlich die „Autonomen“ oder „Autonomie“ sind, beständig auftaucht. Ja, es ist geradezu ein Markenzeichen dieser Bewegung, dass diese Frage seit dem Ende der 70er Jahre immer wiederkehrt. Das hat sicher damit zu tun, dass die Autonomen mehr einem Milieu, einer ideologisch in vieler Hinsicht heterogenen Strömung entsprechen und keiner auf einer bestimmten Weltanschauung basierenden politischen Bewegung wie z.B. der Marxismus.
Selbstverständlich sind auch „marxistische“ Organisationen heterogen, lässt sich doch unter diesem Logo alles finden: von konterrevolutionären stalinistischen oder sozialdemokratischen Gruppierungen über viele Facetten des Zentrismus bis hin zu revolutionären, kommunistischen Organisationen.
Trotz enormer Unterschiede haben alle diese Vereinigungen aber ein mehr oder weniger ausführlich dargelegtes Programm, eine Doktrin, politische Dokumente usw., die Außenstehenden eine Vorstellung der selbst proklamierten Ziele und Methoden zur Erreichung ebendieser Ziele ermöglichen. Sie erlauben auch, die Aktivität dieser Gruppierungen an den von ihnen selbst hergeleiteten Vorstellungen zu messen. Im Falle marxistischer Organisationen kommt außerdem hinzu, dass ihre programmatischen Vorstellungen immer auch einen wissenschaftlichen Anspruch erheben. All dies findet sich bei den Autonomen so gut wie nicht.
Dieser Unterschied der heutigen autonomen Gruppierungen zu anderen politischen Strömungen – am wenigsten vielleicht noch zu den AnarchistInnen – lässt die Autonomen politisch so schwer fassbar erscheinen – für andere, aber auch für sich selbst.
Hinzu kommt, dass die Autonomen heute – anders oder jedenfalls in stärkerem Ausmaß als in den 1980er Jahren – von unterschiedlichen, einander entgegengesetzten Strömungen regelrecht zerrissen werden: Anti-Deutsche versus Anti-Imps; „Schwarzer Block“ versus „Pink and Silver“; AnhängerInnen der revolutionären Machteroberung versus AnhängerInnen Holloways; (Post)-Operaisten versus Ablehner der revolutionären Rolle der Arbeiterklasse usw. usf.
Gerade, weil tiefe Gegensätze die autonome Bewegung schon seit Jahrzehnten durchzogen, erhebt sich die Frage, was die Autonomen eigentlich eint? Können wir überhaupt von einer autonomen Bewegung und deren Kontinuität sprechen?
Natürlich bietet es sich an, in ihr einfach ein soziales, subkulturelles Milieu zu erblicken. Nun wird niemand bestreiten, dass die Autonomen auch ein solches sind. Doch in Wirklichkeit ist diese Antwort äußerst unbefriedigend, wenn es darum geht, die Reproduktion und die Veränderung des Phänomens „Autonome“ über Jahrzehnte zu erklären.
Was verbindet eigentlich die Hausbesetzerbewegung und die Anti-AKW-Bewegung der 80er Jahre mit der Anti-Olympia-Kampagne 1993 oder mit der autonomen Antifa oder autonomem Antirassismus? Sicher gibt es bei diesen Bewegungen personelle Kontinuitäten. Bestimmte Stadtteile, Läden, Zentren, selbstverwaltete Kneipen und Cafés, teilweise auch Uni-Strukturen firmierten jahrelang als Kristallisationspunkt und Infrastruktur. Aber das erklärt noch nicht, was die Autonomen zusammenhält, warum sie über Jahrzehnte sowohl von außen wie auch von innen als eine „Szene“ wahrgenommen werden, was hinter der Abfolge unterschiedlicher Bewegungen und Interventionen eigentlich das Spezifische der Autonomen bzw. der autonomen Politik ausmacht.
Es erklärt erst recht nicht, warum der Einfluss verschiedener autonomer oder ihnen naher Strömungen heute, inmitten der schwersten Krise des Kapitalismus seit dem Zweiten Weltkrieg, auf AktivistInnen zunimmt.
Im Folgenden wollen wir herausarbeiten, was die Autonomen heute wieder attraktiv als scheinbar radikale Alternative zum Reformismus macht. Für uns als MarxistInnen geht es dabei natürlich nicht nur um eine Nachzeichnung dieser Entwicklung, sondern v.a. darum, warum die autonomen Antworten der Vergangenheit so wenig zum Erfolg führen konnten, wie es die heutigen können. Es geht also darum, zu zeigen, warum die „revolutionäre“ Alternative der Autonomie ein Weg in die Sackgasse ist.
Dazu müssen wir – ohne eine Geschichte der Autonomen zu schreiben oder auch nur schreiben zu wollen – auf ihre Entwicklung und auf die Entwicklung ihrer Ideologie eingehen. Wir werden dabei auch herausarbeiten, was unserer Meinung nach das Verbindende, Gemeinsame in der autonomen Bewegung über ihre Fraktionen hinaus ist.
Im nächsten Schritt „Autonomisms und Krise“ beschäftigen wir uns mit den politischen Antworten einiger autonomer Hauptrichtungen auf die gegenwärtige Krise, werden dabei verschiedene Richtungen untersuchen und einer Kritik unterwerfen.
Im vierten Abschnitt beschäftigten wir uns mit der Frage nach dem Klassencharakter der autonomen Bewegung – einer Strömung, die ja im Unterschied zu den linken wie rechten Reformisten, zu SPD und Linkspartei für sich in Anspruch nimmt, anti-kapitalistisch und revolutionär zu sein.
Abschließend gehen wir auf das Verhältnis von Marxismus und Autonomismus ein.
II. Ursprünge und Konzeption des Operaismus
Wer die heutige „Szene“ betrachtet, wird darin nur schwer die geschichtlichen Ursprünge der Autonomen erkennen. Wer denkt schließlich schon an theoretische Hefte und Journale, wer denkt gar an die industrielle Arbeiterklasse, wenn er oder sie die heutigen Autonomen betrachtet?
Der Operaismus (Arbeiterautonomie) ist zu einer minoritären Strömung unter den Autonomen geworden, ja zu einer, die in der Bewegung tw. überhaupt nicht mehr auszumachen ist. Und dennoch geht die autonome Bewegung auf eine politische und theoretische Kritik italienischer Linksintellektueller am Kurs der reformistischen Arbeiterbewegung, vor allem der Kommunistischen Partei Italiens (PCI), aber auch der Sozialistischen Partei (PSI) und der Gewerkschaften zurück, die schließlich zur Bildung der ersten autonomen Organisationen führte.
Die Volksfrontpolitik der PCI und ihre Folgen
Die Mitglieder der PCI hatten im Kampf gegen die Nazis und den italienischen Faschismus zweifellos die Hauptlast getragen und spielten eine führende Rolle in der Befreiungsbewegung. Doch ähnlich wie in ganz Europa – insbesondere auch in Frankreich – war die Sowjetunion unter Stalin strikt gegen jeden Kurs, der den Kampf gegen Faschismus und Besatzung zu einem Kampf um die sozialistische Machtergreifung hätte weitertreiben können (2).
Dieser Kurs wurde von der PCI zwar befolgt, anfänglich jedoch nicht ohne Schwankungen nach links. Mit der Rückkehr Togliattis aus dem Moskauer Exil im März 1944 wurde die Partei stramm auf einen Kurs der Klassenzusammenarbeit mit den Alliierten, den bürgerlichen Parteien und der Regierung Marschall Badoglios ausgerichtet.
Die Regierung Badoglio, dem ehemaligen Generalsstabschef Mussolinis, war im Juli 1943 gebildet worden. Ihre Formierung erfolgte als Reaktion auf die alliierte Landung in Sizilien und das mächtige Anwachsen der anti-faschistischen Bewegung, da die italienische Großbourgeoisie, die Großgrundbesitzer, der Klerus und die Offizierskaste ihre Interessen durch die weitere Herrschaft Mussolinis gefährdet sahen. So hofften die Vertreter der herrschenden Klassen, die gestern noch dem Duce die Verteidigung ihrer Interessen anvertraut hatten, doch noch als Sieger aus dem Weltkrieg hervorzugehen und als – wenn auch spät gekommene – „Antifaschisten“ anerkannt zu werden. V.a. wollten sie so einer drohenden sozialistischen Revolution entgehen.
Dass die Bourgeoisie und die Großgrundbesitzer diese Politik letztlich erfolgreich umsetzen konnten, verdankten sie freilich auch der tatkräftigen Mithilfe des Stalinismus.
Die Sowjetunion erkannte schon am 14. März 1944 die Regierung Badoglio an – als erstes Land überhaupt! Togliatti „erkämpfte“ die Umbildung der Regierung zur „Regierung der nationalen Einheit“, der die PCI am 22. April 1944 beitrat.
Die Ministerpräsidenten dieser Regierung der nationalen Einheit wechselten zwar mehrmals (Bonomi, Parri, De Gaspari). Die KP bliebt jedoch loyaler Teil dieser Regierung – einer Regierung, welche die Partisanenbewegung entwaffnete, den bürgerlichen Staatsapparat in seinen Grundstrukturen rekonstituierte, die Westanbindung Italiens herbeiführte und den Kapitalismus stabilisierte.
Die PCI hatte als größte Partei der Arbeiterklasse eine Schlüsselrolle dabei gespielt, die Lohnabhängigen in Stadt und Land zu demobilisieren und die revolutionären Möglichkeiten zu verraten.
Gedankt hat ihr das die italienische Bourgeoisie jedoch nicht. 1947 wurden Togliatti (Justizminister), Scoccimarro (Finanzen), Pesenti (Schatzminister) und Gullo (Landwirtschaftsminister) aus der Regierung entfernt. Die Christdemokraten brauchten sie als „Partner“ nicht mehr.
Das änderte aber nichts Grundlegendes an der Rolle, die die PCI im italienischen politischen System spielte. Auch als „Oppositionspartei“ war sie u.a. über ihre zahlreichen Posten in kommunalen Verwaltungen fest integriert.
Diese Politik führte u.a. dazu, dass die „offiziellen“ Organisationen der Arbeiterbewegung – neben der PCI auch die kleinere und politische schwächere PSI und die Gewerkschaftsführungen – den täglichen Ausbeutungs- und Arbeitsverhältnissen der Lohnabhängigen, aber auch veränderten Ausbeutungsmethoden, einer neuen Kapitalzusammensetzung und einer Neuformierung der Arbeiterklasse wenig bis keine Beachtung schenkten.
Dabei erlebte Italien in den 50er und frühen 60er Jahre einen enormen Industrialisierungsschub, der zu einem starken Anwachsen der Zahl der Lohnabhängigen v.a. im Norden und zur Massenmigration von ArbeiterInnen aus dem Süden führte. Für die Gewerkschaften und die Reformisten war dabei, wenn überhaupt, nur der sektorale Lohnkampf – eventuell noch die Frage der Arbeitszeit von Belang. Die betriebliche Organisation der Ausbeutung, das „Fabrikregime“ wurde als „gegeben“ betrachtet.
Die Quaderni Rossi
Dagegen entwickelte sich eine kritische intellektuelle Strömung um Autoren wie Panzieri, einem langjährigen oppositionellen Mitglied des ZK der PSI und Übersetzer des 2. Bandes des Kapitals, um die Zeitschrift „Quaderni Rossi“ (Rote Hefte, QR), die von 1961-65 erschienen. Diese können als theoretische Begründer des Operaismus, der „Arbeiterautonomie“ gelten.
In den „Quaderni Rossi“ entwickeln Panzieri u.a. eine Kritik an PCI und PSI sowie den von ihnen dominierten Gewerkschaften. Ein Kernpunkt dieser Kritik richtete sich gegen die „objektivistische Interpretation“ der technologischen Entwicklung, die sie bei den Reformisten feststellen.
„Man hegt nicht den leisesten Verdacht, daß der Kapitalismus die neue »technische Basis«, die der Übergang zum Stadium der fortgeschrittenen Mechanisierung (und der Automatisierung) ermöglicht hat, dazu ausnutzen könnte, um die autoritäre Struktur der Fabrikorganisation zu verewigen und zu konsolidieren; der ganze Industrialisierungsprozeß ist nämlich angeblich von der »technologischen« Zwangsläufigkeit beherrscht, die zur Befreiung »des Menschen von den Schranken führt, die ihm seine Umwelt und seine physischen Möglichkeiten auferlegen«. Die »Verwaltungsrationalisierung«, der gewaltige Ausbau von Funktionen der »Organisation nach außen hin« werden ebenso in einer »technischen«, »reinen« Form gesehen: die Beziehung zwischen diesen Entwicklungen und den Widersprüchen und Prozessen des Spätkapitalismus (der nach immer komplexeren Mitteln sucht, um seine Planung durchzusetzen), d.h. die konkrete historische Wirklichkeit, in der die Arbeiterbewegung lebt und kämpft, die heutige »kapitalistische Anwendung« der Maschinen und der Organisation – alles das wird zugunsten einer idyllischen technologischen Konzeption völlig übersehen.” (3)
Völlig zurecht kritisiert hier Panzieri die undialektische Sichtweise der technischen Entwicklung durch den italienischen Reformismus (wie der Sozialdemokratie und des Stalinismus überhaupt). Die Einheit des kapitalistischen Produktionsprozesses als Verwertungs- und Arbeitsprozess wird in der Art getrennt, dass der Arbeitsprozess nur als technisches Ordnungssystem aufgefasst wird. In dieser Sicht manifestieren sich im Arbeitsprozess bloß ein technologisches Arrangement und ein Fortschritt, auf dem eine Hierarchie der Fabrikorganisation aufbaut, die einfach dem Stand der Technik entspricht (was, nebenbei bemerkt, auch die Notwendigkeit der Beibehaltung eines bürokratischen betrieblichen Regimes in jeder zukünftigen Gesellschaftsformation und seine Rechtfertigung im „real existierenden Sozialismus“ impliziert).
Falsch an der reformistischen Herangehensweise ist, dass sich der Arbeitsprozess immer auch durch ein Ausbeutungsverhältnis, dass die „Despotie“ der Fabrik sich auch in der konkreten Arbeitsorganisation auf Basis einer bestimmten technologischen Stufe manifestiert.
Marx entwickelt diesen Gedanken sehr klar im ersten Band des „Kapitals“ bei der Diskussion des relativen Mehrwerts, wo er den „zwieschlächtigen Charakter“ der kapitalistischen Leitung im Produktionsprozess betont.
„Die Leitung des Kapitalisten ist nicht nur ihre aus der Natur des gesellschaftlichen Arbeitsprozesses entspringende und ihm angehörige besondere Funktion, sie ist zugleich Funktion der Ausbeutung eins gesellschaftlichen Arbeitsprozesses und daher unbedingt durch den unvermeidlichen Antagonismus zwischen dem Ausbeuter und dem Rohmaterial seiner Ausbeutung.“ (4)
Und weiter:
„Wenn daher die kapitalistische Leitung dem Inhalt nach zwieschlächtig ist, wegen der Zwieschlächtigkeit des zu leitenden Produktionsprozesses selbst, welcher einerseits gesellschaftlicher Arbeitsprozess zur Herstellung eines Produkts, andererseits Verwertungsprozess des Kapitals, so ist sie der Form nach despotisch.“ (5)
Der frühe Operaisismus will daran anknüpfen und den Kampf der ArbeiterInnen gegen den „Despotismus“ des Fabrikregimes und der kapitalistischen Leitung zu seinem Recht verhelfen. Er tut dies jedoch, indem er den Kampf gegen diesen Despotismus zum eigentlichen Kern der Klassenauseinandersetzung macht.
“Die »neuen« Forderungen der Arbeiterklasse, die in den Arbeitskämpfen artikuliert werden, haben keinen unmittelbaren revolutionären politischen Inhalt und implizieren auch keine automatische Entwicklung in dieser Richtung. Dennoch kann ihre Bedeutung auch nicht auf die einer bloßen ‘Anpassung’ an die jüngsten technologischen und organisatorischen Entwicklungen in der modernen Fabrik zurückgeführt werden, die eine ‘Regelung’ der Arbeitsverhältnisse auf einem höheren Niveau ermöglichten. Sie liefern vielmehr Hinweise auf die zukünftige Entwicklung des Kampfes der Arbeiterklasse allgemein und seiner politischen Bedeutung. Diese Hinweise ergeben sich jedoch nicht einfach aus der Kenntnisnahme und aus der ‘Summe’ jener Forderungen, so neu und ‘fortschrittlich’ sie sich auch im Vergleich zu den traditionellen Zielen ausnehmen mögen. Die Verhandlungen über Arbeitszeiten und -rhythmen, über die Höhe der Belegschaft, das Verhältnis von Lohn und Produktivität, usw., neigen natürlich dazu, das Kapital innerhalb des Akkumulationsmechanismus selbst und auf der Ebene seiner ‘Stabilisierungsfaktoren’ anzugreifen. Daß diese Forderungen durch die Kämpfe der Arbeiter in den Schlüssel- und Wachstumsindustrien vorangetrieben werden, ist eine Bestätigung ihres systemsprengenden Charakters. Der Versuch, sie für die engen Ziele eines allgemeinen Lohnkampfes auszunutzen, führte in der Praxis nicht zu einer neuen, umfassenderen Einheit der Klassenaktion, sondern zu ihrem geraden Gegenteil, nämlich zu dem Rückfall in betriebliche Abgeschlossenheit als notwendige Folge der Aushöhlung der potentiellen Elemente politischen Fortschritts.” (6)
In dieser Passage von 1961 sind schon Kernelemente des Operaismus enthalten. Panzieri gesteht zwar zu, dass „die neuen Forderungen“, der Arbeiterklasse „keinen unmittelbar revolutionären politischen Inhalt“ haben; anders als die Gewerkschaftsbürokraten und die reformistischen Parteiführungen richten die QR ihren Blick auf die neuen Arbeiterschichten, v.a. auf die MigrantInnen aus Süditalien, die von der expandierenden Industrie Norditaliens als billige Arbeitskräfte angeworben und von den Gewerkschaften praktisch ignoriert wurden.
Aber Panzieri macht in obiger Passage einen weiteren Schritt, der für die Analyse des Operaismus prägend werden sollte. Den „neuen“ ökonomischen Forderungen der Arbeiterklasse wird ein „systemsprengender Charakter“ unterschoben.
Er behauptet, dass der „Versuch, sie für die engen Ziele eines allgemeinen Lohnkampfes auszunutzen“ eigentlich keinen realen Boden auf Grundlage der spontanen Kämpfe hätte, sondern „von außen“ durch die Gewerkschaftsbürokratie oder andere, die ArbeiterInnen gängelnde Organisationen hineingetragen würden.
Nun werden ernsthafte KommunistInnen nicht abstreiten, dass es auch in ökonomischen Kämpfen Momente der Negation des Kapitalsverhältnisses gibt. So unterbricht natürlich jeder Streik die Produktion von Mehrwert und greift zeitweilig die Verfügung des Unternehmers (oder einer ganzen Unternehmergruppe) über ihren Betrieben an.
Natürlich können und werden solche Kämpfe immer wieder auch politische Frage aufwerfen, z.B. wenn die Unternehmer die Polizei zu Hilfe rufen, wenn der bürgerlicher Staat das Streikrecht einschränkt usw.
Das ist jedoch etwas anderes, als die Sichtweise der Operaisten, die dem ökonomischen Kampf selbst einen systemsprengenden Charakter unterstellen.
Hierin unterscheidet sich diese Sicht, wenn auch am Beginn in z.T. ambivalenter Form, grundlegend von jener des Marxismus.
In der Analyse des Arbeitslohns zeigt Marx, dass die Ausbeutung des Arbeiters im Lohnfetisch scheinbar verschwindet, dass das reale Ausbeutungsverhältnis mystifiziert wird. Warum? Weil es so erscheint, als würde der Kapitalist nicht den Wert der Ware Arbeitskraft, sondern die Arbeit bezahlen, als hätte der Arbeiter den Lohn für den „Wert der Arbeit“ erhalten.
„Auf der Oberfläche der bürgerlichen Gesellschaft erscheint der Lohn des Arbeiters als Preis der Arbeit, eine bestimmtes bestimmtes Quantum Geld, das für ein bestimmtes Quantum Arbeit gezahlt wird.“ (7)
Marx weiter: „Was dem Geldbesitzer am Warenmarkt direkt gegenübertritt, ist in der Tat nicht seine Arbeit, sondern der Arbeiter. Was letzter verkauft ist seine Arbeitskraft. Sobald seine Arbeit wirklich beginnt, hat sie bereits aufgehört, ihm zu gehören, kann also nicht mehr verkauft werden. Die Arbeit ist die Substanz der Werte, aber sie hat keinen Wert.“ (8)
Es scheint so, also würde der Kapitalist dem Arbeiter die gesamte Arbeit zahlen. Die Mehrarbeit, die Ausbeutung verschwindet im Bewusstsein beider, so dass auch im Alltagsbewusstsein unter Ausbeutung nur „zu geringe“ Bezahlung, Billiglohn usw. verstanden wird.
Doch damit nicht genug. Marx stellt auch die Frage, warum sich die „illusionäre“ Vorstellung vom „Wert der Arbeit“ so hartnäckig hält, warum diese nicht einfach durch die täglich erfahrene Ausbeutung, durch den gemeinsamen Kampf usw. durchbrochen werden kann?
„Im Ausdruck:‚Wert der Arbeit‘ ist der Wertbegriff nicht nur völlig ausgelöst, sondern in sein Gegenteil verkehrt. Es ist ein imaginärer Ausdruck wie etwa Wert der Erde. Diese imaginären Ausdrücke entspringen jedoch den Produktionsverhältnissen selbst. Sie sind Kategorien für Erscheinungsformen wesentlicher Verhältnisse.“ (9)
Marx weist nach, dass mit der Lohnform (und damit natürlich immer auch im Lohnkampf) spontan eine Verkehrung der realen gesellschaftlichen Verhältnisse im Alltagsbewusstsein der Gesellschaft und natürlich auch in jenem der Arbeiterklasse einhergehen muss. Daher ist das „spontane“ Lohnarbeiterbewusstsein, wie es täglich im Rahmen der kapitalistischen Produktionsverhältnisse unwillkürlich produziert und reproduziert wird, eine Form bürgerlichen Bewusstseins.
Die Forderung nach höherem Lohn, der Lohnkampf als solcher hat daher auch noch keine systemsprengende Qualität, so notwendig und unvermeidlich dieser tägliche Kleinkrieg mit dem Kapital auch ist, wenn die Arbeiterklasse überhaupt ihre Existenzbedingungen wahren will.
Für den Operaismus liegt die Sache aber anders. Die von ihm angeführten Forderungen – Verhandlungen über Arbeitszeiten und -rhythmen, über die Größe der Belegschaft, das Verhältnis von Lohn und Produktivität – sind eigentlich „klassische“ Gewerkschaftsforderungen, ökonomische Forderungen, die sich um die Verkaufs- und Reproduktionsbedingungen der Ware Arbeitskraft drehen. Nun erhebt sie Panzieri zu „systemsprengenden Forderungen“, indem er behauptet, dass sie „das Kapital innerhalb des Akkumulationsmechanismus selbst und auf der Ebene seiner »Stabilisierungsfaktoren«“ angreifen. „Innerhalb des Akkumulationsmechanismus“ bewegt sich aber auch jeder Lohnkampf (ob in einem Betrieb, in einer Branche oder in einer Nationalökonomie). Es geht dabei immer um die Höhe des Mehrwerts, der den ArbeiterInnen abgepresst werden kann. Natürlich kann sich dieser Kampf zu einem politischen Klassenkampf zuspitzen – und MarxistInnen müssen in jedem Fall dafür kämpfen. Aber niemals passiert das „von selbst“. Eine unvermittelt „systemsprengende Qualität“ hat eine ökonomische Forderung für sich eben nicht, sondern immer nur im Rahmen eines Gesamtprogramms. Noch viel weniger trifft das auf die Lohnforderung selbst zu, die von den Operaisten zu einer, wenn nicht sogar zu der zentralen Forderung hochstilisiert wurde.
Hier geht der Operaismus direkt einen Schritt hinter den Marxismus zurück, der eben schon im 19. Jahrhundert forderte, die Fetischisierung des Lohnkampfes z.B. durch die britischen Gewerkschaften durch das revolutionäre Ziel „Abschaffung des Systems der Lohnarbeit“ zu ersetzen.
Es ist typisch für den Operaismus wie auch verschiedene Facetten des linken Syndikalismus, dass eine bestimmte Form des ökonomischen Kampfes – im Fall der Operaisten die Lohnforderung – als “eigentlicher” Klassenkampf hingestellt wird. Ihm wird eine systemsprengende oder jedenfalls qualitativ fortschrittlichere Seite zugesprochen als anderen Auseinandersetzungen (z.B. Kampf um bessere Arbeitsbedingungen). Dass in den letzten Jahren manche oppositionelle Gewerkschafter in Deutschland die operaistische These vom Primat des Lohnkampfes umgekehrt haben und sog. “qualitativen” Forderungen (Arbeitssicherheit, …) eine größere Wichtigkeit bemessen, heißt nur, den Fehler unter anderem Vorzeichen zu wiederholen.
Akkumulations- und Lohnbewegung bei Marx und bei den Operaisten
Für den Marxismus ist der ökonomische Kampf v.a. eine Reaktion auf vorhergehende Zumutungen des Kapitals, um überhaupt die Verkaufsbedingungen der Ware Arbeiterkraft zu ihrem Wert sicherzustellen. Im ersten Band des „Kapitals“ weist Marx nach, dass es einen bestimmten Zusammenhang von Akkumulationsbewegung und Lohnhöhe resp. Ausbeutungsrate gibt, dass die Akkumulationsbewegung der bestimmende Pol dieses Verhältnisses ist.
„Das Gesetz der kapitalistischen Produktion, das dem angeblichen ‚natürlichen Populationsgesetz‘ zugrunde liegt, kommt einfach auf dies heraus: Das Verhältnis zwischen Kapital, Akkumulation und Lohnrate ist nichts als das Verhältnis zwischen der unbezahlten, in Kapital verwandelten Arbeit und der zur Bewegung des Zusatzkapitals erforderlichen zuschüssigen Arbeit. Es ist also keineswegs ein Verhältnis zweier voneinander unabhängigen Größen, einerseits Größe des Kapitals, andrerseits der Zahl der Arbeiterbevölkerung. Wächst die Menge der von der Arbeiterklasse gelieferten und von der Kapitalistenklasse akkumulierten, unbezahlten Arbeit rasch genug, um nur durch einen außergewöhnlichen Zuschuß bezahlter Arbeit sich in Kapital verwandeln zu können, so steigt der Lohn, und alles andre gleichgesetzt, nimmt die unbezahlte Arbeit im Verhältnis ab. Sobald aber diese Abnahme den Punkt berührt, wo die das Kapital ernährende Mehrarbeit nicht mehr in normaler Menge angeboten wird, so tritt eine Reaktion ein: ein geringerer Teil der Revenue wird kapitalisiert, die Akkumulation erlahmt, und die steigende Lohnbewegung empfängt einen Gegenschlag. Die Erhöhung des Arbeitspreises bleibt also eingebannt in Grenzen, die die Grundlagen des kapitalistischen Systems nicht nur unangetastet lassen, sondern auch seine Reproduktion auf wachsender Stufenleiter sichern.“ (10)
Marx fasst hier zusammen, was er im Kapital über „Das allgemeine Gesetz der kapitalistischen Akkumulation“ an anderer Stelle noch prägnanter zusammenfasst:
„Es sind diese absoluten Bewegungen des Kapitals, welche sich als relative Bewegungen in der Masse der exploitablen Arbeitskraft widerspiegeln und daher der eigenen Bewegung der letzteren geschuldet scheinen. Um mathematische Ausdrücke anzuwenden: die Größe der Akkumulation ist die unabhängige Variable, die Lohngröße die abhängige, nicht umgekehrt.“ (11)
Marx verdeutlicht hier nicht nur kategorisch das Verhältnis von Akkumulations- und Lohnbewegung. Er verweist auch darauf, dass dieses Verhältnis an der Oberfläche der bürgerlichen Gesellschaft verkehrt erscheint. Ein beträchtlicher Teil der bürgerlichen Pseudo-Wirtschaftswissenschaft, der „Vulgärökonomie“ baut seine ganze „Weisheit“ auf dieser Erscheinung auf, dass die Lohnhöhe die Investitionen usw. bestimme – was in der platten neoliberalen Formel endet, dass doch die ArbeiterInnen „Zurückhaltung“ üben sollten, damit „die Wirtschaft“ auch in ihrem Interesse wachse.
Doch auch die Operaisten und Autonomisten sitzen diesem Schein auf! Auch sie drehen dieses Verhältnis regelrecht um. Diese Position geht im wesentlichen auf Mario Tronti, einen anderen Autor der QR zurück.
„Wir haben die Ware Arbeitskraft als eigentlich aktive Seite des Kapitals betrachtet, als natürlichen Sitz jeder kapitalistischen Dynamik. Sie ist nicht nur Protagonist in der erweiterten Reproduktion des Verwertungsprozesses, sondern auch in den ständigen revolutionären Veränderungen des Arbeitsprozesses. Selbst die technologischen Veränderungen werden diktiert und durchgesetzt durch die im Wert der Arbeitskraft eingetretenen Veränderungen. Kooperation, Manufaktur, große Industrie sind nur „besondere Methoden der relativen Mehrwertproduktion“, Formen, die von jener Ökonomie der Arbeit verschieden sind, die ihrerseits die zunehmenden Veränderungen in der organischen Zusammensetzung des Kapitals hervorruft. Das Kapital wird immer abhängiger von der Arbeitskraft; diese muß es deswegen immer umfassender besitzen, ebenso wie es die natürlichen Kräfte ihrer Produktion besitzt; es muß die Arbeiterklasse selbst zur Naturkraft der Gesellschaft reduzieren. Je mehr die kapitalistische Entwicklung voranschreitet, desto stärker ist der Gesamtkapitalist darauf angewiesen, die ganze Arbeit innerhalb des Kapitals zu sehen, muß alle Bewegungen – innere und äußere – der Arbeitskraft kontrollieren, und ist gezwungen, das Verhältnis von Kapital und Arbeit langfristig zu planen, als Stabilitätsindex für das Gesellschaftssystem. Sobald das Kapital alle Bereiche außerhalb der Produktion im engeren Sinne erobert hat, beginnt sein Prozeß der inneren Kolonisierung; so kann man erst, wenn sich endlich der Kreis der bürgerlichen Gesellschaft schließt – Produktion, Distribution, Austausch und Konsumtion – recht eigentlich von dem Beginn der kapitalistischen Entwicklung sprechen. An diesem Punkte gesellt sich der Prozeß der objektiven Kapitalisierung der subjektiven Kräfte der Arbeit notwendig zu dem Prozeß der materiellen Auflösung des Gesamtarbeiters und damit des Arbeiters selbst, insofern er Arbeiter ist: er ist selbst auf eine Eigenschaft der kapitalistischen Produktionsweise reduziert und damit eine Funktion des Kapitalisten. Es ist klar, daß die Integration der Arbeiterklasse in das System zur Lebensnotwendigkeit für den Kapitalismus wird: die Ablehnung dieser Integration durch den Arbeiter hindert das System am Funktionieren. Es wird nur eine Alternative möglich: dynamische Stabilisierung des Systems oder proletarische Revolution.“ (12)
Die Krise erscheint nicht als notwendige Folge der Akkumulationsbewegung, als notwendiges Resultat der Kapitalbewegung selbst, sondern als „Antwort“ auf die Aktionen der Arbeiterklasse.
Diese kann selbst die Krise herbeiführen oder gar verschärfen, indem sie den ökonomischen Kampf zuspitzt. Es ist daher auch klar, warum die Lohnforderung einen so zentralen Stellenwert beim Operaismus besitzt.
“Auch wir haben erst die kapitalistische Entwicklung gesehen und dann die Arbeiterkämpfe. Das ist ein Irrtum. Man muß das Problem umdrehen, das Vorzeichen ändern, wieder vom Prinzip ausgehen: und das Prinzip ist der proletarische Klassenkampf. Auf der Ebene des gesellschaftlich entwickelten Kapitals ist die kapitalistische Entwicklung den Arbeiterkämpfen untergeordnet, sie kommt nach ihnen, und der politische Mechanismus der eigenen Produktion muß ihnen entsprechen.” (13)
Der Klassenbegriff des Operaismus
Im obigen Zitat Panzieris klingt auch eine wesentlich (industrie-)soziologische Bestimmung des „revolutionären Subjekts“ an. Im Text sind das die „Arbeiter in den Schlüssel- und Wachstumsindustrien“.
In der operaistischen Theorie der 1960er und der frühen 70er Jahre ist es der „Massenarbeiter“, der aufgrund seiner besonderen Stellung im Produktionsprozess der Kern der revolutionären Umwälzung und das Zentrum und der Ausgangspunkt der politischen Organisierung sei.
In den 50er/60er Jahren sei es in Italien zu einer „Neuzusammensetzung“ der Arbeiterklasse gekommen (ein Prozess, der in anderen Ländern, z.B. den USA schon viel früher verortet wird). Diese „neue Zusammensetzung“ hat einen neuen „Typus“ von Arbeiter hervorgebracht, den „Massenarbeiter“. Darunter können wir uns, grob gesagt, den Fließbandarbeiter, den Proletarier in der Fabrik vorstellen, die gemäß „wissenschaftlicher Betriebsführung“ organisiert ist und den einzelnen ArbeiterInnen nur noch sinnentleerte, mechanische Tätigkeiten zuordnet.
“Im operaistischen Denken ist die materialistische Instanz ein entscheidendes Element der ganzen Theorie: man könnte auch sagen, daß gerade das materialistische Interpretationskriterium es erlaubte, historisch-logisch korrekt die Aufeinanderfolge der Arbeiterfiguren in der Geschichte des Kapitalverhältnisses zu rekonstruieren. Indem man als Festpunkt jeder Analyse die Beziehung der Körper zu den Arbeitsinstrumenten nahm, der Denk- und Handlungsweisen zu den Produktionsweisen, der Subjektivität zur Objektivität, wurde klar, daß die politischen Verhaltensweisen, die Formen, die vom Klassenkampf ausgedrückten Bedürfnisse sich bestimmt haben und sich bestimmen auf der Basis der objektiven Beziehung der Arbeit zum Kapital, des Menschen gegenüber der Maschine. So daß der professionelle Arbeiter angesichts einer nur formalen Subsumption seiner Arbeit unters Kapital für die Wiederaneignung der Produktionsmittel kämpfte, für die Selbstverwaltung der Fabrik – und der Massenarbeiter direkt gegen das physische Bestehen des Kapitals, seine technische Seinsweise, Ausdruck einer nun auch realen Subsumption seiner Arbeit. Der revolutionäre Prozeß definierte und definiert sich also in bezug auf die Arbeiterfigur, die in der kapitalistischen Arbeitsorganisation dominiert oder zur Dominanz tendiert. Die technische Zusammensetzung der Klasse bestimmt genau den Ausschnitt der Klasse, auf den das Kapital den Akkumulationsprozeß zu stützen versucht; die politische Zusammensetzung der Klasse definiert den materiell bestimmten Charakter ihres Antagonismus.“ (14)
Dieses Zitat eines Vertreters der autonomen Richtung verdeutlicht den Unterschied zwischen Marxismus und Autonomismus schon beim Klassenbegriff. Im Marxismus ist der Klassenbegriff – anders als in der bürgerlichen Soziologie – immer einer des Verhältnisses. So scheint der autonome Autor auch zu beginnen, doch führt er das Verhältnis zwischen Arbeiter- und Kapitalistenklasse dann alsbald in die Fabrik, aus der dann schließlich eine historisch bestimmte „Arbeiterfigur“ hervortritt, auf die hin sich der „revolutionäre Prozeß definierte und definiert“.
Entscheidend ist hier: Die Arbeiterklasse wird nicht definiert im Verhältnis zur Kapitalistenklasse, also aufgrund ihrer Stellung in einem gesellschaftlichen Produktionsverhältnis, sondern aufgrund ihrer Stellung zu einem bestimmen Produktionsmittel, zum Arbeitsmittel.
Im Grunde sitzt hier der Operaismus – wieder einmal – der Fetischisierung durch das Kapitalverhältnis selbst auf. In der bürgerlichen Gesellschaft erscheinen Klassen tatsächlich auf den ersten Blick als eine Gruppe von Menschen, die sich durch gemeinsame Eigenschaften auszeichnen, z.B. bestimmte Einkommensgruppen, bestimmte Verhaltensweisen (Habitus), gemeinsame Kenntnisse (Wissen, „intellektuelles“ Kapital) u.ä. Im Operaismus geht es methodisch ähnlich zu. Hier ist es nur eine gemeinsame Stellung zur Technologie, zu einem bestimmten Arrangement der Produktionsorganisation, die eine bestimmte „Arbeiterfigur“ hervorbringt.
Aus dem Verhältnis zum Arbeitsmittel erwächst dann auch das „Bewusstsein“. Der „professionelle Arbeiter“ – gemeint ist hier der Facharbeiter – hätte daher immer für die „Selbstverwaltung der Fabrik“ kämpfen wollen, während der „Massenarbeiter“ „gegen das physische Bestehen des Kapitals“ antrete.
Aus dieser Vorstellung folgt auch die Konzentration der frühen autonomen Bewegung nicht nur auf den Lohnkampf, der ja auch dem Kapital „immer mehr wegnimmt“, sondern auch die Begeisterung für Sabotage als Klassenkampfform oder überhaupt für den „Kampf gegen die Arbeit“.
Diesen Zusammenhang von Arbeitsorganisation und vorherrschender Technologie mit der Frage des revolutionären Bewusstseins verdeutlich der Autor noch einmal in seinem Beitrag.
“Die Klassenzusammensetzung des Massenarbeiters stellte das dar, was in der Statistik ein »Kollektiv« ist, also die Basiseinheit der wissenschaftlichen Beobachtung: ein Ensemble homogener Einheiten mit einem bestimmten »Merkmal«. In unserem Fall: ein Ausschnitt der Arbeitskraft, der materiell homogenisiert wird durch eine bestimmte Beziehung zur kapitalistischen Technologie (dem Fließband) und einem daraus folgenden politischen Verhalten: Forderung nach Lohn als Einkommen, Verweigerung der Arbeit, Sabotage.“ (15)
Hier tritt also ein Grundfehler des Operaismus noch einmal deutlich zutage, der weit reichende politische Konsequenzen hat. Für ihn erwächst Klassenbewusstsein aus einer bestimmten Stellung, aus dem „Sein“ des Massenarbeiters, aus dem Sein eines bestimmten „Arbeitertyps“.
Dieses muss nur „unbefleckt“ zum Vorschein kommen. Die Aufgabe der revolutionären Organisation besteht gewissermaßen darin, diesen Prozess anzuschieben und gegen jene anzukämpfen, die ihn zu behindern versuchen.
„Im gemeinsamem Kampf mit den Protagonisten des Kampfes der arbeitenden Klassen selbst die Ziele und die Formen (zu) suchen, mit denen der aktuell geführte Kampf selbst die Richtung auf die bewusste Verwirklichung eines sozialistischen Systems nehmen kann; die Umwandlung der objektiven Kräfte in subjektive, politisch bewusste Kräfte, in einer Perspektive der Überwindung des bestehenden Systems, die die partikularistischen Forderungen, Resultate der unterschiedlichen Ebenen (…) verbindet zu verallgemeinerten hypothetischen Synthesen, die sich der Lebensnerven des Systems bedienen und die aus dem Inneren der Bewegung des Klassenkampfes selbst die Orientierung seiner entwickeltsten Spitzen geben.“ (16)
Diese Formulierungen erinnern frappant an die Texte der Ökonomisten in der russischen Sozialdemokratie, die sich heftig gegen die Position Lenins und seiner Anhänger wandten. Dieser hatte darauf insistiert, dass revolutionäres Klassenbewusstsein nicht organisch aus dem ökonomischen/betrieblichen Kampf der ArbeiterInnen erwachsen könne, sondern von außen, durch eine organisierte revolutionären Kraft – die kommunistische Partei – in die Klasse getragen werden müsse. Die Ökonomisten hingegen erblicken im ökonomischen Kampf und dem sich daraus entwickelnden Bewusstsein schon „proletarisches Klassenbewusstsein“, während Lenin zu Recht darauf bestand, dass es sich dabei um „nur-gewerkschaftliches Bewusstsein“ handelt und handeln kann.
Die Operaisten der 60er Jahre begehen denselben Fehler, allerdings mit einer anderen Stoßrichtung. Während die russischen Ökonomisten den revolutionären Kampf abschwächen wollten, wollten die Operaisten diesen befördern. Den politischen Konsequenzen dieses Fehlers entgehen sie allerdings nicht, obwohl der „Operaismus“ gegen Ende der 60er Jahre einen enormen politischen Zulauf erhält und einen starken organisatorischen Aufschwung nimmt.
Operaismus und Klassenkämpfe der 1970er Jahre
Zunächst führten die konzeptionellen Vorstellung der Operaisten aber in den QR zu einer Differenz über der Frage, ob es sinnvoll sein, überhaupt noch in den bestehenden Organisationen der Arbeiterbewegung, also den reformistischen Parteien, aber auch in Gewerkschaften zu arbeiten oder nicht. 1962, nach Massenstreiks bei Fiat, wo erstmals der „Massenarbeiter“ in Aktion zu sehen war, wurde diese Frage immer wichtiger und führte 1963 zur Spaltung. Die Gruppe um Marco Tronti und Antonio Negri hielt eine Orientierung an den traditionellen Arbeiterorganisationen für immer weniger sinnvoll und gründete schließlich die politisch offensivere Zeitschrift „Classe Operaia“ (Arbeiterklasse, CO), deren erste Nummer 1964 erschien und die politischen Grundlagen des Operaismus weiter ausarbeitete.
Doch dies war erst der Beginn autonomer Organisationen. Ein Teil von Classe Operaia formierte sich ab 1969 als Potere Operaia (Arbeitermacht), die erste operaistische Organisation im eigentlichen Sinn, die rasch auf mehrere tausend Mitglieder anwuchs. Der Operaismus erhielt in dieser Phase Zulauf aus der Arbeiterradikalisierung und der Jugend.
Er beeinflusste auch zum Teil das Denken anderer Organisationen aus der radikalen Linken wie Lotta Continua, Il manifesto und Avanguardia Operaia.
Diese Gruppierungen waren selbst noch klar auf Kernschichten der Arbeiterklasse, den „Massenarbeiter“ orientiert. Dieser war für sie „das revolutionäre Subjekt.“ Sie vertraten überdies einen positiven Bezug zum „Leninismus“ (oder was sie darunter verstanden), zum Maoismus (besonders zur „proletarischen Kulturrevolution“) und zur Notwendigkeit einer „straffen revolutionären Organisation“. D.h. die Operaisten oder vom Operaismus mehr oder weniger stark beeinflusste Strömungen der späten 60er/frühen 70er Jahre verstanden sich also durchaus als Kaderorganisationen.
Ende der 60er Jahre schien ihnen die Entwicklung des Klassenkampfes in Italien Recht zu geben – und zwar im „Vorzeigebetrieb“ des italienischen imperialistischen Kapitalismus, bei FIAT.
Die Fabrik in Turin war mit 170.000 (!) Beschäftigten ein industrieller Gigant. Dabei hatten es die Konzernführung und das Management verstanden, in den 50er Jahren, die „linken“ Gewerkschaften (also die KP-nahe CGIL) massiv zu schwächen und durch offen gelbe Gewerkschaften, die SIDA (Sindicato Italiano dell‘ Automobile) zu ersetzen.
Trotzdem brachen dort 1962 massive Kämpfe aus. Darin spielten die „Massenarbeiter“, d.h. FließbandarbeiterInnen, die zum größten Teil aus Süditalien angeworben worden waren (auch um die linken Gewerkschaften zu schwächen), eine radikale Schlüsselrolle. Die Kämpfe führten in den 60er Jahren zu zwei Resultaten: einerseits konnte sich die CGIL re-etablieren, andererseits stieg auch der Einfluss des Operaismus, der „Arbeiterautonomie“ in der Fabrik. Diese organisierten sich bei FIAT wie in ganz Norditalien in den Basiskomitees CUB (Comitati Unitari di Base).
1968 beginnt die Wirtschaftskrise die italienische Ökonomie zu treffen. Es kommt zu ersten Streiks und Kämpfen gegen die Abwälzung der Krisenkosten bei FIAT, doch stehen diese noch unter Führung und Hegemonie der Gewerkschaftsapparate.
1969 kippt die Sache. Eine zweite Streikwelle beginnt im Frühjahr 1969, als die Beschäftigten von FIAT Turin in einen Solidaritätsstreik mit den von der Polizei belagerten ArbeiterInnen der süditalienischen Kleinstadt Battipaglia traten (bei der Belagerung waren Arbeiter von der Polizei erschossen worden). Die Unruhe der Arbeiter schwoll zu einer breiten Streikbewegung an: zum „roten“ oder „schleichenden Mai“ (maggio striciante).
Die Gewerkschaftsführungen sahen sich jetzt basisdemokratischen Entwicklungen gegenüber. Die ArbeiterInnen tauschten die gewerkschaftliche Streikleitung durch eigene, von Vollversammlungen gewählte, jederzeit abwählbare Delegierte aus. Teilweise wurden die Gewerkschaftsvertreter auf den Vollversammlungen ausgepfiffen oder gar ausgeschlossen. Vor den großen Fabriken fanden wöchentlich öffentliche Vollversammlungen statt, so dass ArbeiterInnen aus der gesamten Umgebung daran teilnehmen konnten.
Diese zweite Kampfeswelle gipfelte am 3. Juli in einem Generalstreik in Turin gegen die allgemeinen Mieterhöhungen in der Stadt.
Es kam zu einer Konvergenz von Studenten- und Arbeiterbewegung. Während Studierende sich als Streikposten betätigten, nahmen ArbeiterInnen an den Demos der StudentInnen teil. Im Rahmen eines Streiks im Juli 1969 beteiligten sich die Bewohner des Turiner Stadtviertels Mirafiori an Zusammenstößen mit der Polizei, was Ausdruck einer gesellschaftlichen Verbreiterung der Forderungen der autonomen ArbeiterInnen war.
Den Höhepunkt erreichten die Streikaktivitäten im Herbst 1969. Eine ganze Streikwelle durchzog Norditalien mit dem Zentrum Turin, genauer der Turiner FIAT-Werke. Dort erwiesen sich die CUBs – anders als noch 1968 – als Organisationsform und betriebliche politische Führung, die im Kampf die CGIL ablösen konnte. Ein wesentlicher Grund dafür war, dass diese Organisationsform besser geeignet war, neu aktivierte Arbeiterschichten in Bewegung zu setzen, sie zum tätigen Subjekt ihrer Kämpfe werden zu lassen.
Trotz dieser Dynamik, Radikalisierung und Kräfteverschiebung in der Arbeiterklasse offenbarte der Operaismus schon 1969 seine politischen Schwächen in eklatanter Art und Weise:
1. Die Analyse der Krise durch operaistische Organisationen wie Potere Operaio oder auch die 1969 gegründete Lotta Continua waren falsch und desorientierend. V.a. Potero Operaio interpretierte die Krise als Resultat der Arbeiterkämpfe und als „Antwort des Kapitals“ auf die Klasse!
2. Auch die Radikalisierung der Arbeiterklasse wurde einseitig und falsch aufgefasst, als wurzle sie in erster Linie in spezifisch italienischen Bedingungen – der Migrationsbewegung aus dem Süden und der damit verbundenen Entstehung des „Massenarbeiters“ – und wäre nicht v.a. Teil und Ausdruck einer internationalen Entwicklung!
3. Die Operaisten hatten überhaupt keine politische Antwort auf die Krise des italienischen Kapitalismus. Die Regierung war in sich zerstritten, was selbst einen politischen Konflikt in der herrschenden Klasse widerspiegelte, nämlich die Frage, ob es zur „Reform“ der Ökonomie und des Staates notwendig wäre, die KPI in die Regierung zu integrieren.
4. Gab es Zusammenstöße der Massenstreiks, der Studentenbewegung, der ArbeiterInnen und Jugendlichen mit dem Staatsapparat. Das bedeutete, dass die Herrschenden an einem toten Punkt angelangt waren, nicht mehr so konnten, wie sie wollten und nach einer Neuordnung des Kräfteverhältnisses und der sozialen Basis ihrer eigenen Regierung suchten. Zugleich waren sie mit einer Arbeiterklasse konfrontiert, die das Land durch eine Reihe von Massenstreiks erschütterte. Kurz gesagt: Italien befand sich in einer vor-revolutionären Situation. Worin bestand nun das Programm der Operaisten diese vorrevolutionäre Situation zu einer revolutionären zu machen? Welches Programm hatten sie, der Arbeiterklasse einen Weg zur Macht zu weisen? Es existierte nicht!
5. So erwiesen sich die Operaisten als unfähig und unwillig, 1968 bei den Massenstreiks für die Ausweitung der Streiks zu einem unbefristeten Generalstreik einzutreten! Sie verabsäumten das und erhoben diese Forderung nie! Im Gegenteil: einige von Operaisten fast schon fetischisierte Kampfformen, z.B. das Langsamarbeiten, das angeblich „das Kapital selbst“ angriff, erwiesen sich in dieser Periode zunehmend eher als Bremsklotz, denn als ein Mittel, die Massenbewegung zu bündeln und zu einer politischen Streikbewegung gegen die Regierung zu machen.
6. Ebenso verabsäumten sie es, die Frage der Arbeiterkontrolle aufzuwerfen, obwohl sie über eine Massenbasis, z.B. FIAT, verfügten. Gerade diese Forderung hätte jedoch eine zentrale Bedeutung dabei gehabt, ausgehend von der spontanen Massenbewegung in den Betrieben und auf der Straße, Organe der proletarischen Doppelmacht aufzubauen und, gestützt auf die Großindustrie, über das ganze Land auszuweiten. So hätten die industriellen Bastionen zum Vorbild für die Bildung von Fabrikkomitees und Arbeiterräten im ganzen Land werden können – und damit zu Kampforganen gegen die Macht der Kapitalisten und des Staates und zu Keimzellen einer zukünftigen, proletarischen Macht.
7. Ebenso lehnten einige der operaistischen Gruppen oder vom Operaismus beeinflusste Gruppierungen wie Lotta Continua die Forderung nach Vollversammlungen und Wahl von Delegierten ab, da diese die „Initiative der Basis“ behindern könnten. Dieses Pseudoargument zeigt, wie tief der Operaismus und die „radikale Linke“ schon damals „im Milieu“, in dem Fall dem des „Betriebs“ verstrickt war. Ohne gewählte und abwählbare Delegierte von Vollversammlungen hätte sich nie eine alternative, von den ArbeiterInnen kontrollierte Kampfführung landesweit bilden lassen. Die Losung des Generalstreiks hätte eng damit verbunden werden müssen. Mehr noch aber hätten RevolutionärInnen in Italien – gerade 1969 – für einen landesweiten Delegiertenkongress der ArbeiterInnen agitieren müssen.
8. Ein solche Perspektive hätte die Frage nach dem Generalstreik und dem Kampf für ein Programm der Arbeiterklasse gegen die Krise auf die Tagesordnung gesetzt: ein Programm der politischen Machtergreifung der Klasse. Genau das war und ist dem Operaismus – wie all seinen autonomen Nachfolgern – völlig fremd. Er kennt kein Programm der politischen Machtergreifung und noch weniger kennt er Taktiken gegenüber anderen, in der Arbeiterklasse verankerten Organisationen, um deren Einfluss zu brechen.
9. So hatten die Operaisten „natürlich“ überhaupt keine Forderungen und keine Taktik gegenüber der angeblich „erledigten“ KP. Sie hatten keine Forderungen an die Gewerkschaften, sie hatten keine Forderung für die ungelösten demokratischen Fragen Italiens oder für die sozialen Probleme der Bauernschaft und des Südens. Damit hatten sie aber auch kein Mittel, um die proletarische Massenbasis der PCI von ihrer Führung zu brechen. Das war zusätzlich fatal, weil die PCI trotz ihrer erzreformistischen Politik in den 70er Jahren weiter die größte und am besten verankerte Partei in der Arbeiterklasse war und – parallel zur rasch wachsenden radikalen Linken – ihren Einfluss ausbauen konnte. Daher wären Forderungen an die Reformisten wie jene nach einem Bruch mit ihrer Koalitionspolitik (z.B. kein Pakt mit der Regierung!) entscheidend gewesen, um deren proletarische Massenbasis für den Kampf und letztlich für die Revolution zu gewinnen.
10. Die Politik der Operaisten, die weder in der Lage waren, ein revolutionäres Programm zur Machtergreifung vorzulegen, noch einen Weg, die Massen von reformistischen/bürgerlichen Führungen zu brechen und für die Revolution zu gewinnen, musste letztlich scheitern – und sie ist gescheitert. Wir halten uns hier nur deshalb so lange an diesem Punkt auf, um zu zeigen, dass es kein vermeintlich glorreiches Zeitalter des „Arbeiterautonomismus“ gibt, dass er schon bei seiner ersten großen historischen Bewährungsprobe – in einer vorrevolutionären Krise – versagt hat.
11. Entscheidend für dieses Versagen war das grundlegend falsche Verständnis des Operaismus und des späteren Autonomismus vom Verhältnis revolutionärer Avantgarde/Partei/Organisation zu den Massen. Im Operaismus sollte der „Massenarbeiter“ die Massen einfach qua seiner Initiative, durch sein Tun „mitreißen“ und die Hindernisse zur deren Revolutionierung, deren passive Elemente und Bindungen an die bestehende Gesellschaft hinwegspülen. Im Marxismus ist das ganz anders. Die Aufgabe der Avantgarde erschöpft sich keineswegs darin, durch besondere Radikalität der eigenen Aktion, durch „Vorstürmen“, andere mitzureißen. Sie muss auch ein politische Strategie, eine Programm vorlegen, das eine Lösung für alle grundlegenden Probleme einer Gesellschaftsordnung beinhaltet – also nicht nur Schritte, Aktivitäten für die „Avantgarde“ oder die „Kämpfenden“, sondern z.B. auch für die Bauernschaft, für weniger klassenbewusste Schichten der Lohnabhängigen. Sie muss diese in einem Programm bündeln, das deutlich macht, dass nur die Arbeiterklasse in der Lage ist, ein solches Programm umzusetzen, also die gesamte Gesellschaft so zu reorganisieren, dass die Bedürfnisse aller Unterdrückten befriedigt werden können; sie muss verdeutlichen, dass sie zur Realisierung eines solchen Programms selbst die politische Macht übernehmen muss.
Vom Massenarbeiter zum „Gesamtarbeiter”
Der Heiße Herbst 1969 hatte wichtige Konsequenzen. Die italienische Regierung und die Unternehmer reagierten auf die Arbeitermilitanz mit einer Reihe von Zugeständnissen. Als Folge der Kämpfe und des Generalstreiks 1969 wurden vergleichsweise hohe Lohnerhöhungen erwirkt, das Lohnniveau näherte sich 1970 an die Nachbarländer Italiens an, weiter wurden die 40-Stunden-Woche und der Abbau von Lohngruppen durchgesetzt. Im Mai 1970 wurde im Parlament ein neues Arbeiterstatut verabschiedet, das einen weitgehenden Kündigungsschutz garantierte sowie gewerkschaftliche Handlungsfreiheit im Betrieb einführte. Die CUB wurden als Vertretungsorgane der ArbeiterInnen politisch anerkannt.
Zugleich fand in den Betrieben eine massive Umstrukturierung statt, die die Arbeitsabläufe so veränderte, dass die in den Kämpfen sichtbar gewordene und gestärkte Kollektivität und Klassenbindung geschwächt wurde. Dabei waren die Unternehmer einigermaßen erfolgreich. Zwar kam es 1973 zu einer neuen Welle von Arbeitermilitanz, aber es war auch klar, dass das Fabrikregime einen Wandel durchlief.
Ein Resultat war, dass die Unternehmer politisch gegen die Militanten in den Fabriken in die Offensive gingen und alles versuchten, deren Strukturen zu zerschlagen und ihre AktivistInnen zu feuern. Das gelang auch, insbesondere Mitte 70er Jahre verloren hunderte AktivistInnen in kleineren oder mittleren Betrieben – oft nach erbitterten Kämpfen – ihre Jobs.
Das ging damit einher, dass andere politische Bewegungen öffentlich viel stärker und dynamischer in Erscheinung traten: die Frauenbewegung, die StudentInnen an den Universitäten und die Hausbesetzerbewegung.
Dies führte dazu, dass sich das Konzept des „neuen Massenarbeiters“ als brüchig erwies und ein anderes „Subjekt“ anstelle der bisherigen „Arbeiterfigur“ zu treten schien – der „gesellschaftliche Arbeiter“.
Theoretisiert wurde diese Entwicklung durch einen Teil der Autonomisten unter Federführung von Toni Negri. Dieser ging davon aus, dass die Krise – wiewohl in wesentlichen Aspekten ungelöst – zu einer „Neuzusammensetzung“ der Arbeiterklasse geführt hätte. Das Kapital wäre gezwungen worden, der Arbeit einen „noch abstrakteren“ Charakter zu geben und seinen gesellschaftlichen Charakter auszuweiten. Der „Massenarbeiter“ hätte diese Tendenz schon angezeigt, aber dieser hätte nur einen bestimmten Teil der Klasse, die ArbeiterInnen in der Metallindustrie betroffen: die Avantgarde. Nunmehr aber hätte dieser Prozess die gesamte Gesellschaft ergriffen. Die neue, dem adäquate „Arbeiterfigur“ wäre der „operaio sociale“, der gesellschaftliche Arbeiter.
Mit der Krise hätten eine Veränderung in der Funktionsweise des Staates, ja aller gesellschaftlichen Bereiche im Bezug zur Arbeit stattgefunden, die diese Bereiche gewissermaßen „fabrikmäßig“ zu organisieren beginne. Alle Arbeit, alle Tätigkeit, ob in der Fabrik, im Büro, an der Uni würde unter das Kapital reell subsumiert. Damit aber hätte auch die Scheidung von produktiver zu unproduktiver Arbeit ihren Sinn verloren.
Mehr noch: Der gesellschaftliche Grundwiderspruch selbst verändert sich – der Widerspruch von Kapital und Arbeit wird zum Widerspruch von Proletarier und Staat.
Damit ändern sich auch die zentralen Forderungen und Kampfformen. Beim Massenarbeiter stand für den Operaismus der Lohnkampf im Vordergrund, als zentrale Form des Klassenkampfes. Das ist nun vorbei, schließlich sind „wir“, ja alle Teil des „gesellschaftlichen Arbeiters“, ob nun Fabrikarbeiter, Hausbesetzer, Feministin, StudentIn usw. usf. Anstelle der Forderung nach Lohn treten Forderungen wie die nach „Aneignung“ oder nach „garantiertem Lohn für alle“ – auch ohne Arbeit!
Dass solche Forderungen und Positionen Brüche mit den aus den Betrieben kommenden Arbeiterautonomen mit sich brachten, war klar. So berichtet Wright in „Den Himmel stürmen“ von einer Kontroverse in der Autonomia – einem heterogenen Verband von autonomen Gruppierungen ab 1973. Eine Gruppe von ArbeiterInnen von Alfa Romeo, kritisierte die Losung nach einem „garantierten Lohn für alle und jeden“ von einem proletarischen Standpunkt aus. Die Sache endete jedoch damit, dass die GenossInnen „isoliert blieben“ und ein „paar Monate später die Autonomia“ verließen. (17)
Das illustriert eine Entwicklung der autonomen Bewegung der 70er Jahre, die mit der Theorie des „gesellschaftlichen Arbeiters“ theoretisiert wurde. Anders als die Operaisten der 60er Jahre traten in den 70ern immer mehr nichtproletarische Schichten ins Zentrum der autonomen Bewegung, Organisierung und Aktion. Die Klassenbasis der Autonomen setzte sich „neu zusammen“ – weg vom Industriearbeiter, hin zum Studenten, zum Hausbesetzer. Revoltierende sub-proletarische oder proletarische Jugendliche oder Arbeitslose, deren Aktionen zur Illustrierung der Theorie vom „neuen Gesamtarbeiter dienten, spielten in der realen autonomen Bewegung demgegenüber eine untergeordnete, bis vernachlässigbare Rolle.
D.h. die soziale Basis der Autonomen verkleinbürgerlichte. Die Autonomen entwickelten ihr auch heute bekanntes Gepräge als Form des kleinbürgerlichen Radikalismus.
Diese Entwicklung ging einher vor dem Hintergrund des Niedergangs des radikalen, kämpferischen Flügels der italienischen Arbeiterklasse in den 70er Jahren. Schon vor der Niederlage 1977/79 hatten die Operaisten und Autonomisten viele ihre betrieblichen Positionen verloren, wurden zunehmend aus den Unternehmen gedrängt, isoliert, zuerst v.a. in den mittleren und kleineren Unternehmen – oft unter Mithilfe der reformistischen Gewerkschaften und Parteien.
Aber die Operaisten erwiesen sich auch politisch unfähig, eine politische Antwort auf das Erstarken der PCI Anfang/Mitte der 70er Jahre zu geben, die ironischerweise auch auf die Reformen oder Zugeständnisse zurückzuführen war, die der italienische Staat zeitweilig aufgrund der militanten Arbeiterkämpfe gewähren musste. In jedem Fall erwies sich, dass die operaistische Vorstellung falsch war, dass das „eigentliche“ Arbeiterbewusstsein spontan in eine militante oder kämpferische Richtung drängte, dass vielmehr bürgerliches und reformistisches Bewusstsein (und damit die darauf fußenden Organisationen) eine materielle Basis in der Klasse hat. Dieser Reformismus kann nur durch geduldigen und entschlossen Kampf gegen die reformistischen Organisationen gewonnen werden, der sich auch der Mittel der politischen Taktik (Einheitsfront etc.) bedient.
Die meisten Autonomen der 70er Jahre schlugen jedoch den umgekehrten Weg ein. Sie sahen die PCI und die Gewerkschaften einfach als nur bürgerliche und repressive Kräfte, die nicht nur mit den Unternehmern oder dem bürgerlichen Staat eng kooperierten, sondern mit ihnen im Grunde zu einer ununterscheidbaren Einheit verschmolzen waren.
Diese Sicht wurde stellenweise auch noch pseudo-marxistisch zu untermauern versucht, z.B. mit Negris These, dass es in der Krise keine Reformen und ergo keinen Reformismus geben könne. Daraus wurde deduziert, dass „folgerichtig“ die PCI auch keine reformistische Partei sein könne.
Wiewohl solche Positionen sicher durch die reale Politik der PCI – ihre Denunziation von Militanten, die brutale Repression auch in den von ihr regierten Kommunen, v.a. ihre strategische Orientierung auf einen „historischen Kompromiss“ mit der Christ-Demokratie – auch genährt und scheinbar bestätigt wurden, so waren sie politisch auch ein Fallstrick für die Autonomie.
Das Anwachsen von Bewegungen, besetzten Häusern, Stützpunkten an den Unis, aber auch von neuen Kommunikationsmitteln wie z.B. Radiostationen verursachte mehr und mehr Aufruhr bei der herrschenden Klasse, bei der Regierung und der PCI. Eine scharfe Denunziationskampagne gegen die Autonomen, die des „Terrors“ bezichtigt wurden, setzte ein. Die PCI verglich deren Aktionsformen mit denen der Faschisten.
Die Militanz und Kampfkraft der neuen Autonomie, aber auch die Größe und Dynamik erreichten 1977 ihren Höhepunkt. Im Februar und März wurden fast alle Unis Italiens besetzt. Im Frühjahr gehen die Besetzungen weiter, oft von Massendemonstrationen 10.000er begleitet, bei denen es immer zu Zusammenstößen mit der Polizei kommt.
Teilweise werden die Konflikte besonders in KP-dominierten Städten wie Bologna angeheizt, wo es auch zu Kämpfen mit KP-Ordnern kommt. Am 17. März lässt dort die KP zusammen mit den bürgerlichen Parteien auch die „schweigende Mehrheit“ mit 200.000 TeilnehmerInnen aufmarschieren.
„Am 12. März kam es in Rom zu einer Demonstration von über 50.000 Menschen gegen die Verurteilung eines Anarchisten. Diese Demonstration eskalierte in eine der größten Straßenschlachten, die die italienische Hauptstadt jemals erlebt hatte. Dabei praktizierten Gruppen aus dem Strang der »Autonomia operaia organizzata« das von ihnen zuvor propagierte »neue Niveau der Auseinandersetzung«, die bewaffnete Aktion. Während der Demonstration wurden zwei Waffengeschäfte geplündert, unzählige Geschäfte, Cafés und Hotels verwüstet, hunderte von Autos und viele Busse umgestürzt und verbrannt. Büros und Zeitungen der regierenden Christdemokratischen Partei (DC) wurden mit Benzinbomben angegriffen. Der Ablauf dieser Demonstration markierte jedoch einen Wendepunkt in der weiteren Entwicklung der italienischen Autonomia. Viele DemonstrationsteilnehmerInnen fühlten sich durch die Dimension der Militanz überrumpelt und funktionalisiert, dies umso mehr, als der Großteil von ihnen dem militärischen Auftreten der Polizei und deren Racheaktionen nach Ende der Demonstration relativ unvorbereitet und hilflos gegenüberstand.
Die Entwicklung spitzte sich schließlich am 14. Mai bei einer Demonstration in Mailand zu. Gruppen von mit Knarren bewaffneten Jugendlichen griffen die Bullen an und töteten einen. Die Ereignisse führen zu einer verschärften Isolation der organisierten »Autonomia operaia« innerhalb der italienischen Linken. Mit einer zunehmenden Entsolidarisierung und einer massiven staatlichen Repression ging zugleich ein Zerfall des kreativen Strangs der Autonomia einher, der sich, durch staatliche Zugeständnisse begünstigt, in die Drogensubkultur der Großstädte, auf das Land oder in die Radikale Partei (in etwa vergleichbar mit den Grünen) zurückzog. Unter maßgeblicher Mithilfe der PCI, die in ihren Zeitungen die Namen von »Rädelsführern« der Autonomia abdruckte, wurden bis zum Sommer 1977 über 300 Autonome vom italienischen Staat in den Knast gesteckt, »Radio Alice« in Bologna wurde verboten und dessen Sendeeinrichtungen beschlagnahmt. Die staatliche Repression richtete sich gezielt gegen die Strukturen der Bewegung, wie z.B. Buchläden, Verlage, Zeitungsredaktionen usw. Vorwand aller Maßnahmen war die Konstruktion einer »subversiven Vereinigung«, die ein Komplott gegen den italienischen Staat vorbereitet haben sollte.
Weite Teile der Aktivisten aus dem Umfeld der »Autonomia operaia« versuchten, den Zerfall der Bewegung durch eine Steigerung der klandestinen Massengewalt (»Guerilla diffusa«) aufzuhalten und sahen nur noch in der militärischen Konfrontation mit dem Staatsapparat die Möglichkeit zur Entfaltung eines revolutionären Prozesses. »Ganze Vollversammlungen gehen in den Untergrund.« Diese Linie konnte jedoch die schwindende soziale Verankerung der politischen Bewegungen nicht mehr ersetzen. Am 7. April 1979 kam es schließlich zu hunderten von Verhaftungen (darunter auch Negri) gegen die »Autonomia operaia«. Von den 4.000 politischen Gefangenen des Jahres 1981 in Italien gehörten weit über 1.000 dieser Gruppierung an. Die Ereignisse vom 7. April 1979 wurden so zu einer strategischen Niederlage der italienischen »Autonomia operaia«, von der sie sich in den 80er Jahren nicht wieder erholt hat.“ (18)
Zusammenfassung: Was ist Autonomie?
Bevor wir zu den bundesdeutschen und heutigen Autonomen übergehen, wollen wir noch einmal unseren langen Abschnitt zum Operaismus und Autonomismus der 60er und 70er Jahre zusammenfassen und die entscheidenden Merkmale der „Autonomie“ kurz rekapitulieren.
„Die von mir gemeinte Autonomie ist die Klassenautonomie. (…) Autonomie in der doppelten Form: als Klassenbewegung, die Bewegung der Arbeitskraft gegen das Kapital, die Bewegung des Arbeiters als Subjekt der Produktion gegen seine gleichzeitige (Rolle) als Objekt der Verwertung. Aber auch und zugleich über den Fabrikbereich hinausgehend: als Tendenz oder Bewegung der abhängigen Massen gegen den Versuch des Kapitals, diese abhängigen Massen als Objekt der Umsetzung des Mehrwerts in Profit, als Konsumobjekte zu betrachten. In beiden Fällen bedeutet Autonomie den Versuch (…) der Klasse in ihrem Kampf um die Befreiung sich selbständig von der Kapitalbewegung zu machen (…) Klassenautonomie bedeutet, (…) dass die Klassenbewegung als Emanzipationsbewegung, als Bewusstwerdungsprozess völlig unabhängig vom ökonomischen Zyklus verläuft. (…) Autonomie bedeutet nicht eine Absage an das Organisationsprinzip, wohl aber eine Absage an irgendeine Organisation, die eine eigenes Organisationsinteresse entwickelt, das nicht mehr das Klasseninteresse ist.“ (19
Aus dem Zitat wie auch den bisherigen Betrachtungen ergeben sich folgende Punkte, welche „die Autonomie“, die autonome Bewegung prägen:
1. Ablehnung der Vorstellung, dass der Klassenkampf, der Befreiungskampf des Proletariats an bestimmte objektive Bedingungen gebunden ist, die nicht willkürlich durchbrochen werden können. Wir haben diesen Fehler schon oben, z.B. bei Tronti und seiner These nachgewiesen, dass die Lohnbewegung die Akkumulationsbewegung bestimme. Agnoli gibt dem eine andere „Beimengung“, wenn er z.B. sagt, „dass die Klassenbewegung als Emanzipationsbewegung, als Bewusstwerdungsprozess völlig unabhängig vom ökonomischen Zyklus verläuft“.
2. Die Autonomisten/Autonomie gehen davon aus, dass es für die Arbeiterklasse möglich sei, sich im Rahmen der bürgerlichen Gesellschaft „selbstständig von der Kapitalbewegung“ zu machen. Das ist eine idealistische Flause, die letztlich den Klassencharakter der bürgerlichen Gesellschaft, die Tatsache, dass in dieser das Kapital über die Arbeit herrscht, ad absurdum führt, indem unterstellt wird, dass die Klasse von ihrer Stellung als ausgebeutete schon vor der sozialistischen Revolution (im Grunde sogar vor der Entwicklung einer revolutionären Krise oder Doppelmacht) sich „unabhängig“ von der Dominanz durch die herrschende Klasse machen könne!
3. Das ist jedoch keine „zufällige“ Abweichung oder Nebensache, sondern die Grundlage dafür, dass der Autonomismus die „stetige“ Ausweitung von „Freiräumen“, von „angeeigneten“ Zonen/Zentren, das zunehmend „militantere“ Tun, letztlich die Herbeiführung der Krise oder gar der Revolution als rein subjektiven Akt, als reine Folge von Einsicht und „konsequentem“ Handeln versteht.
4. Damit einher geht auch ein anderer Klassenbegriff als jener des Marxismus, wie wir schon beim „Massenarbeiter“ gesehen haben. Noch mehr trifft das auf den „gesellschaftlichen Arbeiter“ zu, der sich aus einem Sammelsurium von Schichten und Klassen zusammensetzt. Die revolutionäre Klasse ist dann auch nicht mehr durch ihr Verhältnis zu den Produktionsmitteln, sondern zum Staat und durch ein Attribut seines Tuns geprägt. Wer gegen ihn kämpft, ist revolutionär. Wer nicht, nicht-revolutionär. Die subjektivistische Sicht der „Autonomie“, der Krise, der Revolution führt also auch zu einer rein subjektivistischen Sicht des „revolutionären Subjekts“.
5. Aus diesem Subjektivismus ergeben sich u.a. folgende wesentliche politische Konsequenzen hinsichtlich der Kampfformen, der Taktik usw., die ebenfalls subjektivistisch und moralistisch und nicht politisch-taktisch bestimmt sind:
a. Fetischisierung bestimmter Kampfziele und -formen bei gleichzeitiger Ignoranz gegenüber anderen;
b. Ablehnung revolutionärer Taktiken gegen Reformismus und Gewerkschaftsführungen;
c. Vernachlässigung bis Ablehnung des politischen Kampfes;
d. Bruch mit dem Leninismus und dem Konzept der leninistischen Partei.
Autonome in Deutschland
Wie wir oben gesehen haben, hat sich die italienische Bewegung hinsichtlich ihrer Klassenbasis von den 60er Jahren bis Ende der 70er/Anfang der 80er Jahre grundlegend verschoben. Von einer Bewegung mit proletarischer Basis in der Industriearbeiterschaft wurde sie zu einer kleinbürgerlichen Erscheinung mit einer längerfristigen sozialen Stütze unter den Studierenden (z.T. SchülerInnen) und in der Intelligenz.
Um nicht missverstanden zu werden, wollen wir hier kurz vorausschicken, dass wir keineswegs alle StudentInnen, SchülerInnen oder Intellektuellen für „kleinbürgerlich“ halten. Vielmehr setzen sie sich aus Kindern und Jugendlichen aller Klassen zusammen.
Unter den Studierenden ist naturgemäß der Anteil des Bürgertums und des gehobenen Kleinbürgertums deutlich größer als an den Schulen, während umgekehrt die Arbeiterklasse (v.a. deren untere Schichten) sowie die Bauernschaft weit geringer vertreten sind.
V.a. die Klassenlage der Studierenden hat auch insofern einen Übergangscharakter, als die Klassenherkunft keineswegs mit der Klassenzukunft der Studierenden identisch sein muss, also sowohl ein sozialer Aufstieg möglich ist, aber auch (v.a. in den letzten Jahren) eine Tendenz zur Proletarisierung der Tätigkeit zukünftiger AbsolventInnen.
Hinzu kommt, dass unter „den Studierenden“ trotz ihrer Heterogenität ein mehr oder weniger ausgeprägtes Bewusstsein als besondere Schicht existiert, was in gewisser Weise auch auf die Intelligenz selbst zutrifft.
Schließlich impliziert der Übergangscharakter und die relativ lange (verglichen mit der Schule oder Berufsschule) relativ selbstständige Tätigkeit auch, dass Studierende oft sehr sensibel auf gesellschaftliche Veränderungen reagieren, in gewisser Weise ein „Seismograph“ für gesellschaftliche Probleme und kommende Umbrüche sind, aber von der Gesellschaft insgesamt noch ignoriert werden.
Wichtig ist für unseren Zusammenhang, dass die soziale Stellung dieser Schicht wichtige Ähnlichkeiten mit jener des Kleinbürgertums (oder der lohnabhängigen Mittelschichten) aufweist. Sie stehen zwischen den beiden Hauptklassen der Gesellschaft – Bourgeoisie und Proletariat – und oszillieren auch ideologisch um sie.
Hinzu kommt, dass diese Schicht – wie das Kleinbürgertum oder lohnabhängige Mittelschichten – insgesamt sehr unterschiedliche politische Formen annehmen kann. Die Grünen z.B. sind eine Partei des gesellschaftlichen Konservatismus gewordenen, gehobene MittelschichtlerInnen, die am liebsten eine Gesellschaft des „sozialen Ausgleiches“ beibehalten möchte, die den Armen ausreichend „Führsorge“ und „Unterstützung“ angedeihen lässt, von den Reichen und Superreichen „Solidarität“, also Mäßigung ihres Gewinnstrebens fordert und selbst ihre Position in der scheinbar aufgeklärten Mitte verewigen will.
Auch die Autonomen waren und sind eine kleinbürgerliche Kraft – aber eine des „rebellierenden“ Kleinbürgers.
Als sie sich in Deutschland in den 80er Jahren zur stärksten Kraft der „radikalen Linken“ entwickelten, zogen sie v.a. ein jugendliches und studentisches Milieu an. Sie waren oft Kinder aus Schichten des städtischen Kleinbürgertums, der lohnabhängigen Mittelschichten, aber auch von FacharbeiterInnen, die studieren konnten.
Ihr radikaler politischer Impetus speiste sich aus ähnlichen Quellen wie jener der StudentInnen der 60er Jahre – der tiefen Ungerechtigkeit des Systems, der Ignoranz gegenüber „neuen“ gesellschaftlichen Problemen, der Überausbeutung der „Dritten Welt“, aus Rassismus und Militarismus des Staates.
Ihre Attraktivität speiste sich aus der autoritären, repressiven Politik der imperialistischen Staaten und der engen Verschmelzung von Monopol und bürgerlicher Politik inklusive der reformistischen Parteien und Gewerkschaften.
Die Autonomen stellten eine führende Kraft dar in der Bewegung gegen den Ausbau der AKWs und der Wiederaufbreitungsanlagen, in der Ökologiebewegung der 80er Jahre ebenso wie in der Hausbesetzerbewegung, im Kampf gegen den schonungslosen Ausbau von Großprojekten (Flughafen Frankfurt), die ohne jede Rücksicht auf die AnwohnerInnen durchgezogen werden sollten.
Sie stellen auch einen aktiven, radikalen Teil in der Bewegung gegen die NATO-Nachrüstung und waren in der Lage, Massendemonstrationen mit bis zu 100.000 Teilnehmern und militante Massenaktionen z.B. in der Anti-IWF-Kampagne Ende der 80er Jahre zu organisieren.
In den 90er Jahren wurden sie zu einer zentralen Kraft im Kampf gegen den Faschismus. Andere leisteten über Jahre kontinuierliche Arbeit gegen Rassismus, insbesondere gegen die Abschiebung von Flüchtlingen. In den letzten Jahrzehnten spielten sie eine Schlüsselrolle in der internationalen Mobilisierung und bei Aktionen gegen „Gipfeltreffen“ imperialistischer und kapitalistische Größen aus Politik und Wirtschaft – bei Anti-IWF oder Anti-G8-Kampagnen bis zur Mobilisierung in Heiligendamm.
Die Attraktivität der Autonomen kommt dabei ohne Zweifel von ihrem Ruf, „radikal“ zu sein. Einerseits radikal in der Ablehnung „traditioneller“ Formen, in der radikalen „Proklamation“, v.a. aber in der Aktion.
Die Autonomen reden nicht nur wie die Reformisten oder viele „radikale“ Linke – sie tun, was sie sagen. Sie sind militant, sie greifen an. Sie kritisieren den Kapitalismus nicht nur, sie greifen ihn an – indem sie seine Symbole abfackeln oder Banken „angreifen“ und entglasen. Diese Attraktivität wird ständig genährt, weil sie geradezu spiegelbildlich ist zur beamtenmäßigen Routine der „Aktionen“ deutscher Gewerkschaften und deren politischer Anpassung an das Kapital.
In dieser Hinsicht hat der Autonomismus eine ähnliche Rolle, wie die Anarchisten gegenüber Reformismus und Revisionismus am Beginn des 20. Jahrhunderts. Sie sind gewissermaßen eine Strafe für den Opportunismus der offiziellen Arbeiterbewegung.
Allerdings lässt sich ein grundlegender Wandel der Autonomen von den 80er Jahren bis heute feststellen.
a) In den 80er Jahren waren die Autonomen als Kraft mehr oder weniger gebündelt in bundesweiten, tw. internationalen Kampagnen oder Bewegungen, die im Zentrum gesellschaftlicher Konflikte standen. Die letzte Kampagne – einschließlich entsprechender Organisierungsprojekte – war wohl die Antifa der 90er Jahre. Der dahinter stehende Organisierungsversuch scheiterte mit der Auflösung der AAO-BO.
b) Doch trotz des oft großen Einflusses in Massenbewegungen als deren „militanter“, radikaler Flügel praktizieren die Autonomen in den 80er Jahren immer wieder dasselbe politische Muster. Sie stellen viele der entschlossensten AktivistInnen, aber ihr politischer Einfluss auf die Führung der Gesamtbewegung blieb gering.
Wo sie begannen, taktisch zu agieren (und das war in diesen Massenbewegungen unvermeidlich), führte das nicht zu einer Schwächung von Reformisten oder kleinbürgerlichen Kräften wie den entstehenden Grünen, sondern zu einer inneren Differenzierung bei den Autonomen, die selbst kein gemeinsames Maß für die Bestimmung einer „richtigen“ Bündnisarbeit hatten und qua Selbstverständnis auch nicht erarbeiten konnten.
So leisteten die Autonomen trotz ihres Radikalismus Mobilisierungshilfe für andere oder Vorfeldpolitisierung z.B. für die entstehende Grüne Partei, statt umgekehrt über die jeweilige Kampagne hinaus als handlungsfähige politische Kraft auf den Plan zu treten.
Dieses Muster wiederholt sich bis heute, wenn auch auf geringerem Niveau (z.B. in der Nutzung der Antifa als Vorfeldstruktur für die Grünen, später für die PDS/LINKE).
c) Die autonome Szene zersplitterte seit Beginn der 90er Jahre, also nach der kapitalistischen Wiedervereinigung – als Folge ihrer bis heute bestehenden Unfähigkeit, deren Ursachen, Charakter und Konsequenzen zu begreifen.
d) Die neoliberalen Reformen haben auch eine Rückwirkung auf das autonome Milieu gehabt. In den 80er Jahren konnte sich dieses nicht zuletzt aufgrund vergleichsweise großer „Freiräume“ an den Unis, Geld über Asten etc. zu besorgen, aber auch durch die noch relativ gesicherte soziale Lage von Studierenden und des geringeren Druckes im Ausbildungssystem sozial vergleichsweise leicht reproduzieren.
Doch mit den Angriffen auf soziale Sicherungssysteme und der kapitalistischen Bildungsreform sind auch die Einkommen der Autonomen prekärer und die zeitlichen Ressourcen neben dem Studium geringer geworden.
e) All das hat zu einer größeren Zersplitterung der autonomen Szene geführt, die als Milieu sich befehdender Szenen erscheint, die nur an bestimmten Knotenpunkten der Mobilisierung gemeinsam handeln (z.B. Anti-G8-Mobilisierung).
f) Ein zusätzlicher, gern übersehener Grund für die Krise der Autonomen ist, dass ihnen das gemeinsame Ziel abhanden gekommen ist. Die Autonomen der 70er Jahre oder auch jene der 80er sahen die Revolution als reales, erkämpfbares Ziel. Ihr, wenn auch oft opportunistischer Bezug auf kleinbürgerliche Befreiungsbewegungen war von revolutionärem Optimismus getragen und dem Bewusstsein, mit ihnen in einer Front gegen den Imperialismus zu stehen. Daraus folgte ja auch die politische Sympathie für den bewaffneten Kampf; daraus folge auch ein, verglichen mit heute, politischerer Charakter der Solidaritätsarbeit. Heute glaubt kaum noch ein Autonomer an die „soziale Revolution“ oder die Erreichbarkeit „des Kommunismus“. Sie sind, wenn nicht überhaupt verteufelt, zu „Phrasen“, zu moralischen Größen geworden.
g) Dies alles führt dazu, dass sich die Autonomen weiter zersplittern, weiter in ihrer Heterogenität bleiben werden. Das drückt sich auch darin aus, dass es überhaupt nicht „die Antwort“ der Autonomen auf die Krise gibt. Von Agnolis emphatischem „autonomen Klassensubjekt“, das sich selbstständig von der Kapitalbewegung macht, dessen „Klassenbewegung als Emanzipationsbewegung, als Bewusstwerdungsprozess völlig abhängig vom ökonomischen Zyklus“ daherkommt, ist bei den realen Autonomen nichts zu beobachten. Im Gegenteil, die „Szene“ blickt auf die Krise wie auf ein Naturereignis.
III. Autonomismus und Krise
Ihre Theoretiker, Ideologen oder Strömungen produzieren allerdings „Antworten“, die tw. so weit voneinander entfernt sind, dass sie überhaupt keine Gemeinsamkeit zu haben scheinen.
Wohl aber lassen sich bestimmte inhaltlich-theoretische Stränge herausarbeiten, die von den „Zusammenhängen“ des autonomen Milieus oder ihm nahe stehenden Netzwerken und Gruppierungen mehr oder weniger beliebig mit anderen Ansätzen (Neo-Gramscianismus, marxistische oder keynesianische Versatzstücke usw.) kombiniert werden.
So haben sich in den letzten Jahren eine Reihe Strömungen (in Deutschland vor allem die „Interventionistische Linke“) gebildet, die autonome Elemente mit reformistischen und rechts-zentristischen Theoremen eklektisch verbinden.
Wir lassen hier alle „anti-deutschen“ oder „anti-nationalen“ Analysen außen vor, weil ihnen jeder emanzipatorische Anspruch abhanden gekommen ist, weil sie – selbst dort, wo sie im Gewand einer „kritischen“ Theorie von Kapital, Staat und Gesellschaft daherkommen – jeden Anspruch auf eine grundlegende Veränderung der Gesellschaft aufgegeben haben. Bei aller Differenz des Marxismus zum Autonomismus ist nämlich dem Kommunismus mit so unterschiedlichen autonomen und post- bzw. neo-operaistischen Theoretikern wie Negri oder Halloway bzw. K.H. Roth gemeinsam, dass in der Krise auch ein revolutionäres Potential zur Überwindung des Kapitalismus gesehen wird.
Wir beschäftigen uns daher mit größeren theoretischen Strängen der autonomen Bewegung, die die gegenwärtige Krise des Kapitalismus auch mit dem Anspruch analysieren, die politische Perspektive eines sich formierenden revolutionären Subjekts (wie unterschiedlich dies auch sein mag) zu formulieren, das eine Massenkraft ist. Es ist dies einerseits die Schule von Negri/Hardt, andererseits die des Neo-Operaismus, für den stellvertretend wir uns mit K.H. Roth beschäftigten werden, wobei Holloway hier eine gewisse Zwischenstellung einnimmt, die ihn scheinbar radikaler und „anschlussfähiger“ für Teile des militanten Autonomenflügels macht.
Negri, das „Empire“ und die „globalen Rechte“
Mitten in die Krisen- und Zerfallsphase der Autonomen in den 1990er Jahren trat eine neue politische Bewegung auf den Plan: Die Zapatisten. Diese Guerillabewegung, die sich auf die indigene Bauernschaft im mexikanischen Bundesstaat Chiapas, einem der ärmsten und entrechtetsten des Landes, stützt und in dieser bis heute sozial verankert ist, unterschied sich in einem zentralen Punkt von allen bisherigen Guerillabewegungen. Auch wenn sie im Grunde eine bewaffnete Bauernmiliz darstellt, proklamiert sie, dass es nicht ihr Ziel sei, die politische Macht zu erobern.
Die Zapatisten spielten eine Schlüsselrolle bei der Formierung der anti-kapitalistischen Bewegung um die Jahrhundertwende; sie waren ein zentraler Bestandteil von „Peoples Global Action“ (20), dem libertär-anarchistisch-autonomen Flügel dieser Bewegung.
Auf sie gehen Losungen zurück, die den Geist dieser Bewegung auf den Punkt bringen: „Eine andere Welt ist möglich“ oder „Fragend suchen wir den Weg“.
Am prägnantesten drückt diese Doktrin vielleicht ihre mediale Gallionsfigur, Subcommandente Marcos, aus: „Wir müssen die Welt nicht erobern. Es reicht, sie neu zu schaffen. Heute. Durch uns!“.
Peoples Global Action (PGA) und die Zapatisten erschienen damals als Speerspitze eines neu entstehenden Widerstandes gegen die kapitalistische Globalisierung und den Neoliberalismus. Sie gehörten zu den ersten, die internationale Vernetzungen aufbauten und so zur Formierung von Widerstand beitrugen.
Sie kooperierten außerdem mit anderen Widerstandsbewegungen, die nach den Niederlagen der frühen 90er Jahre wieder offensiv wurden und in den Augen von PGA und den Zapatisten – wenn auch nicht unbedingt in denen deutscher Autonomer – Teil einer globalen Bewegung gegen einen gemeinsamen Gegner waren. In dieser Periode beginnt auch die 2. Intifada. Es formierte sich die bolivarische Bewegung Boliviens mit einer erfolgreichen Kampagne gegen die Wasserprivatisierung; zugleich wuchs auch die MAS. Massengewerkschaften der indischen Bauern oder die indonesische Gewerkschaftsbewegung waren von Beginn an integrale Bestandteile von PGA.
Auffällig an PGA war jedoch – neben der libertären Doktrin und ihrer Verbindung zur autonom-anarchistisch-antikapitalistischen Bewegung in den Metropolen (inkl. der Mobilisierungen gegen die imperialen Gipfel), dass sie eine kleinbürgerliche Massenbasis, v.a. in der Bauernschaft, hat. Politisch-programmatisch gipfelte das neben einer nebulösen Phrasenhaftigkeit vor allem darin, die Schaffung von genossenschaftlicher oder kleiner Warenproduktion als Alternative zum Kapitalismus in seinem imperialistischen Stadium anzupreisen.
Kurz, trotz aller „antikapitalistischen“ Radikalität war die gesellschaftliche Perspektive von PGA und den Zapatisten utopisch und reaktionär.
Für unsere weitere Betrachtungen von größerer Bedeutung ist jedoch eine Frage, die sich die autonome Bewegung oder deren Theoretiker in den 90er Jahren stellten: Wie kann die „neue Entwicklung“, die Entstehung dieser Bewegungen verstanden werden?
Empire
Pünktlich zur Jahrhundertwende versuchten die Autoren Hardt und Negri mit dem Buch „Empire“ eine Erklärung abzugeben. Danach hätte die Gesellschaft in der Globalisierung einen grundlegenden, fundmentalen Wandel durchgemacht. An die Stelle des bisherigen imperialistischen Weltsystems sei das „Empire“ getreten (21). Es geht uns vielmehr darum, den Begriff und die politischen „Lösungen“ Negris und Hardts kurz nachzuzeichnen, weil ihre Schlüsselforderungen auch zu Gemeinplätzen großer Teile der autonomen Bewegung der letzten 10 Jahre geworden sind.
„Den Begriff des Empire charakterisiert maßgeblich das Fehlen von Grenzziehungen: Die Herrschaft des Empire kennt keine Schranken. Zuallererst setzt der Begriff des Empire ein Regime voraus, das den Raum in seiner Totalität vollständig umfasst, oder anders, das wirklich über die gesamte ‚zivilisierte‘ Welt herrscht. Keine territorialen Grenzziehungen beschränken seine Herrschaft. Zum zweiten stellt sich im Empire kein historisches Regime dar, das aus Eroberungen hervorgegangen ist, sondern vielmehr eine Ordnung, die Geschichte vollständig suspendiert und dadurch die bestehende Lage der Dinge für die Ewigkeit fortschreibt. Aus der Perspektive des Empire ist alles so, wie es immer sein wird und wie es immer schon sein sollte. Das Empire stellt, mit anderen Worten, seine Herrschaft nicht als vergängliches Moment im Verlauf der Geschichte dar, sondern als Regime ohne zeitliche Begrenzung und in diesem Sinn außerhalb und am Ende der Geschichte. Zum dritten bearbeitet die Herrschaft des Empire alle Register der sozialen Ordnung, es dringt ein in die Tiefen der gesellschaftlichen Welt. Das Empire organisiert nicht nur Territorium und Bevölkerung, sondern schafft genau die Welt, in der es lebt. Es lenkt nicht nur die menschliche Interaktion, sondern versucht außerdem indirekt über die menschliche Natur zu herrschen. Das gesellschaftliche Leben in seiner Gesamtheit wird zum Gegenstand der Herrschaft. Das Empire stellt so die paradigmatische Form von Biomacht dar. Und schließlich bleibt das Empire immer mit Frieden verknüpft – einen ewigen und allumfassenden Frieden außerhalb der Geschichte.“ (22)
Wir wollen uns eine lange Polemik zu offenkundig komisch wirkenden Formulierungen wie z.B., dass „das Empire“ auch nach fast einem Jahrzehnt des „Krieges gegen den Terror“ „immer mit Frieden verknüpft“ sei, sparen. Auch die unterstellten „Besonderheiten“ des „Empire“ gegenüber früheren globalen Regimen – z.B., dass es sich „verewigen“ und „außerhalb der Geschichte“ stellen möchte – ist keine solche „Besonderheit“, wie Hardt und Negri behaupten. Vom Standpunkt einer herrschenden Klasse erscheint oft eine Gesellschaftsformation als „die letzte“ oder als „Ende der Geschichte“. In bestimmten Phasen der gesellschaftlichen Entwicklung, v.a. solange eine Gesellschaftsformation einen historisch progressiven Charakter hat, kennzeichnet diese Vorstellung in der Regel auch das Bewusstsein aller Klassen.
Wichtiger ist vielmehr, dass Hardt/Negri davon ausgehen, dass das Empire nicht nur ein neues, post-imperialistisches Stadium des Kapitalismus darstelle, sondern gar eine neue Produktionsweise. Diese fuße auf einer grundlegenden Veränderung von Produktion und Distribution im globalen Maßstab einer „bio-politischen“ Produktion. Diesen, von Foucault entlehnten, Begriff weiten Hardt/Negri aus, indem sie sich auf „die positiven Dimensionen von Biomacht konzentrieren“ (23) wollen.
Für Hardt/Negri wird die „Produktion des Lebens“ selbst zur ersten Produktivkraft. Die Trennung von produktiver und unproduktiver Arbeit wäre, wie Negri schon in der Analyse des „gesellschaftlichen Arbeiters“ behauptet, obsolet. Auch der Begriff des Mehrwerts, wie überhaupt die „traditionelle“ Kritik der politischen Ökonomie wäre von der realen Entwicklung überholt.
„Das Verhältnis zwischen Produktion und Leben hat sich somit dahingehend verändert, dass es sich im Verständnis der politischen Ökonomie vollständig umgekehrt hat. Leben wird nicht mehr in Reproduktionszyklen produziert, die dem Arbeitstag untergeordnet sind; nun wird es im Gegenteil das Leben, das jegliche Produktion bestimmt. In der Tat liegt die Bestimmung des Werts von Arbeit und Produktion tief im Inneren des Lebens. Die Industrie produziert nur das an Mehrwert, was durch gesellschaftliche Tätigkeit erzeugt wird – und genau aus diesem Grund liegt der Wert, begraben unter einer Unmenge von Leben, jenseits allen Maßes.“ (24)
Und weiter:
„Wenn menschliche Macht unmittelbar als eine autonome, kooperative kollektive Kraft auftritt, ist die kapitalistische Vorgeschichte zu Ende. Anders ausgedrückt: Die kapitalistische Vorgeschichte ist dann zu Ende, wenn soziale und subjektive Kooperation nicht mehr Produkt, sondern Voraussetzung ist, wenn das nackte Leben in den Rang einer Produktivkraft erhoben oder genauer: wenn es als Reichtum der Virtualität erscheint.“ (25)
Wir sind also lt. Hardt/Negri bereits in eine neue Gesellschaftsformation eingetreten, die sich dadurch auszeichnet, dass sich das Empire parasitär die in der Menge (Multitude) konzentrierte Produktivkraft der Gesellschaft aneignet.
Hardt/Negri können zu dieser Schlussfolgerung freilich nur kommen, weil sie von verschiedenen Momenten des kapitalistischen Produktionsprozesses ebenso abstrahieren wie von dessen Unterscheidung gegenüber allen, dem Kapitalverhältnis letztlich untergeordneten, Produktionsweisen (z.B. Formen der kleinen Warenproduktion oder der Subsistenzproduktion). Alles verkommt unterschiedslos im Einheitsbrei einer „Produktion des Lebens“, die – anders als von Hardt/Negri unterstellt – überhaupt nicht spezifisch für eine bestimmte Gesellschaftsformation ist, sondern ganz allgemein in jeder Gesellschaft vorkommt. Sie ist aber für Hardt/Negri deshalb überaus nützlich, weil sie so von verschiedenen Formen von Arbeit/Tätigkeit, von Klassenverhältnissen usw. bequem absehen können, weil alles – einschließlich aller Unterschiede unter den unterdrückten Klassen – in der „Menge“ aufgeht.
Es ist überhaupt nur die „Menge“, welche Dynamik in diese gesellschaftliche Beziehung bringt (analog zur operaistischen Sicht von Kapitalbewegung und ökonomischem Kampf der Arbeiterklasse):
„Wenn das Handeln des Empire dennoch Wirkung zeigt, so hat es diese nicht seiner eigenen Stärke zu verdanken, sondern der Tatsache, dass es auf den Widerstand der Menge gegen die imperiale Macht stößt und vom Rückprall dieses Zusammenstoßes vorangetrieben wird. (…)Mit anderen Worten: Die Wirksamkeit der regulierenden und repressiven Vorgehensweise des Empire hängt letztlich vom virtuellen, konstitutiven Handeln der Menge ab. (…)
Imperiale Macht ist das negative Residuum, das Zurückweichen vor dem Handeln der Menge; sie ist ein Parasit, der von der Fähigkeit der Menge lebt, immer wieder neue Energie- und Wertquellen zu schaffen.“ (26)
Das begriffliche Wirrwarr führt zu einer überraschenden politischen Wendung des gealterten „Revolutionärs“ Negri: Die Menge konstituiere nämlich nicht nur alle Produktivkräfte in ihren Händen. Der Kapitalismus ist auch schon deshalb vorbei, weil die Menge auch gleich eine neue Produktionswiese vorstellt:
„Wie bei allen Erneuerungsprozessen wird auch hier die neu entstehende Produktionsweise den Umständen, von denen es sie zu befreien gilt, entgegengesetzt. Die Produktionsweise der Menge wird der Ausbeutung die Arbeit entgegenstellen, dem Eigentum die Kooperation und Korruption die Freiheit. Sie sorgt dafür, dass sich Körper und Arbeit selbst verwerten, sie eignet sich die produktive Intelligenz mittels Kooperation wieder an und verwandelt Dasein in Freiheit.“ (27)
Hier wird ein grundsätzlicher Bruch mit dem revolutionären Marxismus deutlich. Für diesen besteht gerade eine Spezifik der proletarischen im Gegensatz zur bürgerlichen Revolution darin, dass die Arbeiterklasse keine ihre gemäße Produktionsweise im Kapitalismus schaffen kann, sondern dass sie zur Schaffung einer sozialistischen Produktionsweise zuerst die Staatsmacht erobern, die Eigentümer der Produktionsmittel enteignen und die Produktion unter seiner Klassenherrschaft reorganisieren muss. Erst nach eine Periode des Übergangs – von Marx „Diktatur des Proletariats“ genannt – ist der Sieg einer neuen, sozialistischen und später kommunistischen Produktionsweise und darauf aufbauenden Gesellschaftsformation möglich.
Anders bei Hardt/Negri. Für sie entsteht die „neue Produktionsweise“ bereits, sie ist „in der Menge“ schon da. Sie muss nur noch die Hülle des „Empire“ abstreifen!
„Die Produktionsweise der Menge eignet sich den Reichtum des Kapitals wieder an und schafft darüber hinaus neuen Reichtum, der sich zusammen mit den Mächten der Wissenschaft und des sozialen Wissens zur Kooperation artikuliert. In der Moderne war Privateigentum oftmals durch Arbeit legitimiert, aber diese Gleichung wird, wenn sie denn überhaupt jemals stimmte, heute völlig annulliert. Privateigentum an Produktionsmitteln ist heute, im Zeitalter der Hegemonie kooperative und immaterieller Arbeit, nur eine längst verfaulte und tyrannische Sache von gestern. Die Produktionswerkzeuge werden in kollektiver Subjektivität sowie in der kollektiven Intelligenz und im kollektiven Affekt der Arbeiter neu zusammengesetzt; Unternehmertum organisiert sich über die Kooperation von Subjekten und über den ‚General Intellect‘. Damit tritt die Organisation der Menge als politisches Subjekt, als posse die Weltbühne. Die Menge, das ist die biopolitische Selbstorganisation.“ (28)
Damit ist der Weg vom „Linksradikalismus“ zum Neo-Reformismus oder Populismus geebnet. Um der Menge ihren Weg zu weisen, haben die beiden dann auch „Schlüsselforderungen“, die in der autonomen Bewegung – ob nun in Kenntnis dieser theoretischen Rechtfertigung oder nicht – zu Allgemeinplätzen geworden sind.
Zum ersten geht es um die „Forderung nach Weltbürgerschaft“ (29). Dahinter steckt die demokratische und unterstützenswerte Forderung nach Bewegungsfreiheit, nach offenen Grenzen, der Abschaffung von Einreisekontrollen und Beschränkungen für MigrantInnen.
Diese Forderungen richten sich an die bestehenden bürgerlichen Staaten und müssen diesen, so weit möglich, abgerungen werden. Im Empire-Jargon kommt diese Forderung jedoch nicht zufällig als „Forderung nach Weltbürgerschaft“ daher, weil für Hardt/Negri den proletarischen, kleinbürgerlichen und anderen MigrantInnen ja keine imperialistischen Staaten, sondern ein „Empire“ gegenübersteht, im bestehenden System also so etwas wie „Weltbürgerschaft“ von der Menge etabliert werden könnte.
Im Gegensatz zu Hardt/Negri sind sich MarxistInnen nämlich der Grenzen der Forderung nach „offenen Grenzen“ oder „Abschaffung aller Einreisebeschränkungen“ bewusst. Sie dienen als Kampfmittel für demokratische Rechte und gegen imperialistische und bürgerliche Grenzregime.
Wir lehnen aber die utopische Vorstellung ab, dass im Rahmen einer imperialistischen Weltordnung ein staatliches System ohne repressive Grenzregimes verallgemeinert werden und auf Dauer bestehen könnte. Vielmehr müssen RevolutionärInnen den Kampf gegen alle Einreise- und Aufenthaltsbeschränkungen für MigrantInnen dazu nutzen, der Arbeiterklasse und ihren Verbündeten deutlich zu machen, dass diese rassistischen Kontrollen und Grenzregime letztlich nur beseitig werden können, wenn sie mit dem Kampf zum Sturz des Imperialismus verbunden werden. Ein Regime ohne Grenzen wird erst im Sozialismus möglich, also mit Beginn einer Epoche, wo die Staaten selbst verschwinden.
Während die demokratische Forderung nach Bewegungsfreiheit progressiven Charakter hat, so ist die zweite politische Hauptlosung von Hardt/Negri überhaupt nicht fortschrittlich! Es ist die nach einem „sozialen Lohn und nach einem garantierten Einkommen für alle!“.
Hardt/Negri garnieren die Argumentation, die auch zahlreiche Verfechter des „bedingungslosen Grundeinkommens“ auftischen, mit einer zusätzlichen Schrulle. Da die „Produktion“ jetzt die des „Lebens“ selbst wäre, würden Arbeit und Arbeitszeit auch jede „Fixiertheit“, jedes Maß, jede Messbarkeit verlieren.
„Die zunehmende Ununterscheidbarkeit von Produktion und Reproduktion im biopolitischen Kontext zeigt zudem noch einmal in aller Deutlichkeit die Unermesslichkeit von Zeit und Wert. Im Maße, in dem die Arbeit das Fabrikgebäude verlässt, wird es immer schwieriger, an der Fiktion irgendeines Maßes für den Arbeitstag fest zu halten und somit die Produktionszeit von der Reproduktionszeit bzw. die Arbeitszeit von der Freizeit zu trennen.“ (30)
Dumm nur, dass die Kapitalisten – bornierte, aber durchaus praktisch veranlagte Menschen – diese Passagen nicht kennen, so dass ihnen diese vermeintlichen Probleme der Arbeitszeitmessung unbekannt sind. Tja, wo das Kapital tausend Wege kennt, unbezahlte Arbeit gerade in den letzten Jahren massiv auszudehnen, da mag es der Arbeiterklasse zwar ein Rätsel sein, wo die Bezahlung geleisteter zusätzlicher Arbeitsstunden bleibt – von der Messbarkeit der Arbeitszeit, von der Scheidung von Arbeits- und Freizeit weiß sie nur zu gut, dass es sich dabei um keine Fiktion handelt!
Negri setzt seine Verwirrung fort:
„Die Forderung nach einem sozialen Lohn erweitert die Forderung, dass jede für die Kapitalproduktion nötige Tätigkeit durch gleich Kompensation nötige Tätigkeit durch die gleiche Kompensation Anerkennung findet, auf die gesamte Bevölkerung, so dass eine sozialer Lohn letztlich garantiertes Einkommen darstellt.“ (31)
Erstens ist es natürlich Unsinn, dass – wie hier unterstellt – jede Tätigkeit irgendeines Gesellschaftsmitglieds für die Kapitalproduktion gleich nötig wäre. Ansonsten käme man zur offenkundig absurden These, dass die Tätigkeit des beschäftigten Lohnarbeiters gleich viel zur Kapitalbildung beitragen würde wie jene des Arbeitslosen. Wäre dem so, wäre es völlig unbegreiflich, warum die Kapitalisten überhaupt Lohnarbeit beschäftigen und ihre Lohnkosten nicht gleich auf Null reduzieren?!
Zweitens ist These Hardt/Negris wie die aller Grundeinkommens-VerfechterInnen überhaupt nicht so „arbeitslosenfreundlich“, wie sie sich gern präsentiert. Denn: Wovon hängt denn die Nachfrage nach Arbeitskraft durch das gesellschaftliche Gesamtkapital ab? Vom Stand der Akkumulation, von den Verwertungsbedürfnissen des Kapitals. Dieses Kapital beschäftigt dann, sagen wir eine Million ArbeiterInnen bei einer Arbeitswoche von 35 Stunden, um in dieser – angeblich nicht mehr messbaren – Zeit Mehrwert für das Kapital zu schaffen, und zwar dort, wo der Kapitalist es vorschreibt: in der Fabrik und nicht irgendwo „im Leben“.
Sagen wir es gibt 200.000 weitere ArbeiterInnen, die bei bestehendem Geschäftsgang des Kapitals keine Anstellung finden, weil sie nicht gebraucht werden. Die produzieren in ihrer angeblich immer weniger unterscheidbaren „Nicht-Arbeitszeit“ natürlich nicht nur keinen Mehrwert, sie dienen auch als industrielle Reservearmee, indem sie auf die Löhne und Arbeitsbedingungen der Beschäftigten drücken. Zugleich empfinden sie ihre Arbeitslosigkeit als Form der „Nutzlosigkeit“, als „Ausgrenzung aus der Gesellschaft“. Sie sind sicher weit davon entfernt von der Flause, ihre „Lebenstätigkeit“ als gleiche Arbeit wie jene in der Fabrik zu empfinden.
Lt. Hardt/Negri wäre das im Grunde nur ein falsches Bewusstsein dieser Arbeitslosen. Ja, mehr noch, sollten die Kapitalisten von der Million Beschäftigter 200.000 wegen schlechten Geschäftsgangs entlassen und so die Arbeitslosenzahl auf 400.000 vermehren, so empfehlen sie nur: sozialer Lohn für alle!
Stillschweigend akzeptieren sie damit, dass das Kapital bestimmt, wie viele ArbeiterInnen in Lohn und Brot stehen. Dieser Umstand, hinter dem sich die Herrschaft des Kapitals über die Arbeit verbirgt, wird schöngeredet durch den Unfug, dass „jede Tätigkeit“ der Kapitalproduktion gleich sei! Massenarbeitslosigkeit, prekäre Arbeit, Unterbeschäftigung werden damit ebenso schöngeredet wie jeder Unterschied zwischen der Tätigkeit von LohnarbeiterInnen und kleinen Warenproduzenten, also auch ein Klassenunterschied, verwischt wird.
Schließlich kommt aber noch das vollständige Unverständnis darüber hinzu, was überhaupt Lohnarbeit ist, nämlich die Preisform des Werts der Ware Arbeitskraft. Dieses Unverständnis wird auch dadurch genährt, dass die Arbeitszeit für „unmessbar“ erklärt wird.
Dass die LohnarbeiterInnen überhaupt in der Lage sind, für ihre Ware Arbeitskraft einen Preis zu erzielen, der den Reproduktionskosten ebendieser Ware entspricht, hängt wesentlich von der Kampfkraft der Klasse, ihre Organisiertheit und Geschlossenheit ab. Hohe Arbeitslosigkeit, Aufsplitterung der Arbeitsverhältnisse usw. schwächen die Kampfkraft. Daher darf die Arbeiterklasse niemals eine gleichgültige Haltung zu diesen Fragen haben, sondern muss für Mindeststandards der Verkaufsbedingungen der Ware Arbeitskraft (z.B. Mindestlohn), für Beschäftigung der gesamten Klasse, für Aufteilung der Arbeit auf alle Arbeitsfähigen eintreten!
Bevor wir zum letzten „Heilmittel“ von Hardt/Negri übergehen, müssen wir noch darauf hinweisen, dass – anders als beide unterstellen – eben nicht jede Arbeit, die in der gegenwärtigen kapitalistischen Gesellschaft verrichtet wird, gleichermaßen gesellschaftliche Arbeit ist. Ein Beispiel dafür ist die Subsistenzproduktion, also Produktion nicht für den Bedarf anderer, sondern zur eigenen Reproduktion.
Ein anderes Beispiel ist die private, eben nicht vergesellschaftete Hausarbeit. Diese geht natürlich in die Reproduktionskosten der Ware Arbeitskraft mit ein. Unsere Losung ist aber keinesfalls die nach einem „Lohn für Hausarbeit“, „Bürgerinnengeld“ o.ä. Das würde vielmehr zu einer Verfestigung der privaten Hausarbeit führen, zu einer Verfestigung der geschlechtlichen Arbeitsteilung von Mann und Frau. Die fortschrittliche Parole der revolutionären Arbeiterbewegung ist vielmehr, den Kampf um gleiche Arbeitsbedingungen und Beschäftigung für proletarische Frauen mit dem Kampf um die Vergesellschaftung der Hausarbeit zu verbinden.
Kommen wir aber zum letzten Heilmittel von Hardt/Negri, zum „Recht auf Wiederaneignung“. Das erinnert auf den ersten Blick an die Losung der Enteignung, der Verstaatlichung, ja an die Machtergreifung. Doch Vorsicht! Was in den autonomen Pamphleten, Kampagnen usw. zu einer Mantra geworden ist, ist etwas anderes, viel Nebulöseres: „das Recht der Menge auf Selbstkontrolle und autonome Eigenproduktion.“ (32) Klar, wozu soll sie auch unbedingt etwas in Besitz nehmen, wenn ihr lt. Hardt/Negri ohnedies schon die Produktionsmittel gehören, nicht nur ihre Arbeitskraft, da „die Menge nicht nur Maschinen benutzt, sondern auch selbst zunehmend zu einer Art Maschine wird, da die Produktionsmittel immer stärker in die Köpfe und Körper der Menge integriert sind.“ (33)
Der Marxismus versteht unter Aneignung der Produktionsmittel, dass den Kapitalisten ihr Monopol an den gesellschaftlichen Produktionsmitteln entrissen wird. Die Forderung meint nichts anderes als die Enteignung der herrschenden Klasse durch das Proletariat.
Die Formulierung von Hardt/Negri bricht damit. „Aneignung“ kann zwar auch noch die Enteignung eines Kapitalisten bedeuten. Sie kann aber ebensogut die „Wiederaneingnung“ des Produktionsmittels „Körper“ oder der Wohnung (z.B. durch Hausbesetzung) bedeuten.
Diese Veränderung des Inhalts der „Aneignung“ hat im autonomen Milieu den Siegeszug dieser Losung nicht gebremst, sondern begünstig, weil es einem kleinbürgerlichen Milieu erlaubt, seinen eigenen Anstrengungen zur „Aneignung“ des eigenen Kopfes/Körpers die höheren Weihen des Kampfes um eine „Aneignung“ der gesellschaftlichen Produktionsmittel zu verleihen, den Unterschied zwischen dem proletarischen Klassenkampf und „Aneigungs“-Aktionen autonomer Kleinbürger verwischt.
Hardt/Negri und die Krise: Nichts Neues
Das oben Gesagte macht auch verständlich, warum Negri und Co. wenig Erhellendes zur aktuellen Weltwirtschaftskrise sagen oder sagen können. Für Hardt/Negri ergibt sich die Krise im Empire nämlich folgendermaßen:
„Ausbeutung heißt nun, dass die Kooperation enteignet wird und die Bedeutungen sprachlicher Produktion für ungültig erklärt werden. Als Konsequenz daraus kommt es innerhalb des Empire fortwährend zu Widerstand gegen die Ausbeutung, so dass es an allen Knotenpunkten zu Krisen kommt. Mit der postmodernen Totalität kapitalistischer Produktion weitet sich auch die Krise aus; sie sozusagen der Kontrolle inhärent.“ (34)
Die Krise ist nicht nur permanent, sie ist vor allem Resultat des Agierens der „Menge“. In dieser Hinsicht behält das „Empire“ das subjektivistische Krisenverständnis des Operaismus/Autonomismus der 60er Jahre bei.
Wenig originell erblickt Negri in der aktuellen Krise die Tatsache, dass der „Kapitalismus in seiner neo-liberalen Form an Ende sei.“ (35)
Darüber hinaus interpretiert er die Krise ganz aus der Sicht von „Empire“. Auf die Frage „Kann so die vom unproduktiven, spekulierenden Finanzkapital ausgelöste Krise überwunden werden?” antwortet er:
“Das Finanzkapital ist keineswegs unproduktiv, im Gegenteil, sehr produktiv. Das Problem ist, dass es unfähig ist, die gesellschaftliche Produktivität zu verstehen. Der industrielle Kapitalismus hat diese noch sehr gut verstanden. Er wusste, wie die Arbeitszeit einzuteilen, wie die Arbeiterkasse auszubeuten ist. Er hatte ein genaues Maß vom Anteil notwendiger Arbeit und Ausbeutung der Arbeit. Das Finanzkapital hat die Verbindung zum Ort der Arbeit verloren und damit das Maß von gesellschaftlicher Arbeit. Das hat den Finanzkapitalismus in Schwierigkeiten gebracht. Es müssen politische Formen der Vermittlung zwischen Finanzkapital sowie gesellschaftlicher Arbeit und gesellschaftlichem Reichtum gefunden werden.” (36)
Und weiter: „Wir sind mit einer zunehmenden immateriellen, kognitiven und kooperativen Arbeit konfrontiert, einer selbstständigen und selbstverwertenden. Anders als die klassische materielle Arbeit, die auf Arbeits- und Produktionsmittel angewiesen war, die das Kapital zur Verfügung stellte, ist die heutige immaterielle und kognitive Arbeit unmittelbar produktiv, befreit vom Unterordnungsverhältnis, das die materielle Arbeit kennzeichnete, damit zugleich aber auch von Sicherheiten, die noch der Fabrikarbeiter kannte. Eine breite Schicht ist heute gezwungen, in völlig anderen räumlichen und zeitlichen Kontexten unter enorm prekären Bedingungen zu arbeiten. Dieses produktive Subjekt eignet sich selbst die Arbeitsmittel an, ist variables und zugleich fixes Kapital. Über die Finanzialisierung wird versucht, diese fixen Kapitale zusammenzuhalten.
Das Maß des gesellschaftlichen Reichtums hängt heute nicht mehr vom klassischen Wertgesetz ab. Und über diese Tatsache sind die Kapitalisten ebenso erstaunt und irritiert wie die Linke.“ (37)
Er führt den oben dargelegten Gedanken aus, indem er einen grundlegenden Wandel der unterstellt, einen Wandel, der dazu führt, dass die Krise gar nichts mit Überakkumulation von Kapital, Profitratenentwicklung usw. zu tun hat. Statt dessen liege das Problem vielmehr darin, dass Kapitalisten und Linke die Überholtheit des „klassischen Wertgesetzes“ nicht erkannt hätten. Eine solche „Analyse“ trägt mehr zur Verdunkelung realer Zusammenhänge, denn zur ihrer Erhellung bei.
Doch was sagt uns Negri über den Widerstand und die politische Perspektive?
„Dazu gehört die Verweigerung der Arbeit oder Widerstand gegen die Arbeit, die in der kapitalistischen Organisation der Produktion stets Sklaverei ist. Der Kapitalismus ist verletzlicher geworden. Eine rebellierende Peripherie greift schon das Zentrum der Macht an. Und das Empire hat die Peripherien multipliziert, sie befinden sich nun auch in den Metropolen. Eine Rebellion wie in den Banlieues von Paris trifft ins Herz des Empire.“
„Und wie soll das der Multitude gelingen?“, fragt der Journalist vom Neuen Deutschland.
„Wo es Masse gibt, gibt es Energie. Schauen wir auf die globalisierungskritische Bewegung, die Sozialforen: Die hier engagierten jungen Leute sind nicht weniger revolutionär als die Bolschewiki. Sie reißen Mauern und Grenzen ein, die der Kapitalismus aufgerichtet hat. Das ist heute der Klassenkampf. Oder schauen wir nach Lateinamerika, wo sich soziale Bewegungen mit den Regierenden verbinden und neuartige Transformationen wagen. Man muss den Bruch organisieren, ähnlich wie einst die Sowjets, aber in einer andersartigen, pluraleren und differenzierteren Welt. Insubordination, Rebellion, Insurrektion sind legitim. Das Recht auf Widerstand ist ein Grundrecht.“ (38)
Hier kommt Negri wenig darüber hinaus, als dass sich die Multitude zusammentun und kämpfen muss. Er gibt sich dabei „militant“, gehen doch die Rezepte bis zur Insurrektion, zum Aufstand. Auch an den von Negri gern verwendeten Übertreibungen fehlt es nicht. So richtig die Unterstützung der Rebellion in den Banlieues von Paris war, so falsch ist die Annahme, dass diese „ins Herz des Empire“ trafen. Vielmehr wäre die spannende Frage die, wie solch spontane Rebellionen von (sub)proletarischen Schichten mit dem Befreiungskampf der Arbeiterklasse insgesamt verbunden werden können, wie der Chauvinismus der französischen Arbeiterbewegung hätte durchbrochen werden können usw., um wirklich einen Stoß ins „Herz des Empire zur führen?!
Auch bei folgender Frage kommt Negri über die Rezepte aus „Empire“ keinen Millimeter hinaus: „Was sind die Interessen der Multitude? Globale Bürgerrechte, bedingungsloses Einkommen, Wiederaneignung des Gemeinsamen, des Gemeinwesens und Demokratisierung der Weltgemeinschaft.“ (39)
Statt der „revolutionären Perspektive“ tischt Negri ein reformistisches Allerwelts-programm auf. Der Autonome endet als neo-reformistischer Quacksalber.
John Holloway: Keine Macht für niemand reloaded
John Holloway ist in den letzten Jahren zu einem der Haupttheoretiker der Autonomen und des Post-Operaisismus geworden. Auch hierzulande bekannt geworden ist er durch sein Buch „Die Welt verändern ohne die Macht zu übernehmen“, ein geradezu programmatischer Titel für einen großen Teil der weltweiten autonomen Bewegung, besonders in den anglo-amerikanischen Ländern, aber auch in Lateinamerika.
Holloway sieht sich in der autonomen Theorietradition, deren Kraft er darin erblickt, dass „sie ausdrücklich vom Subjekt, von der Arbeiterklasse ausgeht. Sie nimmt für sich in Anspruch eine Theorie des Kampfes zu sein, nicht aber eine Theorie der Rahmenbedingungen von Kämpfen, worauf die Hauptströmung des Marxismus hinausläuft. Als treibende Kraft der sozialen Entwicklung sieht sie den Kampf der Arbeiterklasse.“ (40)
In dieser Schrift wirft er Negri und seinem Buch „Empire“ vor, einer politischen Versuchung erlegen zu sein, die ihn vom „Autonomismus“ entfernt habe und in die Nähe des „orthodoxen“ Marxismus getrieben hätte. Wie kommt er zu diesem eigenartigen Vorwurf?
Hardt und Negri würden sich das Subjekt der Befreiung (die Multitude) wie auch den „Klassenkampf“ insgesamt als etwas „Positives“ vorstellen. Das hätte er mit der „Hauptströmung des Marxismus“ (also allen außer dem Autonomismus in Holloways Verständnis) gemein. Was meint Holloway damit?
„In der Vergangenheit war es üblich, sich den Klassenkampf als Kampf zwischen Kapital und Arbeit vorzustellen, wobei Arbeit als Lohnarbeit, abstrakte Arbeit, verstanden wurde und die Arbeiterklasse oftmals als Klasse der Lohnarbeitenden definiert wurde. Aber diese Auffassung ist falsch. Lohnarbeit und Kapital ergänzen sich gegenseitig, Lohnarbeit ist ein Moment des Kapitals. Es gibt in der Tat einen Konflikt zwischen Lohnarbeit und Kapital, aber es ist ein relativ oberflächlicher Konflikt. Es ist ein Konflikt über die Höhe der Löhne, die Länge des Arbeitstages, die Arbeitsbedingungen: Alle diese Konflikte sind wichtig, aber sie setzen die Existenz des Kapitals voraus. Die wirkliche Bedrohung für das Kapital kommt nicht von der abstrakten Arbeit, sondern von der nützlichen Arbeit oder dem kreativen Tun, denn es ist das kreative Tun, das in radikalem Gegensatz zum Kapital, d.h. zu seiner eigenen Abstraktion, steht. Es ist das kreative Tun, das sagt, „nein, wir werden nicht tun, was das Kapital befiehlt, wir werden tun, was wir für notwendig oder wünschenswert erachten“. (41)
Lt. Holloway wäre der gesamte „Hauptstrom des Marxismus“ eine „Bewegung der abstrakten Arbeit“:
„Seit der Frühzeit des Kapitalismus hat die abstrakte Arbeit ihren Kampf gegen das Kapital, ihren Kampf um bessere Bedingungen für die Lohnarbeit organisiert. Im Zentrum dieser Bewegung befindet sich die Gewerkschaftsbewegung mit ihrem Kampf um höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen. In der klassischen Literatur des orthodoxen Marxismus wird dies als ökonomischer Kampf betrachtet, der durch den politischen Kampf ergänzt werden muss. Der politische Kampf wird durch Parteien organisiert, die die Erlangung der Staatsmacht zum Ziel haben – sei es durch parlamentarische Mittel oder bewaffneten Kampf. Die klassische revolutionäre Partei beabsichtigt selbstverständlich, die Gewerkschaftsperspektive zu überwinden und eine Revolution anzuführen, die die abstrakte Arbeit, die Lohnarbeit abschaffen wird. Aber in Wirklichkeit ist (oder war) sie innerhalb der Welt der abstrakten Arbeit gefangen. Die Welt der abstrakten Arbeit ist eine Welt des Fetischismus, eine Welt, in der gesellschaftliche Verhältnisse als Dinge existieren. Es ist eine Welt, die von Geld, Kapital, dem Staat, den Parteien und Institutionen bevölkert ist, eine Welt voller falscher Stabilitäten, eine Welt der Identitäten. Es ist eine Welt der Trennung, in der das Politische vom Ökonomischen, das Öffentliche vom Privaten, die Zukunft von der Gegenwart, das Subjekt vom Objekt getrennt ist, eine Welt, in der das revolutionäre Subjekt ein sie (die Arbeiterklasse, die Bauernschaft) ist, nicht ein wir. Der Fetischismus ist die Welt der Bewegung, die auf dem Kampf der Lohnarbeit, der abstrakten Arbeit aufbaut und von diesem Fetischismus gibt es kein Entrinnen: Es ist eine Welt, die unterdrückerisch und frustrierend und furchtbar, furchtbar langweilig ist. Es ist auch eine Welt, in der der Klassenkampf symmetrisch ist. Dass sich abstrakte Arbeit und Kapital gegenseitig ergänzen, spiegelt sich in der grundlegenden Symmetrie zwischen dem Kampf der abstrakten Arbeit und dem Kampf des Kapitals wider. Beide drehen sich um den Staat und den Kampf um Macht über andere; beide sind hierarchisch, beide streben nach Legitimität in ihrem Handeln an Stelle anderer.“ (42)
Wir wollen hier einige Zeit bei diesen Passagen verweilen, weil sei durchaus bezeichnend für bestimmte „kritische“ anti-marxistische und autonome Argumentationsmuster sind.
Holloway beginnt mit einer großen Generalabrechnung mit dem „orthodoxen Marxismus“. In der Vergangenheit wäre es „üblich“ gewesen, sich den Klassenkampf „falsch“ oder „relativ oberflächlich“, als Kampf zwischen Klassen vorzustellen. Schuld darin sind die „orthodoxen Marxisten“ wie aber auch die gesamte bisherige Arbeiterbewegung aller Couleur, die den ersten Satz des „Kommunistischen Manifests“, dass alle bisherige Geschichte eine Geschichte von Klassenkämpfen sei, wohl gründlich missverstanden haben müssen.
Auch hätten sie „die Arbeit“ als „Lohnarbeit“ verstanden und die Arbeiterklasse als Klasse von Lohnarbeitern definiert. Die Frage, ob die Geschichte des Kapitalismus nicht tatsächlich vom Kampf dieser beiden Hauptklassen der Gesellschaft geprägt ist oder nicht, kümmert Holloway erst gar nicht. Ebenso wenig macht sich Holloway Gedanken darum, dass die Arbeit der ausgebeuteten Klasse im Kapitalismus, des Proletariats, Lohnarbeit ist und sein muss. Er tut einfach so, als würde die Tatsache, dass die „orthodoxen“ und sonstigen MarxistInnen und noch eine ganze Menge anderer Menschen diese Tatsache als Realität zur Kenntnis nehmen, gegen den Marxismus sprechen.
Er glaubt dann allen Ernstes, noch ein weiteres Geschütz gegen die Marxisten auffahren zu können: dass sämtliche Konflikte zwischen Lohnarbeit und Kapital „die Existenz des Kapitals“ voraussetzen!
Weil aber Kapital und Arbeit einander bedingen, weil die beiden Hauptklassen der Gesellschaft einander antagonistisch gegenüberstehen und „sogar“ wechselseitig durchdringen, meint Holloway, eine Widerlegung der „falschen Sicht“ des Klassenkampfes gefunden zu haben.
Dabei liegt die Stärke von Marx und Engels genau darin, dass sie die Triebfeder für die Entwicklung des Klassenkampfes nicht außerhalb vom, sondern im Kapitalverhältnis selbst gefunden haben – und damit auch die Notwendigkeit der krisenhaften Zuspitzung und revolutionären Lösung dieses Kampfes, der Machtergreifung der Arbeiterklasse.
Es ist bezeichnend für die Methode Holloways, dass er im ersten Zitat „den orthodoxen Marxisten“ unterschiebt, den Klassenkampf zwischen Lohnarbeit und Kapital im wesentlichen ökonomisch gefasst zu haben, also ob die Arbeiterbewegung nicht schon sehr früh auch begonnen hätte, sich als politische Bewegung zu formieren.
Im zweiten Zitat gibt Holloway auf seine Weise zwar zu, dass es verschiedene Flügel der Arbeiterbewegung gab, dass einige nur den gewerkschaftlichen Kampf, anderen wiederum als politische Parteien den Kampf um die politische Macht führen wollten, ein Teil davon sogar auf revolutionäre Weise und mit dem Ziel, das System der Lohnarbeit abzuschaffen.
Doch, was soll’s?! Was bedeuten schon solche Unterschiede, wenn alle in „der Welt der abstrakten Arbeit“ gefangen sind? Den ganze Geschichte der Arbeiterbewegung, alle grundlegenden Differenzen, ja die Verfolgung unterschiedlicher Klassenziele durch Reformismus und revolutionären Kommunismus wird zur Nebensache, seit Herr Holloway endlich die Ursache alles Übels der bisherigen Bewegungen, einen einzigen – unterstellten – „Denkfehler“ entdeckt hat.
Doch er begeht einen für idealistische Denker typischen Fehler. Er betrachtet die „Welt des Fetischismus“ nicht als eine Welt, in der z.B. Politik und Wirtschaft als getrennt erscheinen müssen. Würde er so vorgehen, also die materiellen Grundlagen dieser Trennung zur Kenntnis nehmen, wäre sofort klar, dass es überhaupt nichts nützt, diese Trennung einfach nicht mehr zu denken. Sie würde natürlich weiter bestehen. Die Trennung von wirtschaftlichem und ökonomischem Kampf kann nicht willkürlich überwunden werden, sondern es bedarf dazu eines bewussten taktischen und strategischen Agierens der Klasse – und damit auch einer politischen Führung.
Holloway fällt in seiner „Kritik“ des „orthodoxen Marxismus“ weit hinter Hegel und Marx zurück. In der „Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie“ (43) übernimmt Marx den Hegelschen Gedanken, dass in der bürgerlichen Gesellschaft (anders als in der Feudalgesellschaft) Staat/Politik und Privates/Wirtschaft/Familie als getrennte Sphären auseinander fallen und als einander entgegengesetzte Sphären erscheinen müssen – allerdings mit der wichtigen, wirklich kritischen Wendung, dass (anders als in Hegels Vorstellung) nicht der Staat das treibende Moment dieser Entwicklung in der bürgerlichen Gesellschaft ist, sondern die Ökonomie.
Wichtiger noch als diese Herleitung ist, dass Marx und Engels aus der „Trennung“ von Ökonomie und Politik, von wirtschaftlichem und politischem Kampf keineswegs folgern, dass bloß abstrakt deren „Überwindung“ angesagt ist.
Die Trennung von Ökonomie und Politik bedeutet, dass die Arbeiterklasse auch den ökonomischen Kampf systematisch verfolgen muss – und zwar nicht, weil sie in „der abstrakten Arbeit“ gefangen ist, sondern weil ihr dieser Kampf aufgezwungen ist, wenn sie überhaupt ihre Existenz sichern will.
Zum anderen insistieren Marx und Engels in der Polemik mit den Anarchisten, aus deren Mottenkiste Holloway einen Teil seiner Argumente abgeschrieben haben dürfte, darauf, dass die Arbeiterklasse weit davon entfernt, die politische Kampfmittel bloß als „Fetisch“ oder „identitär“ zu sehen, den Kampf um die Ausweitung demokratische Recht führen muss, aktiv an Wahlkämpfen teilnehmen soll usw.
Schließlich zeigen Marx und Engels auch, dass die Trennung von Ökonomie und Politik in letzter Konsequenz auch nur eine scheinbare ist, dass sich hinter den ökonomischen Kämpfen deren polischer Charakter verbirgt und dass es Aufgabe von RevolutionärInnen ist, diesen politischen Charakter auch bewusst zu machen. Im „Kapital“ schreibt Marx zu diesem Aspekt seitenlang in der Diskussion des Kampfes um den 10-Stunden-Tag, den er als einen Sieg der politischen Ökonomie der Arbeiterklasse charakterisiert. Folgten wir Herrn Holloway, der gern so tut, als hätten die Gedanken, die er nicht näher bestimmten „orthodoxen Marxisten“ unterschiebt, mit Marx nichts zu tun, so müssten wir zum Schluss kommen, dass der alte Marx grob irrte, hätten wir es doch nur mit einem „relativ oberflächlichen“ Konflikt zu tun.
Holloways „Alternative“
Die wirkliche Bedrohung für das Kapital kommt nicht von der abstrakten Arbeit, sondern von der nützlichen Arbeit oder dem kreativen Tun, denn es ist das kreative Tun, das in radikalem Gegensatz zum Kapital, d.h. zu seiner eigenen Abstraktion, steht.“ (44)
Und weiter zum „anti-kapitalistischen“ Kampf Holloways:
„Dies ist ein Kampf, der mit der Symmetrie bricht, die den Kampf der abstrakten Arbeit charakterisiert hat, ein Kampf der sich grundlegend asymmetrisch zum Kampf des Kapitals verhält und der sich an dieser Asymmetrie erfreut: Sachen auf eine andere Art und Weise zu machen, andere gesellschaftliche Verhältnisse aufzubauen, ist ein Leitprinzip.
In dieser Neuzusammensetzung des Klassenkampfes sind wir das revolutionäre Subjekt. Wir? Wer sind wir? Wir sind eine Frage, ein Experiment, ein Schrei, eine Herausforderung. Wir brauchen keine Definition, wir weisen alle Definitionen zurück, denn wir sind die anti-identitäre Kraft des kreativen Tuns und setzen uns über jede Definition hinweg. Nenne uns Multitude wenn Du magst, oder, besser noch, nenne uns Arbeiterklasse, aber jeder Versuch einer Definition ist nur insofern sinnvoll als wir mit dieser Definition brechen. Wir sind heterogen, wir sind dissonant, wir sind unsere eigene Bestätigung, die Verweigerung fremder Bestimmung über unsere Leben. Wir sind daher die Kritik der Repräsentation, die Kritik der Vertikalität und jeder Form von Organisation, die uns Verantwortung für unsere Leben nimmt. Hört die Stimmen der ZapatistInnen, der argentinischen Piqueteros, der Indigenen in Bolivien, der Menschen der sozialen Zentren in Italien: das Subjekt, das sie allzeit in ihren Äußerungen benennen, ist „wir“ und es ist eine Kategorie, die über wirkliche Kraft verfügt.“ (45)
In dieser Passage lassen sich vier Kernelemente der Doktrin Holloways und einer ganzen libertären Strömung der Autonomen festmachen:
a) Das revolutionäre Subjekt sind „wir“, sind diejenigen, die sich darin zusammenfassen. Ob Bauern/Bäuerinnen, ArbeiterInnen oder StudentInnen – die Klassenlage des Subjekts spielt letztlich keine Rolle.
b) Was an diesen unterschiedlichen Kämpfen revolutionär sein soll, ist, dass sie „asymetrisch“ wären zu den „Fetischen“, zur „abstrakten Arbeit“, zum Kapital, zum Staat. Als „revolutionär“ gilt hier also, was vom Großteil der Menschheit gerade nicht als revolutionär verstanden wird. Gemeinhin versteht man unter einer Revolution den gewaltsamen Übergang der politischen Macht, der Herrschaft von einer gesellschaftlichen Klasse zu einer anderen. Nicht so bei Holloway, seine Revolution ist „asymetrisch“, sie stürzt die bestehende Herrschaft nicht, ja das Ziel allein schon gilt ihr als Teufelswerk, als „orthodoxe“, autoritäre Bewegung. In Wirklichkeit ist das eine Phrase eines zu spät gekommenen Anarchisten, deren eigentlicher Inhalt darin besteht, dass die Revolution gar keine ist.
„Unsere Revolution kann folglich nicht als Vorbereitung für ein großes Ereignis in der Zukunft verstanden werden, sondern nur hier und jetzt als Erschaffung von Rissen, Fissuren oder Brüchen im Gewebe der Herrschaft, von Räumen oder Momenten in denen wir deutlich sagen, „nein, wir werden nicht hinnehmen, dass das Kapital unsere Leben gestaltet, wir werden tun, was wir für notwendig oder wünschenswert erachten“. Wenn wir uns umsehen, können wir sehen, dass diese Räume oder Momente der Weigerung und Erschaffung überall existieren, vom lakandonischen Urwald bis zur vorübergehenden Weigerung und Erschaffung eines Ereignisses wie diesem. Revolution, unsere Revolution, kann nur als Ausweitung und Multiplikation dieser Risse, dieser Blitze der Weigerung und Erschaffung, dieser vulkanischen Ausbrüche des Tuns gegen die Arbeit verstanden werden.“ (46)
Holloway beschreitet hier also einen ähnlichen Weg wie Negri (trotz all seiner Polemik gegen „das Positive“ der Multitude). Die neue Gesellschaft existiert für Holloway nämlich ähnlich wie Negris Multitude schon – in den „Rissen“, überall, wo wir Momente der „Weiterung und Erschaffung“ ins Werk setzen.
Das zentrale „Kampfmittel“, das Holloway vorschlägt, ist die Verweigerung und das vom Kapitalverhältnis nicht inkorporierte, erschaffende „Tun“. Dieser Vorschlag ist weder neu, noch originell, sondern anarchistischen Vorstellungen entlehnt. Auch im Anarchismus und seine Ablehnung der „Politik“ steht letztlich eine politische Strategie, die darauf basiert, dass die „Verweigerung“ eines gesellschaftlichen Zwangsverhältnisses dieses Zwangsverhältnis außer Kraft setzen würde.
So haben die Bakunisten u.a. anarchistische Strömungen des 19. Jahrhunderts die Teilnahme an Wahlen u.a. politischen Auseinandersetzungen in der bürgerlichen Gesellschaft mit dem Argument abgelehnt, dass eine Beteiligung an der bürgerlichen Demokratie der „Anerkennung des Staates“ gleichkommen würde.
Marx und Engels machen sich über diese Schrulle lustig, indem sie einfach darauf verwiesen, dass der Staat als Zwangsinstrument eine reale Macht darstellt, dass das politische Terrain der Auseinandersetzung existiert und zwar unabhängig davon, ob ich es „anerkenne“ oder nicht.
Auch auf das Argument der AnarchistInnen, dass die Arbeiterklasse durch die Beteiligung an Wahlen und die Ausnutzung der bürgerlichen Demokratie für ihre Agitation und ihre Forderungen doch nur Kampfmittel aus der bestehenden Gesellschaft entlehne, diese also damit „anerkenne“, antwortet Engels trocken, dass die AnarchistInnen doch einmal darlegen sollten, aus welcher Gesellschaft, wenn nicht aus der bestehenden die Arbeiterklasse ihre Kampfmittel nehmen solle? Er fordert die Anarchisten auf, zu erklären, warum die Arbeiterklasse freiwillig auf Kampfmittel verzichten solle, die in dieser Gesellschaft existieren, warum sie z.B. die Beteiligung an Wahlen nicht als Agitationsmittel gegen die Bourgeoisie verwenden soll.
So wie der Anarchismus gegenüber den politischen Kampfmitteln der bürgerlichen Gesellschaft verfährt Holloway gegenüber dem ökonomischen Kampf und überhaupt gegenüber dem Klassenkampf von Lohnarbeit und Kapital.
Die Arbeiterklasse solle von diesem Kampf Abstand nehmen, zugunsten des „Nein“. In Wirklichkeit läuft dieser Vorschlag also darauf hinaus, dass die Arbeiterklasse freiwillig auf Kampfmittel und Ziele – z.B. Massenstreiks für Lohnerhöhungen, im Kampf für bessere Arbeitsbedingungen usw. – verzichten oder diese zumindest geringer schätzen soll als die „Ausweitung und Multiplikation von Blitzen“, also „Freiräumen“ außerhalb des Lohnarbeit-Kapital-Verhältnisses!
Das ist der Rat eines bürgerlichen Scharlatans, keines „Kämpfers“! Die Ratschläge und die ganze Doktrin eines Holloway sind direkt den Interessen der Arbeiterklasse entgegengesetzt, sie sind direkt anti-revolutionär.
c) Zustimmen können wir Holloway eigentlich nur darin, dass seine „Revolution (…) folglich nicht als Vorbereitung für ein großes Ereignis in der Zukunft verstanden werden“ kann.
Ein „großes Ereignis“ wird mit dieser Strategie sicher nie zustande kommen. Vielmehr werden hier vorübergehende „Nischen“ (selbstverwaltete Betriebe, bäuerliche Subsistenzwirtschaft, Tauschbörsen, besetzte Häuser) schöngeredet. Es wird unterstellt, dass solche Projekte nur stetig verteidigt, ausgeweitet und schließlich verallgemeinert werden müssten und „das Neue“ würde so entstehen.
Holloway spult den Film des Revisionismus noch einmal ab, indem er unterstellt, dass sich im Monopolkapitalismus immer mehr „Nischen“ der Kleinproduktion bilden und diese zu einer neuen Gesellschaft führen würden.
d) Um „das Neue“ in Gang zu setzen, schlägt Holloway der Arbeiterklasse und den Unterdrückten auch eine bestimmte „Organisation“ ihres Kampfes vor:
„Wir sind daher die Kritik der Repräsentation, die Kritik der Vertikalität und jeder Form von Organisation, die uns Verantwortung für unsere Leben nimmt.“
Also, Proletarier, weg mit jeder Form der „Repräsentation“, weg mit der „Vertikalität“!
Was bedeutet das real? Es bedeutet, dass die Arbeiterklasse, die Bauern, die städtische Armut auf wirklich jede Form der Massenorganisation zu verzichten hätte!
Er bricht damit auch mit den früheren Operaisten oder Autonomen, die die Notwendigkeit einer straffen revolutionären Organisierung durchaus anerkannten.
Diese „Medizin“ des Herrn Holloway, die er gegen die „abstrakte Arbeitsbewegung“ empfiehlt, ist Gift für die Unterdrückten und Ausgebeuteten.
Keine unterdrückte Klasse der kapitalistischen Gesellschaft kann auch nur ihre Existenzbedingungen verteidigen, wenn sich nicht organisiert auftritt, ihre Masse, ihre große Zahl als Machtmittel wirksam werden lässt.
Das trifft natürlich noch vielmehr auf jede Aktion zu, die die Machtfrage aufwirft, z.B. einen unbefristeten Generalstreik oder einen Aufstand. Hier werden Millionen in Bewegung gesetzt, um bestimmte politische Ziele zu erreichen.
Sie können ihren Kampf aber nur aufrechterhalten und zum Sieg führen, wenn sie organisiert sind. Ein Generalstreik braucht Verbindung zwischen den einzelnen Betrieben, städtischen Zentren etc. Er braucht Koordination. Er braucht Verbindung und politische Führung z.B. zur Abwehr von Streikbrechern, faschistischen Stoßtrupps, Polizeiübergriffen etc.
All das heißt, dass die einzelnen Belegschaften „Repräsentationen“ brauchen, dass es Delegierte, „Vertikalität“ braucht. Ansonsten fällt die ganze Aktion rasch in sich zusammen. Ja es braucht, nebenbei bemerkt, auch „Formen der Organisation, die uns Verantwortung für unser Leben nimmt“ , also eine Arbeitsteilung innerhalb der Kampfbewegung, so dass nicht jede(r) alles tun muss. Selbst die von Holloway hoch gelobten Beispiele wie besetzte Betriebe in Arbeiterselbstverwaltung oder die Zapatisten wären in Wirklichkeit schon längst am Ende, wenn sie die ihnen unterschobene Holloway-Doktrin befolgen würden.
Wir sehen also, dass die gesamte Arbeiterbewegung aus gutem Grund die kleinbürgerlich-reaktionäre Organisationsfeindlichkeit und die damit verbunden „Prinzipien“ ablehnt.
Dabei wurde von RevolutionärInnen nie bestritten, dass sich jede Form der (Massen)organisationen „verselbstständigen“, sich von ihren ursprünglichen Zwecken entfernen, verbürokratisieren oder verbürgerlichen kann. Das Mittel dagegen ist aber nicht eine abstrakte Entwicklung angeblicher „Prinzipien“, die das verhindern könnten, sondern der Kampf für Arbeiterdemokratie und eine revolutionäre Politik in diesen Organisationen.
So treten wir eben nicht für die Fiktion einer „Nicht-Repräsenanz“ oder „Nicht-Vertikalität“ ein, sondern für die direkte Kontrolle der RepräsentantInnen durch die Basis, deren Rechenschaftspflicht, deren Wähl- und Abwählbarkeit.
Der Verzicht auf „Repräsentation“ und „Vertikalität“ an und für sich läuft darauf hinaus, der Arbeiterklasse den Verzicht auf jede Form wirksamer Klassenorganisation oder Widerstand zu predigen. Er läuft darauf hinaus, die Arbeiterklasse im Zustand permanenter individueller Atomisierung zu halten, also darauf, die Klassenherrschaft der Bourgeoisie zu verewigen!
Hier kommt auch Holloways programmatischer Buchtitel, „Die Welt verändern ohne die Macht zu übernehmen“ zu sich selbst. Er läuft darauf hinaus, dass sich die Welt nicht verändert, sondern bleibt, wie sie ist, dass die Macht in den Händen derer bleibt, die sie haben – in den Händen der herrschenden Klasse.
Exkurs: Die „Zeit der Forderungen ist vorbei“ und die Aufstände der Jugend
Die gegenwärtige autonome Bewegung in ihrer Gesamtheit ist sicher weit davon entfernt, einfach der Doktrin Negri oder Holloway zu folgen, auch wenn viele einen mehr oder weniger eklektischen Mischmasch aus diesen Theorien/Konzeptionen zur Untermauerung ihre Ansichten verwenden oder von diesen o.ä. Gedanken beeinflusst sind. So kommt kaum eine autonome Diskussion ohne den Negrischen Dreiklang von „Recht auf Bewegungsfreiheit“, „Recht auf Grundeinkommen“ und „Recht auf Aneinigung“ aus.
Andere autonome Mobilisierungen meinen, ihren „subversiven“ Charakter durch das Kokettieren mit der eigenen Harmlosigkeit noch herausstreichen zu müssen, so z.B. der Berliner May Day 2009, wo es auf die Frage, wie „Wie weiter!“ heißt:
“Naja – nach dem 1. Mai kommt dann erstmal der 2. Mai. Hallo Alltag. Und dann kommt ja noch die Krise, mit ihre Lügen und Konjunkturpaketen usw. – wie auch immer – unser Mayday Experiment ist ein Baustein in unserem Ringen um eine andere Gesellschaft, um eine andere Politik und eine solidarische Kultur. Mit aller Entschlossenheit voranstolpern! Gegen den Alltag der uns auffrisst, zusammen für eine solidarische Gesellschaft streiten. Das machen wir nicht erst seit Gestern – mal mit Spaß tanzend und mal zäh ringend. Wo Solidarität praktisch werden kann, wo lustvoll die Macht prekarisiert wird, wo wir widerstehen und wo wir Lust am Kollektiven bekommen – dort sind wir! Und jetzt schon freuen wir uns auf den Tag, an dem wir sagen können: Es war nicht alles schlecht im Kapitalismus!” (47)
Es gibt jedoch auch einen anderen Flügel, der sich „militant“, „radikal“, „anti-kapitalistisch“ und „revolutionär“ gibt, z.B. verschiedene Antifa-Gruppen.
Deren politische Sympathie liegt vor allem bei den Kämpfen, die unmittelbar militanten Charakter haben. Teilweise sind das bewaffnete, nationale Befreiungskämpfe wie in Kurdistan oder im Baskenland (weniger in Palästina, weil sie dort schon nicht mehr in der Lage sind, zwischen dem gerechtfertigten und unterstützenswerten Charakter eines nationalen Befreiungskampfes und dem bürgerlichen oder kleinbürgerlichen Charakter der aktuellen Führung dieses Kampfes zu unterscheiden).
Zum anderen und vor allem geht es um Aufstände oder Emeuten der Jugend, wie z.B. in Griechenland Ende 2008 oder in den französischen Banlieues.
Zweifellos ist es ein positives Zeichen dieser Gruppierungen, dass sie den unterstützenswerten und berechtigten Charakter dieser Aufstände der Jugend und insbesondere der migrantischen Jugend erkennen und mit ihnen solidarisch sind. Richtig an der Beschäftigung mit diesen Aktionen und Kämpfen ist auch, dass sie in der kommenden Krisenperiode häufiger auftreten werden und daher auch mehr Beachtung durch revolutionäre Organisationen erfordern. Das unterscheidet diese Autonomen durchaus wohltuend von den reformistischen, tw. auch rechts-zentristischen Gruppierungen, die diesen Emeuten ablehnend und ignorant gegenüberstehen und stillschweigend hoffen, dass der jüngste Krawall im Banlieue oder in einem beliebigen Vorort auch der letzte sein möge.
Aber diese autonome Richtung geht weiter, indem sie diesen Emeuten und Aufständen eine bestimmte Interpretation gibt, die – wie wir sehen werden – von der Holloways oder Negris weniger weit entfernt ist, als sie selbst denken.
Im Sammelband „Die Zeit der Forderungen ist vorbei“ (48), der eine Reihe interessanter Analysen der staatlichen und rassistischen Zurichtung der Banlieues, der Hintergründe und des Verlaufs der Aufstände enthält, kommt eine Autorin zu folgenden Schluss:
„So symbolisieren die Emeutes sowohl die strikte Weigerung, sich am politischen Spiel zu beteiligen, als auch das Fehlen einer sozialen Utopie, die den tiefen Graben zwischen linken Gruppierungen verschiedenster Provenienz aus den Ghettos überbrücken könnte. Und doch sind die Emeutes alles andere als sprachlos. Sie formulieren ein klares Nein gegen die herrschenden Verhältnisse.“ (49)
Deutlicher formuliert Marius von der Lubbe im selben Band, was er für das Zukunftsweisende der Emeuten hält:
„Die Modernität der Aufstände lag darin, den Schwindel repräsentativer Politikformen begriffen zu haben und sie nicht nachzuahmen, kein bloß mythisches Kräfteverhältnis angerufen, sondern ein reelles geschaffen zu haben, dieses Kräfteverhältnis selbst zu sein. Es stimmt natürlich, dass der Staat kaum ins Wanken geriet, auch wenn die Angst zeitweise die Seite wechselt.“ (50)
In ihrem Aufsatz warnt Ingrid Artus an anderer Stelle zwar vor einem kritiklosen „Abfeiern“ der Emeuten. Sie fasst aber ihre politische Botschaft so zusammen, dass sie ein „klares Nein gegen die herrschenden Verhältnisse“ seien. Nun kann darunter viel verstanden werden. Wenn ein „Nein“ zum Rassismus der Regierung, zu den sozialen Zuständen usw. gemeint ist, so ist das sicher zutreffend. Unter „herrschenden Verhältnissen“ kann freilich auch mehr verstanden werden. Marius von der Lubbe tut dies auch und geht einen deutlichen Schritt weiter, wenn er den aufständischen Jugendlichen unterstellt, dass die „den Schwindel repräsentativer Politikformen begriffen hätten“. Hier schwindelt sich nur der Autor etwas vor, weil er die Frustration über und die Ausgrenzung aus dem bestehenden politischen Betrieb und die daraus folgende Ablehnung desselben mit einem „Begreifen“, also einem Bewusstsein seiner Ursachen und Mechanismen verwechselt.
Ebenso falsch, aber für Autonome bezeichnend, ist die Auslassung von der Lubbes über das „Kräfteverhältnis“. Erstens ist ein Kräfteverhältnis schon begrifflich eine Relation zwischen zwei Kräften. Eine soziale Kraft/Gruppe/Aufständische kann daher zwar eine Kraft, niemals aber selbst ein Verhältnis sein. Dieser begriffliche Irrtum kommt aber nicht von ungefähr.
Wenn von der Lubbe nämlich wirklich das Kräfteverhältnis betrachten würde, in dem die Jugendlichen in den Banlieues oder in Griechenland agierten, so müsste er feststellen, dass die Aufstände eine Reaktion auf eine bewusste rassistische Provokation der französischen Regierung unter Sarkozy bzw. der Polizeirepression in Griechenland (Ermordung eines 16jährigen Jugendlichen) waren. Sie waren also Reaktionen auf vorhergehende Angriffe.
Der Widerstand hat dieses Kräfteverhältnis verschoben; er hat gezeigt, dass sich die Jugendlichen wehren wollen und können und die Unterdrückung zu einer politischen Frage für die gesamte Gesellschaft machen können.
Dass die Jugendlichen in den Banlieues keine „soziale Utopie“, keine Forderungen, keine Ziele, keine Organisation hatten, dass es keine revolutionäre, proletarische Kraft gab, die sie führen konnte, erwies sich jedoch in den Kämpfen als eine grundlegende Schwäche, als eine Ursache dafür, dass „der Staat kaum ins Wanken geriet“.
Der Gedanke von der Lubbes wird nicht dadurch besser, dass ihn andere Autonome abschreiben und mit eigenen Fehlern „ergänzen“:
„Während der Revolten verzichteten sie auf Formen politischer Repräsentation, stellten keine ‚konstruktiven‘ Forderungen sondern artikulierten ihren Unmut über ihre Lebenssituation indem sie sich ein paar ‚Freudenfeuer‘ genehmigten. Die Botschaft war eindeutig: ‚Es geht uns beschissen, wir haben die Schnauze voll!‘ Die Kraft der Aufstände lag darin, den Schwindel repräsentativer Politikformen begriffen zu haben und sie nicht nachzuahmen. An kein mythisches Kräfteverhältnis appelliert, sondern auf der Straße ein reelles geschaffen zu haben, es selbst zu sein. In den Angriffen auf Polizeistationen, Schulen, Öffentlichen Nahverkehr und Privatautos gaben sie ihrer Wut Ausdruck. Zwar fehlte ihnen eine revolutionäre politische Perspektive, jedoch haben sie begriffen, dass sie sich auf niemand anders verlassen können, als auf ihre eigene Stärke und die ihrer Klasse. Und die Revolten in Frankreich und Griechenland waren nur die Vorboten kommender Aufstände. (…)
Während die jeweiligen Bündnisse meist klassische Forderungen nach Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, bessere Lernbedingungen und mehr Geld aufstellten, manifestierte sich auf den Straßen und in den bestreikten Schulen die Lust auf konkrete Akte der Verweigerung. In einigen Städten kam es zu Besetzungen öffentlicher Gebäude, Sachbeschädigungen und Auseinandersetzungen mit der Polizei. Die Lektionen, die uns die französischen und griechischen Jugendlichen erteilt haben, sollten wir für den kommenden Schulstreik beherzigen: Nicht mehr so sehr auf seriöse politische Forderungen zu setzen und sich Medien und Politik als ‚konstruktiver‘ Gesprächspartner anzudienen, sondern auf den unvereinnehmbaren, subjektiven und wilden Widerstand. Denn ihr Interesse an unseren Schulstreiks und Forderungen ist geheuchelt. In ihrem System gibt es für uns und unsere Bedürfnisse keinen Platz. Alles was zählt ist unsere Wut.“ (51)
Dieser „Verzicht auf Formen politischer Repräsentation“, mit der auch ein Holloway gut leben könnte, soll nun auch in Berlin nachgeahmt werden. Eine „revolutionäre politische Perspektive“ fehlt zwar, doch was macht das schon, wenn man sich ein paar Freudenfeuer genehmigt und ansonsten begriffen hat, dass man sich nur auf die eigene Stärke, auf die „eigene Klasse“ verlassen kann.
Wer „die eigene Klasse“ der StudentInnen Griechenland sei, lässt das Flugblatt lieber im Dunkeln. Klar, denn sonst würde sich herausstellen, dass in Griechenland und auf der ganzen Welt die entscheidende soziale Kraft eben nicht „die Jugend“, sondern die Arbeiterklasse ist, dass es in Wirklichkeit ein politischer Betrug an ebendieser revoltierenden Jugend ist, sie in der Illusion zu lassen, dass nur „ihre Stärke und die ihrer Klasse“ die Gesellschaft aus den Angeln heben könnte. Die aufständische Jugend kann sich eben nicht „nur auf sich“ verlassen, sie muss sich mit der Arbeiterklasse verbünden und sich in den Befreiungskampf der Arbeiterklasse einreihen. Nur so kann sie ihre Interessen, ihre Forderungen gegen die herrschende Klasse durchsetzen.
Dazu müssen diese Forderungen auch formuliert werden – sowohl gegenüber den Herrschenden, denen sie abgerungen werden müssen, wie auch für die Teile der Gesellschaft, die den Kampf der Jugend, sei es in Griechenland, sei es in den Banlieues, sei es im Bildungsstreik unterstützen sollen. Warum sollen z.B. ArbeiterInnen den Bildungsstreik unterstützen, wenn die Forderungen nicht einmal klar benannt werden? Oder sollen die Proleten auf’s Geratewohl Aktionen ganz unabhängig von ihren eigenen unterstützen? Wer das ernsthaft von der Arbeiterklasse verlangt, zeigt vor allem, dass es in seinem politischen Denken, für die Arbeiterklasse keinen Platz gibt!
Überhaupt ist es natürlich Unsinn, das Aufstellen von Forderungen davon abhängig zu machen, was die Herrschenden zu einem bestimmten Zeitpunkt „ernst nehmen“. Das ist schließlich keine Frage einer über den Klassen stehenden „Vernunft“, sondern eine des Kräfteverhältnisses, der Stärke der Bewegung. Und auch diese wird in der Regel nur stark sein können, wenn sie klare Forderungen hat, um die herum sie die SchülerInnen und Studierenden mobilisieren kann.
Doch das ist den Autonomen zu unsicher. Das könnte ja „vereinnahmt“ werden oder in reformistisches Fahrwasser geraten, womöglich von „Formen politischer Repräsentanz“ (worunter alles – vom Streikrat über den Rätekongress bis zum bürgerlichen Parlament – fällt) geraten. Statt dessen setzt das Flugblatt auf den angeblich „unvereinnehmbaren, subjektiven und wilden Widerstand“.
Hier kommt eine alte autonome und anarchistische Schrulle zum Vorschein, der wir im Artikel schon mehrmals, darunter auch bei Holloways „Negativität“ begegnet sind. Es geht darum, dass bestimmte Formen der Organisation, der Aktion, der Aktivität, des Kampfes gesucht werden, die aus sich heraus vom System nicht vereinnehmbar wären.
Im Anarchosyndikalismus waren das „die Gewerkschaft“ und der „ Generalstreik“, die eine freie Föderation von Kommunen herbeiführen sollten. Diese Instrumente galten als „an sich“ revolutionär und „unvereinnahmbar“. Dieselbe Qualität dichten nun die Autonomen der rebellierenden Jugend an.
Anders der Marxismus. Für ihn gibt es keine Kampfform, keine Organisation, keine Forderung, die „an sich“ revolutionär ist, die nicht missbraucht, pervertiert, in ihr Gegenteil verkehrt werden könnte. Im Gegenteil: dem Marxismus ist die Suche nach solchen „Prinzipien“ fremd, weil auch die beste Organisationsform, die beste Parole usw. sich immer im Klassenkampf, d.h. in einer konkreten politischen Auseinandersetzung bewähren muss, weil ihre „Unvereinnahmbarkeit“ nur durch den Kampf und die richtige Strategie und Taktik, durch eine revolutionäre Kampfführung behauptet werden kann.
Gerade, wenn wir unseren Blick auf die griechischen Aufstände werfen, zeigt sich, dass die ganze Sicht der Autonomen überhaupt nicht zu den von ihnen gewünschten Resultaten führt. Im Flugblatt wird die große Errungenschaft der griechischen Bewegung so dargestellt, als wäre das Wichtigste der Bruch mit der „Repräsentanzvorstellung“.
In Wirklichkeit war das Wichtigste an den Aufständen der Jugend, dass sie Massencharakter hatten, mit Massenstreiks von ArbeiterInnen, v.a. im Öffentlichen Dienst und im Transportsektor einhergingen und eine vorrevolutionäre Periode einläuteten.
Die Hauptfrage war also, wie die Arbeiterklasse zum Kampf um die Macht, für die sozialistische Revolution mobilisiert und gewonnen werden kann. Diese Frage taucht bei den Autonomen bezeichnenderweise erst gar nicht auf. Ihre Hauptsorge gilt der „Unabhängigkeit“ und „Unvereinnahmbarkeit“ der StudentInnen und SchülerInnen!!!
Die Sorge dieser „Revolutionäre“ geht nicht nur am Hauptproblem gänzlich vorbei, sie ist auch politisch falsch. Die StudentInnen, die Jugendlichen können letztlich keine unabhängige Rolle von einer der beiden Hauptklassen der Gesellschaft spielen, sie müssen vielmehr von einer dieser beiden Klassen, gewollt oder ungewollt, „vereinnahmt“ werden. Die Jugend, die „nur auf ihre Kraft“ vertraut, ist eine Fiktion, eine Fiktion, die letztlich nur der Bourgeoisie dient. Und diese Fiktion der „Unvereinnahmbarkeit“, der „Nichtrepräsentanz“ war leider nicht nur ein Problem eines Flugblattes Berliner Autonomer. Es war ein reales Problem der Dominanz des Anarchismus unter der griechischen Jugend, die zu einer Desorganisation des Kampfes führte und ein Hindernis war für die Gewinnung der Jugend für ein revolutionäre, proletarische Perspektive.
Globale Krise – Globale Proletarisierung – Gegenperspektiven
Unter diesem Titel formulierte ein anderer Autor der autonomen, post-operaistischen Linken, K.H. Roth, seine Perspektiven (52). Im Folgenden werden wir uns näher mit seinen 2008 verfassten Thesen, die Mitte 2010 als umfangreicheres Buch erscheinen sollen, beschäftigten. Dafür gibt es mehrere Gründe. Erstens versucht Roth, eine Gesamtsicht und Analyse der Krise wie auch der durch sie eröffneten politischen Möglichkeiten zu geben. Roths Text ist trotz der zahlreichen Differenzen, die wir im folgenden ausführen werden, an etlichen Stellen interessant, anregend und fordert zur weiteren Diskussion heraus.
Hinzu kommt, dass sein Text in weiten Teilen der autonomen, operaistischen oder mit ihr verbundenen Linken diskutiert wird – also bei der Antifa, bei Wildcat oder in der Interventionistischen Linken.
Schließlich präsentiert K.H. Roth im Unterschied zu den bisher diskutierten Autoren ein Anti-Krisen-Programm, das er als „Übergangsprogramm“ zu einer anderen Gesellschaft verstanden wissen will.
Ursachen der Krise
In den ersten Abschnitten skizziert Roth den Verlauf der Krise und vergleicht sie mit bisherigen Krisen- und Entwicklungsperioden des Weltkapitalismus. Im Abschnitt „Wesentliche Eigenschaft der Krise“ stellt er korrekt fest, des es sich „erstens um eine Krise der weltweiten Überakkumulation des Kapitals in allen seinen Erscheinungsformen und Metamorphosen“ handelt. „Diese Überakkumulation geht zweitens mit einer massiven globalen Unterkonsumtion einher. (…)Dennoch wurde (…) drittens in den entwickelten Zentren des Weltsystems das Wechselspiel von Überkapazitäten und Unterkonsumtion zeitweilig durch die Finanzpolitik des billigen Gelds und der billigen Kredite kompensiert, aber dies vermochte den Ausbruch der Krise nur um ein paar Jahre hinauszuzögern.“ (53)
Während diese allgemeine Vorstellung in vielen Punkten korrekt ist, so wollen wir hier auch wesentliche Unterschiede zur Analyse Roths kurz darstellen.
1. Er konstatiert zwar in seinen einleitenden Bemerkungen richtig, dass eine weltweite Überakkumulation des Kapitals den eigentlichen Grund der Krise ausmacht, aber er konterkariert diese Darstellung im zweiten Abschnitt über die „vorhergegangenen Zyklen“ (und deren eigenwillige Einteilung):
„Ein weiterer entscheidender endogener Faktor war die Potenzierung der technologischen Herrschaft des Kapitals. Der »Kondratieff« des Zyklus 1973-2006 verhalf dem Kapital durch massive technische Innovationen zur Steigerung der Profitraten, indem er – bei fortschreitend sinkenden relativen Lohnraten – die organische Zusammensetzung des Kapitals in strategischen Bereichen verringerte: Umwälzung und Standardisierung der Transportketten durch den Container, Umwandlung der Kommunikationsstrukturen durch Informatik und Informationstechnologie, Mikrominiaturisierung und Roboterisierung der Produktionsanlagen und Umstellung der Maschinenparks auf numerisch gesteuerte Aggregate. Bis jetzt liegen keine gesicherten Daten über die im vergangenen Zyklus erreichte Steigerung der Ausbeutungsraten durch die weitere Verdichtung der Arbeitsprozesse, die Einführung der neuen technologischen Instrumente der reellen Subsumtion, die Indienstnahme und Verwertung der subjektiven Kreativität der Ausgebeuteten sowie die arbeitsorganisatorische Totalisierung betrieblicher Herrschaft (»total productive management« usw,) vor. Wir können aber mit Sicherheit davon ausgehen, dass sich die dem Umverteilungsprozess entzogene Produktivkraft des gesellschaftlichen Gesamtarbeiters im vergangenen Zyklus mit jährlichen Steigerungsraten zwischen 2,5 und 3,0 Prozent mindestens verdoppelt hat.“ (54)
Hier geht Roth also davon aus, dass es zu einer Verringerung der organischen Zusammensetzung des Kapitals und damit einhergehend zu einer Steigerung der Profitraten im Zyklus 1973 – 2006 gekommen wäre, den er auch als „Kondratieff“-Zyklus charakterisiert. Wir haben diese falsche, anti-marxistische Theorie in einer früheren Ausgabe des RM ausführlich kritisiert.
Auffällig ist nicht nur der Eklektizismus von Roth, sondern auch die Tatsache, dass er ohne empirische Belege, die Verringerung der organischen Zusammensetzung des Kapitals einfach annimmt. Er selbst gibt das zu, wenn er darauf verweist, dass es keine gesicherten Daten auf diesem Gebiet gäbe.
Mitnichten! Wir haben in einer Reihe von Artikeln (55) nachgewiesen, dass es sehr wohl eine Erhöhung der organischen Zusammensetzung des Kapitals in dieser Periode gab – trotz „neuer Technologien“ und erhöhter Ausbeutungsraten. Und nicht nur wir, auch Robert Brenner hat z.B. in seinem Buch „Boom and Bubble“ (56) die These von Roth eindrucksvoll widerlegt.
2. Roth stellt fest, dass mit der Globalisierung eine Expansion des Weltmarktes und auch die Schaffung globaler Produktionsketten einherging.
„Der Aufbau globaler Netzwerkunternehmen, deren Wertschöpfungsketten von zumeist in den Metropolen gelegenen Entwicklungs-, Design- und Marketingzentren gesteuert werden, war möglich geworden: Die segmentierten Arbeitsprozesse konnten über die Weltregionen mit den niedrigsten Ausbeutungsraten verteilt und miteinander verknüpft werden.“ (57)
So weit so gut. Roth macht jedoch den Fehler, dass er daraus zu sehr auf eine Vereinheitlichung der Arbeiterklasse in den imperialistischen Zentren und in der Peripherie schließt, was auch damit zu tun hat, dass er keinen klaren Imperialismus- und Monopolbegriff kennt.
3. Roth legt zwar zurecht große Aufmerksamkeit auf den Aufstieg Chinas als kapitalistische Macht und das Verhältnis China-USA. Er erwähnt aber überhaupt nicht die Formierung eines imperialistischen EU-Blocks unter deutsch-französischer Führung. So kommt die Einführung des Euro als wichtige Weltwährung, die sich anschickt, dem Dollar Konkurrenz zu machen, gar nicht vor, wie überhaupt die Verschärfung der innerimperialistischen Konkurrenz bei ihm keine große Bedeutung hat.
Hier liegt ein – für operaistische Traditionen – nicht untpyischer, aber grundlegender Fehler vor: nämlich nicht das aktuelle Entwicklungsstadium des imperialistischen Weltsystems, also eine politische und ökonomische Totalität zum Ausgangspunkt zu machen, sondern sich auf eine iw. ökonomische Krisenanalyse zu beschränken.
Soweit die Hauptpunkte unserer Kritik an seiner Analyse der Krise. Roth selbst beschließt folgendermaßen:
„Die große Krise wurde erst durch das seit 1938 in Europa beginnende und ab 1940 auch die USA erfassende internationale Wettrüsten und die Rüstungswirtschaften des zweiten Weltkriegs überwunden. Dieser katastrophale Ausgang der Krise war keineswegs ‚gesetzmäßig‘ vorgezeichnet. Deshalb sollte er uns in der Auseinandersetzung mit der sich jetzt ausbreitenden Weltkrise klar machen, dass unsere Aufgabe darin besteht, Wege zur Krisenüberwindung vorzuschlagen und mit durchzusetzen, die den Weg in einen neuen Weltwirtschaftskrieg verbauen und zugleich als Hebel zur sozialistischen Transformation des Weltsystems genutzt werden können.“ (58)
In dieser Intention liegt zweifellos eine Stärke von Roths Text, verglichen mit Negri und erst recht mit der politischen Bettelsuppe eines Holloway oder der „radikalen“ Autonomen, deren Programm vor allem darin besteht, nichts zu fordern.
Roth will hier bewusst einen anderen Weg gehen und sowohl das Subjekt einer „sozialistischen Transformation“ ausmachen wie auch – und das unterscheidet ihn positiv von den anderen autonomen/post-operaistischen Autoren – ein Programm entwickeln.
Globale Proletarisierung
Folgerichtig ist der nächste große Abschnitt seines Textes der „globalen Proletarisierung“ gewidmet. „Bevor wir uns dieser Frage zuwenden, sollten wir uns darüber verständigen, wer in der Lage sein könnte, einen Weg der Krisenüberwindung durchzusetzen, der nicht erneut in die kapitalistische Barbarei führt, sondern eine sozialistische Transformationsperspektive freimacht. Dies können nur diejenigen Klassern und Schichten sein, die der kapitalistischen Akkumulations- und Regulationsmaschinerie ihr Arbeitsvermögen feilhalten oder entäußern müssen, um leben zu können: Die Eigentumslosen der Welt, aus denen das sich ständig wandelnde Multiversum der Weltarbeiterklasse hervorgeht.“ (59)
Wer aber ist dieses Multiversum?
„Die Weltarbeiterklasse wird nicht durch die doppelt freie Lohnarbeit dominiert, sondern stellt seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts ein vielschichtiges Multiversum dar, innerhalb dessen die großindustrielle Lohnarbeit eine wichtige und zeitweilig auch politisch hegemoniale Rolle spielte, aber nie die Aussicht hatte, die übrigen Segmente des Proletariats zu absorbieren und / oder in eine reine industrielle Reservearmee verwandelt zu sehen. Die globale Klasse der Arbeiterinnen und Arbeiter konstituiert sich bis heute in einem Fünfeck von Massenarmut und Massenerwerbslosigkeit, kleinbäuerlicher Subsistenzwirtschaft, von selbständiger Arbeit (Kleinbauern, Kleinhandwerker und Kleinhändler, scheinselbständige Wissensarbeiter), industrieller Lohnarbeit und unfreien Arbeitsverhältnissen aller Schattierungen (Sklaverei, Schuldknechtschaft, Kuli- bzw. Kontraktarbeit, militarisierte und internierte Zwangsarbeit bis hin zu den ihrer Freizügigkeit beraubten Arbeitsarmen der Metropolen, etwa den Hartz IV-Empfängern).“ (60)
Kurz, das „Multiversum der Weltarbeiterklasse“ umfasst verschiedene Klassen!
Es geht hier keinesfalls darum, die Bedeutung nicht-proletarischer Klassen wie z.B. der subsistenzbäuerlichen Familien, deren Größe Roth auf 2,8 Milliarden Menschen (davon allein 700 Millionen in China) veranschlagt, oder der städtischen Armut (lt. Roth ca. eine Milliarde) gering zu schätzen. Nur ein Narr könnte sagen, dass die Arbeiterklasse den Nöten der Mehrheit der Menschheit nicht größte Aufmerksamkeit zu widmen hätte, zumal gerade die Subsistenzbauern und die städtische Armut von der Krise besonders hart getroffen werden.
Aber Roths grundlegender Fehler und Bruch mit dem Marxismus besteht darin, dass er die unterschiedlichen, teils gegensätzlichen Klasseninteressen von Proletariat und Bauernschaft im „Multiversum“ verwischt. Roth konstatiert richtig die Entwicklung von Widerstand und Kampfbereitschaft:
„Nicht erst seit dem Übergang zur Krise beobachten wir eine deutliche Zunahme von Kämpfen und Revolten, in denen die Akteurinnen und Akteure solidarisch für einander eintreten, egalitäre Verhaltensweisen entwickeln und sich zunehmend weigern, die sozialen Kosten der Krise auf sich zu nehmen.“ (61)
Und weiter unten:
„In allen diesen Eruptionen schärft sich ein wachsendes Krisenbewusstsein, das sich mit der Parole ‚Wir bezahlen Eure Krise nicht‘ zu homogenisieren beginnt. (…)
Alles in allem ist aufgrund der Krise ein weiterer globaler Proletarisierungsschub zu erwarten, der von der heraufziehenden neuen Welle der Massenerwerbslosigkeit in den bisherigen Krisenzentren USA, Europa und Ostasien ausgeht. Erneut werden Millionen von Menschen sozial abstürzen. Wie werden sie reagieren? Die proletarischen Familien, die sie umgebenden sozialen Gruppen und die vielschichtigen Segmente des proletarischen Multiversums haben unterschiedliche Optionen, sobald sie nichts mehr zu verlieren haben: Sie können revoltieren, um sich ihr Existenzrecht zu sichern und eine egalitäre Gesellschaft zu erkämpfen; sie können aber auch den Prozess der individuellen, familiären und sozialen Selbstzerstörung beschreiten, indem sie etwa die patriarchale Gewalttätigkeit restaurieren oder ethnische Konflikte aufladen, um ihr Überleben auf Kosten anderer proletarischer Gruppen zu sichern.“ (62)
Schon hier deutet sich an, was wir auch bei der Betrachtung seines Forderungsprogramms sehen werden. Roth stellt sich gar nicht die Frage, was eigentlich das Klassenprogramm des Proletariats gegen die Krise ist, wie es die Bewegung vereinheitlichen kann, wie es die Bauern und Armen um sich scharen kann.
Roth bleibt vielmehr auf der Ebene, die Forderungen des „Multiversums“ zu sammeln und darzustellen. Daher kann er keine Perspektive und kein strategisches Kampfziel bestimmen, sondern einfach nur verschiedene – progressive wie regressive – „Optionen“ anbieten.
Für KommunistInnen ist die Frage, welche „Option“ der Entwicklung der Unterdrückten – Widerstand/Revoltieren/Revolution oder Regression – sich durchsetzt, abhängig davon, welche politischen Programme und Strategien sich unter den ArbeiterInnen und Unterdrückten durchsetzen, ob es gelingt, die Führungskrise des Proletariats zu lösen und eine revolutionäre Klassenführung zu schaffen.
Bei Roth hängt das hingegen von Prozessen ab, die außerhalb des bewussten Eingreifens von RevolutionärInnen liegen, und davon, ob sich die Tendenzen zur „Vereinheitlichung des Multiversums“ und dessen Homogenisierung durchsetzen oder nicht.
Doch das ist – vom Standpunkt des Marxismus – keineswegs die entscheidende Frage. Die globale Krise kennt sowohl vereinheitlichende wie auch spaltende und zersetzende Tendenzen für die Existenzbedingungen der Arbeiterklasse. Entscheidend ist nicht, ob die Krise mehr in diese oder jene Richtung drängt (klar ist aber, dass sie die zersetzenden Tendenzen in der Arbeiterklasse z.B. durch Anstieg der Massenarbeitslosigkeit verschärft), sondern ob es einer revolutionären Avantgardepartei gelingt, die Klasse im Widerstand gegen die Angriffe zu vereinen und zum Sturz des Kapitalismus zu führen. Das ist auch der eigentliche Sinn eines Übergangsprogramms, wie es von der frühen Kommunistischen Internationale oder von Trotzki entwickelt wurde:
„Die strategische Aufgabe der nächsten Periode – der vorrevolutionären Periode der Agitation, Propaganda und Organisation – besteht darin, den Widerspruch zwischen der Reife der objektiven Bedingungen der Revolution und der Unreife des Proletariats und seiner Vorhut (Verwirrung und Entmutigung der alten Generation, mangelnde Erfahrung der Jungen) zu überwinden. Man muß der Masse im Verlauf ihres täglichen Kampfes helfen, die Brücke zu finden zwischen ihren aktuellen Forderungen und dem Programm der sozialistischen Revolution. Diese Brücke muß in einem System von Übergangsforderungen bestehen, die ausgehen von den augenblicklichen Voraussetzungen und dem heutigen Bewußtsein breiter Schichten der Arbeiterklasse und unabänderlich zu ein und demselben Schluß führen: der Eroberung der Macht durch das Proletariat. (…)
Die strategische Aufgabe der IV. Internationale besteht nicht darin den Kapitalismus zu reformieren, sondern darin, ihn zu stürzen. Ihr politisches Ziel ist die Eroberung der Macht durch das Proletariat, um die Enteignung der Bourgeoisie durchzuführen. Die Lösung dieser strategischen Aufgabe ist jedoch undenkbar ohne die sorgfältigste Aufmerksamkeit gegenüber allen Fragen der Taktik, selbst den geringfügigen und partiellen.
Alle Teile des Proletariats, alle seine Schichten, Berufe und Gruppen müssen in die revolutionäre Bewegung hineingezogen werden. Was die Besonderheit der gegenwärtigen Epoche ausmacht, ist nicht, daß sie die revolutionäre Partei von der prosaischen Arbeit des Alltags befreit, sondern daß sie erlaubt, diesen alltäglichen Kampf in unauflösbarer Verbindung mit den Aufgaben der Revolution zu führen.“ (63)
Für Trotzki ist also das Übergangsprogramm ein Programm zur proletarischen Machtergreifung, das zu seiner Umsetzung eine bewusste, zur Partei und Internationale geformte Avantgarde der Klasse braucht.
Für Roth ist das anders. Das Programm ist bei ihm kein Mittel, kein Weg zur Machtergreifung, sondern eine „Vision“.
„Aus allen diesen Gründen benötigt die emanzipatorische Perspektive eine analytisch ausgewiesene Vision der Gesellschaftstransformation, die mit unmittelbar greifenden Aktionsprogrammen verknüpft ist. Damit die Krise weder in eine Reformperspektive zur »Erneuerung des Kapitalismus“ noch in die drei möglichen Varianten der Barbarei führt – innere Selbstzerstörung, Bürgerkrieg und kapitalistischer Weltwirtschaftskrieg als Vorstufe neuer Großkriege -, sollte die Perspektive der proletarischen Selbstemanzipation auf zwei Handlungsebenen verteilt werden, damit diese ineinander greifend wirksam werden: Erstens in einen Handlungsrahmen zur radikalen Zuspitzung der anlaufenden antizyklischen Reformprogramme, und zweitens davon ausgehend in eine Programmatik zur Initiierung eines Projekts der revolutionären Transformation der kapitalistischen Gesellschaftsformation.“ (64)
Das zeigt sich auch noch einmal im Inhalt seines Programms. Roth fordert die Zuspitzung der Parole „Die Kapitalvermögensbesitzer sollen für die Krise bezahlen“. Das ist für sich genommen richtig, es ist aber typisch für Roth und die Autonomen, wie er die „Zuspitzung“ formuliert:
„Diese massive Umverteilung des Reichtums von oben nach unten strebt keineswegs eine systemimmanente Stabilisierung des Krisenzyklus an, aber sie macht sich das Bestreben der keynesianischen Reformökonomen zunutze, die Schere zwischen Überakkumulation und Unterkonsumtion durch die Steigerung der Masseneinkommen zu schließen und dadurch den Krisenzyklus zu überwinden. Denn zwischen den Lebens- und Konsumtionsbedürfnissen der Klasse der Arbeiterinnen und Arbeiter und der volkswirtschaftlichen Größe der „Massenkaufkraft“ besteht ein unüberwindlicher qualitativer Unterschied, der den Eigentumslosen im Prozess ihrer Homogenisierung die Chance eröffnet, die antizyklische Krisenpolitik der jetzt an die wirtschaftspolitischen Schalthebel gelangenden Machtgruppen über sich hinauszutreiben. Dafür sind weltweit koordinierte Massenaktionen, aber auch eine weltweit vernetzte Informationskampagne erforderlich, die jegliche institutionelle Anbindung an die Projekte und Parteien einer systemimmanent bleibenden antizyklischen Politik der Krisenüberwindung vermeidet.“ (65)
Auffällig und typisch ist der allgemeine, vage Charakter der Formulierungen. Den ArbeiterInnen biete sich die Chance, „die antizyklische Krisenpolitik der jetzt an die wirtschaftspolitischen Schalthebel gelangenden Machtgruppen über sich hinauszutreiben“. Doch wie? Mit welchen Forderungen? Wie sollen sie das sicherstellen? Hier bleibt Roth vage. Er spricht von „koordinierten Massenaktionen“ oder von der Vermeidung „institutioneller Anbindung“. Er gibt nur allgemeine Ratschläge, kein Programm, auf dessen Grundlage die ArbeiterInnen handeln könnten. So fehlen hier grundlegende Übergangsforderungen wie jene nach Offenlegung der Finanzströme, Kontrolle von Produktion und Verteilung durch die Arbeiterorganisationen usw. usf.
Seine zweite „Radikalisierung“ lässt jedoch noch viel mehr zu Wünschen übrig. Sie lautet: „Neue Weltwährung und Wiedereinführung fester Wechselkurse“. Während er sich oben noch gegen das „Herumdockern“ am System verwahrt hat, schlägt er jetzt selbst eine neue Weltwährung vor, ein reformistisches Megaprojekt!
Solche Forderungen zeigen, wie wenig Roths Programm mit einem revolutionären Übergangsprogramm zu tun hat, welches das Proletariat zum Kampf um die Macht vorbereiten und führen soll. Statt dessen kommt ein komplett utopischer Vorschlag, nämlich die Durchsetzung einer „neuen Weltwährung“ – in einer Periode, da gerade die ökonomischen Grundlagen für die das bestehen einer unumstrittenen Weltwährung mit den Niedergang der US-Hegemonie und verschärfter innerimperialistischer Rivalität verschwinden.
Roth fährt fort mit seinem dritten großen Block zur „Zuspitzung“ des Anti-Krisenprogramms: „Demokratisierung der wirtschaftlichen Restrukturierungsprogramme“. Dadurch sollen „basisdemokratisch gewählte Repräsentationen der Arbeiterinnen und Arbeiter in die anlaufenden Redimensionierungs- und Restrukturierungsprozesse der großen Wirtschaftszweige eingeschaltet werden“ und „Lernprozesse in Gang kommen, die von Anfang an global vernetzt sind und als Vorbereitung auf die kollektive Selbstverwaltung der gesellschaftlichen Lebens- und Reproduktionsprozesse“. (66)
Auch hier kommt der reformistische Grundton dieser „Zuspitzung“ klar zum Ausdruck. Es wird gleich gar kein Anti-Krisenprogramm der Arbeiterklasse formuliert. Forderungen wie die nach Verstaatlichung der Banken und Konzerne, die selbst in einem reformistischen Programm vorkommen können, fehlen gänzlich, ebenso wie alle Forderungen nach Programmen gesellschaftlich nützlicher Arbeiten. Auch die Losung der Arbeiterkontrolle fehlt oder ist „bestenfalls“ unklar formuliert, kann doch das „Einschalten“ von RepräsentantInnen der ArbeiterInnen alles Mögliche bedeuten von der Mitbestimmung bis zu Kontrolle.
Doch wer sich vom „Sofortprogramm“ Roths enttäuscht sieht, der wird mit seinem „Transformationsteil“ auch nicht glücklich werden.
„Durch die Forcierung und Zuspitzung der antizyklischen Reformprogramme soll der Weg für einen revolutionären Transformationsprozess freigemacht werden: Sie ermöglicht kollektive Lernprozesse, die das Massenbedürfnis nach einem Umbruch in Richtung Selbstemanzipation und gesellschaftlicher Autonomie hervorbringen. Denn der Übergang zum Sozialismus hat nur dann eine Chance, wenn er weltweit zu einem dominierenden Massenbedürfnis herangewachsen ist. Dieser Prozess benötigt Zeit – sicher mehrere Jahre. Aber auch der Transformationsprozess selbst wird sich über Jahrzehnte hinziehen, bevor der point of no return erreicht ist, an dem die Selbstverwaltung der unmittelbaren Produzenten über die von ihnen angeeigneten Produktions- und Reproduktionsgrundlagen egalitäre und basisdemokratische Strukturen erzeugt hat, die eine Restauration von Klassenherrschaft unmöglich machen.“ (67)
Was hier als „revolutionärer Transformationsprozess“ ausgegeben wird, ist ein Etikettenschwindel. Es ist eine Perspektive der längerfristigen Reform. Das wird noch deutlicher, wenn man Roths drei „Vorbedingungen“ der Transformation betrachtet:
1. „Umstellung der Gewerkschaften auf das Vertrauensleutekörpermodell, Entbürokratisierung und Abbau der Co-Manager-Gehälter ihrer Leitungsgremien; basisdemokratische Umgestaltung der Kommunalparlamente und -verwaltungen als erste Schritte einer allgemeinen und von unten nach oben fortschreitenden Entstaatlichung.“
2. „die Steuereinkommen schwerpunktmäßig auf die kommunalen Strukturen umzuleiten (Modell Schweiz, wo 60 Prozent der Gesamtsteuern in die Kommunen gehen)“
3. „radikale Senkung der Arbeitszeit bei gleichzeitiger Anhebung und Homogenisierung der Arbeitseinkommen“ (68)
So, legt Roth allen Ernstes dar, käme es zu einer „Entstaatlichung“!
„Auf diesen elementaren Grundlagen der aufeinander aufbauenden kommunalen und regionalen Selbstverwaltung der gesellschaftlichen Lebensprozesse werden schließlich Strukturen der gesellschaftlichen Autonomie entstehen, die nicht nur die politischen und wirtschaftlichen Manager-Eliten verabschieden, sondern auch das Aufkommen einer neuen Experten- und Bürokratenkaste verhindern. Parallel dazu werden sich die kommunalen Sozialisierungsprozesse auf regionaler, subkontinentaler und kontinentaler Ebene miteinander verbinden.“ (69)
Und weiter: „Die transnationalen Gewerkschaften sollten sich beim Übergang zu Selbstverwaltungsföderationen auf alle diejenigen Wirtschaftsbranchen konzentrieren, die weltweit operieren und über die regionalen Produktions- und Reproduktionssysteme hinausreichen, die regionalen Rätedemokratien beliefern und die Gegenmacht der Arbeiterinnen und Arbeiter in den Schlüsselsektoren des Weltsystems etablieren.“ (70)
Das gipfelt schließlich in der „Gründung einer Weltföderation der Autonomien“ nach einem langwierigen „Transformationsprozess“, ohne dass das Proletariat die politische Macht ergreifen oder den bürgerlichen Staatsapparat zerschlagen müsste!
Der bürgerliche Staat kommt nämlich in den Ausführungen von Roth erst gar nicht vor. Wozu auch? Schließlich müssen die Kapitalisten ja nicht enteignet und mit Gewalt von ihren Positionen vertrieben werden. Bei Roth werden sie einfach irgendwann „verabschiedet“, während Gewerkschaften und Selbstverwaltungsföderationen (assoziierte Kommunen) anfangen, ganze Wirtschaftsbranchen neu zu regeln.
Der autonome Tiger endet hier als reformistischer Bettvorleger. Um das zu unterstreichen, legt Roth auch noch seine Vorstellung einer revolutionären Organisation, der „globalen Assoziation für Autonomie“ vor:
„Nach langem Zögern habe ich mich dazu durchgerungen, eine organisatorische Vorwegnahme dieses Konzepts durch eine weltweit vernetzte Assoziation vorzuschlagen, die auf allen drei Ebenen gleichzeitig aktiv wird. Es soll sich dabei nicht um eine Kaderorganisation mit Avantgardeanspruch handeln, sondern um einen freien und basisdemokratisch verfassten Zusammenschluss von Menschen, die das hier vorgelegte Konzept kritisiert, korrigiert, überarbeitet, erweitert und sich sodann zu eigen gemacht haben, um seine Nützlichkeit im Dialog mit dem proletarischen Multiversum zu testen. Die sich dabei ergebenden Erfahrungs- und Lernprozesse werden zu einer fortlaufenden Korrektur des Modells führen. Sobald das proletarische Multiversum den Übergang zur globalen Autonomie unumkehrbar zu machen beginnt, wird sich diese Assoziation wieder auflösen.“ (71)
In Roths Programm wie in seiner Organisationsvorstellung tritt der Unterschied zum Marxismus deutlich hervor:
a) Revolutionäre Möglichkeiten ergeben sich nicht am Reißbrett, wie bei Roth, nach einem langen „Transformationsprozess“. Sie ergeben sich durch die krisenhafte Zuspitzung der inneren Widersprüche des Kapitalismus. Sie müssen daher in diesen Perioden oder Situationen ergriffen und gelöst werden. Wird das versäumt, gibt es keinen „langen Transformationsprozess“, sondern einen Sieg der bürgerlichen Konterrevolution.
b) Die revolutionäre Umwälzung ergibt sich nicht als Abschluss langwieriger, schrittweiser Transformationsprozesse, sondern beginnt mit der Eroberung der Staatsmacht durch die Arbeiterklasse. Das ist die Voraussetzung dafür, dass Wirtschaft und Gesellschaft überhaupt im Interesse der Ausgebeuteten reorganisiert werden kann.
c) Die Aufgabe der revolutionären Partei erschöpft sich nicht im Dialog und Zusammenschluss, wie jene der „Assoziation“, sondern besteht darin, die Klasse zur Revolution zu führen. Anders als Roths „Assoziation“ löst sich diese nicht auf, nachdem ein „Übergang zur globalen Autonomie“ unumkehrbar geworden sei (obwohl die politisch-militärischen Apparate der Bourgeoisie weiter bestehen!!). Die Notwendigkeit der revolutionären Partei hört erst dann auf, wenn die Periode des Übergangs zum Sozialismus, der Herrschaft der Arbeiterklasse beendet ist, also mit dem endgültigen Sieg der proletarischen Weltrevolution.
IV. Leninismus und Autonomismus
Wenn wir die autonomen Autoren zur Krise betrachten, so zeigt sich, dass ihre Analysen, Perspektiven, Vorschläge weder besonders originell, noch wegweisend sind. Programmatisch haben sie entweder nichts (Holloway), einige Zauberformeln (Negri) oder eine maues reformistisches Programm zu bieten (Roth).
Dennoch sind die Autonomen in den letzten Jahren eher stärker denn schwächer geworden. Die Ursache dafür liegt jedoch nicht bei den Autonomen selbst, sondern vielmehr in der Krise und Verrottetheit des Reformismus – sei es der einer sozialdemokratischen oder einer ehemals „kommunistischen“ Partei oder jener der Gewerkschaftsbürokratie.
Es gibt er auch eine zweite, mit der aktuellen Krisenperiode eng verbundene Ursache – die soziale Deklassierung und Perspektivlosigkeit, die der Kapitalismus v.a. der Jugend bietet. Das verleiht dem „unintegrierbaren“ Gestus und der zur Schau getragenen Militanz der Autonomen nicht nur Attraktivität, sondern z.T. auch Plausibilität.
Doch die Alternative ist nur eine scheinbare. In Wirklichkeit ist der autonome Weg nicht minder ein Weg in Sackgasse und Niederlage wie jener des Reformismus – und zwar v.a. in Situationen, in denen sich der Klassenkampf verschärft und revolutionär zuspitzt.
Die Tatsache, dass autonome Kräfte teilweise eine wichtige Rolle bei Mobilisierungen spielen und eine Zusammenarbeit mit ihnen notwendig ist, ändert nichts daran, dass RevolutionärInnen den Autonomismus einer schonungslosen Kritik unterziehen müssen. Nur so ist es möglich, die besten und kämpferischsten Jugendlichen und ArbeiterInnen, die in ihm eine Alternative zum Reformismus erblicken, für ein wirklich revolutionäres Programm zu gewinnen.
Wie wir gesehen haben, stützt sich die heutige autonome Bewegung v.a. auf dem Kleinbürgertum ähnliche Schichten, v.a. auf Studierende. Aber auch politisch hat ihre ganze Doktrin über alle Schattierungen hindurch einen kleinbürgerlichen Charakter, sie ist eine Spielart des kleinbürgerlichen Radikalismus.
Das zeigt sich an der Weigerung vieler Gruppierungen, systematisch in der Arbeiterbewegung zu arbeiten, und darin, allgemein Forderungen, Strukturen und Organisation abzulehnen. Politik verkommt dabei zu einem im Grunde moralischen Gestus, zu „revolutionärer Gesinnung“. Zugleich wird der schwankende Charakter der Autonomen, der ihnen wie jeder kleinbürgerlichen Politik eigen ist, aber auch dort deutlich, wo sie sich an Taktik, Forderungen und „Programme“ heranwagen. Dann endet der revolutionäre Anspruch nur allzu leicht im ungewollten Wiederkäuen reformistischer Konzepte.
Zwischen Marxismus und Autonomismus gibt es daher keinen bloß graduellen Unterschied, sondern einen grundlegenden Gegensatz – wie eben zwischen proletarischer und kleinbürgerlicher Politik allgemein.
a) Verständnis des Kapitalismus und seiner Gesetzmäßigkeiten
Für MarxistInnen ist der Kapitalismus eine Gesellschaftsformation, die vom Klassengegensatz von Kapital und Arbeit geprägt ist. Es sind die inneren Entwicklungsgesetze der kapitalistischen Produktionsweise, die Krisen hervorbringen, den Klassenkampf verschärfen und schließlich zum Sturz dieser Gesellschaftsformation durch die proletarische Revolution treiben.
Für die Autonomen und Operaisten hingegen ist es genau umgekehrt, es ist die unterdrückte Klasse/Schicht/Gruppe, die – unabhängig von Gesetzmäßigkeiten der Kapitalakkumulation und der politischen und wirtschaftlichen Lage – durch ihre eigene Aktion die Verhältnisse zuspitzt.
b) Klassenbegriff und Subjektbegriff
Der Klassenbegriff der Autonomen/Operaisten ist daher erstens immer nicht-dialektisch. Die Arbeiterklasse wird nicht wie beim Marxismus im Verhältnis zu anderen Klassen, nicht hinsichtlich ihrer Stellung im gesellschaftlichen Produktionsprozess bestimmt, sondern als soziologische Entität. Es variiert nur der Name der Entität – Massenarbeiter, gesellschaftlicher Arbeiter, Volk (bei den Anti-Imps der 80er), Multitude, Multiversum …
Zweitens ist der autonome Klassenbegriff subjektivistisch. Revolutionäres Subjekt ist, wer revolutionär handelt und zwar möglichst „unvereinnahmbar“. Daher können – je nach autonomer Schule – auch nicht-proletarische Klassen oder Schichten ebenso revolutionär sein wie das Proletariat.
Für den Marxismus hingegen ergibt sich der revolutionäre Charakter der Arbeiterklasse aus ihrer Stellung im Produktionsprozess. Zugleich erkennt der Marxismus, dass die Stellung der Arbeiterklasse als Klasse doppelt freier LohnarbeiterInnen auch eine systematische Verkehrung des Bewusstseins hervorbringt. Das spontane Arbeiterbewusstsein ist ein bürgerliches und dieser Fetisch kann nur durch die Vereinigung von wissenschaftlichem Sozialismus mit der Avantgarde der Klasse durchbrochen werden. Damit die Klasse von einer „Klasse an sich“ zu einer „Klasse für sich“ werden kann, bedarf es der Formierung einer revolutionären Partei.
c) Revolutionsverständnis
Für die Autonomen kann die Revolution jederzeit (oder nie) passieren, sie ist letztlich ein bloßer Willensakt des autonom konstituierten revolutionären Subjekts. Das revolutionäre Subjekt ist daher letztlich nichts als eine Ansammlung autonomer, bürgerlicher Individuen, die sich eben entschließen, die Revolution zu machen. Es gibt daher auch keine bestimmte Revolutionsvorstellung, keine Notwendigkeit einer Übergangsperiode und natürlich auch nicht einer revolutionären Avantgarde und Partei.
Für den Marxismus hingegen setzt die Revolution eine gesellschaftliche Krise voraus, die – in Lenins Worten – impliziert, dass sowohl die herrschende Klasse nicht mehr wie bisher herrschen kann, als auch die unterdrückte Klasse nicht mehr bereit ist, so zu leben wie bisher. Die Revolution ist also an objektive, vom bloßen Willen der Unterdrückten unabhängige Bedingungen gebunden.
Zugleich jedoch geht der Marxismus davon aus, dass das Klassenbewusstsein in der proletarischen Revolution im Unterschied zur bürgerlichen Revolution eine qualitativ größere Rolle spielt, weil die Arbeiterklasse im Kapitalismus eben nicht schon Strukturen einer sozialistischen, der kapitalistischen Produktionsweise überlegenen, Ökonomie entwickeln kann. Nur, wenn die Arbeiterklasse die politische Macht ergreift und in ihren Händen die Produktionsmittel hat, kann sie diese Umwälzung bewusst durchführen.
Um aber eine solche bewusste Umwälzung der Gesellschaft herbeiführen zu können, müssen sich die klassenbewussten Teile des Proletariats zu einer Kampfpartei formieren. Nur unter ihrer Führung können, die weniger bewussten Teile der Arbeiterklasse und andere, nicht-ausbeutende Klassen zu einer siegreichen Revolution geführt werden.
Für den Autonomismus spielt all das keine Rolle. Bei Roth wird man allmählich eine „Assoziation“ schaffen, bei Holloway „Risse“ und bei Negri hat die neue Produktionsweise, die der Menge, eigentlich schon gesiegt …
Bei den subjektivistischen Autonomen spielt das revolutionäre Bewusstsein, die Entwicklung der Arbeiterklasse zum bewussten revolutionären Subjekt eine viel geringere, bloß zufällige und eigentlich vernachlässigbare Rolle. Für den Marxismus hingegen ist das revolutionäre Bewusstsein, die bewusste Klassenführung eine unterlässliche, eine notwendige Bedingung der sozialistischen Revolution und des Übergangs zum Sozialismus.
d) Sozialismus als „Option“ oder als Notwendigkeit?
Für die Autonomen ist der Sozialismus eine „Option“, eine bloße Möglichkeit. Sie bewegen sich damit auf demselben Terrain wie ein großer Teil der bürgerlichen Sozialwissenschaft, die durchaus zugesteht, dass die Menschheit auch eine sozialistische Richtung „wählen“ könnte, ebenso gut aber bis in alle Ewigkeit für Kapitalismus, soziale Marktwirtschaft und bürgerliche Demokratie votieren könne.
Für den Marxismus ist der Sozialismus hingegen eine Notwendigkeit, auf dessen Errichtung die inneren Widersprüche des Kapitalismus selbst drängen. Darauf baut die kommunistische Bewegung letztlich ihr revolutionäres Programm, ein Programm, das eigentlich nur einen Weg weist, wie die Menschheit die von ihr geschaffenen produktiven Möglichkeiten realisieren kann, die der Kapitalismus längst nicht mehr weiterentwickelt und zunehmend unterminiert.
Weil die Autonomen kein Verständnis der inneren Widersprüche des Kapitalismus und der Mittel zu ihrer Lösung haben, sind ihre Sozialismusvorstellungen, ihre „Programme“ usw. auch immer wirr und beliebig. Daher auch das Schwanken der autonomen Bewegung von euphorischer Revolutionsstimmung zur tiefen Depression, ja nach politischer Konjunktur.
Der revolutionäre Kommunismus hingegen schöpft seinen geschichtlichen Optimismus nicht aus kurzfristigen Stimmungen oder aus dem unvermeidlichen Auf und Ab von Bewegungen. Sein Optimismus fußt auf der Gewissheit, dass sein Programm nichts mit willkürlicher Weltverbesserung zu tun hat, sondern nur dem zum bewussten Durchbruch verhilft, wohin die gesellschaftliche Entwicklung selbst strebt: zum Kommunismus.
Anmerkungen und Fußnoten
(1) Geronimo, Glut und Asche, Reflexionen zur Politik der Autonomen Bewegung, Münster 1997, S. 147
(2) Zur konterrevolutionären Rolle des Stalinismus bei der Herstellung der Nachkriegsordnung vergleiche auch die Analyse von Workers Power, unserer britischen Schwesterorganisation, aus den 1980er Jahren. Workers Power, Die Expansion des Stalinismus nach 1945, in: Aufstieg und Fall der Stalinismus, Broschüre der Gruppe Arbeitermacht, Berlin, Oktober 2009, Seite 13-24.
Zur Politik des Stalinismus in Italien: Fernando Claudin, Die Krise der Kommunistischen Bewegung, Bd 2. (Von der Komintern zur Kominform), S. 47 – 75, Berlin 1978
(3) Panzieri, Über die kapitalistische Anwendung der Maschinerie im Spätkapitalismus, QR, Nr. 1, 1961
(4) Marx, Kapital, Bd. 1, MEW 23, S. 350
(5) Marx, Kapital, Bd. 1, MEW 23, S. 351
(6) Panzieri, Über die kapitalistische Anwendung der Maschinerie im Spätkapitalismus, QR, 1, 1961
(7) Marx, Kapital, Bd. 1, MEW 23, S. 557
(8) Marx, Kapital, Bd. 1, MEW 23, S. 559
(9) Marx, Kapital, Bd. 1, MEW, 23, S. 559
(10) Marx, Kapital, Bd. 1, MEW 23, S. 469
(11) Marx, Kapital, Bd. 1, MEW 23, S. 468
(12) Mario Tronti, Fabrik und Gesellschaft, in: Quaderni Rossi , Nr. 2, 1962 (dtsch. in Mario Tronti, Arbeiter und Kapital, Verlag Neue Kritik, Frankfurt/M. 1974, S. 17-40
(13) Mario Tronti, Lenin in England, in: Classe Operaia , Nr. 1, 1964 (dtsch. in: Primo Moroni/Nanni Balestrini: Die goldene Horde. Arbeiterautonomie, Jugendrevolte und bewaffneter Kampf in Italien, Berlin: Assoziation A, 2002, S. 86-93
(14) Roberto Battaggia, Massenarbeiter und gesellschaftlicher Arbeiter – einige Bemerkungen
(15) Ebenda
(16) Alquati, Documenti sulla lotta die classe alle FIAT, zitiert nach Birkner/Flotin, (Post-)Operaismus, Juni 2006, S. 18/19
(17) Steve Wright, Den Himmel stürmen, Eine Theoriegeschichte des Operaismus, 2005, S. 173
(18) Geronimo, Feuer und Flamme, Zur Geschichte der Autonomen
(19) Agnoli, Langer Marsch, Februar 76
(20) Zu einer ausführlichen Darstellung von „Peoples Global Action“ und unserer Kritik siehe: LRKI (Liga für eine revolutionär-kommunistische Internationale, Vorläufer der Liga für die Fünfte Internationale), Globalisierung, Antikapitalismus und Krieg. Ursprünge und Perspektiven einer Bewegung, Berlin, 2001, S. 34-39
(21) An dieser Stelle wollen wir uns eine grundlegende Kritik dieser Konzeption sparen, da wir diese schon in einem früheren Artikel dargelegt haben. Siehe dazu: Rodney Edvinsson/Keith Harvey, Empire: Jenseits des Imperialismus?, in Revolutionärer Marxismus 33, S. 5-56
(22) Hardt/Negri, Empire, Frankfurt/Main 2002, S. 12/13
(23) Ebenda, S. 41
(24) Ebenda, S. 373
(25) Ebenda, S. 374
(26) Ebenda, S. 368/369
(27) Ebenda, S. 415
(28) Ebenda, S. 417
(29) Ebenda, S. 403-7
(30) Ebenda, S. 409
(31) Ebenda, S. 410
(32) Ebenda, S. 413
(33) Ebenda, S. 413
(34) Ebenda, S. 392
(35) Negri, Interview im Neuen Deutschland, 12.12.09
(36) Ebenda
(37) Ebenda
(38) Ebenda
(39) Ebenda
(40) Holloway, Schritt in die falsche Richtung oder Mephisto statt Franz von Assisi, veröffentlicht auf: http://www.wildcat-www.de/material/rhe8holl.htm
(41) Holloway, Wir sind die Krise der abstrakten Arbeit, http://www.grundrisse.net/grundrisse18/john_holloway.htm
(42) Ebenda
(43) Marx, Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie, MEW 1, S. 201-336
(44) Holloway, Wir sind die Krise der abstrakten Arbeit
(45) Ebenda
(46) Ebenda
(47) May Day 2009, http://maydayberlin.blogsport.de/propaganda/
(48) Kollektiv Rage, Die Zeit der Forderungen ist vorbei, Hamburg 2009
(49) Ingrid Artus, die Novemberrevolte, in: Kollektiv Rage, Die Zeit der Forderungen ist vorbei, Hamburg 2009, Seite 47
(50) Marius von der Lubbe, Ihr könnt uns nicht mehr umbringen – wie sind schon tot, in: Kollektiv Rage, Die Zeit der Forderungen ist vorbei, Hamburg 2009, Seite 178
(51) Die Zeit der Forderungen ist vorbei, Flugblatt zum Bildungsstreik, November 2009, Unterstützer des Aufrufs: Antifaschistische Jugendaktion Kreuzberg [AJAK], Antifaschistische Initiative Reinickendorf [AIR], Antifaschistische Revolutionäre Aktion Berlin [arab], Antifaschistische Linke Berlin [ALB]
(52) Karl Heinz Roth, Globale Krise – Globale Proletarisierung – Gegenperspektiven
Zusammenfassung der ersten Ergebnisse – Stand: 21.12.08, http://www.wildcat-www.de/aktuell/a068_khroth_krise.htm
(53) Ebenda
(54) Ebenda
(55) L5I, Revolutionärer Marxismus Nr. 39, Finanzmarktkrise und fallende Profitraten. Beiträge zur Marxistischen Imperialismus- und Krisentheorie, Berlin/Wien, August 2008
(56) Robert Brenner, Boom & Bubble, Hamburg 2003
(57) Karl Heinz Roth, Globale Krise – Globale Proletarisierung – Gegenperspektiven
(58) Ebenda
(59) Ebenda
(60) Ebenda
(61) Ebenda
(62) Ebenda
(63) Trotzki, Der Todeskampf des Kapitalismus und die Aufgaben der IV. Internationale (Übergangsprogramm), in: Trotzki, Das Übergangsprogramm, Essen 1997, S. 86/87
(64) Karl Heinz Roth, Globale Krise – Globale Proletarisierung – Gegenperspektiven
(65) Ebenda
(66) Ebenda
(67) Ebenda
(68) Ebenda
(69) Ebenda
(70) Ebenda
(71) Ebenda