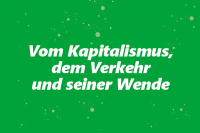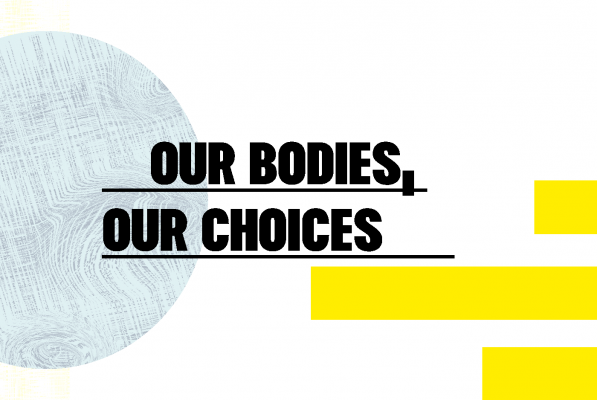Tag Archives
Bis es knirscht und knallt: Marodierende Verkehrsinfrastruktur im Autoland Deutschland
Leo Drais, Infomail 1280, 21. April 2025 Am 11. September letzten Jahres stürzte nachts der Straßenbahnteil der Dresdner Carolabrücke ein, kurz nachdem eine …
Rückblick auf 2024 und Perspektiven für 2025
Liga für die Fünfte Internationale, Infomail 1272, 1. Januar 2025 Im Jahr 2024 verschärfte sich das, was oft als „Mehrfachkrise“ bezeichnet wird – …
La DANA – Flutkatastrophe in Spanien
Frieda Koppler, Infomail 1269, 13. November 2024 Mehr als 200 Menschen starben, fast 80 werden vermisst, viele haben alles verloren. Am 29. Oktober wurde der …
Degrowth: Grüne Alternative zum Kapitalismus?
Alex Zora, Infomail 1229, 1. August 2023 Wer sich in den letzten Jahren mit den Themen Klima, Umweltschutz und Nachhaltigkeit auseinandergesetzt hat, wird …
Klimawandel: Der nächste Waldbrandsommer?
Leo Drais, Neue Internationale 275, Juli/August 2023 Verschwunden sind die Rauchfahnen südlich von Berlin. Nach zwei langen Wochen konnte das Feuer im …
European Gas Conference
REVOLUTION Austria, Infomail 1220, 14. April 2023 5.000 Menschen, darunter Genoss:innen des Arbeiter*innenstandpunkt und von REVOLUTION Austria, demonstrierten …
Lützi bleibt! Tagebuch von Aktivist:innen
Genoss:innen von Arbeiter:innenmacht und REVOLUTION beteiligen sich an den Aktionen und Demonstrationen gegen die Räumung von Lützerath. Hier ihre Eindrücke …
Klimakatastrophenbewältigung auf kapitalistisch: ein Jahr nach der Flut im Ahrtal
Joshua Kornblum, Neue Internationale 266, Juli/August 2022 Etwa ein Jahr ist es nun her, dass sich die Flut in der Region um Ahrweiler ereignet hat. Eine …
Umweltbewegung: Der Krieg bringt die Energiewende?
Joshua Kornblum, Neue Internationale 263, April 2022 Während es noch bis Anfang diesen Jahres angeblich keine Möglichkeiten, kein Geld, keine Mehrheiten für …
Strategiepapier der Linkspartei: Nicht einmal alter Wein in neuen Schläuchen
Susanne Kühn, Neue Internationale 262, Februar 2022 DIE LINKE beschwört einmal mehr den Aufbruch. Das tun schließlich alle Parteien, die gerade eine …