Imperialismustheorie und Neokolonialismus
Markus Lehner, Revolutionärer Marxismus 53, November 2020
Ausgangspunkt der klassischen Imperialismustheorie war die Aufteilung der Welt unter große Kolonialimperien. Auch wenn sich diese als nicht so langlebig erwiesen wie von vielen erwartet, so war ihr Erscheinen ein wesentlicher Wendepunkt in der Globalgeschichte, der noch bis heute in Formen nachwirkt, die sich als „Neokolonialismus“ bezeichnen lassen. Die Analysen der Imperialismustheorie können daher mit gewissen Modifikationen in der Ära der postkolonialen Welt fortgeschrieben werden.
Kolonialismus und „Dekolonisation“
Der Imperialismus als System der politischen und ökonomischen Weltordnung des Kapitals hat eine lange Vorgeschichte, in der die von Anfang an im Begriff des Kapitals gegebene Weltmarktorientierung [i] zur materiellen Wirklichkeit wurde. Der Handelsimperialismus [ii], der seit der frühen Neuzeit die Grundlagen eines kapitalistischen Weltmarktes unter europäischer Dominanz schuf, hatte zuvor im Wesentlichen ein Netz von Handelsstützpunkten und Siedlerkolonien hervorgebracht. Die ersten großen Aktiengesellschaften, wie die niederländische und britische Ostindiengesellschaft, organisierten ihre präkolonialen Aktivitäten sogar in militärischen Fragen noch selbst. Umfangreicher werdende Geschäfte, Durchbrechen der Monopolstellung dieser Gesellschaften, wachsende Konkurrenz und Widerstände der Betroffenen auf der einen Seite und die Schaffung „moderner“ Staatsapparate im Zeitalter des Merkantilismus auf der anderen Seite führten zu einer wachsenden Rolle staatlicher Strukturen in der europäischen Kolonialpolitik des 18. Jahrhunderts. In den Siedlerkolonien des amerikanischen Kontinents löste der Versuch einer strikteren kolonialen Kontrolle (z. B. in Verwaltung und Steuerpolitik) heftigen Widerstand der dort bereits sich entwickelnden starken bürgerlichen Kräfte aus, der letztlich in die Unabhängigkeit der USA und der lateinamerikanischen Republiken (rund 50 Jahre später) führte [iii]. In Asien, wo die Kräfte der bürgerlichen Selbstständigkeit nicht so weit entwickelt waren, gelang den dort intervenierenden europäischen Großmächten jedoch die Umwandlung von Handelsdominanz in direkte koloniale Kontrolle. Im Lauf des 19. Jahrhunderts zwang die Dynamik der Kapitalakkumulation im Rahmen der Entstehung eines industriellen Kapitalismus und der Konkurrenz auf dem Weltmarkt die großen Kapitale zu einer Form der direkteren Kontrolle ihrer Absatz- und Rohstoffmärkte in Form von „Kolonialreichen“, die ihren Höhepunkt in der Aufteilung Afrikas fand. Gleichzeitig wurden formal unabhängige Regionen, wie Lateinamerika oder Ostasien, dort in der Gestalt des „Freihandelsimperialismus“ [iv] in dieses System der Aufteilung der Welt eingegliedert und seit Mitte des 19. Jahrhunderts de facto zu „Halbkolonien“. Den USA gelang es, durch ihre starke eigenständige kapitalistische Entwicklung gegen Ende des Jahrhunderts aufzuschließen und sich am bröckelnden kolonialen Erbe Spaniens zu bedienen (Philippinen, Kuba) bzw. Großbritannien in der halbkolonialen Dominanz Lateinamerikas abzulösen.
Im 19. Jahrhundert brachte also eine kleine Zahl europäischer Staaten (später gefolgt von den USA) den Rest der Welt in geradezu „lachhaft leichter Weise“ [v] unter ihre Kontrolle. Sofern sie die anderen Länder nicht unmittelbar besetzten und beherrschten, garantierten ihre ökonomischen, technischen und militärischen Möglichkeiten eine unangefochtene Vormachtstellung. Große alte Kulturregionen wie Indien wurden zu Anhängseln eines kleinen nordatlantischen Inselstaates, so wie China als ältestes Reich Asiens zu einem Spielball europäischer Mächte verkam. Nur im äußersten Nordwesten des Pazifiks gelang es mit Japan, einer Region sich der imperialistischen Expansion „des Westens“ entgegenzusetzen und eine eigenständige kapitalistische Entwicklung einzuschlagen. Aber selbst diese Ausnahme bestätigte die anscheinende Überlegenheit des westlichen „Entwicklungsmodells“ und einer „Modernisierung“ auf der Grundlage von Kapital, westlicher Wissenschaft und staatlicher Organisation. Später wirkte sogar die bürokratisch degenerierte Sowjetunion in der kolonialen Welt wie ein alternatives Vorbild staatlich dominierter Modernisierungspolitik zwecks „nachholender Entwicklung“.
Die Entwicklungen vom Beginn des Ersten bis Ende des Zweiten Weltkriegs veränderten die Bedingungen dieses Kolonialimperialismus wesentlich. Ähnlich wie im Fall von Lateinamerika während und nach den napoleonischen Kriegen bedeutete die Schwächung der zentralen Kolonialmächte im Rahmen der Weltkriege ein Fenster für mehr ökonomische und politische Eigenentwicklung. Zudem boten der Aufstieg der USA und die Stabilisierung der Sowjetunion Perspektiven für eine Überwindung der europäischen Kolonialreiche, indem von dort Unterstützung für neue, „unabhängige“ Staaten erwartet wurde. Letztlich waren Ereignisse, wie die Weltwirtschaftskrise nach 1929, wesentliche Einschnitte: Bis dahin hatten die Kolonialregime zumindest für stabile Wachstumsraten gesorgt, durch die zumindest die Eliten in den Kolonialländern gesicherte Vermögen aufbauen konnten. Kriegskonjunkturen und Weltwirtschaftskrise führten dazu, dass in den Kolonialländern die Autonomie- und Unabhängigkeitsbewegungen speziell ab den 1930er Jahren immer mehr Auftrieb bekamen. Der Zusammenbruch des Goldwährungssystems und der von Britannien dominierten Welthandelsordnung führte schließlich dazu, dass auch die führenden Kolonialmächte mit einem Ende des alten Kolonialregimes rechnen mussten. Dass dies kein friedlicher und an der eigenständigen Entwicklung der ehemaligen Kolonien interessierter Prozess werden würde, ist klar. Wenn man die Kolonien schon nicht halten konnte, so wurden genug Vorkehrungen getroffen, damit der globale Norden unter der neuen US-amerikanischen Führung die Verhältnisse in den neuen Ländern wesentlich mitbestimmt, insbesondere was die „Offenheit der Märkte“ betrifft. Wie man an der belgischen Börse angesichts der Unabhängigkeit des Kongos bemerkte: „Wir gehen, um zu bleiben“ [vi].
Mit dem zweiten Weltkrieg hatten die USA Großbritannien als Hegemon unter den kapitalistischen Mächten abgelöst, während Frankreich und Britannien weiterhin riesige Kolonialreiche unter immer größeren Kosten aufrechterhielten. Noch 1943 hatte die US-Regierung für die Nachkriegszeit eine rasche Dekolonisation angekündigt und dafür ein „Treuhandschaftsprogramm“ entworfen [vii]. Dabei sollten die damals geplanten „Vereinten Nationen“ die Treuhandschaft über die Kolonien übernehmen und diese letztlich auch über den Zeitpunkt der vollständigen Unabhängigkeit entscheiden. Im Gefolge des Siegs im Pazifikkrieg hintertrieben die USA selbst rasch diese Perspektive, indem sie den Pazifik in eine US-kontrollierte Zone mit Militärstützpunkten und abhängigen Regierungen verwandelten. Im Gefolge des sich entwickelnden Kalten Krieges schwächten die USA schnell ihr Dekolonisationsprogramm ab. Nur die ehemaligen Völkerbundmandate endeten im Treuhandprogramm (mit „Erfolgen“ wie in der Palästina-Frage sichtbar). Für die restlichen Kolonien wurde „Selbstverwaltung“, nicht Unabhängigkeit zum Ziel erklärt – wobei der Prozess zur Entwicklung der Selbstverwaltung den Kolonialmächten selbst überlassen wurde! Somit wurde ein langwieriger Prozess zumeist gewaltsamer Konflikte in Gang gesetzt, der die UNO bloß zur Bühne des Interessenausgleichs zwischen den Großmächten machte. Algerien, Südkorea, Indochina waren die Spitze dieses äußerst blutigen Prozesses, in dem die alten Kolonialmächte ihre Privilegien mit Zähnen und Klauen verteidigten, während die USA (wie in der Suez-Krise und Vietnam deutlich zu sehen), politisch-militärisch längst ihre Stelle eingenommen hatten. Eine „Unabhängigkeit“, die unter diesen Bedingungen erworben wurde, war von vornherein ein schlechter Ausgangspunkt.
Der Prozess der „Dekolonisation“ änderte jedenfalls zwischen 1945 und Anfang der 1960er Jahre die politische Landkarte des Globus dramatisch. Die Zahl der unabhängigen Staaten in Asien verfünffachte sich, in Afrika stieg sie von gerade einem auf ungefähr 50. Dazu kamen noch mehrere in Lateinamerika und der Karibik, zusätzlich zu den „unabhängigen“ Republiken aus Bolivars Zeiten. Einerseits hatte sich damit die europäische Form staatlicher Organisierung in Form des „Nationalstaates“ global durchgesetzt – mitsamt den damit verbundenen „Nationalitätenkonflikten“. Andererseits führten der Aufbau moderner Gesundheitssysteme und die ersten Phasen der Unabhängigkeitskonjunkturen zu einer Verschiebung der globalen Demographie: Im Zeitalter der Industrialisierung zu Beginn des 19. Jahrhunderts war es Europa, das eine Bevölkerungsexplosion im Vergleich zum Rest der Welt aufwies (von 20 % der Weltbevölkerung 1750 auf etwa ein Drittel um 1900); im Zeitalter der Dekolonisation verschob sich das Epizentrum der Bevölkerungsexplosion nach Asien und Afrika – Ende der 1980er Jahre lebten in den „entwickelten“ OECD-Staaten nur noch 15 % der Weltbevölkerung.
Trotz dieser quantitativen Verschiebung, was Zahl der Staaten und der Bevölkerung betraf, änderte sich an den ökonomischen Verhältnissen während des „großen Booms“ der Nachkriegszeit zunächst wenig. Noch 1960 (und heute unvorstellbar) produzierten die industriellen Kernzentren in Westeuropa und Nordamerika über 70 % des globalen realen Sozialprodukts und 80 % des industriellen Mehrwerts. Die neuen „unabhängigen“ Staaten wurden wie zu Zeiten des Kolonialismus weiterhin auf ihre Rolle als Rohstofflieferanten, Agrarländer und Absatzmärkte reduziert, was sich durch mehrere gescheiterte Projekte zum Aufbau eigenständiger Industrien in vielen dieser Länder noch verstärkte – das Industriemonopol des „Westens“ schien sich sogar noch zu verstärken. Nicht zuletzt deswegen erschien der Weg der Sowjetunion oder Chinas für eine wachsende Zahl politischer Kräfte in der postkolonialen Welt seit den 1960er Jahren, insbesondere im Gefolge der kubanischen Revolution, als einziger Ausweg aus der „Unterentwicklungsfalle“ der neuen, durch die USA bestimmten Weltwirtschaftsordnung.
Dabei ist das weiterbestehende Ungleichgewicht auf den Weltmärkten nur eine der Folgen des ungerechten Dekolonisationsprozesses. Die staatlichen Strukturen und Verwaltungen wurden wesentlich von den Kolonialmächten übernommen, mitsamt geringen Mitteln für soziale Sicherung, Bildung, Gesundheit, Renten, etc., aber genug für Militär und Korruption. Dazu kamen nicht gelöste nationale Konflikte, gut genutzt als Herrschaftsmittel der KolonialherrInnen, nun Mittel zum Aufbau neuer Unterdrückungsapparate. Dazu kam eine Klassenstruktur mit mehr oder weniger schwacher Bourgeoisie (entsprechend dem Grad der Kapitalentwicklung außerhalb des staatlichen Sektors) und geringer Entwicklung eines qualifizierten Industrieproletariats. Darüber hinaus wurden die internationalen Institutionen von der UNO bis zur Weltbank und dem Internationalen Währungsfonds nicht die versprochenen Fördererinnen der Entwicklung der neuen unabhängigen Staaten. Vielmehr sind sie Sicherungsorgane der internationalen Ordnung im Interesse der großen Mächte und der mit ihnen verbundenen Kapitalgruppen. Militärisch gesehen zogen die alten Kolonialmächte zwar ab – dafür aber wird die Welt von einem Netz von Stützpunkten der USA (und ihrer Verbündeten) überzogen, von überall einsetzbaren Flottenverbänden und Einsatzkräften genutzt, die immer wieder letztlich für die Aufrechterhaltung der imperialen Ordnung sorgen. Diese Weltordnung, wie sie nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist und nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion nunmehr alleinig von den USA dominiert wird, ist zwar kein unmittelbares Kolonialreich mehr – es kann aber nur als neokolonialistischer Imperialismus bezeichnet werden.
Theorie der „abhängigen Entwicklung“
Theoretisch gesehen stellte sich die Frage, ob Lenins Imperialismustheorie, die auf die Kritik des Kolonialsystems bezogen war, für das Zeitalter der Dekolonisation noch ausreichend ist. Insbesondere zur Erklärung der wachsenden Kluft der dekolonisierten Welt zu den herrschenden „Industrienationen“ entstand, zunächst vor allem in den Amerikas, eine ökonomische Theorie der „Dependenz“, von nachkolonialer Entwicklung als einer vor allem von Abhängigkeit (aufgrund des spanischen Originals oft auch als Dependencia-Theorie bezeichnet). Diese Strömung in den ökonomischen Wissenschaften umfasste sowohl marxistische AutorInnen, wie André Gunder Frank, wie auch ÖkonomInnen, die in bürgerlichen Institutionen tätig waren (wie der argentinische UN-Ökonom Raúl Prebisch oder der spätere brasilianische Staatspräsident Cardoso).
Ein wichtiger Ausgangspunkt war das Prebisch-Singer-Theorem. Die beiden Ökonomen waren nach 1945 wichtige ökonomische Berater der UN-Institutionen, die für Lateinamerika und Afrika die internationalen „Entwicklungsprojekte“ koordinierten bzw. in den wissenschaftlichen Debatten dazu eine wichtige Rolle spielten [viii]. Das Prebisch-Singer-Theorem geht von einer Unterscheidung von „Industrienationen“ und „Entwicklungsländern“ aus und untersucht statistisch die Veränderung der Außenhandelsbeziehungen zwischen diesen beiden Blöcken in Form der „Terms of Trade“ (ToT), der realen Austauschverhältnisse. Dabei werden die Preise von Export- und Importgütern (nach Währungsumrechnung) im Verhältnis zur Masse des Warenaustausches gesetzt – also wird z. B. berechnet, wieviel Tonnen Kaffee ein Entwicklungsland im Austausch zum Import eines Autos aus einem Industrieland exportieren muss. Die These, zu der die beiden Ökonomen kamen, war, dass sich auf lange Sicht die ToT von Entwicklungsländern systematisch verschlechtern. Diese These widerspricht fundamental einem der wichtigsten Theoreme der klassischen politischen Ökonomie und Freihandelstheorie, dem von den „komparativen Kostenvorteilen“ David Ricardos. Danach müsste die Öffnung des Handels zwischen zwei Staaten (oder Blöcken) zu einer internationalen Arbeitsteilung führen, von der beide profitieren, indem sich beide jeweils auf das Gebiet konzentrieren, dass sie am besten beherrschen. Dagegen bedeutet die kontinuierliche Verschlechterung der ToT, dass die Entwicklungsländer immer mehr von ihren Produkten, z. B. mehr Tonnen Kaffee, exportieren müssen, um die gleiche Menge an Industrieprodukten, z. B. Anzahl von Autos, importieren zu können. Dies bedeutet, dass sie immer mehr ihrer Arbeitskräfte und natürlichen Ressourcen einsetzen müssen, um ihre Entwicklung vorantreiben zu können. Die internationale Arbeitsteilung durch ihre Öffnung zum Weltmarkt wird für sie daher zum Hemmnis, nicht zum Antrieb ihrer Entwicklung.
Die Prebisch-Singer-These kennt in ihren Begründungszusammenhängen zwei Versionen. Einerseits was die Gütermärkte betrifft: Peripherieländer sind vor allem von Primärgütermärkten abhängig. Diese sind von der Nachfrageseite her „unelastischer“ als die Industriegütermärkte, so dass mit wachsenden Einkommen die Nachfrage nach Primärgütern hinter derjenigen nach Industriegütern hinterherhinkt. Andererseits ist in Bezug auf die Angebotsseite die Konkurrenz unter Primärgüter-LieferantInnen vielfach größer als in der mehr monopolisierten Industriegüterproduktion. Preiserhöhungen sind im letzteren Sektor also viel leichter durchzusetzen. Zudem führen Produktivitätsfortschritte zu einer relativen Absenkung der Nachfrage nach Rohstoffen, während Industrieprodukte sogar in größerer Zahl angeboten und nachgefragt werden können (bessere Qualität, neue Produktsparten).
In ihrer zweiten Version bezieht sich die These auf die „Faktormärkte“ Kapital und Arbeit: Sinkendes Volumen des Primärsektors und geringe andere Arbeitsmöglichkeiten (aufgrund des niedrigeren Grades an Industrialisierung) führen zu einem Arbeitskräfteüberangebot, das zu einem langfristig niedrigen Lohnniveau führt. Gleichzeitig wird so das periphere Kapital in Niedriglohnsektoren und Primärgüterbereiche gedrängt oder findet in den Industrieländern profitablere Anlage als in einheimischer höherwertiger Produktion. Auch damit kommt es zu einer langfristig schlechteren Entwicklung der Exportpreise der Peripherieländer gegenüber den Importpreisen, also zu einer Verschlechterung der ToT.
Die Konsequenzen der „Entwicklungsökonomen“ aus diesen Zusammenhängen liegen damit auf der Hand:
Die Peripherieländer müssen eine bewusste, staatlich gesteuerte Industrialisierungspolitik betreiben, die einerseits auf den Export ausgerichtet ist, andererseits Importe aus den Industrieländern durch einheimische Produkte ersetzt. Diese Politik muss einerseits durch protektionistische Maßnahmen (Zölle, Einfuhrbeschränkungen, Subventionen, Steuerpolitik etc.) unterstützt werden. In bestimmten Sektoren wurde auch eine Verstaatlichung für notwendig angesehen (z. B. in der Ölindustrie). Andererseits wurde auf „internationale Institutionen“, wie die UNO und die Weltbank, gehofft, um die nötige Anschubfinanzierung in Form von günstigen Krediten zu leisten, einer Art Marschallplan für die dekolonialisierte Welt.
Dieses Programm erwies sich schon in den 1960er Jahren, spätestens aber seit der Weltwirtschaftskrise Mitte der 1970er Jahre als illusorisch. Ein solches Programm stieß auf entschiedenen Widerstand der US-geführten Industrienationen. Protektionismus oder gar Nationalisierungen wurden mit harten Gegenmaßnahmen beantwortet (man denke an den Wirtschaftskrieg gegen den Iran in den 1950er Jahren, als dieser seine Erdölindustrie nationalisierte, gefolgt vom Sturz der Mossadegh-Regierung durch US-Intervention). Und natürlich wurde Kreditvergabe an die weitere „Öffnung“ der Märkte gebunden. Das führte letztlich dazu, dass die Industrialisierungspolitik der Nachkriegsperiode in den Peripherieländern zu einer extremen Verschuldung führte, ohne dass konkurrenzfähige Industrien entstanden waren. Mit der weltweiten Rezession nach 1974 und der ausbrechenden „Schuldenkrise“ in den meisten Peripherieländern musste dann umso mehr unter schlechten Bedingungen für den Export gearbeitet werden, um die Entschuldungspläne der „internationalen Institutionen“ zu erfüllen. Was von den aufgebauten Industrien bzw. der entsprechenden IndustriearbeiterInnenschaft übrig blieb, wurde so wiederum zu einem für die Konzerne des Nordens billig aufkaufbaren Element für die internationalen Produktionsketten, die danach aufgebaut wurden. So hatte sich auch die „Industrialisierungspolitik“ letztlich für die Peripherieländer als Falle erwiesen.
Abgesehen von dieser Kritik an den wirtschaftspolitischen Konsequenzen der Grundthesen der „Entwicklungsökonomie“ gab es schon in Bezug auf die Prebisch-Singer-These selbst eine langwierige Diskussion. Neoliberale ÖkonomInnen leugneten bzw. leugnen bis heute die Tatsache einer Tendenz zur Verschlechterung der ToT für periphere Länder. Dies wurde im Wesentlichen als „lateinamerikanische Häresie“ an der Ricardo’schen Lehre angesehen, die man durch einige Modifikationen in die neue Epoche zu retten suchte. Tatsächlich gab es einige Mängel in der statistischen Methode von Prebisch und Singer (nicht zuletzt waren die Welthandelsstatistiken für die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts bei weitem nicht so genau wie heute). Sicherlich war auch die Vereinfachung – Entwicklungsländer = Primärsektor / entwickelte Länder = Industriesektor – eine Verzerrung der Realität. Tatsächlich ging es aber um eine Tendenz, die Länder, die auf bestimmte Gütermärkte angewiesen sind, gegenüber anderen Ländern benachteiligen. Noch dazu gibt die zweite Version der Prebisch-Singer-These, die sich auf die Faktormärkte bezieht, auch die Möglichkeit, industrialisierte Peripherieländer in die ToT-Berechnung mit einzubeziehen – hier geht es dann um den Vergleich von Industrieproduktion in unterschiedlichen Stufen der Wertschöpfungskette (von Hochtechnologieprodukten bis herunter zu Teilezulieferung).
In einem Aufsatz [ix] von Ocampo und Parra (beides aus Kolumbien stammende ÖkonomInnen, die in jüngerer Zeit die UN-Posten von Prebisch und Singer einnahmen) wird die jahrzehntelange Debatte um die These ausführlich zusammengefasst. Erstaunlich ist insbesondere, dass die meisten statistischen Untersuchungen über längere Zeiträume im 20. Jahrhundert die These weitgehend bestätigt haben (Ocampo/Parra diskutieren 25 dieser Studien). Dies trifft auch auf eine großangelegte Studie zu, die ausgerechnet von der Weltbank (die ja gleichzeitig eine Politik der Handelsöffnung betreibt) initiiert wurde, und mit den Statistiken dieser Institution arbeitete. Diese Studie von Grilli/Yang hat Zeitreihen von 24 Weltmarktgütern und 7 darauf basierenden Marktindizes aufgestellt und dabei festgestellt, dass es zwischen 1900 und 1986 zu einer jährlichen durchschnittlichen Verschlechterung von 0,6 % der ToT zwischen Peripherie- und Zentrumsländern kam.
Ocampo/Parra stellen aber zu Recht fest, dass diese Verschlechterung der ToT keineswegs so linear erfolgt, wie dies die Prebisch-Singer-These erwarten ließe. Vielmehr gibt es bestimmte „Wendepunkte“, an denen diese generelle Tendenz hervortritt und für längere Zeit zu einer solchen Verschlechterung führt, um dann wieder für eine Periode „ausgesetzt“ zu sein. Dies wird an der Aggregation von Preisindizes zu den Austauschverhältnissen zwischen „entwickelten“ und „peripheren“ Ökonomien gezeigt (Abbildung 1). Hier wird einerseits deutlich, dass die Austauschverhältnisse bis zum Ersten Weltkrieg durchaus günstig waren, vor allem durch die Fortschritte im Transportsektor. Dies ist sicherlich mit einer der Gründe, warum sich bis dahin direkter Kolonialismus zur Sicherung von Handelsüberschüssen lohnte bzw. Teile Lateinamerikas auf dem aufsteigenden Ast zu sein schienen. Mit dem Ersten Weltkrieg, der sowohl einen weltwirtschaftlichen Niedergang, Währungskrisen und Rohstoff sparende Produktivitätsfortschritte nach sich zog, sehen wir den ersten langfristigen Bruch in den Austauschverhältnissen. Offensichtlich war der Zweite Weltkrieg bis hin zum „Korea-Boom“ (Ende des Korea-Kriegs) mit Hoffnungen auf Verbesserungen in den Bedingungen auf dem Weltmarkt für die „dekolonialisierte“ Welt verbunden. Dagegen folgte aber während des sogenannten „Nachkriegsbooms“ für die periphere Welt eine langwierige Stagnation, gefolgt vom nächsten strukturellen Bruch: Mit der Verschuldungskrise der 1980er Jahre fielen die Austauschverhältnisse nochmals auf ein längerfristig niedrigeres Niveau. Interessant ist, dass sich Ähnliches auch von den industriellen Sektoren in den peripheren Ländern sagen lässt. Die Abbildung zeigt ab den 1980er Jahren das Verhältnis von Preisen in der verarbeitenden Industrie in den beiden Hemisphären, das sich parallel mit dem für die Gütermärkte ebenso zu Lasten der peripheren Seite verschlechterte – ein deutliches Zeichen dafür, dass die wachsenden Industriesektoren dort Auslagerungen in den untergeordneten Bereichen der internationalen Produktionsketten darstellen. Schließlich mach sich Ende der 1990er Jahre eine Stabilisierung der Gütermärkte durch den Aufstieg der chinesischen Ökonomie bemerkbar. Die statistischen Daten für die Periode, die der großen Rezession von 2009 gefolgt ist, deuten jedoch auf einen neuerlichen strukturellen Bruch hin, der viele der peripheren Länder unter starken ökonomischen Druck gesetzt hat.
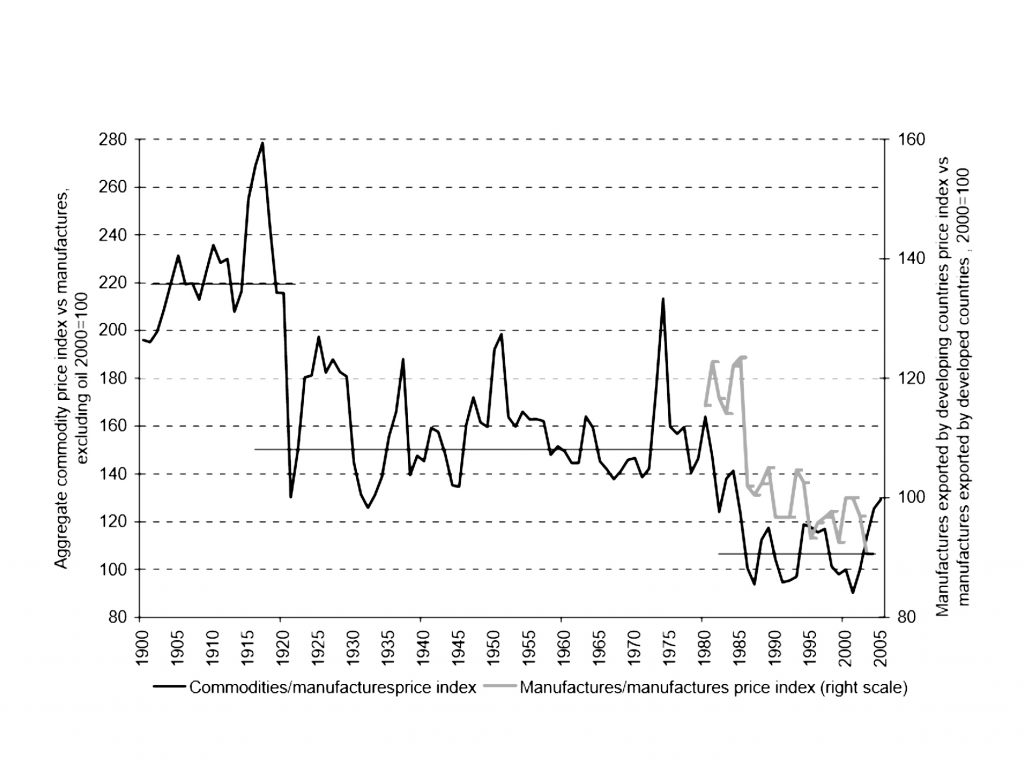
Abbildung 1 Relative Preisindizes auf dem Weltmarkt
Die Prebisch-Singer-These bleibt also empirisch relevant auch in einer Periode, in der die peripheren Ökonomien nicht mehr einfach auf das Etikett „Rohstofflieferantinnen“ reduziert werden können. Dabei muss betont werden, dass trotz „Tigerstaaten“ und Aufstieg der „Newly Industrialized Countries“ (NICs) für einen großen Teil der peripheren Welt der Export von Rohstoffen und natürlichen Ressourcen weiterhin wesentlich ist: Ostasien ausgenommen, machen für Südostasien, Lateinamerika, Nordafrika und den Nahen Osten diese weiterhin 40 % ihres Exports aus, während es für das subsaharische Afrika und die „Least Developed Countries“ (LDC) sogar noch über 50 % sind. Mit der Ausnahme Chinas und Südkoreas fallen jedoch auch die meisten in der Globalisierungsperiode geschaffenen Industriesektoren in der peripheren Welt in die Kategorie der oben dargestellten ungünstigen Austauschverhältnisse.
Tatsächlich aber bleibt das Prebisch-Singer-Theorem auch in seinen Erklärungsversuchen an der Oberfläche der (Welt-)Marktbewegungen haften, ohne auf die Wurzeln der abhängigen Entwicklung auf der Grundlage einer Kapitalismusanalyse einzugehen. Dies versuchten die linken VertreterInnen der Dependenztheorie, insbesondere durch einen Bezug auf eine Theorie des „Monopolkapitalismus“. Diese soll deshalb als Nächstes behandelt werden.
„Monopolkapitalismus“ und die „Entwicklung von Unterentwicklung“
Im Jahr 1965 erschien in der legendären „Monthly Review“[x] das Buch „Kapitalismus und Unterentwicklung in Lateinamerika“[xi] von André Gunder Frank. Frank war, wie er im Vorwort selbst schreibt, als Sohn einer US-Mittelstandsfamilie und Doktorand bei dem erzliberalen Milton Friedman, in ökonomischer Beraterfunktion Anfang der 1960er Jahre nach Afrika und Lateinamerika gekommen. Dort bemerkte er schnell die Funktion dieser „Beratertätigkeit“ und das Ungenügen von Erklärungen der Entwicklungsprobleme über „vormoderne“ Investitions- und Mentalitätshemmnisse, die mit Liberalisierung (insbesondere in Bezug auf den Außenhandel) und „Bildungspolitik“ zu überwinden seien. Erkennend, dass weder die weltwirtschaftlichen Institutionen noch die einheimische Bourgeoisie in der Lage waren, die systematische Benachteiligung dieser Länder zu überwinden, kam er zu dem Schluss: „Die historische Aufgabe der Bourgeoisie in Lateinamerika – die darin bestand, die Unterentwicklung ihrer Gesellschaft und ihrer eigenen Lage zu fördern und zu überwachen – diese Rolle ist ausgespielt. In Lateinamerika wie auch sonst wo ist nun die Rolle der geschichtstreibenden Kraft den Massen des Volkes selbst zugefallen“ [xii]. Um eine politisch wirksame Theorie der Unterentwicklung aufzustellen, meint Frank, „musste ich meine liberalen Lebensformen und meine Metropolenumgebung aufgeben und in die unterentwickelten Länder gehen. Dort nur konnte ich die tatsächliche politische Wissenschaft und politische Ökonomie im klassisch vorliberalen und marxistisch postliberalen Sinn begreifen lernen“ [xiii].
Zentraler Ausgangspunkt für Franks These von der „Entwicklung der Unterentwicklung“ sind die weltweiten Strukturen des Monopolkapitalismus. Dies wird schon aus den Erklärungsmustern der Prebisch-Singer-These verständlich: Wenn die Austauschverhältnisse zwischen den Metropolen und der Peripherie durch die ungünstige Branchenstruktur in letzteren gegenüber ersteren derart nachteilig sind, was verhindert die Veränderung dieser Struktur? Eine Erklärung ist die zähe Verteidigung dieser Strukturen durch die großen wirtschaftlichen Konglomerate in den Metropolen, mitsamt deren Satelliten in den untergeordneten Ländern [xiv] (hier am Beispiel von Chile): „Wie wettbewerbsorientiert die Wirtschaftsstruktur in den Metropolen in allen ihren Entwicklungsstadien auch gewesen sein mag, so war doch die Struktur des weltkapitalistischen Systems als Ganzes, während der ganzen Geschichte der kapitalistischen Entwicklung in höchstem Grad monopolistisch. Deshalb hat das externe Monopolwesen immer zur Enteignung … eines bedeutenden Teils des in Chile produzierten Surplus geführt … Die kapitalistische Monopolstruktur … durchdringt die gesamte chilenische Wirtschaft der Vergangenheit und der Gegenwart. Gerade diese ausbeuterische Beziehung ist es, die kettengleich den kapitalistischen Konnex zwischen der kapitalistischen Welt und den nationalen Metropolen bis zu den regionalen Zentren (dessen Surplus sie sich teilweise aneignen) ausdehnen, und von denen weiter zu den lokalen Zentren, und so fort bis zu den Landbesitzern oder Kaufleuten, die den Surplus von den kleinen Bauern/Bäuerinnen und PächterInnen aneignen, manchmal bis hin zu den landlosen Arbeitern, die wiederum von letzteren ausgebeutet werden. Auf jeder Stufe üben relativ wenige Kapitalisten Monopolgewalt über viele unter sich aus … So bringt an jedem Skalenpunkt das internationale, nationale und lokale kapitalistische System die wirtschaftliche Entwicklung für wenige und die Unterentwicklung für viele mit sich“ [xv].
Neu an Franks Theorie ist erstens die Behauptung, dass Kapitalismus in der (post)kolonialen Welt immer schon stärker von monopolistischen Strukturen gekennzeichnet war. Zweitens, dass das kapitalistische Weltsystem durch eine kettengleiche Hierarchie von Zentrum und Peripherie (mit mehreren Zwischenstufen) gekennzeichnet ist, in der ein Werttransfer zur jeweils höheren Stufe stattfindet, erzwungen durch die jeweiligen monopolistischen Strukturen und ihre Beziehung aufeinander. Drittens, dass dies in den untergeordneten Stufen dieser Hierarchie zu einer systematischen Unterentwicklung führt, die die Entwicklung der übergeordneten Struktur befördert (daher ist es laut Frank auch die Bourgeoisie in der Peripherie, die die „Unterentwicklung fördert und überwacht“, da sie genau dafür ihren Teil am Surplus im Gesamtsystem bekommt).
Zentrale Schwäche in Franks Analyse ist der Mangel an einer werttheoretischen (also auf der Analyse der gesellschaftlichen Produktionsverhältnisse beruhenden) Begründung dieser Zusammenhänge, die rein auf der Verteilungsebene zwischen „Monopolen“ beschrieben werden. Dabei bleibt der Monopolbegriff selbst schwammig. Allerdings beruft sich Frank hier explizit und häufig auf seinen Lehrer Paul Baran, dessen Theorie des „Monopolkapitalismus“ er dabei unverändert übernimmt. Da diese eine wesentliche Revision der Marx’schen Kritik der politischen Ökonomie und der klassischen Imperialismustheorie darstellt, muss sie jetzt an dieser Stelle behandelt werden.
Baran/Sweezy
Paul Baran war einer der wenigen marxistischen WirtschaftstheoretikerInnen, die es in den 1950er Jahren schafften, ihre akademische Funktion zu behalten, in seinem Fall als Professor an der Stanford University. Schon Anfang der 1950er Jahre entwickelte Baran eine Theorie der Unterentwicklung, die Analysen wie die von Prebisch mit der Monopoltheorie in Verbindung brachten [xvi]. In systematischer Form wurde diese Theorie in seinem Buch „The Political Economy of Growth“ von 1957 entwickelt, dass entscheidenden Einfluss auf AutorInnen wie Frank hatte. Zusammengefasst und popularisiert wurde seine Theorie letztlich in dem gemeinsam mit Paul Sweezy geschriebenen Buch „Das Monopolkapital“ [xvii], das in der 68er-Bewegung zu so etwas wie die allgemeine „Ökonomie-Bibel“ wurde [xviii].
In der Einleitung gehen Baran/Sweezy von einer Krise der marxistischen Analyse aus, die die „moderne Überflussgesellschaft“ und die Integration der ArbeiterInnen in den USA des Nachkriegsbooms nicht hinreichend erklären könne. Sie sehen den Grund dafür darin, dass man im Wesentlichen Marx nur zitiere, der den Kapitalismus und seine Bewegungsgesetze in einer ganz anderen Epoche analysiert habe. Hilferding und Lenin haben zwar mit dem Finanzkapital- und Imperialismusbegriff Korrekturen angebracht, ohne jedoch die grundlegend neuen Bewegungsmuster, vor allem was die langfristigen Akkumulationsgesetze wie die Tendenz zur Krise, betrifft. „Wir halten es an der Zeit, mit dieser Situation aufzuräumen, und zwar rücksichtslos und radikal“ [xix]. Während Marx aus dem Konkurrenzkampf der Kapitale eine Tendenz zum Fall der Profitrate, zur periodischen Entstehung großer Arbeitslosenheere und zu Zusammenbruchskrisen abgeleitet habe, würde dies so für das Zeitalter des Monopolkapitals nicht mehr gelten.
Das Monopolkapital wird nicht mehr durch die Preisbewegungen auf den Märkten bestimmt, sondern diktiert die Preise auf den Märkten in seinem Interesse. Daraus würden aber neue Widersprüche erwachsen: Baran/Sweezy ersetzen Marx‘ Mehrwertbegriff (der sich auf Gewinneinkommen wie Profit, Rente und Zins beziehen würde) durch den „Surplus“ (den sie als Überschuss der gesellschaftlichen Produktion gegenüber den Produktionskosten definieren). Das Grundgesetz des Monopolkapitalismus sei nicht mehr der Fall der Profitrate, sondern eine Tendenz zur ständigen Steigerung des Surplus (durch die monopolkapitalistisch kontrollierte beständige Erhöhung der Arbeitsproduktivität). Da gleichzeitig die Profite einen schrumpfenden Teil dieses Surplus ausmachten, bestehe eine Tendenz zur Stagnation. Es entstünde der Wiederspruch zwischen dem tatsächlich realisierten und dem potentiell möglichen Surplus. Das Wachstum des Monopolkapitals hat unter den Bedingungen der Monopolpreise ein ständiges Problem mit der „effektiven Nachfrage“, was zu einem permanenten Kampf um die Realisierung des Surplus führe. Die Folge wären eine ungeheure Ausdehnung unproduktiver Arbeit, von Werbe- und Vertriebsmechanismen, der Rüstungsindustrie und der Staatstätigkeit.
Baran/Sweezy betonen an mehreren Stellen die wesentliche Rolle der Hierarchie von Ländern im System der Enteignung/Aneignung von Surplus. Darauf bezieht sich Frank wesentlich, wenn er in der monopolistischen Struktur der Weltwirtschaft den Hauptgrund für die Unterentwicklung in der Peripherie sieht: Die Aneignung von Surplus aus der Peripherie ist den Realisierungsbedingungen der großen zentralen Monopole untergeordnet. Von daher ist der Widerspruch von tatsächlicher und potentieller Surplusproduktion in der Peripherie besonders ausgeprägt. Frank zeigt an der Wirtschaftsgeschichte Chiles, wie an verschiedenen Punkten (z. B. dem Salpeterboom) eine eigenständige Industrialisierungsdynamik hätte entstehen können, deren Potential jedoch durch die monopolitischen Interessen systematisch unterbunden wurde. „Deshalb kann man essentiell die Nichtrealisierbarkeit und das Nicht-zur-Verfügung-Stehen von ‚potentiellem‘ wirtschaftlichem Surplus für Investitionszwecke der Monopolstruktur des Kapitalismus zuschreiben“ [xx]. Die Konsequenz für die Peripherie ist daher immer schon eine stagnative Gesamtentwicklung bei gleichzeitiger Konzentration auf die Entwicklung derjenigen Sektoren, die für die Surplusrealisierung der übergeordneten Metropolenökonomien wichtig sind.
„Monopolkapitalismus“ versus marxistische Krisentheorie
Das Erscheinen von Baran/Sweezys Revision der Marx‘schen Kapitaltheorie blieb nicht ohne Kritik von Seiten „orthodoxer“ MarxistInnen wie etwa Ernest Mandel oder Robert Brenner. Eine der treffendsten und brillantesten Kritiken jedoch ist Paul Matticks [xxi] „Marxismus und ‚Monopolkapital‘“, die 1967 erschien [xxii]. Matticks Kritik, die zugleich eine Verteidigung einer werttheoretisch begründeten Krisen- und Klassenkampftheorie ist, kann stellvertretend für eine immer klarer werdende Auseinanderentwicklung im „Neomarxismus“ nach 1968 gesehen werden: einerseits Baran/Sweezy, wo die Behauptung, dass die von Marx im „Kapital“ entwickelte Analyse für den „Spätkapitalismus“ nicht mehr gelte, dazu führt, diese durch eine Variante des Neo-Keynesianismus in der Ökonomie und von Subalterne-Theorien in der Klassenanalyse zu ersetzen; andererseits Mattick, wo eine sehr viel strengere Ableitung marxistischer Krisen- und Klassentheorie aus den zugrundeliegenden Analysen von Wertbestimmungen zu einer methodisch sehr viel anspruchsvolleren Rekonstruktion der Marx’schen Krisentheorie führte. Während die „Spätkapitalismus“-Theorien im akademischen Marxismus immer mehr dominierten, waren „Wertkritik“ und „fundamentalistischer“ Rückbezug auf die Marx’sche Krisentheorie Ausgangspunkt für eine Wiederaneignung der Kritik der politischen Ökonomie für einige Organisationen der radikalen Linken – auch in unserer Theorietradition.
Die Auseinandersetzung zwischen Baran/Sweezy und Mattick geht aus von der Frage einer marxistischen Bestimmung des Monopolbegriffs. Baran/Sweezy formulieren diesen Begriff im Sinne der bürgerlichen politischen Ökonomie als reine Marktdominanz, d. h. durch Elemente wie Marktbeherrschung oder der Möglichkeit des Monopols, die Preise für ihre Produkte zu diktieren. Dies würde die Preisbestimmung vom Wert lösen und damit Grundkategorien wie Einkommen, Gewinne und effektive Nachfrage von den Wertbildungsprozessen in der Produktion immer mehr ablösen. Mattick dagegen betont, dass der Ausgangspunkt bei Marx die Analyse der Wertakkumulation des Gesamtkapitals ist, ganz gleich wie dieses in den Marktsegmenten in mehr oder weniger konkurrierende Teile zerfällt. Solange das Kapital-Lohnarbeitsverhältnis [xxiii] besteht, wird die Akkumulation des Gesamtkapitals durch die Bestrebung zur Ersparung von Arbeit, durch den Zwang zur Produktivitätssteigerung geprägt, der die Dynamik der Wertbestimmung in Gang setzt. Die Umverteilung des Mehrwerts zu Gunsten der jeweils produktivsten Kapitale verändert immer wieder die an der Oberfläche des Marktes scheinbar feststehenden Relationen zwischen den Kapitalen und macht so auch jedes „Marktmonopol“ zu einer räumlich und zeitlich relativen Erscheinung. In dieser Sicht wird das Monopol zu einer widersprüchlichen Erscheinung: Es ergibt sich aus dem Akkumulationsprozess als Zentralisierungs- und Konzentrationstendenz, die zugleich die Konkurrenz auf eine immer höhere und schärfere Ebene hebt. Große Unternehmen werden zeitweise für bestimmte Regionen marktbeherrschend, um morgen aufgespalten zu werden und in einer Kette noch größerer Unternehmen aufzugehen. Insofern besteht Mattick darauf, dass Marx sehr wohl eine Theorie des kapitalistischen Monopols hatte, allerdings sei seine „Theorie des Kapitalwettbewerbs (…) zugleich eine Theorie des Monopols; das Monopol in diesem Sinne bleibt immer im Wettbewerb, denn ein Konkurrenzkapitalismus ohne Wettbewerb würde das Ende der Marktbeziehungen bedeuten, die den Privatkapitalismus am Leben erhalten“ [xxiv]. Der Monopolprofit ist so nicht einfach ein willkürlicher Aufschlag auf die Produktionskosten, genauso wenig wie „die Konkurrenz“ einen „marktgerechten“ Profit schafft. Vielmehr ist es ein gesamtgesellschaftlicher Ausgleichprozess zwischen allen Kapitalen, der zu einer Aufteilung des Gesamtmehrwerts zwischen den Sektoren führt – bedingt durch die Akkumulationsbewegung, die über Investitionen, Beschäftigungsnachfrage, Produktivitätsveränderungen etc. und ihre Rahmenbedingungen (z. B. mehr oder weniger „Monopolisierung“) erst die Marktverhältnisse (z. B. Angebot und Nachfrage, Marktbeherrschung) schafft. Daher ist auch bei stärkerer Monopolisierung bestimmter Sektoren, der geschaffene Gesamtwert und damit der Wertbildungsprozess als Ganzes, die Grundlage und Grenze für jegliche Preisbildung. Der Monopolpreis kann sich in diesem Kontext nicht von seiner Grundlage im Arbeitswert lösen – er führt nur zu einer Umverteilung des Mehrwerts, der notwendigerweise zu Reaktionen der anderen Kapitalsektoren führen muss. Marx spricht hier von einer „lokalen Störung“, die im Gesamtprozess ausgeglichen wird, wie bei der Entstehung der Grundrente, hier als Monopolrente [xxv].
Die Dynamik der der Kapitalakkumulation ergibt sich bei Marx nicht aus der Verteilung von Gewinneinkommen, sondern durch die Wertzusammensetzung des Kapitals und ihre Veränderung. In dieser spiegelt es sich als gesellschaftliches Verhältnis wider, nicht in der Bildung der Preise am Markt. Bei Baran/Sweezy dagegen wird der Monopolpreis zu einer Schranke der Akkumulation, da es zu einer Differenz von „effektiver Nachfrage“ und dem Absatz der möglichen Produktionskapazitäten komme. Tatsächlich kommt es aber dem Kapital nicht auf den Absatz der Produktmasse an, sondern um die Realisierung des darin verkörperten Mehrwerts. Dies kann z. B. durch die Senkung der notwendigen Arbeitszeit (Kosten der Reproduktion der Ware Arbeitskraft) oder Steigerung der Nachfrage nach Investitionsgütern auch unter Bedingungen von Masseneinkommen geschehen, die hinter der Entwicklung der Monopolpreise zurückbleiben. Auch ein von großen Konzernen geprägter Kapitalismus entgeht daher nicht dem Zwang zu beständiger Steigerung der Arbeitsproduktivität – und muss daher aber auch nicht in die Stagnation verfallen, die Baran/Sweezy ihm konstatieren.
Dabei bedeutet Produktivitätssteigerung im Kapitalismus immer Ersparung der Anwendung von lebendiger Arbeit durch Einsatz von „kostensparender“ Produktionstechnologie. Daher geht mit der Produktivkraftsteigerung im Kapitalismus, die aus dem Zwang zur Verwertung und Vermehrung des Mehrwerts resultiert, zweierlei hervor: einerseits eine relative Abnahme der in der Produktion angewandten Arbeitskraft gegenüber einem dabei gleichzeitig steigenden Kapitaleinsatz. Während diejenigen, die diese Innovationen zuerst anwenden, dabei große Gewinne machen können, führt dies durch die steigende organische Zusammensetzung des Kapitals zu einer Tendenz zum Fall der Profitrate. Da die Produktivitätssteigerung aber zugleich auch die Ausdehnung der Produktion ermöglicht, kann diese Tendenz durch Steigerung der absoluten Masse an realisierbarem Mehrwert ausgeglichen werden. Produktivitätssteigerungen, relative Zunahme der Kapitalkosten, daher relatives Fallen der Profitrate, gehen dabei einher mit Ausdehnung der Produktion, Steigerung der Beschäftigung (wenn auch wertmäßig mit geringerer Steigerung als das konstante Kapital), Anwachsen der Profitmasse und so in der gewöhnlichen Akkumulationsbewegung eine widersprüchliche Verbindung ein – relatives Fallen der Profitrate bei Steigerung der Profitmasse.
Mattick weist zu Recht darauf hin, dass Baran/Sweezy diesen Doppelcharakter des Marx’schen Akkumulationsgesetzes verkennen, wenn sie meinen, Marx‘ Gesetz vom Profitratenfall durch das Gesetz des „steigenden Surplus“ ersetzen zu können. Marx spricht dagegen vom „zwieschlächtige(n) Gesetz der aus denselben Ursachen entspringenden Abnahme der Profitrate und gleichzeitigen Zunahme der absoluten Profitmasse“ [xxvi]. Dies ist eine Gesetzmäßigkeit, die sich nicht aus den Preisbestimmungen auf den Güter- und Kapitalmärkten ergibt, sondern aus dem Grundcharakter der kapitalistischen Produktion als Ausbeutungsverhältnis, wie es sich in der kapitalistischen Form der Steigerung der Arbeitsproduktivität ausdrückt. Die Konkurrenz der Kapitale (neben der Auseinandersetzung von Kapital und Lohnarbeit) ist eine Form, die Zwänge dieser Gesetzmäßigkeit durchzusetzen, z. B. durch Werttransfer hin zu produktiverem Kapital. Tatsächlich sind aber auch „Monopole“ im Kapitalismus, also sehr große, konzentrierte Kapitale mit gewisser Marktbeherrschung, nicht in der Lage, diesen Mechanismen langfristig auszuweichen: Ob in den Innenbeziehungen (z. B. verschiedene Zulieferbereiche, konkurrierende Abteilungen) oder in der Marktumgebung (andere große Konzerne, nicht-monopolisierte Sektoren) können produktivere Kapitale den sowieso vorhandenen Zwang zur Produktivitätssteigerung durchsetzen, da sonst auf lange Sicht die marktbeherrschende Stellung in Gefahr zu kommen droht.
Der Punkt ist nicht, dass trotz aller Probleme der Untergrabung der Profitrate auf lange Sicht, wie sie Marx analysiert, nicht zugleich eine beständige Ausdehnung von Ausbeutung und Mehrwertaneignung stattfinden kann. Das Entscheidende, das Marx in dieser Analyse erkannt hat, ist vielmehr, dass diese widersprüchliche Bewegung immer wieder an eine Schranke kommt, in der die Ausdehnung des Mehrwerts nicht mehr ausreicht, um die relativ sinkende Profitratenbewegung auszugleichen, dass also an einem bestimmten, nicht vorhersehbaren Punkt die Akkumulationsbewegung den tatsächlich synchronen Fall von Profitmassen hervorbringt – und daher in ihre Krisenphase eintritt. Das von Baran/Sweezy dargelegte Modell der durch Staat und Monopole modifizierten Akkumulation als permanente Stagnation ist daher nichts anderes als ein grundlegender Bruch mit der Marx’schen Analyse von den aus dem kapitalistischen Produktionsprozess herrührenden stürmischen Auf- und Abwärtsbewegungen der wirtschaftlichen Entwicklung und ihres grundlegend krisenhaften Charakters. Baran/Sweezy behaupten eine angeblich immer mehr stagnierende Kapitalakkumulation in den produktiven Sphären z. B. der Industrie, die im „Monopolkapitalismus“ durch eine rein monetäre Akkumulation nicht-produktiver, „verschwenderischer“ Ersatzsegmente (Rüstung, Werbung, Staat …) ersetzt würde, die immer mehr „Surplus“ hervorbringen würden. Ihre Akkumulationstheorie ist daher logisch mit der Abkehr von der Wertanalyse verbunden. Nur damit kann auch die scheinbar terminologische Ersetzung des Mehrwertbegriffs durch den des Surplus verstanden werden.
Mattick weist zu Recht darauf hin, dass der angeblich präzisere Begriff des „Surplus“ bei Baran/Sweezy eine Vermischung mehrere Ebenen der Analyse ist: Bei Marx ist der Mehrwert auf der Ebene des Gesamtkapitals das Ergebnis des Verwertungsprozesses bestehenden variablen und konstanten Kapitals. Auf der Ebene des Zirkulationsprozesses geht eine Vielzahl von wirtschaftlichen Aktivitäten in die Realisierung des Mehrwerts ein, die große Teiledavon auch auf nicht-produktive Wirtschaftssektoren verteilen. Erst auf der Ebene des Einzelkapitals bzw. des Grundeigentums, des Staates etc. erscheint der Mehrwert dann als Geldeinkommen in Form von Profit, Zins, Grundrente, Steue etc. Die Behauptung von Baran/Sweezy, bei Marx wäre der Mehrwert im Wesentlichen Profit und Zins, der Surplus dagegen umfasse auch Staatseinkommen und Einkommen für unproduktive Arbeiten, geht an einer Analyse des Mehrwerts und seiner Realisierung/Verteilung vorbei. Sie dient offensichtlich der theoretischen Begründung für ein angeblich jenseits des Produktionsprozesses zu betrachtendes „Wertprodukt“ – so wie die bürgerlichen Kategorien von „Sozialprodukt“ und „Nationaleinkommen“ die eigentliche Wertbildung verschleiern. Die Tatsache, dass in den imperialistischen Ländern ein wachsender Teil des Sozialprodukts auf unproduktive (z. B. Finanzsektor) und öffentliche Sektoren entfällt, ändert nichts an der Tatsache, dass deren Einkommensquellen letztlich nur auf einer Umverteilung des Gesamtmehrwerts beruhen können, der in den (im kapitalistischen Sinn) produktiven Sektoren der Ökonomie entsteht. Baran/Sweezy folgen mit ihrer Surplustheorie im Wesentlichen dem Schein der Marktoberfläche, der auch die bürgerliche Ökonomie aufsitzt.
Weder unproduktive Sektoren und Arbeiten durch Aufblähen von Staatsapparat, Rüstungsindustrie, Marketing etc. können langfristig die Probleme eines stagnierenden Produktionssektors lösen, noch kann es, wie Baran/Sweezy behaupten, ein Rückgriff auf Verschuldung, besonders der Staatsverschuldung. Dies verschiebt das Problem nur auf den Zwang, diese durch eine spätere Ausdehnung des Mehrwerts zu finanzieren. Die Ausdehnung von unproduktiven Sektoren und von „Verschwendung“ oder Staatsverschuldung wird daher (anders als Baran/Sweezy tatsächlich behaupten) nicht das Programm der herrschenden Klasse sein: „Alle sozialen Schichten, die vom Mehrwert leben, sind ebenso wie die Expansion des Kapitals als Kapital von diesem Mehrwert abhängig, der zwar durch die wachsende Arbeitsproduktivität noch so gesteigert werden kann, aber gleichzeitig abnimmt, weil der unrentable Sektor der Wirtschaft verhältnismäßig schneller wächst als der rentable“ [xxvii].
Das Problem im Kapitalismus bleibt daher, dass ab einem gewissen Punkt es gerade nicht so ist, dass „zu viel Mehrwert“ im Überfluss vorhanden ist, sondern dass das Kapital immer wieder an seine eigene Grenze stößt: dass Mehrwert fehlt, der zur Verwertung von produktivem Kapital eingesetzt werden kann; dass vielmehr Kapital in großer Masse in Bereichen festsitzt, die angesichts des tendenziellen Falls der Profitrate nicht mehr genug Profitmasse für profitable Anlage abwerfen. Daher der beständige Zwang im Rahmen der Dynamik der Kapitalakkumulation zur Erhöhung der Ausbeutung (der Mehrwertrate), zur Vernichtung von Kapital, Freisetzung von Arbeitskraft, Erschließung neuer Akkumulationsmöglichkeiten (z. B. durch Kapitalexport).
Für die Weltwirtschaft als Ganzes bedeutet dies, dass nicht Monopolisierung und Surplus-Überfluss das Hindernis für Entwicklung sind, sondern:
- Einerseits ist Entwicklung immer davon abhängig, ob bei gegebener Zusammensetzung des Kapitals und gegebener Arbeitsproduktivität genug Kapital (Mehrwert) vorhanden ist, um Kapitalexpansion zu ermöglichen: „Wenn man die Welt als Ganzes betrachtet, liegt es jedoch auf der Hand, dass sie nicht an Überschuss, sondern an Knappheit leidet. Der potentielle Surplus des Monopolkapitals wird mehr als ausgeglichen durch den effektiven Mangel an allem in den kapitalschwachen Ländern. Die Überproduktion an Kapital in einem Teil der Welt steht der Unterkapitalisierung in dem anderen gegenüber. Wenn man den Kapitalismus als ganzes, als ein Weltmarktsystem, betrachtet, verschwindet der Surplus; statt dessen findet sich ein großer Mangel an Mehrwert“ [xxviii].
- Der Kapitalexport wirkt einerseits dem Fall der Profitrate in den Metropolen entgegen, als er Produktion in Länder mit geringerer organischer Zusammensetzung des Kapitals verlagert und andererseits wirkt er dem Kapitalmangel in den peripheren Ländern entgegen. Dies bedeutet aber gleichzeitig eine Verfestigung der Verhältnisse unterschiedlicher Arbeitsproduktivität, eine von den Verwertungsinteressen des Zentrums abhängige Entwicklung wie auch einen Werttransfer in die Region mit höherer Arbeitsproduktivität. Durch die weltweit geringere als mögliche Gesamtproduktivität wird auch der Mehrwert weniger als möglich ausgedehnt und damit der Knappheit, insbesondere an relativem Mehrwert, zu wenig entgegengewirkt. Der Zwang zur Erhöhung des absoluten Mehrwerts (Arbeitszeit, -intensität …) in der Peripherie bleibt bestehen.
- Schließlich ist der Akkumulationsprozess „gleichzeitig ein Prozess der Kapitalkonzentration, der ebenso das Weltkapital auf wenige Länder wie in jedem einzelnen Land in die Hände von immer weniger Leuten zu konzentrieren sucht. Denn allein die Wertexpansion des vorhandenen Kapitals zählt, nicht dessen räumliche Ausdehnung“ [xxix]. Die untergeordnete Funktion der räumlichen Ausdehnung führt dazu, dass Monopolisierung vor allem auch die Einteilung der Welt in Regionen mit unterschiedlicher organischer Zusammensetzung des Kapitals bedeutet. Dies wiederum bedeutet, dass die Schranken der Kapitalexpansion durch Überakkumulation langsamer erreicht werden – die Hinauszögerung der Krise wird mit Unterentwicklung der Peripherie erkauft.
So ungenügend die Monopoltheorie von Baran/Sweezy (und im Gefolge von Frank) auch war, so politisch folgenreich war sie doch innerhalb der „Neuen Linken“. Während Matticks werttheoretische Ableitung des Monopolkapitalismus diesen weiterhin elementar durch den Widerspruch von Kapital und Lohnarbeit auch auf Weltebene bestimmt versteht, sind die zentralen Widersprüche bei Baran/Sweezy und Frank diejenigen zwischen den monopolistischen ProfiteurInnen der tatsächlichen Surplusrealisierung (Monopole, Staat, unproduktive Schichten, weite Teile der ArbeiterInnenklasse der Metropolen) und denjenigen, denen die Versprechungen der potentiellen Surplusproduktion vorenthalten werden. Dies sind verschiedenste „periphere“ Schichten und Regionen. In den imperialistischen Ländern zählen Baran/Sweezy vor allem die rassistisch Unterdrückten, die Randschichten in den großen Städten und die durch die Überflussgesellschaften krank Gemachten auf. In der peripheren Welt sind große Teile der Bevölkerung dagegen als Ganzes von der Unterentwicklung des Surplus betroffen, die von den Monopolen aufgezwungen wird. Die proletarische Weltrevolution als politische Perspektive wird also durch die Perspektive des „Aufstands der Peripherie“ ersetzt. Mit der Dependenztheorie einher ging die Auffassung eines einheitlichen Blocks der „Dritten Welt“ (oder auch „Trikont“, da sie vor allem auf Asien, Afrika und Lateinamerika bezogen wurde), der einerseits durch gleiche Abhängigkeitsökonomien gekennzeichnet sei, andererseits aber auch überall einen dagegen gerichteten revolutionären Prozess, die Trikont-Bewegung, begonnen hätte.
Wenige Jahre später wurde offensichtlich, dass weder der imperialistische Block so krisenfrei und frei von breiteren (nicht nur periphere Schichten betreffenden) gesellschaftlichen Widersprüchen war noch dass die Krisen- und Entwicklungsverläufe der „3. Welt“ so einheitlich waren, wie angenommen. Zusätzlich bewahrheitete sich auch nicht die Hoffnung der meisten Dependencia-AnhängerInnen, dass dem Beispiel Kubas (und später Vietnams) eine Welle von Revolutionen folgen würde, die die politische Macht des Monopolkapitalismus brechen und die Sowjetunion (oder China) zum Vorbild ihrer Entwicklung machen würde (wie kritisch auch immer der Bezug auf diese „Modelle“ war). Aus der Dependencia-Theorie erwuchsen weder eine klare revolutionäre Strategie zur Überwindung der kapitalistischen Verhältnisse vor Ort noch einheitliche wirtschaftliche Forderungen im unmittelbaren Kampf noch eine internationalistische Strategie jenseits der Hoffnung auf Unterstützung durch die stalinistischen Staaten. Deren Bezug auf die Trikont-Bewegungen war jedoch längst im Rahmen der „friedlichen Koexistenz“ fern jeder Perspektive eines zu unterstützenden weltrevolutionären Prozesses (selbst kontinental beschränkt) beerdigt worden.
In den folgenden Abschnitten werden wir daher den Anregungen von Mattick zur Analyse der Akkumulationsbewegung des Kapitals auf Weltmarktebene folgen, wie er sie in Abgrenzung zu Dependenz- und Monopolkapitalismustheorie entwickelt hat. Dies beginnt mit der Frage der Wertzusammensetzung des Kapitals auf Weltebene, ihrer Auswirkung auf die globale Akkumulationsbewegung, um zu den Modifikationen des „doppelgesichtigen Gesetzes“ von relativem Profitratenfall und Ausdehnung der Profitmasse auf Weltebene zu gelangen. Insbesondere wird sich zeigen, dass die Akkumulations- und Krisenbewegung des globalen Kapitals zu sehr unterschiedlichen „Entwicklungsmodellen“ („ungleichzeitige und kombinierte Entwicklung“) und einer spezifischen Verteilung von Krisentendenzen zwischen Peripherie und Metropolen führt. Auf dieser Grundlage lässt sich auch die Frage der Wirkungsweise und Modifikation des Wertgesetzes im globalisierten Kapitalismus konkreter fassen, insbesondere in der kritischen Auseinandersetzung mit der Theorie des „ungleichen Tausches“. Auf dieser Grundlage wird sich erweisen, dass das Verständnis des modernen „dekolonialisierten“ Imperialismus weiterhin auf der Grundlage der Marx’schen Akkumulations- und Krisentheorie sehr viel besser gewonnen werden kann als durch Revisionen rund um „Spätkapitalismus-“, „Monpolkapitalismus“- oder Theorien des „ungleichen Tausches“ (heute: „imperiale Lebensweise“) oder „Postkolonialismus“.
Das globale Kapital nach dem Ende der Kolonialreiche
Wir beginnen mit einer mehr statistisch ausgerichteten Analyse der weltweiten Kapitalzusammensetzung. Für statistische Berechnungen gut geeignet sind die „Extended Penn World Tables“, von denen aus Zeitreihen (bis in die 1960er Jahre) zu 31 Indikatoren für 176 Länder abgerufen werden können [xxx]. Sie werden unter anderem von Michael Roberts in seinem stets lesenswerten Blog zur Lage des globalen Kapitalismus verwendet [xxxi].
Einen guten Überblick über das Problem der unterschiedlichen Kapitalisierung gibt zunächst das von Piketty so zentral benutzte Kapital/Einkommensverhältnis, d. h. die langfristige Entwicklung des Verhältnisses von „Vermögen“ (auf Ebene der Nationalökonomien ein Amalgam aus Anlagevermögen, Grundbesitz, Finanzvermögen) zum Nationaleinkommen (das Bruttoinlandsprodukt – Einkommen der AusländerInnen im Inland + Einkommen der InländerInnen im Ausland = Bruttonationaleinkommen abzüglich der Abschreibungen = (Netto-)Nationaleinkommen). Diese Verhältniszahl entspricht also etwa der an Jahren, die in einer Nationalökonomie gearbeitet werden müssten, um das bestehende Vermögen zu erzeugen. Es ist also ein Maßstab für das angehäufte Kapital. Auffällig ist einerseits, dass in den „reichen Ländern“ trotz langfristig sinkenden BIP-Wachstums, die Vermögen trotzdem ungebremst wachsen, was zu einem säkularen, langfristigen Anstieg des Kapital/Einkommens-Verhältnisses führt (Abbildung 2).
Das BIP, Bruttoinlandsprodukt (englisch: Gross Domestic Product; GDP), gibt den Gesamtwert aller Güter, d. h. Waren und Dienstleistungen an, die während eines Jahres innerhalb der Landesgrenzen einer Volkswirtschaft als Endprodukte hergestellt wurden, nach Abzug aller Vorleistungen. Als Vorleistungen gelten in der Wirtschaftswissenschaft die im Produktionsprozess verbrauchten, verarbeiteten oder umgewandelten Güter und Dienstleistungen (vgl. Europäisches System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen – ESVG). Die Vorleistungen unterscheiden sich von den Investitionen dadurch, dass ein Investitionsgut über mehrere Abrechnungsperioden hinweg im Produktionsprozess eingesetzt und allmählich abgeschrieben wird.
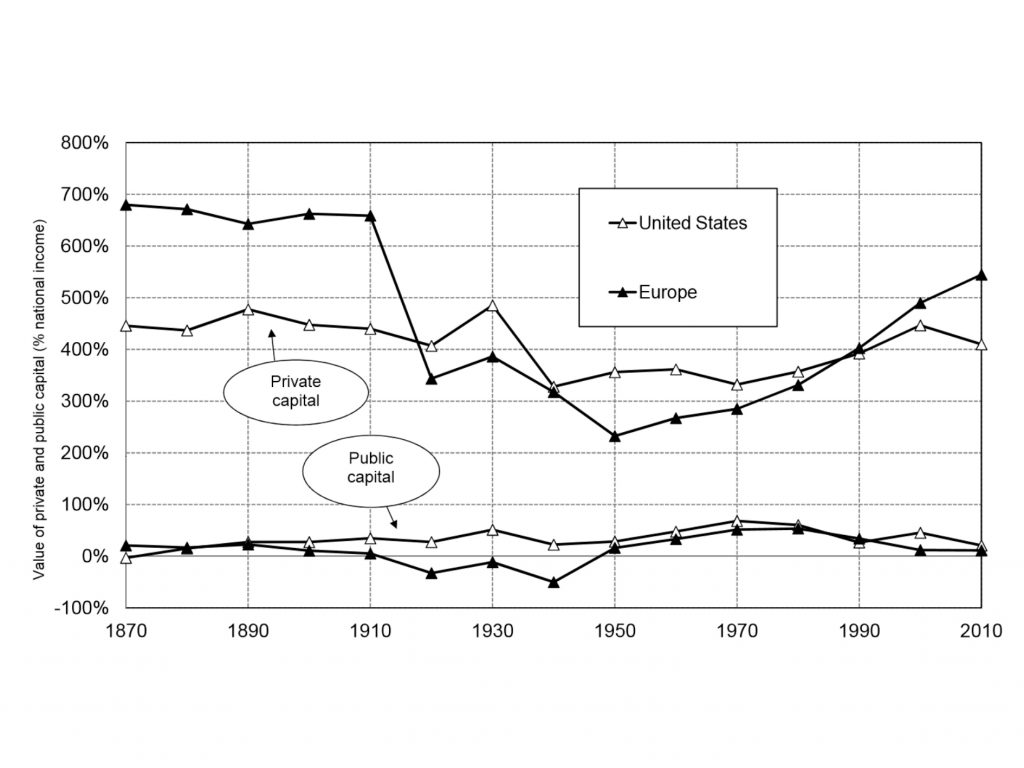
Abbildung 2: Kapital/Einkommensentwicklung Europa und USA 1870-2010 [xxxii]
Auffällig ist der schwere Einschnitt in die europäische Kapitalentwicklung nach dem 1. Weltkrieg und dem Ende des direkten Kolonialismus, der sich auch in einer realen Staatsverschuldung (Staatsschulden gegenüber dem Staatsvermögen) ausgedrückt hat. Seither haben sich die europäische und US-amerikanische Wirtschaft wieder auf ein Niveau hochbewegt, wo die Vermögen das Nationaleinkommen um das 4- bis 6-Fache übersteigen. Um das angehäufte Kapital zu verwerten (EigentümerInnen erwarten eine Mindestkapitalrendite von 4 – 5 % auf ihre Vermögensgegenstände als „Kapitaleinkommen“), muss ein beträchtlicher Teil des jedes Jahr neu geschaffenen Werts wieder akkumuliert werden (zumeist über 10 % des BIP). So wächst die Masse des akkumulierten Mehrwerts auch trotz sinkenden Wachstums der Gesamtproduktion immer weiter. Wie Piketty zeigt, ist dies notwendig mit einem Wachsen des Anteils der Kapitaleinkommen am Nationaleinkommen (d. h. Sinken der „Lohnquote“) und einer wachsenden Ungleichverteilung von Einkommen und Vermögen verbunden, die zu einer immer extremeren Konzentration des Reichtums auch in den „reichen Ländern“ führt.
In unserem Zusammenhang ist interessant, wie sich diese Entwicklung weltweit jenseits der traditionellen Industrieländer darstellt. Hier kann man insbesondere auf die Daten des „Global Wealth Reports“ [xxxiii] der Credit Swiss zurückgreifen. Hier wird beispielsweise für das „zukunftsträchtige“ Brasilien für 2012 ein Gesamtvermögen von 3,3 Billionen US-Dollar ausgewiesen – zum Vergleich: für Frankreich mit etwa einem Drittel der Bevölkerung sind es im selben Jahr über 12 Billionen. Dem steht in Brasilien 2012 ein Nationaleinkommen von 3 Billionen (in internationaler Kaufkraftparität) gegenüber, in Frankreich jedoch eines von 2,7. Während Frankreich also eine Kapital/Einkommensrelation (KER) von etwa 5 erreicht, liegt sie in Brasilien gerade mal bei über 1! Noch extremer stellt es sich in Indien dar, das trotz seiner Milliardenbevölkerung ebenso nur ein Vermögen von 3,2 Billionen US-Dollar meldet, aber sogar ein Nationaleinkommen von über 6,1 Billionen. Erst 2019 wurde in Indien ein KER von 1 erreicht (bei 12 Billionen Vermögen). In Brasilien dagegen wuchsen im Vergleich die Vermögen nur auf 3,5 Billionen (Frankreich 13,7), während das Nationaleinkommen bei 3,2 stagnierte. Dieses geringe Kapital/Einkommensverhältnis ist für viele Länder außerhalb der „reichen“ typisch, was dazu führt, dass die „capital formation“ (d. h. die Kapitalakkumulation) aus „inländischen Quellen“ auf sehr viel geringerem Niveau vor sich geht, wenn auch mit zumeist höherem Anteil am BIP.
Insgesamt ist diese „Unterkapitalisierung“ im „globalen Süden“ (auch wenn Australien und Neuseeland auf der Südhalbkugel liegen) letztlich auch sehr deutlich auf der Weltkarte der Vermögensverteilung zu sehen.

Abbildung 3: Globale Vermögensverteilung [xxxiv]
Noch deutlicher wird dies, wenn man den regionalen Anteil der Vermögen am Weltgesamtvermögen betrachtet. Während die „klassischen“ imperialistischen Länder in Nordamerika, Europa, Japan und auf der Südhalbkugel (Australien, Neuseeland) nur noch ein Viertel der Weltbevölkerung beherbergen, konzentrieren sie aktuell weiterhin 70 % des weltweiten Kapitals. Rechnet man noch die fast 20 % Anteil von China und Russland hinzu, so wird deutlich, wie wenig Kapital im Vergleich in der nicht-imperialistischen Welt zur Verfügung steht. Dazu kommt, dass das vorhandene Vermögen in den ärmeren Ländern auch noch extrem ungleich verteilt, d. h. jeweils unter der Kontrolle einer sehr kleinen Oberschicht konzentriert ist (siehe die weltweiten Aufstellungen zum Gini-Indikator).
Für die Kapitalakkumulation, insofern sie Verwertung des bestehenden Kapitals bedeutet, ist jedoch nicht das Gesamtvermögen entscheidend, sondern der „Kapitalstock“, d. h. das in produktiver Weise in Anlagevermögen angelegte Kapital. Die Statistiken weisen seit den 1980er Jahren für die „reichen Länder“ ein weitaus langsameres Wachstum des Kapitalstocks als für das Vermögen insgesamt aus. Dagegen wächst der Anteil an Anlagen in „Finanzvermögen“ bzw. Immobilien. Da letzteres zumeist auch über Finanzagenturen läuft, kann man es unter „Finanzkapital“ zusammenfassen. Während z. B. in der BRD der Anteil des produktiven Anlagevermögens 1983 noch bei fast 60 % des Vermögens lag, lag er 2010 bei nur noch 48 % (Berechnung der Größe des Kapitalstocks mit Penn-Reihe und des Gesamtvermögens nach Piketty jeweils gemäß PPP von 2005).
In Ländern wie Brasilien dagegen ist bis heute das Kapital weit direkter mit der unmittelbaren Anlage verbunden, so dass der Kapitalstock 75 % des Vermögens entspricht. In vielen Ländern, wie Indien oder Indonesien, liegt auch noch der Anteil an „real property“, also vor allem Grund- und Boden, bei über 20 % des Vermögens. Insgesamt ist die Kategorie des „Finanzvermögens“ kritisch zu betrachten: Das Kapital verwandelt sich in seinem Verwertungsprozess beständig in die Formen von Waren-, Produktiv- und Geldkapital. Die Zirkulationsformen des Geldkapitals ermöglichen die Aneignung eines Teils des Profits in der Form des Zinses (G-G‘). Der Handel mit Anteilseigentum an Kapital wiederum erzeugt andere Formen der Aufteilung des Profits und die Entstehung eines Kapitalmarktes, der zinsähnliche Gewinne verspricht. Im „Finanzvermögen“ wird Zinskapital, Anteilseigentum und Kapitalmarktinvestition vermengt. Dies verschleiert die jeweilige Nähe zur unmittelbaren produktiven Anlagesphäre. Der gestiegene Anteil des Finanzvermögens am Kapital ist jeweils nur ein Indikator für die „Abstraktheit“ des Kapitals gegenüber der unmittelbaren Verwertungsebene bzw. seiner Beweglichkeit, was die Anlagesphären betrifft. Dass die peripheren Länder hier weitaus weniger „Finanzkapital“ aufweisen, ist eine deutliche Konkretisierung von Lenins Thesen zur Rolle des Finanzkapitals im Imperialismus. Es sind globale Akteure, wie BlackRock Inc. oder Allianz Global Investors (AGI), die weltweit „Finanzvermögen“ einsammeln, um mit ihren Anlagen in Anteilseigentum und auf den Kapital- und Anleihemärkten wesentlichen Einfluss auf alle wichtigen Unternehmen aber auch auf Staaten auszuüben. Es ist klar, dass alle diese Hauptagenturen des modernen Kapitalismus in den imperialistischen Zentren zu finden sind.
Als säkularer Trend ist zu beobachten, dass auch der Kapitalstock gegenüber dem BIP seit den 1960er Jahren begonnen hat, schneller zu steigen als das BIP, wenn auch nicht im selben Tempo wie das Gesamtvermögen. Hier die Entwicklung in den USA, die von einem Verhältnis von fast 1:1 zu einem Verhältnis 1:0,6 geführt hat (Abbildung 4):
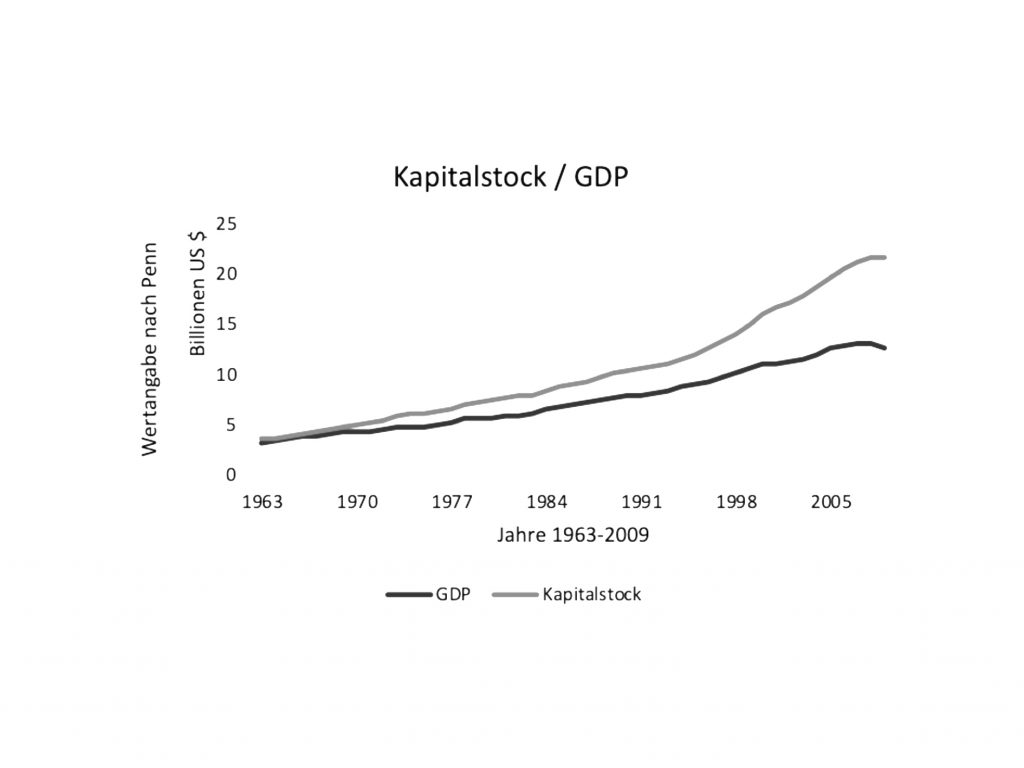
Abbildung 4: Entwicklung BIP und Kapitalstock – USA [xxxv]
Dies heißt aber auch, dass immer mehr Anlagekapital notwendig ist, um noch eine weitere Steigerung des Gesamtprodukts hervorzubringen. Diese Tendenz zum Sinken der „Kapitalproduktivität“ ist in allen Industrieländern gleichermaßen ausgeprägt (auf derzeit etwa 60 %). In der Welt jenseits der alten Industrienationen jedoch finden sich sehr unterschiedliche Werte und Historien der Kapitalproduktivität. So folgte Brasilien in den 1960er/1970er Jahren (während der Industrialisierungspolitik der Militärdiktatur) dem Trend eines raschen Aufbaus des Kapitalstocks. Mit der Krise Ende der 1970er Jahre brachen sowohl das Wachstum des Kapitalstocks wie des BIP ein. Letzteres wuchs mit der Stabilisierung in den 1990er Jahren wieder, ohne im selben Tempo zum Aufbau des Kapitalstocks zu führen. Damit verbleibt in Brasilien die Kapitalproduktivität heute bei 75 % (siehe: Abbildung 5).
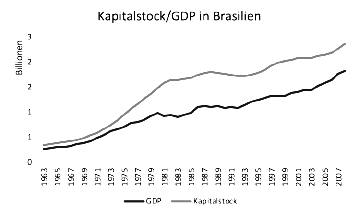
Abbildung 5: Entwicklung BIP und Kapitalstock in Brasilien [xxxvi]
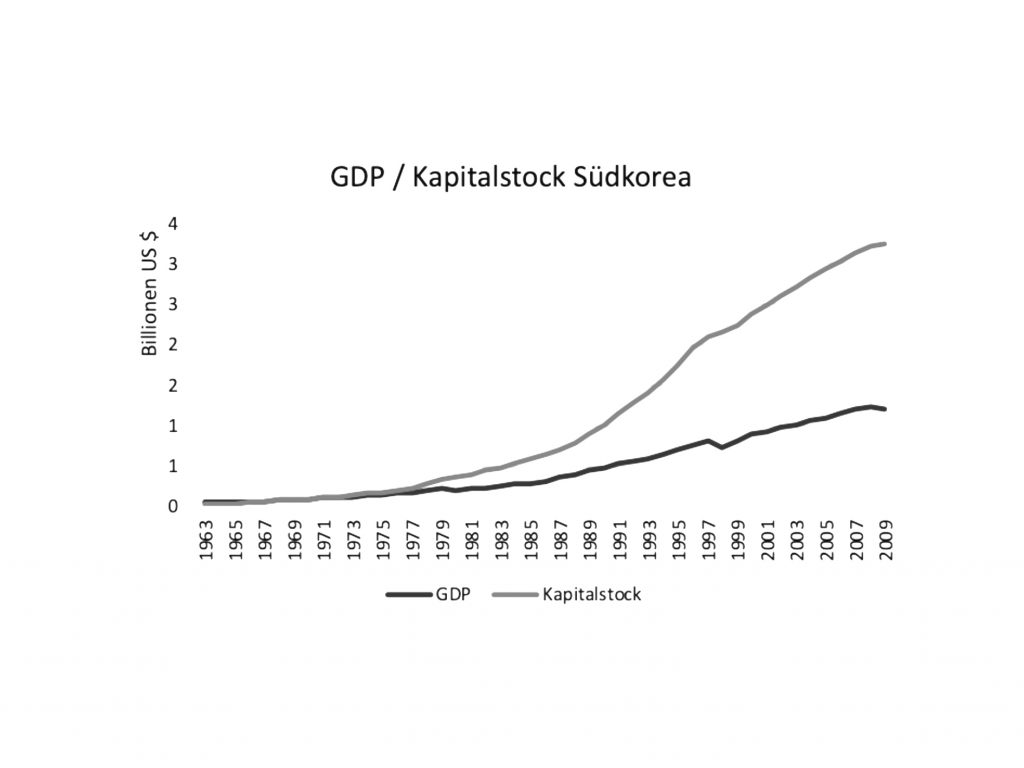
Abbildung 6: Verhältnis Kapitalstock zu BIP in Südkorea [xxxviii]
Betrachtet man andere Peripherieländer, so ergeben sich je nach den historischen Entwicklungen ganz unterschiedliche Kategorien in Bezug auf die Kapitalstockentwicklung. So gibt es in afrikanischen Ländern (südlich der Sahara) zumeist weiterhin eine Parallelentwicklung von Kapitalstock und BIP. So liegt die Kapitalproduktivität von Kenia heute noch bei 98 %, wenig geringer als in der Zeit kurz nach der Unabhängigkeit 1963. Ganz im Unterschied dazu die Entwicklung in Algerien: Insbesondere die Verstaatlichung der Erdöl- und Erdgasunternehmen aus französischem Besitz 1971[xxxvii] und die darauf aufgebaute „sozialistische“ Industrialisierungspolitik führte bis in die 1980er Jahre zu einem großen Kapitalstock, verglichen mit immer geringer werdendem wirtschaftlichen Wachstum. Daher sank schon in den 1970er Jahren die Kapitalproduktivität unter 50 %, um in den 1980er Jahren sogar unter 40 % zu fallen. Anders als in Lateinamerika konnten die Öl- und Gas-Einnahmen die damit verbundenen Probleme noch bis Ende der 1980er Jahre auffangen. Mit dem Sinken der Ölpreise Ende der 1980er Jahre brach eine schwere wirtschaftliche und in deren Gefolge auch politische Krise aus (Bürgerkrieg). Die von Bouteflika durchgesetzte „Befriedungspolitik“ beinhaltete in den 2000er Jahren eine gegen den heftigen Widerstand der Gewerkschaften durchgesetzte „Privatisierungspolitik“, die an den Kapitalabbau während der Krise anknüpfte und das Land stark für Auslandsinvestitionen öffnete. Damit wurde die Kapitalproduktivität auf heute wieder über 50 % gehoben.
Solche Geschichten wie für Algerien könnten für viele Länder erzählt werden, die auf der Grundlage des Exports ihres Rohstoffreichtums eine vor allem staatliche Industrialisierungspolitik betrieben haben. Eine ganz andere Entwicklung sehen wir in Ländern, die wenig Möglichkeiten hatten, ihre Industrialisierung auf Rohstoffexport zu begründen. Insbesondere die auf Export ausgerichteten „Entwicklungsdiktaturen“, die sich als Standorte für „Billiglohnfertigung“ den großen Konzernen des Zentrums anboten, folgten einem Muster, das sich wohl am extremsten in Südkorea zeigt:
Ohne Rohstoffbasis und geschwächt durch die Verheerungen des Koreakrieges war Südkorea in den 1950er Jahren am unteren Ende der Entwicklung und wurde seit den frühen 1960er Jahren durch eine brutale Militärdiktatur unter Park-Chung-hee regiert. Park begründete die südkoreanische Industriestruktur, die zugleich mit einer strikten Unterdrückung von ArbeiterInnenrechten verbunden war. Wie an der Entwicklung des Kapitalstocks zu erkennen ist, gab es jedoch erst nach der globalen Krise 1974 eine explosionsartige Änderung der Situation. Seither ist das Wachstum des Kapitalstocks gegenüber dem Wachstum des BIP entfesselt: Während das Verhältnis noch in den 1960er Jahren bei über 100 % lag, sank es 1996 erstmals unter 40 %. Erst die Asienkrise 1997 hat zu einer Verlangsamung im Tempo des Aufbaus des Kapitalstocks geführt. Heute liegt die Kapitalproduktivität Südkoreas bei etwa 36 %.
Hier bestätigt sich Matticks These, dass die Aufhebung von Akkumulationsschranken für das Kapital (die die „Globalisierungsperiode“ für viele, insbesondere asiatische, „Tigerstaaten“ mit sich gebracht hat) zugleich auch die Überakkumulation aus dem Zentrum in die Peripherie trägt – und damit auch die Überakkumulationskrise auf eine globalere Ebene hebt. Mit der Aufhebung der „Sphäre geringerer organischer Zusammensetzung des Kapitals“ für immer mehr Regionen der Welt, wird zugleich ein wichtiger krisenhemmender Faktor in der Weltakkumulation des Kapitals abgebaut. Häufigere Krisenanfälligkeit und Tendenz zu schnellerer Entwicklung von überregionalen zyklischen Abschwüngen sind ein Merkmal der Globalisierungsperiode seit Mitte der 1990er Jahre.
Was Südkorea betrifft, gibt es natürlich auf Grund der Kapitalisierung und der Weltbedeutung mehrerer ihrer großen Kapitale Argumente für den Aufstieg in den Klub des Imperialismus. Allerdings deutet schon die äußerst hohe Kapitalzusammensetzung (bzw. niedrige Kapitalproduktivität) darauf hin, dass es sich hierbei auch um eine andere Form der Abhängigkeit handelt. Viele der asiatischen Staaten, die einen ähnlich raschen Aufstieg in der Globalisierungsperiode durchgemacht haben, wie Malaysia oder Indonesien, haben eine ähnliche Entwicklung ihrer Kapitalproduktivität hinter sich (85 % auf 48 % bzw. 91 % auf 55 %), die sie über die üblichen Peripheriestaaten stellt. Diese Überkapitalisierung kann – neben Druck auf die Löhne –nur durch starkes Exportwachstum ausgeglichen werden. Das macht diese Länder abhängig von Welthandel und der Entwicklung in den zentralen Industrieländern (inklusive China). Jeder globale Einbruch führt dazu, dass die Folgen der Überakkumulation sofort gespürt werden. Dazu kommt, dass in der Globalisierungsperiode die kapitalistische Produktion stark entlang internationaler Produktionsketten von Komponenten und Dienstleistungen organisiert wurde. Dies hat eine „Wertschöpfungskette“ von den hochspezialisierten bis zu den niedrig bewerteten Tätigkeiten eingeführt, in denen der Großteil der „Wertschöpfung“ tatsächlich an der Spitze der Produktionsketten abgegriffen wird.
Globale Produktion als Produktions- und Aneignungsprozess von Mehrwert
Zu den globalen Wertschöpfungsketten („global value chains“; GVC) gibt es inzwischen umfangreiche Studien und statistische Indikatoren, die speziell auch als „Entwicklungsindikatoren“ dienen[xxxix]. Insgesamt ist in der Globalisierungsperiode der Anteil an GVCs am Welthandel stark gestiegen: Während der Anteil der nur im Inland produzierten und konsumierten Güter an der Weltproduktion von 85 % (1995) auf heute 80 % zurückgegangen ist, wuchs der traditionelle Exporthandel nur moderat – entscheidend war das Wachstum des Handels mit Zwischenprodukten oder produktionsbezogenen Dienstleistungen. Diese machen inzwischen zwei Drittel des Welthandels aus. Die GVCs reichen dabei von einfachen Zulieferproduktionen (nur 1-2 Grenzüberquerungen bis zum fertigen Produkt) bis zu komplexen Netzwerken von sehr vielen über viele Länder verstreuten AkteurInnen.
Die WTO hat hierzu die etwas unübersichtlichen, aber informativen „Smile-Kurven“ entwickelt. In Abbildung 7 wird die Smile-Kurve für die Industrien für elektrische und optische Apparate dargestellt, in der die Daten von 35 Industrien, die über 41 Ökonomien zerstreut sind, aus den Input-Output-Tabellen der WTO kombiniert wurden. Dabei stellen die Zahlen neben den Ländernamen Kennzahlen für Industrien nach den WTO-Tabellen dar (z. B. steht „14“ für Elektro- und Optik-Industrie, „28“ für Finanzdienstleistungen, „12“ für Metallverarbeitung). Um die Ländernamen werden Kreise gezeichnet, die den „Wertanteil“ der jeweiligen Länderindustrien in der Produktstufe darstellen (außer bei China in der Abbildung schwer zu erkennen). Die schraffierte Fläche um die Kurve stellt das Ausmaß der Kompensationen dar, wie die einzelnen Stufen im Produktleben in die Preisbildung eingehen, bevor es zum Endprodukt für die KundInnen kommt. Deutlich wird, dass dieses am Beginn (Planung, Entwicklung, Finanzierung, etc.) und am Ende (Verkauf, Service, etc.) der GVC am größten ist (das „obere Ende“ der Wertschöpfungskette). Da die senkrechte Achse die Lohnkompensation (pro Stunde) in den jeweiligen Stufen darstellt, wird deutlich, dass die Stufen, die am meisten mit Produktion zu tun haben, auch die mit der geringsten Kompensation sind. Bei der Kette handelt es sich also eigentlich weniger um eine „Wertschöpfungskette“ als vielmehr um eine Wertaneignungskette – die produktive Arbeit wird in der Senke der Kurve geleistet, deren Wertproduktion aber vor allem an den beiden Enden der Kette in Preise transformiert. Ein Großteil des Preises machen offensichtlich die Preiszuschläge der großen Handelskonzerne aus („20“ steht für den Großhandel).
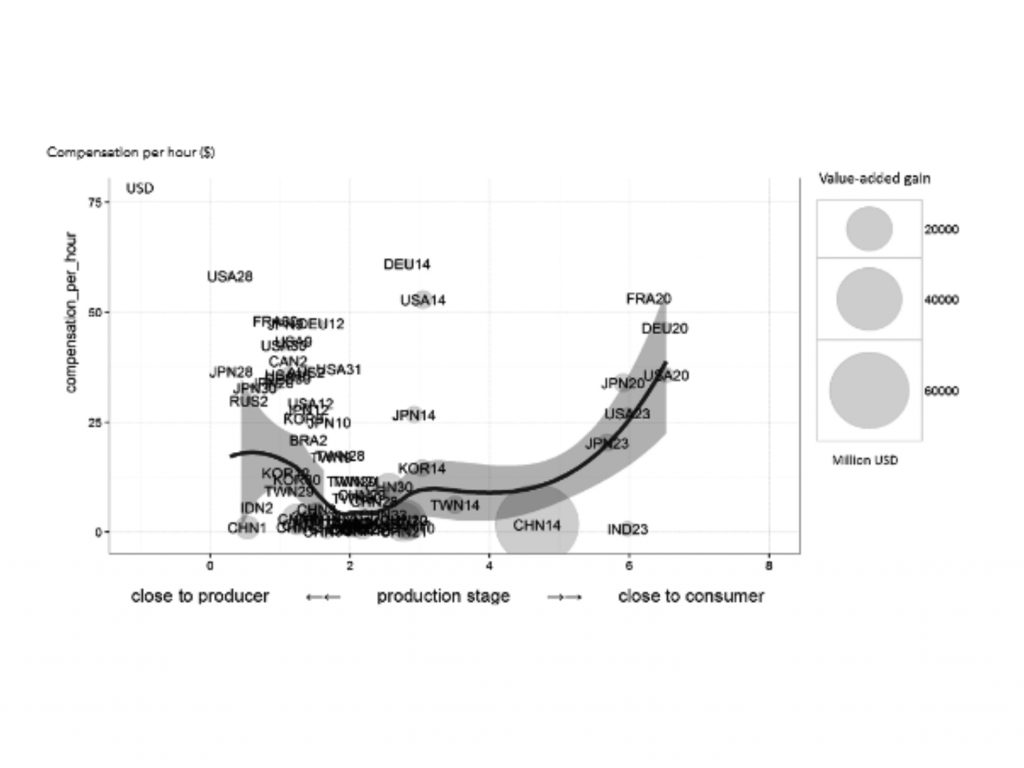
Abbildung 7: Wertschöpfungskette für elektrische und optische Apparate 2005 [xl]
Die traditionell ungünstigen Beziehungen zwischen Peripherie und Zentrum über die Terms of Trade nach Prebisch/Singer erweitern sich somit heute zusätzlich durch die Zuordnung zu ungünstigen Positionierungen in den GVCs. In der Smile-Kurve wird dies deutlich einerseits an der kaum mehr lesbaren Wolke an Länderindustrien am Minimum der Kurve, wo vor allem asiatische Zulieferbetriebe zu finden sind. Alle zeichnen sich durch ein auf niedrigen Löhnen basierendes Exportmodell aus. China konzentriert einen großen Anteil am Ende der eigentlichen Produktionskette, also nahe der Endmontage. Ein kleinerer Teil der Produktion wird weiter „hochpreisig“ in Ländern wie Deutschland, den USA und Japan durchgeführt. Auch Südkorea ist eher im Aufstieg in diesem Segment, d. h. verlässt die Region der Billiglohnländer. Inzwischen kann man bei vielen dieser Branchenuntersuchungen feststellen, dass China in der „Wertschöpfungskette“ aufsteigt und selber Stufen zu Beginn und am Ende der Produktkette übernimmt. Auf jeden Fall hat sich ein weltweites Muster herausgebildet, das für die globale Produktion wenige große Zentren aufzeigt, um die ein Netz von Satelliten gruppiert sind. Die zentralen Player dabei sind die USA, China, Deutschland (mit Frankreich und Italien als Co-Zentren), Japan und Südkorea (siehe Abbildung 8).
Dabei ist auffällig, dass die Produktionsnetzwerke im Jahr 2000 noch sehr lose zusammengefügt waren und vor allem in den europäischen und den asiatisch-pazifischen Raum getrennt waren. Um 2005 wird klar, dass China ein eigenes Zuliefernetzwerk in Asien aufgebaut hat, in dem Taiwan eine zentrale Rolle spielt. Aber auch Japan und Südkorea begannen im Windschatten des China-Booms mit dem Aufbau ihrer tieferen internationalen Produktionsketten, während das europäische Netzwerk auf lateinamerikanische Industrien und Russland ausgriff. 2011 stellt den Punkt der größten Annäherung der drei Blöcke dar, in der es zunehmend auch vor allem zwischen asiatischen und europäischen Industrien Vernetzungen gab.
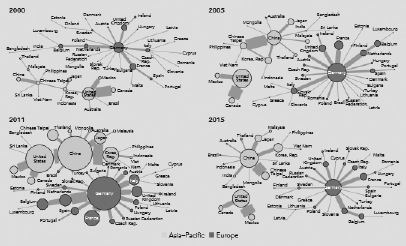
Abbildung 8: Netzwerk der GVCs [xli]
Mit der großen Rezession und der folgenden Stagnationsperiode kam es zu einem Rückbau der Internationalisierung (zum Teil wurde durch Insourcing wieder Verlagerungstiefe zurückgenommen). Insbesondere haben sich die USA inzwischen wieder stärker auf protektionistische Politik und Rückfluss von Kapital orientiert, was sich auch im Abbau von internationalen Produktionsketten außerhalb Nordamerikas/Mexikos ausdrückt. Auch in der EU sind seit der Euro-Krise und der Stagnation in den zentralen Ökonomien Rückbautendenzen zu erkennen. Davon und durch das geringere Wachstum des Welthandels insgesamt blieben auch der Block um China, Japan und Südkorea nicht unberührt.
Hierarchien in der globalen Ökonomie
Was das Schicksal der neu industrialisierten Länder betrifft, so spricht auch die WTO-Studie von einer in der Entwicklungsökonomie viel besprochenen „middle-income trap“ [xlii]. Damit wird gemeint, dass einige der sich besonders rasch industrialisierenden Länder zwar eine Zeitlang zu Treibern globaler Aufschwünge werden, dabei auch beträchtliches Kapital und Know-how ansammeln, dann aber von der nächsten Krise besonders getroffen und wieder zurückgeworfen werden. Sie scheinen bereits an der „Schwelle“ zu einer Ökonomie wie die „reichen Länder“ zu sein, schaffen es aber nicht, deren Krisenbewältigungsfähigkeiten zu erlangen. Exemplarisch führt die WTO-Studie folgende „Entwicklungsstufen“ ein:
- Stufe 0: Abhängigkeit von Agrar- und Rohstoffexporten und Kapitalimport
- Stufe 1: Einfache Zulieferindustrien (Beispiel: Vietnam)
- Stufe 2: Konzentration von Industrien, eigene Zulieferketten (z. B.: Malaysia, Thailand)
- Stufe 3: Fähigkeit zur Produktion von hochtechnischen Produkten (z. B.: Südkorea, Taiwan)
- Stufe 4: „Global leader“ (z. B.: USA, EU, Japan, China)
Wie auch die WTO-Studie feststellt, sind es Probleme in der Kapitalbildung, der Struktur der Ökonomie und Faktoren der globalen politischen Ordnung, die auf Stufe 2 und 3 gegenüber der jeweils nächsten Stufe wie „gläserne Wände“ den weiteren Aufstieg zu verhindern scheinen.
Für die Möglichkeiten und Grenzen der Entwicklung unter kapitalistischen Bedingungen ist neben der Kapitalmasse, der Kapitalproduktivität, der Position im Welthandel und in den globalen Wertschöpfungsketten, die Einkommensentwicklung entscheidend, insbesondere insofern sie das langfristige Verhältnis zwischen Kapital und Arbeit widerspiegelt. Grundlegende Indikatoren dafür sind die Verhältnisse von BIP-Wachstum und Anteil der Löhne dabei. Das Volumen des Nationaleinkommens (als Maß des produzierten Neuwerts pro Jahr), abgeleitet aus dem BIP, stellt dabei das maximal zu verteilende Einkommen auf die Masse der Bevölkerung dar. Das Wirtschaftswachstum im Vergleich zwischen den Ländern von unterschiedlichen Entwicklungsstufen stellt damit einen ersten Anhaltspunkt dar:
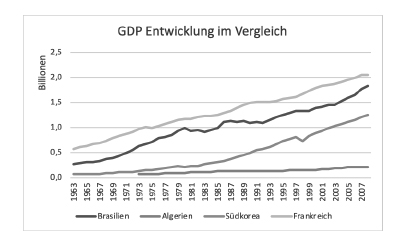
Abbildung 9 Reales BIP in KKP von 2005 [xliii]
In der Abbildung wird klar, dass das starke Wachsen des Kapitalstocks in Algerien zugleich mit einem im Vergleich sehr schwachen Wachstum gekoppelt war, das erst in den 2000er Jahren leicht nach oben ging. Das Wachstum eines wenig spektakulären Zentrumlandes wie Frankreich stellt sich dagegen fast linear dar, mit kaum wahrnehmbaren „Dellen“ 1974, 1981, 1991 und 2000. Das gesamte BIP von Brasilien, das dreimal mehr Menschen als Frankreich bevölkern, liegt die ganzen Jahre hinter dessen BIP zurück (Algerien, mit der Hälfte der Bevölkerung, hat dagegen ein kaum wahrnehmbares BIP). Dagegen waren die Wachstumseinbrüche Ende der 1970er Jahre, Mitte der 1980er Jahre und (wenn auch nicht so ausgeprägt) Ende der 1990er Jahre jeweils dramatisch, mit schwerwiegenden Folgen für das Einkommen vieler. War das Wachstum in Algerien viel zu gering, um der zunehmenden Bevölkerung ein erträgliches Einkommen zu garantieren, so waren es die Einbrüche im Wachstum, die der stark wachsenden brasilianischen Bevölkerung große Einkommensprobleme bescherten. Schließlich zeigt das Beispiel Südkoreas, mit einem Viertel der Bevölkerung Brasiliens, ein BIP-Wachstum, das ein Einholen des großen Brasiliens fast möglich erscheinen ließ. Angesichts der steigenden Kapitalzusammensetzung der südkoreanischen Industrie ist dieses Wachstum aber auch erforderlich (wie später bei der Profitratenbetrachtung noch zu sehen sein wird). Allerdings führte die Wirtschaftsentwicklung 1997 in der „Asienkrise“ zu einem starken Einbruch (– 5,5 %), der jedoch in den 2000er Jahren wieder wettgemacht werden konnte. Ersichtlich ist auch, dass Brasilien ebenfalls in den 2000er Jahren auf den starken Wachstumspfad zurückzukehren schien und parallel zu Südkorea wuchs. In der gegenwärtigen Stagnationsphase der Weltwirtschaft werden beide Länder wieder von Wachstumsproblemen gebeutelt (Wachstumsraten von unter 3 % sind für Südkorea angesichts des großen Kapitalstocks problematisch, und werden wesentlich durch das Geschäft mit China und Japan aufrechterhalten).
Diese BIP-Veränderungen müssen noch in Beziehung gesetzt werden zu einem Bevölkerungswachstum, das in demselben Zeitraum Brasilien und Algerien fast verdreifacht hat, Südkorea verdoppelt, während Frankreich nur um etwa 50 % wuchs. Selbst bei einer fiktiven Gleichverteilung der Einkommen muss es daher negative Effekte auf die möglichen Einkommen in den unterschiedlichen Regionen geben. Piketty stellt folgende Gesamtrechnung für die Welt angesichts der unterschiedlichen Proportionen von Bevölkerung und BIP in den Hauptregionen auf:
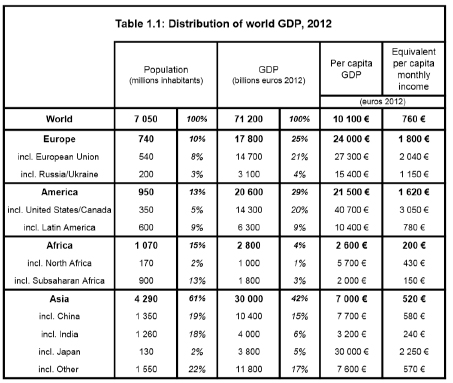
Abbildung 10: Weltweite Verteilung von BIP und Nationaleinkommen pro Kopf [xliv]
Trotz mehrerer Jahrzehnte, in denen einige „Schwellenländer“ große ökonomische Wachstumsraten gegenüber dem alten Zentrum aufwiesen, produzieren die auf 13 % der Weltbevölkerung geschrumpften EinwohnerInnen EU-Europas und Nordamerikas weiterhin 41 % des Welt-BIP (zur Erinnerung: Bei den Vermögen ist es noch einseitiger mit 62 % des Weltvermögens). Die Wachstumsverschiebung hat angesichts des jeweiligen Bevölkerungsanstiegs daher nur geringe Veränderungen im Verhältnis BIP pro Einwohner gebracht. Vom BIP müssen Abschreibungen und die Außenbilanz abgerechnet werden, so dass sich daraus das monatlich verfügbare Einkommen pro Einwohner ergibt (bei Gleichverteilung). Dieses ist in der Tabelle in der äußersten rechten Spalte in Euro zu ersehen. Es ist nicht erstaunlich, dass sich Afrika mit 200 Euro weiterhin am untersten Level der Einkommensniveaus befindet (wobei Algerien mit 450 Euro noch über dem nordafrikanischen Durchschnitt liegt!). Trotz des großen Aufholprozesses in Asien liegt es weiter nur bei 520 Euro. Dabei ist dies auch in Asien weiterhin stark ungleich verteilt, mit Japan bei 2.250 Euro und Südkorea bei 1.700 Euro. Die Megaländer China mit 520 Euro, aber vor allem Indien mit 240 Euro finden sich weiter bei den „mittleren“ bzw. unteren Einkommen. Trotz der krisenhaften Entwicklung in Lateinamerika liegt dieses mit 780 Euro noch darüber. Auch hier gibt es große Unterschiede: von Chile mit 960 Euro über Brasilien mit 660 Euro bis Bolivien mit 275 Euro. Die Einkommen der „reichen Länder“ in Europa, Nordamerika, Japan und auf der Südhalbkugel liegen dagegen 3-4 mal über dem Weltdurchschnitt (760 Euro).
Die Weltbank verwendet das Verhältnis von Bruttonationaleinkommen zu EinwohnerIn als „Entwicklungsindikator“ und teilt dabei die Länder in die vier Kategorien „niedriges“, „unteres mittleres“, „oberes mittleres“ und „hohes“ Einkommen. Diese entsprechende Kategorisierung wird jährlich veröffentlicht und ist auch als historische Zeitreihe erhältlich [xlv]. Auch wenn die Grenzziehungen stark willkürlich sind (für das oben betrachtete Jahr war die Grenze zu „oberen mittleren“ Einkommen bei 320 Euro, zu „hohem“ bei etwa 1.000 Euro), so lassen sich doch langfristige Trends erkennen. Brasilien gehört zwar generell zu den „oberen mittleren“, fiel aber mehrfach kurzfristig in die „unteren mittleren“ (Ende der 1980er Jahre, Anfang der 2000er). Algerien fiel Ende der 8190er Jahre vom oberen Mittel ins untere, um erst wieder 2008 ins obere Mittel zu steigen. Indien stieg erst 2007 überhaupt von der Kategorie „niedrig“ zur Kategorie „unteres Mittel“ auf, um dort seither zu verharren. China dagegen stieg 1997 zu „unterem Mittel“ auf, um 2010 ins „obere Mittel“ zu gelangen. Schließlich stieg Südkorea 1995 zur Kategorie „Hoch“ auf, um 1998 wieder zu „oberes Mittel“ abzufallen, aber verharrte dann ab 2001 in „Hoch“. Insgesamt sind 78 Länder heute in den beiden unteren Kategorien zu finden, also als „arme“ zu bezeichnen. Die 60 Länder in der dritten Kategorie sind zwar rund um den Durchschnitt des Welteinkommens gruppiert und werden heute allgemein als „middle income countries“ bezeichnet, sind aber im Vergleich zu den reichen Ländern in Europa und Nordamerika tatsächlich auch nur an der „Schwelle“ zur Überwindung von Armut, nicht auf dem Sprung zu „reichen Ländern“ wie oft mit dem Begriff „Schwellenländer“ suggeriert wird.
Die Größe des Neuwerts, der in einem Land produziert wurde, sagt noch nichts darüber aus, wieviel davon tatsächlich bei denen ankommt, die ihn produziert haben – den Lohnabhängigen. Dies ist abhängig letztlich von der jeweils spezifischen Klassenauseinandersetzung, aber auch dem Entwicklungsstand und der Stellung im Weltkapitalismus insgesamt. In Abbildung 11 wird die Lohnquote (der Anteil der Lohnsumme am Nationaleinkommen) von vier verschiedenen Ländern wiedergegeben, diesmal mit der USA als Repräsentantin der „reichen Länder“ (leider sind die Daten für Brasilien, Südkorea und Algerien aus den Penn-Reihen etwas unvollständig).
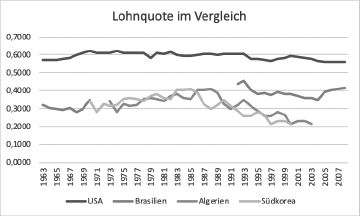
Abbildung 11: Lohnquote am Nationaleinkommen im Vergleich [xlvi]
Grob gesagt werden kann, dass in den 1960er Jahren in den reichen Ländern Lohnquoten um die 60 % üblich waren gegenüber 30 % im Rest. Dies drückt einerseits die größere gewerkschaftliche Organisation und andererseits die Integration der ArbeiterInnenklasse, insbesondere durch das aus, was Lenin die „ArbeiterInnenaristokratie“ genannt hat. Letzteres fehlte in den Halbkolonien, während die gewerkschaftliche Organisation zumeist mit repressiven Maßnahmen bis hin zur Militärdiktatur unterdrückt wurden. In der Krisenperiode der 1970er und frühen 1980er Jahre konnten die Lohnquoten in den Halbkolonien zumeist auf um die 40 % verbessert werden, während diejenige in den imperialistischen Zentren zumeist auf um die 55 % sank. Danach verlief die Entwicklung in der „Globalisierungsperiode“ sehr unterschiedlich. In den imperialistischen Zentren sank die Lohnquote weiter kontinuierlich gegen 50 % aufgrund der geschwächten Position der Gewerkschaften und neoliberaler „Reformpolitik“. Andererseits wurde das Wachstum in Asien kaum tatsächlich in höhere Löhne umgesetzt, so dass der Anteil der Lohneinkommen am Nationaleinkommen trotz des „Wirtschaftswunders“ sogar im Allgemeinen sank.
In Südkorea fiel während des ersten großen Exportbooms Mitte der 1980er Jahre die Quote von 40 auf 30 %, ein Fall der erst durch das Ende der Militärdiktatur etwas abgebremst wurde. Der nächste Exportboom in den 1990er Jahren und dessen Einbrüche (vor allem die Asienkrise) brachten die Quote weiter auf gegen 20 % herunter, wo sie heute verharrt. Angesichts des hohen Kapitalanteils (geringe Kapitalproduktivität) ist es klar, dass das südkoreanische Kapital weiterhin auf relativ geringe Löhne im Verhältnis zum Output angewiesen ist – nur so lässt sich das große angehäufte Kapital verwerten.
Auch wenn die Bewegung in Algerien einem ähnlichen Trend wie Südkorea zu folgen scheint, hat sie ganz andere Ursachen. Die stagnative, von Öl- und Gasexporten abhängige Ökonomie mit hoher Staatsquote konnte politische Stabilität nur durch Einkommensverbesserungen erzielen, die zu einem Anwachsen der Lohnquote bei einem wenig gestiegenen BIP führten (über 40 % bis Ende der 1980er Jahre). Damit gab es notwendig immer weniger Spielraum für Gewinneinkommen, was zum Ausbruch der Krise Ende der 1980er Jahre führte, als die Einnahmen aus dem Ölexport sanken. Im Verlauf der Krise stellte das algerische Kapital seine Profitabilität vor allem zu Lasten der Lohneinkommen wieder her, so dass im Gefolge der „Privatisierungspolitik“ die Lohnquote ebenfalls auf an die 20 % sank. Erst der große Generalstreik der UGTA konnte 2003 die weitere Abwärtsbewegung stoppen.
In Lateinamerika waren nach dem „verlorenen Jahrzehnt“ der 1980er Jahre die neoliberalen „ReformerInnen“ und ihre Militärdiktaturen weitgehend an den Rand gedrängt. Politische und ökonomische Konsolidierung konnten nur mit Hilfe von „linken“ und populistischen Kräften zusammen mit Konzessionen an die Gewerkschaften erzielt werden. So war das wiederaufkommende Wachstum in den 1990er Jahren mit einer Stabilisierung der Lohnquote bei 40 % in den meisten Ländern (wie auch in Brasilien) verbunden.
Insgesamt bleibt aber eine deutliche Lücke zwischen den Lohnquoten in den imperialistischen Zentren und im Rest der Welt, insbesondere was Asien betrifft. Nur China, das aus der planwirtschaftlichen Vergangenheit mit einer relativ hohen Lohnquote gestartet ist, liegt etwa im Bereich der alten Zentren (bei 48 %). Bei den niedrigen Löhnen, von denen zu Beginn der Globalisierungsperiode gestartet wurde, ist von dem großen Wachstumsboom also wenig in Lohnsteigerungen eingegangen. Das Weltkapital profitiert weiterhin von niedrigen Löhnen, insbesondere in Asien.
Tendenzen der globalen Profitratenentwicklung
Die Indikatoren Lohnquote und Kapitalproduktivität führen nun direkt zum zentralen Indikator für die Kapitalakkumulation aus marxistischer Sicht: der Profitrate. Für das Marx’sche Verständnis der Dynamik der Wachstumsbewegung ist entscheidend das Verhältnis von Entwicklung der Produktivkräfte (vergegenständlicht im Kapitalstock und einer disponiblen Lohnabhängigenmasse) und dem kapitalistischen Imperativ, das bestehende Kapital (in allen seinen Formen) zu verwerten. Die kapitalistische Form der Produktivkraftentwicklung verläuft unter dem Primat der Einsparung von Arbeitskosten und Erhöhung des Produktausstoßes (Produktivitätssteigerung). Dies führt zu einem Steigen des Anlagekapitals gegenüber der eingesetzten Arbeitskraft und bei gleichbleibender Mehrwertrate daher zu einem Sinken der Profitrate, gleichzeitig aber zu einer Erhöhung des produzierten Neuwerts und damit (Mehrwertrate!) auch der absoluten Profitmasse. Sofern das Mehr an Profit ausreichend ist, den gewachsenen Kapitalstock weiter zu verwerten, kann die Akkumulation auf erweiterter Stufenleiter fortgesetzt werden. Ist dies nicht der Fall, muss der überakkumulierte Kapitalstock in einer der Formen der kapitalistischen Krise entwertet werden. Bevor es soweit kommt, können „entgegenwirkende Ursachen“ wirken: Einerseits können Teile des Kapitalstocks (wie auch immer) schon vor der Krise entwertet und verbilligt werden. Weiter kann das Kapital auf verschiedene Weise die Mehrwertrate erhöhen (relativ, absolut; Umstrukturierung der Beschäftigung). Verwertungsprobleme können durch Schulden bzw. Umwandlung von Schulden in Kapital (Kapitalmarkt) zeitweise aufgeschoben werden und letztlich dient der Weltmarkt als Ventil (worauf noch näher eingegangen wird). Helfen alle diese Mittel (die im Wesentlichen nur aufschiebende Wirkung zeitigen bzw. sogar verschärfende) nicht, ist der zyklische Abschwung unvermeidlich. Im Krisenzyklus setzen sich die von den produktiveren Kapitalen (die die Krise überleben) eingesetzten Neuerungen allgemein durch, führen zu einem gesamtwirtschaftlichen Ausgleich der Profitrate auf niedrigerem Niveau, womit der nächste Zyklus einsetzt. Auf diese Weise kommt es zu einer langfristigen Tendenz zum Fallen der Durchschnittsprofitrate wie einer beständigen Ausdehnung der Produktion, begleitet von einem noch größeren Wachstum des Kapitalstocks.
In den 1960er Jahren wurde die Profitratentheorie von Marx nicht nur von Baran/Sweezy (die dies mehr auf empirischer Ebene taten), sondern auch von theoretischer Seite in Frage gestellt. Der japanische Wirtschaftstheoretiker Nobuo Okishio stellte 1961 Berechnungen an, nachdem bei gleichbleibenden Reallöhnen und einer Verbilligung von Produktionsmitteln im Gefolge von Produktivitätssteigerungen die Profitrate steigt und nicht sinkt. Dieses „Okishio-Theorem“ wurde auch von „MarxistInnen“ als Widerlegung des Profitratenfalls angesehen, da damals eine Reduktion von Wertkategorien auf Preiskategorien allgemein anerkannt wurde. In ausführlichen Kontroversen um das Okishio-Theorem wurde insbesondere auf wertanalytischem Hintergrund dieses Theorem widerlegt. Ohne auf die Details eingehen zu können, hat z. B. Andrew Kliman gezeigt, dass es darauf ankommt, wie die Kapitalzusammensetzung (Verhältnis von Lohnarbeit und Kapitalstock) bestimmt wird, die in die Profitratenberechnung eingeht. Marx selbst hat zwischen der „technischen Zusammensetzung“ (materielles Verhältnis von Produktionsmitteln als Vergegenständlichung vergangener Arbeit und der benötigten gegenwärtigen Arbeitszeit) und der „organischen Zusammensetzung“ (Wertausdruck der technischen Zusammensetzung aus konstantem und variablem Kapital) unterschieden. Für das Kapital, das einen alten durch einen neuen Produktionsprozess ersetzt, ändert sich die technische Zusammensetzung, ohne dass sich dadurch im gesamten Sektor (der diese Neuerung noch nicht eingeführt hat), die Wertzusammensetzung geändert hat. Umgekehrt führen technische Neuerungen, die Produktionsmittel verbilligen, die einige Kapitalisten zuerst einsetzen, ebenfalls noch nicht zu einer Änderung der Wertzusammensetzung. Schließlich führt die Durchsetzung, Verallgemeinerung der Wertänderung dazu, dass große Teile des bestehenden Kapitals entwertet werden, wodurch gerade die Teile des Kapitals, die noch die alte technische Zusammensetzung verwenden, Profit verlieren. Was also auf der Ebene des Einzelkapitals in Preiskategorien als Profitratensteigerung erscheint, ergibt sich auf der Ebene des Gesamtkapitals im Verhältnis von technischer und organischer Zusammensetzung des Kapitals als Profitratenminderung für das Gesamtkapital. Betrachtet werden muss daher die Profitrate nicht als Verhältnis von Profitmasse zum Kapitalstock in seinen gegenwärtigen, auf modernster Technik beruhenden Preisen, sondern in dessem „historischen“ Wert (eine Differenz, die sich für das Kapital in größer werdender „Abschreibung“ ausdrückt).
In der statistischen Auswertung ist es daher wichtig, für die Profitratenberechnung vom „historischen“ Wert des Kapitalstocks auszugehen und nicht die Wiederbeschaffungspreise, sondern die historischen Preisreihen zu verwenden. Außerdem ist in den vorhandenen Statistiken oft eine Vermengung von produktivem Kapital und anderen Kategorien (z. B. Handel, Banken, Dienstleistungen etc.) gegeben. Ein richtiger Ausgangspunkt für die Profitratenberechnung ist daher, z. B. zunächst eine „sichere“ Ausgangsbasis zu wählen, z. B. die nicht-finanziellen Gesellschaften („non-financial corporate business“) in den USA. Dieser ist bedeutend genug, um Sondereffekte und Nischenbereiche zu umgehen und ist weltweit so bestimmend, dass er als Leitindex für alle anderen Profitratenbetrachtungen dienen kann. Zur Berechnung wird zumeist die Rendite auf den Kapitalstock herangezogen. Die Profitrate nach Marx vergleicht zwar Profitmasse zu eingesetztem Kapital PLUS Lohnsumme. Die Kapitalrendite ist jedoch offensichtlich eine obere Grenze für letzteren Bruch – und solange die Lohnsumme nicht sinkt, hat diese auch keinen dämpfenden Effekt auf die Gesamtrate. Daher ist diese Vereinfachung akzeptabel. Schließlich kann noch die Art der Bemessung der Profitmasse diskutiert werden (vor oder nach Steuer- und/oder Zinsabzügen auf verschiedenen Stufen in der Bilanzierung von Gewinnen). Eine übersichtliche Darstellung mit entsprechenden Berechnungen findet sich bei T. Kalogerakos [xlvii]. Seine Berechnung des Verlaufs der Profitrate für nicht-finanzielle Gesellschaften in den USA von 1945 bis 2008 findet sich in Abbildung 12.
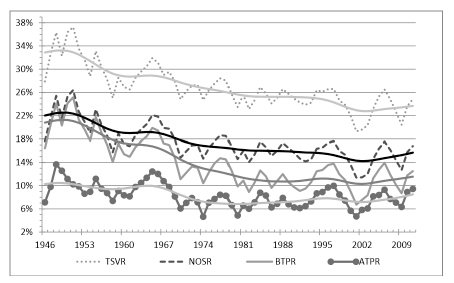
Abbildung 12: Profitrate nicht-finanzieller Gesellschaften in den USA, 1946-2011 [xlviii]
Die oberste Kurve (TSVR) bezeichnet das Verhältnis von „Gross Profit“ (also dem Gewinn ohne jegliche Abzüge außer Lohn- und Produktionskosten) und Kapitalstock (in historischen Preisen). Die unteren Kurven beziehen sich auf unterschiedliche Abzüge vom Bruttogewinn (Steuern auf Produktionskosten, Zinsen und Dividenden, Gewinnsteuern). Die durchgezogenen Linien sind Anwendungen von statistischen Filtern, die zyklische Abweichungen begradigen.
Erkennbar ist jedenfalls der langfristige absteigende Trend, insbesondere der Bruttoprofitrate, der sich allerdings stark zyklisch durchsetzt. So sieht man ein scheinbares Abheben der Profitrate Mitte der 1950er Jahre, dem ein Einbruch Mitte der 1960er Jahre folgt. Diese kann erst in den 1980er Jahren auf niedrigerem Niveau wieder stabilisiert werden. Es folgt ein neuerliches scheinbares Abheben Anfang der 1990er Jahre, das schon in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts wieder stark einbricht. Die Erholung Anfang der 2000er kennen wir heute als von den Finanzmärkten aufgeblähten Scheinaufschwung, der in der großen Rezession von 2008/2009 mündete. Die Fortsetzung der Geschichte kann man regelmäßig aktualisiert im Blog von Michael Roberts nachlesen. Danach gab es zwar bis 2012 wiederum eine Erholung der Profitrate bis fast auf Vorkrisenniveau, um dann ab 2014 bis 2018 auf einen Wert unter 23 % zu fallen (mit langfristigem Trend zu weiterem Fallen).
Auffällig ist auch, dass das, was letztlich bei den Unternehmen an Gewinn verbleibt (nach allen Abzügen) relativ konstant ist – außer einem leichten Absinken in den 1970er Jahren. Dies ist offensichtlich vor allem auf Steuererleichterungen für die Unternehmen zurückzuführen. Andererseits drückt vor allem die Öffnung zwischen den beiden mittleren Kurven den Anstieg der Einnahmen des Finanzkapitals aus den Unternehmensgewinnen aus, deutlich zu Lasten der Steuerabgaben.
In einem lesenswerten Artikel [xlix] aus dem Jahr 2009 hat Dave Zachariah wichtige Anstöße für ein genaueres, auch mathematisches Verständnis der Profitratentheorie von Marx geliefert. Durch seine wahrscheinlichkeitstheoretische Deutung der Werttheorie (die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit stellt sich ja immer erst „im Nachhinein“ her), kommt er zu weit präziseren Akkumulationsmodellen als solche, die Wertbegriffe durch neoklassische Variablen (in Preiskategorien) simulieren. Hierbei wird die Profitrate zu einem Erwartungswert, der sich aus verschiedenen möglichen Verteilungen von Kapital und Arbeit gemäß unterschiedlicher technischer Zusammensetzung des Kapitals ergibt. Ohne hier näher auf die Hintergründe einzugehen, sei nur gesagt, dass die Ausarbeitung Zachariahs dazu führt, dass es im Wesentlichen drei Komponenten gibt, die die Richtung der Entwicklung der Profitrate bestimmen:
„über dem Bruchstrich“: Wachstum von Beschäftigung (mehr ArbeiterInnen)
„über dem Bruchstrich“: Wachstum der Arbeitsproduktivität (mehr Wert pro ArbeiterIn)
„unter dem Bruchstrich“: Wachstum der Bruttoinvestitionen (Ersatz-/Neuanschaffung von Kapital)
Letzteres ist insofern wesentlich, da mit größer werdendem Kapitalstock, das Ausmaß der Ersatzinvestitionen enorm zunimmt und mit den geringer werdenden Neuinvestitionen der Spielraum für Steigerungen der Arbeitsproduktivität und Neubeschäftigung abnimmt. Die folgende Abbildung zeigt, dass in den alten Industrienationen das Gewicht der Ersatzinvestitionen gegenüber der Profitmasse (ganz wie Marx es vorausgesagt hat) immer stärker ansteigt:
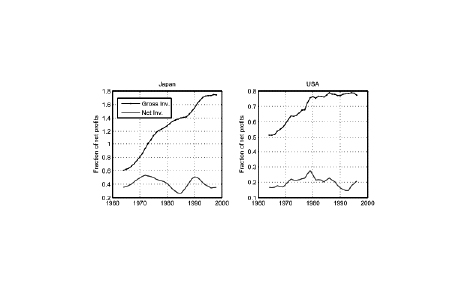
Abbildung 13: Brutto- und Nettoinvestitionen in Relation zum BIP [l]
In den USA ist ersichtlich, dass die Gesamtinvestitionen seit den 1980er Jahren bei etwa 80 % der Profitmasse liegen, aber nur noch unter 20 % für Neuinvestitionen zur Verfügung stehen. In Japan übersteigen die Bruttoinvestitionen schon seit Mitte der 1970er Jahre die Eigenfinanzierung aus dem Profit, was längerfristig auch das relativ hohe Niveau von Neuinvestitionen seit den 1990ern zurückgehenlässt. Die Lücke zwischen Bruttoinvestitionen und Neuinvestitionen, die hier aufgeht, bedeutet letztlich, dass immer mehr akkumuliert wird, um bestehendes Kapital zu verwerten und der Spielraum für Steigerungen der Produktivität (als wesentliche entgegenwirkende Ursache zum Profitratenfall) geringer wird. Dieses Moment ist insbesondere seit Beginn der 2010er Jahre v. a. in den USA bestimmend.
Die genannten Faktoren machen für die Betrachtung von armen bzw. „mittleren“ Ländern klar:
- Das Akkumulationspotential ist durch großes Arbeitskräfteangebot, geringeren Kapitalstock und große Möglichkeiten zu Produktivitätssteigerung hoch (Start mit hohen Profitraten)
- Mangel an Kapital, Restriktionen zu Technologiezugang und fehlende „Mobilität“ von Arbeitskräften („rasch Beschäftigte mit richtigen Qualifikationen finden“) sind interne entgegenwirkende Faktoren.
Deswegen waren die Entwicklungen der letzten Jahrzehnte in allen diesen Ländern sehr verschieden, je nachdem wie die Potentiale für die Steigerung der Profitrate einerseits und den Kapitalaufbau andererseits genutzt werden konnten. Die folgende Abbildung zeigt einen Vergleich der Kapitalrenditen(Vorsicht: die Berechnung mithilfe von Kapitalproduktivität und Gewinnquote aus den Zahlen der Gesamtökonomie liefert nur einen Anhaltspunkt für die tatsächliche Profitrate; außerdem ist die Penn-Reihe wieder lückenhaft und liefert für China natürlich erst seit 1995 Zahlen):
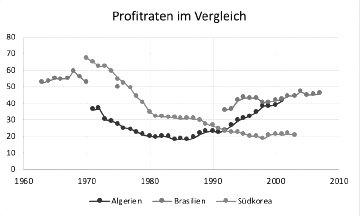
Abbildung 14: Profitratenberechnung auf Basis der EPWT
Für viele „Entwicklungsländer“ galt in den 1960er Jahren, dass sie von wesentlich höheren Profitraten als die imperialistischen Zentren starteten (z. B. Südkorea bei 70 %, Brasilien zwischen 50 und 60 %, gegenüber unter 40 % in den USA). Dies entspricht mehr den Erwartungen in Investitionsmöglichkeiten als tatsächlichen großen Fortschritten in der damaligen Zeit. Länder wie Algerien, die durch die Erdöl- und Erdgasindustrie schon einen großen Kapitalstock „geerbt“ hatten, fingen naturgemäß mit einer weitaus geringeren Profitrate an (hier 40 %).
Südkorea folgt dem klassischen Akkumulationsmodell: mit sehr schnell steigendem Kapitalstock sinkt sogar bei sinkender Lohnquote die Profitrate, bis sie sich um 2000 auf niedrigem Niveau stabilisiert. Wie gesehen hängt dies vor allem an einem langsameren Wachstum des Kapitalstocks gegenüber dem Wirtschaftswachstum, aber auch einem weiteren Sinken der Lohnquote. Beides deutet darauf hin, dass es Südkorea gelungen ist, seine Arbeitsproduktivität wesentlich zu verbessern.
In Brasilien wiederum führte der rasche Aufbau des Kaitalstocks während der Militärdiktatur (Halbierung der Kapitalproduktivität) schneller zu einem Sinken der Profitrate. Hier wirkte die Krise der 1980er Jahre, die den Aufbau des Kapitalstocks bremste, hin zur Wiederherstellung einer höheren Profitrate in den 1990er Jahren. Das wiederum befeuerte erneute Investitionen in Brasilien bis zum Einbruch nach 2014.
In Algerien ist der Fall der Profitrate in den 1970er Jahren kein Zeichen der Überakkumulation wie in Südkorea, sondern Ergebnis von geringer Veränderung von Arbeitsproduktivität und Beschäftigung im produktiven Sektor gegenüber einem aufgeblähten Kapitalstock der Energiewirtschaft. Das Sinken der Profitrate unter 20 % in den 1980er Jahren war zusammen mit der Krise der Ölindustrie der Auslöser einer schweren Wirtschaftskrise. In deren Verlauf wurde die Profitabilität offensichtlich wiederhergestellt. Wie an den zuvor dargestellten Daten ersichtlich, gelang dies vor allem durch ein extremes Senken der Lohnquote, d. h. von Löhnen und staatlichen Leistungen.
Wie ersichtlich, folgt der Verlauf der Profitraten in den Ländern mit abhängiger Entwicklung weniger eindeutigen Trends als die der US-Gesellschaften. Verschiedene Faktoren führen zu sehr unterschiedlichen Verläufen in den Ländern und Regionen. Außerdem sind die Ausschläge und Veränderungen weitaus dramatischer (auch im Volumen der Veränderung). Während sich die Entwicklung der Profitrate der US-Gesellschaften weitgehend aus endogenen Faktoren erklären lässt, sind für die nachholende Entwicklung exogene Faktoren, die als positive oder negative Einflüsse erscheinen (Abhängigkeit von Rohstoffexport oder -import, fehlende Arbeitskräfte, fehlendes investives Kapital, Verschuldungsproblem, … ), zusätzlich wichtig.
Architektur des Weltmarktes nach 1945
Die beschriebenen Momente in der Akkumulationsbewegung des Kapitals erklären nun auch Besonderheiten in der Entwicklung des Weltmarktes für Kapital und Waren. Die Überakkumulation von Kapital (wie sie oben insbesondere beim Verhältnis von Investitionen und Profit in der japanischen Ökonomie deutlich wurde) zwingt die großen Kapitale notwendigerweise, über Grenzen verschiedener Art hinauszugehen. Dies betrifft einerseits die Grenzen des Kapitals selbst (hin zu Finanz- und fiktivem Kapital), andererseits die tatsächlichen nationalen Grenzen. Es ist durchaus wichtig, beide Aspekte im Zusammenhang zu betrachten – und offensichtlich spielt bei beidem auch der Staat bzw. die „internationale Ordnung“ eine wichtige Rolle.
Die jeweilige nationale Sphäre des Kapitals ist zunächst auch eine Zirkulationssphäre, mit eigenem Geld, Finanzinstitutionen, staatlich geregelten Märkten und Grenzen für Zu- oder Abwanderung von Arbeitskräften. Zwischen den Zirkulationssphären vermittelt zuerst das Verhältnis des Geldes als Währung mit bestimmten Tauschverhältnissen. Nach der Theorie der ökonomischen Klassik ergibt sich das Tauschverhältnis zwischen den Währungen zweier Nationen aus den unterschiedlichen Verhältnissen ihrer Arbeitsproduktivität. Darauf basiert Ricardos Lehre von den „komparativen Kostenvorteilen“: Länder mit schwächerer Arbeitsproduktivität sind aufgrund von Handelsdefiziten zur Währungsabwertung gezwungen, wodurch in Folge bestimmte ihrer Sektoren konkurrenzfähig zu denen der produktiveren Länder würden. So sorge der Währungsmechanismus für eine internationale Arbeitsteilung zum Vorteile aller („Win-Win-Situation“). Offensichtlich ist Ricardos Lehre verbunden mit der Hypothese eines Freihandelsregimes und eines auf dem Goldstandard beruhenden internationalen Währungssystems: Ein Land mit Handelsüberschüssen sammelt Fremdwährung, die es zu Fälligkeitsterminen in „Goldziehungsrechten“ von den Ländern mit Handelsdefiziten begleichen kann. Die geringere reale Goldmenge dort bedeutet dann im internationalen Zahlungsverkehr eine Abwertung von deren Währung. Dieses Ideal des kapitalistischen Weltmarktes wird schon dadurch modifiziert, dass selbst im „Freihandelskapitalismus“ eine Unmenge an Handelsbeschränkungen und Zollschranken bestanden. Außerdem gibt es Ausgleichsbewegungen mit Einfluss auf die Arbeitsproduktivität durch die Zu- und Abwanderung von Arbeitskräften (oft mit folgenden Transferzahlungen in der stärkeren Währung).
Vor allem jedoch fließt Geld zwischen Ländern nicht nur in der Vermittlung des Austausches von Waren. In Ländern mit größerer Kapitalakkumulation entsteht die Tendenz, überakkumuliertes Kapital, das sich im Inland nicht mehr produktiv (mit entsprechenden Profitraten) anlegen lässt, im Währungsausland zu investieren. Dies kann sowohl in Form von zinstragendem Kapital, von Anlage auf Kapitalmärkten, als auch in direkter produktiver Anlage geschehen. Die stärkere Währung verbilligt noch zusätzlich die Anlage, die aber nur produktiv sein kann, wenn die Währungsverluste beim Rücktransfer durch entsprechend höhere Profitraten ausgeglichen werden. Die Masse des Rückflusses wird zusätzlich die Währung des Landes mit höheren Verbindlichkeiten schwächen. Da die Kreditfinanzierung immer mehr zum Standard internationaler Zahlungsvorgänge wurde, hat auch längst das Kreditgeld den Goldstandard ersetzt. Seit dem Zusammenbruch des Währungssystems von Bretton Woods (benannt nach einem Ort in New Hampshire, USA) Anfang der 1970er Jahre ist der US-Dollar (jenseits der Goldbindung), mit dem Euro (seit den 2000ern) als Reservewährung, zur Basis des internationalen Zahlungsverkehrs geworden. Jedes Land muss entsprechende US-Dollar- (und Euro-) Reserven vorhalten, die bei langfristigen Handels- oder/und Kapitalbilanzdefiziten abschmelzen – oder eben die Währung abwerten. Mit Währungsabwertung ist sofort Verteuerung der Importe (d. h. zumeist Inflation) und eine Verbilligung ausländischer Kapitalanlage verbunden. Nur die USA (und in beschränkterer Weise auch die EU und Japan) können eine expansive Geldpolitik betreiben, ohne Folgen für die eigene Währung. Die Handelsbilanzdefizite der USA werden so durch eine hohe Inlandsverschuldung gedeckt, ohne auf die Stärke des US-Dollar zu wirken (entgegen der Lehre von den gegenseitigen Kostenvorteilen). Die Rolle des US-Dollar als Weltgeld gibt den USA einen quasi unbeschränkten Kreditrahmen, solange alle anderen Länder ihre Währungspolitik über den US-Dollar abwickeln.
Geschichtlich gesehen war der spanische Silberdollar seit dem 16. Jahrhundert das erste Weltgeld. Die jahrhundertelange Ausbeutung der bolivianischen und mexikanischen Silberminen und der „Silberhunger“ in China und Indien schufen eine globale Zirkulation von Silbergeld und „Welthandelswaren“ (SklavInnen, Zucker, Baumwolle, Tabak, Gewürze, Textilien, Porzellan, Transportleistungen, Waffen, … ), die in verschiedenen „Dreiecksbeziehungen“ internationale Handelszentren mit lokalen Märkten verbanden – und überall galt der spanische Silberdollar als anerkanntes Zahlungsmittel. Zugleich war der spanische Staat nicht in der Lage, eine entsprechende imperiale Rolle zu spielen, sondern versank sehr schnell in enormer Verschuldung (mehrere Staatsbankrotte schon im 17. Jahrhundert) und induzierte in Europa eine säkulare Inflation (schon allein dadurch, dass es eine große Differenz zwischen nominalem und realem Silbergehalt der in Umlauf gebrachten Münzen gab). Der Großteil des real durch europäischen Welthandel angeeigneten Mehrwerts wurde so in den nordeuropäischen Ökonomien (vor allem in den „7 unabhängigen Provinzen der Niederlande“ und England) akkumuliert, deren Handelsgesellschaften zu großen Welthandelsoperationen und frühindustrieller Fertigung in der Lage waren. Erst die industrielle Revolution mit konkurrenzlosen Billigwaren für den schon vorbereiteten Weltmarkt und der folgenden Verbilligung der Transportkosten schuf auch die Grundlagen für ein neues Weltgeld. Die ökonomische, politische und militärische Dominanz Großbritanniens auf „dem Weltmarkt“ brachte zum ersten Mal auch eine Macht hervor, die einen Weltwährungsmechanismus durchsetzen konnte. Nach der starken Entwertung des Silbers zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurde der bis dahin geltende Gold/Silber-Mix durch einen reinen Goldstandard ersetzt, wobei der Ausgleich des internationalen Zahlungsverkehrs in Bezug auf Gold, gemessen in „Pfund Sterling“, in letzter Instanz durch die Londoner Banken geregelt wurde. Der Zusammenbruch der britischen Hegemonie und die enorme Ausdehnung des Welthandels, aber auch der Finanzmärkte machten diese Bindung der Weltleitwährung an den Goldstandard immer unmöglicher. Auch wenn der US-Dollar als neue Weltleitwährung nach Bretton Woods zunächst wieder an den Goldstandard angebunden wurde, so ließ sich dies nicht lange halten: Wie Spanien waren die USA aufgrund ihrer Weltmachtrolle zu hoher Verschuldung gezwungen und eine Tendenz zur Stagnation der US-Industrie wurde begleitet von hohem Industriewachstum in Deutschland und Japan.
Inflation, Verschuldungsprobleme und die Überakkumulationskrisen der 1970er und frühen 1980er Jahre führten zu einer Phase des Übergangs zu einem neuen Weltwährungsmechanismus, der viel langwieriger und voller an Wendungen war, als es die Phrase vom „Zusammenbruch von Bretton Woods“ erscheinen lässt. Die Lösung, die Durchsetzung von auf Kredit basiertem Weltgeld in Form der Währungen zentraler imperialistischer Staaten (US-Dollar als Hauptwährung und von D-Mark, später Euro, und Yen als Reservewährungen) hat mehrere Voraussetzungen und Folgen: Sie ist stark an einen permanenten Aufschwung von globalen Handels- und Finanzmärkten gebunden, der Gewinne wieder in die Finanzierung der zugrundeliegenden Kreditformen (längst nicht mehr nur Staatsanleihen) zurückfließen lässt. Gelang dies zunächst über die Anerkennung von Offshore-Vermögen in diesen Leitwährungen (z. B. „Petrodollars“), so hat sich dies in eine starke Abhängigkeit von den deregulierten internationalen Finanzanlagemärkten hinein vervielfacht. Die oben entwickelte Vermögensinflation (gegenüber dem BIP-Wachstum) in den imperialistischen Ländern führt zu einer starken Anfälligkeit des Weltwährungssystems von den Anlagetendenzen dieser großen VermögenseignerInnen. Dazu kommt, dass die Verschuldungsprobleme außerhalb der imperialistischen Zentren damit genauso wenig gelöst sind wie die Fragen der Geldwertstabilität. Institutionen, die in Bretton Woods vorgeblich zum Ausgleich bei zeitweisen Handelsbilanzungleichgewichten oder zum Entwicklungsanschub gegründet wurden, nämlich IWF und Weltbank, wurden damit jetzt zu Instrumenten der Schuldenmoderation und des damit verbundenen Diktats von Wirtschaftspolitik im Interesse der GläubigerInnen.
Es wird somit klar, dass die Währungsrelationen nicht einfach auf unterschiedlichen Niveaus von Arbeitsproduktivität beruhen, sondern ebenso auf der Größe und Ausdehnungsfähigkeit der Kapitale der unterschiedlichen Länder und letztlich auch auf dem Währungsregime (heute dem US-Dollar als Weltkreditgeld). Was die unterschiedliche Verteilung des Kapitals weltweit, seine Zusammensetzung (Anteil des Finanzkapitals) und Überakkumulation (Zwang zur Suche nach produktiver Anlage betrifft), wurde oben schon einiges ausgeführt. Zusätzlich zur Neuordnung des internationalen Währungssystems während der 1970er und 1980er Jahre kommt jedoch auch noch die Veränderung der Weltmarkt- und Finanzmarkt-(De-)Regulierung hinzu. Entscheidendes Kriterium für „Kreditwürdigkeit“ sind seit den Verschuldungskrisen der 1970er und 1980er Jahre die von den „internationalen Institutionen“ geforderten Deregulierungen oder „Öffnungen“ des entsprechenden Landes in Bezug auf Waren- und Finanzmärkte. D. h. etwa Unterwerfung unter die Regularien der WTO, was Handelspolitik betrifft, Aufhebungen von Investitionsbeschränkungen, Verkauf wichtiger inländischer Industrien, keine Einschränkungen in Bezug auf Anlage auf dem inländischen Kapitalmarkt, Abverkauf der inländischen Banken etc. Das betrifft aber auch die Deregulierung der Finanzmärkte selbst: Abschwächung von Eigenkapitaldeckung und Regeln für die Besicherung von Finanzgeschäften, Aufhebung von internationalen Beschränkungen für Finanzgeschäfte, Verbriefung von fast allem (vor allem von Schulden aller Art), Erleichterung internationaler Finanzgeschäfte durch immer größere Fortschritte in der IT-Industrie, etc.
In Folge der „Entfesselung“ der internationalen Finanzmärkte in der Globalisierungsperiode ergab sich parallel zur Steigerung der globalen Akkumulation eine noch rascher wachsende von fiktivem Kapital. Wie wir an anderer Stelle ausführlich dargestellt haben, handelt es sich dabei (wie Marx schon im dritten Band des Kapitals entwickelt hat) um eine nur scheinbare Verdoppelung von Kapital: Tatsächlich Profit abwerfendes Kapital erscheint in Wertpapieren, die seine Verwertung repräsentieren, nochmals als „Kapital“. Durch die Berechnung eines fiktiven Kapitalpreises (wie etwa in der Wertpapierdiskontierung) scheint es, seine eigene Verwertung, losgelöst von seinem produktiven Ursprung, zu ermöglichen. Anders als beim Zins, der an bestimmte Fälligkeitstermine gebunden ist, und damit viel schneller an die Profitentwicklung rückgekoppelt ist, kann fiktives Kapital weiterwachsen, solange seine VerkäuferInnen immer wieder auch AbnehmerInnen finden. Die modernen Finanzmarktkrisen zeigen, dass die Profitabilitätsprobleme des Realkapitals irgendwann eben dazu führen, dass sich in genügend großer Zahl keine KäuferInnen mehr finden und es dann zum Crash kommt. In den 2000er Jahren waren die bürgerlichen ÖkonomInnen allgemein der Auffassung, dass eine Ausdehnung des Kredits, eine darauf basierende Verbriefung von Schulden und astronomisch wachsende Finanzmärkte letztlich auch das realwirtschaftliche Wachstum durch „Multiplikatoreffekte“ zum Abheben bringen würden. Tatsächlich führte dies zur Finanzkrise 2007, der Krise des internationalen Zahlungsverkehrs, dem Fast-Zusammenbruch des Welthandels und in Folge zu der schweren weltweiten Rezession 2008/2009. In Folge setzte man aber im Wesentlichen dieselbe Politik fort (wenn auch mit ein paar leichten Regulierungen in Bezug auf Sicherheiten und Eigenkapitaldeckung). Auch heute wird wieder auf das Wachstum der Finanzmärkte gesetzt und verdutzt darauf gesehen, dass das realwirtschaftliche Wachstum nicht vom Fleck kommt – um dann verwirrt zu erklären, dass sich vielleicht etwas fundamental am „Funktionieren der Märkte“ verändert habe, das man nicht versteht.
Es ist klar, dass sich diese „Explosion der Finanzmärkte“ vor allem in den imperialistischen Zentren abgespielt hat, wo nicht nur die größten Vermögen angehäuft, sondern auch die Institutionen beheimatet sind, die die weltweiten Vermögen für die Weiterinvestition einsammeln. Andererseits waren neben dem Immobiliengeschäft und den Investitionen in die neoliberale Privatisierung aber auch die Investitionen in die „emerging markets“, die „aufstrebenden“ Entwicklungsökonomien, vor allem in Asien, Ziel der globalen Anlagestrategien dieser Institutionen. Mit der wachsenden privaten Verschuldung in den USA wuchs zugleich der Import an immer billigeren Waren aus Asien. Die starke Akkumulation in Asien schien somit durch die Verschuldungspolitik in den Zentren die notwendige Nachfrage zu finden, während gleichzeitig die Masse der Bevölkerung auf beiden Seiten Wohlstandsgewinne erziele (eine neue „Win-Win“-Story). Allein die Geldmarktfonds in den USA (in deren Titeln der Großteil des internationalen Zahlungsverkehrs abgewickelt wird und die meist mit einem Mix an Schuldtiteln gesichert werden) wuchsen bis 2005 auf ein Verhältnis von 145 % gegenüber dem US-BIP (Geldmenge M3). Anders als in den 1970er Jahren führte diese extreme Ausdehnung von Kredit- und Geldmenge nicht zur Inflation, da dies durch die immer mehr sinkenden Erzeugerpreise ausgeglichen wurde. Andererseits führte die Finanzkrise 2007 durch das Übergreifen auf die Geldmarkfonds unmittelbar zu einer Geldkrise, die den Fast-Kollaps 2008 besonders dramatisch machte.
Finanzmarktkrisen (rasche Entwertung von fiktivem Kapital) führen damit sofort zu einer Kette von Zahlungsproblemen für die nicht einbringbaren Schulden, zu einer Masse an Pfändungen auf Vermögenswerte, allgemein zu Liquiditätsproblemen (Geld als Zahlungsmittel). Die Finanzmarktkrise geht damit unmittelbar in eine Bankenkrise über, sofern Schulden in großer Zahl tatsächlich abgeschrieben werden müssen und die Eigenkapitaldeckung für die Begleichung der eigenen Verbindlichkeiten auch nicht mehr ausreicht. Dem folgt unmittelbar eine „Kreditklemme“ für das produktive Kapital, das seine Überakkumulation nicht mehr durch Finanzmärkte und Schuldenausdehnung finanzieren kann. Die Krise kehrt dann zu ihrem Ausgangspunkt zurück und äußert sich in Produktionsstillegung, Abschreibung von produktivem Kapital und Massenentlassungen. Ein weiterer wesentlicher Unterschied zwischen den imperialistischen Zentren und der Peripherie ist nun die Rolle des bürgerlichen Staates in diesem Krisenmechanismus. In den imperialistischen Staaten stehen genug Vermögenswerte auch im öffentlichen Sektor zur Verfügung, um bei schweren Finanzmarktkrisen eine Bankenkrise durch Übernahme (quasi Verstaatlichung) von nicht einbringbaren Schulden abzubremsen (z. B. durch die Bildung von „bad banks“ in öffentlicher Hand, direkte Umwandlung in Staatsschulden etc.). Gleichzeitig können die Zentralbanken imperialistischer Staaten (durch die Rolle von US-Dollar, Yen und Euro im Weltwährungssystem) ihre Geldmengen trotz Krise sogar ausweiten (Niedrigzinspolitik), um Liquiditätsprobleme zu überwinden. Damit werden Kreditklemmen im Allgemeinen rasch überwunden und Auswirkungen auf das produktive Kapital abgefedert.
Ganz anders die Rolle des Staates bei Krisen in Halbkolonien: Hier muss zur Sicherung der eigenen Finanzmärkte und des Zuflusses an Kapital der Staat zumeist eine aggressive Austeritätspolitik (Schuldenabbau) und eine restriktive Geldpolitik (Hochzinspolitik) durchführen, um gleichzeitig bei der „Bankenrettung“ insbesondere die ausländischen Verbindlichkeiten derselben zu bedienen – was selbst wieder zu einer noch größeren Vermögensübertragung an ausländisches Kapital führt (bzw. den Staat als Schuldner eben zu der Austeritätspolitik zwingt). An dieser Stelle wirken dann die bekannten internationalen Institutionen, insbesondere der IWF und die Weltbank, als die Hebel zur Durchsetzung einer entsprechenden „Krisenpolitik“. Während der Staat in den imperialistischen Zentren als Abfederung im Krisenfall dient, wirkt er in den Halbkolonien als Verstärker, dessen Hauptfunktion die Rettung des Werts der ausländischen Direktinvestitionen ist.
Eine weitere Kehrseite des großen Kapitalzuflusses in die „emerging markets“ ist einerseits die Verstärkung der Finanzierungsprobleme derjenigen Länder, die entweder sich nicht an die vom Finanzkapital definierten Regeln halten (siehe Argentinienkrise) oder keine entsprechenden Investitionsmöglichkeiten bieten (siehe vor allem große Teile Afrikas). Auch diejenigen, die von den Investitionen „begünstigt“ werden, haben bestimmte Konsequenzen zu tragen: Viele der Investitionen werden tatsächlich im Rahmen von Privatisierungen oder dem Aufbau von GVCs getätigt. Bei beidem handelt es sich um eine Form der abhängigen Entwicklung. Vor allem ist diese darauf ausgerichtet, die günstigen Ausbeutungsbedingungen in den betroffenen Ländern auszunützen. Insbesondere die Ausbeutung der ArbeiterInnenklasse wird dabei sowohl quantitativ (starker Anstieg der Proletarisierung) als auch in der Form von Kontrolle und Repression gefördert. Dies wird nicht zuletzt auch durch die Zahlen zu Anstieg der Beschäftigung, Wachstumsraten und gleichzeitigem Sinken der Lohnquote, die wir schon angeführt haben, deutlich.
Zusätzlich wird auch der Handel von Primärgütern immer stärker von den Finanzmärkten dominiert. Ein Faktor, der sich in den letzten Jahrzehnten dabei in den Vordergrund geschoben hat, ist die Bedeutung der Waren- und Terminbörsen. Rohstoffe und Agrargüter werden immer weniger direkt gehandelt, sondern vermittelt über diese Agenturen. So wird das Kilo Kaffee schon lange vor seiner Ernte an einer Terminbörse verkauft, zu einem Preis, der auf Annahmen beruht, wie diese tatsächliche Ernte ausfällt. Zumeist tragen damit die ErzeugerInnen das Risiko für Ernteausfälle bzw. erhalten damit oft unerfüllbare Vorgaben. Denn viele kleine AnbieterInnen stehen hier der geballten Handelsmacht des großen Kapitals gegenüber, das damit das ganze Risiko der Marktschwankungen auf die Menschen in den armen Ländern abschiebt. Auf der Produktionsseite dagegen sind es auch immer größer werdende Konzerne, die z. B. weltweit Saatgut oder Düngemittel monopolisieren und so ebenfalls die kleinen ErzeugerInnen in ihre Abhängigkeit bringen. So setzt sich auch im Agrarsektor die Smile-Kurve durch: Am Beginn und am Ende stehen große Konzerne und Finanziers im „Norden“, die den Löwenanteil an der „Wertschöpfung“ abbekommen, während die eigentlichen ProduzentInnen im „Süden“ kaum etwas vom Endpreis erhalten.
Insgesamt kann man daher die Funktionsweise des modernen Neokolonialismus so zusammenfassen:
- Die weltweite Verteilung des Kapitals konzentriert die Massen des verfügbaren Finanzkapitals im globalen Norden
- Die Deregulierung der globalen Finanzmärkte und das gegenwärtige Welthandelsregime zwingen die Länder des globalen Südens zur Öffnung ihrer Märkte für globalen Kapitalzufluss, ohne den die eigene Wirtschaft unterkapitalisiert und krisenhaft wäre
- Der Zwang zum Aufbau von US-Dollarreserven und der Zufluss von US-Dollar-Kapital führen zu starker Ausrichtung der Wirtschaft auf Exportsektoren und die Sektoren, für die ausländische Direktinvestitionen sich interessieren könnten; eine eigenständige Wirtschaftspolitik und Entwicklung sind so nicht möglich, ganz gleich welche Regierung an die Macht kommt
- Die Entwicklung der eigenen Industrie gliedert sich ein in „globale Wertschöpfungsketten“ (GVCs) nach dem Muster der Smile-Kurven, mit den ProduzentInnen im Süden im Bereich des Minimums der Kurve
- Der Welthandel wird durch Finanzkonzerne, Waren- und Terminbörsen und die Regeln der WTO strukturiert – alles Elemente, die die ungünstigen Terms of Trade zwischen Norden und Süden verewigen
- Die Durchsetzung des US-Dollar (und als Reserve Euro, Yen) als Weltwährung ermöglicht zusammen mit den niedrigen Erzeugerpreisen aus dem Süden einen Aufschub von Überakkumulationskrisen im Norden auf Grundlage einer auf Schulden basierten Akkumulation von fiktivem Kapital; dies führt einerseits zum Verschieben der Krisenrisiken in den globalen Süden, andererseits zur Gefahr von Finanzmarktkrisen, die die ganze Welt erschüttern (um dann besonders im Süden ausgebadet zu werden)
- Im Krisenfall wirken die imperialistischen Staaten als Abfederung von Finanzierungs- und Liquiditätsproblemen für ihre eigenen Ökonomien, während sie in den Halbkolonien als Verstärker dieser Probleme wirken und die Sicherung der ausländischen Investitionen als primäre Aufgabe verfolgen; dies wird durch Institutionen wie IWF und Weltbank abgesichert; die Krise schlägt in den Halbkolonien notwendig auf Einbrüche in Produktion und Massenkaufkraft durch
Natürlich haben sich unter diesen Bedingungen einige halbkoloniale Ökonomien stark „entwickelt“, d. h. haben große Kapitalstöcke und ArbeiterInnenklassen aufgebaut. Andere Ökonomien sind dabei jedoch auf der Strecke geblieben (bis hinunter zu den „failed states“). Andere verblieben auf dem Status, wesentlich Rohstofflieferantinnen zu sein, andere wiederum sind gegenüber schon erreichten Ständen stark zurückgefallen (wie Argentinien, Algerien/Nordafrika, Südafrika). Auch dort wo Entwicklung stattfand, ist diese primär im Interesse des globalen Kapitals vor sich gegangen, ist also weiterhin „abhängige Entwicklung“. Richtig ist aber, dass sich das Bild heute sehr viel uneinheitlicher als noch in den 1960er Jahren darstellt. Dazu kommt, dass mit China und Russland neue imperialistische Großmächte beim Kampf um die Regulierung und Aufteilung der Weltmärkte dazugekommen sind und einige Halbkolonien, wie Südkorea und Taiwan, rein ökonomisch gesehen zu den „reichen Ländern“ aufgeschlossen haben. Dies führt insgesamt zu einer schärferen Konkurrenzsituation zwischen den großen Kapitalen, was insbesondere die hegemoniale Position des US-Kapitals in der imperialen Ordnung, wie sie seit dem 2. Weltkrieg bestand, untergräbt. Damit werden auch die Verhältnisse und Mechanismen, mit denen bislang neokoloniale Kontrolle ausgeübt wurde, verändert. Investitionen und Kredite aus China und dessen eigene imperiale Projekte (wie die „neue Seidenstraße“) scheinen als „Alternative“ zu den bisherigen Vorgaben aus den anderen imperialistischen Zentren. Die Antwort der USA in Form von scharfen Konflikten um Handelspolitik ließ nicht lange auf sich warten. Der Kampf um die Neuordnung des Weltmarktes und des Weltwährungssystems hat längst begonnen.
Aus der Darstellung der Durchsetzung von „Entwicklung als Entwicklung von Abhängigkeit“ wird deutlich, dass die primäre Funktion der „neokolonialen Beherrschung“ die Erschließung der Halbkolonien für die Akkumulationsbedürfnisse des imperialen Kapitals ist. Insbesondere für die Überakkumulationstendenzen dieses Kapitals stellt die halbkoloniale Ökonomie eine wesentliche entgegenwirkende Ursache für Profitabilitätsprobleme, Nachfrageschranken und Verengung von Investitionsmöglichkeiten dar. Sekundär folgt dann auch ein Profitabfluss (für die Erträge von Direktinvestitionen) und ein Handelsgewinn (aufgrund der Terms of Trade). Dies sind auch in Preisen messbare Werttransfers in die imperialistischen Zentren. Doch sind die Preiskategorien hierbei stark irreführend. Wie an den Beispielen der GVCs und der Agrarpreise dargestellt wurde, werden Weltmarktpreise in diesen Sektoren so gebildet, dass in Bezug auf die Wertschöpfung die in den Halbkolonien geleistete Arbeit systematisch unterbewertet wird gegenüber den Finanz- und Handelsspannen der Weltmarktkonzerne. Das heißt, hinter den in US-Dollar messbaren Geldtransfers in die Metropolen steht noch ein weitaus größerer Werttransfer, der sich hinter der Bildung von Weltmarktpreisen verbirgt.
Werttransfers und Kapitalexport
Doch zunächst sollte auch der in den offiziellen Kapitalbilanzen messbare Werttransfer erwähnt werden. Eine Form der Darstellung, die z. B. Piketty verwendet, ist die Differenz von Inlandsprodukt und Nationaleinkommen. Die Größe der Inlandsproduktion wird zunächst aus dem BIP durch Abrechnung der Abschreibungen auf Vermögenswerte berechnet – davon wird dann zur Bildung des Nationaleinkommens der „Außenbeitrag“ ab- bzw. zugerechnet. Dies ist das Netto aus den Kapitaleinkünften (bzw. auch Transferzahlungen, die aber dagegen zu vernachlässigen sind) zwischen In- und Ausland. Ein Land, in dem es einen größeren Zufluss an Zinsen, Dividenden, Erträgen aus Kapitalanlagen bzw. Verkäufen derselben als einen Abfluss davon gibt, hat einen positiven Außenbeitrag. Die Weltbank verwendet den Prozentsatz des Außenbeitrages mit positivem oder negativem Vorzeichen als Indikator für „Entwicklung“ und Kreditwürdigkeit eines Landes. Zumeist wird hier das Verhältnis von Bruttoinlandsvermögen (GNI) zu Bruttoinlandsprodukt (BIP) betrachtet (d. h. es wird bei beiden Werten die Abschreibung nicht berücksichtigt). Die folgende Abbildung zeigt an drei Beispielen den typischen Vergleich zwischen imperialistischer und halbkolonialer Welt (der Achsenwert „1“ bedeutet keine Auswirkung des Außenbeitrags; „1,xx“ bedeutet, dass xx % zusätzliche Werte aus dem Ausland in das im Inland zu Verfügung stehende Einkommen eingehen; „0,yy“ bedeutet, dass (100-yy) % des eigenen Inlandsprodukts an Werten ins Ausland abfließen).
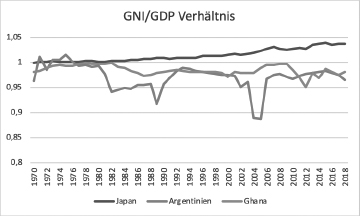
Abbildung 15: Verhältnis von Nationaleinkommen und Sozialprodukt [li]
Die Kurve für Japan zeigt seit den 1980er Jahren konstant nach oben und wurde auch durch die Finanzmarktkrise nicht wesentlich gebremst. Japan hat heute einen positiven Außenbeitrag von um die 3 %. D. h. etwa 10 % der Profiteinnahmen des japanischen Kapitals kommen aus dem Saldo von Auslandsinvestitionen und Investitionen von ausländischem Kapital in Japan. Auch bei dem geringen Wachstum der japanischen Ökonomie der letzten Jahre sind so weitere Gewinnsteigerungen möglich. Japan und Deutschland (das heute bei gewöhnlich über 2 % Außensaldo liegt) sind dabei von den großen imperialistischen Ländern die größten Profiteure von Kapitaleinkommen aus dem Weltmarkt (was auch mit der Rolle von Finanzgeschäften entlang der GVCs zu tun hat). Spitzenreiter ist allerdings Norwegen, dass durch seine Ölfonds und deren weltweite Anlagen heute über 4 % Außenbeitrag erzielt. Die USA bieiben mit 1 % eher im unteren Feld der ImperialistInnen, was angesichts der steigenden Verschuldung sogar erstaunlich ist. Dies liegt daran, dass die USA trotz riesigen Handelsbilanzdefizits und hoher Staats- und Privatschulden weiterhin beständige Kapitalzufuhr (in den „sicheren Hafen“ des Zentrums des US-Dollars) erfahren. Die riesigen Vermögen und diese Kapitalzufuhr erlauben es wiederum den USA, als größte Kapitalexporteurin zu agieren und so die eigenen Verpflichtungen gegenüber dem Ausland mehr als nur bedienen zu können. Während und um die Finanzmarktkrise von 2006-2012 sank der Außenbeitrag allerdings auf nur knapp über 0 %.
Ganz anders halbkoloniale Ökonomien: Das Beispiel Argentiniens zeigt, wie unmittelbar ökonomische Krisen auch in Kapitalabfluss und einen negativen Außenbeitrag durchschlagen. Anfang der 1980er Jahre, während der „Verschuldungskrise“ in Lateinamerika, stieg der abzuliefernde Außenbeitrag sogar auf über 5 %. Dies ist im Übrigen der Wert, der im Durchschnitt heute für Afrika gilt. Ein solcher Wert bedeutet, dass etwa ein Sechstel des Profits abzuliefern ist bzw. bei langfristiger Dauer ein entsprechender Teil des Kapitals direkt von ausländischem Kapital beherrscht sein wird. Da ausländisches Kapital sich auf wesentliche, für den Export relevante Sektoren konzentriert, gehen Schätzungen davon aus, dass in afrikanischen Ländern 30 – 40 % der Schlüsselindustrien in Auslandsbesitz sind.
Lateinamerika fiel während des „verlorenen Jahrzehnts“ auch auf dieses Niveau zurück. Dies hatte auch dort zu einem massiven Ausverkauf und einem Abwürgen von weiterer Entwicklung durch die Schuldendienste an die imperialistischen Länder geführt. Ende der 1980er Jahre kam es zu einem teilweisen „Schuldenerlass“, der mit harten wirtschaftspolitischen Auflagen gekoppelt war (Brady-Plan). Danach sank der Außenbeitrag zunächst wieder auf das für „entwickelte Halbkolonien“ übliche Ausmaß von 1 – 2 % (Brasilien hat es von 1995 bis heute auf konstant unter 1 % negativen Außenbeitrag geschafft, manchmal sogar bei günstigem Stand der Rohstoffmärkte einen positiven). In Argentinien dagegen schlug die schwere Finanzmarktkrise Ende der 1990er Jahre mit der folgenden Wirtschaftskrise in den frühen 2000er Jahren auch in einen enorm hohen Außenbeitrag durch. Dieser fiel maximal sogar auf über 10 % aus, was also heißt, dass sogar ein Drittel der Profite an internationale KapitalgeberInnen abzuliefern war. Die folgende Erhöhung hat lediglich zu einem Niveau von -3 % geführt, was immer noch für die schwächelnde argentinische Wirtschaft viel zu hoch für eine Erholungskonjunktur ist.
Die Entwicklung des Außenbeitrags von Ghana (einer für Afrika relativ stabilen Ökonomie) zeigt wiederum, wie stark die „große Rezession“ besonders für halbkoloniale Länder durchgeschlagen ist. Einerseits waren bei den eingetriebenen Schulden im Gefolge der Neubewertung von Auslandsinvestitionen tatsächlich viele Schulden oder „Vermögenswerte“ in Halbkolonien betroffen, die in unmittelbaren Zahlungsforderungen mündeten. Insbesondere die unmittelbar nach der Krise hohen Rohstoff- und Agrarpreise haben zusätzlich zu Zahlungsproblemen für Länder wie Ghana geführt. Erst das Sinken der Ölpreise und der Aufschwung der eigenen Goldschürfung führte zu einer Stabilisierung des Außenbeitrags von Ghana bei etwa -2 %.
Überraschenderweise ist auch bei den meisten asiatischen Ländern (außer China, Japan, Südkorea und Taiwan) der Außenbeitrag relativ hoch. So etwa bei Malaysia, das in den 1980er Jahren zwischen -4 und -8 % hin- und herpendelte, um sich in den 1990ern auf -5 % zu stabilisieren. Nach der Asienkrise fiel der Beitrag sogar wieder auf -9 %, um bis zur „großen Rezession“ auf -2 % zu steigen. Danach fiel man bis heute wieder auf das -4 %-Niveau zurück. Hier wird deutlich, dass viele der asiatischen Wachstumsmärkte stark vom Zufluss ausländischen Kapitals abhängig sind und damit auch ein hohes Niveau an Abfluss von Kapitalgewinnen aufweisen. Auch wenn Indien in den letzten Jahren beträchtliches eigenes Kapital gebildet hat, gehört es weiterhin zu den Netto-Kapitalimporteuren. Seit den 1970er Jahren gab es kein einziges Jahr bis heute, in dem Indien einen positiven Außenbeitrag aufwies. In den letzten Jahren hat sich das Niveau auf -1 % bis -2 % eingependelt. Südkorea hatte bis 2010 ebenfalls zumeist einen geringen negativen Außenbeitrag. Seitdem jedoch gehört es zu den Nettokapitalexporteuren (auch wenn auf niedrigem Niveau eines Außenbeitrags unter +1 %). Das deutet darauf hin, dass es große eigene Kapitale gibt, deren Auslandsgewinne inzwischen nachhaltig den Kapitalabfluss durch Investitionen ausländischen Kapitals (insbesondere aus Japan und China) ausgleichen können. China selbst schwankt beständig zwischen einem geringen Nettoplus und -minus. Angesichts dessen, dass China international das Hauptziel von Investitionen ist, zeigt dies zweierlei: einerseits, dass die Kapitalmarktregulierungen in China den Kapitalzufluss an Bedingungen knüpfen, die einen großen Teil der Gewinne in China selbst belassen; andererseits, dass China inzwischen selbst, ob über Staatsfonds oder privates Kapital, in großem Stil Kapitalexport betreibt. Auf jeden Fall spricht die Erfolgsgeschichte Chinas nicht gerade für den Mythos, dass die unbeschränkte Öffnung für Auslandskapital das erfolgreiche „Entwicklungskonzept“ ist.
Der Kapitalfluss zwischen Ländern besteht im Wesentlichen aus direkten Kreditgeschäften, „Portfolioinvestitionen“ (hauptsächlich Anteilseigentum, z. B. Aktien, oder Anleihen, z. B. Staats- oder Unternehmensanleihen) und „Direktinvestitionen“ (auf Englisch „FDI“ abgekürzt). Für die am wenigsten entwickelten Länder spielen zumeist Transferzahlungen (z. B. Rücküberweisungen von MigrantInnen „nach Hause“) und die „Entwicklungshilfe“ („Official Development Assistance“; ODA) eine wichtige Rolle. Die Abbildung zeigt den Anteil der verschiedenen Kapitalzuflüsse für die Länder, die die UNO-Entwicklungshilfeorganisation heute noch als „Entwicklungsländer“ bezeichnet (dazu zählen auch China und Südkorea):
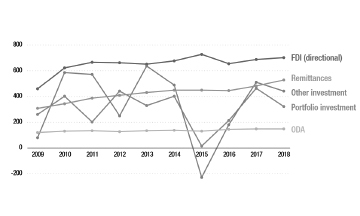
Abbildung 16: Kapitalzufluss in die „developing countries“ [lii]
Hier wird deutlich, dass neben Transferzahlungen und „Entwicklungshilfe“ die ausländischen Direktinvestitionen das stabilste Element sind. Portfolioinvestitionen folgen den raschen spekulativen Strömen der internationalen Finanzmärkte, während die Kreditvergabe offensichtlich auch schnell in die eine oder andere Richtung geht. FDIs sind langfristigere Investitionen, bei denen das Auslandskapital auch die Managementkontrolle ausübt und die daher nicht so „volatil“ sind wie die anderen Kapitalzuflüsse. Daher ist die langfristige Entwicklung der FDIs der wichtigste Indikator für die Frage der internationalen Kapitaldurchdringung. Dabei ist zu beachten, dass schon seit der Schaffung des modernen Weltmarktes nach dem 2. Weltkrieg die Hauptströme von FDIs zwischen den imperialistischen Ländern fließen (auch heute noch, unter Einschluss von China, über zwei Drittel). Auch was den Rest der Welt betrifft, sind auch in den einzelnen Regionen bestimmte Länder Schwerpunkte des FDI-Zuflusses (in Lateinamerika z. B. in den letzten Jahren Brasilien). Nur was Asien betrifft, gibt es eine breitere Streuung. Auch stehen jeweils bestimmte Wirtschaftssektoren (z. B. Chemie, Pharma, Agroindustrie, Zulieferindustrien etc.) im Fokus des jeweiligen Landes. In der Form laufen die Investitionen entweder als tatsächliche Neuanlage („greenfield investment“) oder als Übernahme/Fusion von/mit bestehendem Kapital vor Ort ab. Gerade was „Entwicklungsländer“ betrifft, liegen in der Mehrzahl Übernahmen vor. Es ist auch klar, dass die Hauptakteure von FDIs multinationale Konzerne sind, deren Hauptquartiere sich zumeist in den imperialistischen Metropolen befinden.
Nach dem Gesagten ist es nicht verwunderlich, dass das größte Ziel von FDIs die USA ist. Von den etwa 2 Billionen US-Dollar, die 2017 in FDIs ins Ausland flossen, gingen 277 Milliarden in die USA (zusammen mit Kanada das Doppelte gegenüber dem Rest des amerikanischen Kontinents, auf den 147 Milliarden entfielen), gefolgt von China (134 Milliarden; allerdings mit engen Beziehungen zu den 111 Milliarden in Hongkong). Zusammen genommen war die europäische Union mit 342 Milliarden sogar der größte Block (zusätzlich machen die FDIs innerhalb Europas einen weiteren großen Anteil an den weltweiten FDIs aus). Als zentrale Drehscheibe für den asiatischen Raum spielt zusätzlich noch Singapur (76 Milliarden) eine große Rolle sowie Brasilien für Lateinamerika (68 Mrd). Danach folgt eine Gruppe von „mittelwichtigen“ Investitionszielen: Australien (42), Indien (40), Mexiko (32), Russland (26), Indonesien (21), Israel (18), Südkorea (18), Vietnam (14). Danach kommen noch einige Länder, die zumeist über 10 Milliarden erhalten (Kolumbien, Chile, Türkei, Arabische Emirate). Der Rest der Welt (darunter ganz Afrika) läuft unter „ferner liefen“ (konstant unter 10 Milliarden).
Noch deutlicher ist die Statistik, wenn man die HaupttäterInnen bei den FDIs betrachtet: hier machen die alten imperialistischen Ökonomien 80 – 60 % (je nach Konjunktur) aus. Dabei ergibt sich jedoch ein leicht anderes Bild der HauptakteurInnen, denn hier ist Japan einer der größten Investoren (mit 160 Mrd. 2017), knapp gefolgt von China (158 Mrd.; hier sind die 87 Mrd. von Hongkong zu einem großen Teil wohl Durchlaufposten für Auslandsinvestitionen nach China selbst). Danach folgen aber mit Auslandsinvestitionen um die 100 Milliarden Deutschland, Frankreich und Britannien und mit gewissem Abstand die Niederlande, Spanien, Italien und Schweden, so dass die EU wiederum auch die größte Kapitalexporteurin ist (insgesamt etwa 412 Milliarden). In Asien spielen ansonsten Südkorea (34), Singapur (44) und Taiwan (12) eine relevante Rolle. Dies wird noch ergänzt um die reichen arabischen Ölstaaten, die auch milliardenschwere Auslandsinvestitionen tätigen. Die USA liegen in den meisten Jahren an der Spitze der AuslandsinvestorInnen (2017: etwa 300 Milliarden). Ein Großteil der 2010er Jahre überwog aber der Kapitalzufluss den Kapitalabfluss (besonders dramatisch 2018, wo 300 Milliarden mehr in die USA flossen, als anderswo investiert wurde).
Damit wird auch klar, dass der so entstehende Kapitalstock (weltweit etwa 30 Billionen US-Dollar) einerseits stark in den imperialistischen Ländern konzentriert ist, andererseits aber noch viel mehr sich in ihrem Besitz befindet. Die Abbildung zeigt die Verteilung des Kapitalstocks ausländischer Firmen pro Region, gegenüber dem Besitz von Firmen im Ausland, ebenfalls nach Region:
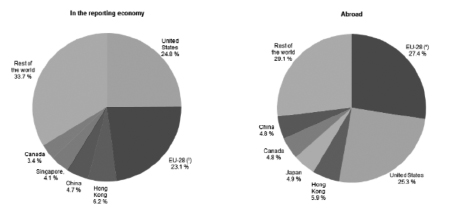
Abbildung 17: Weltweite Anlage von Auslandsdirektinvestitionen wo und von wem, 2017 [liii]
Es wird klar, dass der Kapitalstock, der durch FDI aufgebaut wurde, insbesondere in den USA und Europa residiert, während sich derjenige in China (mit Vermittlung über Hongkong bzw. Singapur) erst im Aufbau befindet. Während sich der FDI-Kapitalstock insgesamt zu etwa zwei Drittel in den imperialistischen Ländern befindet, besitzen diese Ökonomien sogar etwa drei Viertel des weltweiten FDI-Kapitalstocks.
Diese Differenz erklärt den konstanten Abfluss von Kapitaleinkünften in die imperialistischen Zentren. Die FDI sind dabei das Element, dass diesen Abfluss konstant macht, mit zyklischen Verstärkungen durch Schuldrückzahlungen oder Abfluss von kurzfristigerem Anlagekapital.
Trotz dieser größeren Stetigkeit von FDIs unterliegen sie aber selbst auch starken Weltmarkzyklen, die mit den Überakkumulations- und Krisentendenzen in den Zentren eng verbunden sind.
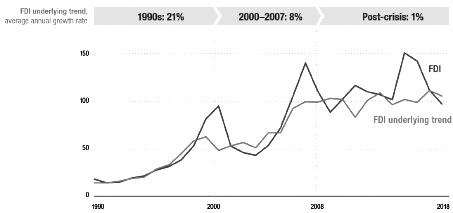
Abbildung 18: Zyklen der Auslandsdirektinvestitionen seit den 1980er Jahren [liv]
Hier wird die Entwicklung der jährlichen FDI-Zuflüsse als Wachstumskurve mit dem Jahr 2010 als 100 %-Vergleichsmarke dargestellt. Die offensichtlich großen Ausschläge der Kurve werden wiederum durch Filterung mit einer langfristigen Tendenzkurve unterlegt. Daraus ergibt sich eine über den Kurven festgehaltene Periodisierung der FDI-Entwicklung:
- Eine enorm starke Zunahme von FDIs mit durchschnittlich jährlichem Wachstum um 21 % in der Hochphase der „Globalisierung“ in den 1990er Jahren
- Eine Abschwächung der FDIs auf immer noch hohe 8 %-Raten zwischen 2000 und 2007, wohl im Gefolge solcher Krisen wie derjenigen in Mexiko, Russland, Argentinien, aber vor allem der Asien- und Dotcom-Krise
- Schließlich eine stagnative Tendenz nach der großen Rezession.
Die starken Einbrüche in der FDI-Entwicklung – 2000, 2007, 2012, 2016 – bedeuten jeweils für bestimmte Ökonomien, die ihre Akkumulationsbewegung auf den Weltmarkt ausgerichtet haben, eine stark krisenbeschleunigende Wirkung. Dies kann man nach 2012 und 2016 derzeit deutlich an heftigen Krisenerscheinungen in mehreren „Schwellenländern“ beobachten (z. B. Brasilien, Türkei, Argentinien, Ägypten, Indien).
Werttransfer und „ungleicher Tausch“
Die klassische Imperialismustheorie leitet die dominierende Rolle der Metropolen auf dem Weltmarkt ab aus der Rolle von deren Monopol- und Finanzkapital in der weltweiten Akkumulation. Diese verhindern (bis auf wenige Ausnahmen) durch ihre beherrschende Stellung auf dem Weltmarkt und durch die Auswirkungen ihres Kapitalexports das Aufkommen neuer, konkurrierender großer Kapitale in Ländern eines niedrigeren Entwicklungsstandes (im Sinne der kapitalistischen Entwicklung). Damit bleibt deren Kapitalakkumulation immer abhängig und untergeordnet gegenüber derjenigen der Metropolen, die sie für die Gewinnung von Extraprofiten aus ihrem Kapitalexport nutzen können bzw. zur Abmilderung von Krisentendenzen im Zentrum.
Schon die Anfänge der Dependenztheorie haben der klassischen Imperialismustheorie widersprochen, indem sie die langfristigen Tendenzen der Kapitalakkumulation nicht aus der Krisentendenz (Überakkumulation), sondern aus der Stagnation des Monopolkapitals (unproduktive Konsumption des Surplus) hergeleitet hat. Diese würde eine Ausnutzung der wirklichen Entwicklungspotentiale in der Peripherie verhindern und diese stattdessen in eine Hierarchie der Ablieferung von Surplus einbinden. Diese Grundausrichtung vor allem von Frank wurde später ergänzt durch eine noch tiefgehendere Revision der Imperialismustheorie in Form der Theorie des „ungleichen Tausches“. Diese basiert wesentlich auf den Beobachtungen der ungünstigen Terms of Trade, wie wir sie in der Prebisch-Singer-Theorie dargestellt haben. Die Theorie des ungleichen Tausches liefert nicht nur eine eigene Erklärung dieses Phänomens, sondern will auch die Mechanismen darstellen, wie sich die Hierarchie der Surplusaneignung auf dem Weltmarkt herausbildet – und zwar ohne Bezug auf die Dynamik der Kapitalakkumulation, sondern rein aus der Funktionsweise des „ungerechten“ Welthandels.
Die Theorie des ungleichen Tausches wurde ursprünglich 1962 erstmals durch den in Frankreich lehrenden griechischen Ökonomen Arghiri Emmanuel formuliert [lv]. Populär wurde die Theorie später vor allem durch einen seiner Schüler, den aus Ägypten stammenden Samir Amin, z. B. durch sein 1976 erschienenes Buch „L’impérialisme et le développement inégal“ (Imperialismus und ungleiche Entwicklung). Bemerkenswert an der Theorie ist die Nebenrolle von Kapitalexport oder von Unterschieden in Kapitalzusammensetzung oder Profitraten – der alles entscheidende Faktor für die ungleiche Entwicklung ist nach der Theorie [lvi] der Unterschied der Lohnniveaus. Während die Internationalisierung des Kapitals und die frei fließenden Geldströme Produktionsbedingungen überall vereinheitlichen würden, würde nichts dergleichen in Bezug auf die Löhne und Lebensverhältnisse zwischen den Arbeitenden in den Metropolen und der Peripherie geschehen – hier würden zumindest relativ die Verhältnisse sogar immer mehr auseinandergehen. Grund dafür sei die mangelnde Mobilität des Faktors Arbeit gegenüber dem Faktor Kapital. Die Gründe dafür sieht Emmanuel in: (1) restriktiven Bedingungen für Migration (insbesondere in die Metropolen), (2) in sehr unterschiedlichen Bedingungen für das „soziale Minimum“, das in unterschiedlich entwickelten Ländern als „überlebensnotwendig“ gesellschaftlich anerkannt ist, bzw. wie dieses mittels vormoderner Methoden zustande kommt, (3) größere Trägheit, Arbeitsplätze zu wechseln (aus sozialer Bindung an ein Unternehmen, Familientradition, …), als Marx dies angenommen habe, (4) die größere Verteilungsmacht der Gewerkschaften in den entwickelteren Ökonomien.
Damit werde das jeweilige landesspezifische Lohnniveau zu einem exogenen Faktor für die kapitalistische Entwicklung dieses Landes, während die endogene kapitalistische Dynamik ansonsten die Produktionsverhältnisse angleiche. Dies beteffe insbesondere die technische Zusammensetzung des Kapitals und letztlich auch die Profitraten. D. h. die Konkurrenz auf dem Weltmarkt führe dazu, dass heutzutage die organische Zusammensetzung des Kapitals in Metropolen und Peripherie als gleich behandelt werden können und es auch zu einer Angleichung der Profitraten hin zu einer weltweit einheitlichen komme. Dies im Gegensatz zur Höhe der Löhne und der Mehrwertrate, die der entscheidende Unterschied zwischen imperialistischer Ökonomie und Halbkolonie sei.
Um die Auswirkung des Austauschs auf dem Weltmarkt unter diesen Bedingungen darzustellen, führt Emmanuel komplexe Berechnungen durch, die hier in einem vereinfachten Schema verdeutlicht werden. Im Modell produziert das reiche Land A im Jahr 30 Autos, das arme B 30 Tonnen Kaffee – mit jeweils der gleichen Anzahl von ArbeiterInnen.
| Land A – 30 Autos | 480c | 120v | 120s | 720 nMW |
| Land B – 30 Tonnen Kaffee | 240c | 60v | 180s | 480 nMW |
Abbildung 19: Wert der Produktion – A „globaler Norden“, B „globaler Süden“
Dabei wird in A ein Wert von 720 Stunden (Verwertung von 480 Stunden in Maschinen vergegenständlichter Arbeit und 240 Stunden neu geleisteter Arbeit) erzeugt, mit einem Wert pro Auto von 720/30 = 24 Stunden. In B wird ein Wert von 480 Stunden erzeugt, mit 240 Stunden indirekter und 240 Stunden direkter Arbeit. 1 Tonne Kaffee hat dann den Wert von 480/30 = 16 Stunden Arbeit. Damit ist die organische Zusammensetzung (v/c) des Kapitals in beiden Ländern gleich, und zwar 1 zu 4. Was sich unterscheidet, ist das Lohnniveau: um die gleiche Menge ArbeiterInnen (v) zu reproduzieren, ist in A doppelt soviel Arbeitszeit notwendig wie in B. Schließlich unterscheidet sich auch die Mehrwertrate (s/v): sie ist in B dreimal so hoch wie in A (300 % und 100 %).
In Konsequenz läge bei gleichwertigem Tausch die Profitrate (m/(c+v)) in A (120/600) bei 20 %, in B aber (180/300) bei 60 %. Kaffeeproduktion wäre also durchaus lohnender als Autoproduktion: man braucht weniger Kaffee, aber durch die niedrigen Löhne und die hohe Ausbeutung auf den Plantagen würde man viel mehr Gewinn machen. Mit den 30 Tonnen Kaffee könnten unter gleichem Tausch 20 Autos gekauft werden und die volle Wertmenge würde realisiert werden.
Nimmt man nun dagegen an, dass sich die Profitraten in A und B ausgleichen, ändern sich die Tauschverhältnisse. Ausgleich der Profitraten bedeutet, dass gleich großes Kapital auch gleich viel Profit abwirft, so dass in Summe die Gesamtmenge an Kapital (cA+vA+cB+vB=900) aus beiden Ländern wiederum zusammen den Gesamtwehrwert aneignet (sA+sB=300). Damit gleicht sich die Profitrate auf 300/900 = 33 1/3 Prozent aus. Wendet man diese Profitrate auf die Preisbildung in beiden Ländern an, ergibt sich ein neues Schema des Austausches:
| A – 30 | 480c | 120v | 200 iWE | 800 iWE |
| B – 30 | 240c | 60v | 100 iWE | 400 iWE |
Abbildung 20: Weltmarktpreis unter Annahme einer gleichen Durchschnittsprofitrate (33,3 %)
Nunmehr landet ein beträchtlich größerer Gewinn (200 statt 120) in A, während er in B abnimmt (100 statt 180). Dies verteuert auch die Autos von 24 auf 800/30=26 2/3 pro Auto, während die Tonne Kaffee sich von 16 auf 400/30 = 13 1/3 verbilligt. Das Verhältnis des ursprünglichen Werts der beiden Waren 24:16=1,6 verändert sich auf 26 2/3 : 13 1/3 = 2.
Angenommen A kauft nun am Weltmarkt 6 Tonnen Kaffee, so zahlt es einen Weltmarktpreis von 6 mal 13 1/3 gleich 80. Mit diesen 80 Weltgeldeinheiten lassen sich zum Weltmarktpreis gerade mal 3 Autos kaufen (3 mal 26 2/3 ist 80). Aber von der Arbeitszeitrechnung repräsentieren die 6 Tonnen Kaffee 6 mal 16 gleich 96 Stunden, die 3 Autos aber 3 mal 24 gleich 72 Stunden. Durch diesen auf Wertebene ungleichen Tausch, eignet sich das Kapital von A ein Wertäquivalent von 24 Stunden Arbeitszeit aus B an. Da die Löhne gleich bleiben, bedeutet es, dass von den 36 in B für 6 Tonnen Kaffee geleisteten Mehrarbeitsstunden, nur 12 im eigenen Land realisiert werden. Der ungleiche Tausch bedeutet, dass die ArbeiterInnen im Land mit dem niedrigeren Lohnniveau systematisch Mehrarbeit für das Land mit höherem Lohnniveau leisten. Der durch den ungleichen Tausch bedingte Werttransfer in die reichen Länder beruhe damit auf der Überausbeutung der arbeitenden Bevölkerung in den armen Ländern.
Die Theorie des ungleichen Tausches erklärt somit die ungünstigen Terms of Trade für Peripherieländer aus dem niedrigen Lohnniveau bei gleichzeitigem Vorherrschen einer internationalen gleichen Profitrate und Kapitalzusammensetzung. Zusätzlich, und das ist der entscheidende Kern der Theorie, schlussfolgerte sie eine Dynamik, die aufgrund der Werttransfers die Lohndifferenz zwischen den beiden Teilen der Welt immer mehr auseinanderdriften lässt, was wiederum den ungleichen Tausch expandieren hilft. Dieser sich verstärkende Kreislauf könne nur durch Schutzmaßnahmen gegen den Weltmarkt bis hin zur Autarkie durchbrochen werden.
Insbesondere führt diese These auch dazu, Lohngewinne in den imperialistischen Ländern als Verstärkung der Ausbeutung in den Halbkolonien zu erklären. Die auseinandergehenden Lohnniveaus, auch durch die gewerkschaftlichen Kämpfe in den Metropolen, führen zu verstärktem Werttransfer aus der Peripherie, die letztlich auch die größeren Verteilungsspielräume in den Metropolen ermöglichen. Die ArbeiterInnen in den Metropolen werden so zur globalen „ArbeiterInnenaristokratie“, die den Kämpfen der Ausgebeuteten in der Peripherie genauso entgegenstünden wie die großen Kapitale. Somit könne der Imperialismus in seinen Heimatländern einen breiten gesellschaftlichen Konsens für seine globale Ausbeutungsordnung organisieren.
Kritik des „ungleichen Tausches“
Die Theorie des ungleichen Tausches hat mehrere methodische Fehler, die sich aus den Voraussetzungen, das Durcheinanderwürfeln mehrerer Analyseebenen, ergeben und zu einem Verfehlen des Zusammenhangs der Entwicklungsgesetze des Kapitals durch die im Schema dargestellten Tauschverhältnisse auf dem Weltmarkt führen.
Die Marx’sche Werttheorie entwickelt die Wertrechnung der erweiterten Reproduktion des Kapitals im abstrakten Modell eines grenzenlosen globalen Gesamtkapitals. Eine solche Berechnung auf dem Weltmarkt durchzuführen, muss damit schon begründet werden. Immerhin stoßen im Weltmarkt verschiedene Produktionssphären mit unterschiedlichen Produktivitäts- und Kapitalzusammensetzungen aufeinander, indem verschiedene Zirkulationssphären über ihn vermittelt werden. Die Wert-Preistransformation zu Weltmarktpreisen hat also noch einiges mehr an Vermittlungsschritten einzubeziehen als die nationale Preisbildung, die aber z. B. in der Frage der Lohnkosten sehr wohl auch eine Rolle spielt. Wir werden im nächsten Kapitel auf die Differenzen von nationaler und Weltmarktpreisbildung genauer eingehen – und dabei zeigen, dass ein zusammengefasstes Reproduktionsschema – wie oben dargestellt – somit ein Zusammenwürfeln von Ebenen der Abstraktion ist.
Zunächst aber ist die zentrale Voraussetzung von Emmanuels Theorie, dass man weltweit von gleichen Wertzusammensetzungen des Kapitals und einem bereits abgeschlossenen Ausgleich zu einer „Weltdurchschnittsprofitrate“ ausgehen kann, abzulehnen. Ersteres lässt sie sich schon empirisch widerlegen (wie sich schon oben an den Unterschieden in der Kapitalproduktivität gezeigt hat). Wesentlicher noch ist, dass ein Fehlverständnis der Rolle der „Durchschnittsprofitrate“ in der Akkumulationstheorie von Marx vorliegt. Die Durchschnittsprofitrate ist keine „an sich“ gegebene Größe, die sich auf derselben Ebene wie die Produktionskosten berechnen ließe. Es geht vor allem darum, dass es einen Prozess des Ausgleichs hin zur Durchschnittsprofitrate gibt, der die Unterschiede der Kapitalzusammensetzung der verschiedenen Sektoren des Gesamtkapitals und ihre Dynamik in Bezug auf die Produktivitätsentwicklung widerspiegelt.
Marx führt die Tendenz zum Ausgleichen der Profitrate im dritten Band des Kapitals im Rahmen des Modells eines globalen Gesamtkapitals ein, in der verschiedene Sektoren der Ökonomie unter unterschiedlichen Anforderungen an Kapital- und Arbeitskräftebedarf produzieren. Einige Bereiche der Konsumgüterindustrie mögen mit wenig Einsatz von Maschinerie und auch mit wenig qualifizierten ArbeiterInnen produzieren, während andere Bereiche, z. B. in der Produktion von Flugzeugen, mit sehr hohem Kapitaleinsatz und höherem Bedarf an speziell qualifizierter Arbeit rechnen müssen. Bei gegebener Mehrwertrate würden erstere Sektoren höheren Profit als letztere machen. Allerdings führen die unterschiedlichen Produktionsbedingungen dazu, dass sich sehr viel mehr Kapital im „einfacheren“ Sektor als in dem mit hohen Anforderungen konzentriert. Dies führt zu einem Angebotsüberhang im ersten und einem Nachfrageüberhang im zweiten. Da auch in den Sektoren die einzelnen Kapitale mit unterschiedlicher Produktivität agieren, bedeutet diese Verteilung von Angebot und Nachfrage, dass sich der Preis in den Sektoren mit niedrigerer Kapitalzusammensetzung hin zu den produktiveren Unternehmen verschiebt, in den Sektoren mit höherer organischer Zusammensetzung aber zu den Kapitalen, die weniger produktiv sind. Im Konsumgüterbereich müssen die Waren daher unter Wert verkauft werden (womit die Masse der ProduzentInnen einen beträchtlichen Teil der Mehrarbeit nicht in Profit realisieren kann), während im Flugzeugbau über Wert verkauft werden kann. Da der in der Gesamtökonomie geschaffene Wert gleichbleibt, bedeutet dies, dass ein Werttransfer zwischen den Sektoren stattfindet, durch den sich die Profitraten angleichen.
Marx erklärt den Ausgleich der Profitraten also gerade durch die Wirkung von unterschiedlicher Kapitalzusammensetzung und Arbeitsproduktivität im Verhältnis zu derjenigen in anderen Sektoren. Der Fluss von Kapital und Arbeit innerhalb und zwischen Sektoren, im Zusammenwirken mit der durch den Markt vermittelten Reproduktion des Gesamtsystems (die in einem Austauschschema dargestellt werden kann), bringt einen Werttransfer hervor, der erst den Profitratenausgleich erzeugt – und nicht umgekehrt!
Damit ist ein dynamischer Prozess in Gang gesetzt: So zwingt die erhöhte Konkurrenz in den weniger kapitalintensiven Bereichen diese tendenziell eher dazu, größere Produktivitätssteigerungen zu erzielen, Arbeitsproduktivität zu erhöhen und tendenziell Arbeitskräfte auf die Straße zu setzen. Diese finden aber in den kapitalintensiveren Bereichen Arbeit, da dort auch nicht so produktive, arbeitsintensivere Unternehmen immer noch zu kostendeckenden Preisen verkaufen können. Die Bewegung ist also zugleich eine Bewegung der wechselseitigen Anstachelung zu weiterer Produktivitätssteigerung wie auch zur Angleichung der Kapitalzusammensetzung selbst. Wie Marx es formulierte, wirft diese Bewegung zugleich beständig ArbeiterInnen aus dem einen Sektor heraus, um sie im anderen aufzunehmen, und das in rascher Folge. Da die Gesamtbewegung eine der erweiterten Reproduktion ist (also ein Teil des Profits zur Ausdehnung von Kapital und Arbeit in allen Sektoren verwendet wird), verändern sich so beständig auch die Austauschverhältnisse (Zusammensetzung der wertbildenden Komponenten) und damit auch Umfang und Richtung des Werttransfers. Die langfristige Tendenz dabei ist die des rascheren Anstiegs der konstanten Kapitalanlage wie auch des Wachstums der Arbeitsbevölkerung. Diese wächst zwar auch, aber im Vergleich zum Gesamtwachstum immer abgebremster.
Das Modell des ungleichen Tausches geht dagegen von einem gegebenen Schema von Tauschverhältnissen auf der Grundlage einer „fixen“ Gegebenheit aus, der unterschiedlichen Lohnniveaus in A und B. Die gleiche Profitrate wird dann als weitere „gegebene“ Annahme eingeführt, ohne auf die wechselseitigen Einflüsse einzugehen. Tatsächlich spricht ein geringes Lohnniveau zumeist auch für eine geringere Produktivität und daher nicht, wie zusätzlich angenommen, für eine gleiche organische Zusammensetzung des Kapitals. Emmanuels statisches Modell bleibt bei einer Periode der Reproduktion stehen – im dynamischen Modell der Ausgleichungsprozesse der Durchschnittsprofitrate kann das beschriebene Schema ganz anders fortgeschrieben werden: Die günstigen Gewinnmöglichkeiten in B-Ländern könnten tatsächlich mehr Kapital in diese Länder fließen lassen, was zu einem Überangebot z. B. der kaffeeproduzierenden Länder führen würde, während die hochkonzentrierte Automobilindustrie viel weniger Konkurrenz und größere Hemmnisse für NeueinsteigerInnen bietet. Dies bevorzugt dann aber diejenigen B-Länder, die mit höherem Kapitaleinsatz und höherer Arbeitsproduktivität auch bei niedrigem Preis ihrer Waren noch Gewinn machen. Wie im nationalen Rahmen auch würde die Gesamtbewegung zu einer Aufgabe vieler B-Länder führen, für die der Export dieser Ware nicht mehr rentabel ist (Konkurrenz nimmt zu und Kapitalzufluss nimmt ab), andererseits aber zu einem Überleben von B-ExporteureInnen mit höherer Produktivität (organische Zusammensetzung nimmt zu). Die Abnahme der Zahl der Exportländer kann in den jetzt begünstigteren und technisch besser ausgestatteten B-Ländern dann sogar zu einem Aufbau von Beschäftigung in dem Sektor führen, was dort auch die Bedingungen für Lohnsteigerungen schafft.
Die Entwicklung der Ausgleichsbewegung kann also auch unter Bedingungen des Werttransfers dazu führen, dass nicht alle weniger entwickelten Länder in der Abwärtsspirale der ungünstigen Weltmarktpreise immer mehr verarmen. Wie auch die tatsächliche, zuvor gezeigte Entwicklung beweist, kann es unter den Halbkolonien zu sehr verschiedenen Akkumulationsniveaus kommen, bei denen einige stark von dem Emmanuel‘schen Modell abweichen – z. B. halbkoloniale Ökonomien, die nicht durch ungünstige ToT dem Werttransfer ausgeliefert sind, sondern z. B. durch ihre Einordnung in internationale Produktionsketten. Dass diese Halbkolonien nicht mehr speziell durch den ungünstigen Weltmarktpreis ihrer Roh- oder Agrarprodukte ausgebeutet werden, sondern durch ihre Rolle im internationalen Produktionsprozess, macht sie nicht weniger zu Opfern der kapitalistischen Weltordnung. Im Gegenteil, oft wird die „gemütlichere“ Form von z. B. Plantagenwirtschaft durch die Mühle von Ausbeutungsverhältnissen ersetzt, wie sie in Europa die erste industrielle Revolution gekennzeichnet haben. Jedenfalls zeigt sich in der Entwicklung der Kapitalzusammensetzung in der Peripherie überhaupt nicht die Annahme von Emmanuel: wie gesehen gibt es entwickelte Halbkolonien, die sich in der Kapitalproduktivität den Zentren angleichen, während andere weiterhin einen sehr viel geringeren Kapitalstock im Verhältnis zum BIP aufweisen.
Die andere zentrale Voraussetzung von Emmanuel, die Bedeutung der Lohndifferenz zwischen A- und B-Ländern, greift theoretisch ebenso zu kurz. Wichtig für das Kapital ist ja nicht die Lohnhöhe an sich, sondern wieviel Mehrwert aus dem Produktionsprozess angeeignet werden kann. Dies bezieht sich sowohl auf die Mehrwertrate als auch darauf, wieviel Masse an Mehrwert durch welche Masse an notwendiger Arbeitszeit erzielt werden kann (Arbeitsproduktivität).
Nun führen die beständigen Steigerungen der Arbeitsproduktivität in „Hochlohnländern“ (Tendenz des Kapitals zur Rationalisierung des teureren Faktors „Arbeit“) einerseits zu Druck auf die Löhne, andererseits aber auch zur Verbilligung der Konsumprodukte der ArbeiterInnen, also jedenfalls zur Erhöhung der (absoluten und relativen) Mehrwertrate. Da Mehrwertrate und Mehrwertmasse durch solche Produktivitätssteigerungen wesentlich stärker erhöht werden können als durch Methoden der Beschäftigung von elenden, kaum ausgebildeten Menschen (denen durch Arbeitszeitverlängerung und noch unmenschlichere Arbeitsbedingungen nur marginal mehr Mehrwert abgepresst werden kann), hielten marxistische KritikerInnen Emmanuel zumeist entgegen, dass die Mehrwertaneignung in den entwickelteren Ländern sogar höher als in der Peripherie ist – dass also in den Metropolen die ArbeiterInnen zwar besser bezahlt, aber stärker ausgebeutet werden Dies wäre ein Faktor, der natürlich auch der Ausgleichsbewegung der Profitraten stark entgegenwirken würde, da Kapitalanlage in den entwickelteren Ländern daher durchaus noch bei größerem Kapitalzufluss (statt Abfluss in die Peripherie) profitable Preise erzielen kann. Dies passt z. B. auch mit der Beobachtung zusammen, dass das Ausmaß der FDI in andere imperialistische Länder bei weitem den Kapitalfluss in die Peripherie übersteigt. Das Modell der sich immer mehr erhöhenden Lohndifferenz in den beiden Welten hätte dagegen eigentlich zu einem Abfluss des Kapitals aus den Metropolen führen müssen.
Der Faktor der Arbeitsproduktivität muss eben als wichtiges Moment der Relativierung von Lohndifferenzen und der Angleichung der Mehrwertraten gesehen werden. Die Abbildung zeigt die Entwicklung des Outputs (in Kaufkraftparitäts-US-Dollar) pro Beschäftigtem/r in vier Vergleichsländern seit den 1960er Jahren:
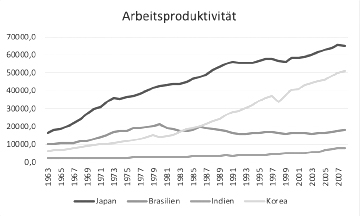
Abbildung 21: Vergleich der Entwicklung der Arbeitsproduktivität Metropolen/Peripherie [lvii]
Es wird deutlich, dass die Arbeitsproduktivität in Indien im Vergleich sehr geringes Wachstum aufweist und erst im 2000er Jahrzehnt eine leichte Bewegung nach oben zeigt. Brasilien erreichte Ende der 1970er Jahre einen Zenit des Anstiegs, um danach auf einem Niveau darunter zu stagnieren. Beide Länder halten jedenfalls keinem Vergleich zu Südkorea und noch weniger zu Japan stand. Letzteres hat bis Anfang der 1990er Jahre konstant hohe Wachstumsraten, mit einer Delle in den 1990er Jahren. Südkorea ist dagegen ein Modell für die nachholende Entwicklung einer Halbkolonie, die sich seit den 1990er Jahren sogar auf Aufholkurs zu Japan befindet. Die niedrigeren Löhne in Indien oder Brasilien können also in den anderen beiden Ländern dadurch aufgewogen werden, dass Investitionen dort durch das Vielfache der Arbeitsproduktivität einfach mehr Wert produzieren lassen.
Die Lohnquote, die an früherer Stelle dargestellt wurde, zeigt jedenfalls auch eine Annäherung zwischen Zentrum und Peripherie. Zusätzlich spiegelt die Lohnquote nur bedingt die Mehrwertrate wider. Berücksichtigt werden muss die stark unterschiedliche Klassenstruktur in beiden. In den imperialistischen Zentren konzentriert sich ein Großteil der ManagerInnen und BürokratInnen des globalen Kapitalismus sowie deren großes Heer an lohnabhängigen „Mittelschichten“. Eine Masse von abgeleiteten Elementen des „fungierenden Kapitals“ wird über die Form des Lohnes alimentiert. Dies sind eigentlich andere Elemente des Abzugs vom Profit (neben Zins oder Grundrente), die aber in die Lohnquote als „Arbeitseinkommen“ eingehen. Piketty (wie andere) hat ausführliche länderspezifische Aufstellungen dieser „versteckten Kapitaleinkommen“ aufgestellt. Danach kann man davon ausgehen, dass die Lohnquote in den Metropolen im Durchschnitt um mindestens 10 % geringer ausfällt als eigentlich angegeben. Rechnet man dann noch die etwa 10 – 20 % besonders privilegierten Teile der Lohnabhängigen (die „ArbeiterInnenaristokratie“ ab), ergibt sich für den Rest der ArbeiterInnenklasse eine Mehrwertrate, die sich im Mittel der Halbkolonien befindet.
Zusammen mit der Tatsache der größeren Arbeitsproduktivität (größere Masse an Mehrwert) ergibt sich damit, dass tatsächlich in den imperialistischen Zentren auch anteilsmäßig mehr Mehrwert ausgepresst wird als in den Halbkolonien.
Ein weiteres Argument gegen die Theorie des ungleichen Tausches ist, dass Emmanuel von einem Modell perfekter Konkurrenz zwischen Ländern mit abgegrenzter sektoraler Spezialisierung ausgeht. Tatsächlich gibt es auf dem Weltmarkt durchaus Waren, die sowohl im Zentrum wie in der Peripherie produziert werden: unter den größten WeizenproduzentInnen finden sich sowohl Länder wie die USA und die EU als auch Indien, Argentinien und die Ukraine; ähnlich z. B. bei Schweinebäuchen. Trotzdem werden für diese Waren Weltmarktpreise über globale Marktinstitutionen (z. B. Warenterminbörsen) gebildet. Für die Emmanuel’schen Schemata ist das tödlich: Fügt man in seine Austauschgleichungen eine weitere Ware hinzu (z. B. Weizen), die in A und B produziert wird, so ändert sich die Situation. Sogar unter den Annahmen von gleicher Profitrate und höherer Mehrwertrate in B kommt jetzt als weiterer Faktor hinzu, wie Arbeit und Kapital auf die gemeinsame Ware verteilt werden. Anderson[lviii] hat gezeigt, dass sich damit für alle Hauptthesen von Emmanuel leicht plausible Verteilungen finden lassen, die genau zum Gegenteil führen: z. B. wo die Erhöhung der Löhne in A zur Verminderung des Werttransfers führt, zur Verbesserung der Terms of Trade von B bzw. zur Erhöhung der Löhne dort. Dies sagt nichts darüber aus, ob das Szenario des ungleichen Tausches wahrscheinlich ist, sondern nur, dass die Begründung aus der wachsenden Lohndifferenz keine notwendige Gesetzmäßigkeit ausdrückt.
Schließlich ist auch die Annahme der perfekten Konkurrenz zwischen Ländern mit sektoraler Spezialisierung nicht aufrechtzuerhalten. Immerhin gibt es ganze Sektoren (z. B. im Agrarbereich) die heute von sehr wenigen großen Konzernen und Finanzgruppen beherrscht werden – und das auf Weltmarktebene. Bei diesen Weltmarktpreisen kann davon ausgegangen werden, dass sie eine starke monopolistische Gegentendenz zu einer Ausgleichsbewegung der Profitraten ergeben. Insgesamt zeigen die Tendenzen der Profitratenbewegungen global (so wie wir das oben versucht haben zu zeigen), dass sich die Profitraten zwischen imperialistischen Ländern zwar annähernd angleichen, dass dies aber für die halbkoloniale Welt nicht gilt! Sowohl die Kapitalzusammensetzung als auch die Profitraten zeigen dort ein sehr differenziertes Bild und geringere organische Zusammensetzung als auch höhere Profitraten sind das vorherrschende Bild. Daher ist eher Unterkapitalisierung das Problem, als es ungünstige Profiterwartungen (durch übermäßigen Verlust durch den ungleichen Tausch) darstellen. Die zu geringe Akkumulation von Kapital gegenüber dem Potential ist auch der Grund für relative Unterbeschäftigung. Damit aber ist dann das niedrige Lohnniveau ein Resultat von zu geringer Teilnahme an der globalen Akkumulation, nicht eines von zu viel!
Ein letztes wichtiges Argument gegen die Theorie des ungleichen Tausches ist die Frage der Quantifizierung des Werttransfers. Der Werttransfer durch Tausch muss ja durch das Gesamtausmaß des Exports der Peripherieländer in die Industrieländer begrenzt sein. Da der im Verhältnis zum Gesamtprodukt in den 1960er Jahren nicht besonders hoch war, wäre damit auch der Werttransfer nicht so bedeutsam, dass die große Abwärtsspirale, die daraus gefolgert wurde, gut begründet werden konnte. Samir Amin[lix] schätzte daraufhin den Anteil des Werttransfers an den Exporten auf sagenhafte 88 %. Damit kam er dann zu der Schlussfolgerung, dass die armen Länder an die 15 % ihres BIP durch Werttransfer an die reichen abführen. Das wäre dann natürlich groß genug, um die eigenständige Entwicklung nachhaltig zu bremsen. Allerdings: wenn die Untersuchungen zur Prebisch-Singer-These zeigen, dass sich auch heute noch die Terms of Trade der Peripherie beständig verschlechtern, wäre das bei 88 % Werttransfer schon in den 1960er Jahren kaum vorstellbar (schon in den 1970er Jahren wäre dann bereits gar nichts mehr an Profit bei Exporten beim Peripherie-Kapital übriggeblieben). Angesichts des heute enorm gestiegenen Volumens des Welthandels wäre eine fundiertere Abschätzung des Ausmaßes des Werttransfers durch die Bildung von Weltmarktpreisen zu Ungunsten der Peripherie tatsächlich angebracht.

Abbildung 22: Anteil des Handels mit Waren, Dienstleistungen und Kapital im Vergleich mit dem Welt-BIP in Prozent [lx]
Hier ist ersichtlich, dass nach dem Zusammenbruch des Welthandels in den 1930er/1940er Jahren, erst in den 1970er Jahren wieder das Niveau des Welthandels der klassischen Periode des Imperialismus erreicht wurde. Nach der Krisenperiode der 1970er/1980er Jahre brachte der Globalisierungsschub einen Anteil von über 50 % des Welthandels am Welt-BIP. Mit der großen Rezession stagniert der Anteil nun auf diesem Niveau. Trotzdem zeigt dies die enorme Globalisierung des Kapitalismus, die internationale Vernetzung als Warenökonomie. Der gewachsene Anteil des über Importe gekauften Warenangebots und der über Exporte geleisteten Arbeit stellt Fragen neu nach der Bewertung der in einem Land geleisteten Arbeit in Relation zu den dort erzielten Einkommen aller Art – und dies im Vergleich zu den Ländern, mit denen Handel getrieben wird.
Wertbildung, Weltmarktpreise und „Kaufkraftparitäten“
Ende der 1960er Jahre startete die UN-Statistikbehörde ein Programm zum Vergleich von Preisniveaus unterschiedlicher Länder und Regionen mit Namen ICP (International Comparison Program)[lxi]. Es ging von der Erkenntnis aus, dass die in US-Dollar ausgedrückten Preis- und Statistikgrößen (wie das BIP) nicht tatsächlich für den Vergleich von Ökonomien und ihre Austauschverhältnisse herangezogen werden können. Das Programm begann erst mit wenigen Ländern, um inzwischen 199 Ökonomien zu umfassen. Dabei werden jetzt an die 700 Waren und deren Preise in diesen Ländern in den jeweiligen Landeswährungen gemessen und für den Untersuchungszeitraum (inzwischen 6 Jahre) in Zeitreihen (samt US-Dollar-Entwicklung der Landeswährung) erfasst. Daraus werden verschiedene Indikatoren berechnet, insbesondere ein internationaler Preisindex (Prozentsatz pro Land gegenüber dem weltweiten Durchschnitt, der bei 100 % angesetzt wird). Aufgrund von „Warenkörben“, die für jedes Land einen entsprechenden Konsum- oder Produktionsbereich charakterisieren, werden Preisindizes für Ausgabenkategorien im internationalen Vergleich erstellt und letztlich die „Kaufkraftparitäten“ (KKP, englisch PPP = purchasing power parities) erstellt.
Der Preisindexvergleich ergibt zum Beispiel, dass eine Person, die in Pakistan 300 US-Dollar für den Einkauf zur Verfügung hat, damit Nahrungsmittel erwerben könnte, für die man in Deutschland 750 US-Dollar ausgeben müsste. Wie kommen solche Aussagen zustande?
Zunächst werden für individuelle Waren PPP-Relationen berechnet: Kostet etwa ein Burger in Deutschland 4,80 Euro in den USA aber 4,00 US-Dollar, so ist die PPP-Relation 0,83 US-Dollar zum Euro aus deutscher Perspektive, d. h. für jeden Euro in Deutschland, den man für Burger ausgibt, müsste man in den USA 0,83 US-Dollar ausgeben. Für die Berechnung der PPP-Relation zwischen Ländern werden nun Gruppen von Waren gebildet und deren Preissummen in PPP-Relation gesetzt, bis man auf der Ebene des BIP angelangt ist. In der ICP-Untersuchung 2011 errechnete man für Deutschland eine PPP für das BIP von 0,78 US-Dollar – d. h. für jeden Euro, der für einen Bestandteil des Gesamtprodukts von Deutschland ausgegeben würde, müsste man in den USA für ein dortiges Produkt 0,78 US-Dollar ausgeben. Tatsächlich erhielt man für einen Euro 2011 im Durchschnitt nur 0,72 US-Dollar – der US-Dollar war also um etwa 6 Cents unterbewertet (aus der Sicht des PPP). PPP-Umrechnungsraten sind streng genommen immer auf bestimmte Aggregate bezogen (BIP, Konsum, Nahrungsmittelkonsum etc.). So liegt etwa die PPP in Bezug auf individuellen Nahrungsmittelkonsum in Pakistan 2011 bei 41 US-Dollar. Für die gleiche Menge an Nahrungsmitteln, für die man in Pakistan 10 Rupien ausgeben musste, hätte man also in den USA 410 US-Dollar gebraucht. Nach dem offiziellen Kurs der Rupie wäre die pakistanische Ware noch doppelt so wenig wert gewesen (Kurs 1:85).
Woran liegen diese großen Unterschiede in den PPP-Relationen zwischen Zentrums- und Peripherieländern? Erstens gibt es immer bestimmte geographische Faktoren. So sind agrarische Erzeugerländer aufgrund der geringeren Transport- oder Handelskosten in der Lage, auf lokalen Märkten sehr viel näher an den Erzeugerkosten zu verkaufen. Zweitens sind die Kosten der Reproduktion der Ware Arbeitskraft, d. h. die Lohnkosten geringer. Dies liegt einerseits eben gerade an den billigeren Waren im Agrarbereich. Andererseits aber auch an oft noch weit verbreiteter Subsistenzwirtschaft, in der Familien sehr viel mehr unbezahlte Arbeit zur Ermöglichung eben dieser Reproduktion leisten (z. B. Hausarbeit, informeller Sektor, kleine Landwirtschaft). Die informelle „Schatten“wirtschaft führt auch dazu, dass viele Ausgaben, die im Zentrum große Teile der Reproduktionskosten ausmachen (Wohnung, Energie, Transport), einen sehr viel kleineren Anteil einnehmen (z. B. durch Wohnen in Slums). Drittens fallen öffentliche Leistungen, z. B. für Gesundheit, Bildung, Transport, Sozialversicherungen, sehr viel geringer aus. Dies schlägt sich in weniger indirekten bzw. weniger Lohnsteuern nieder – letzteres senkt auch wiederum die Bruttolohnkosten. Viertens lässt sich der Entwicklungsstand auch an dem „sozialen Minimum“ ablesen, also dem, was in dem Land als das angesehen wird, was „zum Leben notwendig ist“.
Offensichtlich wird der Wert der Ware Arbeitskraft (das „nationale Lohnniveau“) wie auch der vieler Konsumgüter und persönlicher Dienstleistungen stärker von der Wertbildung in der nationalen Zirkulationssphäre bestimmt. Dagegen werden Export und Import offensichtlich nicht in PPP-Werten abgewickelt, sondern in US-Dollaräquivalenten. Sicherlich sind PPP-Vergleichswerte wesentlich beständiger als Währungsvergleiche. Trotzdem kann man die systematische „Unterbewertung“ der nationalen Zirkulationssphären von Peripherieländern gegenüber denen der Metropolen (Unterschied der Bewertungen des BIP in PPP und in US-Dollar) nicht auf „Währungsspekulation“ oder volatile Kapitalflüsse zurückführen – im Unterschied zum Auf und Ab etwa im US-Dollar/Euro-Verhältnis, bleibt die PPP/US-Dollar-Differenz bei Halbkolonien systematisch unvorteilhaft. Es muss hier von zwei Ebenen der Wertbildung ausgegangen werden, die sowohl differenzieren als auch wechselwirken: einerseits der nationalen Wertbildung, abhängig von der durchschnittlichen nationalen Produktivität, dem nationalen Kapitalstock, der Arbeitsproduktivität und Zusammensetzung der Lohnarbeit vor Ort, des national bestimmten Werts der Ware Arbeitskraft etc.. Andererseits besteht seit Beginn des Kapitalismus die Sphäre des Weltmarktes mit der Herausbildung von Weltmarktpreisen, zumeist in Form des vorherrschenden „Weltgeldes“, früher also in Goldwährung, heute in US-Dollar. Diese Sphäre koppelt nicht unvermittelt alle nationalen Branchen, sondern bildet eine Stufenleiter von eigenen Wertbildungsprozessen. Es gibt einige Bereiche der Produktion (wie heute die meisten „großen Industrien“, z. B. Automobilindustrie), die vollständig auf den Weltmarkt ausgerichtet sind und wo sich die Konkurrenz auf dem Weltmarkt in der Durchsetzung der produktivsten Kapitale auch in der Preisbildung ausdrückt. D. h., hier bestimmt eine übernationale Zusammensetzung von Kapital und Arbeit die global notwendige durchschnittlich notwendige Arbeitszeit, die den Wert des Produkts ausmacht. Dagegen waren eine Ebene darunter z. B. Zulieferindustrien lange Zeit noch stark von nationalen Wertbildungsprozessen bestimmt, allerdings schon lange von der darüber liegenden Ebene der multinationalen Konzerne in Kostenkonkurrenz gebracht und so je nach Branche mehr oder weniger der Weltmarktsphäre angeglichen. Staatliche und öffentliche Bereiche waren früher stark in nationalem Wertbildungsprozess (bzw. Werttransfers) verankert, wurden jedoch durch Privatisierungen und Outsourcing in vielen Bereichen (z. B. Transport oder Gesundheit) für die Weltmarktebene geöffnet. Die dort geforderte höhere gesellschaftliche (globale) Durchschnittsproduktivität muss sich notwendigerweise in einer Wertdifferenz zur noch bestehenden nationalen Wertbildung ausdrücken. Ohne Schutz durch eine schwächere Währung würden viele Bereiche dieser nationalen Wertbildung in Frage gestellt bzw. die Preise so gedrückt, dass viele nationale ProduzentInnen das Feld räumen müssten. Der Mechanismus der Vermeidung von Handelsbilanzdefiziten und Kapitalabfluss (Sicherung von US-Dollarreserven), der zur Währungsabwertung führt, vermittelt hier nur die zeitweise Koexistenz dieser beiden Zirkulationssphären. Auf die Dauer ist die Ausweitung des Weltmarktsektors unvermeidlich und führt so auch immer wieder zu neuen „Gleichgewichtszuständen“ dieser Ebenen. Schon zuvor untergraben die dynamischen Ausschläge der Weltmarktpreise und ihre Auswirkungen auf die noch bestehenden Inlandsmärkte diese Gleichgewichte zuungunsten der Halbkolonien.
Was die statistische Differenzierung dieser beiden Bereiche betrifft, so berechnet das ICP systematisch den PPP-Wert der sogenannten Inlandsnachfrage („domestic absorption“), der Differenz von BIP und der Handelsbilanz (was den Bereich der Produkte und Dienstleistungen umfassen soll, der für den inländischen Bedarf produziert wird). Hier macht sich die Differenz von der PPP-Bewertung zur US-Dollarbewertung besonders deutlich:
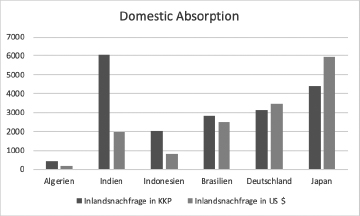
Abbildung 23: Wert des reinen Inlandsprodukts in KKP und US-Dollar (Milliarden) [lxii]
Es wird deutlich, dass die PPP-Werte sicherlich besser die tatsächliche Größe des inneren Marktes wiedergeben, während sie in US-Dollar eher nach der Weltmarktgeltung gewichtet werden. Dieser letztere Unterschied wird klar, wenn man die unterschiedliche Gewichtung des Handelsbilanzüberschusses gegenüberstellt:
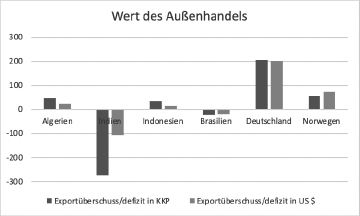
Abbildung 24: Wert des Außenhandelsüberschusses oder -defizits in KKP und US-Dollar (Milliarden) [lxiii]
In Halbkolonien ist der „nationale Wert“ der exportierten oder importierten Waren sehr viel höher als der US-Dollarwert. Für Handelsbilanzüberschüsse muss also viel mehr an Arbeit und Kapital im nationalen Maßstab aufgebracht werden bzw. verlangen Handelsbilanzdefizite auch umso mehr Aufwand, um sie wieder abzubauen (oder eine entsprechend größere Abwertung der Währung gegenüber dem US-Dollar). Umgekehrt müssen imperialistische Länder weniger für ihre Exportüberschüsse anstellen bzw. erhalten in US-Dollar mehr, als sie an Arbeit erbringen mussten. Damit ist diese Differenz im Außenbeitrag ein gewisser Maßstab für den „Werttransfer“ durch ungleichen Tausch am Weltmarkt. Tatsächlich sollte deutlich geworden sein, dass dies ein „Werttransfer“ nur in einem übertragenen Sinn ist. Denn EINEN Wert auf Weltebene gibt es so nicht: vom Maßstab des nationalen Werts aus gesehen wird tatsächlich Wert an die importierenden reichen Länder abgegeben, vom Maßstab der Wertbildung am Weltmarkt jedoch herrscht gleicher Tausch und es findet kein Werttransfer statt. Die unterschiedlichen Entwicklungsniveaus der Länder in Bezug auf Produktivität, Kapitalbildung und Lohnniveaus führen zu einer Differenz in der Wertbildung, die für die weniger entwickelten Länder einen größeren Teil an Arbeit erfordert, um die Arbeitsprodukte von entwickelteren Ländern einzukaufen. In diesem Sinn herrscht „ungleicher Tausch“ vor, der aber aus einem auf dem Weltmarkt modifizierten Wertgesetz resultiert. Er ist damit sicherlich ein Hindernis für die aufholende Entwicklung, gleichzeitig aber unentbehrlich für den Fortschritt der Produktivkraftentwicklung in den davon betroffenen Ländern. Eine Angleichungsbewegung der Profitraten (in US-Dollarpreisen) ist dann Folge dieses ungleichen Tausches (infolge der währungsbedingten Preissenkung), nicht jedoch Ursache dafür (wie Emmanuel postuliert hat).
Historischer Materialismus und die Frage der „Entwicklung“
In den vorherigen Abschnitten wurde oft von „Entwicklung“, „Entwicklungsstufen“, „entwickelteren“ oder „weniger entwickelten“ Ländern etc. gesprochen. Natürlich ist diese Begrifflichkeit, spätestens nach den „post-colonial studies“ höchst umstritten. Entwicklung macht nur Sin gegenüber einem Maßstab, einem Ziel, wohin sich etwas entwickelt oder entwickeln soll. Viele der globalen Institutionen, die sich mit „Entwicklung“ beschäftigen, sehen offensichtlich die reichen Länder wie die USA oder „Kern-Europa“ als Vorbilder, an denen Fortschritt gemessen wird. Dies hat dem Begriff insgesamt eine stark ideologische, „eurozentristische“ Mitbedeutung verliehen. Andererseits geht auch der Marxismus in Form des historischen Materialismus von einem Begriff des gesellschaftlichen Fortschritts aus, der einen globalen Maßstab für Entwicklung begründet. Gegenüber den marktliberalen Entwicklungsbegriffen werden hier die sozialen und kulturellen Errungenschaften, die auf bestimmter ökonomischer Grundlage möglich werden, in den Vordergrund gerückt. Außerdem betrachtet der historische Materialismus die Entwicklung von Gesellschaften nicht als linearen Fortschrittsprozess, sondern als notwendig von Widersprüchen zwischen der Entfaltung der sozialen und ökonomischen Potenziale geprägt. Keine dieser von Widersprüchen geprägte Gesellschaftsformationen ist ewig. Jede wird letztlich zur Fessel der weiteren Entwicklung, so dass nur historische Brüche, Umwälzungen der ihnen zugrundeliegenden Produktionsweisen Fortschritt bringen, nicht immanente Entwicklung. Auch wenn Marx seine Beispiele vornehmlich aus der europäischen Geschichte entnommen hat, ist diese historische Methode, die von den jeweiligen materiellen Bedingungen des gesellschaftlichen Zusammenlebens ausgeht und diese in der Dynamik von Entwicklung, Entwicklungshemmnissen und historischen Bruchpunkten betrachtet, allgemein genug, um auf die verschiedensten Regionen und Kulturen angewendet werden zu können. Dies betrifft insbesondere die Klassenverhältnisse, die sich unmittelbar um den gesellschaftlichen Arbeitsprozess herausbilden und sich in Eigentums- und Ausbeutungsverhältnissen reproduzieren.
Bekanntlich postulierte Marx, dass es vor dem Kapitalismus im Wesentlichen vier verschiedene historische Produktionsweisen gab: den Urkommunismus, die Sklavenhaltergesellschaft, den Feudalismus und die asiatische Produktionsweise [lxiv]. Marx behauptete keinesfalls eine notwendige Stufenleiter, die hier bis zur Moderne durchlaufen werden müsse. Schon die asiatische Produktionsweise passt hier nicht in ein solches Stufenschema. Immerhin hat sie zumeist Elemente der anderen Gesellschaftsformationen wie Gemeinschaftseigentum (wie im Urkommunismus) der Dorfgemeinde verknüpft mit Abgaben an die Autoritäten (wie im Feudalismus), aber auch SklavInnen im Dienst dieser Autoritäten (wie in der antiken Sklavenhaltergesellschaft). Tatsächlich hat die stalinistische Karikatur des historischen Materialismus diesen zu einem quasi-deterministischen Entwicklungsmodell vereinfacht – und dabei konsequent die störende asiatische Produktionsweise unter den Tisch fallen lassen.
Dies ist deswegen so wichtig, da die sozialistischen/kommunistischen Parteien der (halb-)kolonialen Welt zumeist diesem mechanistischen Entwicklungsmodell gefolgt sind. Ihre Analyse der „Rückständigkeit“ ihrer Länder war dann: Entscheidendes Entwicklungshemmnis sind die „feudalen Überreste“ (wenn nicht gar noch das Vorherrschen des Feudalismus, besonders durch den Großgrundbesitz). Kolonialismus und Feudalismus sind gemeinsame Feinde aller an der Entwicklung „der Nation“ interessierten, auch der „nationalen Bourgeoisie“. Durch die geringe Entwicklung des Kapitalismus sind sowohl die nationale Bourgeoisie als auch die ArbeiterInnenklasse weniger stark als in „modernen Gesellschaften“, wohingegen die arme Bauern-/Bäuerinnenschaft die am meisten ausgebeutete Klasse sei. Das vordringlichste Ziel sozialistischer Parteien müssten unter diesen Bedingungen die nationale Unabhängigkeit und die Überwindung der rückständigen, feudalen Verhältnisse sein, d. h., zunächst bürgerlich-demokratische Verhältnisse und eine „moderne Gesellschaft“ (d. h. einen entwickelten Kapitalismus) zu erkämpfen, im Bündnis mit nationaler Bourgeoisie und Bauern-/Bäuerinnenschaft. Erst dies würde die Voraussetzung für eine weitergehende, sozialistische Entwicklung schaffen. Wir werden später darstellen, dass weder die Analyse von den „feudalen Überresten“ (mit Abstraktion von anderen vor- oder nicht-kapitalistischen Gesellschaftselementen) noch das Absehen von der Strukturierung der kolonialen Gesellschaften und Ökonomien durch den Weltkapitalismus dem historischen Materialismus und einer darauf aufbauenden revolutionären Strategie gerecht werden.
Das Scheitern dieser Strategie, die sich fälschlicherweise auf den Marxismus berufen hat, hat dann zugleich auch „den historischen Materialismus“ (d. h. die Karikatur desselben) diskreditiert. Die nationalen Bourgeoisien haben, wenn es kritisch wurde, immer lieber mit den „rückständigen“ Kräften oder den imperialistischen Mächten zusammengearbeitet als mit „dem Volk“. Jede „Volksfront“ mit der Bourgeoisie war letztlich ein Massengrab für die Organisationen, die ArbeiterInnen, Landproletariat oder kleine Bauern und Bäuerinnen organisiert haben. Die „unabhängigen“, „demokratischen“ Staaten dienten weniger der Entwicklung moderner Ökonomien mit entsprechenden Sozialsystemen als vielmehr der Durchsetzung der Ausbeutungsinteressen von nationaler und internationaler Bourgeoisie im Verbund mit „rückständigen“ Besitzklassen aller Art. Die Enttäuschung über die tatsächlichen Ergebnisse der „Dekolonisation“, die wiederum in die Entbehrungen der abhängigen (Unter-)Entwicklung führte, mussten zumeist repressiv und diktatorisch abgesichert werden – auch gegen die sozialistischen Organisationen und Gewerkschaften, die trotz ihrer Politik ein Hindernis für die neue, neokoloniale Ordnung waren.
In der „postkolonialen Theorie“, wie sie im Laufe der 1990er Jahre unter anderem in Indien entwickelt wurde, erscheint das obige Modell, das man eigentlich als „eurozentristisch“ abgelegt haben will, noch wie in einem zerbrochenen Spiegel. Eines der zentralen Motive der Theorie ist die These der „Dominanz ohne Hegemonie“ [lxv]: Anders als im globalen Norden habe sich die Bourgeoisie in der Peripherie als zu schwach erwiesen, um tatsächlich „die Macht“ zu ergreifen, alle die Entwicklung des Kapitalismus hemmenden Relikte zu beseitigen. Sie hätte zwar durch die ökonomische Vorherrschaft des Kapitalismus eine Dominanz über die Gesellschaft erlangt, sei aber weit davon entfernt, die Hegemonie über sie auszuüben. Es gäbe eine Menge von sozialen Beziehungen (nicht nur was alte Grundbesitzerschichten betrifft, sondern auch spezielle solidarische Strukturen der „Subalternen“), die der bürgerlichen Vorherrschaft Grenzen setzen. Damit spielen aber auch „europäische Begriffe“ wie Nation, Klasse, nationale Entwicklung eine „falsche Rolle“, die für die Opfer der „Entwicklung“ nichts Gutes bringen können. Nicht in der „Entwicklung der Nation“, sondern in der Besinnung auf die Stärken der eigenen subalternen Kulturen und Netzwerke liege der Ausweg aus Abhängigkeit und Fremdbestimmung [lxvi].
Zunächst einmal war auch im globalen Norden das Ziel der Bourgeoisie nie die Entwicklung einer modernen, sozialen Gesellschaft – sondern schlicht die Verwertung des Kapitals und das Wegräumen aller Hindernisse, die dem im Weg stehen. Dies gelang natürlich nirgends vollständig – immerhin ist in der Verwertung des Kapitals schon selbst der Klassenwiderspruch angelegt (die Bestimmung der Grenze von notwendiger Arbeit zu Mehrarbeit). Kapitalistische Gesellschaft ist daher immer von Klassenkämpfen und der Herstellung von zeitweisen, periodischen Kompromissen, bedingt durch das Kräfteverhältnis zwischen den Klassen, geprägt. Aufgrund des zentralen Klassenwiderspruchs ist das Kapital, wie Marx in den „Theorien über den Mehrwert“ ausgeführt hat, auch zur Integration einer großen Menge an überkommenen Klassen und Schichten (GrundbesitzerInnen, Bürokratie, privilegierte Stände, Kleinbürgertum aller Art etc.) gezwungen bzw. gibt ihrer Alimentierung spezielle Wertformen (Grundrente, Honorare, staatliche Einkommen aller Art, …). Erst auf dieser Grundlage baut sich die bürgerliche Hegemonie auf, als Verschleierung der eigentlich grundlegenden Klassenherrschaft. Dass die Bourgeoisie nicht als „Hauptdarstellerin“ der Szenerie auftritt, ist gerade nicht ein Zeichen mangelnder Hegemonie, sondern ist die Normalform einer um die Macht der Kapitalverwertung und der daraus folgenden Alimentierung aller anderen besitzenden Schichten organisierten Gesellschaft. Der Mythos von der nicht an der Macht seienden Bourgeoisie in den Halbkolonien ist eigentlich eine Wiederholung der falschen stalinistischen Orientierung auf den „Fortschritt“, den die nationale Bourgeoisie durch die Schaffung eines mächtigen, unabhängigen Nationalstaates im Verbund mit den Volksklassen hervorbringen würde. Dass die Bourgeoisie in den Halbkolonien stattdessen jede Menge rückständiger Verhältnisse integriert hat, heißt dagegen überhaupt nicht, dass sie nicht gerade darüber ihre Macht in geeigneter Weise ausübt. Schließlich bleibt die Bourgeoisie in den Halbkolonien selbst eine vom internationalen Kapital und dessen weltpolitischen AkteurInnen abhängige Klasse. Das Zusammenwirken von internationaler Kapitalherrschaft und der nationalen Stellung der Bourgeoisie bestimmt auch letztlich die inneren Kräfteverhältnisse zu ihren Gunsten.
Die Dependenztheorie, allen voran Frank, hat bereits in den 1960er Jahren in ganz anderer Weise mit dem stalinistischen Modell der antikolonialen Entwicklung gebrochen: Frank erklärte in seinen Lateinamerika-Studien die These von den „feudalen Überresten“ für Unsinn und die nationalen Bourgeoisien für das Haupthindernis der Entwicklung in den Halbkolonien. Zu Recht kritisiert Frank in seiner auch heute noch lesenswerten Studie „Kapitalismus und der Mythos des Feudalismus in der brasilianischen Landwirtschaft“[lxvii] die Vorstellung von zwei getrennten Sektoren in Halbkolonien: dem entwickelten industriellen Bereich, der den Kapitalismus repräsentiere, gegenüber der rückständigen, von Großgrundbesitz gekennzeichneten Landwirtschaft, der den Feudalismus verkörpere. Die Vorstellung eines feudalistischen Sektors stimmt mit der Charakteristik von feudalen Gesellschaften überein, in sich weitgehend geschlossen, von persönlichen Abhängigkeitsverhältnissen und geringer Veränderungsdynamik gekennzeichnet zu sein. Am Beispiel der brasilianischen Landwirtschaft, die wegen der großen Rolle bestimmter Großgrundbesitzerfamilien hier ein gutes Beispiel zu sein scheint, zeigt Frank, dass dies mit der Realität wenig zu tun hat. Tatsächlich waren Länder wie Brasilien gerade in ihrem Agrarbereich (Zucker, Kaffee, Fleisch, etc.) immer schon stark in eine von den kapitalistischen Zentren und ihren Handelsinteressen bestimmte internationale Arbeitsteilung eingebunden, die ihnen gerade die Rolle als Agrarproduzentinnen zuwies (im Gegensatz zu anderen Ländern, die für bestimmte Industrien oder Bergbau auserkoren wurden). Dies bedeutete auch, dass diese Landwirtschaft stark von kapitalistischen Organisationsprinzipien und Verwertungsprinzipien bestimmt war. In mehreren Wellen kann man die verstärkte Kapitalisierung (im Bezug von Saatgut, Dünger, Arbeitsmitteln …) feststellen wie auch die Einbindung in große Handelsmonopole. Sowohl von der Kapitalseite (Kreditfinanzierung, Kapitalgesellschaften als Eigentümerinnen, wachsende Konzentration, …) als auch von der Arbeitsseite (Pachtsystem, Lohnarbeitssystem nach Aufhebung der Sklaverei, Vertreibung von vormals „eigentumslosen“ LandbewohnerInnen …) ist diese Landwirtschaft sogar stärker kapitalistisch organisiert als die vieler europäischer Länder.
Die Kritik an der Vorstellung der getrennten Sektoren – von den Metropolen dominierter Weltmarkt und ihre Satelliten in der Halbkolonie, nationale Industrie, rückständige Landwirtschaft – ist sicherlich ein sehr wichtiger Punkt. Wie wir oben gesehen haben, sind die verschiedenen Produktions- und Zirkulationssphären zwar differenziert, aber doch durch die globalen und regionalen Akkumulationsbewegungen eng miteinander verflochten. Frank geht hier, wie schon dargestellt, von einem hierarchischen Weltsystem aus, in dem von Stufe zu Stufe eine Abschöpfung von Surplus Richtung Metropolen stattfindet. Insofern stünden damit Landwirtschaft, lokale Industrie und Exportsektoren in einem Zusammenhang, der sich wesentlich aus der kapitalistischen Struktur des globalen Kapitalismus ableitet. Auch wenn sein Monopol- und Surplusbegriff ungenügend ist, die Funktionsweise und Dynamik des globalen Kapitalismus richtig zu erfassen, ist diese Schlussfolgerung sicherlich richtig und wesentlich fruchtbarer als die heutigen postkolonialen Theorien.
Immanuel Wallerstein
Diese beherrschende Funktion des kapitalistischen Gesamtsystems für den Zusammenhang der widersprüchlichen Teile wird noch stärker betont von einem anderen Exponenten aus dem Umfeld der Dependenztheorie, dem kürzlich verstorbenen Immanuel Wallerstein[lxviii]. Wallerstein sieht alle Länder, welchen Entwicklungsstand sie auch haben mögen, seit dem 16. Jahrhundert als Bestandteile eines einzigen, kapitalistischen „Weltsystems“. Kulturen und Ökonomien wären seit einer gewissen Stufe der Zivilisation immer schon Bestandteile von solchen Weltsystemen gewesen, d. h. eines Netzwerks von kulturellen, politischen und ökonomischen Beziehungen unterschiedlicher Länder, die normalerweise keinen übergreifenden Staat bilden (außer in den besonderen Umständen von „Imperien“). Im 16. Jahrhundert nun sei es dem Kapitalismus gelungen, alle bis dahin bestehenden Weltsysteme (insbesondere durch die Einbeziehung Asiens in den europäischen „Weltmarkt“) in ein einziges kapitalistisches System einzugliedern. Das Akkumulationsprinzip des Kapitalismus sei besonders geeignet für eine solche globale Zusammenfassung. Andererseits erfordern Monopolbildung und die Durchsetzung von deren Interessen die Stärkung der Staaten, die mit diesen Monopolen verbunden sind. Auch bei Frank sind es die Monopole, die eine Hierarchie von Zentrum bis Peripherie herausbilden, die auch das System der Staaten und ihrer Beziehungen bestimmt. Dabei führt Wallerstein zusätzlich die Kategorie von „semiperipheren“ Ländern ein, die zeitweise eine unabhängigere Stellung, mitsamt besserer Akkumulationsmöglichkeiten für ihre Monopole hervorbringen können – um in einem nächsten Zyklus wieder zurückzufallen. Auch wenn Wallerstein eine sehr gering entwickelte eigene Akkumulationstheorie besitzt (im Wesentlichen geht er davon aus, dass ohne Monopolisierung und Staatseingriffe die Akkumulation durch Profitratenfall und Absatzprobleme zugrunde gehen würde), erkennt er zurecht, dass das kapitalistische Weltsystem grundlegend von der Tendenz zur Krise geprägt ist. Er geht von langfristigen Zyklen aus, in denen sich bestimmte Monopolstrukturen herausbilden, die aber in sich verkrusten und durch konkurrierende aufsteigende MonopolaspirantInnen herausgefordert werden. Dies würde weltweite Krisenzyklen von etwa 20– 30 Jahren Dauer bewirken, in denen sich jeweils das Gesicht des Weltsystems grundlegend ändert.
Gleichzeitig sieht Wallerstein mit dem Weltsystem eine universelle Geokultur am Wachsen, die aber durch Beharrungskräfte, Rassismus und Sexismus zu einem widersprüchlichen Ganzen zusammenwirkt. Grundlegend sieht er die globale Tendenz zur Überwindung des Kapitalismus als Grundlage des Weltsystems in dieser Geokultur zunehmen. Jedoch ist es unmöglich, ein solches totales Weltsystem in einem seiner Teile (in einem Land oder einer Region) zu transformieren. Diese Überwindung sei nur global, weltweit möglich. Wallerstein sieht die Welt heute in einer solchen Fundamentalkrise: „Diese Krise mag auch noch 25 bis 50 Jahre andauern. Da ein zentrales Merkmal einer solchen Übergangsphase ist, dass wir wilde Oszillationen all jener Strukturen und Prozesse erleben, die wir als festen Bestandteil des gegebenen Welt-Systems kennen gelernt haben, stellen sich unsere kurzfristigen Aussichten notwendigerweise als ziemlich instabil heraus“ [lxix].
Ausdruck dieser instabilen Lage sei die Aufgabe des „Developmentalismus“ (sowohl gegenüber Halbkolonien als auch, was die Überwindung sozialer Gegensätze im Zentrum betrifft) und die Hegemonie des „Neoliberalismus“ einerseits (Öffnung der Märkte, Privatisierung, Abbau von Regulierungen …), sowie im Verhältnis zu den Halbkolonien die Unterordnung unter den „Washington Consensus“ (Primat der internationalen Märkte für „Anpassungsprogramme“ in den Halbkolonien). Die internationalen Institutionen seien zu reinen Umsetzungsorganen dieser Prinzipien geraten, die nur noch zur Dekoration den Begriff der „Entwicklung“ verwenden. Damit habe man eine weltweite Polarisierung hervorgebracht, die starke Gegenkräfte und globale „Anti-System Bewegungen“ hervorbringen würden, die sich besonders auch gegen diese Institutionen und die dahinter liegende Krisenregulierung namens „Globalisierung“ organisieren. Wallerstein und seine NachfolgerInnen wurden damit intellektuelle MentorInnen der „altermondialistischen“ Bewegung („eine andere Welt ist möglich“).
In seinen historischen Abhandlungen zum Kolonialismus hat Wallerstein ebenfalls das übliche Muster der stalinistischen Entwicklungsstufen kritisiert, besonders ihr Beharren auf den „feudalen Strukturen“, die angeblich überall in der kolonialisierten Welt konserviert worden wären. Zu Recht bemerkt Wallerstein, dass Feudalismus außerhalb von Europa nur sehr selten überhaupt als historisches Stadium eines ganzen Landes zu finden war – Japan stellt hier eher eine seltene Ausnahme dar. Wie schon andere vor ihm hat auch Wallerstein hier die „asiatische Produktionsweise“ als theoretische Errungenschaft des Marxismus rehabilitiert. Tatsächlich sind in vielen Ländern, die von der europäischen Expansion betroffen waren, zunächst viele Elemente von Gemein- oder Claneigentum Hindernisse und dann auch Opfer der Herausbildung des kolonialen Kapitalismus geworden. Die Oligarchien, die sich zuvor über den lokalen Gemeinschaften und feudalen Teilsystemen erhoben, waren sehr viel schneller in der Lage, sich in kapitalistische EigentümerInnen, GroßgrundbesitzerInnen, BürokratInnen im kolonialen System zu verwandeln.
Rosa Luxemburg hat dies in ihrem berühmten Buch „Die Akkumulation des Kapitals“ [lxx] eindrucksvoll anhand der Geschichte Algeriens in der französischen Kolonialzeit dargestellt [lxxi]. Dabei macht sie klar, dass der Kolonialismus wesentliche Elemente der ursprünglichen Akkumulation perpetuiert. Schon Marx hatte im Kapitel über den Kolonialismus in „Das Kapital“ festgestellt, dass er vor allem die Aspekte der ursprünglichen Akkumulation nachholt, die zur Schaffung eines Proletariats führen – weniger diejenigen, die zur Bildung von Kapital dienen. Immerhin ist er als Raubsystem mitels des merkantilen Kapitals ja ein wichtiger Faktor bei der Formierung des europäischen Kapitalismus gewesen. Das Werk der ursprünglichen Akkumulation stieß auch in der kolonialen Welt auf vielfältige vorkapitalistische Strukturen, die sich einer warenförmigen Organisation stark entgegensetzen. Während feudaler Grundbesitz über Pachtsysteme, Verschuldung, Landverkauf etc. relativ leicht in kapitalistische Verhältnisse überführt werden kann, entziehen sich Elemente der Gemeinnutzung durch ihre Marktferne dieser Transformation sehr viel stärker. Luxemburg beschreibt die Verhältnisse in Algerien zu Beginn der Kolonialzeit (1830) auf dem Land als mehrheitlich von Claneigentum gekennzeichnet. Die „Eigentümerinnen“ des Landes waren wechselnde Oligarchien, die zwar Abgaben erhoben, aber ohne das Wirtschaften der Clans groß zu bestimmen. Der Erwerb dieses „Eigentums“ durch die KolonialistInnen änderte daher aus der Sichtweise der Clans nichts an ihren Rechten auf „ihr“ Land – anders aus Sicht der kapitalistischen ErwerberInnen. Dies musste notwendigerweise zu einem harten Aufeinandertreffen von „Rechtsvorstellungen“ führen, das zumeist in Vertreibungen oder blutigem Widerstand mündete. „Die planmäßige, bewusste Vernichtung und Aufteilung des Gemeineigentums, das war der unverrückbare Pol, nach dem sich der Kompass der französischen Kolonialpolitik ungeachtet aller Stürme im Inneren des Staatslebens während eines halben Jahrhunderts richtete“ [lxxii]. Dies einerseits sicherlich zur Sicherung der eigenen Herrschaft, andererseits um überhaupt kapitalistische Verhältnisse herzustellen. Die Vertreibung vom Gemeineigentum war die Voraussetzung für die Schaffung eines landlosen Proletariats als Grundlage für Kapitalverwertung. Insbesondere war aber die Durchsetzung des Privateigentums am Land auch die Voraussetzung für intensive, kapitalistische Landwirtschaft, wie diese auch die Lebensmittel in Waren umwandelt, die nur gegen Geld zu erlangen sind. So war dieser Prozess der Entwicklung einer „fortschrittlichen“ Landwirtschaft zugleich ein Prozess der massenhaften Vernichtung von Lebensbedingungen, von großen Hungersnöten unter denen, die plötzlich durch den Markt von dem getrennt waren, was sie bisher in Gemeinwirtschaft sich erarbeiten konnten. Kapitalisierung der Landwirtschaft, Zerstörung der Dorfwirtschaften, Verwandlung allen Bodens in Privateigentum, Durchsetzung des Marktes als alleinigen Zugangspunkt zu Lebensmitteln, all das sind die Elemente der ursprünglichen Akkumulation, deren Werk der Kolonialismus in unterschiedlichen Ausprägungen überall verrichtet hat.
Insofern sind weiterhin bestehende „informelle“ Sektoren, Subsistenzwirtschaft, Besetzung und Nutzung von „eigentumslosem“ Land genauso wie „illegale“ Siedlung und die Vorgehensweise dagegen der Beweis, dass dieses Werk der ursprünglichen Akkumulation von den neuen Oligarchien der postkolonialen Welt genauso fortgesetzt wird und tatsächlich ein wichtiges Zeichen ihrer fortgesetzten kolonialen Strukturen ist. Es sind weniger übriggebliebene „feudale Reste“ als vielmehr tief in den Unterschichten verankerte nicht marktförmige Lebens- und Arbeitsweisen, die sich für die Kapitalentwicklung als Schranken erweisen. Sie begrenzen das Arbeitskräftepotential, das verfügbare Land, die mögliche Nachfrage auf den Konsummärkten etc. und tragen zur Festsetzung eines niedrigeren Lohnniveaus bei. Andererseits bilden sie eine beständige Quelle des Aufstands gegen Kapitalverhältnisse, gegen fortgesetzte Enteignung und für solidarische gesellschaftliche Beziehungen. Wie die Landlosenbewegung in Brasilien (MST) und später die Bewegung der Favela-BewohnerInnen (MTST) zeigte, kann dies zu einer stabilen langfristigen Organisierung führen, die in ein enges Bündnis zur organisierten ArbeiterInnenbewegung tritt. Der Terror des Agrarkapitals gegen die MST, der Kampf um besetztes Land, die Verteidigung gegen die Räumung von Favelas etc. zeigen, dass die Konflikte des Kolonialkapitals nur eine neue Form angenommen haben: Das agierende Kapital bleibt das gleiche, ob in kolonialer oder dekolonialisierter Verkleidung.
Agrarfrage, kapitalistische Entwicklung und soziale Revolution
Aus dem Jahr 1881 stammt ein Briefwechsel von Karl Marx mit der jungen russischen Revolutionärin Wera Sassulitsch[lxxiii] über die Bedeutung der russischen Dorfgemeinschaft, der sogenannten Obschtschina (oder Mir). In Russland hatten sich bis zu dieser Zeit Elemente des Gemeineigentums in den agrarischen Dorfgemeinschaften gehalten, wenn auch traditionell kombiniert mit einem System von Abhängigkeiten und Abgaben in Richtung GroßgrundbesitzerInnen bzw. Staat. Sassulitsch nahm Bezug auf die „offiziellen“ MarxistInnen in Russland, die den Untergang der alten Dorfgemeinschaften als „historisch notwendige“ Voraussetzung für die Entwicklung Russlands ansahen, während die „VolkstümlerInnen“ dem Dorf eine zentrale Rolle für den Übergang zum Sozialismus beimaßen.
Marx arbeitete sich an dieser Fragestellung in vier Antwortentwürfen[lxxiv] ab, um dann (aufgrund persönlicher Umstände) nur eine sehr knappe Antwort zu schreiben. Die Briefentwürfe werfen jedoch sehr zentrale Fragen zum Entwicklungsbegriff auf, die zu einer starken Nachwirkung in Teilen des Marxismus bis heute geführt haben. Schon in einer Antwort auf eine Frage einer russischen Zeitung 4 Jahre zuvor nach der Notwendigkeit des Nachholens der „ursprünglichen Akkumulation“ in Russland schrieb Marx, dass man seine „historische Skizze von der Entstehung des Kapitalismus in Westeuropa“ nicht in eine „geschichtsphilosophische Theorie des allgemeinen Entwicklungsganges verwandeln“ solle, „der allen Völkern schicksalsmäßig vorgeschrieben ist, was immer die geschichtlichen Umstände sein mögen“ [lxxv]. Er erinnert dabei daran, dass die Vertreibung der Bauern/Bäuerinnen vom Land im alten Rom, anders als im Britannien der Industrialisierung, diese nicht zu ProletarierInnen im modernen Sinne, sondern zu plebejischen Anhängseln der auf Sklavenarbeit beruhenden Produktionsweise gemacht hat – und meint dazu: „Wenn man jede dieser Entwicklungen für sich studiert und sie dann miteinander vergleicht, wird man leicht den Schlüssel zu dieser Erscheinung finden, aber man wird niemals dahin gelangen mit dem Universalschlüssel einer allgemeinen geschichtsphilosophischen Theorie, deren größter Vorzug darin besteht, übergeschichtlich zu sein“ [lxxvi].
Auf Marx kann sich also niemand berufen, der von „notwendigen Etappen“ oder einer mechanischen Anwendung von Entwicklungsschemata ausgeht. Stattdessen ist die konkrete, historische Analyse auf der Grundlage eines Verständnisses des Werdegangs, der Widersprüche und der Entwicklungsmöglichkeiten der untersuchten gesellschaftlichen Formation notwendig. Marx betont nochmals in seiner Antwort an Sassulitsch, dass seine Analyse der „ursprünglichen Akkumulation“ von den in Westeuropa vorherrschenden Formen des Privateigentums ausging: „Das Privateigentum, das auf persönlicher Arbeit gegründet ist … wird verdrängt durch das kapitalistische Privateigentum, das auf der Ausbeutung der Arbeit andrer, der Lohnarbeit gegründet ist“ [lxxvii]. Das aus dem Feudalismus hervorgegangene bäuerliche Kleineigentum war für die Entstehungsgeschichte des Kapitalismus in Westeuropa so geeignet, weil es durch die Kapitalisierung des Bodens, die Verschuldung der Bauern/Bäuerinnen, die Umwandlung von Gemeindeland in Privateigentum etc. letztlich große Teile der Landbevölkerung enteignen konnte, um sie als ProletarierInnen in den städtischen Industrien nutzen zu können. Daher sei diese Entwicklung in einem Land wie Russland, in dem das bäuerliche Privateigentum nie eine ähnliche Rolle gespielt hat, eben auch nicht einfach übertragbar: „Weil in Rußland, dank eines einzigartigen Zusammentreffens von Umständen, die noch im nationalen Maßstab vorhandene Dorfgemeinde sich nach und nach von ihren primitiven Wesenszügen befreien und sich unmittelbar als Element der kollektiven Produktion in nationalem Maßstab entwickeln kann“ [lxxviii].
Marx führt hier die Möglichkeit an, dass aufgrund der Entwicklung um Russland herum, dieses viele Stufen, die in anderen Ländern mühsam durchlaufen werden mussten, überspringen könne. Wenn dies in Bezug auf das Fabriksystem und die Herausbildung einer modernen Zirkulationssphäre möglich gewesen sei, warum nicht auch in Bezug auf eine kollektivierte Landwirtschaft, wenn diese wiederum Teil einer proletarischen Umwälzung in ganz Europa, einschließlich Russlands ist?
Anders als dies viele InterpretInnen der Sassulitsch-Briefe herauszulesen meinten, zeichnet Marx ein durchaus kritisches Bild der russischen Dorfgemeinde und macht daraus keineswegs ein kommunistisches Landkommunen-Idyll, das es zu verallgemeinern gelte:
Erstens handelt es sich um ein Relikt aus der langen Geschichte des Verfalls von Urgemeinschaften, die viele Unterschiede, aber auch gemeinsame Stufen des Übergangs in andere Produktionsformationen aufweisen. Dörfliche Agrarwirtschaft mit gemeinsamer Haushaltung und Arbeit großer Familienverbände in einer beanspruchten Domäne erwies sich über viele wechselnde Produktionsweisen als sehr widerstandsfähig, gleichzeitig aber auch limitiert, was ihre ökonomische Leistungsfähigkeit anbelangt, und damit in entsprechendem Umfeld letztlich zum Untergang verurteilt. Darin einbegriffen ist nach Marx, dass es viele Übergangsformen gibt, in denen das Gemeineigentum (z. B. an Gerätschaften, Waldnutzung, besonderen Ernteereignissen) kombiniert wird mit privatem Eigentum an Parzellen oder Einzelhäusern. Familienbande und patriarchale Strukturen sind nicht nur Schutz, sondern auch Elemente der Rückständigkeit, persönlicher Abhängigkeit und sozialer Unterdrückung. Durch den Kontakt mit der Außenwelt löst sich die Dorfgemeinde besonders durch den notwendigen Zerfall dieser Schranken zugunsten der Absonderung der privaten Parzellenbauern/-bäuerinnen im Verbund mit den sich ausweitenden lokalen und überregionalen Märkten auf.
Wenn Marx davon spricht, dass die Entwicklung Russlands diesen Auflösungsprozess lange verzögert hat, so spricht er damit etwas aus, das natürlich auf viele Länder außerhalb Europas zutrifft. Im zaristischen Russland kam hinzu, dass die zentrale Agrarreform, die sogenannte „Abschaffung der Leibeigenschaft“ von 1861, stark auf die Funktion der alten Obschtschina angewiesen war. Als Kompromiss mit der adeligen Großgrundbesitzerschaft wurde den „befreiten“ Bauern/Bäuerinnen vor allem das schlechtere Land zugeteilt bzw. für ihr “Los“ auch noch ein Kaufpreis abverlangt, den sie über Kredite und Abgaben zu finanzieren hatten. Nur über die Dorfgemeinschaft, die die gemeinsame Bewirtschaftung und die finanziellen Abgaben bündelte, konnte der Teil der Landbevölkerung, der sich nicht gleich wieder an die GrundbesitzerInnen verkaufte, überleben. So standen noch zu Zeiten der 1905er Revolution über 9 Millionen Dorfgemeinden gerade mal 2 Millionen privaten Kleinbauern/-bäuerinnen gegenüber. Russland war hier nur ein Vorläufer vieler „Agrarreformen“, die im Namen der „Gerechtigkeit auf dem Lande“ zu einer Ausdehnung des Großgrundbesitzes auf kapitalistischer Basis bei gleichzeitiger Wiedererstehung oder Transformation alter Formen des Kommunenwesens führten. Wie Lenin zu Recht in seiner Analyse der Bauern-/Bäuerinnenwirtschaften zu Beginn des 20. Jahrhunderts nachwies, waren die „Dorfgemeinschaften“ ein Anhängsel der Agrarbourgeoisie, an die sie verschuldet waren und von deren Handelsorganisationen sie abhing.
Die agrarischen Solidargemeinschaften, wie sie in verschiedenen Weltregionen als Überbleibsel alter Produktionsformationen zu finden sind, sind einerseits Entwicklungshemmnisse:
- geringe Produktivität aufgrund zurückgebliebener Produktivkräfte (Werkzeuge, Maschinerie, Saatgut, Düngemittel …);
- sie binden eine große Zahl an wenig qualifizierter Arbeitskräfte, die in diesen Produktionsformen gerade so überleben können. Der Überfluss an Arbeitskraft befestigt die geringe Produktivität pro landwirtschaftlich Beschäftigten;
- die traditionalen Strukturen zeigen große Widerstände gegen Veränderung der Produktionsweise und damit auch Aufnahme von Wissen, neuen Verfahren etc.;
- die kleinteilige Struktur der Agrargemeinden verhindert die Wirkung positiver Skaleneffekte, die Großbetriebe erreichen können (Reduktion von Fixkosten, Mengeneffekte, Mechanisierung, Losgrößenaufteilung gemäß Bodenbeschaffenheit …)
- für viele ihrer Beteiligten (z. B. Frauen, Kinder …) stellen sie eher ein Gefängnis dar, das sie an zurückgebliebene patriarchalische Strukturen bindet und geringe Bildungs- und Entfaltungsmöglichkeiten bietet.
Die Stärke dagegen ist die zumeist garantierte gesicherte materielle Existenz in einer Solidargemeinschaft, auf welch geringen Niveau auch immer (natürlich gefährdet durch Naturkatastrophen oder menschengemachten Klimawandel). Daher ist es kein Wunder, dass in Krisenzeiten diese Solidargemeinschaften wieder stark zum Vorschein kommen. So auch in Russland, wo sie durch die liberalen Reformen nach 1905 (Stolypin-Reformen) gegenüber bäuerlichen Klein- und Großbetrieben stark zurückgedrängt wurden: Mit der Not des ersten Weltkriegs kehrten sie massiv zurück und wurden nach der Februarrevolution zu Zentren der Umverteilung des Landes an die Dorfgemeinschaften („schwarze Enteignung“).
Es ist kein Wunder, dass kapitalistische Großbetriebe im Agrarbereich regional und über den Weltmarkt die bäuerliche Kleinproduktion durch ihre Produktivitätsvorteile über die Preiskonkurrenz verdrängen, sofern nicht staatliche Schutzmaßnahmen oder das Ausweichen in Nischenbereiche helfen. Daher überrascht es auch gegenwärtig nicht, dass die Größen landwirtschaftlicher Betriebe weiter zunehmen.
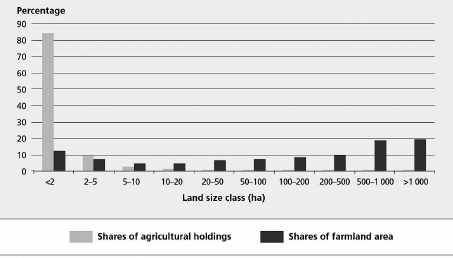
Abbildung 25: Unterschied von Anzahl landwirtschaftlicher Betriebe und Betriebsgröße [lxxix]
Weltweit gesehen sind es nur 2 % der agrarischen Betriebe, die über zwei Drittel der landwirtschaftlichen Nutzfläche bewirtschaften (also tatsächlich Großbetriebe sind). Dabei gibt es in einigen „Entwicklungsländern“ sogar die größten landwirtschaftlichen Betriebe mit über 10.000 ha. Inzwischen werden solche Großflächen auch zu starken Investitionsfeldern des multinationalen Kapitals. Dagegen gelten laut den Statistiken der FAO 80 % der landwirtschaftlichen Betriebe als Kleinbetriebe mit weniger als 2 ha. Von den weltweit geschätzten 580 Millionen landwirtschaftlichen Betrieben gelten 88 % als „Familienbetriebe“. Von den 2,6 Milliarden Menschen, die heute in der Landwirtschaft arbeiten, arbeitet also ein Großteil weiter auf kleinster Fläche, ist aber für einen Großteil der Nahrungsmittelversorgung der armen Länder verantwortlich. Dabei ist der Begriff des „Familienbetriebs“ der FAO sehr weit gesteckt: er umfasst Kleinbauern/-bäuerinnen, Dorfgemeinschaften, indigene Bewirtschaftung etc. (lt. FAO werden z. B. auch 33 % der Waldfläche der Welt „gemeinschaftlich“ bewirtschaftet). Die Bedeutung dieser Kleinbetriebe wird auch klar, wenn die FAO behauptet, dass sie für etwa 80 % der Nahrungsmittelgrundversorgung gerade in den „Entwicklungsländern“ verantwortlich sind. Folglich ist damit ihre Verdrängung durch die Weltmarktdominanz des globalen Agrobusiness für viele Länder existenzbedrohend – wie man nach der Krise 2008/2009, die zu einem starken Anstieg der Weltmarktreise führte, sehen konnte. Zusätzlich gibt es eine starke regionale Differenzierung: Während in Lateinamerika die großflächige Landwirtschaft schon länger dominant ist, befindet sie sich in Asien und Afrika erst auf dem Vormarsch. Die Abbildung zeigt die durchschnittliche „Hofgröße“ nach Region in ha. Daher ist es kein Wunder, dass in weiten Teilen Afrikas und Asiens (vor allem dem indischen und indochinesischen Subkontinent) heute noch über 40 % der Menschen von der Landwirtschaft leben, während dieser Anteil in Lateinamerika und den imperialistischen Ländern unter 5 % liegt. Letzteres wird laut offizieller Statistik inzwischen auch von China behauptet (ein Zeichen einer massiven gesellschaftlichen Veränderung in den letzten zwei Jahrzehnten).
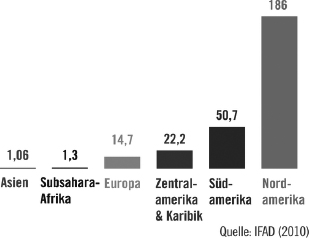
Abbildung 26: Durchschnittliche Hofgröße in Hektar nach Region [lxxx]
Der Fortschritt der kapitalistischen Durchdringung der Landwirtschaft ist wie jeder im Kapitalismus eine zweiseitige Angelegenheit. Die grundlegende Vergesellschaftung auch der landwirtschaftlichen Arbeit (im Verbund mit vorgelagerter Schaffung von Voraussetzungen und nachgelagerter Verarbeitung) ist sicherlich ein Fortschritt für die Ernährungsgrundlagen einer wachsenden Weltbevölkerung. Andererseits setzt sie einen elementaren Bereich der Grundversorgung der Krisenhaftigkeit dieser Produktionsweise aus, genauso der ökologischen Katastrophe des Verwertungszwangs ohne Grenzen der Nachhaltigkeit. Die Zerstörung der traditionellen landwirtschaftlichen Strukturen, ohne dass die vom Land vertriebenen Arbeitskräfte vollständig in die industrielle Akkumulation aufgesogen werden können, führt zum Entstehen prekärer Existenzbedingungen rund um die großen Metropolen der Halbkolonien (bzw. zu großen Migrationsbewegungen). Dies beinhaltet auch das Wiederentstehen von Formen der solidarischen Subsistenzwirtschaft in prekärer Form.
Die Frage der „Dorfgemeinschaft“ bleibt also aktuell. Marx gibt hier insofern einen wichtigen Hinweis, als er den Übergangscharakter dieser Erscheinungen analysiert hat. Sie sind durch ihre Elemente kollektiver Arbeit nicht an sich „Keimzellen des Kommunismus“. Sie sind vielmehr unter den vorherrschenden kapitalistischen Bedingungen immer eine Notgemeinschaft als Resultat besonderer Bedingungen der Durchsetzung des Kapitalismus auf dem Land. In Bezug auf die russische Dorfgemeinde stellt Marx deren Rückständigkeit, Elend und Zersplitterung fest – alles Elemente, die überwunden werden müssen, auch in einer sozialistischen Revolution. Andererseits gab es in Russland eine lange Tradition des Zusammenschlusses der Dorfgemeinden in sogenannten Artels, einer Form, die im Westen als „Genossenschaften“ bezeichnet wurde. Das Artel beinhaltete gemeinsames Eigentum an den Gerätschaften, dem Saatgut und den gemeinschaftlich erarbeiteten Produkten, ließ aber den einzelnen Bauern/Bäuerinnen das Eigentum an Häusern und selbst bebauten Nutzflächen. Im Unterschied zu westlichen Genossenschaften war es weniger formalisiert und mehr Zusammenschluss von Großfamilien zu einem Verband.
Marx sieht in dieser Tendenz die Möglichkeit, die Revolution in der Stadt mit der auf dem Land zu verbinden. Die russische Dorfgemeinde sei durch die Entwicklung der kapitalistischen Landwirtschaft extrem bedroht. Andererseits ermögliche eine sozialistische Revolution, dass sie den Landgemeinden die Mittel nicht nur zum Überleben liefert, sondern ihnen auch eine Perspektive der Weiterentwicklung des Artel-Wesens bietet: „Einerseits gestattet ihr das Gemeineigentum am Boden, den parzellierten und individualistischen Ackerbau unmittelbar und allmählich in kollektive Bearbeitung umzuwandeln; und die russischen Bauern betreiben dies ja bereits auf den ungeteilten Wiesen. Die physische Beschaffenheit des russischen Bodens lädt zu einer maschinellen Bearbeitung in großem Maßstab geradezu ein; das Vertrautsein des Bauern mit den Artelbeziehungen erleichtert ihm den Übergang von der Parzellen- zur genossenschaftlichen Arbeit, und schließlich schuldet ihm die russische Gesellschaft, die solange auf seine Kosten gelebt hat, die notwendigen Vorschüsse für einen solchen Übergang“ [lxxxi].
Es wird klar, dass Marx eine massenhafte Aneignung von Grund und Boden durch die Dorfgemeinden vorhersah, die für eine genossenschaftliche Bewirtschaftung gewonnen werden mussten. Kernelement dieser Genossenschaften musste ihre Entschuldung und die Bereitstellung der produktiven Mittel für die Kollektivbewirtschaftung sein, also die Ausrüstung der Genossenschaften mit Maschinerie, Saatgut, Wissen etc., die sie zur produktiven Bewirtschaftung des kollektivierten Landes befähigen. Eben letzteres ist es, was bürgerliche Agrarreformen den „begünstigten“ Bauern/Bäuerinnen nicht zuteilen – sie mögen Böden erhalten, sind aber nicht befähigt, sie schuldenfrei auch in entsprechend konkurrenzfähiger Form zu bewirtschaften.
Tatsächlich waren in der Russischen Revolution die Dorfgemeinden die Zentren der bäuerlichen Aneignung. Mit dem „Dekret über den Boden“, in dem die Sowjetregierung diese Aneignungen sanktionierte, gewann diese auch die Unterstützung der Bauern-/Bäuerinnenmassen. Allerdings gelang es in Zeiten des Bürgerkriegs und des Kriegskommunismus, nur wenige Dorfgemeinden für Kollektivierung in Form von Genossenschaften zu gewinnen. Dazu fehlten auch die Mittel aus einer zusammenbrechenden Industrie, die vor allem auf Kriegsproduktion ausgerichtet war, um hier der Bauern-/Bäuerinnenschaft etwas bieten zu können. Die Dorfgemeinden blieben Subsistenzwirtschaften zum Überleben im Bürgerkrieg und mussten mit Zwangsmaßnahmen zur Ernährung der Städte gezwungen werden. Das Auseinanderklaffen von Industrie- und Agrarpreisen (die sogenannte Scherenkrise) führte auch nach Ende des Bürgerkriegs zu einem faktischen Produktionsstreik der Landwirtschaft. Dies konnte im Rahmen der NÖP nur durch die Liberalisierung des Agrarmarktes und Förderung von privater Landwirtschaft überwunden werden. Während die Zahl genossenschaftlicher Betriebe auf unter 5 % sank, stieg die von kleinen und mittleren privaten Bauern/Bäuerinnen enorm an. Dies erwuchs nicht aus einer mangelnden Betonung der „kommunistischen Elemente“ der Dorfgemeinde durch die Bolschewiki, sondern aus der Dynamik der Dorfgemeinde unter den gegebenen Umständen selbst.
Die Probleme der frühen Sowjetunion sind tatsächlich exemplarisch für Länder, bei denen eine antikapitalistische Umwälzung mit der Notwendigkeit der nachholenden Entwicklung verbunden ist. Russland hatte einerseits eine hochentwickelte, auf den Weltmarkt ausgerichtete Industrie, die im Rahmen der Gesamtökonomie zwar klein war, aber das herausragendste Wachstum aufwies. Andererseits war der Binnenmarkt von rückständigen Strukturen, insbesondere in der Landwirtschaft bestimmt, in der insbesondere Kleinbetriebe und Dorfgemeinden wesentlich für die Nahrungsmittelversorgung blieben. Die moderne Industrie war durch die Umwälzung nicht nur geschwächt, sondern war auch gar nicht auf die Bedürfnisse der Binnenökonomie ausgerichtet. Die Landwirtschaft war zwar umverteilt, aber nicht kollektiviert. Sie war einer der zentralen Teile der Ökonomie, der weiterhin über den Markt mit dem verstaatlichten Teil der Ökonomie im Austausch stand. Für diese Situation entwickelte der führende bolschewistische Ökonom Jewgeni Preobraschenski die Theorie der „ursprünglichen sozialistischen Akkumulation“ [lxxxii].
Hiernach gibt es einerseits die Entwicklung der vergesellschafteten Industrie, die nicht mehr dem Wertgesetz folgt – in der also die Entscheidungen über Produktivitätsentwicklung, Arbeitskräfteeinsatz, Produktionsmenge etc. bewusst, über einen Entwicklungsplan, gefällt werden. Diese sozialistische Akkumulation muss unter Bedingungen der nachhaltigen Entwicklung schrittweise mehr und mehr Wirtschaftszweige einbeziehen, die zunächst aufgrund der unterschiedlichen Entwicklungsniveaus nicht vergesellschaftet werden können. Hier spricht Preobraschenski von einem der ursprünglichen Akkumulation ähnlichen Prozess, in dem ein „Werttransfer“ oder „ungleicher Tausch“ von den nichtsozialistischen Sektoren in die sozialistischen stattfindet. Auch hier kann wieder nur in analoger Weise von Werttransfer gesprochen werden, da ja im sozialistischen Sektor gar kein Wert produziert wird. Sehr wohl handelt es sich aber wiederum um einen Vergleich von Arbeitsquanten, die jeweils in der staatlichen Industrie gegenüber der privaten Landwirtschaft geleistet werden. Erhöht sich zum Beispiel die Produktivität der Traktorenfertigung, so kann dies in einer Preisreduktion weitergegeben werden – oder zu Aneignung von landwirtschaftlicher Mehrarbeit führen, durch nur teilweise Senkung der Industriepreise. Letzteres lässt sich wiederum in eine Ausweitung der Industrie umsetzen, durch die größere Zahl an ArbeiterInnen, die ernährt werden können.
Der Vorschlag von Preobraschenski, dem auch Trotzki gefolgt ist, sah also vor, durch Konzentration auf die Modernisierung der Industrie und ihre Ausrichtung auf die Binnenbedürfnisse auch Anreize für die Entwicklung der Landwirtschaft zu setzen, um insgesamt ein Wachstum zu erzielen, das die weitere sozialistische Akkumulation ermöglichen würde. Gleichzeitig sollte das Industriemonopol dazu genutzt werden, die Bildung landwirtschaftlicher Genossenschaften (Kolchosen) durch deren bevorzugten Zugang zu Produktionsvoraussetzungen und den Aufbau eines staatlichen Verteilungsmechanismus landwirtschaftlicher Güter anzureizen.
Die Parteiführung um Stalin und Bucharin folgte diesem Weg nicht, sondern setzte auf die Parallelentwicklung von privater Landwirtschaft und einem auf die Stabilisierung der bestehenden Industrien ausgerichteten ersten 5-Jahresplan 1927. Dies führte zu einer Verschärfung der Scherenkrise und einer Bedrohung der sozialen Basis der Revolution durch eine wachsende private Bauern-/Bäuerinnenschaft. Stalin war Ende der19 20er Jahre daraufhin zu einer totalen Kehrtwende gezwungen – der Zwangskollektivierung der Landwirtschaft. Statt wie Preobraschenski/Trotzki auf die langfristige Überzeugung der Bauern-/Bäuerinnenschaft und ihre organische Eingliederung in die Kollektivwirtschaft zu setzen, wurde diese gegen großen bäuerlichen Widerstand eingeführt, ohne die Vorbereitungen für dafür notwendige Planungsstrukturen und deren Zusammenwirken mit der industriellen Entwicklung getroffen zu haben. Auch wenn das Kolchosensystem letztlich bis Mitte der 1930er Jahre zum Funktionieren gebracht wurde, hatte dies Tausende von Opfern gefordert und war von vornherein mit starken Effektivitätsproblemen konfrontiert.
In der Dependenztheorie, z. B. bei Frank oder Amin, finden wir einen Anklang an das Stalin’sche Modell des „Sozialismus in einem Land“, indem sie als Antwort auf ungleichen Tausch und monopolistische Surplusabschöpfung eine Wirtschaftspolitik der Autarkie vorschlagen, die einzig eine nachholende Entwicklung ermöglichen würde. Die Sowjetunion war durch die historischen Umstände zunächst auf eben eine solche Autarkie (Zusammenbruch des Außenhandels bis Mitte der 1920er Jahre) zurückgeworfen – und selbst unter den günstigen Bedingungen eines sehr großen, bevölkerungsreichen Landes mit vielen natürlichen und kulturellen Ressourcen erwies sich die autarke nachholende Entwicklung als Utopie. Die HauptträgerInnen der Umwälzungen auf dem Land werden in vielen Fällen wie in der Sowjetunion nicht von vornherein für kollektive landwirtschaftliche Bewirtschaftung zu gewinnen sein. Auch wenn es durch die größeren Agrarbetriebe heute mehr Möglichkeiten für von Beginn an verstaatliche Landwirtschaft gibt, wird insbesondere die Versorgungssicherheit bei Rückfall auf Autarkie wesentlich durch einen Agrarmarkt von KleinproduzentInnen gesichert werden müssen. Dies zu überwinden bedarf es wie gesehen einer Industrie, die durch die Herauslösung aus dem Weltmarkt zunächst überhaupt nicht dafür geeignet ist.
Hier kommt ein zweiter, noch wesentlicherer Faktor dazu: Selbst die Sowjetunion erwies sich letztlich nicht als unabhängig vom Weltmarkt, die Autarkie war auch in Bezug auf die industrielle Entwicklung eine reaktionäre Utopie. So stellte Trotzki 1928 fest [lxxxiii], dass die industrielle Basis der russischen Industrie auch damals noch zu zwei Dritteln aus Produktionsmitteln bestand, die so nur das kapitalistische Ausland produzieren konnte. Aufgrund des nicht so schnell gelingenden eigenen Ersatzes war es unumgänglich, dass ab Mitte der 1920er Jahre nicht nur der Import von Produktionsmittelgütern zu Weltmarktpreisen immer mehr anstieg – sondern dies wurde sogar zu einem lebenswichtigen Element der industriellen Entwicklung. „Nichts versetzt der Theorie eines isolierten ‚vollständigen Sozialismus‘ einen so tödlichen Schlag wie die einfache Tatsache, dass unsere Außenhandelszahlen in den letzten Jahren zu den Eckpfeilern unserer Wirtschaftspläne geworden sind. Die ‚Schwachstelle‘ unserer Wirtschaft, einschließlich unserer Industrie, ist der Import, der vollständig vom Export abhängt“ [lxxxiv]. D. h., selbst unter den für eine nachholende Entwicklung günstigen Bedingungen eines staatlichen Außenhandelsmonopols ändert sich nichts an der Sprengwirkung von Weltmarktpreisen: Die Sowjetunion musste teure, lebenswichtige Industriegüter auf dem Weltmarkt erwerben, und dafür zu ungünstigen Preisen eigentlich dringend benötigte, niedriger wertige Produkte vor allem aus dem Agrarbereich exportieren. Das Außenhandelsmonopol schützte zwar die eigene Industrie im Binnenmarkt vor ausländischer Konkurrenz, soweit Import nicht notwendig war – auf Kosten des einheimischen Konsums. Gleichzeitig befestigte es damit aber auch ein Preissystem im Inneren, das den Produktivitätsstandards des Weltmarktes nicht entsprach (damit notwendig Schattenwirtschaft, doppelte Preise etc. hervorbrachte). „Unser Außenhandelsmonopol ist selbst das beste Zeugnis der Schwere und Gefährlichkeit unserer Abhängigkeit. Die entscheidende Bedeutung des Monopols für unseren sozialistischen Aufbau entspringt gerade diesem für uns ungünstigen Kräfteverhältnis. Doch wir dürfen keinen Augenblick vergessen, dass das Außenhandelsmonopol unsere Abhängigkeit vom Weltmarkt nur regelt, aber nicht abschafft“ [lxxxv].
Autarkie samt Importsubstitution, ursprüngliche sozialistische Akkumulation samt Kollektivierung der Landwirtschaft, Regulierung der Weltmarktabhängigkeit durch das Außenhandelsmonopol – all das können nur Übergangsformen, nicht das Gerüst einer Etappe des Aufbaus in einem Land sein, in dieser grundlegenden Verschiebung des Kräfteverhältnisses zwischen ArbeiterInnenstaaten und kapitalistischem Weltmarkt. Diese Verschiebung kann es einerseits nur durch eine den Kapitalismus überholende Produktivitätsentwicklung geben, andererseits vor allem aber in der Ausweitung der revolutionären Umwälzung auf immer mehr Länder, so dass dem kapitalistischen Weltmarkt eine international geplante, den ungleichen Tausch überwindende, nachkapitalistische Weltökonomie entgegengestellt werden kann. Die wirtschaftlichen Zusammenschlüsse der degenerierten ArbeiterInnenstaaten, wie der Comecon/RGW, waren dagegen weder ökonomisch konkurrenzfähig noch in der Lage, einen internationalen Zusammenhang herzustellen, der auch nur ansatzweise die Vernetzungsqualitäten des kapitalistischen Weltmarktes gehabt hätte. Mangel an Demokratie, bürokratische Schwerfälligkeit und nationalistische Engstirnigkeit hemmten die Produktivkraftentwicklung weit mehr, als sie durch kollektive Eigentumsformen, Planwirtschaft und Außenhandelsmonopol gefördert werden konnten. Spätestens seit den 1970er Jahren war der technologische Rückstand so groß, dass die Finanzierung der notwendigen Importe durch immer größere Anstrengungen, Verschuldung und Inflation erkauft werden musste – was letztlich zum ökonomischen und politischen Kollaps führte.
Ungleichzeitige und kombinierte Entwicklung und revolutionäre Strategie
Die hier entwickelte Dominanz des Weltmarktes, sowohl was die Halbkolonien betrifft als auch selbst die ersten ArbeiterInnenstaaten, ist Ausdruck der Totalität des Kapitalismus als Weltsystem. Das Kapital mag die nationale Zirkulationssphäre als seine ursprüngliche Operationsbasis betrachten – es bleibt doch seinem Wesen als Akkumulationsmaschine gemäß schrankenlos, d. h. gleichzeitig auf die Überwindung auch aller nationaler Schranken ausgerichtet. Spätestens mit der imperialistischen Epoche, der Vorherrschaft von „Monopolkapital“ und Kapitalexport, ist das globale kapitalistische System eine Totalität – es bestimmt alle seine Teile, seien diese auch noch so wenig „entwickelt“. In jedem Land wirken Weltmarkt und seine kapitalistischen Subsysteme vor Ort als die beherrschenden und seine Entwicklungsweise bestimmenden ökonomischen Faktoren. Jede Etappentheorie, die für ein Land noch etwa eine „anti-feudale“ Umwälzung als „nächsten Entwicklungsschritt“ oder ähnliches vorsieht, hat sich erübrigt – alle Bewegungen von Unterdrückten müssen allenthalben mit dem Kapital, sei es in seinen nationalen oder internationalen Repräsentanten, als ihrem Hauptgegner rechnen.
Die Auswirkung dieser globalen Totalität auf jedes einzelne, insbesondere (halb-)koloniale, Land im gegenwärtigen Kapitalismus hat Trotzki im Gesetz von der „ungleichzeitigen und kombinierten Entwicklung“ ausgesprochen[lxxxvi]. Die Stalin’sche wie auch die Dependenztheorie gehen dagegen von einer Verkürzung der Lenin’schen Imperialismustheorie zu einer Tendenz zur „ungleichzeitigen Entwicklung“ aus: Danach gab es zwar im Kapitalismus immer schon unterschiedliche Entwicklungsniveaus, die von den nachholenden Kapitalen nur schwer überwindbar waren (z. B. Deutschland und Japan, die mit besonderen Mitteln den Rückstand zu Britannien und Frankreich aufholen mussten), doch mit der imperialistischen Epoche ist es für Länder mit nachholender Entwicklung so gut wie unmöglich, in den Kreis der etablierten imperialistischen Ökonomien aufzusteigen. Oder wie es das Komintern-Programm von 1928 auf den Punkt brachte: „Die Ungleichmäßigkeit der politischen und ökonomischen Entwicklung ist ein unbedingtes Gesetz der kapitalistischen Entwicklung. Das Zeitalter des Imperialismus steigert und verschärft diese Ungleichmäßigkeit noch mehr“ [lxxxvii].
Wie Trotzki bemerkt, wird hier nur eine Seite des Kapitalismus und der Expansion des Kapitals beleuchtet, die eigentlich auch für die meisten anderen Produktionsweisen zutrifft. Dem Kapital ist aber auch die gegenteilige Tendenz zur Überwindung von Schranken und Ungleichzeitigkeiten eigen, wie es sich auch im nationalen Maßstab in der Ausgleichung der Profitrate zeigt. Wie gesehen, setzt sich der Ausgleich der Profitrate zwar nicht ungebremst auf dem Weltmarkt fort – trotzdem wird die Wertbildung im nationalen Rahmen in jedem Land dominiert von den Weltmarktbranchen, ganz egal, ob dies über Direktinvestitionen, Export-/Import-Industrien, Agroindustrien, Kredit- und Finanzkapital etc. geschieht. Die Entwicklung der für diese Kapitalbewegungen interessanten Sektoren wird vorangetrieben, während gleichzeitig die rückständigen durch die globale Organisation von Akkumulationsbewegung und Welthandel befestigt werden zum Zwecke des Werttransfers, Erhalten des niedrigen Lohnniveaus, ungünstigen Terms of Trade für die Waren dieser Sektoren – kurz als fortgesetztes Reservoir für neokoloniale Ausbeutung. Genau dies hat Trotzki im Sinn, wenn er die beiden Seiten der fieberhaften Entwicklung einerseits und der Befestigung von Rückständigkeit andererseits in eine widersprüchliche Tendenz fasst: „Der Imperialismus hat, dank seiner allgegenwärtigen, alles durchdringenden leichtbeweglichen dampfartigen Triebkraft – dem Finanzkapital – diese beiden Tendenzen noch verstärkt. Er verbindet die einzelnen Länder und Kontinente noch viel rascher und stärker miteinander. Er bringt sie in engste lebendige Abhängigkeit und gleicht deren Wirtschaftsmethoden, gesellschaftliche Formen und Entwicklungsstufen einander an. Er erreicht das aber durch solche feindseligen Methoden, durch solche Löwensprünge und Überfälle auf zurückgebliebene Länder und Gebiete, dass die von ihm angestrebte Vereinigung und Nivellierung der Weltwirtschaft noch viel stürmischer und konvulsionsartiger gestört wird, als es in der vorangehenden Epoche der Fall war“ [lxxxviii].
Diese Charakterisierung des globalen Kapitalismus passt offensichtlich sehr viel mehr auf die Entwicklung des Neokolonialismus nach 1945 als die Theorie von der sich „beständig verschärfenden Ungleichzeitigkeit“. Stattdessen sehen wir eine rasche Entwicklung bestimmter Sektoren und Regionen wie auch schnelle Umkehr in krisenhaften Perioden; großen Bedeutungsgewinn einiger auch industrialisierter Bereiche in der Peripherie, bei gleichzeitiger Steigerung der Abhängigkeit vom Finanz- und Konzernkapital des Zentrums; eine Zunahme von abgehängten Regionen, Bevölkerungsschichten, bei gleichzeitiger enormer Ausdehnung der LohnarbeiterInnenschaft – insgesamt aber jedenfalls eine immer größere Dominanz des Weltmarktes, der internationalen Produktions- und Handelszusammenhänge und nicht zuletzt der kulturellen Globalisierung. Die Entwicklung des globalen Kapitalismus macht die Form des Nationalstaates immer obsoleter, schwächt seine sowieso schon eingeschränkte Handlungsfähigkeit und führt schon von den materiellen Grundlagen zur Politisierung von übernationalen, globalen Fragen, die nur internationale politische Kräfte lösen können. Die einzige Form der internationalen Politik, die die Bourgeoisie in unserer Epoche besitzt, ist weiterhin die Aufteilung der Welt unter konkurrierende Großmächte, die auf dem Metropolenkapital ihre Macht begründen. Der Imperialismus ist daher die reaktionäre Lösung der Bourgeoisie für die Krisenhaftigkeit des globalen kapitalistischen Systems mit seinen Charakteristiken der ungleichzeitigen und kombinierten Entwicklung und der Überholtheit des Nationalstaates.
Es ist daher klar, dass eine Perspektive der Überwindung des Kapitalismus, d. h. des Imperialismus, heute keine Revolution im nationalstaatlichen Rahmen mehr sein kann.
Eine der bedeutsamsten Auseinandersetzungen um die Oktoberrevolution ist sicherlich die Frage, ob in einem „unterentwickelten“ Land, das stark von einer „rückständigen“ Landwirtschaft und einer nur in bestimmten Zentren vorhandenen großen Industrie geprägt ist, überhaupt eine sozialistische Revolution möglich ist. Eine mechanische Anwendung der Marx’schen Formeln von der Entwicklung des Widerspruchs von Produktivkräften und Produktionsverhältnissen führte auch viele westliche „MarxistInnen“ zu der Ansicht, dass dort zunächst eine demokratische, bürgerliche Revolution nötig sei, die eine entsprechende Entwicklung von Industrie und Landwirtschaft einleiten würde, die erst die Voraussetzungen für eine sozialistische Umwälzung schüfe. Wie wir gesehen haben, ist eine solche Entwicklungsperspektive für zurückgebliebene Länder in der imperialistischen Epoche jedoch eine Illusion, sowohl was die ökonomische Entwicklung betrifft (die höchstens bestimmte Bereiche im Interesse des Weltmarkts voranbringt, aber ansonsten die Rückständigkeit sogar befördert), als auch, was die Klassenbasis betrifft. Denn einerseits ist die Bourgeoisie vollständig mit dieser abhängigen Entwicklung verbunden und fürchtet die revoltierenden Massen weitaus, mehr als sie die Abhängigkeiten von den ausländischen Investoren überwinden will. Andererseits gibt es für den überwiegenden Teil der Landbevölkerung durch „Agrarreformen“ keine Perspektive außer weiterer Verdrängung von den agrarischen Produktionsmitteln. Damit hat die Russische Revolution in ihrem schnellen Übergang von der Februar- zur Oktoberrevolution die enge Verbindung aufgezeigt, die in der imperialistischen Epoche zwischen „demokratischen Aufgaben“ in den abhängig entwickelten Ländern und der Perspektive der sozialistischen Revolution besteht. Da die Bourgeoisie wesentliche Elemente dieser Aufgaben nicht umsetzen will und kann, wird sie nicht nur das Proletariat, sondern auch große Teile der ländlichen und kleinbürgerlichen Massen zu weitergehenden Schritten vorantreiben – mit der unerbittlichen Konsequenz, dass entweder Imperialismus und eigene Bourgeoisie eine konterrevolutionäre Stabilisierung erzwingen oder die Revolution zur Enteignung der Bourgeoisie, zur sozialistischen Revolution voranschreitet.
Dies meinte Trotzki, als er den von Marx in der 1848er Revolution geprägten Begriff der „permanenten Revolution“ erst auf die Russische Revolution und dann auf die seit den 1920er Jahren in der halbkolonialen Welt beginnenden Revolutionen anwandte [lxxxix]. In seiner berühmten gleichnamigen Verteidigungsschrift von 1929 fasste Trotzki die Theorie in drei Punkte zusammen [xc]:
- Charakter der Verbindung von demokratischen und sozialistischen Umwälzungen.
- Dynamik der Klassenkämpfe nach der sozialistischen Umwälzung.
- Notwendige internationale Verknüpfung der revolutionären Erschütterungen.
Die Veränderungen der globalen Ökonomie durch die Durchsetzung des Imperialismus als Weltsystem, geprägt durch die ungleichzeitige und kombinierte Entwicklung, bestimmen auch die Frage der „Reife“ der Widersprüche des Kapitalismus als Ganzes. Dieses oder jenes Land mag in seiner Entwicklung der einzelnen Elemente zurück sein, die als Voraussetzungen einer sozialistischen Umwälzung gelten können. Doch der Weltkapitalismus hat in seiner imperialistischen Entwicklung das Stadium erreicht, in dem er als Ganzes zu einem grundlegenden Hindernis geworden ist für eine ökonomisch und ökologisch sinnvolle Entwicklung der Produktivkräfte insbesondere in den Halbkolonien. Daher ist es kein Wunder, dass die Widersprüche des Systems gerade in den kapitalistisch gesehen rückständigeren Ländern aufbrechen müssen. Zentrale Probleme der Versorgung, Bildung, Gesundheit, Sicherung der Lebensverhältnisse in Stadt und Land können auf der Grundlage der abhängig entwickelten Länder nur zu oft nicht auf „demokratische“ Weise gelöst werden – die nicht gelösten demokratischen Fragen verbinden sich notwendigerweise mit sozialen Explosionen. Je mehr Forderungen der Massen nach sozialen Veränderungen zur Umsetzung drängen, desto sicherer erfolgen die Reaktionen der imperialistischen Agenturen und der antidemokratischen Repression. Daher ist die alte „Entwicklungstheorie“ einer langen Phase der demokratischen und sozialen Umgestaltung der Gesellschaft als Voraussetzung für den Sozialismus unmöglich geworden. Grundlegende Kämpfe um soziale und demokratische Rechte setzen in zugespitzten Situationen in den Halbkolonien immer die Frage Sozialismus oder Konterrevolution auf die Tagesordnung. Auch in China und Kuba erwiesen sich die Pläne für eine länger dauernde Phase der „neuen Demokratie“ [xci] in Koexistenz mit „nationaler Bourgeoisie“ und westlichem Imperialismus als Illusion – vor die Wahl gestellt, entschieden sich die stalinistischen Führungen dann sehr schnell für ihre Variante der „Diktatur des Proletariats“.
Der objektiven Dynamik der Verbindung der Fragen von demokratischer und sozialistischer Revolution entspricht aber auch die Richtung der Klassenkämpfe. Die Bourgeoisie hat nicht nur in den Metropolen ihre „revolutionäre Rolle“ verloren (wie dies Marx schon 1848 festgestellt hat). Auch in den Halbkolonien brauchte es nicht erst die Analysen von André Gunder Frank, um festzustellen, dass es keinen Teil der Bourgeoisie gibt, der dort noch eine fortschrittliche, anti-(neo-)koloniale Rolle spielt (also auch keine „nationale“ im Vergleich zur „Kompradoren“-Bourgeoisie). Die Bourgeoisie der Halbkolonien, selbst von Monopolisierungen der wichtigen Wirtschaftsbereiche geprägt, ist aufs Engste in die Hierarchie des weltweiten Monopolkapitals eingebunden. Daher stehen die halbkolonialen Volksmassen, die ArbeiterInnen, kleinen Bauern und Bäuerinnen, Landlose, städtische Arme, KleinbürgerInnen des informellen Sektors etc. in ihren Kämpfen letztlich gegen den Verband der Herrschenden im In- und Ausland: die große und mittlere Bourgeoisie, die großen GrundbesitzerInnen, die VertreterInnen der internationalen Konzerne und ihre Agenturen in den Metropolen. Angesichts des weiterhin großen Anteils der Landbevölkerung in vielen Halbkolonien spielt auch die Rebellion der ländlichen Armut und ihre berechtigten Forderungen nach Landaufteilung in den Klassenkämpfen eine große Rolle. Als Marx erkannte, dass in der 1848er Revolution die Bourgeoisie nicht mehr in der Lage war, der ländlichen Rebellion eine soziale Perspektive zu geben, sah er voraus, dass damit auch die Agrarrevolution eine neue Dynamik erhalten würde: Von einer „demokratischen“ Frage, die natürlicherweise die Bauern-/Bäuerinnenschaft in den Windschatten einer bürgerlichen Revolution führt, zu einer, die nur eine proletarische Revolution lösen kann: „Die ganze Sache in Deutschland wird abhängen von der Möglichkeit, der proletarischen Revolution durch eine Art zweiter Auflage des Bauernkrieges Deckung zu geben.“ [xcii]
Weiterhin sind die armen Volksmassen auf dem Land in den Halbkolonien viel zu aufgefächert in ihren sozialen Lagen und Interessen, als dass sie eine einheitliche, für die gesamte Gesellschaft weisende Entwicklungsperspektive hervorbringen könnten. Notwendigerweise müssen sie sich objektiv mit einer der beiden Hauptklassen verbinden, um ihren Interessen zum Durchbruch zu verhelfen. In der imperialistischen Epoche geraten ihre revolutionären Bewegungen dabei aber notwendiger Weise in scharfen Widerspruch mit der Bourgeoisie, so dass sie offen für das Bündnis mit revolutionären Bestrebungen der ArbeiterInnenklasse werden. Lenin und Trotzki erkannten daher sehr richtig, dass nach der Februarrevolution die russische Auflage des Bauern-/Bäuerinnenkriegs zur hervorragenden Deckung der proletarischen Revolution werden konnte – dass daher das Aufgreifen der Landfrage, wie Marx es nach 1848 und später in den Sassulitsch-Briefen angedeutet hatte, zur Grundlage einer proletarischen Diktatur werden kann, die sich auf das Bündnis mit der Bauern-/Bäuerinnenschaft stützt.
Wesentlich bleibt hier die Erkenntnis Trotzkis (der zweite seiner Punkte), dass auch dieses Bündnis keine lange Etappe einer „Diktatur der Arbeiter und Bauern/Bäuerinnen“ ist. Die sozialistische Revolution mag vor allem durch die Aufstände am Land sich siegreich durchsetzen. Entscheidend für ihre Befestigung und Etablierung ist jedoch die Umsetzung eines Programms der proletarischen Diktatur, d. h. der Umsetzung von Vergesellschaftung der ökonomischen Schlüsselbereiche, der Kontrolle über den Außenhandel und des Beginns eines langfristigen sozialistischen Umbauprojektes. Dies muss notwendigerweise zu Konflikten mit den kleinbürgerlichen Bestrebungen auf dem Land führen, zu einem Klassenkampf zur Vergesellschaftung auch der landwirtschaftlichen Produktion (z. B. über den beschriebenen Prozess des Genossenschaftswesens). Jegliche Verwischung der Klassenfrage, z. B. durch Bildung populistischer Arbeiter-/Bauern-/Bäuerinnen-Parteien [xciii], angeblich sozialistischer Umgestaltungen durch „linke“ Bauern-/Bäuerinnenparteien oder eben die Konstruktion einer Etappe der „demokratischen Diktatur der Arbeiter und Bauern/Bäuerinnen“, wie er für eine bestimmte Phase des Stalinismus typisch war, führen damit grundlegend in die Irre. Ganz zu schweigen natürlich von der maoistischen Verirrung des Bündnisses der „vier revolutionären Klassen“ (Proletariat, Kleinbürgertum, Halbproletariat und (!) nationale Bourgeoisie). Letztlich erwiesen sich die stalinistischen FreundInnen des Bauern-/Bäuerinnentums in den zugespitzten ökonomischen Krisen, die sie mit ihrer Agrarpolitik auslösten, als ihre SchlächterInnen, unfähig die Bauern-/Bäuerinnenschaft wirklich für eine sozialistische Umgestaltung der Verhältnisse auf dem Land zu gewinnen.
Heute ist es keine Frage mehr, dass in den Globalisierungswellen des Kapitals seit dem 2. Weltkrieg das Lohnarbeitsverhältnis zur vorherrschenden Form der Arbeitsorganisation weltweit geworden und damit auch das Weltproletariat enorm gewachsen ist. Die dargestellte Ausweitung des Welthandels, die Ausdehnung der multinationalen Kapitale und die Schaffung tief gestaffelter internationaler Produktionsketten haben eine Unzahl „chinesischer Mauern“ zwischen Kapital und Arbeit niedergerissen, haben nationale Grenzen immer mehr zu einem Anachronismus gemacht. Trotzdem brauchen die bürgerlichen Klassen zur Herstellung ihrer politischen und ideologischen Hegemonie weiterhin vor allem den Nationalstaat und die nationalistische Aufspaltung der Welt. Kleinbürgertum, lohnabhängige Mittelschichten und die mit ihnen verbundenen Teile von ArbeiterInnenbürokratie und ArbeiterInnenaristokratie krallen sich ebenso an der nationalstaatlichen Absicherung ihrer besonderen „Vorrechte“ fest. Es ist im Wesentlichen die WeltarbeiterInnenklasse, die objektiv als dem Weltkapital gegenüberstehende Kraft ein fundamentales Interesse an der Überwindung des Nationalstaates, seinen krisenhaften Erscheinungen in der imperialistischen Epoche und an einem international vereinigten Kampf gegen das global agierende Kapital hegt. Dies ist die Grundlage des dritten Merkmals der permanenten Revolution – ihr notwendig internationalistischer Charakter: „Der internationale Charakter der sozialistischen Revolution … ergibt sich aus dem heutigen Zustand der Ökonomik und der sozialen Struktur der Menschheit. Der Internationalismus ist kein abstraktes Prinzip, sondern ein theoretisches und politisches Abbild des Charakters der Weltwirtschaft, der Weltentwicklung der Produktivkräfte und des Weltmaßstabes des Klassenkampfes. … Die Aufrechterhaltung der proletarischen Revolution in nationalem Rahmen kann nur ein provisorischer Zustand sein… Von diesem Standpunkte aus gesehen, ist eine nationale Revolution kein in sich verankertes Ganzes: sie ist nur ein Glied einer internationalen Kette. Die internationale Revolution stellt einen permanenten Prozeß dar … “ [xciv].
In allen Krisen und tiefgreifenden Erschütterungen in der neokolonialen Welt hat sich diese Verkettung revolutionärer Prozesse, von der Trotzki hier spricht, bestätigt. Zuletzt zeigte sich dies, als sich mit den Nachwirkungen der großen Weltrezession 2009 die Versorgungslage in vielen arabischen Halbkolonien verschärfte und die folgenden Proteste zu einer verallgemeinerten Revolte gegen jahrzehntelange Unterdrückungsregime fortschritten. Der „Arabische Frühling“ erfasste von Tunesien ausgehend ein arabisches Land nach dem anderen und eröffnete eine erste Phase demokratischer Revolutionen. Ohne eine politische Führung, die diese Eröffnung nutzen konnte, die demokratische Umwälzung zu einer sozialen Umwälzung fortzutreiben, mündete der Prozess notwendigerweise in einer blutigen Konterrevolution, in Bürgerkriegen wie in Libyen oder Syrien, letztlich in der Restauration repressiver proimperialistischer Regime. Ebenso führte die „Schwellenländerkrise“ in Gefolge der langen Stagnation nach 2009 am Ende des Jahrzehnts zu einer untragbaren sozialen Situation in Lateinamerika, die 2019 zu einem Proteststurm führte, der ebenso ein Land nach dem anderen erfasste. In der gegenwärtigen Periode des globalisierten Kapitalismus sind diese internationalen Kettenreaktionen unvermeidlich. Ebenso stellt es sich immer mehr als zentrales Problem der Massenproteste heraus, dass es nicht gelingt, darauf auch eine internationale Antwort zu geben, eine internationale Koordination der Kämpfe zu bilden, die das Problem an der imperialistischen Wurzel packt.
Die gegenwärtige Krise, die mit der Unfähigkeit des Weltkapitalismus im Umgang mit der Corona-Pandemie beginnt und sich zu einem der schwersten Weltwirtschaftseinbrüche in der Geschichte des Kapitalismus entwickelt, wird die Frage der internationalen Antwort auf die Krise auf eine neue Qualität heben. Insbesondere die neokoloniale Welt, die sowohl durch die ungenügenden Gesundheitssysteme als auch durch den massiven Kapitalabfluss im Gefolge der imperialistischen Krisenpolitik schwer gebeutelt ist, wird wiederum im Zentrum von verzweifelten Massenrevolten stehen. Die Frage der permanenten Revolution wird sich in einem nie gekannten globalen Ausmaß stellen. Der Aufbau einer proletarischen Internationale, die gegenüber dem versagenden Weltkapitalismus die Kämpfe der ArbeiterInnen und der verzweifelten Massen länderübergreifend vereint, ist mehr denn je das Gebot der Stunde!
Endnoten
[i] „Die Tendenz, den Weltmarkt zu schaffen, ist unmittelbar im Begriff des Kapitals selbst gegeben.“ MEW 42 („Grundrisse“), Berlin/O. 1983, S. 321.
[ii] In Portugal war schon früh der Begriff „Imperio“ für die „überseeischen“ Besitzungen im Gebrauch, auch wenn dies mehr einen mittelalterlich-religiösen Hintergrund hatte. Tatsächlich wurden ab dem 17. Jahrhundert die meisten Kolonialunternehmungen Besitz privater Handels- und Aktiengesellschaften. Erst im 19. Jahrhundert wurde der Imperiumsbegriff wieder modern. Auch der britische „Empire“-Begriff hatte jedoch starke religiöse Bezüge und wurde mit Bibelzitaten hinterlegt, die angeblich die Herrschaft über alle Weltmeere für ein christliches Imperium voraussagen. Zur christlichen Mythologie kam aber im 19. Jahrhundert eine immer ausgeprägtere rassistische Komponente.
[iii] Anders als in den USA waren die Unabhängigkeitsbewegungen in Lateinamerika erst durch die Schwächung Spaniens durch die napoleonischen Kriege erfolgversprechend, brauchten aber auch dann noch mehrere Anläufe, bis in den 1820er Jahren eine Reihe schwacher und rivalisierender Republiken entstand – entgegen dem Traum Simon Bolivars von einer geeinten lateinamerikanischen Republik. Mit der französischen Revolution gelang auch erstmals eine erfolgreiche SklavenarbeiterInnenrevolution, die letztlich zur Unabhängigkeit Haitis von Frankreich führte. Die restliche Karibik blieb bis ins 20. Jahrhundert Kolonialgebiet – auch Kuba, als letzte wichtige spanische Kolonie.
[iv] Das Propagieren des „Freihandels“, des Abbaus von Handelsschranken und Zöllen und die „Öffnung“ von Märkten als Ablösung des Merkantilismus war die theoretisch vorherrschende Richtung der politischen Ökonomie in Großbritannien seit Mitte des 19. Jahrhunderts. Die Vorstellung, dass ohne staatliche Regulierung global frei agierendes Kapital überall zu Wohlstand und Demokratie führen würden, wurde jedoch schnell selbst zum Vorwand politisch-militärischer Intervention.
[v] E. Hobsbawm, Das Zeitalter der Extreme, München, 1998, S. 253
[vi] Zitiert nach: Der Spiegel, „Der heiße Ziegelstein“, 3.8.1960 (zum Dekolonisationsprozess von Belgisch-Kongo). Auch lesenswert, um den zu dieser Zeit noch sehr offenen Rassismus auch solcher Blätter wie „Der Spiegel“ gegenüber „den Negern“ zu bemerken.
[vii] Siehe ausführlich: W. Reinhard, Die Unterwerfung der Welt, Kapitel „Ein Dekolonisationsprogramm, die USA und der Nahe Osten“, S. 1121ff., München 2016
[viii] Raúl Prebisch war 1948 einer der Begründer der CEPAL, der Wirtschaftskommission der UNO für Lateinamerika und die Karibik, und lange ihr Generalsekretär. In den 1930er Jahren war er Zentralbankchef Argentiniens gewesen. Hans Singer war Leiter der Entwicklungsabteilung im UN-Sekretariat, verantwortlich für den Aufbau von Entwicklungsbanken z. B. für Afrika und für Beschäftigungsprogramme der ILO.
[ix] José Antonio Ocampo/Mariangelica Parra, The continuing Relevance of the Terms of Trade and Industrialization Debate, in: Vernengo and Perez-Caldentey (eds), Ideas, Policies and Economic Development in the Americas, Routledge Studies in Development Economics, Routledge, 2007.
[x] Das Magazin „Monthly Review“ besteht seit 1949 als Sammelpunkt marxistischer Theorieproduktion in den USA. Zu seinen prägenden Gründungspersönlichkeiten zählten Paul M. Sweezy und Leo Huberman. Im gleichen Jahr stieß Paul A. Baran hinzu, später u. a. Harry Magdoff. Seit dessen Tod 2006 ist John Bellamy Foster der alleinige Herausgeber.
[xi] In der deutschen Übersetzung unter diesem Titel erschien es 1968 bei EVA, Frankfurt.
[xii] Ebd., S. 12
[xiii] Ebd., S. 14. Frank blieb intellektueller Begleiter verschiedener linker Bewegungen in Lateinamerika, musste mehrfach ins Exil gehen. Er war bei ImperialistInnen wie StalinistInnen gleichermaßen unbeliebt und mit diversen Lehr- und Einreiseverboten belegt. Nach dem Militärputsch in Chile fand er untergeordnete akademische Posten in Westdeutschland und den Niederlanden.
[xiv] Franks Aufsatz hier bezieht sich speziell auf Chile (seiner damaligen Wirkungsstätte), das hier aber nur exemplarisch genannt ist.
[xv] Ebd., S. 25f.
[xvi] P. Baran, On the political Economy of Backwardness, Manchester, 1952
[xvii] Im Original als „Monopoly Capital (For Che Guevara)“ 1966 bei Monthly Review Press erschienen, auf Deutsch 1967 bei Suhrkamp.
[xviii] Rudi Dutschke bezeichnete es in seinem 1966 erschienenen Aufsatz „Zur Literatur des revolutionären Sozialismus von Karl Marx bis in die Gegenwart“ als den „unserer Meinung nach bedeutendsten theoretischen politökonomischen Beitrag seit dem Ende des zweiten Weltkriegs“ (SDS-Korrespondenz Jg. 1, Sondernummer, Frankfurt a. M., 1966, S. 22).
[xix] Baran/Sweezy, a. a. O., S. 15
[xx] Frank, a. a. O., S. 25.
[xxi] Paul Mattick war ein deutscher Rätekommunist, der seit 1926 in den USA lebte und seit den 1930er Jahren grundlegende politökonomische Analysen mit starken Rückbezügen auf das Werk von Marx und in Abgrenzung zur „offiziellen“ Marx-Lektüre erarbeitete. Er trug wesentlich zur Verbreitung der Präzisierung der Marx’schen Krisentheorie durch Henryk Grossmann und zusammen mit Roman Rosdolsky („Zur Entstehungsgeschichte des Marxschen <<Kapital>>“, 1967) zur Rückbesinnung auf eine werttheoretisch begründete Kapitalismuskritik bei.
[xxii] Hier zitiert nach „Monopolkapital. Thesen zu dem Buch von Paul A. Baran und Paul M. Sweezy“, Hrsg. von Federico Hermanin, Karin Monte und Claus Rolshausen, EVA, Frankfurt/Main, 1969, S. 31 – 59.
[xxiii] Marx, „Das Kapital“, Band 3, MEW 25, Berlin/O. 1969, S. 886f.: „Es ist nach der bisher gegebenen Entwicklung überflüssig, von neuem nachzuweisen, wie das Verhältnis von Kapital und Lohnarbeit den ganzen Charakter der Produktionsweise bestimmt.“
[xxiv] Mattick, a. a. O., S. 32.
[xxv] Siehe auch: Marx, „Das Kapital“, Band 3, Kapitel 50, „Der Schein der Konkurrenz“: „Findet endlich die Ausgleichung des Mehrwerts zur Durchschnittsprofitrate ein Hindernis an … Monopolen …, so daß ein Monopolpreis möglich würde, der über den Produktionspreis und über den Wert der Waren stiege, auf die das Monopol wirkt, so würden die durch den Wert der Waren gegebnen Grenzen dadurch nicht aufgehoben. Der Monopolpreis gewisser Waren würde nur einen Teil des Profits der andern Warenproduzenten auf die Waren mit dem Monopolpreis übertragen. Es fände indirekt eine örtliche Störung in der Verteilung des Mehrwerts unter die verschiedenen Produktionssphären statt, die aber die Grenze dieses Mehrwerts unverändert ließe.“ (a. a. O., S. 868f.)
[xxvi] Marx, ebd., S. 230.
[xxvii] Mattick, a. a. O., S. 58
[xxviii] Ebd., S. 45
[xxix] Ebd.
[xxx] A. Marquetti, Extended Penn World Tables (EPWT), https://sites.google.com/a/newschool.edu/duncan-foley-homepage/home/EPWT
[xxxi] Michael Roberts, Towards a World Rate of Profit – again, 2017, https://thenextrecession.wordpress.com/2017/09/09/towards-a-world-rate-of-profit-again/
[xxxii] Aus: T. Piketty, Das Kapital im 21. Jahrhundert, München 2014, S. 218
[xxxiii] CreditSwiss, Zürich, 2010-2019, https://www.credit-suisse.com/about-us/en/reports-research/global-wealth-report.html
[xxxiv] Credit Swiss, Global Wealth Report 2012, S.11, Figure 3
[xxxv] EPWT, Spalten J und K – in KKP von 2005
[xxxvi] Ebd.
[xxxvii] Die FLN-Revolutionsregierung hatte in den Friedensabkommen mit Frankreich Erdöl und Gas in der Sahara weiterhin in französischem Besitz belassen, anscheinend weil sie meinte, die garantierten Zahlungen aus den Einkünften der 4 französischen Konzerne für ihre Zwecke zu gebrauchen. 1971 wurde gegen den Widerstand der französischen Regierung ein Aufkauf von 51 % des Gesellschaftseinkommens durchgesetzt. Der Beitrag Algeriens zur Preispolitik der OPEC war in Folge entscheidend für den „Ölpreisschock“ 1973 und die danach ausgelöste Weltwirtschaftsrezession 1974.
[xxxviii] Aus den EPWT
[xxxix] Siehe z. B. WTO u. a., Global Value Chain Report 2017, Measuring and Analyzing the Impact of GVCs on Economic Development
[xl] Ebd., S. 55.
[xli] Ebd., S. 51
[xlii] Ebd., The middle-income trap and upgrading along global value chains, S. 119 – 134
[xliii] Aus den EPWT, Spalte J.
[xliv] Aus: T. Piketty, Das Kapital im 21. Jahrhundert, a. a. O., S. 92
[xlv] World Bank Data Team, New Country Classifications by Income Level, 2019, https://blogs.worldbank.org/opendata/new-country-classifications-income-level-2019-2020
[xlvi] EPWT, Spalte T,
[xlvii] Themistoklis Kalogerakos, Financialization, the Great Recession and the Rate of Profit: profitability trends in the US corporate business sector, 1946 – 2011, Lund 2013
[xlviii] Ebd., S. 28
[xlix] D. Zachariah, Determinants of the average profit rate and the trajectory of capitalist economies. Presented at the conference on Probabilistic Political Economy, Kingston University, July 2008. Published in Bulletin of Political Economy, Vol.3, No.1, New Dehli, 2009
[l] Ebd., S. 10
[li] Berechnungen basierend auf BIP, GNI in current US Dollar; Daten aus: Weltbank, World Development Indicators, https://databank.worldbank.org/data/download/WDI_excel.zip
[lii] Aus: United Nations Conference on Trade and Development, World Investment Report 2019, S. 12. Hier sind „Remittances“ die Transferzahlungen von MigrantInnen. Unter „other investments“ zählen z. B. Kredite oder Derivate.
[liii] EUROSTAT 2017, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/World_direct_investment_patterns
[liv] UNCTAD, World Investment Report 2019, S.2015
[lv] Tatsächlich wurde Emmanuels Theorie erst durch sein 1969 veröffentlichtes Buch „L’échange inégal: Essais sur les antagonismes dans les rapports économiques internationaux“, Paris (François Maspero), bekannt, das durch spätere Übersetzungen erst in den 1970er Jahren international zugänglich war. Erstmals vertreten hat Emmanuel die Theorie aber bereits in Vorlesungen in Paris Anfang der 1960er Jahre
[lvi] Die Darstellung und Kritik der Theorie stützt sich wesentlich auf: M. C. Howard/J. E. King, A History of Marxist Economy, London 1992, Band 2, Kapitel 10 „Unequal Exchange“, S. 186 – 204.
[lvii] Berechnung aufgrund der EPWT als Verhältnis von BIP zu Lohnsumme in KKP von 2005.
[lviii] J.-O. Anderson, Studies in the Theory of Unequal Exchange, Åbo (Turku), 1976; ausgeführt in Howard/King a. a. O., S. 195f., wo auch ein ausführliches Modellbeispiel gemäß Andersons Reformulierung der Theorie gerechnet wird.
[lix] Samir Amin, Unequal Development: An Essay on the Social Formations of Peripheral Capitalism, New York 1976 (Monthly Review Press), S. 143f.
[lx] Deutsche Bank, Jahresausblick 2017, interne Quellen und die Penn World Tables 2016: https://www.deutsche-bank.de/pfb/content/jahresausblick-2017_die-weltwirtschaft-im-zeichen-der-usa.html
[lxi] Das Programm wird heute unter Federführung der Weltbank durchgeführt und veröffentlicht seine Langfriststudien z. B. unter: https://www.worldbank.org/en/programs/icp. Die Daten, die im Folgenden verwendet wurden, stammen aus dem Download „ICP 2011 results Excel data file“.
[lxii] Berechnung aus dem ICP data report 2011
[lxiii] Ebd.
[lxiv] Siehe zusammenfassend: Karl Marx, Zur Kritik der politischen Ökonomie, Vorwort, MEW 13, Berlin/O. 1974, S. 7ff.
[lxv] Siehe z. B.: R. Guha, Dominance without Hegemony: History and Power in Colonial India, Dehli, 1983. D. Chakrabarty, Provincializing Europe, Princeton, 2000.
[lxvi] Zur Kritik an der „postkolonialen Theorie“ siehe vor allem: V. Chibber, Postkoloniale Theorie und das Gespenst des Kapitals, Berlin 2018.
[lxvii] In: Kapitalismus und Unterentwicklung in Lateinamerika, Frankfurt a. M. 1968 (EVA), S. 220 – 276
[lxviii] Siehe vor allem: Immanuel Wallerstein, Das moderne Weltsystem, 4 Bände, 2004, 2012, 2004, 2012, Wien (Promedia). Eine kurze zusammenfassende Darstellung: I. Wallerstein, Welt-System-Analyse, Wiesbaden, 2019.
[lxix] I. Wallerstein, Welt-System-Analyse, a. a. O., S. 88
[lxx] R. Luxemburg, Die Akkumulation des Kapitals. Ein Beitrag zur ökonomischen Erklärung des Imperialismus, Gesammelte Werke Band 5, Berlin 1985, S. 5 – 411 (ursprünglich 1913)
[lxxi] Ebd., S. 325f., wo neben Algerien auch die Geschichte der indischen Landwirtschaft behandelt wird
[lxxii] Ebd., S. 323
[lxxiii] Wera I. Sassulitsch war eine russische Revolutionärin, die als 28-Jährige mit einem Attentat auf den Stadthauptmann von Petersburg russlandweit legendäre Bekanntheit erlangte (1878). Von den VolkstümlerInnen entwickelte sie sich im Exil zur Marxistin und wurde Mitbegründerin der ersten sozialdemokratischen Partei (1883) in Russland. Nach der ISKRA-Spaltung war sie Vertreterin der Menschewiki.
[lxxiv] Karl Marx, Entwürfe einer Antwort auf den Brief von V.I. Sassulitsch, MEW 19, Berlin/O. 1974, S. 384 – 406. Der Brief selber findet sich im selben Band, S. 242f. Ebenso in diesem Band findet sich zum selben Thema eine Antwort an die Redaktion der „Otetschestwennyje Sapiski“, einer progressiven russischen Zeitschrift, S. 107 – 112.
[lxxv] Ebd., S. 111
[lxxvi] Ebd., S. 112
[lxxvii] Ebd., S. 384
[lxxviii] Ebd., S. 385
[lxxix] FAO, The State of Food and Agriculture 2014, S.12
[lxxx] FAO, Weltagrarbericht, https://www.weltagrarbericht.de/themen-des-weltagrarberichts/baeuerliche-und-industrielle-landwirtschaft.html
[lxxxi] MEW 19, a. a. O., S. 389
[lxxxii] E. Preobraschenski, Die Neue Ökonomik, Verlag Neuer Kurs, Berlin/W. 1971 (Original 1926); eine ausführliche und lesenswerte Analyse findet sich in: M. Seelos, Revisited: Die Theorie der ursprünglichen sozialistischen Akkumulation. Oder: Welches Verhältnis kann die Planwirtschaft zu der bäuerlichen Agrarwirtschaft haben, Wien 2014.
[lxxxiii] L.Trotzki, Die Dritte Internationale nach Lenin, Der Programmentwurf der Komintern, Kapitel „Die Abhängigkeit der UdSSR von der Weltwirtschaft“, Essen 1993 (Original 1928), S. 61ff.
[lxxxiv] Ebd., S. 63f.
[lxxxv] Ebd., S. 65f.
[lxxxvi] Z. B. in: ebd., S. 35ff.
[lxxxvii] Zitiert in: ebd., S. 38
[lxxxviii] Ebd., S. 39
[lxxxix] Siehe: L. Trotzki, Ergebnisse und Perspektiven (1906); Die permanente Revolution (1928). Beides erscheinen als Reprint in einem Band bei EVA, Frankfurt a. M. 1971 (Zitate aus dieser Ausgabe).
[xc] Ebd., Permanente Revolution, S. 26ff.
[xci] So erklärte Mao 1940, dass angesichts der relativen Kleinheit des chinesischen Proletariats von der KPCh die bürgerliche Revolution fortgesetzt werden müsse, nur dass die „Demokratie“ durch die unter Führung der KP stehenden „vier revolutionären Klassen“ einen ganz anderen, progressiven Charakter bekäme. (Mao Tse-tung, Über die Neue Demokratie, Januar 1940: http://www.infopartisan.net/archive/maowerke/MaoAWII_395_449.htm) .
[xcii] Zitiert in Trotzki, Permanente Revolution, a. a. O., S. 130
[xciii] Siehe ausführlich zu diesen Revisionen: Trotzki, Dritte Internationale nach Lenin, a. a. O., Kapitel „Die reaktionäre Theorie der ‚kombinierten Arbeiter- und Bauernparteien‘ für den Orient“, S. 211ff.
[xciv] Trotzki, Permanente Revolution, a. a. O., S. 28f.