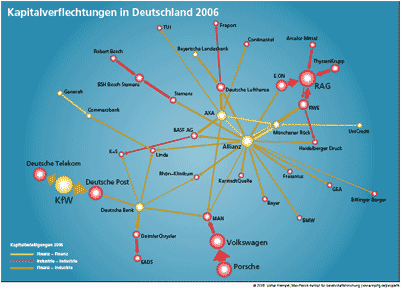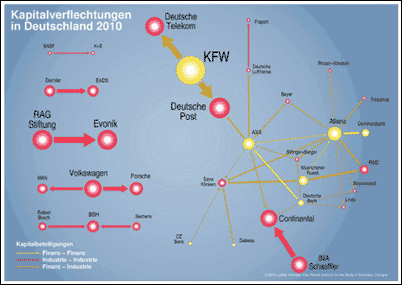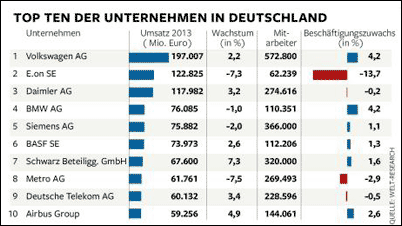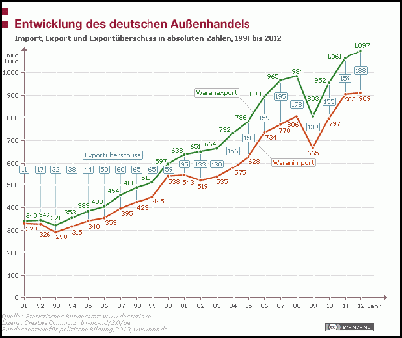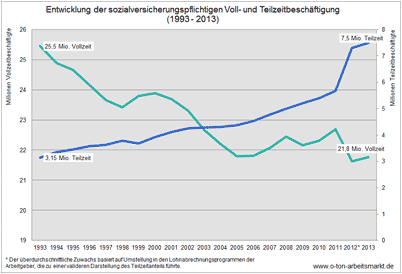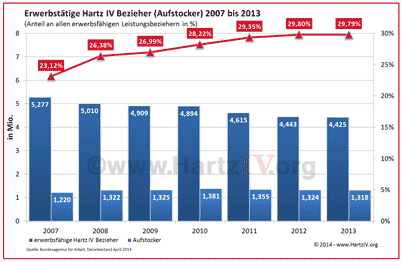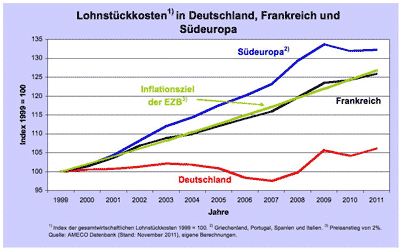Martin Suchanek, Revolutionärer Marxismus 47, September 2015
Historische Krisen verändern alles. Sie stellen alle gesellschaftlichen Verhältnisse, alle Beziehungen zwischen den verschiedenen Klassen wie die „Ordnung“ zwischen den Staaten rasch, oft bruchartig in Frage.
War die vorhergehende Periode von einem mehr oder weniger stabilen „Gleichgewicht“ geprägt, innerhalb dessen sich die sozialen und politischen Verhältnisse entwickelten, das wie eine Schranke der gesellschaftlichen Konflikte wirkte, so zeichnet eine Krisenperiode gerade aus, dass dieses Gleichgewicht nachhaltig gestört, ja zerstört ist. Erst durch eine Reihe von Klassenkämpfen und eine globale politische Neuordnung kann ein neues Gleichgewicht überhaupt re-etabliert werden.
Eine solche Krisenperiode begann 2007. Die Maßnahmen, die die herrschenden Klassen der führenden imperialistischen Staaten zur Bekämpfung der Krise durchführten, haben jedoch bislang keineswegs zur Beseitigung der Ursache der Krise – der Überakkumulation von Kapital – geführt. Im Gegenteil, das überschüssige Kapital, das sich in den Händen der großen Monopole auf dem Finanzsektor und in der Industrie der imperialistischen Staaten konzentriert, wurde auf Kosten der Gesellschaft – v.a. der ArbeiterInnenklasse, der Bauernschaft, der städtischen und ländlichen Armut, aber auch von Teilen des Kleinbürgertums und der Mittelschichten – „gerettet“.
So können zwar kurzfristig Profite gesichert und Anlagesphären für das vagabundierende Finanzkapital geschaffen werden, allerdings nur um den Preis der nächsten, größeren wirtschaftlichen Explosion, der weiteren Anhäufung der Ursachen der Krise. Denn die Vernichtung überschüssigen Kapitals, das keine produktive Verwertung mehr in der Industrie finden kann, ist unvermeidlich, um dem Fall der Profitrate in allen zentralen Wirtschaftssektoren entgegenzuwirken. Das ist letztlich nur durch einen Schock, die Zerstörung enormer Überhänge von Kapital und auch realer produktiver Kapazitäten der Gesellschaft sowie einer historischen Niederlage der ArbeiterInnenklasse und aller nicht-ausbeutenden Schichten möglich.
Imperialismus als ein globales politisches und ökonomisches System bedeutet dabei, dass zwischen den Kapitalien und auch zwischen den großen Staatenblöcken ein Kampf auf Leben und Tod entbrennt um die Frage, wer welche Kosten der Krise tragen muss, welches nationale Gesamtkapital (und das heißt v.a., welches Monopolkapital) siegt. Diese Konkurrenz wird keineswegs nur auf ökonomischer Ebene ausgetragen, ja sie muss unvermeidlich auch politisch und militärisch ausgefochten werden.
Im Rahmen des Kapitalismus kann die Krise nicht gelöst werden ohne eine Neuaufteilung der Welt unter den Großmächten. Daher ist die Formierung imperialistischer Blöcke um alte und neue Mächte (USA, China, Japan, Deutschland, Frankreich, Britannien, Russland), das Eingreifen verschiedener Mächte in alle Konflikte auf dem Globus eine notwendige politische Folgeerscheinung der gegenwärtigen Periode.
Im folgenden Artikel wollen wir uns freilich nicht mit den Ursachen der Krise, ihrer Verlaufsform und der inner-imperialistischen Konkurrenz beschäftigen. Dazu haben wir in früheren Ausgaben des „Revolutionären Marxismus“ (RM) grundlegende Artikel veröffentlicht (1). Zur Krise der Europäischen Union und zu den Ambitionen des deutschen Imperialismus findet sich ein Text in diesem RM (2).
Unser Hauptaugenmerk gilt vielmehr der ArbeiterInnenklasse, genauer ihrer politischen Umgruppierung in der gegenwärtigen Periode. Die Bedeutung des Themas lässt sich kaum zu gering veranschlagen.
In den letzten Jahren sind auf der ganzen Welt „neue“ politische Parteien, Formationen der ArbeiterInnenklasse und der Unterdrückten entstanden. Innerhalb der „radikalen“ Linken findet eine rege Diskussion statt, wie auf diese Veränderung der Klasse zu reagieren, ob und wie in diese Neuformierungen zu intervenieren sei.
Um die politischen Veränderungen der Klasse zu verstehen, reicht es freilich nicht aus, nur die ideologischen Neuformationen zu konstatieren. Der Grund für die Entstehung neuer und, bei Lichte betrachtet, oft keineswegs so „neuer“ politischer Parteien liegt auch darin, dass die Klasse selbst und ihre „tradierten“ gewerkschaftlichen und politischen Organisationen grundlegende Veränderungen durchmachen – und so überhaupt erst das Bedürfnis nach einer Neuorganisation bei größeren Teilen der Avantgarde, der politisch fortgeschrittenen Schichten der ArbeiterInnenklasse, tw. auch bei der Masse, schaffen.
A Die Krise und die Veränderungen der Klasse
Die ArbeiterInnenklasse war seit ihrer Entstehung nie eine „geschlossene“ soziale Gruppe, sondern von inneren Schichtungen und Differenzierungen gezeichnet. V.a. aber ist für den marxistischen Klassenbegriff im Unterschied zum Nominalismus der bürgerlichen Soziologie entscheidend, die „Klassenzugehörigkeit“ als ein Verhältnis zwischen Gruppen von Menschen, zwischen Klassen zu fassen, nicht als eine Ansammlung von individuellen Attributen (Berufsstand, Einkommensgröße …). Ohne Kapital keine Lohnarbeit und umgekehrt. Die Wandlung des Kapitals ist es dabei, die wesentlich die Zusammensetzung, Umwälzung, Neuzusammensetzung der Klasse bestimmt. Die gegenwärtige Krisenperiode hat daher – wenig überraschend – die ArbeiterInnenklasse weltweit grundlegend verändert.
Schon in der vorhergehende Periode, jener der „Globalisierung“, also seit dem Zusammenbruch der ehemaligen degenerierten ArbeiterInnenstaaten (3), begann das Proletariat, weltweit einen grundlegenden Wandlungsprozess durchzumachen. In mancher Hinsicht haben die Entwicklungen der letzten Jahre jene der Globalisierungsperiode noch verschärft und beschleunigt. Zugleich stehen wir jedoch auch vor neuen Tendenzen, deren volle Ausprägung wir selbst heute erst in ihrem Entstehen beobachten können. Im ersten Abschnitt des Artikels wollen wir die wichtigsten dieser Veränderungen zusammenfassen, um danach die Rückwirkung dieser Veränderungen auf die gewerkschaftlichen und politischen Organisationen der Klasse zu betrachten.
Die Verlagerung der industriellen ArbeiterInnenklasse
In den letzten zwei Jahrzehnten ist die ArbeiterInnenklasse weltweit weiter gewachsen. Allerdings haben sich mit veränderter Produktionsstruktur die Zentren der Klasse verlagert, v.a. nach Asien. Das betrifft v.a. das massive Anwachsen des Proletariats in China, aber auch in Indien und Brasilien. Die gewaltige Umwälzung und das Wachstum der ArbeiterInnenklasse in China haben heute insbesondere ökonomische Auswirkungen, als sie die Basis für die Etablierung einer neuen imperialistischen Macht und deren Expansion bieten – aber es ist auch eine neue ArbeiterInnenklasse entstanden, die sich ihrer potentiellen politischen, gesellschaftlichen Macht (trotz enormer ökonomischer Kampfaktivitäten) noch kaum bewusst ist.
Neben China ist die ArbeiterInnenklasse auch in einer Reihe von Ländern in Ostasien und in Indien gewachsen. Ebenso ist Brasilien ein Land mit einer der konzentriertesten Industriegebiete der Welt mit Millionen Lohnabhängigen. Die Erfahrungen der Tigerstaaten Asiens (Indonesien, Südkorea) infolge der Währungskrise Ende der 1990er Jahre zeigten jedoch schon damals, wie fragil der industrielle Aufschwung und die Kapitalbildung in solchen, letztlich von einer oder mehreren imperialistischen Mächten dominierten, im Weltmarkt untergeordneten Staaten sind.
So wichtig daher das Anwachsen der ArbeiterInnenklasse in Ländern wie Brasilien, Vietnam, Indonesien, Indien oder auch der Türkei ist – letztlich handelt es sich um die Formierung einer ArbeiterInnenklasse in halbkolonialen Ländern, deren Entwicklung jedoch stark vom Fluss des imperialistischen Anlagekapitals abhängt.
Auch wenn sich Russland als imperialistische Macht (4) neu etabliert hat, so entspricht der Anteil der produktiven Arbeit zahlenmäßig nur einem Bruchteil der ArbeiterInnen in der früheren Sowjetunion. Der Anteil an der Industrieproduktion ist heute gering, während die Sowjetunion noch bis zu ihrem Zusammenbruch die zweitgrößte Industrie der Welt hatte.
In den tradierten imperialistischen Zentren (Nordamerika, Westeuropa, Japan, Australien) können wir schon vor dem Zusammenbruch des Stalinismus eine Verringerung des industriellen Proletariats feststellen. Der Anteil der „Dienstleistungen“ ging generell nach oben, auch wenn die bürgerliche Statistik den Trend systematisch übertreibt, weil etliche Dienstleistungen durchaus Formen produktiver Arbeit darstellen und Mehrwert für das Kapital schaffen.
Die letzten Jahrzehnte (und besonders die Krise) haben auch hier die Unterschiede enorm vertieft. In den meisten „alten“ imperialistischen Staaten brach infolge der Krise die Industrieproduktion ein und hat seither noch immer nicht das Niveau der Phase vor 2007 erreicht. Wenn wir April 2008 als Bezugspunkt nehmen – also den Beginn der globalen – Krise, so erreichte die Industrieproduktion in Frankreich bis November 2013 nur 85 Prozent dieses Niveaus, jene Britanniens 87,3 Prozent und jene Japans 85,1 Prozent. Nur Die USA hatten zu diesem Zeitpunkt das Niveau des Jahres 2008 übertroffen – um ein Prozent. Deutschland hatte es fast erreicht und lag nur 1,3 Prozentpunkte unter dem Niveau von 2008 (5).
Die Entwicklung in den USA und Deutschland stellen jedenfalls die Ausnahmen dar. Die USA, weil sie mehr als jede andere Nation die Kosten der Krise auf den „Rest der Welt“ abwälzen konnten und weiter der größte und wichtigste Binnenmarkt der Welt sind. Deutschland, weil sein Exporterfolg auch auf der Dominanz über seine Konkurrenten in der Eurozone basiert.
Dieser „Erfolg“ geht zugleich mit einer Entwicklung einher, die wir schon seit Jahren beobachten können: Das Schrumpfen des industriellen Proletariats bis hin zur weitgehenden Deindustrialisierung ganzer Länder. In Südeuropa hat sich v.a. in Griechenland der Prozess rasant fortgesetzt. Rund ein Viertel der ArbeiterInnenklasse ist arbeitslos, mehr als die Hälfte der Jugend. Es folgt damit dem Beispiel Osteuropas, wo nach 1990 ein großer Teil der Industrie vernichtet wurde und nur einzelne Länder oder einzelne industrielle „Inseln“ als Zulieferer oder Vorproduzenten von westlichen Konzernen überleben konnten.
Die nächste potentiell dramatischere Entwicklung steht in Europa allerdings noch ins Haus – massive Angriffe auf die Industrie Spaniens, Italiens und Frankreichs, die mehr und mehr von der deutschen Konkurrenz an die Wand gedrückt werden.
Außerhalb Europas ist die Lage noch weitaus dramatischer, v.a. in Afrika. Hier sind ganze Länder praktisch de-industrialisiert oder davon bedroht. Dasselbe gilt für einige Länder der arabischen Welt.
Im Extremfall hat sich in diesen Staaten – insgesamt die am härtesten getroffenen Opfer imperialistischer Ausplünderungen oder „Neuordnungsversuche“ (siehe Irak) – die gesellschaftliche Krise vertieft und verstetigt. Es existiert kaum eine Industriearbeiterschaft, ja die Reproduktion des gesellschaftlichen Gesamtzusam-menhangs und damit selbst die eines staatlichen Gebildes und gesellschaftlicher Klassen ist in Frage gestellt. Die Gesellschaften und Staaten zerfallen – sie zeigen in extremis, was immer größeren Teilen der Menschheit bei einem Fortschreiten der Krise droht.
Anwachsen der unteren Schichten des Proletariats
Während die ArbeiterInnenklasse insgesamt in den letzten Jahrzehnten (noch) gewachsen ist, haben weltweit die Differenzierungen, die Schichtungen und Unterschiede im Proletariat weiter zugenommen.
In praktisch allen imperialistischen Ländern sind seit den 1980er Jahren immer größere Schichten der Klasse von Unterbeschäftigung, von „prekären“ Arbeitsverhältnissen, Teilzeitarbeit usw. betroffen und bilden einen wachsenden Teil der Klasse, der von „Niedriglohn“ leben muss. Damit ist nicht einfach „schlechte Bezahlung“ zu verstehen. Ein immer größerer Teil der ArbeiterInnenklasse wird gezwungen, seine Arbeitskraft unter ihren Reproduktionskosten zu verkaufen.
In den meisten imperialistischen Ländern (wie auch in den degenerierten ArbeiterInnenstaaten und selbst einigen Halb-Kolonien) hatten sich in der Nachkriegsperiode Verhältnisse etabliert, die ab den 50er, spätestens jedoch in den 60er und auch 70er Jahren (also grob gesagt bei einer ganzen Generation) den Eindruck erwecken konnten, dass die nächste Generation der ArbeiterInnenklasse materiell besser gestellt wäre als ihre Eltern.
In der Tat war es auch so. Doch dies war an historisch außergewöhnliche Bedingungen geknüpft: die Kapitalvernichtung nach dem Zweiten Weltkrieg, die Erneuerung des Produktionsapparates in zahlreichen Ländern, die Möglichkeit, „überschüssiges“ US-Kapital zum Aufbau auf der ganzen Welt zu nutzen bei gleichzeitiger Wiederbelebung und Expansion wichtiger imperialistischer Rivalen (v.a. Deutschland und Japan), die enorm gesteigerte Ausbeutungsrate der ArbeiterInnenklasse während des Kriegs in den faschistischen und demokratischen Ländern, die Etablierung einer klaren Führungsmacht unter den imperialistischen Staaten, damit des Dollar als Weltgeld und die Öffnung der Kolonialmärkte Britanniens und Frankreichs (was letztlich die Abschaffung des Kapitalismus in Osteuropa und China kompensieren konnte).
So konnten Akkumulationsbedingungen geschaffen werden, die es für mehrere Konjunkturzyklen ermöglichten, die Steigerung der Profitmasse mit einer Erhöhung des Konsums der ArbeiterInnenklasse zu kombinieren – nicht zuletzt, weil die vorherrschende Form der Erhöhung des Mehrwerts die Produktion des relativen Mehrwerts war. Das Proletariat wuchs enorm und zugleich war die Nachkriegsperiode auch von einer weit größeren Bedeutung der Konsumgüterindustrie geprägt.
Mit der „neoliberalen Wende“, den Angriffen auf die ArbeiterInnenklasse unter Reagan und Thatcher wie auch der neoliberalen Umstrukturierung in Lateinamerika änderte sich das. Der Zusammenbruch der bürokratischen Planwirtschaften der Sowjetunion und Osteuropas verschärfte das noch dramatisch, schuf eine industrielle Reservearmee – und veränderte zugleich das globale Kräfteverhältnis und stärkte für mehr als ein Jahrzehnt die hegemoniale Position der USA. Immer größere Teile der Klasse werden unter ihr Reproduktionsniveau gedrückt.
All diese Veränderungen haben dazu bezüglich der Neuzusammensetzung der Klasse zu zwei grundlegenden Erscheinungen geführt. Erstens der Entstehung eines permanenten Sockels von Langzeitarbeitslosen, die nicht mehr in den Arbeitsprozess integriert werden können. Selbst in den Perioden des Aufschwungs verschwindet er längst nicht mehr. D.h. ein beachtlicher Teil des Proletariats kann seine Arbeitskraft trotz oft drakonischer Strafmaßnahmen durch die bürgerlichen Staaten permanent nicht verkaufen, droht ins Sub- oder gar Lumpenproletariat abzusinken.
Laut ILO waren Ende 2013 199,8 Millionen Lohnabhängige arbeitslos. Die Zahl der Arbeitslosen ist damit um 30,6 Millionen größer als vor der großen Krise und wurde v.a in den „Industrieländern“, also, grob gesprochen, den imperialistischen Staaten, kaum abgebaut (6).
Zweitens hat sich in allen lang etablierten imperialistischen Ländern eine bedeutende Schicht von ArbeiterInnen gebildet, die unter ihren Reproduktionskosten entlohnt werden, „Working Poor“, Billigjobber, „Prekariat“. Diese oft weiblich, jugendlich und migrantisch geprägten Teile der ArbeiterInnenklasse machen z.B. in Deutschland mittlerweile rund ein Viertel der Lohnabhängigen aus, in vielen anderen Ländern sogar mehr.
In den Halbkolonien hat diese Entwicklung noch weit extremere Formen angenommen. In den letzten Jahrzehnten haben sich weltweit „Megastädte“ gebildet – einschließlich von erbärmlichen Wohn- und Lebensverhältnissen für Abermillionen ProletarierInnen. Das hat dazu geführt, dass mittlerweile die Mehrheit der Weltbevölkerung in Städten und nicht mehr auf dem Land lebt.
Rund 1,2 Milliarden Menschen müssen mit weniger als 1,25 Dollar/Tag ihr Auskommen fristen; geschätzte 2 Milliarden (also fast ein Viertel der Weltbevölkerung) leben heute von 2 Dollar/Tag oder noch weniger. Dazu zählen natürlich große Teile der Landarmut, von Bauern, Landlosen, Flüchtenden usw. – aber eben auch Abermillionen EinwohnerInnen dieser riesigen städtischen Ballungszentren. Von den LohnarbeiterInnen der Welt leben lt. ILO geschätzte 447 Millionen von einem Einkommen von weniger als 1,25 Dollar/Tag (7).
Dabei speist sich die Verstädterung aus zwei unterschiedlichen Quellen. Einerseits sind v.a. in Asien (davor aber auch in Brasilien) Städte gewachsen, teilweise regelrecht aus dem Boden gestampft worden, die zu riesigen industriellen Zentren wurden samt einer überausgebeuteten IndustriearbeiterInnenschaft. So haben die „WanderarbeiterInnen“ – die weltweit größte und wichtigste Welle der Arbeitsmigration – einen enormen Anteil am chinesischen „Wirtschaftswunder“.
Ähnlich der Entwicklung des Frühkapitalismus wird „überschüssige“ Landbevölkerung, die ihrerseits keine oder kaum noch Existenzmöglichkeiten am Land hat, von industriellen Investoren angezogen und folgt ihnen. Etliche der chinesischen Städte, die heute Millionenstädte sind, waren noch vor einigen Jahrzehnten Kleinstädte oder gar Dörfer, manche mögen auch mit dem „Weiterziehen“ des Kapitals im nächsten Zyklus wieder schrumpfen.
Entscheidend ist jedoch, dass sich bei dieser Form der Migration zur Stadt eine neue, produktive ArbeiterInnenklasse samt aller möglichen weiteren Bevölkerungsgruppen, die zu Großstädten gehören, bildet. Auch wenn diese Lohnabhängigen als extrem ausgebeutete, entrechtete, oft auch „illegale“ Arbeitskräfte beginnen, so entwickeln sie mehr oder weniger „spontan“ Formen des ökonomischen Kampfes und beginnen früher oder später für höhere Einkommen zu kämpfen, um ihre eigene Reproduktion zu sichern.
Das Anwachsen von Megastädten führt aber auch zu einer anderen Tendenz, die für bestimmte Ballungszentren geradezu typisch ist. Millionen werden vom Land vertrieben, weil sie dort kein Auskommen finden, was natürlich oft noch durch Kriege, sozialen Niedergang, klimatische Katastrophen verschärft wird. Doch in den städtischen Zentren werden sie auch als Lohnabhängige nicht gebraucht. In immer mehr Halbkolonien bilden sie eine wachsende Masse von Menschen, die sich abwechselnd als GelegenheitsarbeiterInnen, als kleine „HändlerInnen“, als Kriminelle, Paupers usw. verdingen müssen. Ihnen allen ist gemein, dass sie ins Lumpenproletariat abzurutschen drohen. Der Kapitalismus hat für sie selbst als billigstes Ausbeutungsmaterial keine oder nur gelegentlich Verwendung.
Im „Kommunistischen Manifest“ beschreibt Marx eindrücklich, dass die Krisen im Kapitalismus einen solchen Zustand hervorrufen, der die Reproduktion des Lohnsklaven als Lohnsklaven immer prekärer macht.
„Der moderne Arbeiter hingegen, statt sich mit dem Fortschritt der Industrie zu heben, sinkt immer tiefer unter die Bedingungen seiner eigenen Klasse herab. Der Arbeiter wird zum Pauper, und der Pauperismus entwickelt sich schneller als Bevölkerung und Reichtum. Es tritt hiermit offen hervor, dass die Bourgeoisie unfähig ist, noch länger herrschende Klasse der Gesellschaft zu bleiben und die Lebensbedingungen ihrer Klasse der Gesellschaft als regelndes Gesetz aufzuzwingen. Sie ist unfähig zu herrschen, weil sie unfähig ist, ihrem Sklaven die Existenz selbst innerhalb seiner Sklaverei zu sichern“. (8)
Für Milliarden Menschen ist heute das Leben als Pauper oder an der Grenze zum Pauperismus Realität – und nur Phantasten können davon träumen, dass der Kapitalismus für diese eine bessere Zukunft bieten kann.
Neben den Wanderungsbewegungen in städtische Zentren ist die Migration von der „Peripherie“ in die Zentren des Weltkapitalismus ein Kennzeichen der gesamten imperialistischen Epoche, v.a. der letzten Jahrzehnte. Die Verheerungen des globalen Kapitalismus haben Millionen in Mexiko u.a. zentralamerikanischen Ländern oder in Osteuropa weiter entwurzelt, „überflüssig“ gemacht. Das gilt ebenso für zahlreiche Länder des arabischen Raums, Afrikas oder Asiens. Nur ein geringer Teil der Flüchtlinge und ArbeitsmigrantInnen versucht dabei in die eine Lebensperspektive versprechenden Zentren Nordamerikas oder Westeuropas zu kommen. Die meisten scheitern an den rassistisch abgeschotteten Außengrenzen, Zehntausende krepieren beim Versuch, „illegal“ in die Zentren des Weltimperialismus zu kommen.
Dort droht ihnen Abschiebung und entwürdigende Behandlung als Bittsteller. Bestenfalls werden sie als passgerechte Arbeitskräfte mit weniger oder gar keinen sozialen Rechten, geringeren Löhnen, als Menschen zweiter Klasse verwendet. „Integration“ ist trotz ihrer permanenten Beschwörung letztlich nicht gewünscht. Daher werden auch Menschen der zweiten und dritten Generation, also die Kinder von MigrantInnen, bis heute als „AusländerInnen“ behandelt, als „GastarbeiterInnen“, die nach getaner Arbeit möglichst wieder verschwinden sollen.
Dieses System findet sich in fast noch zugespitzterer Form in manchen Halbkolonien, v.a. in den arabischen Golfstaaten oder Ländern wie Libyen, deren Nationaleinkommen sich im wesentlich aus der Grundrente speist und wo ein Großteil der Arbeit von MigrantInnen geleistet wird.
Die Arbeitsmigration ist ein wichtiger Lebensaspekt der weltweiten ArbeiterInnen-klasse geworden. Ein immer größerer Teil ist gezwungen, Grenzen zu überschreiten – oft unter erbärmlichsten Bedingungen. Diese mit unendlichem menschlichen Leid verbundenen Wanderungsbewegungen haben aber auch einen enorm revolutionierenden Aspekt für die ArbeiterInnenklasse. Sie stellen lokale oder nationale „Traditionen“ in Frage, sie untergraben den oft jahrzehntelang etablierten Konservatismus der „einheimischen“ ArbeiterInnen (einschließlich früherer Generationen von MigrantInnen), sie schaffen länder- und sprachenübergreifende Verbindungen.
Die Integration der ArbeitsmigrantInnen und Flüchtlinge in die ArbeiterInnenbe-wegung kann dabei letztlich nur über den gemeinsamen Klassenkampf erfolgen – sie ist jedoch eine Schlüsselaufgabe der gegenwärtigen Periode. Sie kann nur durch einen unversöhnlichen Kampf gegen Chauvinismus, Rassismus, Nationalismus, aber auch „mildere“ Formen der Bevormundung und des unkritischen Verteidigens der „eigenen“ etablierten „Arbeiter“kultur (in der Regel ohnedies nur als eine unter den Lohnabhängigen etablierte Form der bürgerlichen Kultur) bewältigt werden.
Alte und neue Arbeiteraristokratie
Nicht nur die unteren und mittleren Schichten des Proletariats, sondern auch die besser gestellten Teile haben sich in den letzten Jahrzehnten gewaltig verändert.
Schon im 19. Jahrhundert, beim Übergang zur imperialistischen Epoche, hatte Friedrich Engels (9) bei der Analyse des britischen Imperialismus festgestellt, dass sich im Kerngebiet des Empire eine relativ privilegierte Schicht der ArbeiterInnenklasse – die Arbeiteraristokratie – abzusondern begann und so zu einer erweiterten sozialen Basis der bürgerlichen Gesellschaftsordnung in die Reihen der Klasse der Lohnabhängigen geworden war. Engels leitete die Entstehung einer solchen Schicht von „besser gestellten“ ArbeiterInnen aus der vorherrschenden Stellung des britischen Imperialismus, aus dessen Weltmarktmonopol ab, und aus der starken ökonomischen Stellung dieser ArbeiterInnenschichten in der großen Industrie.
Lenin griff den Gedanken von Engels auf und erkannte, dass die imperialistische Epoche die Grundlage für die Entstehung und Reproduktion einer ganzen Schicht der ArbeiterInnenaristokratie in allen dominierenden kapitalistischen Staaten schuf. Britannien bildete nicht länger eine Ausnahme:
„Damals war es möglich, die Arbeiterklasse eines Landes zu bestechen, für Jahrzehnte zu korrumpieren. Heute ist das unwahrscheinlich und eigentlich kaum möglich, dafür kann jede imperialistische ‚Groß’macht kleinere (als England 1848-1868) Schichten der ‚Arbeiteraristokratie‘ bestechen und besticht sie auch. Damals konnte sich die ‚bürgerliche Arbeiterpartei‘, um das außerordentlich treffende Wort von Engels zu gebrauchen, nur in einem einzigen Land, dafür aber für lange Zeit, herausbilden, denn nur ein Land besaß eine Monopolstellung. Jetzt ist die ‚bürgerliche Arbeiterpartei‘ unvermeidlich und typisch für alle imperialistischen Länder, aber in Anbetracht des verzweifelten Kampfes dieser Länder um die Teilung der Beute ist es unwahrscheinlich, daß eine solche Partei auf lange Zeit die Oberhand behalten kann.“ (10)
Gegen Lenins Theorie der Arbeiteraristokratie sind viele Einwände in den letzten hundert Jahren gemacht worden – insbesondere auch, indem ihm aus einzelnen Zitaten eine recht primitive „Bestechungstheorie“ unterstellt wurde. Unter „Bestechung“ dürfen wir uns keineswegs ein quasi-kriminelles „Kaufen“ der oberen Schichten der Klasse vorstellen (wiewohl es das auch gibt).
Die Entstehung der ArbeiterInnenaristokratie vollzieht sich vielmehr wesentlich über den ökonomischen, gewerkschaftlichen Kampf, der für die Lohnabhängigen in zentralen Industrien und strategischen Sektoren ermöglicht, dauerhaft relative gute Verkaufsbedingungen der Ware Arbeitskraft zu erringen (im Gegensatz nicht nur zu den ArbeiterInnen in den vom Imperialismus unterdrückten Staaten, sondern auch zu den unteren Schichten und zum Durchschnitt der Klasse). Kurzum, diese Schichten sind in der Lage, die Arbeitskraft über eine längere Periode über dem Wert der Ware Arbeitskraft zu verkaufen (was nichts daran ändert, dass sie weiter LohnarbeiterInnen bleiben und ihre Ausbeutungsrate extrem, ja sogar höher als die anderer Arbeiterschichten sein kann).
Zweitens bedeutet die Zugehörigkeit zur ArbeiterInnenaristokratie keineswegs, dass diese Schichten immer weniger Kampfbereitschaft zeigen würden als andere. Im Gegenteil, unter bestimmten historischen Bedingungen können sie sogar Kernschichten der Avantgarde umfassen. So waren z.B. die Revolutionären Obleute in der Novemberrevolution eindeutig ein Teil der ArbeiterInnenaristokratie.
Wichtig für uns ist jedoch, dass Lenin erkannte, dass die Bildung einer ArbeiterInnenaristokratie und deren Reproduktion zu einem Kennzeichen aller imperialistischen Staaten wurde. Inmitten des Ersten Weltkriegs konnte er realistischerweise mit einer objektiven Aushöhlung der Stellung der ArbeiterInnenaristo-kratie und damit auch bürgerlicher ArbeiterInnenpolitik und der dominierenden Stellung „bürgerlicher ArbeiterInnenparteien“ rechnen.
Nach dem Zweiten Weltkrieg expandierte die Arbeiteraristokratie in den imperialistischen Ländern jedoch in einem bis dahin nicht dagewesenen Maß und konnte sich über eine historisch außergewöhnlich lange Periode als solche reproduzieren. Mehr noch, solche Formen der Bildung einer (wenn auch zahlenmäßig deutlich kleineren) „Aristokratie“ lassen sich auch in den halb-kolonialen Ländern, v.a. in den industriell fortgeschritteneren, wie auch in den degenerierten ArbeiterInnenstaaten konstatieren.
Mit dem Ende des „langen Booms“ und v.a. mit der Wende zum Neoliberalismus wurden auch Kernschichten der ArbeiterInnenaristokratie (z.B. die Bergarbeiter und Docker unter Thatcher, die Fluglotsen unter Reagan) zu Angriffszielen, ja teilweise zu bevorzugten Zielen. Die Niederlagen dieser Kernschichten hatten unmittelbar demoralisierende Auswirkungen auf die große Masse der Lohnabhängigen, denen so deutlich gemacht wurde, dass ihr Widerstand erst recht zwecklos sei.
In jedem Fall haben wir in den letzten Jahrzehnten eine dramatische Beschleunigung des Wandels der ArbeiterInnenaristokratie beobachten können.
Erstens wurden traditionelle Schichten der Nachkriegsaristokratie aufgrund von technischem Wandel, Verlagerungen und Niederlagen massiv geschwächt. Die „traditionelle“ Aristokratie ist im Schrumpfen begriffen.
Zweitens sind aber auch neue Schichten der ArbeiterInnenaristokratie entstanden infolge der Proletarisierung von lohnabhängigen Mittelschichten, der realen Subsumtion ihrer zuvor oft nur formell unter das Kapital subsumierten Arbeit.
Zum Dritten ist in neuen imperialistischen Ländern (v.a. China) und in einigen wirtschaftlich stärkeren Halbkolonien, z.B. den BRIC-Staaten, eine neue Arbeiteraristokratie entstanden oder im Falle Chinas im Entstehen.
Restrukturierung des Produktionsprozesses
Die Jahrzehnte nach dem Zusammenbruch des Stalinismus haben zu einer massiven Ausdehnung des Weltmarktes geführt. Der Welthandel ist dabei deutlich stärker gewachsen als die Produktion selbst. Dies hat zugleich die ArbeiterInnenklasse selbst zu einer Klasse gemacht, wo wachsende Teile der Lohnabhängigen in den globalen Austausch integriert sind. Ihre Arbeit ist in sehr unmittelbarem Sinn Arbeit, die auf eine globale Vergesellschaftung bezogen ist.
Das betrifft zum einen die Herstellung von Produkten für globale Märkte von Gütern und Dienstleistungen. Diese Entwicklung wird jedoch ergänzt und vertieft durch die Etablierung international integrierter Produktionsketten. Die Planung in den großen Monopolen findet heute oft länderübergreifend statt, unmittelbar bezogen auf den Weltmarkt (bzw. dessen zentrale Märkte). Das hat auch dazu geführt, dass z.B. in der Autoindustrie ein globaler industrieller Zyklus etabliert wurde, dass über den nationalen Rahmen hinaus eine Tendenz zur Bildung einer globalen Durchschnittsprofitrate für einzelne Industrien entsteht.
Heute arbeiten hunderte Millionen Lohnabhängige in multi-nationalen Konzernen, deren Produktionsstätten weltweit vernetzt sind, wo praktisch globale Planung – wenn auch für die bornierten Zwecke eines Einzelkapitals – etabliert wird.
Der Kapitalexport und die globalen Geldströme, spekulative Anlagen – kurz sämtliche Operationen von Kapital in Geldform – haben in den letzten Jahrzehnten gigantische Ausmaße angenommen, was selbst zu einer enormen Veränderung der Struktur des Produktionsprozesses, zur massiven Veränderung der Eigentums-struktur geführt hat. Mehr und mehr Kapital ist in privater Hand und der Hand des imperialistischen Monopolkapitals konzentriert.
Das ist die andere, im imperialistischen System unvermeidliche Seite des Internationalismus.
Das Niederreißen von Handelsschranken und Hemmnissen für den „freien Kapitalverkehr“ zwischen den einzelnen Ländern – wobei Niederreißen für die kapitalistischen Zentren höchst selektiv ist – ist ein Moment, das diesen Prozess massiv beschleunigt, zum Teil erst möglich gemacht hat. Das andere waren Niederlagen der ArbeiterInnenklasse, die die Durchsetzung dieser Umstrukturierung erlaubten.
Die Form der Internationalisierung geht freilich einher mit zunehmender Konkurrenz. Der Nationalstaat wird letztlich zu einem Hindernis für die weitere Durchdringung der Weltwirtschaft, weil er einerseits zwar Instrument der kapitalistischen Globalisierung, andererseits aber Instrument der nationalen Kapitale (und als imperialistischer Staat dementsprechend dominierender Finanzkapitale ist), so dass diese Entwicklung im Nationalstaat eben auch ihre Schranke hat – eine Schranke, die auf kapitalistischer Basis nicht überwunden werden kann.
Wir müssen daher damit rechnen, dass die zunehmende Konkurrenz vor dem Hintergrund struktureller Überakkumulation der Weltwirtschaft früher oder später auch zu Rückschlägen, Zusammenbrüchen, Einbrüchen der heute so vernetzten Weltwirtschaft führen wird, dass die „Open Door“-Policy mehr und mehr von der Bildung von Blöcken abgelöst werden wird.
Für die ArbeiterInnenklasse hat die Internationalisierung der Produktion, die Ausdehnung des Weltmarktes, der immer raschere Transfer des Kapitals von einem Land, einem Anlage- oder Spekulationsobjekt zum anderen enorme Probleme mit sich gebracht – insbesondere, weil ganze Gruppen von ArbeiterInnen, ganze „Standorte“, ja ganze Klassen gegeneinander direkt in Konkurrenz zueinander gesetzt werden.
Andererseits hat es auch die Möglichkeit direkter international koordinierter Aktion geschaffen. Die Verschlankung der Produktion und die Reduktion der Lagerhaltung haben auch die Konzerne anfälliger gemacht für die Aktion selbst relativ kleiner Gruppen von Lohnabhängigen.
Während die Gewerkschaften und die tradierten Organisationen der ArbeiterInnenklasse noch dabei sind, sich auf Neuzusammensetzung des Kapitals und der Klasse einzustellen, zeichnet sich für die Zukunft freilich eine neue, katastrophische Entwicklung ab. An einem bestimmten Punkt wird die Internationalisierung des Kapitals in ihr Gegenteil umschlagen (was bis zu einem Zusammenbruch des Weltmarktes gehen kann). Zweifellos kann dieser Moment hinausgeschoben werden, können die führenden Mächte dem bis zu einen gewissen Grad entgegenwirken. Aber auf dem Boden des Imperialismus und des Kampfes um die Neuaufteilung der Welt ist ein solcher Zusammenbruch letztlich unvermeidlich.
Reproduktionsprozess
Mit dem Produktionsprozess wurden in den letzten Jahren auch die Reproduktionsbedingungen der Klasse umgekrempelt. „Soziale Absicherung“ gab es für große Teile der Lohnabhängigen dieser Welt ohnedies nie. Doch in den letzten Jahrzehnten wurden die von der ArbeiterInnenklasse erkämpften oder von der herrschenden Klasse zugestandenen sozialen Sicherungssysteme, Versicherungen, staatliche Vorsorge, Bildungs- und Sozialleistungen, Renten usw. massiv zurückgefahren und oft privatisiert. Dasselbe gilt generell für staatliche Dienstleistungen. Einerseits wurden so Anlage suchenden Kapitalien Investitionsmöglichkeiten geboten zur mehr oder weniger sicheren, raschen Bereicherung.
Andererseits geht es v.a. darum, die Reproduktionskosten der Klasse zu senken. Vorher über Steuern finanzierte Leistungen müssen nun zunehmend aus dem Nettolohn bestritten werden. Insgesamt findet so eine Absenkung des Werts der Ware Arbeitskraft statt – und somit eine Erhöhung der Masse des Profits.
Zugleich hat die Absenkung der Reproduktionskosten enorme Auswirkungen für die Frauen, die Jugend, Kranke und RentnerInnen. Die Lage der proletarischen Frauen war im Kapitalismus schon immer durch die Doppellast von Ausbeutung als Lohnabhängige und privater Hausarbeit gekennzeichnet. Die Reorganisation des Reproduktionsbereiches unter dem Neoliberalismus hat diese Doppelbelastung noch erhöht. Die Kürzung bzw. Verteuerung von Sozialleistungen bedeutet für Millionen und Abermillionen proletarischer Frauen, dass sie diese Dienste nun zusätzlich und „kostenlos“ zu verrichten haben – und verstärkt aus dem politischen und gesellschaftlichen Leben gedrängt werden.
Wie die Frauen sind auch andere sozial Unterdrückte besonders von den Kürzungen, von der Umstrukturierung des Reproduktionsprozesses betroffen: MigrantInnen, Jugendliche, RentnerInnen sowie alle, die aus dem Produktionsprozess wegen Krankheit ausscheiden müssen.
B Auswirkung auf die Organisationen der Klasse
Die Neuzusammensetzung der ArbeiterInnenklasse folgt generell der Kapitalbewegung. Dies ist jedoch nie Resultat „rein“ ökonomischer Entwicklungen und Auseinandersetzungen. Vielmehr setzten grundlegend veränderte Ausbeutungs- und Akkumulationsbedingungen immer auch entscheidende Verschiebungen im Verhältnis zwischen den Klassen voraus. Tiefer gehende und zugleich längerfristige Verbesserungen der Ausbeutungsrate, der Möglichkeit, Extraprofite aus Halbkolonien zu ziehen oder Krisenkosten rivalisierenden Staaten aufzuhalsen usw. sind daher nicht nur Resultat ökonomischer Krisen oder Einbrüche, sondern erfordern auch politische Offensiven der herrschenden Klasse, sind immer Resultat von politischen Kämpfen.
Es zeigt sich darin nur, dass die bürgerliche Gesellschaft eben nicht nur auf einer ökonomischen Basis – dem Kapital/Lohnarbeitsverhältnis beruht – sondern eine Totalität samt politischem, ideologischem Überbau, staatlicher und internationaler „Ordnung“, verschiedenen Zwischenklassen und Zwischenschichten, also eine ganze Gesellschaftsformation darstellt. In dieser Gesamtheit stellt sich Politik letztlich als konzentrierte Ökonomie dar – müssen daher alle wesentlichen gesellschaftlichen Veränderungen auch politisch ausgefochten werden.
Die Veränderungen der letzten Jahre und v.a. seit der Krise haben generell zu einer Erhöhung der Ausbeutungsrate der ArbeiterInnenklasse geführt. Das ist ein wesentlicher Faktor für die Sicherung der Monopolprofite und enormen Gewinne des Großkapitals selbst in der Krisenperiode, während der Fall der durchschnittlichen Profitrate nicht gestoppt werden konnte, weil die „Anti-Krisenpolitik“ gerade auf die Verhinderung der Vernichtung überschüssigen, in den Händen der Monopole konzentrierten Kapitals angelegt war.
Für Überakkumulationsperioden ist es kennzeichnend, dass die Ausbeutungsrate v.a. über die Steigerung des absoluten Mehrwerts erreicht werden soll und Kürzung der Einkommen der Lohnabhängigen und anderer subalterner Schichten und Klassen, was notwendig zur Einschränkung ihres Konsums führt.
Die Krise hat die globale ArbeiterInnenklasse hart getroffen. Aber ihre Wirkungen verschärfen auch die Gegensätze in der Klasse. Das hat einerseits mit der ungleichzeitigen Auswirkung der Krise selbst zu tun. Länder wie Deutschland erholten sich nach einer tiefen Rezession sehr rasch, entpuppten sich als Krisengewinnler, konnten die Arbeitslosigkeit selbst in der Krise relativ gering halten und große Teil der industriellen ArbeiterInnenklasse, die Kernschichten der ArbeiterInnenaristokratie, erhalten und befrieden.
Andere Länder machten einen enormen Niedergang durch, befinden sich praktisch seit 2008 ständig in Rezession, die nur von kurzfristigen Phasen der Stagnation und minimalen Wachstums unterbrochen wird. Dort schrumpfte die Klasse und selbst ehemals sehr kampfkräftige Teile sind ökonomisch massiv geschwächt.
Zugleich vergrößerte sich die soziale Differenz nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch innerhalb der ArbeiterInnenklasse. Die Unterschiede zwischen den „besser gestellten“, aristokratischen Schichten, dem Durchschnitt wie den unteren Schichten des Proletariats haben sich deutlich vergrößert. Das trifft nicht nur auf die etablierten imperialistischen Staaten, sondern auch auf aufstrebende Mächte wie China und die halb-kolonialen Länder zu, wo die Einkommensdifferenz zwischen Aristokratie und Masse oft sehr viel größer ist.
Die Vertiefung der inneren Spaltung der Klasse hat auch zu einer Schwächung ihrer Organisationen geführt, z.T. zum Entstehen neuer Bewegungen und politischer Formationen. Wir stehen am Beginn einer historischen Neuzusammensetzung der ArbeiterInnenklasse und auch einer Umwälzung ihrer Organisationen.
Gewerkschaften und betriebliche Organisationen
Die Gewerkschaften gelten nicht von ungefähr als „Grundorganisationen“ der Lohnabhängigen. Auf sich allein gestellt, ohne kollektive, gemeinsame Vertretungen sind die ArbeiterInnen letztlich nicht einmal in der Lage, ihre Arbeitskraft zum ihr entsprechenden Preis, also entsprechend ihrer Reproduktionskosten, zu verkaufen.
Es ist kein Wunder, dass Gewerkschaften (und erst recht betriebliche Organisationsformen) der Klasse in einer Krisenperiode in die Defensive geraten müssen. Der „nur-gewerkschaftliche“ Kampf, der Kampf um die Verkaufsbedingungen der Ware Arbeitskraft stößt hier unausweichlich an seine Grenzen.
Generell ist der gewerkschaftliche Organisierungsgrad weltweit in den letzten beiden Jahrzehnten deutlich gesunken. In den meisten europäischen Ländern ist der Organisationsgrad in den letzten Jahren gesunken (Ausnahmen: Italien, Belgien, Norwegen, Zypern, Luxemburg, Malta). Besonders dramatisch ist die Lage in Osteuropa seit dem Zusammenbruch des Stalinismus. In der Europäischen Union beträgt – bei enormen nationalen Unterschieden – der durchschnittliche Organisationsgrad gerade 24 Prozent. (11)
Natürlich war es immer schon ein Mythos, dass alle oder auch nur die Mehrheit der Klasse gewerkschaftlich organisiert wäre. Das traf immer nur auf bestimmte Regionen/Ländergruppen zu – in der Regel die dominierenden, relativ starken imperialistischen Länder, die nicht nur eine starke ArbeiterInnenaristokratie haben, sondern wo die Gewerkschaften auch als regelnder Faktor in das System der Klassenzusammenarbeit über längere Perioden erfolgreich einbezogen werden konnten.
Die Veränderungen der Klasse haben dabei ihrerseits wesentlich zum Erodieren des gewerkschaftlichen Organisationsgrades beigetragen. Das war und ist bis zu einem gewissen Grad unvermeidlich, weil Gewerkschaften als Mittel zur Führung des ökonomischen Kampfes v.a. defensive, reagierende Organisationen sind – wie der ökonomische Kampf selbst seinem Wesen nach einen reaktiven Charakter hat und als Gegenaktion auf Angriffe des Gegners, auf Zumutungen des Kapitals, auf Veränderungen der ökonomischen Struktur der Gesellschaft verstanden werden muss.
Daher haben es historische Krisen, ökonomische Einbrüche aber auch politische Generalangriffe, revolutionäre Aufstände und Bürgerkriege (also höhere Formen des Klassenkampfes) an sich, dass sie auch die Schwächen der rein-gewerkschaftlichen oder reformistisch geführten Gewerkschaftsarbeit offenbaren, weil sie die Grenzen des ökonomischen Klassenkampfes verdeutlichen.
In den letzten Jahrzehnten haben die Umstrukturierungen der ArbeiterInnenklasse in vielen „neuen“ Industrien und Dienstleistungsbranchen fast zu gewerkschaftsfreien Zonen geführt. Die Verbände erwiesen sich in der Regel als unfähig, sowohl die Lohnabhängigen in „neuen“ Branchen (selbst wenn diese recht privilegiert waren) wie auch jene in den ausgelagerten, prekarisierten Sektoren zu organisieren.
In vielen Ländern wurde – sofern es dies je gab – die landesweite oder branchenweite Aushandlung von Tarifen und Arbeitsbedingungen ausgehebelt. Schon seit den 80er Jahren greift die betriebliche Aushandlung von Löhnen mehr und mehr um sich.
Zugleich hat die Umstrukturierung des Produktionsprozesses zu einer Schwächung und Aushöhlung des Prinzips der Industriegewerkschaften geführt (sofern es je durchgesetzt war).
Heute begegnen wir zwei, tw. einander ergänzenden Entwicklungen. Einerseits einer massiven Zersplitterung der Gewerkschaften. Gerade in den Halbkolonien, Ländern wie Pakistan, Indien, Sri Lanka, geht ein sehr geringer Organisationsgrad mit der Existenz tausender kleiner und kleinster Gewerkschaften einher.
Andererseits (und tw. in Kombination) mit der obigen Tendenz erleben wir die Fusion von Gewerkschaften unterschiedlicher Branchen, die Entstehung konkurrierender Dachverbände und unterschiedlicher Gewerkschaften in einem Betrieb. Die Existenz politisch konkurrierender Verbände oder „politischer“ Gewerkschaften – so verständlich die Spaltungen mitunter sein mögen – erweisen sich selbst als eine Spielart und als Teil des Problems.
Die Schwächung der Gewerkschaften und betrieblichen Interessenvertretungen war natürlich kein Selbstläufer, sondern war und ist auch Resultat politischer und unternehmerischer Angriffe. Weltweit wurden Einschränkungen der Rechte der Gewerkschaften, der Aktivität im Betrieb, des Streikrechts durchgesetzt und werden weiter forciert. Die „Tarifeinheit“ in Deutschland ist nur ein Teil (und international betrachtet sogar nur ein relativ marginaler Teil davon).
Freilich wären diese Angriffe nicht oder jedenfalls nicht mit so wenig Widerstand durchsetzbar gewesen ohne die Kooperation der Gewerkschaftsführungen und des Apparats der Gewerkschaftsbürokratie wie ihrer betrieblichen Entsprechung in Form der Betriebsräte/Personalräte, v.a. in den Großunternehmen und im Öffentlichen Dienst. Bei allen Unterschieden lässt sich feststellen, dass sich die Gewerkschaften mehr und mehr zu Organisationen der besser gestellten Lohnabhängigen in Großbetrieben und im Staatsapparat verengen. Sie waren natürlich auch schon die meiste Zeit im 20. Jahrhundert wesentlich von der ArbeiterInnenaristokratie bestimmt, zogen aber lange Zeit auch wirtschaftlich weniger kampfkräftige Schichten an. Heute erleben wir eine Tendenz der Verengung der Gewerkschaften auf die ArbeiterInnenaristokratie.
Die politische Ausrichtung auf Co-Management, New Realism, Sozialpartnerschaft usw. war die Reaktion der Führungen der Gewerkschaften auf Angriffe, Niederlagen und den Wunsch der Bürokratie, ihre eigene Vermittlerrolle zwischen Kapital und Arbeit auch unter ungünstigeren Bedingungen aufrechtzuerhalten.
Schon die gesamte Nachkriegsperiode war davon gekennzeichnet, dass die Gewerkschaften und die betrieblichen Vertretungen der Klasse in den Staat oder die Unternehmensführung integriert wurden. Trotzki hat auf diese Tendenz des Monopolkapitalismus in seiner Schrift „Die Gewerkschaften in der imperialistischen Epoche“ sehr ausdrücklich hingewiesen.
„Der Monopolkapitalismus fußt nicht auf Privatinitiative und freier Konkurrenz, sondern auf zentralisiertem Kommando. Die kapitalistischen Cliquen an der Spitze mächtiger Trusts, Syndikate, Bankkonsortien usw. sehen das Wirtschaftsleben von ganz denselben Höhen wie die Staatsgewalt und benötigen bei jedem Schritt deren Mitarbeit. Ihrerseits finden sich die Gewerkschaften in wichtigen Zweiten der Industrie beraubt, die Konkurrenz zwischen den Untenehmen auszunutzen. Sie haben einen zentralisierten, eng mit der Staatsgewalt verbundenen kapitalistischen Widersacher zu bekämpfen. Für die Gewerkschaften – soweit sie auf reformistischem Boden bleiben, d.h. soweit sie sich dem Privateigentum anpassen – entspringt daraus die Notwendigkeit, sich auch dem kapitalistischen Staat anzupassen und die Zusammenarbeit mit ihm anzustreben.
Die Gewerkschaftsbürokratie seiht ihre Hauptaufgabe darin, den Staat aus der Umklammerung des Kapitalismus zu ‚befreien‘, seine Abhängigkeit von den Trusts zu mildern und ihn auf ihre Seite zu ziehen. Diese Einstellung entspricht vollkommen der sozialen Lage der Arbeiteraristokratie und der Arbeiterbürokratie, die beide um Abfallbrocken aus den Überprofiten des imperialistischen Kapitalismus kämpfen.“ (12)
Die Bindung von Gewerkschaften an den Staat und die Monopole ist längst keine Entwicklung der letzten Jahrzehnte, sondern ist schon lange etabliert – einschließlich der Verwendung der Gewerkschaften als außenpolitische Agenturen großer imperialistischer Staaten und Konzerne. Hier hat nicht nur die AFL-CIO eine unrühmliche, konterrevolutionäre Geschichte vorzuweisen. Auch die DGB-Gewerkschaften machten sich beim „Export“ des deutschen Modells industrieller Beziehungen (Betriebsverfassungsgesetz, Tarifsystem, Mitbestimmung) in Osteuropa für das Kapital nützlich. Die chinesische Regierung lässt aus gutem Grund das „deutsche System“ der Sozialpartnerschaft und Mitbestimmung studieren, um so die Beziehungen zwischen Unternehmen und Beschäftigten zu „regulieren“.
Sozialdemokratische und stalinistische Massenparteien
Der Dominanz der Bürokratie und ihre soziale Basis und Verankerung v.a. in der ArbeiterInnenaristokratie entspricht die fortgesetzte Dominanz der Gewerkschaften durch bürgerliche ArbeiterInnenparteien sozialdemokratischen oder labouristischen Zuschnitts (zumeist in Europa, aber auch in Brasilien oder Australien), durch den stalinistischen Reformismus (z.B. in Indien) oder durch bürgerlichen Nationalismus und Populismus (u.a. in Argentinien oder Venezuela). Im schlimmsten Fall sind sie weiter an „linke“ bürgerliche Parteien der imperialistischen Bourgeoisie wie in den USA oder eng an den Staatsapparat gebunden (Russland, China, Türkei).
Unbestreitbar haben die letzten Jahrzehnte und die Jahre seit der Krise die historische und wesentlich noch über die Gewerkschaften bestehende organische Bindung dieser Parteien an die ArbeiterInnenklasse geschwächt. In einzelnen Fällen (Italien) hat sich eine ehemalige bürgerliche ArbeiterInnenpartei durch die Fusion mit einem Teil der Christdemokratie zu einer offen bürgerlichen Partei gewandelt – was freilich die Führung des größten Gewerkschaftsverbandes nicht hindert, sich auch dieser Partei politisch unterzuordnen.
Es wäre jedoch impressionistisch, verkürzt und politisch fatal, auf den unvermeidlichen Abgesang der bürgerlichen ArbeiterInnenparteien als quasi-automatischen Prozess zu hoffen.
Die bürgerliche ArbeiterInnenpolitik hat vielmehr selbst ihre Wurzeln im Lohnarbeitsverhältnis und in der Verlängerung des gewerkschaftlichen Kampfes zur Sozialreform auf politischer Ebene. Die imperialistische Epoche schafft außerdem mit der Entstehung der ArbeiterInnenaristokratie auch die Voraussetzung einer sozial-chauvinistischen-bürgerlichen ArbeiterInnenpartei und deren Reproduktion, macht sie zu einer für das politische System typischen Erscheinung.
Die aktuelle Krise unterminiert zwar ihre soziale Basis, sie zerstört sie aber keineswegs vollständig. In der Tat wird es die Basis für eine bürgerliche, reformistische Strömung in der ArbeiterInnenklasse solange geben wie das imperialistische System selbst. Die Vorstellung, dass die Krise automatisch solche Parteien und deren Einfluss in der ArbeiterInnenklasse erledigte, ist rein mechanisch und hat sich in zahlreichen Ländern als fatale Fehleinschätzung entpuppt. So hatte die NPA-Führung in Frankreich bei Gründung der Partei immer wieder proklamiert, dass der Reformismus als politische Formation erledigt sei. Kurz darauf formierten sich jedoch nicht nur die links-reformistische Konkurrenz der Parti de Gauche und die Front de Gauche als Block mit der KP, sondern selbst die Parti Socialiste von Hollande konnte sich noch einmal, wenn auch kurzfristig, als politische Alternative zu den Konservativen profilieren und gewann bei den Präsidentschaftswahlen.
Zur Begründung des (vorgeblichen) Verschwindens des Reformismus wird gern ein falscher, auf eine bestimmte Form bürgerlicher ArbeiterInnenpolitik beschränkter Begriff von Reformismus verwandt. Dieser sei wesentlich durch die politische Zielsetzung gekennzeichnet, den Kapitalismus über Reformen zu überwinden, also den „Weg zum Ziel“ zu machen. Wie aber schon Rosa Luxemburg nachwies, ist das jedoch nichts anderes als eine ideologische Beschönigung und Selbstrechtfertigung. Der Reformismus zeichnet sich wie jede bürgerliche ArbeiterInnenpolitik keineswegs nur dadurch aus, dass er auf einem anderen (friedlichen, parlamentarischen usw.) Weg zum gleichen sozialistischen Ziel will. In Wirklichkeit verändert sich gegenüber der revolutionären Politik auch das Ziel. Die Reform, der Kampf um Verbesserungen wird zum eigentlichen Zweck – und damit die Ausgestaltung des bestehenden Systems, nicht dessen Sturz. Diese Politik hat einen bürgerlichen Charakter unabhängig davon, ob der „Sozialismus“ als Ziel proklamiert wird oder nicht. Auch wenn etliche bürgerliche ArbeiterInnenparteien ursprünglich den Sozialismus proklamierten. v.a. jene, die aus der marxistisch geprägten Sozialdemokratie des 19. Jahrhunderts entstanden, macht das keineswegs das Wesen der reformistischen Parteien aus. Manche – wie die Labour Party – traten nie für den Sozialismus ein und gaben nie vor, marxistische Organisationen zu sein. Bestätigt hat sich jedoch seit dem Ersten Weltkrieg immer wieder, dass die reformistische Partei das kapitalistische und bürgerliche System gegen die Revolution verteidigt.
Mit dem Verrat von 1914 gingen diese Parteien ins Lager des Sozialchauvinismus über, auch wenn ihre sozialen und historischen Wurzeln in der ArbeiterInnenklasse bestehen blieben. Für die Bestimmung des Klassencharakters dieser Parteien ist es nebensächlich, ob sie den Sozialismus als „Endziel“ beschwören, entscheidend ist vielmehr, welches gesellschaftliche System sie verteidigen. Sie hören daher nicht auf, bürgerliche ArbeiterInnenparteien zu sein, weil sie eine Politik der „Gegenreformen“ oder gar direkt der Konterrevolution wie im Ersten Weltkrieg oder danach durchführen. Entscheidend dafür, ob eine Partei bürgerliche ArbeiterInnenpartei ist oder nicht, ist ihr Verhältnis zur Klasse, nicht ihre Ideologie.
Unter den Bedingungen der Krise ist freilich unvermeidlich, dass die Fähigkeit dieser Parteien, die Lohnabhängigen mit Reformen, mit Brosamen vom Tisch der Herrschenden zu integrieren, schwinden muss. Generell führt die Krise dazu, dass die sozialdemokratischen Parteien (wie auch die von ihr dominierten Gewerkschaften) weiter nach rechts gehen. Im Extremfall versuchen sie, ihre historischen und sozialen Wurzeln in der ArbeiterInnenklasse zu lösen und sich eine neue soziale Basis zu verschaffen. So waren der „Dritte Weg“ von Tony Blair oder die „Neue Mitte“ von Schröder Ideologien, die ihren Parteien eine Basis in den lohnabhängigen Mittelschichten verschaffen und sie unabhängiger von den Gewerkschaften machen sollten. Diese Politik hat zwar die reformistischen Parteien noch rechter, hilfloser und willfähriger gemacht, die neuen „Mittelschichten“ haben sie in der Regel jedoch nicht gewinnen können.
Wie aktuell die Kandidatur von Jeremy Corbyn in der britischen Labour Party zeigt, können unter bestimmen Bedingungen durchaus auch Massenbewegungen zu einer „Wiederbelebung“ dieser Parteien entstehen. Derartigen Brüchen in der Sozialdemokratie, in Labour oder auch Differenzierungen in populistischen Massenparteien (wie der PSUV in Venezuela) müssen RevolutionärInnen immer ein besonderes Augenmerk schenken.
Die Notwendigkeit einer besonderen, taktischen Herangehensweise an reformistische Parteien (wie auch die Massengewerkschaften) – also die Anwendung der Einheitsfronttaktik in all ihren Spielarten – ergibt sich freilich nicht erst mit deren „linkerer“ Erscheinungsweise, sondern besteht im Grunde immer und solange, wie diese Parteien Masseneinfluss haben oder im schlimmsten Fall gar die Avantgarde der Klasse dominieren.
Linke Gewerkschaften?
Die Betrachtung der tradierten ArbeiterInnenbewegung wäre unvollständig, würden wir nicht die oppositionellen Regungen in den Gewerkschaften, die Bildung neuer Verbände oder Kämpfe bislang eher passiver Teile der Klasse betrachten.
Zu konstatieren bleibt jedoch, dass die Brüche insgesamt weitgehend organisatorischer Natur blieben. Die schon länger bestehenden, kleineren „radikalen“ Gewerkschaften (COBAS in Italien, SUD in Frankreich) erwiesen sich in der Krise allenfalls verbal radikaler als die großen Verbände. Eine politische Alternative vermochten auch sie nicht zu weisen – weil sie letztlich nur einen radikaleren Syndikalismus verkörpern.
Hinzu kommt, dass ihre Verankerung in den Betrieben zu gering war und ist, um eigenständige, längere oder gar unbefristete Branchenstreiks durchzusetzen. Das heißt, sie waren auch nicht in der Lage, einen besseren gewerkschaftlichen Kampf zu führen.
Neue Gewerkschaften wie die Labour Qaumi Movement (13) in Pakistan oder selbst alte, ehemals sehr konservative Berufsgewerkschaften wie die GdL erwiesen sich hier als kampffähiger und wirkungsvoller, weil sie die Mehrheit der Beschäftigten in einer Branche oder Berufsgruppe vertreten und mobilisieren können und damit einer zentralen Bedingung jedes erfolgreichen ökonomischen Kampfes – der größtmöglichen Einheit – viel direkter Rechnung tragen als kleine „linke“ oder gar vorgeblich „revolutionäre“ Gewerkschaften, die jedoch nur eine Minderheit der Klasse vertreten. Letztere sind in Wahrheit nur eine Fraktion, eine bestimmte politische Strömung in den Gewerkschaften oder Betrieben – aber eine, die ohne jedes Bewusstsein dieser Tatsache die organisatorische Eigenständigkeit fetischisiert.
Die Lösung des Problems besteht darin, für eine klassenkämpferische, demokratische Einheit der Gewerkschaften nach dem Prinzip „Ein Betrieb, eine Branche, eine Gewerkschaft“ zu kämpfen, statt die gesonderte Organisierung der kämpferischeren Minderheit auf dieser Ebene zu forcieren. Vielmehr sollte diese politisch bewusstere Minderheit den Kampf für gewerkschaftliche Einheit mit der politischen Organisierung dieser Minderheit in einer Partei kombinieren. Doch diese kommunistische und einzig angemessene Lösung des Problems lehnt der Syndikalismus (einschließlich seiner linken und links-radikalen Spielarten) aus doktrinären Gründen, aufgrund der Überhöhung des ökonomischen Kampfes zum „eigentlichen Klassenkampf“, ab.
Die Grenzen des spontanen Gewerkschaftertums offenbaren sich besonders dramatisch im Kernland der Arabischen Revolution, in Ägypten. Die unter dem Mubarak-Regime in der Illegalität entstandene unabhängige Gewerkschaftsbewegung war und ist zweifellos eine der beeindruckendsten, vielleicht die beeindruckendste der Welt. Sie vermag Millionen anzuführen. Beim Sturz des alten Regimes kam ihr durch die Drohung eines Generalstreiks eine Schlüsselrolle zu – wie auch durch die Streikwellen vor dem Sturz von Mursi.
Aber politisch konnte sie der Revolution keine Richtung geben, sondern musste die politische Initiative den Islamisten der Moslembruderschaft, pro-westlichen „liberalen“ Quacksalbern, kleinbürgerlichen Phantasten aus der „sozialen Bewegung“ und schließlich den „säkularen“ Putschisten, Nationalisten und Militärs überlassen.
Die starke Tendenz zum „reinen“ Syndikalismus als falscher Alternative zur sozialdemokratischen oder stalinistischen Beherrschung der Gewerkschaften ist eine der Hauptursachen der Schwäche der gewerkschaftlichen Linken einschließlich linker Abspaltungen in der Krise. Bei allen reformistischen Schwächen bildet die Initiative der NUMSA in Südafrika hier ein Ausnahme in die richtige Richtung – nämlich die Initiative zur Bildung einer Klassenpartei der ArbeiterInnen, die sich gegen die Politik der Klassenkollaboration des ANC und der CPSA stellt.
Revolutionen, Konterrevolutionen und neue soziale Bewegungen
Die Einbindung der Sozialdemokratie und der Gewerkschaften in die „Anti-Krisenpolitik“, Angriffe auf und Befriedung der ArbeiterInnenklasse sowie die politische Schwäche der gewerkschaftlichen, betrieblich-oppositionellen Kräfte haben zwei zentrale Phänomene der letzten Jahre hervorgebracht: einerseits „neue“ Parteiformationen (die wir weiter unten betrachten), andererseits neue Bewegungen wie Occupy oder die Indignados.
Ob dieser Entwicklungen wird oft der Unterschied zu politisch weitaus entwickelteren Formen der gesellschaftlichen Widersprüche „übersehen“: zu den Arabischen Revolutionen, zur vor-revolutionären Periode in Griechenland oder zum Bürgerkrieg in der Ukraine.
In den arabischen Ländern hatten wir es mit genuinen „Volksrevolutionen“ zu tun, also Revolutionen, die alle Klassen, alle Schichten der Gesellschaft in Bewegung setzten, zum Sturz jahrzehntelang etablierter Regime führten oder zu Bürgerkriegen um die politische Macht. Natürlich spielten dabei Massendemonstrationen/Ansammlungen an zentralen Plätzen wie dem Tahrir in Kairo eine Schlüsselrolle (wie in allen Revolutionen der Kampf um die Hauptstadt von zentraler Bedeutung ist). Aber in Kairo war er der Sammelpunkt einer revolutionären Zuspitzung im Kampf um die Macht.
In Griechenland waren die Besetzungen des Syntagma-Platzes in Athen ebenfalls politischer Ausdruck einer langen, vor-revolutionären Periode, die schon 2008 begonnen und immer wieder Phasen der politischen Ebbe und Flut durchlaufen hatte. Die Platzbesetzungen waren dabei aber nur eine Form des Kampfes, die wie andere (durchaus höhere Formen wie z.B. die Aufstände der Jugend 2008, unzählige unbefristete oder politisch wichtige Betriebsbesetzungen) allesamt am Mangel an revolutionärer Führung litten, die die vorrevolutionäre Lage durch ihr bewusstes Agieren in eine revolutionäre hätte verwandeln können.
In Kiew hat der konterrevolutionäre Putsch Anfang 2014 zu einem gerechtfertigten Massenwiderstand im Osten geführt, der rasch die Form des Bürgerkriegs annahm. Wie in Griechenland und den Arabischen Revolutionen zeigte sich auch dort die Tiefe der Krise der proletarischen Führung, das Fehlen einer revolutionären Kaderpartei.
Es ist jedoch für Teile der „radikalen“, genauer der radikalen kleinbürgerlichen, Linken typisch, die Bewegungen in den Arabischen Revolutionen oder auch am Syntagma in eine Reihe mit Blockupy oder den Indignados zu stellen.
Ohne die Bedeutung eines landesweiten Massenprotests und der Besetzung innerstädtischer zentraler Plätze zu schmälern, war Blockupy eindeutig eine kleinbürgerliche Bewegung. Sie artikulierte eine tief greifende Unzufriedenheit auch von ArbeiterInnen, der Armut und selbst der Mittelschichten und entwickelte eine Dynamik, die auch eine große internationale Ausstrahlungskraft hatte. Andererseits aber kam auch sie nicht über einen radikalen Populismus hinaus. Blockupy war nicht der Ausdruck einer Bewegung, die alle Klassen der Gesellschaft umfasste und erst recht nicht die ArbeiterInnenklasse, sondern v.a. jener der Mittelschichten.
Die Indignados und auch viele andere Massenkampagnen in Spanien hatten zweifellos eine tiefere soziale Verankerung und basierten auch auf Massenkampagnen gegen Wohnungsnot, Wasserprivatisierung usw. Aber auch sie waren von der organisierten ArbeiterInnenbewegung relativ getrennt, ja standen nicht nur der PSOE, sondern auch den Gewerkschaften, der IU und selbst den organisierten, radikaleren linken Kräften oft offen feindlich gegenüber. Die Besetzungsbewegung in Spanien war letztlich stark populistisch geprägt, was durch den Einfluss anarchistischer und libertärer Strömungen und deren Anti-Politizismus noch gefördert wurde. Es ist kein Zufall, dass sich aus dieser Bewegung auch der Aufstieg von Podemos, einer populistischen Massenbewegung und neuen Partei, speiste.
Die kommende Periode wird weitere solche Bewegungen hervorbringen – gerade aufgrund des Verrats der sozialdemokratischen Parteien und Gewerkschaftsführun-gen sowie der Passivität der „Linksparteien“. Es ist notwendig, in solche Bewegungen zu intervenieren, ihre Mobilisierungen zu unterstützen, wo sie einen fortschrittlichen Charakter haben. Gegenüber ihren politischen Fehlern, ihrem kleinbürgerlichen Populismus darf es jedoch keine Zugeständnisse geben, zumal etliche von ihnen auch leicht dazu führen können, dass (Teile) dieser Bewegungen zum Spielball rechter, demagogischer Kräfte werden.
C Neue politische Formationen
Die Rechtsentwicklung und Krise der sozialdemokratischen Parteien und des Labourismus einerseits, die Grenzen von „reiner“ Bewegungspolitik andererseits haben in vielen Ländern schon vor und auch nach der Krise zur Entstehung neuer politischer Parteien geführt, die sich als politische Alternative anbieten.
Die oft kursorische Betrachtung dieser Parteien hat freilich den Mangel, dass darunter oft sehr verschiedene Formen in einen Topf geworfen werden. Dieser Artikel ist nicht der Ort, um diese Parteien im Detail zu analysieren – wohl aber ist es notwendig, sie hinsichtlich ihres Klassencharakters und ihres Verhältnisses zur ArbeiterInnenklasse, deren Avantgarde und den sozialen Bewegungen zu charakterisieren.
Linke reformistische Parteien
Das erste und zahlenmäßig wohl bedeutendste Phänomen stellen die links-reformistischen Parteien dar. Programmatisch betrachtet repräsentieren sie oft eine mehr oder weniger linke Variante der klassischen sozialdemokratischen Politik der Nachkriegsperiode, wobei klassische Reformkonzepte mit antizyklischer keynesianischer Wirtschaftspolitik kombiniert werden.
Viele dieser Parteien sind keineswegs so „neu“, sondern gehen auf ehemalige stalinistische Parteien zurück, die sich eurokommunistisch und links-sozialdemokratisch gewendet haben (Synaspismos, später Syriza in Griechenland; KP Portugal, KPF, IU, RC in Italien, Linkspartei in Schweden, PDS/DIE LINKE in Deutschland). Tw. kommen sie aus Abspaltungen der Sozialdemokratie (Parti de Gauche; WASG/DIE LINKE in Deutschland; im Grunde auch PSOL in Brasilien). Einige von ihnen sind auch maßgeblich durch die Politik zentristischer Organisationen, v.a. aus der Vierten Internationale oder auch ehemaliger Maoisten, entstanden (Einheitsliste in Dänemark, Linksblock in Portugal, Niederlande/Belgien).
Das zeigt schon, dass viele dieser „neuen“ Parteien keineswegs ganz so neu sind, sondern oft schon eine lange Tradition mit einem bürokratischen Apparat haben. Einige von ihnen waren im Grunde schon vor der Krise politisch schwer diskreditiert aufgrund ihrer parlamentarischen Fixierung, reformistischen Politik und der Beteiligung an Koalitionen mit der Sozialdemokratie (KPF) oder Volksfrontregierun-gen (RC in Italien).
Wichtig für diese Parteien ist, dass sie in bestimmten Perioden in der Lage waren, für Schichten der ArbeiterInnenklasse aus der Sozialdemokratie oder links-nationalistischen Parteien (PASOK in Griechenland) sowie für soziale Bewegungen zum Anziehungspunkt zu werden. Alle diese Parteien konnten zu bestimmten Perioden zu einem Anziehungspunkt für die politisch bewussteren, reformistisch geprägten ArbeiterInnen werden, waren aber aufgrund eben der Begrenzungen ihrer elektoral und reformerisch ausgerichteten Politik nicht in der Lage, mehr zu werden als der linke Flügel des parlamentarischen Spektrums.
Nur eine dieser Parteien – Syriza – hat es geschafft, zur stärksten Partei in der ArbeiterInnenklasse ihres Landes und von einer kleinen reformistischen Partei zu einer Massenpartei zu werden, die auch große Teile der Avantgarde des Landes organisiert.
Dieses Wachstum hatte zwei Ursachen: erstens die tiefe gesellschaftliche Krise und der Zusammenbruch der etablierten Parteien, zweitens vermochte Syriza als einzige Partei, die sich auf die ArbeiterInnen und sozialen Bewegungen stützte, eine, wenn auch reformistische Antwort auf die Regierungsfrage in den Mittelpunkt ihrer Agitation zu stellen.
Die Lage in Griechenland (und im Grunde in allen „Krisenländern“) erfordert eine konkrete Antwort auf die Machtfrage. Über zahlreiche Mobilisierungen und aufgrund permanenter Verarmung haben die Massen gelernt, dass es einer politischen Lösung bedarf, um zu verhindern, dass die Krise weiter auf ihrer Kosten „gelöst“ wird. Syriza (und alle Reformisten) antworten darauf, dass es notwendig ist, an die Regierung zu kommen – auch wenn sie eine Koalition mit sozialdemokratischen und offen bürgerlichen Parteien vorziehen. So hat die Syriza-Spitze in Griechenland von Beginn an eine Volksfrontregierung mit der erz-reaktionären, rassistischen und anti-semitischen ANEL einer Alleinregierung oder dem Kampf um eine ArbeiterInnenregierung vorgezogen.
Hinter der „Macht“politik von Syriza wie aller Linksparteien verbirgt sich zwar die Illusion, mit dem bürgerlichen Staatsapparat eine Politik durchsetzen zu können, die sich gegen den Neo-Liberalismus wendet und eine Umverteilung zugunsten der Ausgebeuteten längerfristig durchsetzt. Aber die Anerkennung der Tatsache, dass in der gegenwärtigen Krise die Machtfrage von entscheidender Bedeutung für die Frage ist, welche Klasse der Gesellschaft ihr „Anti-Krisen-Programm“ aufzwingen kann, hebt Syriza und den linken Reformismus von den utopischen und illusorischen Konzepten ab, die davon ausgehen, dass die Krise nur durch den Kampf der „sozialen Bewegungen“ gestoppt werden könne.
Die Unfähigkeit von KKE und Antarsya, auf diese Frage der Macht eine konkrete taktische Antwort jenseits allgemeiner Formeln zu liefern, war ein zentraler Grund, warum Syriza mehr und mehr AnhängerInnen in der Klasse und den sozialen Bewegungen gewann und als einzige Alternative zu ND und PASOK erschien. Zugleich hat der Wahlsieg von Syriza die Grenzen der reformistischen Politik, ihren illusionären Charakter offenbart. Vom „erratischen Marxismus“ und vom „ehrenhaften Kompromiss“ ist nur die nicht allzu ehrenhafte Kapitulation übrig geblieben. Aber zugleich eröffnet der Verrat auch die Möglichkeit, große Teile von Syriza für einen Bruch und eine Neugruppierung der griechischen ArbeiterInnenklasse, für die Schaffung eine Partei auf Grundlage eines revolutionären Aktionsprogramms zu gewinnen. Die größten Hindernisse sind dabei freilich der passive, links-reformistische oder zentristische Kurs der ehemaligen Syriza-Linken, der FührerInnen der heutigen „Volkseinheit“, die einen Bruch mit Tsipras nicht offensiv vorbereiteten, sondern letztlich vermeiden wollten, die sektiererische Spielart des Reformismus der KKE und die fehlende Klarheit und taktische Flexibilität von Antarsya.
Im Gegensatz zu Syriza sind die anderen Parteien der europäischen Linkspartei in den letzten Jahren weit weniger gewachsen, auch wenn sie sich in den meisten Ländern stabilisiert haben. In Spanien verliert die IU zugunsten von Podemos gewaltig. Andererseits könnte es in Britannien bei einem Sieg des Linksreformisten Corbyn bei der Abstimmung um die Labour-Führung oder im Falle eines Fraktionskampfes seiner AnhängerInnen zu einem Bruch in Labour kommen.
Außerhalb Europas sind kaum Phänomene wie die Linksparteien zu finden, obwohl in einigen Ländern die Basis für eine solche Entwicklung durchaus vorhanden wäre. So betreiben die indischen KPen – immerhin die größten bürgerlichen ArbeiterInnenparteien der Welt – seit Jahren eine widerliche Koalitionspolitik mit der Kongresspartei auf Provinzebene. In Brasilien zeichnet sich nicht nur ein Ende des „Wirtschaftswunders“ ab, sondern auch eine tiefe Regierungskrise und eine Krise der PT, was eventuell dazu führen könnte, dass sich die PSOL als links-reformistisches Partei stärkt oder Teile der PT wegbrechen.
Schließlich schafft die Krise in vielen Ländern, die keine oder nur verschwindend schwache reformistische (zumeist stalinistische) Parteien kennen, die Bedingungen zur Bildung neuer ArbeiterInnenparteien. Das trifft insbesondere auf Südafrika zu, in gewisser Weise aber auch auf Pakistan, wo die AWP eigentlich auch als Keim einer solchen fungieren müsste.
Im Grunde steht die Frage der ArbeiterInnenparteitaktik in zahlreichen Ländern – nicht nur der halbkolonialen Welt, sondern insbesondere auch den USA auf der Tagesordnung.
Bei den „neuen Parteien“ haben wir es aber nicht nur mit der Bildung von linken, reformistischen, also bürgerlichen ArbeiterInnenparteien zu tun, die im Einzelfall sogar zentristische Formen annehmen können.
Bürgerlicher und kleinbürgerlicher Populismus
Schon Ende der 90er Jahre konnten wir in Lateinamerika die Bildung neuer, populistischer Parteien und Bewegungen im Gefolge der venezolanischen Revolution beobachten, die heute die Regierungsgewalt in Ländern wie Bolivien, Venezuela, Ecuador ausüben. Die „bolivarischen“ Parteien sind in Wirklichkeit bürgerlich-populistische Parteien oder solche geworden. Nichtsdestotrotz war es politisch richtig, in deren Formierung zu intervenieren, insbesondere in der Gründungsperiode der PSUV in Venezuela. In den letzten Jahren haben wir es aber auch mit der Entstehung neuer, linker kleinbürgerlicher Parteien in Europa zu tun, die sich als politische Antwort auf die Krise der Gesellschaft anbieten.
Das betrifft einerseits die HDP (Demokratische Partei der Völker) in der Türkei, die sich wesentlich auf die kurdische nationale Befreiungsbewegung stützt, einschließlich der nach wie vor brutal verfolgten PKK, wie auch auf Teile der türkischen radikalen Linken und der Bewegungen der letzten Jahre wie die Gezi-Park-Bewegung und Chancen hat, die Spaltung zwischen kurdischer und türkischer ArbeiterInnenklasse zu überwinden.
Doch die HDP ist keine bürgerliche ArbeiterInnenpartei, sondern vielmehr eine kleinbürgerliche Partei, die v.a. eine unterdrückte Nation und ihren Befreiungskampf politisch vertritt. In der Partei (und in der kurdischen Bewegung) findet unter der Oberfläche schon jetzt der Kampf um ihre Ausrichtung statt. Soll sie eine „linke Volkspartei“, eine Form der türkischen Grünen oder eine türkische Variante von Sinn Fein nach dem Good-Friday-Abkommen werden? Soll sie eine links-reformistische Partei werden? Oder eine sozialistische, eine revolutionäre ArbeiterInnenpartei? Für letztere Perspektive sollten MarxistInnen in der Türkei in der HDP kämpfen.
In Spanien ist mit Podemos eine linke populistische Partei entstanden, die erfolgreich die IU in Bedrängnis gebracht und auch große Gewinne von der PSOE erzielen konnte. Politisch ist sie stark vom Chávismus inspiriert. Von der ArbeiterInnenklasse ist wenig zu hören, an ihre Stelle tritt das Volk. Zweifellos erfordert auch Podemos die Intervention von RevolutionärInnen, um dort für den Bruch der proletarischen und revolutionären Kräfte mit der populistischen Führung zu kämpfen.
Im Unterschied zu Podemos gibt es für die HDP zur Zeit kaum Spielraum, sich in das autoritäre politische System der Türkei und als feste Größe im Parlamentarismus zu etablieren. Das Regime Erdogan ist vielmehr dabei, einen Krieg gegen die KurdInnen zu entfachen und will die HDP zerschlagen. Die Tatsache, dass die türkische Regierung und die Armee zur Ausschaltung der HDP und der PKK sogar bereit sind, das Risiko eines Bürgerkriegs in Kauf zunehmen, obwohl diese ihre Bereitschaft zu einem Friedensprozess immer wieder zum Ausdruck gebracht haben, zeigt, dass selbst in relativ starken halbkolonialen Ländern wie der Türkei große Teile der herrschenden Klasse nicht bereit sind, die Festigung einer radikaleren, demokratischen „Volkspartei“ einer unterdrückten Nation oder eine reformistische Massenpartei zuzulassen. Dieses Problem trifft zahlreiche Länder der „Dritten Welt“. Aber es trifft auch einige imperialistische Staaten wie China, Russland, wo der Kampf um eine ArbeiterInnenpartei – zumal eine, die frei vom Mief des Stalinismus, Nationalismus und der offenen Bindung an den Staat ist – nur unter Bedingungen der Illegalität oder Halblegalität geführt werden kann. Selbst in westlichen Demokratien wie den USA ist klar, dass jede neue ArbeiterInnenpartei (oder selbst eine populistische Partei), die sich auch auf die rassistisch Unterdrückten stützen würde, mit Repression, Infiltrationen, rassistischen Übergriffen durch Polizei und faschistoide Kräfte rechnen müsste.
Podemos ist in dieser Hinsicht anders. Die neue Partei könnte in nächster Zukunft sogar zur Regierungspartei im imperialistischen Spanien werden.
Die Bildung der linken populistischen Parteien war bisher in Europa ein recht wenig bekanntes Phänomen (im Unterschied zu Lateinamerika). Die Krise bringt jedoch mit sich, dass die reformistische ArbeiterInnenbewegung – v.a. wo sie mit in der Regierung sitzt – die Lohnabhängigen verrät. Erst recht bietet sie den Mittelschichten und dem Kleinbürgertum, das selbst von Deklassierung betroffen ist, keine Perspektive. Podemos o.ä. Parteien erscheinen heute als eine solche, linke Alternative für die „Mitte“ der Gesellschaft wie für Arbeitslose und Verarmte. Allerdings kann die nächste Enttäuschung mit dem linken Populismus leicht dazu führen, dass sich diese Massen dann nach rechts wenden, um dort den nächsten populistischen Führer zu finden.
Die reformistischen Parteien erweisen sich als unfähig, den Mittelschichten oder dem Kleinbürgertum einen Ausweg aus der Krise zu bieten – nicht nur an der Regierung, sondern auch schon, weil ihre ganze Politik eng auf die Interessen bestimmter Schichten der Lohnabhängigen fixiert ist. Ihre darüber hinausgehende „Gesellschaftspolitik“ ist oft genug wenig mehr als ein eklektischer Mix aus politischen Angeboten anderer Klassen und Bewegungen, wobei sie sich in allen entscheidenden Fragen an die Vorgaben des Finanzkapitals halten.
In der Krise wird eine genuin revolutionäre ArbeiterInnenpolitik für Teile der Mittelschichten und das Kleinbürgertum viel eher attraktiv werden als der Reformismus, da eine revolutionäre Organisation ein Programm vertritt, das sich nicht auf „Arbeiterfragen“ beschränkt, sondern eine grundlegende Umwälzung der gesamten Gesellschaftsordnung anstrebt.
Neue „antikapitalistische Parteien“
In den letzten Jahren entstanden neben „neuen“ Parteien unterschiedlichen Charakters auch Umgruppierungsprojekte und Vereinigungsprojekte. Zweifellos ist das Fehlen revolutionärer Parteien und einer revolutionären Internationale heute das Kernproblem der ArbeiterInnenklasse. Die letzte, die Vierte Internationale Leo Trotzkis ist zwischen 1948 und 1951 politisch degeneriert und seit 1953 auch organisatorisch zerfallen (14). Anders als die ersten drei Internationalen hatte sie, von einigen Ländern und kurzen Perioden abgesehen, nie Masseneinfluss, ja war selbst in der Avantgarde der Klasse nur eine marginale Kraft.
Heute sind die Gruppierungen und Strömungen, die sich auf den Trotzkismus beziehen, zentristische Organisationen. Sie sind alle keine „Parteien“, also Organisationen, die signifikante Teile der ArbeiterInnenklasse anführen, sondern mehr oder weniger große Propagandagesellschaften, die eigentlich vor der Aufgabe stehen, revolutionäre Avantgardeparteien zu schaffen.
Dasselbe trifft auf andere Strömungen der „radikalen Linken“ zu, die sich auf die ArbeiterInnenklasse beziehen. Die „Marxistisch-Leninistischen“ Strömungen basteln an ihren „Internationalen“ ebenso wie andere Strömungen des linken Stalinismus. Auch sie sind letztlich in der Regel keine Parteien im eigentlichen Sinn. Hinzu kommt, dass sie anders als die „trotzkistischen“ Strömungen oft nur nationale Existenz haben, ihre „Internationalen“ wenig bis keine Verbindlichkeit aufweisen.
Darüber hinaus agiert je nach Land eine Vielzahl von „revolutionären“ Strömungen unterschiedlichster politischer Traditionen: linke AutonomistInnen, linke Flügel in bestehenden Massenparteien, linke, syndikalistische Strömungen in Gewerkschaften, links-nationalistische Strömungen in den Halbkolonien usw. usf. Sie alle proklamieren die Notwendigkeit einer revolutionären „Neuformierung“, auch wenn sie darunter höchst Unterschiedliches verstehen.
Eine Reihe von linken Organisationen hat in der letzten Periode auf die Notwendigkeit, die Möglichkeiten zu revolutionärer Einheit, der Schaffung einer politischen und organisatorischen Alternative zum Reformismus reagiert. Allerdings mit mehreren politischen Schwächen und Fehlern behaftet, die immer wieder zur Krise oder zum Zerfall dieser Formationen führen.
Lange Zeit galt die Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA) in Frankreich als Modell für diese Formationen. Die NPA wurde 2009 gegründet, nachdem die LCR mit Olivier Besancenot einen extrem erfolgreichen Wahlkampf zur Präsidentschaftswahl geführt und alle anderen linken Kandidaten – einschließlich der KPF – deutlich hinter sich gelassen hatte. Die LCR entschied sich damals korrekterweise, aufbauend auf diesem Erfolg, die Initiative zur Gründung einer neuen, antikapitalistischen Partei als Alternative zur Sozialdemokratie und zur abgewirtschafteten KPF zu nutzen. Die Resonanz war sehr positiv und die NPA wuchs rasch auf rund 10.000 Mitglieder.
Auch wenn die LCR mit der Gründung der NPA formell programmatische Positionen des Trotzkismus verwarf, so änderte das nichts daran, dass die NPA eigentlich einen Schritt nach links gegenüber der LCR darstellte. Ziele wie „Diktatur des Proletariats“, zu denen sich die LCR auf dem Papier noch bekannte, hatte die Vierte Internationale schon längst über Bord geworfen und für die LCR hatten sie ebenso wenig reale Bedeutung wie ihr abstraktes Bekenntnis zum „Trotzkismus“.
Die Gründung der NPA stellte einen Schritt nach links dar. Sie war ein Bruch mit der damaligen strategischen Orientierung der LCR, der Bildung einer „pluralen Linken“ (gauche plurielle) mit der KPF, den Grünen, kleinbürgerlichen Bewegungen wie Bovés Confédération Paysanne (Bauernbund). Der rechte Flügel der LCR um Christian Picquet lehnte folgerichtig auch die Gründung der NPA ab, was jedoch etliche seiner AnhängerInnen nicht daran hinderte, in der NPA weiter ihr Unwesen zu treiben.
Die NPA nahm 2009 ein relativ linkes „provisorisches“ zentristisches Programm (15) an, das jedoch im Zuge der folgenden Jahre nicht weiterentwickelt wurde. Politisch kontroverse Punkte blieben „offen“, eine Klärung oder Weiterentwicklung gab es nicht. Statt die anderen Parteien der Linken oder ArbeiterInnenbewegung vor sich herzutreiben, wurde sie rasch selbst von der Front de Gauche unter Druck gesetzt. Strittigen politischen Fragen versuchte sie auszuweichen, passte sich an oder schwieg sich aus. Hinzu kam, dass sie aus den Klassenkämpfen gegen die Sarkozy-Regierung und die Rentenreform – einschließlich riesiger Massenmobilisierungen und trotz großer Aktivität der Mitglieder – wenig gewinnen konnte, v.a. weil sie (selbst ein Erbe der LCR) zu einer zentralisierten, verbindlichen Intervention nicht in der Lage war und auch nicht zu einer Politik, die sich von der Gewerkschaftsbürokratie abhob (v.a. jener der CGT, die relativ links agierte).
Die NPA scheiterte letztlich daran, dass sie die Schaffung einer zentristischen Partei, also einer Partei, die zwischen revolutionärer, kommunistischer Politik und Programm und Reformismus schwankt, als strategisches Ziel proklamierte. Die „Einheit“ der anti-kapitalistischen Linken sollte durch Kompromisse oder Vertagen grundlegender politischer und programmatischer Differenzen erreicht werden.
Eine solche Politik ist jedoch eine Utopie. Der Klassenkampf selbst stellt immer wieder Aufgaben, die eine klare Linie, ein konsequentes Programm erfordern. Das stimmt schon für eine kleine Gruppierung. Für eine Organisation mit rund 10.000 Mitgliedern, die also wirklich die Avantgarde der Klasse in der nächsten Periode gewinnen könnte, die sich zur Aufgabe stellen müsste, eine revolutionäre Partei für Zehntausende zu werden, kann jede Halbheit in entscheidenden Fragen nur zur Zersetzung führen. Wird die Halbheit zur Methode, ist der Zerfall vorprogrammiert.
Die NPA ist keineswegs das einzige Phänomen in dieser Richtung. Auch in anderen Ländern kam es zur Gründung von neuen, antikapitalistischen und revolutionären Allianzen von ihrem Wesen nach zentristischen Gruppierungen.
Ähnliche zentristische Projekte stellen Antarsya in Griechenland oder die FIT (Front der Linken und ArbeiterInnen) in Argentinien dar. Auch diese basieren auf einem zentristischen Programm oder einer ebensolchen Wahlplattform. Ein ähnliches Phänomen stellt auch die AWP in Pakistan dar, auch wenn sie sich mehr und mehr zu einer reformistischen Organisation entwickelt. Wegen deren geringer Größe (weniger als 10.000) verfügt sie jedoch (ähnlich wie NPA, FIT, Antarsya) über keinen starken Apparat. Ihre Führung mag sich bürokratisch verhalten – eine nennenswerte Parteibürokratie wie bei etablierten reformistischen Massenparteien haben diese Formationen nicht.
Die Parteien der Europäischen Linkspartei oder die kleinbürgerlichen Parteien wie Podemos und die HDP sind in der Regel Massenparteien oder jedenfalls welche mit einem signifikanten Anhang in der Klasse, national Unterdrückten, im Kleinbürgertum oder den Mittelschichten. Mit ihrer Etablierung haben diese Parteien auch einen Parteiapparat und eine große, über parlamentarische Vertretungskörperschaften vom Staat alimentierte Schicht geschaffen, die eine Bürokratie bilden, die diese Parteien beherrscht (oder um diese Herrschaft ringt). Im Fall der HDP stellt sich die Lage etwas anders dar. Hier stellen eine aus dem Stalinismus entstandene Partei, die PKK, sowie die Guerilla-Strukturen den Kern eines bürokratischen Apparats, der die Organisation beherrscht.
Die neuen „antikapitalistischen“ Parteien haben einen vergleichbaren Apparat nicht, was sie auch instabiler macht. Entscheidend ist jedoch, dass es für sie nur drei Optionen gibt. Erstens können sich die antikapitalistischen Parteien zu reformistischen entwickeln. Diese Möglichkeit ist jedoch eher gering, v.a. in Ländern, wo es schon eine oder mehrere bürgerliche ArbeiterInnenparteien gibt und eine weitere, schwachbrüstige Miniaturvariante des Reformismus nicht gebraucht wird.
Zweitens können die Parteien über gemeinsame Praxis und programmatische Vereinheitlichung den Schritt zu einer genuin revolutionären neuen Partei machen. Dieses in jedem Fall wünschenswerteste Resultat setzt aber voraus, den „Pluralismus“, der jedem Umgruppierungsprojekt eigen ist, die programmatischen und politischen Differenzen, nicht als Ziel, sondern als zu überwindenden Zustand zu begreifen.
Gerade die historischen Beispiele zentristischer Parteien wie der USPD in Deutschland oder der POUM im Spanischen Bürgerkrieg zeigen, dass (a) der Zentrismus keine konsistente Alternative zum Reformismus, Anarchismus oder reinen Syndikalismus bieten kann und (b) zentristische Parteien nur vorübergehender Natur sein können.
Daher ist die dritte Möglichkeit – die Bildung einer zentristischen Partei – letztlich keine dauerhafte Lösung und kann es auch nicht sein. Solche Blöcke/Umgruppierungsprojekte können nur von vorübergehender Natur sein.
Ähnlich wie bei der NPA in Frankreich sind es dabei weniger die inneren Differenzen, auch wenn es den Beteiligten so erscheinen mag, sondern die Anforderungen des Klassenkampfes, die die Probleme aufwerfen.
Im Fall von Antarsya war es die Weigerung, eine Taktik gegenüber den Reformisten von Syriza (und KKE) anzuwenden, der von diesen die Übernahme der Regierung und die Bildung einer ArbeiterInnenregierung gefordert hätte, um so die Illusionen der Massen in diese Parteien einem Test zu unterziehen in einer Form, die den objektiven Erfordernissen des Klassenkampfes entsprach.
Hinzu kommt, dass die einzelnen Komponenten von Antarsya in der ganzen letzten Periode selbst kein gemeinsames Aktionsprogramm für Griechenland erarbeiten konnten – der Block also selbst keinen Schritt weiter kam, eine revolutionäre Partei zu formieren. Das hinderte letztlich auch daran, in den Aufschwung wie in die Krise von Syriza durch eine Fraktionsarbeit, organisatorischen Anschluss oder Entrismus zu intervenieren. Heute müsste Antarsya eigentlich versuchen, die linke Plattform in Syriza in Kampf um eine Mehrheit und den Bruch mit Tsipras zu unterstützen und vor sich herzutreiben, und so für die Schaffung einer revolutionären Partei zu kämpfen. Doch Antarsya bevorzugt hier Abwarten und Passivität, nicht zuletzt, weil jede solche Taktik, jedes offensive Manöver gegenüber einer reformistischen Massenpartei auch die Differenzen in Antarsya aufs Tapet bringen würde.
Die FIT in Argentinien kam nie über ein Wahlbündnis hinaus. Auch wenn sich seine Hauptorganisationen (Partido Obrero und PTS) gern als „orthodoxe“ Trotzkisten hinstellen und daher die FIT gern als „Modell“ anpreisen, so ist doch bemerkenswert, dass das Wahlbündnis selbst kein revolutionäres Programm hat (16). Die PTS proklamiert zwar, dass aus der FIT eine revolutionäre Partei werden soll, lehnt aber zugleich die Bildung von Grundstrukturen der FIT zwischen den Wahlen ab. Die Differenzen sind nicht geringer als jene in Antarsya oder in der NPA. So vertreten die drei Hauptorganisationen (PTS, PO, IS) zur Ukraine drei unterschiedliche Positionen. PO verteidigt den Widerstand gegen das Kiewer Regime, IS unterstützte den Maidan. Die PTS lehnt es ab, den Widerstand gegen Kiew zu unterstützen und nimmt eine „neutrale“ Haltung ein. Die konkrete Solidarität wird durch eine Abstraktion, den Aufruf zum gemeinsamen Arbeiterwiderstand, ersetzt.
Heute droht eine Spaltung der FIT. Trotz beachtlicher Wahlerfolge ist sie eine reine Wahlfront geblieben, die nun mit zwei gegeneinander antretenden Listen in die Vorwahlen gegangen ist. Diese Ausscheidung hat die PTS gewonnen, war zweifellos eine Verschiebung des Kräfteverhältnisses im Block darstellt. Dass sich nach geschlagener Vorwahl die unterlegene Liste freudig in den „gemeinsamen“ Wahlkampf einreihen wird, darf jedoch bezweifelt werden.
Noch problematischer ist das Fehlen einer offensiven Taktik gegenüber den peronistisch geführten großen Gewerkschaftsverbänden. In Argentinien zeichnet sich eine neue, tiefe Krise ab. Gerade hier dürfte sich der Kampf für den Bruch mit dem Peronismus nicht auf die Aufforderung zur Wahl eines linken Wahlbündnisses beschränken. Von den Gewerkschaften einschließlich ihrer Führungen müsste auch der Bruch mit der peronistischen Partei und die Gründung einer ArbeiterInnenpartei gefordert werden. RevolutionärInnen sollten dabei klarmachen, dass sie sich daran beteiligen würden – und zugleich dafür kämpfen, dass eine solche Partei von Beginn an ein revolutionäres Programm hat, ohne dies jedoch zur Bedingung ihrer Mitarbeit zu machen.
Die vielleicht größte Schwäche des Wahlblocks der FIT besteht freilich darin, dass die beteiligten zentristischen Gruppierungen des Wahlprogramm als ein revolutionäres ausgeben – und das, obwohl es die Frage der Regierung noch ganz allgemein darstellt. Die Notwendigkeit, dass sich eine ArbeiterInnenregierung auf Räte, auf Milizen stützen und den bürgerlichen Staatsapparat zerschlagen muss, wird im ganzen Text nicht angesprochen. Obwohl die Parteigänger der FIT diese gerne als „revolutionäre“ Alternative zur opportunistischen NPA hinstellen, findet sich im ganzen „revolutionären Programm“ kein Wort von Räten oder ArbeiterInnenmilizen!
Wir haben es hier – mit Ausnahme von Antarsya und bis zu einem gewissen Grad der NPA – mit Umgruppierungsprojekten im trotzkistischen Spektrum zu tun und mit Gruppen, die schon länger existieren.
Die gegenwärtige Periode kann aber auch dazu führen, dass Umgruppierungs-projekte aus recht neuen Gruppen, zentristischen Gruppierungen oder gar Parteien entstehen, weil unter dem Druck des Klassenkampfes auch Abspaltungen von reformistischen Organisationen oder militante ArbeiterInnenschichten in diese Richtung tendieren. Diese Entwicklung, die z.B. in der 68er Bewegung sehr viel ausgeprägter war, ist bislang sehr schwach – sie kann aber durchaus in der nächsten Periode bei eine Vertiefung der Krise und des Widerstands stärker ausfallen, zumal die Massen wie die Avantgarde mit neuen politischen Erfahrungen in die Auseinandersetzung gehen werden.
Ein Beispiel für eine zentristische Gruppierung, die in den letzten Jahren entstanden ist und in Westeuropa eine gewisse Bekanntheit erlangt hat, ist Borotba (Kampf) aus der Ukraine. Borotba entstand aus einer Abspaltung von der Kommunistischen Jugend der Ukraine gegen die Politik die Unterstützung des Janukowytsch-Regimes durch die KPU.
Anfänglich war Borotba ein politisch heterogener Zusammenschluss, der v.a. aus jungen GenossInnen mit einem Kaderkern und einigen hundert AktivistInnen bestand und sich stark auf anti-faschistische Aktivität konzentrierte. Mit dem Maidan und dem Putsch wurde die Organisation gezwungen, sich wie eine politische Partei oder Vorform einer solchen zu verhalten. Hinzu kam, dass sie außer im Osten im ganzen Land praktisch in die Illegalität gedrängt wurde, ihre Mitglieder auf den „Terrorlisten“ der Regierung auftauchten, ihre Führung praktisch ins Exil gehen musste.
Die Organisation zeigte trotzdem große Stärken und Heroismus, als sie praktisch die einzige größere Gruppierung der radikalen Linken war, die nicht vor dem Maidan-Putsch kapitulierte und auf den Widerstand orientierte, ohne vor dem russischen Imperialismus zu kapitulieren. Zugleich machten sich ihre programmatischen Schwächen, so z.B. eine Faschismusanalyse, die stark an Dimitroff angelehnt ist, wie überhaupt das Fehlen eines Programms und einer programmatischen Methode bemerkbar.
Auch wenn die Neue antikapitalistische Organisation (NaO) in Deutschland mit den anderen Umgruppierungsprojekten zahlenmäßig nicht vergleichbar ist und z.Z. eine schwere Krise durchläuft, so zeigt auch sie, dass ein solcher Umgruppierungs-prozess immer vor die Frage gestellt wird, ob er sich Richtung programmatischer Vereinheitlichung entwickelt – oder auseinandertreibt.
D Die zentralen Fehler der ‘radikalen’ Linken
Die „radikale“, subjektiv nicht-reformistische Linke war und ist gezwungen, auf die Veränderungen in der ArbeiterInnenklasse und deren Organisationen zu reagieren. Das betrifft insbesondere auch die politische Neuformierung der Klasse. Auch wenn sie zahlenmäßig und politisch schwach sein mag, so hat die Intervention (oder das Unterlassen ebendieser) von linken, antikapitalistischen Strömungen und Gruppierungen einen wichtigen Einfluss auf die Neuformierung der Klasse in den letzten Jahren gehabt. Allerdings hat diese Intervention keineswegs zur Realisierung des Potentials für eine revolutionäre Neuformierung der Klasse auf allen Ebenen geführt, sondern leider oft genug zum Gegenteil. Sie hat den Problemen der „spontanen“ Neugruppierung neue hinzugefügt. Hier zu den wichtigsten Fehlern:
Eine fatale Reaktion bestand darin, den politischen Formierungsprozess zugunsten der Bewegungen abzulehnen. Entstehende Massenbewegungen im Aufschwung erzeugen bei ihren UnterstützerInnen oft den Eindruck, dass eine breite, aktive Bewegung alle Hindernisse aus der Welt schaffen könne, dass politische Organisationen, Programme, „Parteienstreit“ nur zur Spaltung führen würden. Diese Position spiegelt in naiver Form die erste Erfahrung des gewerkschaftlichen Kampfes oder des Kampfes um soziale Verbesserungen wider.
Aber in jeder Bewegung zeigt sich auch, dass es den scheinbar über allen Parteien stehenden, von allen „Außeneinflüssen“ freien Kampf nicht gibt und nicht geben kann. Mag der Ruf nach „Parteilosigkeit“ auch die Enttäuschung über die bestehenden Parteien ausdrücken, die vorgeben, die ArbeiterInnenklasse zu vertreten, so ist er letztlich ein Fallstrick für jede proletarische, jede progressive Bewegung. Die Bewegung „fern“ von der Politik, vom offenen Kampf politischer Ideologien, Strömungen, Parteien zu halten, läuft in Wirklichkeit nur darauf hinaus, dass die schon vorherrschenden Ideologien bzw. jene, die sich auf dem Stand des Bewusstseins spontan entwickeln, dominieren werden. Das heißt, es werden Formen, Spielarten bürgerlichen Bewusstseins, politische Ausrichtungen und Parteien dominieren, die einen in letzter Instanz bürgerlichen Charakter haben.
Wer linke oder revolutionäre Parteien aus dem Kampf um die politische Führung in Bewegungen heraushalten will, verkennt, dass sich revolutionäres Klassenbewusstsein nie spontan entwickeln kann. Eine solche Gruppierung verkennt, dass revolutionäres Klassenbewusstsein von außen in die Klasse und ihre Kämpfe getragen werden muss. Ein revolutionäres Programm entsteht nie einfach „aus der Bewegung“, „von unten“, sondern ist immer Resultat einer wissenschaftlichen, theoretischen Verarbeitung vergangener und aktueller Erfahrung. Nur so kann die Theorie überhaupt, nur so kann das Programm die aktuelle Praxis anleiten, ihr einen Weg weisen.
Der Autonomismus, Anarchismus, die Libertären und linken SyndikalistInnen wiederholen hier auf unterschiedliche Weise die Fehler des Ökonomismus – die Anbetung der Spontanität.
Das führt sie dazu, dass sie bestimmte Formen des Kampfes, nämlich die Formen von „Neuformierung“ auf betrieblicher oder gewerkschaftlicher Ebene samt ihrer Irrwege (insb. der Gründung von separaten Gewerkschaften, Ablehnung der bewussten Intervention in die politischen Neuformierungen) über andere stellen und als „eigentlichen“ Klassenkampf betrachten. Die Bewegungsfetischisten, die an die Stelle bestimmter Sektoren der Klasse bestimmte, oft kleinbürgerlich-utopische, tw. populistisch inspirierte Bewegungen zur zentralen Form der „Neuformierung“ machen, sind ihnen ähnlich.
Laufen die einen ideologisch der betrieblichen Selbstverwaltung (oft genug irrtümlich zu einer Form der „ArbeiterInnenkontrolle“ überhöht) hinterher, so die anderen bestimmten Formen des utopischen oder kleinbürgerlichen Sozialismus oder seiner Wiederkehr in neuen Farben. So erfreuen so unterschiedliche Utopien wie der Populismus von Blockupy, die Zapatisten, der „demokratische Konföderalismus“ der PKK oder die Verfechter der „Commons“ ihre Unterstützer. Es herrscht kein Mangel an diesen kleinbürgerlichen Ideologien. Neben Bewegungen und Organisationen, deren mehr oder weniger bewusster Ausdruck sie sind, ist die links-akademische Produktion voll von solchen Ideologien (Negri, Holloway, Naomi Klein).
All diesen Strömungen ist neben einer entschiedenen Ablehnung von „Parteipolitik“ das Fehlen eines klaren, politisch verbindlichen Programms eigen. Ihre Utopien blühen immer wieder auf als scheinbar nahe liegende Reaktion auf den politischen Reformismus und dessen „Staatsfixiertheit“.
Die Fetischisten des ökonomischen Kampfes oder der „reinen“ Bewegung machen es zu ihrem Markenzeichen, die Staatsmacht erst gar nicht erobern zu wollen. Das ändert zwar nichts daran, dass sie in den seltenen Fällen, wo ihnen Regierungsmacht zufällt, als Träger, als regierende Kraft handeln müssen (z.B. in Rojava). Statt diesen Umstand jedoch als ein reales Problem zu begreifen, das ihre Ideologie praktisch in Frage stellt, wird es gern durch allerlei ideologische Notbehelfe verkleistert.
In der Regel führt das „Raushalten“ aus der Politik, der Verzicht auf den bewussten politischen Kampf um die Macht dazu, dass die „linke“ Politik denen überlassen wird oder bleibt, die sie bisher schon betrieben haben – den linken, reformistischen, echten Massenparteien oder auch linken populistischen Parteien/Bewegungen.
So reproduzieren in der Regel die „BewegungsaktivistInnen“ und deren Organisationen eine für das bürgerliche System typische Arbeitsteilung, wenn auch in einer linkeren Variante. Die Trennung von Politik und Ökonomie ist für die bürgerliche Gesellschaft konstitutiv, was sich auch in der Trennung von StaatsbürgerIn und Privatmensch widerspiegelt. In der herkömmlichen Form bürgerlicher ArbeiterInnenpolitik, wie sie v.a. in Europa etabliert wurde, erscheint diese Trennung als Trennung von wirtschaftlichem Kampf, für den die Gewerkschaften zuständig sind, und Politik, die von der reformistischen Partei betrieben wird.
In den sozialen Kämpfen, in zahlreichen Mobilisierungen der letzten Jahre wurde die Bewegungsmacherei den „AntikapitalistInnen“, v.a. der post-autonomen, post-… Linken überlassen – und die „eigentliche“ Politik, Wahlen, die Vorstellung von „Alternativen“ den linken oder populistischen Parteien.
Die neueren reformistischen und populistischen Parteien haben es umgekehrt ganz gut verstanden, sich viele „Linksradikale“, die vorgeben, die Bewegung über die Partei zu stellen, als ein zuverlässiges Fußvolk heranzuziehen. Es ist durchaus bemerkenswert, dass viele solcher „libertärer, anti-autoritärer“ Kräfte bei den Auseinandersetzungen der reformistischen Parteien mit deren Spitze oder gar deren rechten Flügeln gehen – nicht zuletzt, weil diese dem „traditionellen“ Etatismus des Reformismus ferner stehen würden.
In der Tat hat der traditionelle Reformismus den bürgerlichen Staatsapparat und den Parlamentarismus als ein Mittel betrachtet, durch den, gestützt auf die Masse des Volkes, Schritte zur einer Umgestaltung der Gesellschaft vollzogen werden könnten (im Maximalfall bis zum Sozialismus). Allenfalls müsste dazu der bürgerliche Staat noch weiter demokratisiert und von den reaktionärsten Elementen gesäubert werden.
Der Reformismus hat sich selbst von diesem Programm seit Jahrzehnten weit entfernt. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde es zumeist durch den Keynesianismus ersetzt, der seinerseits auch auf einen Staat setzt, der in die krisenhafte Entwicklung der Ökonomie eingreift.
Ironischerweise kritisieren viele der Bewegungslinken am Reformismus freilich nicht seine Illusionen, seine Fixiertheit auf den bürgerlichen Staat, sondern lehnen jede Notwendigkeit ab, dass sich die ArbeiterInnenklasse der Staatsmacht bemächtigen müsste, dass sie ihren eigenen Rätestaat aufbauen, dass sie die Wirtschaft in ihren Händen zentralisieren und gemäß eines gesellschaftlichen Plans reorganisieren müsste. Den „Bewegungslinken“ erscheint das Programm des Marxismus nicht als eine grundsätzliche Alternative zur bürgerlichen Politik, sondern auch der Räte-Halbstaat als Fortsetzung des „Staatsfetisch“, weil der Marxismus auf den Zentralismus, auf zentraler Planung beharrt.
Die Formierung neuer, reformistischer oder „radikaler“ kleinbürgerlicher Parteien hat die „revolutionäre Linke“ zweifellos vor die Notwendigkeit gestellt, darauf politisch-taktisch zu reagieren.
Der rechteste Teil der Zentristen hat freilich daraus einen fatalen Schluss gezogen. Er tritt für die Schaffung „breiter neuer Parteien“ ein, da die Schaffung von anti-kapitalistischen Organisationen „verfrüht“ sei, weil sie dem Bewusstsein der Klasse nicht angemessen wären. Für diesen Flügel der „radikalen Linken“ geht es letztlich darum, Parteien vom Schlage der europäischen Linkspartei zu schaffen, diese entweder als eigenständige Formationen zur Anpassung an den Reformismus zu führen oder den Aufbau „echter“ anti-kapitalistischer oder revolutionärer Formationen auf eine ferne Zukunft zu verschieben.
Diese Taktik hat nicht nur zur Spaltung der NPA in Frankreich geführt. So wurde auch der Linksblock in Portugal weiter und weiter nach rechts getrieben. Ähnliches gilt für PSOL in Brasilien. Am schlimmsten wirkt diese Methode in Podemos in Spanien. Das Problem ist dabei nicht die Intervention in diese Formationen, sondern der Verzicht auf einen organisierten politischen Kampf.
In der letzten Periode wurde diese Politik der Anpassung noch extrem gesteigert. Anders als die Parti de Gauche oder Syriza sind Parteien wie Podemos keine Parteien, die organisch in der ArbeiterInnenklasse verankert sind, sie sind keine bürgerlichen ArbeiterInnenparteien. Zweifellos ist es richtig, in diesen Formationen für eine revolutionäre Ausrichtung und für eine Spaltung entlang der Klassenlinie zu kämpfen, wenn diese große Teile der Avantgarde oder nach links gehender Schichten der Klasse anziehen oder organisieren. Aber eine gezielte revolutionäre Intervention beinhaltet auch ein klares Verständnis, worin überhaupt interveniert wird – und zu welchem Zweck. In der zentristischen Linken, v.a. unter den rechten Zentristen, ist es Mode, die grundlegenden Unterschiede des Klassencharakters von Parteien herunterzuspielen und so zu tun, als gehörten diese Fragen einer längst vergangenen Periode an.
Dabei zeigt gerade die aktuelle Entwicklung, wie wichtig ein solches Verständnis ist. Alle, die z.B. erklärt hatten, dass die Labour Party längst eine „ganz normale“ offen bürgerliche Partei geworden wäre, die sich hinsichtlich ihres Verhältnisses zur ArbeiterInnenklasse keinen Deut von jeder liberalen, jeder offen bürgerlichen Partei unterscheide, sind durch die Kampagne von Jeremy Corbyn blamiert. Ihre Einschätzung hat sich angesichts von 100.000 Neueintritten, 300.000 weiteren stimmberechtigten UnterstützInnen und der Bildung einer Unterstützungsbewegung tausender, v.a. junger AktivistInnen als falsch und empiristisch erwiesen.
Umgekehrt ist die Kampagne von Sanders in den USA, der bei den Vorwahlen der Demokratischen Partei viel Zuspruch erlebt und von Teilen der Gewerkschaftsbürokratie unterstützt wird, damit nicht gleichzusetzen. Während Corbyn um die Wiederbelebung einer, wenn auch bürgerlichen, ArbeiterInnenpartei kämpft, hat Sanders‘ Wahlkampagne keinerlei Auswirkung auf den Klassencharakter der Demokratischen Partei. Diese ist eine der wichtigsten Parteien der imperialistischen Bourgeoisie. Sanders‘ Kampagne dient letztlich dazu, ArbeiterInnen an diese Partei zu binden. RevolutionärInnen sollten zwar in die Kampagne intervenieren, aber dabei erklären, dass die Demokraten die Partei des Klassengegners sind, dass sie keine organische Bindung zur Klasse haben und Sanders und seine UnterstützInnen auffordern, mit ihnen zu brechen und für den Aufbau einer ArbeiterInnenpartei zu kämpfen.
Noch wichtiger als das Verwischen des Unterschiedes von reformistischen, kleinbürgerlichen oder offen bürgerlichen Parteien ist freilich das Negieren des Unterschieds von revolutionären, kommunistischen Parteien zu nicht-revolutionären Formationen. RevolutionärInnen unterscheidet von anderen Anti-KapitalistInnen nicht, dass wir die Notwendigkeit anerkennen, unter bestimmten Bedingungen in reformistischen, zentristischen oder klein-bürgerlichen Organisationen zu intervenieren. Aber es unterscheidet uns das Ziel. Für uns hat jede Taktik nur Sinn als Mittel zum Aufbau einer revolutionären Partei oder jedenfalls zur Stärkung ihrer Vorform.
Während für einen Teil der Zentristen die Bildung einer reformistischen Partei in der aktuellen Periode den Charakter eines strategischen Etappenziels angenommen hat, lehnen viele diese falsche Konzeption ab. Sie treten für den Aufbau einer „breiten antikapitalistischen Partei“ (im Unterschied zu einer „breiten Partei“) ein. Das ist zwar ein Schritt nach links, aber es ist ein inkonsequenter Schritt. Wir haben schon weiter oben das Problem dieser Taktik betrachtet, sowohl in ihren linkeren wie rechteren Spielarten.
Eine Sonderform dieser Politik besteht darin, die Frage der „Umgruppierung“ auf ein bestimmtes ideologisches Spektrum oder auf bestimmte Formen der Radikalisierung festzulegen. Die Frage, mit wem zu welchem Zeitpunkt eine Umgruppierung zur Bildung revolutionärer Einheit sinnvoll ist, ist keine Frage, die nur mit einem Abgleich von „Grundsätzen“, „Prinzipien“ oder dem Bekenntnis zu einer bestimmten historischen Tradition zu erledigen ist. Entscheidender als die formelle Ähnlichkeit der Positionen ist die Bewegungsrichtung anderer Strömungen, um überhaupt die Basis für eine Umgruppierung zu ergeben. Zweitens setzt die Möglichkeit zu einer organisierten Diskussion und Entwicklung einer größeren, revolutionären Formation in der Regel eine Krise bei den beteiligten zentristischen Gruppierungen oder anderen Strömungen voraus.
Wir lehnen jedoch die Vorstellung, dass es um die Einheit einer bestimmen „geschichtlichen Strömung“ gehe, grundsätzlich ab. Die Frage der „Einheit des Trotzkismus“ oder der „Wiedervereinigung“, Neugründung, Bildung ihres vorgeblich linken Flügels ist ein überholtes Konzept, eine Chimäre. Als einheitliche Strömung ist „der“ Trotzkismus, ist die Vierte Internationale tot. Ihre Spaltprodukte stehen der Möglichkeit revolutionärer Einheit, also der Überwindung grundsätzlicher programmatischer Differenzen und der Entwicklung einer gemeinsamen programmatischen Grundlage für eine zukünftige revolutionäre Internationale grundsätzlich nicht näher als andere Strömungen der „radikalen Linken“.
Zweitens verengt die Frage dieser „Einheit“ den Blick auf die Notwendigkeit der entschlossenen Intervention in die historische Neuformierung der Klasse und ihrer Avantgarde. Diese wird unterschiedlichste politische Taktiken des Eingreifens in die Klassenbewegung auf politischer wie ökonomischer Ebene erfordern. Jede Fetischisierung einer bestimmten Variante kann dabei nur zur Anpassung oder zur Selbstisolation vor wichtigen Veränderungen der Klasse und ihrer Avantgarde führen. Sie führt zum:
a) Fetischisieren eines oder mehrerer Elemente realer Bewegungen;
b) zum Verzicht auf flexiblen Zugang zu anderen Phänomenen;
c) Ersetzen von Taktik durch eine Strategie;
d) Verzicht auf Erarbeitung eines revolutionären Programms.
E Trotzkis Lehren
Für alle Strömungen der „extremen Linken“ stellt sich die Frage, wie sie mit ihren geringen Kräften in einen Prozess der historischen Neuformierung der Klasse, der grundlegenden Erschütterung ihrer bestehenden Organisationen, der raschen Bildung „neuer“ politischer Kräfte und ihres oft ebenso raschen Niedergangs intervenieren sollten.
Wir müssen unsere Taktik dabei nicht mit dem Blick auf die mehr oder weniger radikale Linke, sondern vor allem in Hinblick darauf bestimmen, wie wir die reale Avantgarde in ihrer gewerkschaftlichen, sozialen und vor allem politischen Neuformierung beeinflussen, an ihrer Seite arbeiten können und sie für ein revolutionäres Programm und den Aufbau eine revolutionären Partei gewinnen können.
Wir tun dies als sehr kleine Propagandagesellschaft. Anders als revolutionäre Parteien, die wenigstens einige tausend, wenn nicht zehntausende Kader zählen und signifikante Teile der ArbeiterInnenklasse anführen können, müssen kleine revolutionäre Gruppierungen v.a. auch versuchen, Wege und Taktiken zu entwickeln, wie sie überhaupt in größere Veränderungen der Klasse eingreifen können.
In dieser Hinsicht sind die Erfahrungen des Trotzkismus von 1933 bis zum Zweiten Weltkrieg für unsere heutige Situation von enormer Bedeutung. Bis zur Niederlage der deutschen ArbeiterInnenklasse gegen den Faschismus hatten die TrotzkistInnen für eine Reform der Kommunistischen Internationale als „externe Fraktion“ gekämpft. Die Losung einer neuen Internationale wurde bis dahin von den Gruppierungen der „Internationalen linken Opposition“, also den „TrotzkistInnen“, vehement abgelehnt, da es ihrer Meinung nach v.a. darum ging, den Kampf um eine politische Kursänderung der Kommunistischen Internationale zu führen, die sich noch auf Millionen revolutionäre ArbeiterInnen stützen konnte. Die Avantgarde der Klasse war damals im Großen und Ganzen in diesen Parteien zu finden.
Die Niederlage der deutschen ArbeiterInnenklasse offenbarte aber auch das komplette Scheitern der Komintern-Strategie und der ultra-linken Politik der „Dritten Periode“. Die KPD hatte ganz in diesem Sinne jahrelang die Anwendung der Einheitsfrontpolitik gegenüber der Sozialdemokratie abgelehnt und so den reformistischen Führern die Ablehnung der Einheitsfront mit den KommnistInnen erleichtert, die Einheit der Klasse gegen die Faschisten und die Gewinnung der sozialdemokratischen ArbeiterInnen massiv erschwert. All das führte dazu, dass die ArbeiterInnenklasse den Faschismus nicht stoppen konnte und für den offenen Verrat der Sozialdemokratie und die fatale, ultralinke Politik der KPD (garniert mit reichlich Nationalismus) mit der schwersten Niederlage des 20. Jahrhunderts zahlen musste.
Die Komintern und die KPD wurden zu diesem Zeitpunkt von Trotzki und der linken Opposition nicht als reformistisch, sondern als zentristisch, genauer als „bürokratischer Zentrismus“, charakterisiert. Trotzdem drängte Trotzkis nach der Niederlage darauf, dass die Linke Opposition nunmehr ihren Kurs auf eine „Reform“ der Komintern aufgeben müsse, weil sich die KPD wie die Komintern als unfähig erwiesen, selbst nach dieser historischen Niederlage, ihre Fehler zu analysieren. Im Gegenteil, die KPD und das Exekutivkomitee der Kommunistischen Internationale bestätigten nach der Machtergreifung Hitlers, dass der Kurs grundsätzlich richtig gewesen wäre, ja man ging noch davon aus, dass Hitler rasch „abwirtschaften“ würde und dann die KPD die Macht ergreifen könne. Gegen diesen Kurs regte sich in der Komintern nicht nur an der Spitze, sondern auch in den Sektionen kein offener Widerstand – auch wenn sich ArbeiterInnen mehr oder weniger demoralisiert von ihr abwandten.
Daraus zog Trotzki den Schluss (zuerst hinsichtlich der KPD, dann gegenüber der gesamten Komintern), dass eine „Reform“ der stalinistischen Parteien für die Zukunft auszuschließen sei und daher auch eine Neuausrichtung der Linken Opposition notwendig geworden wäre, die sich fortan „Internationale Kommunistische Liga“ nannte. Das Ziel war nunmehr der Aufbau einer neuen, revolutionären Internationale. Die Entwicklung einer recht kleinen Propagandagruppe hin zu einer Kaderpartei kann freilich nicht ohne entschlossene taktische Manöver im Parteiaufbau bewerkstelligt werden – Manöver, die auch in den 30er Jahren zu vielen sektiererischen Einwänden wie zu opportunistischen Fehlern führten. Hinzu kommt, dass die Fragmente der Vierten Internationale diese Taktiken nach dem zweiten Weltkrieg pervertierten und ihres revolutionären Gehalts beraubten. Das wohl bekannteste Beispiel ist die Entrismustaktik, die nach dem Zweiten Weltkrieg grundsätzlich einen opportunistischen Charakter erhielt.
Wir haben uns an anderer Stelle ausführlich mit den verschiedenen Taktiken (17) auseinandergesetzt. Für uns geht es an dieser Stelle darum, die grundlegenden Methoden, die Trotzki in den 30er Jahren angewandt hat und entwickelte, zu skizzieren, da wir sie für unsere heutigen Aufgaben für besonders interessant halten. Wir können dabei drei zentrale politische Taktiken/Methoden unterscheiden, die wir im Folgenden darstellen wollen: a) Die „Block-Taktik”, b) Entrismus und c) die ArbeiterInnenparteitaktik.
Die Block-Taktik
Vor allem nach der Niederlage gegen den Faschismus orientierte Trotzki auf die Einheit mit nach links gehenden, zentristischen Organisationen, die sich von der Sozialdemokratie oder dem Stalinismus abgespalten hatten. Entscheidend für Trotzki war dabei, diese Organisationen für einen klaren organisatorisch-politischen Bruch mit den bestehenden Zweiten und Dritten Internationalen zu gewinnen und für einen Aufbau einer gemeinsamen, neuen Internationale.
Das brachte ihn einerseits in scharfen politischen Gegensatz zur Mehrheit der „Zwischengruppen“ zwischen der Kommunistischen Internationale und der Sozialdemokratie, die sich einerseits formierten (Pariser Konferenz 1933, Gründung des „Londoner Büros“), andererseits das Hintertürchen einer zukünftigen Einheit mit den Reformisten oder den Stalinisten offen halten wollten.
So unterzeichneten schließlich vier Organisationen im August 1933 die „Erklärung der Vier“. Diese beinhaltet auf einigen Seiten eine gemeinsame Einschätzung des Scheiterns von Stalinismus und Sozialdemokratie, die grundsätzliche Notwendigkeit, deren politische Abweichungen zu bekämpfen und eine eigene, revolutionäre Alternative aufzubauen auf Grundlage der Anwendung der politischen Grundsätze und Prinzipien von Marx und Lenin.
Die beteiligten Organisation – die IKL sowie drei zentristische Gruppierungen: die SAP aus Deutschland, RSP und OSP aus den Niederlanden – einigten sich außerdem auf die Einsetzung einer Kommission „a) zur Ausarbeitung eines programmatischen Manifests als Geburtsurkunde einer neuen Internationale; b) mit der Vorbereitung einer kritischen Übersicht über die gegenwärtigen Organisationen und Strömungen der Arbeiterbewegung (Kommentar zum Manifest), c) mit der Ausarbeitung von Thesen zu allen Grundfragen der revolutionären Strategie und Taktik“ (18).
Auch wenn der Block letztlich auseinanderbrach, weil sich die SAP rasch wieder nach rechts hin zum „Londoner Büro“ entwickelte, so brachte der Block sehr wohl einige Erfolge. OSP und RSP fusionierten rasch und bildeten eine gemeinsame Organisation und spätere Sektion der IKL in den Niederlanden.
Vor allem aber bestimmten die IKL und der Trotzkismus ihre grundlegende Herangehensweise an den Zentrismus, an „Vereinigungsprojekte“. Programmatische Einheit war dabei von entscheidender Bedeutung, insbesondere die Konkretisierung der Programmatik auf die jeweiligen aktuellen Ereignisse. Trotzki weist darauf hin, dass es überhaupt keinen Wert hat, die Notwendigkeit der „Diktatur des Proletariats“ anzuerkennen, wenn es kein gemeinsames Verständnis der Notwendigkeit der Arbeitereinheitsfront gegen die faschistische Gefahr gibt. Das trifft auch auf entscheidende Taktiken zu. So reicht es offenkundig nicht aus, dass die Einheitsfronttaktik „allgemein“ anerkannt wird, wenn zugleich nicht konkretisiert wird, an wen sie sich zu richten hat, ob sie an die Basis und Führung der Massenorganisationen zu richten sei (oder praktisch nur eine Spielart der Einheitsfront von unten darstellt).
Hinsichtlich der konkreten Hinwendung zu einer bestimmten Gruppierung ist nicht die formelle Ähnlichkeit des Programms entscheidend, sondern die Bewegungsrichtung der vorgeblichen revolutionären Organisation. Trotzki verdeutlicht das mit dem Verweis darauf, dass sich der stalinistische Zentrismus der „Dritten Periode“ aus dem Bolschewismus entwickelt und zu einer dogmatischen, ultra-linken Doktrin (einschließlich etlicher rechter Schwankungen) wurde. Das bedeutete auch, dass die „offizielle“ Kommunistische Internationale als dem Marxismus näherstehend erscheinen konnte, da sie sich selbst militanter oder kämpferischer inszenierte und für einen ganz und gar nicht bolschewistischen Inhalt noch immer die Terminologie des Bolschewismus verwandte. Die aus der Sozialdemokratie kommenden zentristischen Strömungen erschienen demgegenüber oft weicher, tendierten zur Fetischisierung der „Einheit“ und waren auch stärker durch die Mentalität der Sozialdemokratie geprägt. Entscheidend war daher für Trotzki die Bewegungsrichtung – nicht die formelle Nähe.
Das bedeutete auch, dass Blöcke, die Möglichkeiten zu größerer revolutionärer Einheit boten, notwendig nur für begrenzte Zeit vorhanden waren. Die politischen und wirtschaftlichen Erschütterungen, die zentristische Organisationen und ihre Führer nach links stießen, sind in einer Krisenperiode oft nur von kurzer Dauer. Eine neue Wendung der Ereignisse kann leicht zu einem Kurswechsel der Zentristen führen. So waren der Zulauf des Faschismus in Frankreich und die Niederlage des österreichischen Proletariats 1934 Faktoren, die zu einer Linksentwicklung der Sozialdemokratie insgesamt führten bis hin zu „zentristischen Anwandlungen“ ganzer Parteien. Viele linke Zentristen der 30er Jahre verleitete das jedoch zu einem Rechtsschwenk, gewissermaßen um den nach links gehenden Sozialdemokraten auf halbem Weg entgegenzukommen.
Falsch war daran nicht, sich auf die politischen Erschütterungen dieser Parteien zu orientieren, wohl aber, sich daran programmatisch anzupassen.
Bei der taktischen Zusammenarbeit – und der Bildung von Blöcken mit ihrem Wesen nach zwischen Reform und Revolution schwankenden Organisationen und ihren Führern – muss deren Schwanken also in Rechnung gestellt werden. Das heißt, es darf keine politischen Zugeständnisse geben und es ist notwendig, die unvermeidlichen Schwankungen der Partner zu kritisieren. Zugleich ist es aber auch notwendig, auf organisatorischer Ebene sich überaus flexibel zu verhalten. In „Der Zentrismus und die Vierte Internationale“ fasst Trotzki die Lehren aus dem Block der Vier zusammen:
„Wir können unsere Erfolge in relativ kurzer Frist ausbauen und vertiefen, wenn wir:
a) den historischen Prozess ernst nehmen, nicht Versteck spielen, sondern aussprechen, was ist;
b) uns theoretisch Rechenschaft ablegen von allen Veränderungen der allgemeinen Situation, die in der gegenwärtigen Epoche nicht selten den Charakter schroffer Wendungen annehmen;
c) aufmerksam auf die Stimmung der Massen achten, ohne Voreingenommenheit, ohne Illusionen, ohne Selbsttäuschung, um, aufgrund einer richtigen Beurteilung des Kräfteverhältnisses innerhalb des Proletariats, weder dem Opportunismus noch dem Abenteurertum zu verfallen, die Massen vorwärts zu führen und nicht zurückzuwerfen;
d) uns jeden Tag und jede Stunde fragen, welches der nächste praktische Schritt sein soll; wenn wir diesen sorgfältig planen und den Arbeitern auf der Grundlage lebendiger Erfahrung den prinzipiellen Unterschied zwischen Bolschewismus und all den anderen Parteien und Strömungen klar machen;
e) die taktischen Aufgaben der Einheitsfront nicht mit der grundlegenden historischen Aufgabe – der Schaffung neuer Parteien und einer neuen Internationale – verwechseln;
f) für das praktische Handeln auch den schwächsten Bündnispartner nicht geringschätzen;
g) die am weitesten ‚links‘ stehenden Bündnispartner als mögliche Gegner kritisch beobachten;
h) jenen Gruppierungen größte Aufmerksamkeit widmen, die tatsächlich zu uns tendieren; mit Geduld und Feingefühl auf ihre Kritik, ihre Zweifel und Schwankungen reagieren; ihre Entwicklung in Richtung auf den Marxismus unterstützen; keine Angst vor ihren Launen, Drohungen und Ultimaten haben (Zentristen sind immer launisch und mimosenhaft); ihnen keinerlei prinzipielle Zugeständnisse machen;
i) und, noch einmal sei es gesagt, nicht scheuen, auszusprechen, was ist.“ (19)
Entrismus, Fraktionsarbeit, organisatorischer Anschluss
Die Frage revolutionärer Taktik, der Schwerpunkte für den Aufbau, ist notwendigerweise immer mit einer Einschätzung verbunden, wo sich zu einem bestimmten konkreten Zeitpunkt die wichtigsten politischen Veränderungen in der Avantgarde der Klasse bemerkbar machen.
Unter bestimmten Umständen kann sich eine solche Krise innerhalb bestehender politischer Parteien der Klasse ausdrücken oder in Neuformierungen. Die Voraussetzung dafür ist in der Regel eine politische Erschütterung (Krise, Entwicklung der Reaktion, historischer Angriff, Revolten …), die den tradierten Führungen und Organisationen nicht mehr erlaubt, so weiterzumachen wie bisher. Oft sind Niederlagen oder drohende Niederlagen Katalysatoren für solche Entwicklungen. So waren sicher der Sieg des Faschismus in Deutschland und der Bürgerkrieg in Österreich 1934 neben der innenpolitischen Lage in Frankreich maßgeblich dafür verantwortlich, dass die Bedingungen für den Entrismus in die dortige Sozialdemokratie, die SFIO, entstanden, das „klassische Modell“ für Entrismus.
Es ist jedoch wichtig anzumerken, dass der Entrismus – also der Eintritt einer gesamten Organisation in eine bestehende Partei – keine „Neuerfindung“ des Trotzkismus ist.
Schon Marx und Engels hatten erkannt, dass KommunistInnen unter Umständen auch in nicht-revolutionären oder sogar in nicht-proletarischen Parteien arbeiten können, um so überhaupt erst die Grundlagen zur organisatorischen Formierung des Kommunismus, zur Gewinnung erster MitstreiterInnen zu legen.
In etlichen asiatischen Ländern entstanden die Kommunistischen Parteien aus ideologischen und organisatorischen Absetz- und Abspaltungsbewegungen aus bürgerlich-nationalistischen Parteien (China) oder gar aus islamistischen Parteien (Indonesien).
Lenin hatte der britischen KP in seiner Schrift „Der linke Radikalismus“ nachdrücklich die Unterstützung von Labour-KandidatInnen bei Wahlen empfohlen. Im Jahr 1920 und auf dem Gründungskongress der Kommunistischen Internationale spricht er sich darüber hinaus ausdrücklich für den organisatorischen Anschluss an die Labour Party an. Labour hatte damals noch einen relativ föderalen Charakter, der auch den Beitritt von Organisationen ermöglichte (nicht ganz unähnlich wie Syriza bis 2013). Er trat dafür ein, dass sich die KP als Organisation anschließen solle, also nicht „nur“ die Mitglieder individuell beitreten sollten. So sollte die kleine Kommunistische Partei nicht nur näher an die damals wachsende Labour Party und deren ArbeiterInnenbasis herankommen, es sollte so auch vor den Augen der Massen der Anspruch der Labour Party einem Test unterzogen werden, die gesamte ArbeiterInnenklasse zu repräsentieren: „Diese Partei erlaubt angegliederten Organisationen gegenwärtig die Freiheit der Kritik und die Freiheit von propagandistischen, agitatorischen und organisatorischen Aktivitäten für die Diktatur des Proletariats, solange die Partei ihren Charakter als Bund aller Gewerkschaftsorganisationen der Arbeiterklasse bewahrt.” (20) Solche Kompromisse oder Zugeständnisse, hauptsächlich in Wahlangelegenheiten, sollten die Kommunisten eingehen wegen „der Möglichkeit des Einflusses auf breiteste Arbeitermassen, der Entlarvung der opportunistischen Führer von einer höheren und für die Massen besser sichtbaren Plattform aus und wegen der Möglichkeit, den Übergang der politischen Macht von den direkten Repräsentanten der Bourgeoisie auf die ‚Labour-Leutnants‘ der Kapitalistenklasse zu beschleunigen, damit die Massen schneller von ihren gröbsten Illusionen im Bezug auf die Führung befreit werden.“ (21)
Diese Zitate zeigen die Ähnlichkeit in der methodischen Herangehensweise zur Entrismustaktik, wie sie von Trotzki in den 1930er Jahren entwickelt und in etlichen Ländern zu verschiedenen Perioden angewandt wurde.
Von 1934 an entwickelte Trotzki eine Taktik, die den völligen Eintritt der französischen Bolschewiki-Leninisten (wie die TrotzkistInnen sich damals nannten) in sozialdemokratische und zentristische Parteien zum Inhalt hatte. Trotzki verstand diese Taktik nicht als langfristig, geschweige denn als einen strategischen Versuch zur Umwandlung der Sozialdemokratien in für die soziale Revolution geeignete Instrumente. Aber er erkannte, dass die fortgeschrittensten ArbeiterInnen angesichts der drohenden faschistischen Gefahr nicht nur die Einheitsfront mit der KPF forderten, sondern dass die SFIO nach dem Bruch mit ihrem rechten Flügel und unter dem Druck der Ereignisse auch zum Attraktionspol für die Klasse und deren Avantgarde wurde. Hinzu kam, dass sich auch die KPF nicht mehr länger der Einheitsfront entziehen konnte, einen Schwenk weg von der „Dritten Periode“ machte (allerdings auch den Übergang zur Volksfront vorbereitete). Trotzki machte nicht nur auf die Möglichkeiten dieser Lage aufmerksam, er erkannte auch die Gefahr für die französische Sektion, nämlich praktisch von der Bildung eine Einheitsfront gegen die Rechte und den politischen Debatten in der Klasse ausgeschlossen zu werden.
„Die innere Situation (der SFIO) schafft die Möglichkeit eines Eintritts mit unserem eigenen Banner. Die Modalitäten entsprechen unseren selbstgesteckten Zielen. Wir müssen nun so handeln, dass unsere Erklärung keinesfalls den führenden bürgerlichen Flügel stärkt, sondern stattdessen den fortschrittlichen proletarischen Flügel, und dass Text und Verbreitung unserer Erklärung es uns erlauben, erhobenen Hauptes im Falle ihrer Annahme, wie auch im Falle von Hinhaltemanövern oder der Ablehnung zu bleiben. Eine Auflösung unserer Organisation kommt nicht in Frage. Wir treten als bolschewistisch-leninistische Fraktion ein; unsere organisatorischen Bindungen bleiben wie bisher, unsere Presse besteht weiter neben ‚Bataille Socialiste‘ und anderen.“ (22)
Die Taktik brachte etliche Probleme mit sich. Ein Teil der Sektion verweigerte zu Beginn den Eintritt, um dann, als er mehr und mehr in die Selbstisolation geriet, nachzufolgen. Das änderte nichts an den großen Gewinnen, die die Bolschewiki-Leninisten hatten, v.a. unter der Jugend. Aber der Erfolg führte auch dazu, dass ein Teil der Sektion die Prinzipien über Bord warf und den Entrismus als langfristige Taktik aufzufassen begann, die Kritik an der Parteiführung und v.a. an der versöhnlerischen Haltung der Zentristen in der SFIO abschwächte. Es kam daher um die Frage des Austritts zur Spaltung der Sektion und einer längeren Krise. All das führte Trotzki dazu, die „Lehren des Entrismus“ folgendermaßen zusammenzufassen:
„1.) Der Entrismus in eine reformistische oder zentristische Partei ist an sich keine langfristige Perspektive. Es ist nur ein Stadium, das unter Umständen sogar auf eine Episode verkürzt sein kann.
2.) Die Krise und die Kriegsgefahr haben eine doppelte Wirkung. Zunächst schaffen sie Bedingungen, unter denen der Entrismus allgemein möglich wird. Aber andererseits zwingen sie den herrschenden Apparat auch, zum Mittel des Ausschlusses von revolutionären Elementen zu greifen.
3.) Man muss den entscheidenden Angriff der Bürokratie frühzeitig erkennen und sich dagegen verteidigen, nicht durch Zugeständnisse, Anpassung oder Versteckspiel, sondern durch eine revolutionäre Offensive.
4.) Das oben Gesagte schließt nicht die Aufgabe der „Anpassung“ an die Arbeiter in den reformistischen Parteien aus, indem man ihnen neue Ideen in einer für sie verständlichen Sprache vermittelt. Im Gegenteil, diese Kunst muss so schnell wie möglich erlernt werden. Aber man darf nicht unter dem Vorwand, die Basis erreichen zu wollen, den führenden Zentristen bzw. Linkszentristen Zugeständnisse machen.
5.) Die größte Aufmerksamkeit ist der Jugend zu widmen.
6.) (…) fester ideologischer Zusammenhalt und Klarsicht im Hinblick auf unsere ganze internationale Erfahrung sind notwendig.“ (23)
Die Entrismustaktik war keineswegs nur auf Frankreich beschränkt, sondern wurde in etlichen Ländern ausgeführt: In Britannien in die „Independent Labour Party“ (1933-36) und später in die Labour Party, in die Socialist Party in den USA (1936/37) unter sehr schwierigen Bedingungen des Fraktionsverbotes, in die belgische Arbeiterpartei oder in die POUM in Spanien.
Neben dem Eintritt in zentristische oder reformistische Parteien sprach sich Trotzki außerdem auch für die Fraktionsarbeit in den linken Flügeln von bürgerlichen Parteien aus. So forderte er in „India faced with imperialist war“ die Arbeit in der Congress Socialist Party, dem linken Flügel der Kongresspartei, der damals von Jawaharlal Nehru und Chandra Bose geführt wurde.
„Anders als selbst-gefällige Sektierer müssen die revolutionären Marxisten aktiv an der Arbeit der Gewerkschaften, der Bildungsvereinigungen, der Congress Socialist Party und grundsätzlich in allen Massenorganisationen teilnehmen.“ (24)
Propagandagesellschaft und Avantgarde
Trotzki schlägt hier die Arbeit in einer Fraktion einer bürgerlich-nationalistischen Partei vor. Auf den ersten Blick scheint das – so argumentierten Sektierer damals wie heute – „prinzipienlos“. RevolutionärInnen würden, so argumentierten z.B. viele gegen den Entrismus in die SFIO, ihre organisatorische Unabhängigkeit aufgeben. Trotzki antwortete damals folgendermaßen:
„Für formalistische Köpfe schien es in absolutem Widerspruch zu stehen. für eine neue Internationale und neue nationale revolutionäre Parteien aufzurufen und in Verletzung des Prinzips, dass eine revolutionäre Partei ihre Unabhängigkeit aufrecht erhalten müsse; manche betrachteten es als einen Verrat an den Prinzipien, andere argumentierten taktisch dagegen. […] Unabhängigkeit war ein Prinzip für revolutionäre Parteien, aber dieses Prinzip konnte nicht für kleine Gruppen gelten. […] Es bedurfte taktischer Flexibilität, um Gebrauch von den hervorragenden Bedingungen zu machen und aus der Isolation herauszubrechen.“ (25)
Vor ähnlichen Bedingungen stehen wir auch heute und werden wir in der kommenden Periode immer wieder stehen. Die Notwendigkeit von Taktiken wie Entrismus, Fraktionsarbeit, organisatorische Angliederung folgen im Grunde immer daraus, dass die kommunistische Organisation noch keine Partei ist, dass sie nur als ideologische Strömung oder als kämpfende Propagandagruppe existiert. Einer solchen Gruppierung ist es unmöglich, sich direkt an die Masse des Proletariats zu wenden, ja die meisten von ihnen, die nur hunderte Mitglieder zählen, können nur kleine Teile der Avantgarde der Klasse erreichen.
Die Avantgarde der Klasse ist dabei – solange es keine Kommunistische Partei gibt – selbst nur bedingt Avantgarde, sprich sie ist nicht zu einer Partei formiert, die die politisch bewusstesten Teile der Klasse auf Basis eines wissenschaftlichen, kommunistischen Programms organisiert. Es gibt keine kommunistische Avantgarde im Sinne des Marxismus, wie sie im Kommunistischen Manifest bestimmt ist – also jene proletarische Partei, die sich durch ihr Bewusstsein der allgemeinen Interessen, Aufgaben, Ziele und des Werdegangs der proletarischen Bewegung auszeichnet, die als Stratege der Klasse handeln und diese führen kann.
In diesem Sinn gibt es heute auf der ganzen Welt keine oder nur eine auf kleine Gruppen reduzierte proletarische Avantgarde. Aber im weiteren Sinne gibt es natürlich eine Avantgarde der Klasse, so wie sich in jedem Kampf, in jeder Auseinandersetzung fortgeschrittenere und rückständigere Teile formieren.
Über Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich die Avantgarde der Klasse in Teilen der Gewerkschaften – oft in starken Industriegewerkschaften wie den AutoarbeiterInnen in Deutschland oder bis in die 80er Jahre die Bergarbeiter in Britannien – formiert. Diese „ökonomische Avantgarde“ hat sich in den letzten Jahren natürlich auch verändert. Entscheidend für uns ist dabei, dass die Führung, größere Militanz in einzelnen Kämpfen diese noch nicht zur Avantgarde für eine ganze Klasse macht. Ein solches Verhältnis wird über längere politische Entwicklungen etabliert und wirkt dann nicht nur im Sinne einer kämpferischen Vorhut, sondern kann auch in die gegenteilige Richtung ausschlagen. So kann z.B. die geringe Aktivität der etablierten Avantgarde den Effekt haben, dass auch die anderen Sektoren der Klasse für eine ganze Periode relativ wenige Kämpfe führen. Eine solche negative Rolle spielte z.B. die IG Metall mit dem „Bündnis für Arbeit“ und v.a. seit dem Ausverkauf des Streiks für die 35-Stunden-Woche im Osten.
Die „wirtschaftliche“ Avantgarde ist oft eng verbunden mit einer bestimmten politischen Strömung in der Klasse. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben diese Rollen sozialdemokratische und stalinistische Parteien für sich monopolisiert. In manchen Ländern gab es nicht einmal solche reformistischen Parteien, hier bildete sich über die ökonomische Sphäre hinaus gar keine Avantgarde. Allenfalls fand sich dies in Strömungen des kämpferischen Syndikalismus oder in kleinen reformistischen Strömungen (einschließlich solcher, die auch in populistischen Parteien anzutreffen sein können).
Die Krise des Reformismus hat dazu geführt, dass die Bindung der kämpferischeren Schichten in den Gewerkschaften schwächer wurde, dass es oft v.a. die politische Tradition und der Apparat sind, die diese Bindung noch herstellen und reproduzieren. Ganz offenkundig hat diese Entwicklung auch die Form angenommen, dass links-reformistische Parteien Teile der Avantgarde der Klasse organisieren oder anziehen. In Ländern wie Griechenland repräsentiert Syriza einen wichtigen Teil der Avantgarde (neben der KKE).
Diese Entwicklung macht Trotzkis Bemerkungen zum Verhältnis von Klassenbewegung, Parteikeim und „Unabhängigkeit“ heute brandaktuell. RevolutionärInnen, die diesen Veränderungen in der Klasse keine Aufmerksamkeit schenken und die Notwendigkeit einer Intervention negieren oder herabspielen, sind keine. Sie sind letztlich eine Mischung aus Sektierern und Ökonomisten.
ArbeiterInnenparteitaktik
Das trifft auch auf die Frage der ArbeiterInnenparteitaktik zu. Ursprünglich wurde diese von Trotzki für die USA mit einigem Zögern entwickelt, da er eine opportunistische Anwendung dieser Taktik fürchtete. Trotzki befürchtete, dass diese als Forderung nach einer reformistischen, nicht-revolutionären Partei interpretiert werden könne oder gar nach einer klassenübergreifenden Partei wie der politisch falschen Losung der „Arbeiter- und Bauernpartei“.
Die Entwicklung in den 30er Jahren zeigt andererseits nicht nur verschiedene Initiativen zur Schaffung einer ArbeiterInnenpartei in den USA im Gefolge des Wachsens der ArbeiterInnenbewegung. Die Losung hat auch einen enormen Wert, um die Klasse und die Gewerkschaften aus der Bindung an eine offen bürgerliche Partei (sei sie nun demokratisch, liberal, populistisch oder nationalistisch) zu lösen.
1938 kam er schließlich zu den entscheidenden, methodischen Schlussfolgerungen:
„a) Revolutionäre müssen es ablehnen, die Forderung nach einer unabhängigen, auf die Gewerkschaften gestützten Partei und die begleitende Forderung an die Bürokratie, mit der Bourgeoisie zu brechen, mit der Forderung nach einer reformistischen Labor Party zu identifizieren.
b) Das Übergangsprogramm als Programm für die Labor Party ist das Kampfmittel zur Gewährleistung einer revolutionären Entwicklung.
c) Für den unvermeidlichen Kampf mit der Bürokratie muss eine revolutionäre Organisation auch innerhalb der Bewegung für eine Labor Party aufrechterhalten werden.
d) Perioden der Wirtschaftskrise und des sich verschärfenden Klassenkampfes sind am günstigsten für die Aufstellung der Losung einer Labor Party. Aber selbst in ‚ruhigen‘ Zeiten behält die Losung einen propagandistischen Wert und kann in lokalen Situationen oder bei Wahlen auch agitatorisch gehandhabt werden. Revolutionäre würden z.B. von den Gewerkschaften statt der Wahlunterstützung für einen demokratischen Kandidaten die Aufstellung eines unabhängigen Kandidaten der Arbeiterklasse fordern.
e) Keineswegs ist eine Labor Party, die natürlich weniger darstellt als eine revolutionäre Partei, eine notwendige Entwicklungsstufe für die Arbeiterklasse in Ländern ohne Arbeiterparteien.
f) Noch einmal sei daran erinnert: Das Programm hat Vorrang.” (26)
In der gegenwärtigen Periode hat die Losung der ArbeiterInnenpartei in vielen Ländern auch heute eine enorme Bedeutung. Wo sie angemessen ist, sollten RevolutionärInnen diese aktiv propagieren und von Beginn an dafür kämpfen, dass diese Partei eine revolutionäre wird und ein Aktionsprogramm als deren Basis vorschlagen. Sie dürfen das aber keinesfalls zur Bedingung ihrer Teilnahme am Kampf für eine solche Partei machen. Dies wäre ein sektiererischer Fehler, der im Grunde die ganze Taktik, also eine Form der Einheitsfront gegenüber anderen, nicht-revolutionären Teilen der Klasse, v.a. gegenüber den Gewerkschaften, zunichtemachen würde.
Die Rechtsentwicklung der Sozialdemokratie oder stalinistischer Parteien hat heute in einigen Ländern die Möglichkeit geschaffen, dass die ArbeiterInnenparteitaktik auch angewandt werden kann, wenn es schon eine etablierte, reformistische Partei gibt (z.B. in Deutschland bei Formierung der WASG).
F Schlussfolgerungen
Dieser kurze Überblick über Taktiken der kommunistischen Bewegung zeigt, wie fruchtbringend sie heute auch für die Intervention in die Neuformierung der ArbeiterInnenklasse sind.
Natürlich erschöpft sich die Frage der Neuformierung nicht auf die Frage der politischen Organisation, auf Taktiken im Parteiaufbau. Zweifellos muss jede kommunistische Organisation, jede Organisation, die eine neue anti-kapitalistische Kraft in der Klasse werden will, darauf aber grundlegende Antworten und Vorschläge liefern.
In den Gewerkschaften und auf betrieblicher Ebene stehen heute zweifellos der Kampf gegen jede Einschränkung der Organisationsfreiheit und des Streikrechts, der Kampf für demokratische, klassenkämpferische Gewerkschaften, strukturiert nach Branchen und Wertschöpfungsketten im Zentrum.
Für eine solche Politik braucht es nicht nur die organisierte revolutionäre Tätigkeit (revolutionärer Gewerkschaftsfraktionen und Betriebsgruppen), sondern auch die Sammlung aller anti-bürokratischen, klassenkämpferischen Kräfte, die Schaffung einer Basisbewegung, die für eine klassenkämpferische Führung kämpft.
Auf der Ebene des Abwehrkampfes treten wir für die Bildung von Aktionskomitees in Betrieben, Schulen, Unis, den Stadtteilen und Kommunen ein, die nach den Grundsätzen der ArbeiterInnendemokratie organisiert sein sollen. Sie sollen auf Massenversammlungen von ihrer Basis gewählt, dieser gegenüber rechenschaftspflichtig und von ihr abwählbar sein.
Der Klassenkampf erfordert heute intensive internationale Zusammenarbeit, d.h. es geht darum, dass wir auch internationale Koordinierungen schaffen, die real Aktionen verabreden und gemeinsam durchführen, sei es gegen imperialistische Interventionen, gegen soziale Angriffe oder rassistische Abschottung.
So wie wir in den Gewerkschaften und Betrieben die existierenden Organisationsformen umkrempeln müssen, so wirft die Krise neben der Frage von Einheitsfronten gegen Rassismus und Faschismus, Angriffe auf demokratische Rechte auch die Frage nach Massenbewegungen der gesellschaftlich Unterdrückten auf. Das betrifft v.a. den Kampf für eine revolutionäre Jugend- und eine proletarische Frauenbewegung.
All diese Kampfbereiche, alle politischen und organisatorischen Antworten zur Reorganisation und Revolutionierung der ArbeiterInnenklasse sind ein unverzichtbarer Bestandteil kommunistischer Aktivität.
Aber es gibt einen Grund, warum wir die Frage der politischen Neuformierung der Klasse ins Zentrum unserer Überlegungen rücken. Das größte Problem der Menschheit ist die Krise der proletarischen Führung, das Fehlen einer genuin kommunistischen Partei und erst recht einer solchen Internationale – und das in einer Periode, die objektiv die Alternative „Imperialistische Barbarei oder Sozialismus“ aufwirft.
Natürlich gibt es auch ohne revolutionäre Partei revolutionäre Krisen, Situationen, ja auch Revolutionen – aber keine siegreichen. Ohne revolutionäre Führung bleiben sie auf halbem Wege stecken und enden, wie die Arabische Revolution gerade zeigt, früher oder später unvermeidlich mit dem Sieg der Konterrevolution.
Natürlich werden in den aktuellen Kämpfen und erst recht in vor-revolutionären oder revolutionären Krisen neue Schichten aktiviert und politisiert. Das trifft sicher auch auf die Arabischen Revolutionen, auf den kurdischen Kampf, auf Griechenland oder die Ost-Ukraine, auf China oder Lateinamerika zu. Aber allein aus diesen Kämpfen entwickelt sich keinesfalls spontan eine politische Alternative oder gar eine bewusste revolutionäre Kraft.
Das Hauptfeld der Auseinandersetzung um die Lösung der Führungskrise der Klasse bilden die politischen Neuformierungsprozesse. Aus den ökonomischen und sozialen Kämpfen, aus Bewegungen kann nur ein Impuls zur Suche nach einer politischen Alternative entstehen, die Notwendigkeit bewusst werden – und zwar nicht als direkte „Verlängerung“ dieser Kämpfe, sondern aufgrund der Schranken, auf die sie in ihrer eigenen Entwicklung gestoßen werden.
Bei all ihren Mängeln, bei aller notwendigen Kritik an den (neo)reformistischen, klein-bürgerlichen oder zentristischen Fehlern, findet dort die Auseinandersetzung um die politische Neuformierung der Klasse statt. Hier werden die Kämpfe um die zukünftige politische Ausrichtung, Strategie und Taktik, um die Programmatik der Klasse ausgefochten. Die Reformisten versuchen natürlich, dem Ganzen einen bürgerlichen Charakter zu geben bzw. die bestehende politische Dominanz bürgerlicher Ideen und Programme, wenn auch vielleicht in neuer Form zu verteidigen.
Ob es sich nun um eine „Neuformierung“ der anti-kapitalistischen Linken, einen Kampf in der Labour Party oder den Bruch in einer Partei wie Syriza handelt – auf jeden Fall bilden diese Formationen den Rahmen für einen politischen und ideologischen Klassenkampf, dessen Ausgang entscheidend für die Bewusstseinsentwicklung der ArbeiterInnenklasse sein wird.
So wie sich von Land zu Land die Form dieser Entwicklung unterschiedlich gestaltet, so werden unterschiedliche Taktiken (Blocktaktik, Entrismus, ArbeiterInnenpar-teitaktik) oder auch eine Kombination dieser Taktiken notwendig sein, um möglichst effektiv in diese Auseinandersetzung eingreifen zu können. Mögen die Taktiken auch unterschieden sein – das aktive, offensive Eingreifen ist eine strategische Notwendigkeit zur Überwindung der Führungskrise des Proletariats.
Die Fetischisierung einzelner Formen oder gar das Fernbleiben vom politischen Kampf in Massenparteien oder „Umgruppierungsprojekten“ mit der Begründung, dass diese ja reformistisch wären, hat nichts mit dem „Kampf gegen den Reformismus und Zentrismus“ zu tun, sondern bedeutet nur, ihm das Feld zu überlassen. Natürlich werden angesichts des aktuellen Kräfteverhältnisses die meisten dieser „Neuformierungen“ und auch die meisten der Projekte zur „revolutionären Einheit“ mit dem Sieg der Reformisten oder Zentristen oder gar von Populisten wie bei Podemos enden. Ihr Potential mag dann rasch erschöpft sein.
Freilich, den Kampf um eine revolutionäre Ausrichtung mit dem Argument abzulehnen, dass er wahrscheinlich ohnedies nicht gewonnen wird, ist der Realismus des Vorweg-Kapitulanten.
Als Liga für die Fünfte Internationale haben wir uns dazu entschieden, dass unsere Sektionen aktiv an den Umgruppierungen der Klasse teilnehmen, weil sich, unabhängig vom konkreten Ausgang dieses oder jenes Projekts, sich in diesen politischen und ideologischen Kämpfen die Kader einer zukünftigen kommunistischen Bewegung bewähren müssen, lernen können und müssen, ihre Politik und ihr Programm auf der Höhe der Zeit zu vertreten.
Endnoten
(1) Siehe: Revolutionärer Marxismus 39, Finanzmarktkrise und fallende Profitraten. Beiträge zur marxistischen Imperialismus- und Krisentheorie, Berlin 2008; Markus Lehner, Finanzmarktkrise – Rückblick und Ausblick, in: Revolutionärer Marxismus 41, Berlin 2010, S. 5 – 42, Markus Lehner/Peter Main, Schwache Erholung, massive Aggression, kommende Krise, in: Revolutionärer Marxismus 46, Berlin 2014, S. 214 – 227
(2) Tobi Hansen, Sparpakete, Krise, Widerstand: Welche Perspektive für das EU-Projekt, in: Revolutionärer Marxismus 46, S. 87 – 113; Tobi Hansen, Dritter Anlauf um den Platz an der Sonne, in: Revolutionärer Marxismus 47, S. 56
(3) Unter degenerierten ArbeiterInnenstaaten verstehen im Anschluss an Leo Trotzkis Analyse der Sowjetunion und des Stalinismus Staaten, wo zwar das Kapital enteignet und die Herrschaft der Kapitalistenklasse gebrochen wurde, die politische Macht jedoch nicht von der ArbeiterInnenklasse ausgeübt, sondern von einer bürokratischen Kaste usurpiert wurde. Mehr zu unserer Analyse siehe unsere Broschüre: Gruppe Arbeitermacht, Aufstieg und Fall des Stalinismus, 2009 (http://www.arbeitermacht.de/broschueren/stalinismus/vorwort.htm). Umfassender und ausführlicher: Workers Power, The Degenerated Revolution. The Rise and Fall of the Stalinist States, London 2012
(4) Frederik Haber, Die Auferstehung des russischen Imperialismus, in: Revolutionärer Marxismus 46, S. 114 – 143
(5) OECD, World Economic Report 2014
(6) ILO, World of Work Report 2014, S. 2
(7) Ebenda, S. 6
(8) Marx, Manifest der Kommunistischen Partei, MEW 4, S. 473
(9) Friedrich Engels, England 1845 und 1885, in: MEW 21, S. 191 – 198
(10) Lenin, Der Imperialismus und die Spaltung der Sozialdemokratie, in LW 23, S. 113
(11) de.worker-participation.eu/Nationale-Arbeitsbeziehungen/Quer-durch-Europa/Gewerkschaften#note1
(12) Trotzki, Die Gewerkschaften in der Epoche des imperialistischen Niedergangs, Intarlit, Dortmund 1977, S. 36
(13) Labour Qaumi Movement (LQM) ist eine Gewerkschaft von Webern in Pakistan, die noch unter der Diktatur Musharaffs gegründet wurde und heute rund 45.000 Arbeiter, v.a. in Faisalabad, einem Zentrum der Textilindustrie des Landes, organisiert. Siehe dazu auch: Martin Suchanek, LQM – eine etwas andere Gewerkschaft, http://www.arbeitermacht.de/ni/ni189/lqm.htm
(14) Zur ausführlichen Darstellung siehe die Broschüre: Gruppe Arbeitermacht, Der letzte macht das Licht aus, http://www.arbeitermacht.de/broschueren/vs/index.htm
(15) Zur Gründung der NPA und zur Kritik ihres provisorischen Programms siehe: Dave Stockton, The New Anticapitalist Party in France: a historic opportunity, in: Fifth International Vol. 3, Issue 2, London 2009
(16) Zur Kritik des Programms der FIT siehe: Christian Gebhardt, Wie weiter für die radikale Linke in Argentinien? http://www.arbeitermacht.de/infomail/711/argentinien.htm
(17) Zur Darstellung der Entrismustaktik, der ArbeiterInnenparteitaktik und der Taktik des organisatorischen Anschlusses siehe: Thesen zum Reformismus, in: Revolutionärer Marxismus 44, S. 107 – 181; zur Entrismustaktik: Dave Stockton, Turn to the Masses, in: Trotskyist International 24, 1998, Seite 32 – 46, zur Blocktaktik: Dave Stockton, Trotsky and revolutionary unity: The fight for the Fourth International, http://www.fifthinternational.org/content/trotsky-and-revolutionary-unity-fight-fourth-international
(18) Trotzki, Die Erklärung der Vier, in: Trotzki, Schriften Band 3.3., Linke Opposition und IV. Internationale 1928-1934, S. 460
(19) Trotzki, Der Zentrismus und die IV. Internationale, in: Schriften 3.3., Linke Opposition und IV. Internationale 1928-1934, S. 530
(20) Lenin, Collected Works, Bd. 31, S. 199
(21) Ebenda
(22) Trotzki, Writings, Supplement 1934-40, S. 494
(23) Trotzki, Crisis of the French Section, (Die Krise der französischen Sektion), New York 1977, S. 125/126
(24) Trotzki, Writings 1939-40, S. 34
(25) Vorwort aus Leo Trotzkis „Crisis of the French Section“ (Die Krise der französischen Sektion), New York 1977, S. 20
(26) Bewegung für eine revolutionär-kommunistische Internationale (Vorläuferorganisation der Liga für die Fünfte Internationale), Thesen zum Reformismus, in: Revolutionärer Marxismus 44, S. 176