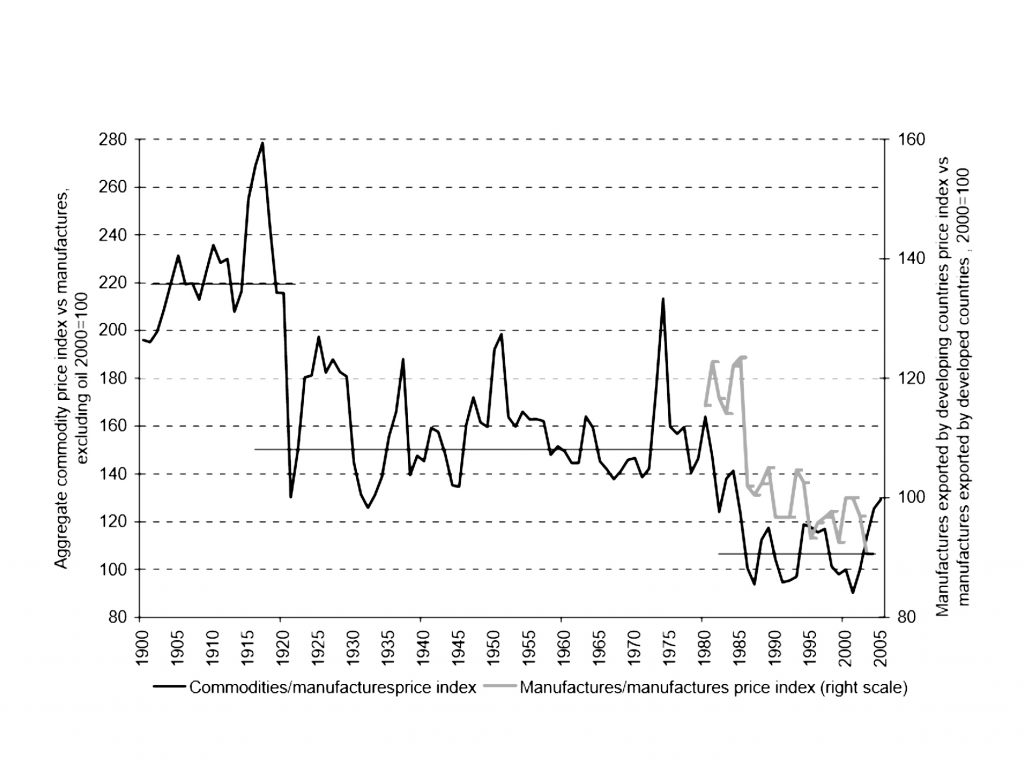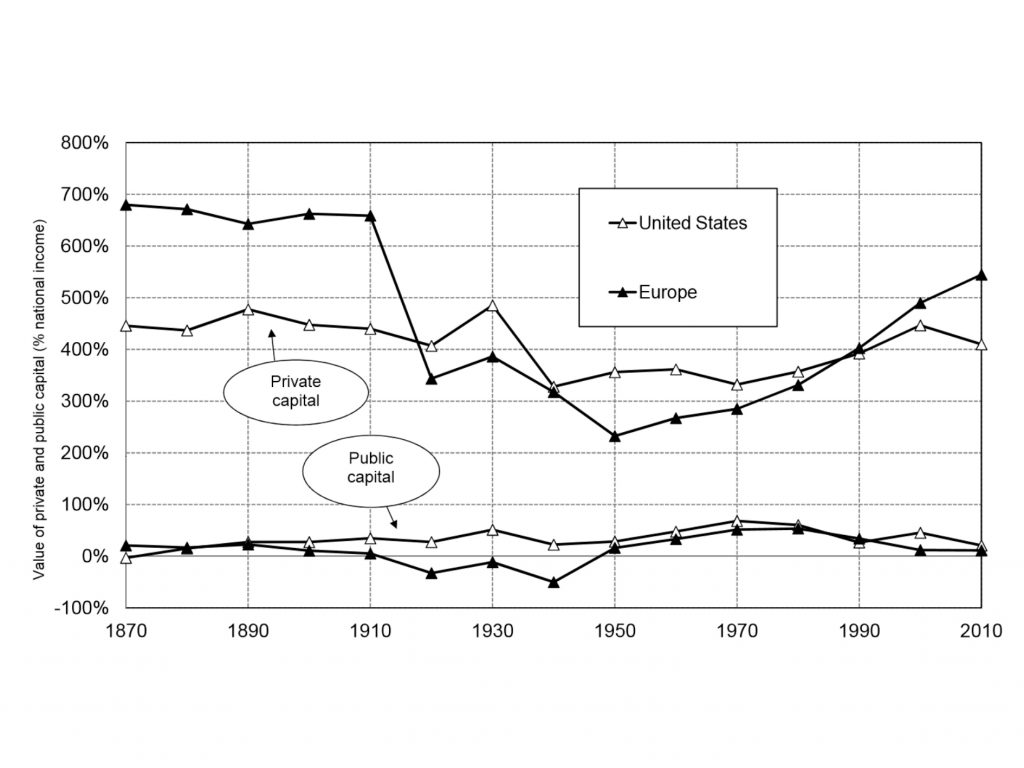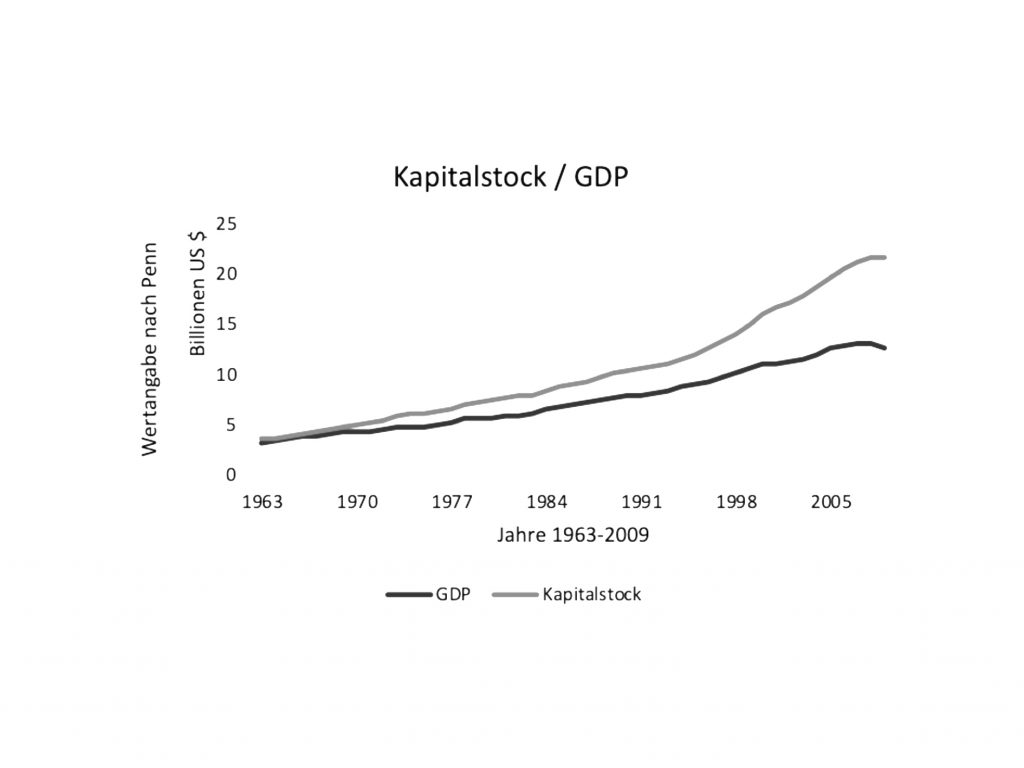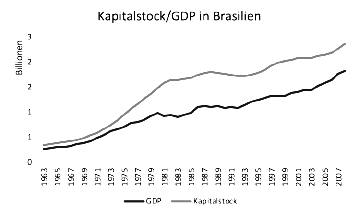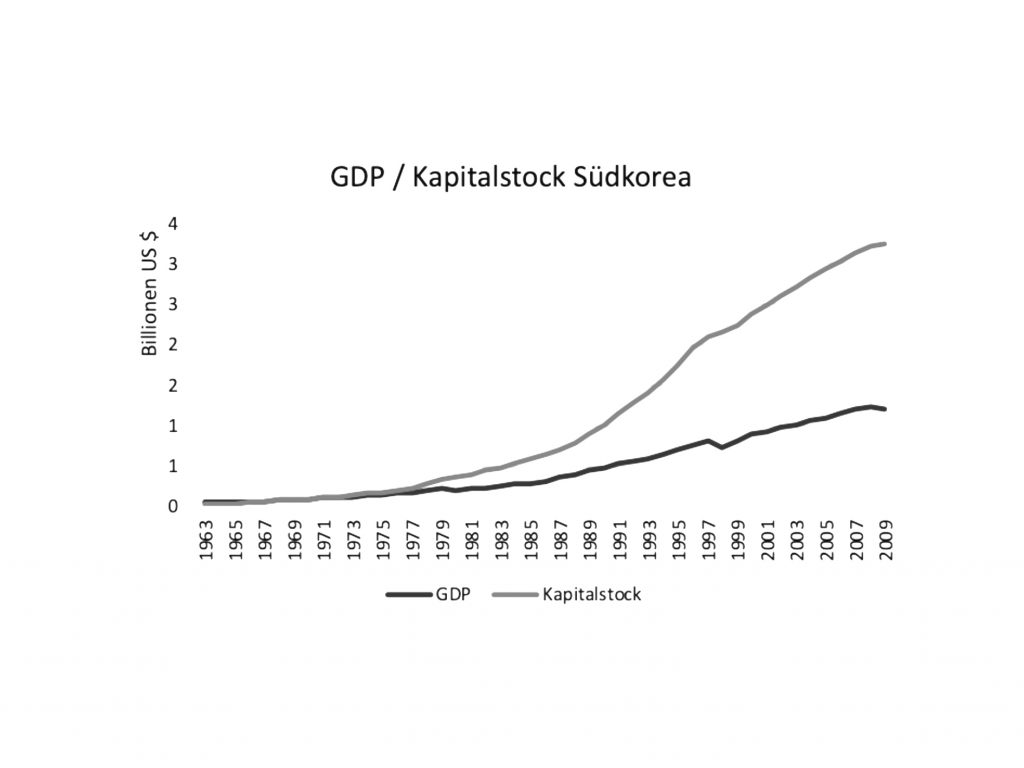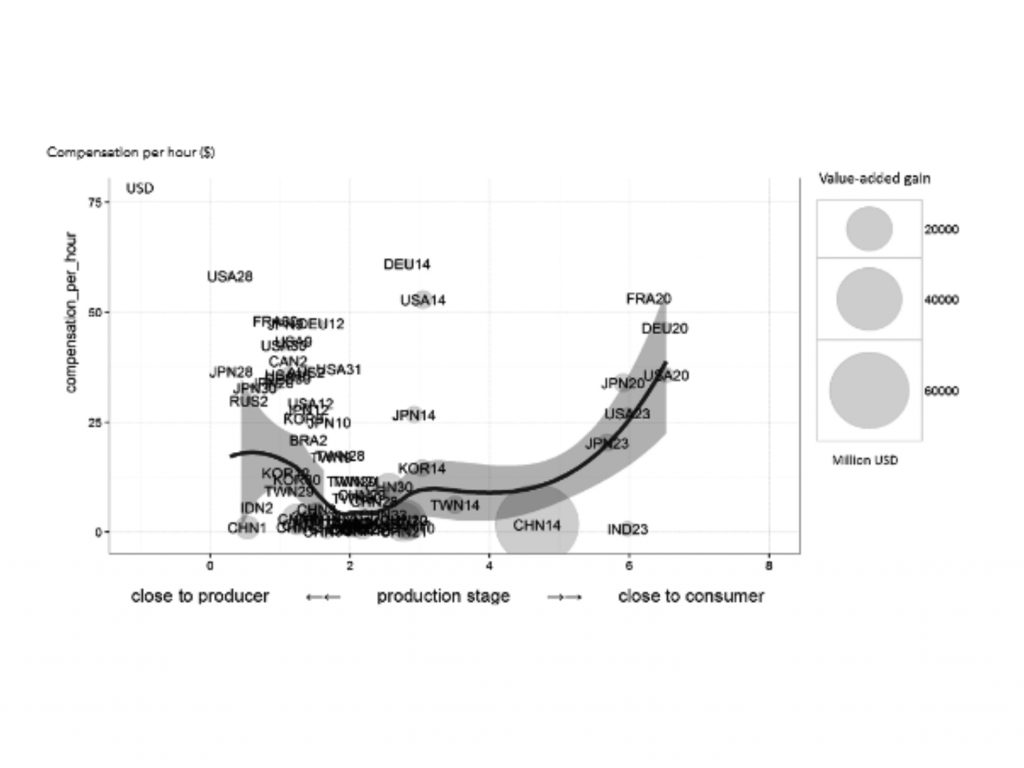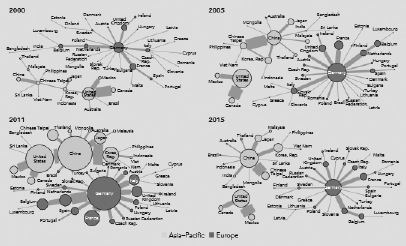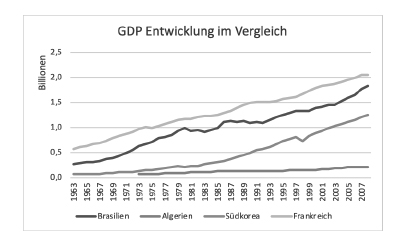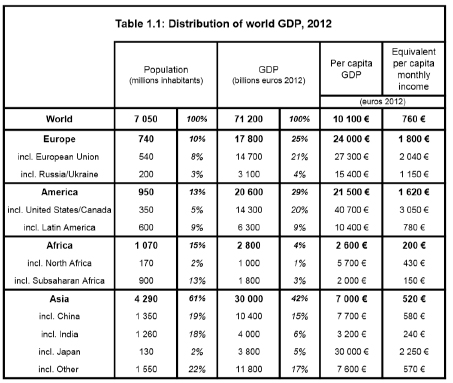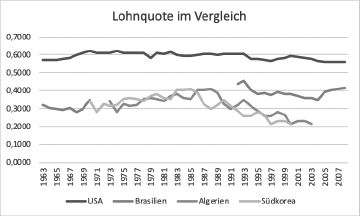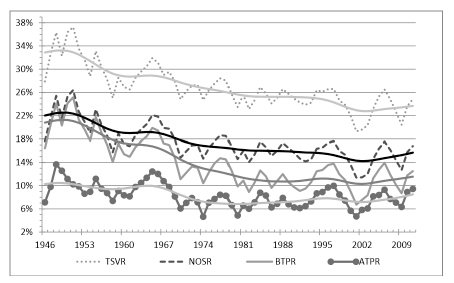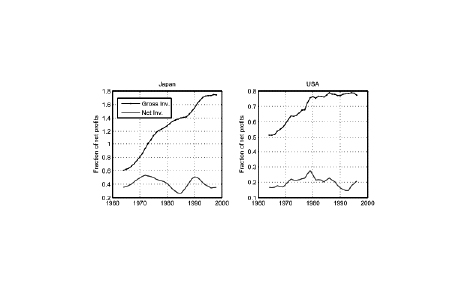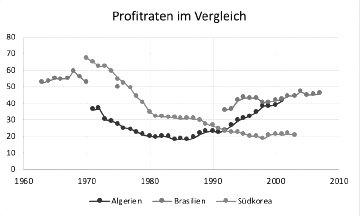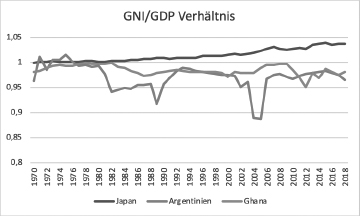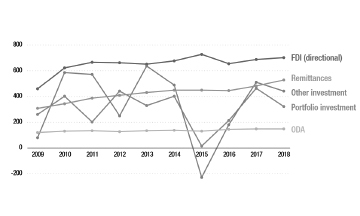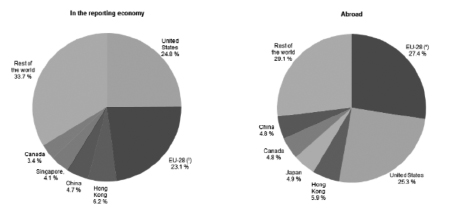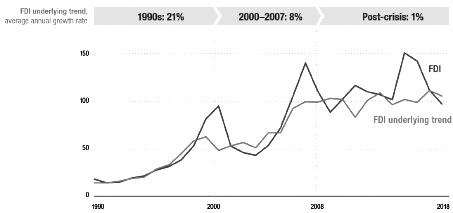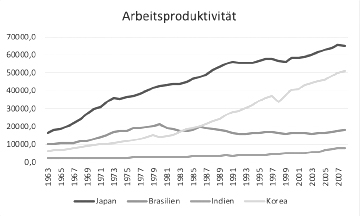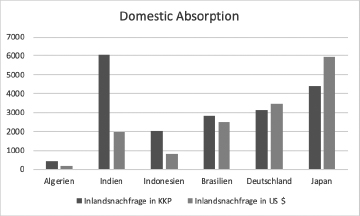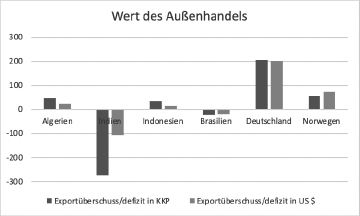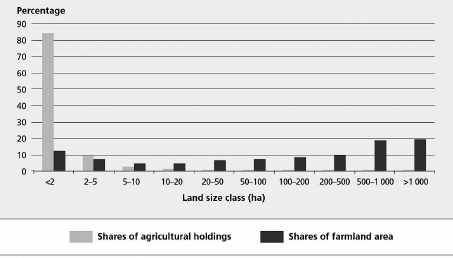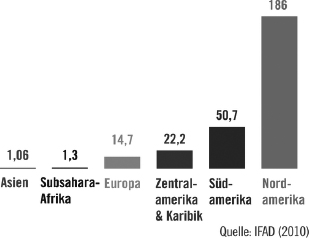Martin Suchanek, Revolutionäre Marxismus 53, November 2020
1. Einleitung
Der Begriff Imperialismus ist wieder modern geworden. Nach dem Zusammenbruch des Stalinismus und der Restauration des Kapitalismus in den ehemaligen degenerierten ArbeiterInnenstaaten [i], mit dem Beginn der Globalisierung und dem scheinbar endgültigen, wenn auch kurzlebigen Triumph der Bourgeoisie schien er in der Öffentlichkeit marginalisiert. Die Möchtegern-ChefideologInnen des Weltkapitalismus schwärmten vom „Ende der Geschichte“ [ii], proklamierten naiv wie seit über einem Jahrhundert nicht mehr den angeblich endgültigen Triumph der liberalen Demokratie und der Marktwirtschaft. Nicht nur die reformistischen Führungen der ArbeiterInnenbewegung passten sich dem Zeitgeist an, sondern auch die „radikale“ Linke stimmte teils zähneknirschend, teils euphorisch in den Kanon ein.
In dieser Periode des scheinbar endgültigen Triumphs des Kapitalismus wirkten auch alle Theorien überholt, die von den inneren Widersprüchen dieser Produktionsweise ausgehen, die darauf pochen, dass dieses System auf der Ausbeutung der ArbeiterInnenklasse, der Aneignung der Reichtümer der sog. „Dritten Welt“ und der Natur beruht. Die bürgerliche Gesellschaft hätte in den Zeiten der kapitalistischen Globalisierung auch ihre inneren Krisen hinter sich gelassen, so jedenfalls die vorschnelle Hoffnung ihrer ApologetInnen bis hinein ins vormals linke Lager.
Der Sieg des Kapitalismus im Kalten Krieg manifestierte sich notwendigerweise auch als ideologischer. In den 1990er Jahren und am Beginn dieses Jahrhunderts schien also jede Theorie „veraltet“ und „überholt“, die von einer materialistischen Analyse des Kapitalismus als Klassengesellschaft und des Imperialismus als ökonomisch-politischer Ordnung ausging. Ihre Widerlegung bedurfte im journalistischen wie im bürgerlich-wissenschaftlichen Diskurs eigentlich keiner Argumente. Es reichte der Verweis auf die vordergründige „Macht des Faktischen“.
An die Stelle der Klassentheorie traten oft geradezu reaktionäre weltanschauliche und geistige Strömungen wie der Postmodernismus, die bis heute in der akademischen Welt, vor allem in den Sozial-, Geistes- und Kulturwissenschaften eine dominierende Rolle spielen. Auch wenn sich diese Strömungen oftmals als „links“ präsentieren und die Überwindung des angeblich überholten Gegensatzes von bürgerlicher Wissenschaft und marxistischer Theorie proklamieren, stellen sie ideologisch eine Kapitulation dar, eine Regression zum subjektiven Idealismus und Irrationalismus. Die verschiedenen Spielarten des Postmodernismus eint letztlich, dass sie jeden Versuch, die Entwicklungsdynamik einer Gesellschaftsformation, deren innere Triebkräfte, Widersprüche und Gesetzmäßigkeiten zu entschlüsseln, als bloß subjektives „Narrativ“, also bloße gedankliche Konstruktion verwerfen. Allein dieser Anspruch einer objektiven Fundierung linker Politik wird als Form der „Unterwerfung“ der Menschen unter eine „Konstruktion“ und als „Herrschaftsanspruch“ denunziert. Damit verwirft der Postmodernismus zugleich jeden Versuch, die Entwicklungsdynamik von Geschichte und Gesellschaft zu entschlüsseln, die der Menschheit bisher als blinde, außerhalb ihrer Kontrolle liegende Macht entgegentraten. Nichts demonstriert den reaktionären, antiemanzipatorischen Charakter der neumodischen „kritischen“ bürgerlichen Antitheorie deutlicher als ihr vehementes Bestreiten auch nur der Möglichkeit, dass die Menschheit gesellschaftliche Beziehungen und ihr Verhältnis zur Natur bewusst gestalten könnte.
Aus der behaupteten Unmöglichkeit und Verwerflichkeit einer materialistischen Theorie der Gesellschaft folgt die kategorische Ablehnung jeder objektiven Fundierung revolutionärer und notwendigerweise auch jeder proletarischen Klassenpolitik. Wie kritisch sich die IdeologInnen postmoderner Theorie gegenüber den Normen und Sitten der bürgerlichen Gesellschaft, ja gegenüber dieser selbst wähnen mögen, steht doch der Marxismus (oder was sie dafür halten) im Mittelpunkt ihrer Kritik und Polemik. Dies ist kein Zufall. Die bürgerlichen Theorien der Gesellschaft und die Erkenntnistheorie haben längst den Anspruch auf eine rationale, historische Erklärung und Rechtfertigung der Geschichte sowie auf die Ausarbeitung einer wissenschaftlich fundierten, umfassenden Weltanschauung aufgegeben [iii]. Im Gegensatz dazu versucht der Marxismus, nicht nur die Gesellschaft, ihre inneren Widersprüche und damit auch ihre Historizität zu verstehen. Er begründet auch die Möglichkeit und Notwendigkeit einer rationalen, von den Menschen bewusst gestalteten Produktion und Reproduktion der Gesellschaft und des Verhältnisses von Mensch und Natur.
Die marxistische Kapitalismus- und Imperialismustheorie mündet daher notwendigerweise immer in einer Revolutionstheorie, untrennbar verbunden mit der Frage der Subjektbildung und der rationalen Neugestaltung der Gesellschaft auf Basis einer Planwirtschaft.
Wo der Imperialismusbegriff in den neuen postmodernen oder auch in den postkolonialen Theorien auftaucht, ist er seines Bezugs zur marxistischen Kapitalismustheorie, zum Klassenbegriff und auch zur Theorie Lenins und anderer RevolutionärInnen vollständig beraubt [iv].
Neben diesen direkt reaktionären Auffassungen brachte die Globalisierungsperiode jedoch auch Konzeptionen hervor, die bestimmte Aspekte der Entwicklung des globalen Kapitalismus hervorhoben und oft genug auch einseitig überbetonten. Dazu gehören zum Beispiel Werke wie Negris und Hardts „Empire“ [v] und dessen Behauptung, dass der Gegensatz von Empire und Multitude den Widerspruch von Lohnarbeit und Kapital abgelöst habe, dass an die Stelle des Imperialismus ersteres getreten sei[vi]. Die häufigen und heftigen Kriegszüge und Interventionen der Großmächte seit dem Beginn des Jahrtausends ließen die eklektische Theorie, die ihrerseits zahlreiche Anleihen beim Postmodernismus gemacht hatte, zunehmend empirisch fragwürdig erscheinen. Etliche ihrer Gedanken wirken jedoch bis heute nach. Einerseits schwingt die Konzeption der Multitude weiter in der postautonomen Theorie und Politik fort, andererseits knüpfen z. B. Postkapitalismustheorien wie jene von Paul Mason mehr oder minder offen an Hardt und Negri an – so z. B. mit der Vorstellung, dass der Mehrwert „unmessbar“ werde und aufgrund der enorm gestiegenen Arbeitsproduktivität verschwinde.
Schon im ersten Jahrzehnt der Globalisierungsperiode wurde dieser ideologische Schein mehr und mehr durch die reale Entwicklung desavouiert. Die historische Krise der Weltwirtschaft und der Globalisierung trat für alle, die sich noch einen Funken klaren Verstandes bewahrt hatten, spätestens seit 2008 immer deutlicher zutage. Ihre krisenhafte Eruption hatte sich schon lange davor vorbereitet.
Eine Folge dieser realen Entwicklung bestand und besteht darin, dass die Begriffe Kapitalismus und Imperialismus wieder ins öffentliche Bewusstsein rückten. Allein das weist schon darauf hin, dass der Mainstream der bürgerlichen Wissenschaft über kein begriffliches Instrumentarium verfügt, auch nur einigermaßen tief unter die Oberfläche der Erscheinungsformen des realen Wirtschaftslebens, des Weltmarktes und des darauf aufbauenden globalen politischen Systems zu dringen und die realen Bewegungsgesetze dieser Ordnung, ihre innere Dynamik zu fassen. Nicht nur der Neoliberalismus, alle anderen mehr oder weniger obskuren bürgerlichen sozialwissenschaftlichen Theorien des letzten halben Jahrhunderts haben sich bis auf die Knochen blamiert. Das offenbart – nebenbei bemerkt –, dass die bürgerliche Gesellschaftswissenschaft in der imperialistischen Epoche im Wesentlichen stagnierte oder regredierte, zu einer ideologischen Magd einer historisch überfälligen, reaktionär gewordenen imperialistischen Bourgeoisie verkam.
Die Krise manifestiert sich nicht nur als eine ökonomische und politische. Sie begann auch, die Köpfe durchzurütteln. Begriffe wie Kapitalismus haben nun Konjunktur, insbesondere im linken Diskurs. Kaum eine Neuerscheinung auf dem Markt der Ideen, die nicht auch wieder vom Imperialismus spricht. Autoren wie David Harvey bemühen sich um den „neuen“ Imperialismus [vii]. In einer seiner letzten Arbeiten, „Konkurrenz für’s Empire“ [viii] , rekurriert Elmar Altvater, jahrzehntelang Ideengeber des akademischen Marxismus, auf den Imperialismusbegriff, dessen Bedeutung er und die Berliner Weltmarktschule lange relativiert hatten. Auch Joachim Bischoff, der den Lenin’schen Imperialismusbegriff eigentlich verwirft, kommt in seinem Buch „Die Herrschaft der Finanzmärkte“ nicht umhin, das Vordringen des Finanzkapitals zu konstatieren, auch wenn er dies für eine atypische Entwicklung des Kapitalismus hält [ix]. Die Zeitschrift Prokla widmet mehrere Schwerpunkte der Imperialismustheorie und neueren Entwicklungen [x]. Die indischen AutorInnen Patnaik [xi] versuchen eine alternative Fundierung der Imperialismustheorie. Bei zentristischen, also zwischen Reformismus und revolutionärem Marxismus schwankenden Strömungen und TheoretikerInnen finden wir eine Hinwendung und verstärkte Rezeption der Imperialismustheorie, auch wenn sie zentrale Erkenntnisse der Lenin’schen Theorie ablehnen, insbesondere die Konzeption der ArbeiterInnenaristokratie.
In diesem Artikel können wir die verschiedenen Ansätze keiner detaillierten Kritik unterziehen, das wird weiteren Arbeiten vorbehalten sein. An dieser Stelle geht es uns vielmehr darum aufzuzeigen, dass der zunehmende Rekurs auf den Begriff Imperialismus – einschließlich der Debatten zu seiner theoretischen Fundierung – die Realität einer globalen Krise ausdrückt.
Deren umfassender Charakter drängt geradezu zur Bezugnahme auf eine Theorie, die die Totalität der internationalen Entwicklung, ja, auch des Mensch-Natur-Verhältnisses zu fassen vermag. Die Hinwendung oder wenigstens Reflexion auf die Marx’sche Kapitalismuskritik und auf die Imperialismustheorie stellt daher keine zufällige Entwicklung dar, sondern liegt schlichtweg daran, dass diese überhaupt das Problem auf eine umfassende Art zu erklären versuchen. Eine der wenigen linksbürgerlichen ökonomischen Theorien, auf die daher in Krisenperioden auch verstärkt rekurriert wird, stellt der Keynesianismus dar, gerade weil er die Krisenhaftigkeit der Marktwirtschaft anerkennt und nach einer makroökonomischen und gesamtgesellschaftlichen, wenn auch bürgerlichen Antkrisenpolitik sucht.
Nur die Marx’sche Analyse des Kapitals und seiner Bewegungsgesetze ermöglicht jedoch ein tiefgehendes und radikales Verständnis der aktuellen Krise, ihrer Erscheinungsformen wie ihrer tieferen Ursachen. Eine materialistische Theorie muss versuchen, den Begriff des Imperialismus, die Besonderheiten dieser Epoche sowie einzelne Entwicklungsstadien oder Perioden innerhalb dieser Formation aus den Begriffen der Marx’schen Kapitalanalyse herzuleiten und zu erklären.
Diesen Anspruch versuchten so unterschiedliche AutorInnen wie Lenin, Luxemburg, Hilferding, Bucharin, Trotzki – um nur einige zentrale zu nennen – einzulösen. Im folgenden Text werden wir sie einer kurzen kritischen Würdigung unterziehen. Im Zentrum des Interesses steht jedoch die Theorie Lenins, weil sie die Gesamtheit des Imperialismus am besten zu fassen vermag. Ihr entscheidender Vorzug besteht gerade darin, dass Lenin den Imperialismus nicht bloß als ökonomisches und schon gar nicht als rein politisches Phänomen verstand, sondern als politisch-ökonomische Totalität, als Entwicklungsstadium einer Gesellschaftsformation.
Die Stärke seiner Theorie besteht, wie wir sehen werden, darüber hinaus darin, dass er den Imperialismus als globales Verhältnis begriff, also von der Realität eines Weltmarktzusammenhangs und einer darauf basierenden Weltordnung, eines globalen Systems, ausging. Dies bildet im Übrigen auch eine Schnittstelle zu der Theorie der permanenten Revolution Leo Trotzkis, gewissermaßen das Alter Ego von Lenins Theorie.
Eine an Lenin und Trotzki anknüpfende Imperialismustheorie erlaubt bei aller Kritik im Einzelnen, die gegenwärtige Periode im Rahmen der historischen Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft, der kapitalistischen Gesellschaftsformation zu verstehen. Nur die darauf basierenden programmatischen und politischen Schlussfolgerungen und die darin verkörperte Methode, wie sie von Marx und Engels grundgelegt und später im Kampf der internationalistischen Linken der Zweiten Internationale, vom Bolschewismus, von der Dritten Internationale unter Lenin und Trotzki, dem Kampf der ILO und der frühen Vierten Internationale entwickelt wurden, liefern eine Grundlage für die politische Bewaffnung, das unverzichtbare Werkzeug der Führung der kommenden Revolution, einer neuen, Fünften Internationale, deren Aufbau die große Aufgabe unserer Zeit ist.
Wenn wir von der historischen Bestätigung des Marxismus sprechen, so heißt das natürlich nicht, dass wir es mit einer Sammlung überhistorischer Wahrheiten, einer abgeschlossenen Wissenschaft zu tun hätten, die nur wie ein Tableau über aktuelle Ereignisse gestülpt werden müsse, um dann das „richtige“ Ergebnis zu erhalten. Wie wir weiter unten zeigen werden, war die Lenin’sche Imperialismustheorie allen anderen Theorien auch in der II. und III. Internationale aufgrund ihres Epochenbegriffs zwar qualitativ überlegen, keineswegs jedoch frei von eigenen begrifflichen Schwächen. Noch weniger konnte sie natürlich alle weiteren Entwicklungen einfach „vorwegnehmen“.
Dass die Imperialismustheorie seit den 1920er Jahren trotz einiger Versuche wenig weiterentwickelt wurde, dass wir bis heute – und sei es auch noch so „kritisch“ – auf die AutorInnen des Beginns des 20. Jahrhunderts mehr als auf andere rekurrieren, bedarf einer Erklärung. Die Degeneration der ArbeiterInnenbewegung, die Verbürgerlichung der Sozialdemokratie, die Bürokratisierung der Sowjetunion und das Verkommen dieses „Marxismus“ zu einer Herrschaftsideologie der Staatsbürokratie und ihrer Gefolgsleute in Ost und West stellen dafür eine zentrale Ursache dar. Die revolutionäre Minderheit der ArbeiterInnenbewegung, die sich in den 1930er Jahren und 1940er Jahren um den Aufbau einer neuen, revolutionären Vierten Internationale und die Verteidigung des kommunistischen Programms formierte, blieb marginalisiert und versackte selbst in Opportunismus und/oder SektiererInnentum.
Dies hatte unvermeidlich auch theoretische Konsequenzen. Die Weiterentwicklung der Lenin’schen Theorie blieb auf der Strecke. Sie wurde wie z. B. in der Theorie des staatsmonopolistischen Kapitalismus vereinseitigt, entstellt und zur Begründung klassenübergreifender Bündnisse wie der antimonopolistischen Demokratie missbraucht. Andere AutorInnen wie z. B. Mandel in seiner Theorie des „Spätkapitalismus“ knüpften zwar an Lenins Theorie an, aber ihr Versuch, die Entwicklung des Kapitalismus nach dem Zweiten Weltkrieg zu erklären, enthielt wichtige Revisionen des Marxismus (z. B. eine eklektische Krisentheorie oder Zugeständnisse an die Theorie der langen Wellen) und oft genug ein eklektisches Nebeneinander. Nichtsdestotrotz bilden Arbeiten wie jene von Mandel einen Referenzpunkt bis heute, weil er sich als einer der wenigen überhaupt die Aufgabe stellte, eine umfassende Theorie der Entwicklung des Kapitalismus bis in die 1980er und 1990er Jahre auszuarbeiten.
Zweifellos lassen sich auch in den Arbeiten anderer AutorInnen wichtige Elemente finden, an denen es anzuknüpfen gilt. Besonders hervorgehoben seien an dieser Stelle nur Henryk Grossmann [xii], Paul Mattick [xiii] und Roman Rosdolsky [xiv].
Insgesamt zeichnet die Entwicklung der marxistischen Theorie nach 1945 jedoch aus, dass Imperialismus- und Krisentheorie weitgehend voneinander getrennte Wege gehen, dass viele, die an der Marx’schen Krisentheorie festhalten, keinen Bezug zur Imperialismustheorie herstellten oder herstellen wollten. Umgekehrt verwerfen zahlreiche nach 1945 entwickelte Imperialismustheorien die von Marx entwickelten grundlegenden Gesetzmäßigkeiten, die die Krisen im Kapitalismus erklären, insbesondere das Gesetz vom tendenziellen Fall der Profitrate.
Schließlich mutierte die Imperialismustheorie bei etlichen „marxistischen“ und linksradikalen Strömungen und Gruppierungen von einer Theorie der Analyse der konkreten Situation zu einer rein formellen Selbstvergewisserung, als ob die wesentliche Leistung einer revolutionären Theorie einzig darin bestünde, den „Charakter“ einer bestimmten Entwicklungsphase zu bestimmen. Wir wollen das Problem im folgenden Absatz verdeutlichen.
So ist es zweifellos richtig, „die Globalisierung“ als einen Abschnitt der imperialistischen Epoche zu charakterisieren, in dem die Wesensmerkmale des Imperialismus hervortreten. Ich habe damit aber noch gar nichts ausgesagt, was diese Periode von anderen, in ihrer Erscheinungsform sehr verschiedenen Abschnitten der Epoche unterscheidet. Ich habe daher auch gar nichts ausgesagt darüber, welche Formen des Klassenkampfes, welche politischen und sozialen Fragen im Vordergrund stehen, geschweige denn über die spezifische Entwicklungsdynamik innerhalb der Periode, das Zusammenwirken von Politik und Ökonomie, von Basis und Überbau, über die konkrete Verlaufsform der Zuspitzung der Widersprüche. Vor allem habe ich damit gar nichts ausgesagt über die Programmatik, über Strategie und Taktik. Das Ganze wird vielmehr zu einer mehr oder weniger dürren und sterilen „allgemeinen Wahrheit“ – die auch äußerst begrenzt ist, weil sie über die konkrete Lage keine konkrete Aussage zu treffen vermag, weil sie eben nicht hilft, eine konkrete Situation genauer zu verstehen und somit zielgerichteter zu handeln. Eine solche Herangehensweise verurteilt also nicht nur zu Sterilität gegenüber der aktuellen Periode oder Situation. Sie macht letztlich auch den Epochenbegriff oder den Begriff des Imperialismus (oder, wenn dieselbe Herangehensweise verwendet wird, auch jenen des Kapitalismus) zu einer schalen Angelegenheit. Dies insbesondere, weil so auch nicht geklärt wird, warum sich der Imperialismus als historische Epoche in so unterschiedlichen Formen präsentieren kann, welche Faktoren nicht nur die Entwicklung innerhalb einer Periode bestimmen, sondern auch, welche ihre krisenhaften Übergänge determinieren.
Wir haben uns mit diesem Punkt so lange aufgehalten, weil die Bestimmung des Verhältnisses von Epoche zu längeren und kürzeren Perioden der Entwicklung, zu den zyklischen Bewegungen der Kapitalakkumulation einen zentralen Problempunkt bildete, um den die Debatten über die Imperialismus- und Krisentheorie nach dem Zweiten Weltkrieg, nach Zusammenbruch und Degeneration der Vierten Internationale kreisten.
2. Kapitalismus als historische Gesellschaftsformation
Wie alle MarxistInnen zu Beginn des 20. Jahrhunderts versuchte auch Lenin, den Imperialismusbegriff aus den Kategorien der Marx’schen Kapital- und Gesellschaftstheorie herzuleiten. Die Überlegenheit seiner Auffassung lässt sich nur schwer verstehen, wenn wir nicht auf letztere eingehen. So wird auch verständlich, worin eigentlich die Schwächen konkurrierender Theorien z. B. jener Hilferdings, Luxemburgs oder Bucharins liegen. Bevor wir uns mit den Konzeptionen des linken Flügels der II. Internationale und der frühen III. Internationale beschäftigen, müssen wir jedoch auf für unsere Darlegung wesentliche Besonderheiten und Schlussfolgerungen der Marx’schen Theorie zu sprechen kommen.
Im Vorwort zur „Kritik der politischen Ökonomie“ (1859) gibt Marx einen kurzen und bekanntgewordenen Abriss über das Verhältnis von ökonomischer Basis einer Gesellschaft zu ihrem politischen, ideologischen, geistigen, staatlichen etc. Überbau.
„In der gesellschaftlichen Produktion ihres Lebens gehen die Menschen bestimmte, notwendige von ihrem Willen unabhängige Verhältnisse ein, Produktionsverhältnisse, die einer bestimmten Entwicklungsstufe ihrer materiellen Produktivkräfte entsprechen. Die Gesamtheit dieser Produktionsverhältnisse bildet die ökonomische Struktur der Gesellschaft, die reale Basis, worauf sich ein juristischer und politischer Überbau erhebt und welcher bestimmte gesellschaftliche Bewußtseinsformen entsprechen. (…)
Auf einer gewissen Stufe ihrer Entwicklung geraten die materiellen Produktivkräfte der Gesellschaft in Widerspruch mit den vorhandenen Produktionsverhältnissen oder, was nur ein juristischer Ausdruck dafür ist, mit den Eigentumsverhältnissen, innerhalb deren sie sich bisher bewegt hatten. Aus Entwicklungsformen der Produktivkräfte schlagen diese Verhältnisse in Fesseln derselben um. Es tritt dann eine Epoche sozialer Revolution ein. (…)
Die bürgerlichen Produktionsverhältnisse sind die letzte antagonistische Form des gesellschaftlichen Produktionsprozesses, antagonistisch nicht im Sinn von individuellem Antagonismus, sondern eines aus den gesellschaftlichen Lebensbedingungen der Individuen hervorwachsenden Antagonismus, aber die im Schoß der bürgerlichen Gesellschaft sich entwickelnden Produktivkräfte schaffen zugleich die materiellen Bedingungen zur Lösung dieses Antagonismus. Mit dieser Gesellschaftsformation schließt daher die Vorgeschichte der menschlichen Gesellschaft ab.“ [xv]
Für unsere weitere Betrachtung der Imperialismustheorie entscheidend ist, dass Marx eine historische Gesellschaftsformation als Einheit von ökonomischer Basis und dem entsprechenden politischen und ideologischen, ideellen usw. Überbau betrachtet.
Die kapitalistischen Produktionsverhältnisse bestimmen die ökonomische Struktur der bürgerlichen Gesellschaft, ganz so wie die feudalen die Feudalgesellschaft oder die Kaufsklaverei die Antike. Marx verweist darauf, dass die Gesamtheit der Produktionsverhältnisse die ökonomische Basis der Gesellschaft bildet. So existieren z. B. im Kapitalismus neben den kapitalistischen noch weitere Formen. Je mehr die dominante Produktionsweise expandiert, jeden Winkel der Erde erreicht, jede chinesische Mauer überwindet, den Weltmarkt weiterentwickelt, je mehr die Unterordnung der Lohnarbeit unter das Kapital voranschreitet, werden andere Produktionsverhältnisse entweder aufgelöst und zerstört oder mehr und mehr der kapitalistischen untergeordnet, dieser funktional einverleibt. Hinsichtlich bestimmter Produktionsformen lassen sich beide Phänomene beobachten, z. B. beim Kleineigentum an Produktionsmitteln und damit der Reproduktion des KleinbürgerInnentums als auch bei der privaten Hausarbeit.
In bestimmten Phasen der Entwicklung entstehen sogar Formen vorhergehender Ausbeutungsverhältnisse neu. So war z. B. die Sklaverei in den Amerikas ein Resultat und Mittel der kapitalistischen Durchdringung und Expansion, wobei sich diese grundlegend von der antiken unterscheidet, weil sie immer schon auf den kapitalistischen Weltmarkt bezogen war, ja ein entscheidendes Mittel zu dessen Herstellung. Daher bezeichnet Marx den/die SklavInnen ausbeutende/n PlantagenbesitzerIn auch zu Recht als KapitalistIn. „Daß wir jetzt die Plantagenbesitzer in Amerika nicht nur Kapitalisten nennen, sondern daß sie es sind, beruht darauf, daß sie als Anomalien innerhalb eines auf der freien Arbeit beruhenden Weltmarkts existieren.“ [xvi] Ebenso entstehen feudale Formen der Ausbeutung in Indien erst als direkte Folge des Kolonialismus und der Integration in das britische Welt- und Handelsimperium.
Schließlich bildet die private Hausarbeit der LohnarbeiterInnen eine, dem Kapitalverhältnis untergeordnete und von diesem bestimmte Produktionsweise, die zwar Ähnlichkeiten mit der Subsistenzproduktion aufweist, sich von dieser jedoch grundlegend unterscheidet. Sie ist nämlich – ähnlich der Sklaverei in den Amerikas – fest in die Welt der Warenproduktion und des Warentausches eingebunden, weil die LohnarbeiterInnen ihre Lebensmittel, ihre Wohnung … als Waren kaufen und dazu ihre Arbeitskraft verkaufen müssen.
Für Marx bedeutet die ökonomische Struktur also keineswegs die Existenz nur einer Produktionsweise. Entscheidend ist vielmehr, dass in den jeweiligen historischen Gesellschaftsformationen eine bestimmte Produktionsweise die gesamte ökonomische Struktur der Gesellschaft bestimmt. Große historische Umbrüche stellen auch dieses Verhältnis in Frage. So entwickelt sich die kapitalistische Produktionsweise schon in der Übergangsepoche der Neuzeit und drängt die feudale immer mehr zurück. Politisch entspricht dem der Absolutismus als Übergangsregime. Die bürgerliche Revolution kann sich also auf die Herausbildung wesentlicher Elemente einer ihr entsprechenden Produktionsweise schon vor ihrem Sieg stützen, die ökonomische Vorherrschaft der Bourgeoise beginnt sich bereits mehr und mehr zu entwickeln, bevor sie die politische endgültig erringt.
Für die proletarische Revolution ist das unmöglich, weil sich keine sozialistische Produktionsweise im Kapitalismus entwickelt, ja nicht entwickeln kann. Wohl aber bilden sich die Voraussetzungen für eine bewusste, rationale, globale Planung. Um dies zu erreichen, muss aber das Proletariat zuerst die politische Macht erobern.
Darum ist auch die Kapitalismustheorie, die Analyse des antagonistischen Charakters der Produktionsweise für Marx und Engels so eng mit der Revolutionstheorie verflochten. Für sie besteht der ganze Zweck der Kritik der politischen Ökonomie schließlich darin, die Bedingungen, die Notwendigkeit und das Programm der proletarischen Machtergreifung wissenschaftlich zu unterfüttern.
Wenn wir – wie alle MarxistInnen – von Imperialismus sprechen, so meinen wir eine bestimmten Epoche der kapitalistischen Entwicklung, genauer der Entwicklung der kapitalistischen oder bürgerlichen Gesellschaftsformation.
Der Imperialismus wird bestimmt als Epoche des Übergangs und Niedergangs des Kapitalismus und zwar in einem spezifischen Sinn. Die Produktionsverhältnisse sind zu einer Fessel der Entwicklung der Produktivkräfte, der Entwicklung der Gesellschaft geworden. Der Kapitalismus hat aufgehört, eine fortschrittliche Produktionsweise zu sein und zwar in den beiden Bestimmungen:
1. Die Zerstörung vorkapitalistischer Produktionsweisen und sich darauf erhebender politischer Formen ist im globalen Maßstab vollzogen. Wo sie fortbestehen, existieren sie entweder weiter als in den Weltmarkt eingebettete, funktionale Formen oder als Marginalien.
2. Die Bildung der zentralen Voraussetzungen für eine globale, bewusst gelenkte Produktionsweise – große Industrie und ArbeiterInnenklasse – ist auf globaler Ebene erfolgt.
Keineswegs darf diese Bestimmung damit verwechselt werden, dass in der imperialistischen Epoche die Produktivkräfte dauerhaft stagnieren würden oder überhaupt dauerhaft stagnierten könnten. Diese, oft katastrophistisch konnotierten Interpretationen finden sich teilweise im Stalinismus der Dritten Periode, teilweise im zentristischen Nachkriegstrotzkismus. Sie gehen davon aus, dass die Stagnation der Produktivkräfte Voraussetzung für den revolutionären Charakter einer bestimmten Epoche oder Geschichtsperiode wäre.
Geht man nämlich einmal davon aus, dass die Möglichkeit der proletarischen Revolution von der Stagnation der Produktivkräfte abhängt, so muss diese geradezu ständig „bewiesen“ werden, will man nicht gegen den eigenen revolutionären Willen zum Utopismus abgleiten. Dann muss – was jeder revolutionären Theorie schlecht zu Gesicht steht – die reale Entwicklung umgedeutet werden. Die gigantische Entwicklung der Produktivkräfte seit 1945 wird geleugnet und zur „Entwicklung“ von „Destruktivkräften“ umbenannt. Dass damit nichts gewonnen ist, liegt auf der Hand.
Methodisch betrachtet wurde ein dialektisches Widerspruchsverhältnis zwischen Produktivkräften und Produktionsverhältnissen auf die Betrachtung einer Seite reduziert. Für die kapitalistische Produktionsweise ist es jedoch gerade kennzeichnend, dass sie die Produktivkräfte ständig, wenn auch auf Kosten von ArbeiterInnen und Natur (insofern natürlich destruktiv!) umwälzen muss. Die Umwälzung erfolgt notwendig krisenhaft, gelingt, historisch betrachtet, immer schwieriger und geht daher tendenziell mit immer größeren gesellschaftlichen Konflikten einher.
Der Begriff der Gesellschaftsformation inkludiert darüber hinaus neben den Produktionsverhältnissen auch den gesamten Überbau – und somit auch das Verhältnis zwischen allen Klassen, sowie die staatlichen und internationalen Verhältnisse.
Gesellschaftsformation und Staat
Marx und Engels verwiesen in ihren Untersuchungen und Analysen von Staats- und Herrschaftsformen, Ideologien usw. immer wieder darauf, dass die Ungleichzeitigkeit der Entwicklung der verschiedenen Nationalökonomien, deren historisch bedingte Unterschiede, ihre verschiedenartige Integration in den Weltmarktzusammenhang usw. eine enorme Formenvielfalt und Kombinationen des staatlichen, ideellen, institutionellen und gesellschaftlichen Überbaus hervorbringen.
So entfaltete sich die kapitalistische Produktionsweise über einen langwierigen und blutigen Prozess des Klassenkampfes bekanntlich zuerst in England. Die epochemachende, weltgeschichtliche Umwälzung vollzieht sich jedoch im ökonomisch eigentlich rückständigeren Frankreich – ein früheres Beispiel für das Gesetz der ungleichzeitigen und kombinierten Entwicklung. Andererseits bildet Deutschland, das Land der gescheiterten Revolutionen, ein Musterbeispiel für die Umwälzung der Produktionsweise durch eine Klassenallianz von aufstrebendem Großkapital und Aristokratie. Bonapartismus und Verpreußung bilden die entsprechende staatliche und ideologische Überbauform. Der US-amerikanische Kapitalismus hingegen brauchte weder feudale Überreste hinwegzufegen, noch bedurfte es eines Kompromisses mit tradierten herrschenden Klassen und Herrschaftsformen. Die bürgerliche Gesellschaft entwickelte sich ohne Rücksichtnahme auf diese, zugleich jedoch auf Basis von Sklaverei, Vertreibung und Ausrottung der indigenen Bevölkerung.
Unbeschadet dieser enormen Unterschiede des gesellschaftlichen Lebens, der Öffentlichkeit wie der gesamten ideologischen Sphäre können, wie Marx und Engels immer wieder hervorheben, diese berechtigterweise als bürgerliche Staaten und Gesellschaften charakterisiert und begriffen werden, weil sie auf derselben ökonomischen Grundlage, auf der kapitalistischen Produktionsweise beruhen.
„Und nun gar der wüste Mißbrauch, den das Programm mit den Worten ‚heutiger Staat’, ‚heutige Gesellschaft’ treibt, und den noch wüsteren Mißverstand, den es über den Staat anrichtet, an den es seine Forderungen richtet!
Die ‚heutige Gesellschaft’ ist die kapitalistische Gesellschaft, die in allen Kulturländern existiert, mehr oder weniger frei von mittelaltrigem Beisatz, mehr oder weniger durch die besondre geschichtliche Entwicklung jedes Landes modifiziert, mehr oder weniger entwickelt. Dagegen der ‚heutige Staat’ wechselt mit der Landesgrenze. Er ist ein andrer im preußisch-deutschen Reich als in der Schweiz, ein andrer in England als in den Vereinigten Staaten. ‚Der heutige Staat’ ist also eine Fiktion.
Jedoch haben die verschiednen Staaten der verschiednen Kulturländer, trotz ihrer bunten Formverschiedenheit, alle das gemein, daß sie auf dem Boden der modernen bürgerlichen Gesellschaft stehn, nur einer mehr oder minder kapitalistisch entwickelten. Sie haben daher auch gewisse wesentliche Charaktere gemein. In diesem Sinn kann man von ‚heutigem Staatswesen’ sprechen, im Gegensatz zur Zukunft, worin seine jetzige Wurzel, die bürgerliche Gesellschaft, abgestorben ist.“ [xvii]
Die Institutionen des Überbaus dienen nicht nur der gewaltsamen wie auch ideologischen, über bürgerliche Medien, Wissenschaft und Öffentlichkeit vermittelte Sicherung der Herrschaft des Kapitals. Der Staat muss auch als Garant der Reproduktion des Kapitalverhältnisses, als Sachwalter des gesellschaftlichen Gesamtkapitals, als ideeller Gesamtkapitalist fungieren.
Um diese Rolle erfüllen zu können, muss er als über den Klassen und einzelnen Kapitalfraktionen stehend erscheinen, als Sachwalter des gesellschaftlich Allgemeinen. Schon bei Betrachtung der Oberflächenerscheinungen der Gesellschaft – z. B. empirisch der Resultate staatlicher Entscheidungen, Gesetze und auch des konkreten Handelns von Gerichten, Behörden, Polizei und anderen ehrwürdigen Institutionen – wird rasch klar, dass die Ideologie der Gleichheit, die die kapitalistische Warenproduktion notwendigerweise erzeugt und reproduziert und als deren Sachwalter der Staat erscheint, mit der Reproduktion und Verstärkung der reellen Ungleichheit einhergeht, wenn auch in einer durchaus elastischen Form.
Das liegt einerseits an den Kämpfen der ArbeiterInnenklasse und der Unterdrückten, die progressive Reformen und eine Ausdehnung demokratischer Rechte erzwingen können, freilich ohne dass dabei die klassenspezifische Substanz des Staatsapparates berührt wird. Nicht zuletzt durch diesen Druck erweist sich der bürgerliche Staat als überaus wandlungs- und anpassungsfähig, wenn es darum geht, solche erzwungenen Reformen in das Gesamtsystems zu integrieren und seine Herrschaftsform zu modifizieren. Fast alle bedeutenden gesetzlichen und sozialen Reformen gingen aus sozialen und politischen Konflikten hervor, einschließlich von revolutionären Kämpfen oder BürgerInnenkriegen. Rosa Luxemburg bringt diese Dialektik von Reform und Revolution als eine der Ersten auf den Punkt, wenn sie die gesetzliche Reform als Nebenprodukt, als Resultat des revolutionären Klassenkampfes bestimmt. [xviii]
Die Tatsache, dass solche Reformen durchsetzbar sind, verweist nicht nur darauf, dass der Kampf um Verbesserungen ein notwendiges, wenn auch beschränktes Moment des Klassenkampfes darstellt. Diese Form der Veränderung bildet – ganz ähnlich wie der erfolgreiche gewerkschaftliche Kampf um Verbesserungen – zugleich auch eine Wurzel von Illusionen in die Reformierbarkeit des Gesamtsystems. Die relativ elastische demokratische Herrschaftsform des Kapitals erweist sich als Mittel zur Integration vor allem der Mittelschichten, des KleinbürgerInnentums, aber auch der ArbeiterInnenklasse oder jedenfalls ihrer privilegierteren Schichten ins politische und institutionelle System. Wie Marx und Engels immer wieder verdeutlichen, ändert das jedoch nichts am Klassencharakter des Staates. Auch die demokratischste Republik bleibt eine Form der demokratisch verhüllten Diktatur des Kapitals.
Gerade dass in der demokratischen Republik Unterschiede des Besitzes und des Reichtums offiziell keine Ungleichheit ausmachen sollen und LohnarbeiterInnen und KapitalbesitzerInnen als gleich erscheinen, erweitert die Möglichkeiten zur Integration von Ausgebeuteten und Unterdrückten. So wie das Lohnarbeitsverhältnis selbst eine gewisse „Elastizität“ aufweist, so fließt in die Ausgestaltung des bürgerlichen Staates immer auch ein gesellschaftliches Kräfteverhältnis ein, das seinerseits auch die Vorstellung von dessen scheinbarer Klassenneutralität verstärkt. Damit hängt außerdem zusammen, dass der Staat selbst die allgemeinen Reproduktionsbedingungen des Gesamtkapitals sichern muss, und zwar auch gegen widerstreitende Teile der herrschenden Klasse. Weil sich die Hauptklassen der Gesellschaft aus freien, formell gleichen Individuen, aus WarenbesitzerInnen zusammensetzen, deren Mitglieder selbst in einem Konkurrenzverhältnis stehen (wenn auch in einem für die Klasse der KapitalistInnen und der LohnarbeiterInnen jeweils spezifischen), so muss der Staat notwendigerweise als scheinbar über den Klassen erscheinen.
Ideeller Gesamtkapitalist
Damit der Staat als ideeller Gesamtkapitalist agieren kann, muss er bis zu einem gewissen Grad auch unterschieden sein von der KapitalistInnenklasse oder selbst von deren dominierenden Fraktionen. Mandel führt dies in der Einleitung zu Trotzkis „Schriften über Deutschland“ [xix] recht plastisch anhand der Politik des New Deal aus:
„Die artikulierte Mehrheit der amerikanischen Großbürger schrie Zeter und Mordio über Roosevelts ,New Deal’; sogar Trumans ‚Fair Deal’ wurde mit nicht wenig Geschrei über ‚schleichenden Sozialismus’ beantwortet. Aber kein objektiver Beobachter der Entwicklung der amerikanischen Wirtschaft und Gesellschaft der letzten 35 Jahre könnte heute bestreiten, daß sich in dieser Epoche die Akkumulation des Kapitals erweitert und nicht eingeschränkt hat; daß die amerikanischen Großkonzerne unvergleichbar reicher und mächtiger geworden sind, als sie in den zwanziger Jahren waren; daß die Bereitschaft anderer Gesellschaftsklassen – hauptsächlich der Industriearbeiterschaft – die Herrschaft dieser Konzerne unmittelbar gesellschaftlich und politisch in Frage zu stellen, geringer geworden ist, als sie während und sofort nach der großen Wirtschaftskrise war.“ [xx]
Ob der New Deal dem Interesse des US-amerikanischen Gesamtkapitals entspricht, zeigt sich nicht daran, ob alle oder selbst die Mehrheit der Konzerne diesem von Beginn an zustimmt. Im Gegenteil. Da das Kapital als konkurrierende Einzelkapitale in Erscheinung treten muss, erfordert die Herausbildung eines Gesamtinteresses der Klasse einen politischen, staatlichen Vermittlungsprozess, der notfalls auch gegen die unmittelbaren Einzelinteressen durchgesetzt werden muss.
Internationaler Charakter
Abschließend müssen wir beim Marx’schen Begriff der bürgerlichen Gesellschaftsformation darauf eingehen, dass diese (auch im Unterschied zu vorhergehenden) immer schon als globale betrachtet und gedacht werden muss. Dieser Gedanke wird bereits im Kommunistischen Manifest betont, wo Marx und Engels darauf verweisen, dass eine Besonderheit des Kapitalismus und dessen historisch fortschrittliche Mission gerade darin bestehen, dass sich die Bourgeoisie im Unterschied zu vorhergehenden herrschenden Klassen revolutionär gegenüber vorkapitalistischen Produktionsweisen verhält. Es gehört zum Wesen des Kapitals, diese zurückzudrängen, zu zerstören. Es drängt zur globalen Expansion, nistet sich ein, überwindet chinesische Mauern.
„Die Entdeckung Amerikas, die Umschiffung Afrikas schufen der aufkommenden Bourgeoisie ein neues Terrain. Der ostindische und chinesische Markt, die Kolonisierung von Amerika, der Austausch mit den Kolonien, die Vermehrung der Tauschmittel und der Waren überhaupt gaben dem Handel, der Schiffahrt, der Industrie einen nie gekannten Aufschwung und damit dem revolutionären Element in der zerfallenden feudalen Gesellschaft eine rasche Entwicklung.“ [xxi]
In den Grundrissen legt Marx dar, dass der Weltmarkt im Begriff des Kapitals eingeschrieben ist, von diesem vorausgesetzt und geschaffen wird. „Wie das Kapital daher einerseits die Tendenz hat, stets mehr Surplusarbeit zu schaffen, so die ergänzende, mehr Austauschpunkte zu schaffen; d. h. hier vom Standpunkt des absoluten Mehrwerts oder Surplusarbeit aus, mehr Surplusarbeit als Ergänzung zu sich selbst hervorzurufen, au fond (im Grunde) die auf dem Kapital basierte Produktion oder die ihm entsprechende Produktionsweise zu propagieren. Die Tendenz, den Weltmarkt zu schaffen, ist unmittelbar im Begriff des Kapitals selbst gegeben.“ [xxii]
Die Tendenz zur Schaffung des Weltmarktes, das „propagandistische“ Wirken des Kapitals prägt seine Entwicklung von Beginn an. Die koloniale Expansion, die „Entdeckung“ Lateinamerikas und von dessen Reichtümern verleiht der Ausbreitung des Kapitalismus in England einen mächtigen Impuls, der durch die bloß innere Akkumulation viel langsamer und langwieriger erfolgt wäre. Im Unterkapitel „Genesis des industriellen Kapitalisten“, Teil der Abhandlung über die sog. ursprüngliche Akkumulation im Ersten Band des „Kapital“, verweist Marx darauf, dass sich die Genesis der/s industriellen KapitalistIn in einem engen Zusammenhang mit dem Weltmarkt vollzog:
„Die Genesis des industriellen Kapitalisten ging nicht in derselben allmählichen Weise vor wie die des Pächters. Zweifelsohne verwandelten sich manche kleine Zunftmeister und noch mehr selbständige kleine Handwerker oder auch Lohnarbeiter in kleine Kapitalisten und durch allmählich ausgedehntere Exploitation von Lohnarbeit und entsprechende Akkumulation in Kapitalisten sans phrase (schlechthin). In der Kindheitsperiode der kapitalistischen Produktion ging’s vielfach zu wie in der Kindheitsperiode des mittelaltrigen Städtewesens, wo die Frage, wer von den entlaufnen Leibeignen soll Meister sein und wer Diener, großenteils durch das frühere oder spätere Datum ihrer Flucht entschieden wurde. Indes entsprach der Schneckengang dieser Methode in keiner Weise den Handelsbedürfnissen des neuen Weltmarkts, welchen die großen Entdeckungen Ende des 15. Jahrhunderts geschaffen hatten.“ [xxiii]
Vielmehr erlaubt die koloniale Plünderung, also die Herausbildung eines Weltmarktes – vermittelt über die Entwicklung des Wucher- und Handelskapitals – eine extreme Beschleunigung der Akkumulation der Industrie, die Schaffung der eigentlichen kapitalistischen Produktionsweise in jenen Ländern wie England, wo die feudalen Verhältnisse auf dem Land bereits aufgelöst oder jedenfalls in Auflösung begriffen waren, eine disponible Klasse doppelt freier LohnarbeiterInnen zur Verfügung stand. Marx bringt die Verhältnisse sarkastisch auf den Punkt:
„Die Entdeckung der Gold- und Silberländer in Amerika, die Ausrottung, Versklavung und Vergrabung der eingebornen Bevölkerung in die Bergwerke, die beginnende Eroberung und Ausplünderung von Ostindien, die Verwandlung von Afrika in ein Geheg zur Handelsjagd auf Schwarzhäute bezeichnen die Morgenröte der kapitalistischen Produktionsära. Diese idyllischen Prozesse sind Hauptmomente der ursprünglichen Akkumulation. Auf dem Fuß folgt der Handelskrieg der europäischen Nationen, mit dem Erdrund als Schauplatz. Er wird eröffnet durch den Abfall der Niederlande von Spanien, nimmt Riesenumfang an in Englands Antijakobinerkrieg, spielt noch fort in den Opiumkriegen gegen China usw.
Die verschiednen Momente der ursprünglichen Akkumulation verteilen sich nun, mehr oder minder in zeitlicher Reihenfolge, namentlich auf Spanien, Portugal, Holland, Frankreich und England. In England werden sie Ende des 17. Jahrhunderts systematisch zusammengefaßt im Kolonialsystem, Staatsschuldensystem, modernen Steuersystem und Protektionssystem. Diese Methoden beruhn zum Teil auf brutalster Gewalt, z. B. das Kolonialsystem. Alle aber benutzten die Staatsmacht, die konzentrierte und organisierte Gewalt der Gesellschaft, um den Verwandlungsprozeß der feudalen in die kapitalistische Produktionsweise treibhausmäßig zu fördern und die Übergänge abzukürzen. Die Gewalt ist der Geburtshelfer jeder alten Gesellschaft, die mit einer neuen schwanger geht. Sie selbst ist eine ökonomische Potenz.“ [xxiv]
Die Schaffung einer universellen, die Partikularität vorhergehender Produktionsweisen überwindenden, auf den Weltmarkt bezogenen Produktionsweise stellt für Marx und Engels einen historischen Fortschritt dar – trotz des von ihnen geschilderten, notwendigerweise extrem brutalen und gewalttätigen Prozesses in Bezug auf die Herausbildung der ArbeiterInnenklasse und der kolonialen Ausbeutung. Der Kern des geschichtlichen Fortschritts besteht für Marx nämlich nicht in der Schaffung einer kapitalistischen Ökonomie und der bürgerlichen Gesellschaft als solcher, sondern darin, dass dies eine notwendige Voraussetzung für die Schaffung einer zukünftigen universellen Entwicklung der Menschen ist. [xxv]
Die Frage der Expansion des Kapitalverhältnisses und des Weltmarkts inkludiert daher auch in einem anderen Sinn ein grundlegend historisches Moment. Sobald es sich gemäß seiner eigenen technischen Grundlage – der großen Industrie – durchgesetzt hat und der Weltmarkt etabliert ist, hört die Bourgeoisie auf, eine fortschrittliche Klasse zu sein. Die Welt ist unter die großen Kapitale und Mächte aufgeteilt, die ihrerseits auch den Eintritt und die Form der Weltmarktintegration der sog. Dritten Welt bestimmen.
Alle marxistischen Imperialismustheorien beziehen sich im Grunde auf ein solches, historisches Stadium der kapitalistischen Gesellschaftsformation, mögen ihre Erklärungsansätze auch sehr verschieden sein. Auch eine Aktualisierung und Weiterentwicklung der Lenin’schen Imperialismustheorie muss vom internationalen Charakter des Kapitalismus ausgehen – oder sie ist im Voraus zum Scheitern verurteilt.
Obiges Zitat enthält schließlich auch die zentralen Elemente der Marx’schen Revolutionstheorie und den historisch-spezifischen Charakter der proletarischen Revolution. Die bürgerliche Gesellschaft bildet den Abschluss der „Vorgeschichte der menschlichen Gesellschaft“, die kapitalistische die letzte antagonistische Form des Produktionsprozesses. Damit ist auch die zentrale Rolle der klassenbewussten Organisierung des Proletariats grundgelegt – die Formierung der revolutionären Partei.
3. Kapitalbegriff, Krisentheorie und Imperialismus
Marx’ politischer Ökonomie geht es u. a. darum, die Notwendigkeit der Verschärfung der inneren Widersprüche des Kapitalismus darzulegen, die Notwendigkeit der Krise, der Lösung, Aufhebung dieser inneren Widersprüche der Gesellschaftsformation.
Dem Kapitalbegriff von Marx ist daher die Möglichkeit und Notwendigkeit der Krise immanent, nichts von außen Hineingetragenes. Vielmehr legt er nicht nur die Unvermeidbarkeit der Krisen, sondern auch die in der widersprüchlichen Kapitalbewegung angelegten Tendenzen zur Überwindung der kapitalistischen Produktionsweise dar.
Im ersten Band leitet er die historischen Entwicklungstendenzen des Kapitals her:
„Je ein Kapitalist schlägt viele tot. Hand in Hand mit dieser Zentralisation oder der Expropriation vieler Kapitalisten durch wenige entwickelt sich die kooperative Form des Arbeitsprozesses auf stets wachsender Stufenleiter, die bewußte technische Anwendung der Wissenschaft, die planmäßige Ausbeutung der Erde, die Verwandlung der Arbeitsmittel in nur gemeinsam verwendbare Arbeitsmittel, die Ökonomisierung aller Produktionsmittel durch ihren Gebrauch als Produktionsmittel kombinierter, gesellschaftlicher Arbeit, die Verschlingung aller Völker in das Netz des Weltmarkts und damit der internationale Charakter des kapitalistischen Regimes. Mit der beständig abnehmenden Zahl der Kapitalmagnaten, welche alle Vorteile dieses Umwandlungsprozesses usurpieren und monopolisieren, wächst die Masse des Elends, des Drucks, der Knechtschaft, der Entartung, der Ausbeutung, aber auch die Empörung der stets anschwellenden und durch den Mechanismus des kapitalistischen Produktionsprozesses selbst geschulten vereinten und organisierten Arbeiterklasse. Das Kapitalmonopol wird zur Fessel der Produktionsweise, die mit und unter ihm aufgeblüht ist. Die Zentralisation der Produktionsmittel und die Vergesellschaftung der Arbeit erreichen einen Punkt, wo sie unverträglich werden mit ihrer kapitalistischen Hülle. Sie wird gesprengt. Die Stunde des kapitalistischen Privateigentums schlägt. Die Expropriateurs werden expropriiert.“ [xxvi]
In diesem Zitat wird schon deutlich, dass das Kapital selbst die eigentliche Schranke der Entwicklung der kapitalistischen Produktionsweise ist.
„Die kapitalistische Produktion strebt beständig, diese ihr immanenten Schranken zu überwinden, aber sie überwindet sie nur durch Mittel, die ihr diese Schranken aufs neue und auf gewaltigerm Maßstab entgegenstellen.
Die wahre Schranke der kapitalistischen Produktion ist das Kapital selbst, ist dies: daß das Kapital und seine Selbstverwertung als Ausgangspunkt und Endpunkt, als Motiv und Zweck der Produktion erscheint; daß die Produktion nur Produktion für das Kapital ist und nicht umgekehrt die Produktionsmittel bloße Mittel für eine stets sich erweiternde Gestaltung des Lebensprozesses für die Gesellschaft der Produzenten sind. Die Schranken, denen sich die Erhaltung und Verwertung des Kapitalwerts, die auf der Enteignung und Verarmung der großen Masse der Produzenten beruht, allein bewegen kann, diese Schranken treten daher beständig in Widerspruch mit den Produktionsmethoden, die das Kapital zu seinen Zwecken anwenden muß und die auf die unbeschränkte Vermehrung der Produktion, auf die Produktion als Selbstzweck, auf unbedingte Entwicklung der gesellschaftlichen Produktivkräfte der Arbeit lossteuern. Das Mittel – unbedingte Entwicklung der gesellschaftlichen Produktivkräfte – gerät in fortwährenden Konflikt mit dem beschränkten Zweck, der Verwertung des vorhandnen Kapitals. Wenn daher die kapitalistische Produktionsweise ein historisches Mittel ist, um die materielle Produktivkraft zu entwickeln und den ihr entsprechenden Weltmarkt zu schaffen, ist sie zugleich der beständige Widerspruch zwischen dieser ihrer historischen Aufgabe und den ihr entsprechenden gesellschaftlichen Produktionsverhältnissen.“ [xxvii]
In diesen wie in vielen anderen Passagen von Marx und Engels zeigt sich, dass die Marx’sche Theorie im Kern eine Krisentheorie darstellt. Die Produktionsweise strebt auf das Eklatieren ihrer inneren Widersprüche zu. Entscheidend ist dabei, dass die Entwicklung der Produktivkräfte an einem bestimmten Punkt selbst zu einer Schranke für die weitere Verwertung des Kapitals wird, dass sie, wie es Marx in den Grundrissen ausdrückt, „die Selbstverwertung des Kapitals aufhebt, statt sie zu setzen.“ [xxviii]
Der tendenzielle Fall der Profitrate führt dazu, dass ab einem bestimmten Punkt der Stachel der Akkumulation erlahmt, die Verwertung des neu geschaffenen Profits nicht mehr profitabel erscheint für das Gesamtkapital – Stagnation und Krise sind die Folge, deren einziger Ausweg in der Vernichtung überschüssigen Kapitals besteht. Dies zeigt für Marx zugleich die historischen Grenzen, die Überholtheit der kapitalistischen Produktionsweise selbst an und die Notwendigkeit, die gesellschaftliche Produktion der Kontrolle der Bourgeoisie zu entreißen und in bewusster Form zu gestalten.
„In schneidenden Widersprüchen, Krisen, Krämpfen drückt sich die wachsende Unangemessenheit der produktiven Entwicklung der Gesellschaft zu ihren bisherigen Produktionsverhältnissen aus. Gewaltsame Vernichtung von Kapital, nicht durch ihm äußere Verhältnisse, sondern als Bedingung seiner Selbsterhaltung, ist die schlagendste Form, worin ihm advice (Rat) gegeben wird, to be gone and to give room to a higher stage of social production (abzutreten und einem höheren Stadium der gesellschaftlichen Produktion Raum zu geben).“ [xxix]
In diesem Sinne vertritt Marx durchaus eine Zusammenbruchstheorie oder kann man von einer Tendenz zum Zusammenbruch sprechen, die immer wieder historische Krisen nicht nur der Akkumulation, sondern der gesamten Gesellschaftsformation hervorbringt. In seiner Arbeit „Zur Entstehungsgeschichte des Marxschen ‚Kapital’“ würdigt Roman Rosdolsky nicht nur zu Recht die Verdienste von Luxemburg und Grossmann bei der Verteidigung der Marx’schen Theorie und verweist auf die Ursachen der Angriffe auf die „Zusammenbruchstheorie“: „Die Behauptung, Marx hätte keine ‚Zusammenbruchstheorie’ aufgestellt, ist wohl vor allem auf die revisionistische Auslegung des Marxschen ökonomischen Systems vor und nach dem ersten Weltkrieg zurückzuführen.“ [xxx]
Zweifellos wurde die „Kritik“ an der sog. Zusammenbruchstheorie auch dadurch gerechtfertigt, dass ihren VertreterInnen unterstellt wurde, dass sie nicht nur von einer Krisentendenz ausgegangen seien, sondern auch deren Unüberwindbarkeit oder eine unvermeidliche Ablösung des Kapitalismus durch den Sozialismus unterstellen würden.
Im marxistischen Verständnis bedeuten solche Krisen oder Krisenperioden jedoch keinesfalls, dass es einen rein ökonomisch fixierbaren Endpunkt des Kapitalismus gibt oder auch nur geben könne. Ein Zusammenbruch stellt immer eine zeitlich begrenzte Phase dar, die auf verschiedenen Wegen möglich ist. Erstens durch eine massive Kapitalvernichtung und eine Neuordnung der Verhältnisse durch die herrschende Klasse – und sei es durch den Gebrauch barbarischer Mittel wie Krieg, Eroberung, diktatorische oder gar faschistische Herrschaft. Zweitens die revolutionäre Umgestaltung der Gesellschaft durch eine sozialistische Weltrevolution, also die fortschrittliche Aufhebung der inneren Widersprüche, wie sie Marx skizziert. Drittens kann eine historische Krise mit der Vernichtung der Hauptklassen der Gesellschaft und deren Regression in die Barbarei (oder im Extremfall der Vernichtung der Menschheit oder ihrer natürlichen Lebensgrundlagen) enden. Allein das verweist auf die entscheidende Bedeutung des subjektiven Faktors, der Entwicklung von revolutionärer Organisation und des Klassenbewusstseins für eine gesellschaftliche Umwälzung.
Daher kann sich eine revolutionäre Theorie der Gesellschaft niemals nur auf die Enthüllung der inneren Bewegungsgesetze der Kapitalismus beschränken, sondern sie muss die Notwendigkeit ihrer Verschärfung und der schließlichen revolutionären Aufhebung dieser Widersprüche ins Zentrum rücken. Jede marxistische Imperialismustheorie ist daher notwendig eine Theorie über die Niedergangsepoche des Kapitalismus, der Verschärfung seiner inneren Widersprüche.
Alle Imperialismustheorien, die revolutionären und marxistischen Anspruch erheben, müssen daher an der von Marx im Kapital entwickelten inneren Krisenhaftigkeit des Kapitalismus festhalten. Alle AutorInnen der klassischen Imperialismustheorie der II. und III. Internationale erheben diesen Anspruch, verteidigen ihn und versuchen, ihn zur Geltung zu bringen. Aber alle offenbaren auch bedeutende Schwächen, wenn es darum geht, diesen Anspruch einzulösen. So vermag z. B. keine der klassischen Imperialismustheorien, das Gesetz vom tendenziellen Fall der Profitrate zu integrieren, geschweige denn seinen zentralen Charakter für die Marx’sche Krisentheorie aufzunehmen. Im Folgenden wollen wir auch daher noch einmal einige zentrale Momente des Kapitalbegriffs darstellen, die auch Ansatzpunkte für ein Verständnis des Imperialismus bilden.
Zentrale Momente des Kapitalbegriffs
Erstens ist im Marx’schen Kapitalbegriff, wie wir gesehen haben, immer schon inkludiert, dass der Kapitalismus seinem Wesen nach eine internationale, auf den Weltmarkt bezogene Produktionsweise darstellt. In der Schaffung des Weltmarktes, dem Niederreißen vorhergehender Produktionsweisen, der Verwandlung aller Nationen in bürgerliche besteht schließlich eine der unbestritten progressiven Leistungen der kapitalistischen Produktionsweise und die weltgeschichtlich revolutionäre Rolle der Bourgeoisie in der Früh- und Blütezeit des Kapitalismus.
Zweitens verhält sich das Kapital, anders als vorhergehende Produktionsweisen, zur technischen Grundlage der Produktion und zu den Produktivkräften revolutionär, wälzt diese im Hunger auf die Aneignung von Mehrwert ständig um. Marx zeigt, dass sich dieser Mechanismus aus dem Verhältnis von Lohnarbeit und Kapital, aus der Begrenztheit der Möglichkeiten zur Steigerung der absoluten Mehrwertrate und der Notwendigkeit der Steigerung des relativen Mehrwerts ergibt. Daraus folgt notwendigerweise auch immer, dass die ArbeiterInnenklasse selbst beständig „umgewälzt“ wird und permanenter Veränderung unterliegt. Der Klassenkampf, der Kampf um die Höhe des Mehrwerts bildet ein integrales Element des Kapitalbegriffs selbst und nichts von außen, „exogen“ Hineingetragenes.
Die ständige Erhöhung der Produktivität der Arbeit drückt sich in einer fortschreitenden höheren organischen Zusammensetzung des Kapitals und einer Tendenz zum Fallen der Profitrate aus – selbst ein Ausdruck der historischen Tendenzen der Akkumulation.
Drittens – und als ein Resultat davon – führt die Entwicklung des Kapitalismus zu einer ständigen größeren Anhäufung des Kapitals, zu seiner fortschreitenden Zentralisation und Konzentration. Ein/e KapitalistIn schlägt die/den andere/n tot. Die Konkurrenz ist die Form, in der sich die inneren Gesetzmäßigkeiten des Kapitals manifestieren müssen.
Viertens entdeckt Marx die Bedeutung des industriellen Zyklus für die ständige Umwälzung und Erneuerung der technischen Grundlage der Produktion, als Basis einer neuen, erweiterten Grundlage der Akkumulation, einer dynamischen Form der Reproduktion der Widersprüche im Kapitalismus. Das „Bett“ der Dynamik des industriellen Zyklus bildet die Reproduktionsdauer der Masse des fixen Kapitals, die auch eine durchschnittliche Länge des Zyklus von 7 bis 10 Jahren konstituiert.
Das Marx’sche Verständnis des industriellen Zyklus enthält ein wichtiges Spezifikum, das es von bürgerlichen Theorien unterscheidet. Die verschiedenen Momente des Zyklus kulminieren in der Krise, dem „Ende eines Zyklus und Ausgangspunkt eines neuen“ [xxxi], dem bestimmenden Moment des Zyklus. In ihr zeigt sich die Einheit der in den anderen Phasen des Zyklus gegeneinander verselbstständigten Elemente. In ihr konzentrieren sich die Widersprüche der Kapitalbewegung und kommen eruptiv zum Ausbruch.
Fünftens muss das Kapital zur „Lösung“ seiner inneren Widersprüche, zum Entgegenwirken gegen den Fall der Profitrate, zur Aufrechterhaltung der Akkumulationsdynamik und zur weiteren Entwicklung der Produktivkraft der Arbeit dem gesellschaftlichen Charakter der Produktion im Kapitalismus Rechnung tragen. Es muss selbst mehr und mehr zu gesellschaftlichen Formen – Formen, die das Kapital auf dem Boden des Kapitalismus negieren – zurückgreifen: Aktienkapital, Kredit, Verstaatlichung.
Dahinter manifestiert sich nichts anderes als der grundlegende Widerspruch der kapitalistischen Produktionsweise: gesellschaftliche Produktion bei fortgesetzter privater Aneignung. Oben genannte Formen „gesellschaftlichen Kapitals“ lösen diesen Widerspruch nicht, sondern treiben ihn vielmehr auf die Spitze. Sie rufen nach ihrer Überwindung durch die proletarische Revolution.
Marx und Engels arbeiten nicht nur in der Analyse des Kapitals, sondern auch in den konkreten Betrachtungen der Entwicklung in den fortgeschrittenen kapitalistischen Ländern heraus, dass die innere Entwicklung des Kapitals wie auch die Politik der herrschenden Klasse mehr und mehr zu solchen „Übergangsformen“ führen, dass sich eine Veränderung der Entwicklungsrichtung des Kapitalismus selbst abzeichnet. Scharfsinnig beobachten sie deren Ausprägungen im 19. Jahrhundert.
Für Marx und Engels stellen die Ausdehnung des Aktienkapitals und andere gesellschaftliche Formen des Kapitals, seine weitere Konzentration und Zentralisation sowie die Entstehung des Finanzkapitals Zeichen dieser Entwicklung dar, um Schranken für die Entwicklung der Produktivkräfte zu überwinden. Sie sind nicht nur Ausdruck dafür, dass das Kapital auf Grenzen seiner Entwicklungsmöglichkeiten trifft, sondern bilden zugleich Austragungsformen dieses Widerspruchs. Sie verweisen darauf, dass die Bourgeoisie selbst mehr und mehr auf den Staat und solche gesellschaftlichen Formen des Kapitals zurückgreifen muss, die dem gesellschaftlichen Charakter der Produktion indirekt Rechnung tragen. In der imperialistischen Epoche schlagen sie in ihrer Gesamtheit in ihr Gegenteil um. Das Finanzkapital wird selbst zu einer Fessel der Entwicklung der Produktivkräfte und der Gesellschaft.
Sechstens sind das Finanzkapital und seine immer ausufernder werdende Bedeutung genauso wenig ein „Abirren“ der kapitalistischen Entwicklungsgeschichte wie Finanzkrisen zufällige Spekulationsverirrungen darstellen, die mit den sonstigen Krisentendenzen nicht verbunden wären. Vielmehr stellt das zinstragende Kapital die höchste Stufe der Entwicklung der Wertform der Arbeitsprodukte dar: Der Titel auf verwertbares Eigentum selbst wird zum Grund der Aneignung von Mehrwert, unbeschadet des unmittelbaren Kommandos über den zugrundeliegenden Produktionsprozess. Die Verwandlung von Geld in mehr Geld (G – G‘), die Bewegungsform des zinstragenden Kapitals, drückt in praktischer Weise die widerspruchsvolle Schrankenlosigkeit der Kapitalverwertungsbewegung aus, die sich von ihren materiellen Bedingungen in realen, produktiven Kapitalverwertungsbedingungen zu lösen versucht. Mit der notwendigen Dopplung von Kapital in Geldkapital und Unternehmensführung wird ein bestimmter Teil der Kapitalistenklasse, trotz seiner besonderen Verwertungsinteressen als Finanzkapital, gleichzeitig in gesellschaftlicher Form zum Vertreter der Verwertungsinteressen des Gesamtkapitals:
„Es kommt hinzu, daß mit Entwicklung der großen Industrie das Geldkapital mehr und mehr (…) nicht vom einzelnen Kapitalisten vertreten wird, (…) sondern als konzentrierte, organisierte Masse auftritt, die ganz anders als die reelle Produktion unter die Kontrolle der das gesellschaftliche Kapital vertretenden Bankiers gestellt ist“. [xxxii]
In der imperialistischen Epoche erscheinen die Finanzkapitale wie riesige „Planungsagenturen“, die auf Basis der Renditeziele ihrer AnlegerInnen mit ihrem Buchgeld riesige Industrie- und Handelsunternehmen auf- und abbauen, umstrukturieren, neu zusammensetzen etc. Selbst wenn die realen Verwertungsbedingungen es nicht mehr hergeben, können mit Hilfe ihrer Kreditmacht noch lange Renditen simuliert werden, im Versprechen auf sagenhafte zukünftige Profite. Auf diese Weise kann das Finanzkapital die industriellen Zyklen und Krisenperioden überlagernde Finanzmarktzyklen initiieren, die den zugrundeliegenden Krisentendenzen zeitweise entgegenwirken. Damit wird die Finanzkrise (Kreditklemme, Geldkrise, Banken- und Firmenzusammenbrüche in großem Umfang,…) zum notwendigen Moment der Krisen- und Zusammenbruchstendenz im Imperialismus. Mit der Finanzkrise wandelt sich der Finanzmarktzyklus von einer entgegenwirkenden, zu einer verstärkenden Tendenz der Kapitalverwertungsprobleme. Im Allgemeinen kündigen daher Finanzkrisen einen Periodenwechsel an (auch wenn dies nicht unmittelbar erfolgen muss).
Siebtens entwickeln sich mit dem Weltmarkt auch Weltmarktzyklen und -krisen. Ihre Bedeutung kann schwerlich überschätzt werden. „Die Weltmarktkrisen müssen als die reale Zusammenfassung und gewaltsame Ausgleichung aller Widersprüche der bürgerlichen Ökonomie gefaßt werden.“ [xxxiii]
Mit der Entwicklung der kapitalistischen Produktionsweise, des internationalen Handels und des Kapitalverkehrs nimmt auch das Gewicht der Weltmarktbewegungen für die industriellen Zyklen der jeweiligen Nationalökonomien zu, die selbst integrale Bestandteile des Weltmarktes bilden. Dieser stellt dabei nicht bloß eine Summe nationaler Märkte und Ökonomien dar, sondern bildet eine seine Teile bestimmende Realität. Wie sehr die nationalen industriellen Zyklen synchronisiert werden und einen einheitlichen Weltmarktzyklus bilden, stellt einen widersprüchlichen Prozess dar, weil das Kapital zwar einerseits zur Überwindung nationaler Barrieren drängt, andererseits die Kapitalbildung jedoch immer auf einen Nationalstaat bezogen ist. Mit der Entwicklung des Imperialismus verstetigt sich zudem die von den Metropolen und dort gebildetem Großkapital dominierte, hierarchische Ordnung der internationalen Ökonomie – ein Widerspruchsverhältnis, das auf Basis des Kapitalismus nicht überwunden werden kann, sondern vielmehr selbst Ausdruck der zunehmenden globalen Vergesellschaftung (internationale Produktionsketten, Ausweitung des Handels, des Austausches zwischen den Nationen, …) des Kapitals einerseits und seiner privaten Aneignung und damit einhergehender bornierter Zwecksetzung andererseits ist.
Achtens geht die Entwicklung der Akkumulation des Kapitals immer mit der Unterminierung und tendenziellen Zerstörung der beiden Quellen des gesellschaftlichen Eigentums einher – der lebendigen Arbeit und der natürlichen Lebensgrundlagen der Gattung Mensch. Dem Kapitalismus ist die Tendenz zur Verelendung der ausgebeuteten Klasse der Lohnabhängigen immanent. Ohne ökonomischen Kampf und den politischen Kampf um gesetzliche Schranken der Ausbeutung könnte die ArbeiterInnenklasse auf Dauer nicht einmal den Preis der Ware Arbeitskraft und somit ihre eigene Reproduktion sichern. Doch nicht nur sie ist einer ständigen Tendenz zur Zerstörung ihrer eigenen Lebensbedingungen unterworfen.
Der Kapitalismus untergräbt notwendigerweise auch die natürlichen Lebensgrundlagen der Menschheit selbst – und zwar nicht erst seit der, spätestens in den 1970er Jahren immer offenkundiger gewordenen, Drohung einer ökologischen Katastrophe. Marx weist diesen immanenten, zerstörerischen Charakter der Produktionsweise schon im Kapital nach. [xxxiv] Er verweist aber auch schon darauf, dass die kapitalistische Produktionsweise nicht nur die Klasse hervorbringt, die die zunehmend gesellschaftliche Produktion rational organisieren kann, sondern auch die Voraussetzungen für eine vernünftige Ausgestaltung des Mensch-Natur-Verhältnisses schafft – die Entwicklung der großen Industrie und der Naturwissenschaft. Doch so wie die Produktivkräfte der Menschheit letztlich von den Schranken der kapitalistischen Eigentumsverhältnisse befreit werden müssen, so kann auch nur auf Grundlage einer bewusst gesellschaftlichen Planung ein rationales Verhältnis der Menschheit im Umgang mit ihren natürlichen Lebensgrundlagen etabliert werden.
Neuntens ist die gesamte Kapitalismustheorie von Marx untrennbar mit seiner Revolutionstheorie verbunden. Die Analyse des Kapitals und seiner inneren Bewegung zeigt die Notwendigkeit der sozialistischen Revolution. Zu ihr drängt die kapitalistische Entwicklung selbst, weil der Sozialismus die einzige Lösungsform ist, in der die gesellschaftliche Entwicklung, die der Kapitalismus mit sich gebracht hat, überhaupt rational gebändigt und auf eine höhere Stufe gehoben werden kann.
In ihrer Analyse des Kapitals und der bürgerlichen Gesellschaft weisen Marx und Engels zugleich die spezifischen Elemente der proletarischen, der sozialistischen Umwälzung nach. Bekanntlich sind die vorherrschenden Gedanken – auch der beherrschten Klassen – in jeder geschichtlichen Formation jene der Herrschenden.
Im Kapitalismus werden diese auf besondere Weise geprägt. Die Wertform bringt auch eigene Formen der Ideologie hervor, objektive ideologische Gedankenformen. Die Lohnform, die Vorstellung vom „gerechten Lohn“ etc. prägen das Bewusstsein der ArbeiterInnenklasse unwillkürlich. In ihr verschwindet scheinbar die Mehrarbeit, der Mehrwert. Es erscheint, als würde der/die KapitalistIn nicht nur die notwendige, sondern die ganze Arbeit bezahlen. Auf solchen Formen – selbst Resultat der formalen rechtlichen Gleichheit des/r ArbeiterIn und KapitalistIn als WarenbesitzerInnen – baut eine ganze weitere Kette von Ideologien, Fetischformen auf. So z. B. den Staats- und Demokratiefetisch, also den Schein, dass „die Demokratie“, der „Staat“, „die Menschenrechte“ keine Herrschaftsformen oder Ideologien einer bestimmten Klasse wären, sondern über diesen stünden.
Während die Bourgeoisie als „Mittelklasse“ der feudalen Gesellschaft ihre Produktionsweise schon in deren Poren hervorbringt, in der Periode der absoluten Monarchie, sich in einer geschichtlichen Übergangsepoche im Bund mit dem Monarchen mehr und mehr herausbildet und mit dieser Entwicklung ihre spezifische Produktionsweise entfaltet, während der Adel mehr und mehr in Abhängigkeit und eine miserable Lage gerät, kann die ArbeiterInnenklasse „ihre“ zukünftige Produktionsweise nicht im Rahmen des Kapitalismus etablieren. Entwickelt, vorbereitet werden „nur“ die Produktivkräfte, die Technik, Verkehrsformen und vor allem nicht zuletzt die gesellschaftliche Gesamtarbeit selbst, die reale Lenkung der Produktion und Reproduktion der Gesellschaft durch die ArbeiterInnenklasse selbst.
Im Kapitalismus – und in der imperialistischen Epoche wird das sozusagen auf die Spitze getrieben – geht diese Entwicklung einher mit immer stärkerer Subsumtion der Arbeit unter das Kapital, immer manifester werdender Herrschaft der toten über die lebendige Arbeit. Diese Hülle, dieses Hemmnis der gesellschaftlichen Entwicklung kann nur durch die bewusste revolutionäre Aktion der Klasse gesprengt werden.
Anders herum, die Frage des Bewusstseins hat eine qualitative andere Bedeutung in der proletarischen Revolution als in der bürgerlichen. Natürlich bildeten auch die revolutionären VertreterInnen der Bourgeoisie (oft sozial gesehen radikale Angehörige des KleinbürgerInnentums) gegen den Feudaladel und seine AnhängerInnen revolutionäre Organisationen (Clubs, Parteien, Vereinigungen usw.) und brachten radikale, bürgerlich-revolutionäre Ideologien hervor, indem sie an Reformation und Aufklärung anknüpften. Aber sie konnten sich der gesellschaftlichen Bedingungen, unter denen sie kämpften, keinesfalls voll bewusst werden, ja, sie bedurften, wie Marx in „Der 18. Brumaire des Louis Bonaparte“[xxxv] anmerkt, einer gewissen (Selbst-)Täuschung, um die weltgeschichtliche Umwälzung überhaupt durchführen zu können, die zum Sieg des Kapitals führte.
Sie mussten sich diese notwendigerweise ideologisch verkleistern, weil die gesellschaftlichen Bedingungen und ihr eigenes gesellschaftliches Sein dafür noch zu unreif waren – was natürlich auch auf die mehr oder minder utopischen oder radikalen, über die bürgerlichen Kräfte hinausgehenden Ideologien und gesellschaftlichen Visionen der Unterklassen, der Verbündeten der Bourgeoisie zutrifft. Die weltgeschichtliche Selbsttäuschung, der Heroismus der bürgerlichen Revolutionen, ihr Bezug auf imaginierte oder stilisierte Idole der Vergangenheit – seien es das Alte Testament in der Englischen oder die römische Republik in der Französischen Revolution – waren notwendig, damit die Volksmasse, die plebejischen Schichten der Bevölkerung überhaupt mobilisiert werden konnten. Mit der Konsolidierung der bürgerlichen Verhältnisse und der notwendigen Enttäuschung darüber, dass sie sich nicht als Befreiung der Menschheit, sondern als Herrschaft des Kapitals entpuppten, verschwand regelmäßig das Pathos.
Die proletarische Revolution bedarf solcher Verkleisterungen nicht mehr, ja, sie sind für sie schädlich, blenden sie doch nur die eigene Klasse und ihre besten KämpferInnen.
„Die soziale Revolution des neunzehnten Jahrhunderts kann ihre Poesie nicht aus der Vergangenheit schöpfen, sondern nur aus der Zukunft. Sie kann nicht mit sich selbst beginnen, bevor sie allen Aberglauben an die Vergangenheit abgestreift hat. Die früheren Revolutionen bedurften der weltgeschichtlichen Rückerinnerungen, um über ihren eigenen Inhalt zu betäuben. Die Revolution des neunzehnten Jahrhunderts muß die Toten ihre Toten begraben lassen, um bei ihrem eignen Inhalt anzukommen. Dort ging die Phrase über den Inhalt, hier geht der Inhalt über die Phrase hinaus.“ [xxxvi]
Die ArbeiterInnenklasse kann sich nur befreien, wenn sie selbst die gesamte Gesellschaft von einem mehr oder weniger blinden, scheinbar automatischen, sich als wirtschaftlicher „Sachzwang“ manifestierenden Reproduktionszusammenhang befreit, das Verhältnis der Menschen zueinander und zur Natur bewusst und vernünftig reguliert. Zum Sozialismus und erst recht zum Kommunismus kann das Proletariat nur bewusst kommen, nur indem es sich als Klasse für sich konstituiert, sein eigenes Verschwinden als besondere Klasse vorbereitet und bewusst herbeiführt.
Diese Umgestaltung kann nur durchgeführt werden, wenn sich das Proletariat aller zentralen Produktionsmittel der Gesellschaft bemächtigt, die Staatsmacht ergreift und seine eigene Herrschaft ausübt. Nur so kann es den kapitalistischen Produktionsprozess umstrukturieren und zugleich konterrevolutionären Umstürzen vorbeugen.
Daraus ergibt sich aber auch, dass es eine ganze Periode der proletarischen Herrschaft, der Umwälzung zu einer sozialistischen Gesellschaft braucht, der Diktatur des Proletariats, in der „alte“ und „neue“, sich erst entwickelnde, Gesellschaftsformation im Überlebenskampf stehen, in der der Entscheidungskampf zwischen Kapitalismus und Sozialismus ausgefochten wird.
Wie aber kann nun das Proletariat als Klasse, dessen Dasein zwar tagtäglich zum Kampf mit dem Kapital zwingt und zum Sozialismus drängt, dessen Bewusstsein jedoch „spontan“ bürgerlich ist, zu einer revolutionären Klasse werden, von einer Klasse an sich zu einer Klasse für sich?
Indem seine bewusstesten Elemente, also die TrägerInnen des Gesamtinteresses der Klasse, zu einer politischen Kampforganisation verschmelzen. Eine solche Partei muss auf einem wissenschaftlich fundierten Programm basieren. Sie muss den anderen Parteien der ArbeiterInnenklasse die Einsicht in die historischen Ziele, den allgemeinen Werdegang usw. der Bewegung voraushaben. Sie selbst stellt die Verbindung von revolutionärer Theorie und Avantgarde dar. Die Partei ist das Vermittelnde in der Bewegung der Klasse von einer Klasse an sich zu einer für sich. Ohne revolutionäre Partei kann diese Verbindung nicht geschaffen werden und ist damit auch die Herausbildung einer in der ArbeiterInnenklasse wirkenden und verwurzelten Trägerin von Klassenbewusstsein, einer bewussten Vertreterin von revolutionärer Strategie, Taktik, Programmatik unmöglich. Ohne Herausbildung dieses bewussten Elements bleibt freilich auch die proletarische Revolution und die Transformation zum Sozialismus eine Utopie, eine Unmöglichkeit.
Schließlich geht Marx’ Revolutionstheorie – wie schon seine Kapitalanalyse – immer vom internationalen Charakter des Klassenkampfes aus. Die zukünftige sozialistische (und kommunistische) Gesellschaft kann nur international sein, oder sie ist nicht. Daher geht es vom Bund der Kommunisten, über die Erste Internationale bis zur Zweiten Internationale nie um die Formierung bloß nationaler Parteien, sondern immer um den Aufbau einer Internationale der ArbeiterInnenklasse.
4. Lenins Imperialismustheorie und die Bedeutung seines Begriffs der Epoche
Grundsätzlich liegt Lenins Imperialismustheorie das Marx’sche Kapitalismus- und Revolutionsverständnis zugrunde. Die Politik des Bolschewismus, der Kampf der internationalistischen Linken in der Zweiten Internationale, die revolutionären GegnerInnen der Burgfriedenspolitik und vor allem die frühe Dritte Internationale versuchen bewusst, an einen „unverfälschten“, vom Schematismus der Zweiten Internationalen befreiten Marxismus anzuknüpfen und diesen in einer neuen weltgeschichtlichen Lage herauszuarbeiten und weiterzuentwickeln.
Lenins Theorie kann also nicht isoliert von der geistigen Situation der damaligen internationalen ArbeiterInnenbewegung verstanden werden. Sein Werk kennzeichnet grundsätzlich ein Ringen um marxistische Prinzipien und Theorie, das selbst in Wechselwirkung zu den Arbeiten anderer MarxistInnen der Zweiten Internationale steht, ja, von diesen auch inspiriert ist. So hebt er selbst an etlichen Stellen, durchaus mit Recht, Hilferding und seine Arbeit „Das Finanzkapital“ [xxxvii] als inhaltlichen Bezugspunkt hervor.
Schon Rosa Luxemburg hatte gefordert: „Daß die Erklärung der ökonomischen Wurzel des Imperialismus speziell aus den Gesetzen der Kapitalakkumulation abgeleitet und mit ihnen in Einklang gebracht werden muß“. [xxxviii] Doch so groß Luxemburgs Verdienste in der Verteidigung der marxistischen Theorie und Positionen in vielen Fragen – nicht zuletzt auch auf dem Gebiet der ökonomischen Theorie – sind, muss festgehalten werden, dass ihre Imperialismustheorie grundlegende methodische Schwächen aufweist und ihrer eigenen Zielsetzung, die „ökonomischen Wurzeln (…) aus den Gesetzen der Kapitalakkumulation“ herzuleiten, gerade nicht erfüllt.
Darauf haben u. a. Roman Rosdolsky in „Zur Entstehungsgeschichte des Marxschen ‚Kapital’“ und Henryk Grossmann in „Das Akkumulations- und Zusammenbruchsgesetz des kapitalistischen Systems“ [xxxix] hingewiesen. Grossmann fasst seine Kritik wie folgt zusammen:
„Nicht aus den immanenten Gesetzen der Kapitalakkumulation, aus einer bestimmten Höhe derselben, leitet sie die Notwendigkeit des Untergangs des Kapitalismus ab, sondern aus der transzendenten Tatsache des Fehlens nichtkapitalistischer Länder. War für Marx die Problematik des Kapitalismus mit dem Produktionsprozeß verknüpft, so verlegt Rosa Luxemburg die für die Existenz des Kapitalismus entscheidenden Probleme aus der Produktionssphäre in die Zirkulationssphäre.“ [xl]
Hilferdings „Finanzkapital“ kommt das Verdienst zu, überhaupt den Begriff geprägt, die Formveränderungen des Kapitals und die Entstehung des Finanzkapitals ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt zu haben. Aber seine falsche Geldtheorie, die mit der Marx’schen Werttheorie bricht und unvereinbar ist, führt auch zu eine Blindheit gegenüber den sich weiter verselbstständigenden Formen des fiktiven Kapitals, zu einer Unterschätzung der Bedeutung der Börsen und Aktienmärkte. Nach dem Zusammenbruch der Zweiten Internationale treten auch die offen reformistischen und harmonistischen politischen Schlussfolgerungen zutage, die als theoretische Schwächen schon in seinem Werk angelegt sind.
Die Grundfehler, die sich exemplarisch bei Hilferding und Luxemburg zeigen, hängen mit zwei Faktoren zusammen. Erstens einer falschen Erschließung und Interpretation des Marx’schen Kapitals bzw. zentraler Kategorien; bei Hilferding die Geldtheorie (und damit auch eine Revision der Werttheorie); bei Luxemburg auch ihre Kritik am Gesetz vom tendenziellen Fall der Profitrate, ein falsches Verständnis der Reproduktionsschemata und die Ablehnung der Marx’schen Geldtheorie. Diese Fehler stehen in Verbindung mit einem ungenügenden Verständnis der Bedeutung der Abstraktionsebenen in der Methode des „Kapital“, wenn sie z. B. die Reproduktionsschemata des Zweitens Bandes als „leblose“ Darstellung missversteht, weil sie von der Existenz eines Dritten, also anderer Klassen absähen. In Wirklichkeit verkennt Luxemburg, dass es Marx bei den Reproduktionsschemata nicht um einer Darstellung der geschichtlichen Realität, sondern um einen Aspekt in der Entfaltung des Kapitals im Allgemeinen geht.
Für unseren Zusammenhang jedoch noch gewichtiger ist aber der Umstand, dass Hilferding und Luxemburg – sowie der Großteil der nachleninschen Imperialismus- und KrisentheoretikerInnen – keinen umfassenden Begriff der Epoche entwickeln.
Bei Lenins Theorie handelt es sich zweifellos um die reifste und entwickeltste Imperialismustheorie, gerade weil sein Begriff des Imperialismus auf die Totalität der Gesellschaftsformation zielt.
In seiner Broschüre „Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus. Gemeinverständlicher Abriß“ [xli] wie auch in zahlreichen anderen Arbeiten entwickelt er den Begriff des Imperialismus aus der inneren Entwicklungslogik des Kapitals. Bekanntlich arbeitet Lenin in seinem Buch Merkmale dieser neuen Formation des Kapitalismus heraus – Konzentration der Produktion und Monopol, neue Rolle der Banken, Finanzkapital (Verschmelzen von Industrie und zinstragendem Kapital), Kapitalexport, Aufteilung der Welt unter die Kapitalistenverbände und Aufteilung der Welt unter die Großmächte.
Der Begriff des Finanzkapitals und des Monopols stehen dabei im Zentrum von Lenins ökonomischer Bestimmung des Imperialismus.
„Konzentration der Produktion, daraus erwachsende Monopole, Verschmelzung oder Verwachsen der Banken mit der Industrie – das ist die Entstehungsgeschichte des Finanzkapitals und der Inhalt dieses Begriffs.“ [xlii]
Oder an anderer Stelle: „Würde eine möglichst kurze Definition des Imperialismus verlangt, so müßte man sagen, daß der Imperialismus das monopolistische Stadium des Kapitalismus ist. Eine solche Definition enthielte die Hauptsache, denn auf der einen Seite ist das Finanzkapital das Bankkapital einiger weniger monopolistischer Großbanken, das mit dem Kapital monopolistischer Industriellenverbände verschmolzen ist, und auf der anderen Seite ist die Aufteilung der Welt der Übergang von einer Kolonialpolitik, die sich ungehindert auf noch von keiner kapitalistischen Macht eroberte Gebiete ausdehnt, zu einer Kolonialpolitik der monopolistischen Beherrschung des Territoriums der restlos aufgeteilten Erde.“ [xliii]
Lenin erklärt diese Entwicklung im Anschluss an Marx und Engels aus der zunehmenden Zentralisation und Konzentration des industriellen Kapitals und der Ausdehnung „gesellschaftlicher Formen“ des Kapitals (Banken, Kredit, …). So Marx z. B. in den Grundrissen dazu:
„Solange das Kapital schwach ist, sucht es selbst noch nach den Krücken vergangner oder mit seinem Erscheinen vergehnder Produktionsweisen. Sobald es sich stark fühlt, wirft es die Krücken weg und bewegt sich seinen eigenen Gesetzen gemäß. Sobald es anfängt, sich selbst als Schranke der Entwicklung zu fühlen und gewußt zu werden, nimmt es zu Formen Zuflucht, die, indem sie die Herrschaft des Kapitals zu vollenden scheinen, durch Züglung der freien Konkurrenz zugleich die Ankündiger seiner Auflösung und der Auflösung der auf ihm beruhenden Produktionsweise sind.“ [xliv]
Marx und Engels erkennen, dass mit der Entwicklung des Kapitalismus die „freie Konkurrenz“ selbst ihr gegenläufige innere Tendenzen – eine Tendenz zum Monopol – hervorbringt. Allerdings – und darauf werden wir im nächsten Abschnitt näher eingehen müssen – inkludiert der Monopolbegriff bei Lenin eine problematische und theoretisch unklare Seite, wenn er im Anschluss an Hilferding von einer Ablösung der Konkurrenz durch das Monopol spricht.
So richtig Lenin die Tendenz zur Monopolbildung erkennt, so enthält der Begriff des „monopolistischen Stadiums“ ein grundlegendes Problem, als sein Verhältnis zur Konkurrenz als regulierendem Zwangsgesetz, das den einzelnen Kapitalen die Gesetzmäßigkeiten der Akkumulation aufzwingt, unausgearbeitet und unklar bleibt. Bei TheoretikerInnen wie Hilferding, Bucharin oder später im Stalinismus zeigen sich diese Probleme nur zu klar, da in diesem Verständnis des Imperialismus andere Gesetzmäßigkeiten das Verhältnis der Kapitale zueinander regulieren als in der „freien Konkurrenz“. Wird dies einmal als dauerhaft gegeben unterstellt oder anerkannt, hängen auch die Marx’sche Krisentheorie und insbesondere das Gesetz vom tendenziellen Fall der Profitrate in der Luft.
Wie wir weiter unten zeigen werden, bedarf die Lenin’sche Theorie an dieser Stelle einer begrifflichen und theoretischen Korrektur, um die Imperialismustheorie auf dem Boden der Marx’schen Krisentheorie ausformulieren zu können.
Hier nur soviel: Monopol und Finanzkapital wirken ähnlich wie andere „gesellschaftliche Formen“ des Kapitals Krisen entgegen, indem diese zeitweilig die Ausgleichsbewegung der Profitrate modifizieren.
Die privaten Kapitale, die eine monopolistische Stellung als Einzelkapital oder als eine Gruppe dominierender Unternehmen eines Wirtschaftszweiges erzielen, können diese Position zeitweilig nutzen, um sich auf Kosten anderer Kapitalgruppen, der imperialisierten Länder und der Gesellschaft einen höheren Anteil am Gesamtmehrwert anzueignen.
Dieser Monopolprofit geht also zeitweilig nicht in die Ausgleichsbewegung der Profitrate ein und erlaubt so, das Abladen von eigenen Krisen auf imperialisierte Länder, die ArbeiterInnenklasse und schwächere, nicht monopolistische Kapitale, deren Profitraten im Durchschnitt sinken.
Imperialismus als politisch-ökonomische Totalität
Der Imperialismus stellt – wie wir sehen werden, auch für Lenins Theorie – jedoch keineswegs nur ein rein ökonomisches Verhältnis, sondern eine historische Stufe dar, wo der Kapitalismus den Weltmarkt nicht nur geschaffen, sondern auch alle Länder, Regionen, Gebiete in diesen eingegliedert hat. Vorgefundene vorkapitalistische Produktionsweisen wurden zerstört oder der kapitalistischen untergeordnet. Die Aufteilung der Welt unter die großen Mächte und Kapitale ist abgeschlossen und kann, innerhalb gewisser Grenzen, nur durch einen Weltbrand, Krieg, Revolutionen, Konterrevolutionen verändert werden.
Zugleich sind zugeteilte Gebiete, Länder – ob nun Kolonien oder Halbkolonien – fest in diese Ordnung eingebunden. Eine „nachholende“, die fortgeschrittenen Länder einholende Entwicklung ist, von außergewöhnlichen, einzelnen Ausnahmen abgesehen, unmöglich geworden. Im Gegenteil: Die Entwicklung des Weltmarktes und der internationalen Arbeitsteilung verfestigt die von den Zentren der Kapitalakkumulation abhängige Entwicklung dieser Länder. Dass sich China als imperialistische Weltmacht etablieren konnte, hängt ironischer Weise auch eng damit zusammen, dass es für eine ganze Periode als bürokratische Planwirtschaft und degenerierter ArbeiterInnenstaat nicht von der Weltmarktkonkurrenz bestimmt war.
Grundsätzlich sind jedoch die Länder der sog. Dritten Welt in der Epoche des Finanzkapitals zur halbkolonialen oder kolonialen Einbindung in ein Weltsystem verdammt, das ihnen einen untergeordneten Platz auf dem Weltmarkt zuweist, diesen über die Institutionen des Finanzkapitals reproduziert und verfestigt und durch die diplomatische und militärische Macht der imperialistischen Staaten absichert. Nur durch die Verbindung der demokratischen (antiimperialistischen) Revolution mit der proletarischen können diese Länder befreit werden. Trotzkis Theorie der permanenten Revolution[xlv] bringt diese Entwicklung auf den Punkt. Auch aus diesem Grund stellte sie eine, an den Grundtendenzen der imperialistischen Epoche anknüpfende revolutionäre Konzeption dar, das Alter Ego von Lenins Imperialismus- und Revolutionstheorie.
Der Begriff des Finanzkapitals inkludiert auch korrekterweise, dass eine bestimmte, die fortgeschrittenste Kapitalfraktion, die Gesellschaft, einschließlich anderer Kapitalgruppen, beherrscht. Diese Herrschaft prägt und verändert auch die gesamte Klassenformierung und den gesellschaftlichen Überbau.
Daher ist Imperialismus nicht bloß eine bestimmte reaktionäre, aggressive Politik, sondern die Politik des Finanzkapitals. Eine nichtimperialistische Politik der Weltmächte ist unmöglich.
Die Unterordnung der gesamten Welt unter ein imperialistisches System und die Vorherrschaft des Finanzkapitals und Monopols bedeuten auch notwendig eine enorme Zunahme von Fäulnis, Parasitismus. Zweifellos haben diese Charakterisierungen oft auch eine missverständliche Seite, weil sie – durchaus entgegen Lenins eigenen Anmerkungen – dazu verleiten, die imperialistische Epoche als eine Jahrzehnte andauernde ökonomische Stagnations- oder Niedergangsphase zu betrachten. Wenn wir diesen Irrtum einmal geklärt haben, erweisen sich Lenins Verweise, insbesondere auf den Parasitismus als durchaus zutreffend. Der Imperialismus steigert erstens eine Tendenz, die die kapitalistische Entwicklung auch schon im 19. Jahrhundert kannte, nämlich das Auseinandertreten von Eigentum und Leitung des kapitalistischen Betriebes. Ein Teil der KapitalistInnenklasse (und ihr angelagerter kleinerer Schichten von AnlegerInnen) wird faktisch zu einer Gruppe von Menschen, die den geschaffenen Reichtum in Form der Revenue einstreifen und die operativen Geschäfte des Managements, die Überwachung der Produktion, deren Kontrolle usw. anderen Teilen der KapitalistInnenklasse oder den lohnabhängigen Mittelschichten überlassen. Die Bourgeoisie wird ökonomisch eigentlich längst überflüssig, wie schon Marx und Engels bemerken. Das verändert aber auch die Klassenstruktur des globalen Kapitalismus, sowohl in den Zentren als auch in den von den imperialistischen Staaten beherrschten Ländern, ob diese nun als Kolonien oder Halbkolonien existieren.
Lenins selbst gibt nicht nur eine knappe ökonomische Definition und Darlegung der grundlegenden Merkmale des Imperialismus. Er geht mit gutem Grund weiter:
„Wir werden später sehen, wie der Imperialismus anders definiert werden kann und muß, wenn man nicht nur die grundlegenden rein ökonomischen Begriffe (auf die sich die angeführte Definition beschränkt) im Auge hat, sondern auch den historischen Platz dieses Stadiums des Kapitalismus in bezug auf den Kapitalismus überhaupt oder das Verhältnis zwischen dem Imperialismus und den zwei Grundrichtungen innerhalb der Arbeiterbewegung. Es sei gleich bemerkt, dass der Imperialismus, in diesem Sinne aufgefasst, zweifellos ein besonderes Entwicklungsstadium des Kapitalismus darstellt.“ [xlvi]
Dieser Abschnitt über die historische Stellung des Imperialismus bildet in seinem Buch keinen „Anhang“, keinen willkürlichen Zusatz, sondern einen essenziellen Bestandteil seiner Konzeption. Für Lenin bedeutet Imperialismus „Übergangskapitalismus“. Immer wieder verwendet er auch den Terminus „sterbender Kapitalismus“ – eine Bezeichnung, die hinsichtlich der historischen Einordnung des Imperialismus und erst recht angesichts der revolutionären Lage treffend ist, die der Erste Weltkrieg schuf und die mit der Russischen Revolution einen ersten Höhepunkt fand. Auch wenn sie in der Folge dahingehend falsch interpretiert wurde, dass der Kapitalismus „automatisch“ abtreten oder „absterben“ müsse/werde oder dass die Tendenz um Absterben bzw. Übergang in jeder Entwicklungsphase der imperialistischen Epoche gleich ausgeprägt wäre. Im weltgeschichtlichen Sinn stellt sie jedoch eine Epoche des Übergangs vom Kapitalismus zum Sozialismus dar, daher eine von Kriegen und Revolutionen (und somit auch von Konterrevolutionen).
Lenins Epochenbegriff bezieht sich hier nicht nur auf die Ökonomie, sondern auf die Gesamtheit der bürgerlichen Gesellschaftsformation. Hier liegt die eigentliche, entscheidende Stärke seine Konzeption. Imperialismus wird nicht nur allgemein als Epochenbruch verstanden, sondern in seiner gesamtgesellschaftlichen Dimension (Klassenstruktur, Politik, Kultur etc.) erfasst.
Imperialistische Kette
Lenins Imperialismustheorie, insbesondere in ihren politischen Schlussfolgerungen, hatte erwiesenermaßen eine ausreichende Tiefe, um daraus richtige, revolutionäre Schlussfolgerungen zu ziehen.
Bei aller Kritik an ihr (siehe dazu weiter unten) gibt es in seiner Theorie einen damit zusammenhängenden Aspekt, der diesen Ansatz von allen anderen klassischen Imperialismustheorien positiv unterscheidet und zu politisch bedeutsamen Konsequenzen führt: Das ist der Gedanke der „imperialistischen Kette“. Während vor und im 1. Weltkrieg bei den TheoretikerInnen der Linken der 2. Internationale gewissermaßen „der Weltkapitalismus“ die Analyseebene war, sozusagen der Kapitalismus als sozioökonomische Struktur auf Weltebene gesehen wurde, führt Lenin die Differenzierung der „imperialistischen Kette“ ein (ein Gedanke, der ihm – dies nur nebenbei – auch seine einzigartige Position zur „nationalen Frage“ ermöglicht).
Der Begriff der imperialistischen Kette beinhaltet, dass die einzelnen Glieder nicht einfach als Nationalökonomien innerhalb eines globalen Weltkapitalismus begriffen werden, sondern als Staaten. D. h., es geht nicht nur um ökonomische, sondern auch um politische und militärische Faktoren, ja um die Gesamtheit der Klassenbeziehungen eines Landes. Revolutionen fänden nicht zunächst in den Ländern statt, die am weitesten entwickelt sind, sondern die imperialistische Kette bricht am schwächsten Glied. Dieser Gedanke stellt einen grundlegenden Bruch mit dem ökonomistischen Marxismusverständnis der II. Internationale dar.
Der Kapitalismus bilde auf globaler Ebene keine einheitliche Struktur. Er stelle eine Verbindung verschiedener Ebenen nationalstaatlicher wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Strukturen dar, wobei die „Kette“ als kapitalistische Kette reproduziert werden müsse. Die ökonomische Stärke bilde nur einen Faktor für den Handlungsspielraum eines imperialen Staates. Es ist jedoch die Gesamtheit der Klassenbeziehungen eines Staates, die diesen Handlungsspielraum determiniert (wobei diese wiederum durch internationale Konstellationen beeinflusst wird).
Veränderungen der Klassenstruktur
Die ökonomischen Merkmale – Monopol, Finanzkapital –, auf deren Boden der Imperialismus basiert, gehen nicht nur mit einem „Weltsystem“ einher. Sie führen natürlich auch zu einer grundlegenden Umwälzung der inneren Beziehungen jeder Nation, jedes Staates, der imperialistischen wie der vom Imperialismus beherrschten Länder.
Herrschaft des Finanzkapitals wäre undenkbar ohne eine massive Ausdehnung des repressiven Staatsapparates in allen imperialistischen Ländern, des Militarismus, der Überwachung, Durchdringung der Gesellschaft. Wie die Erfahrung zeigt, sind diese Entwicklungen durchaus auch mit der Ausdehnung formaler Demokratie und der Ausweitung demokratischer Rechte (Wahlrecht, formale Gleichheit etc.) vereinbar.
Damit geht eine viel engere Verquickung politischer und ökonomischer Macht einher als in der vorimperialistischen Epoche. Die Lenkung aller wesentlichen Geschäfte wird über Kanäle, „Netze“ von Abhängigkeitsverhältnissen mitbestimmt, die alle Institutionen der bürgerlichen Gesellschaft umspannen.
Das Finanzkapital strebt, so Lenin, nach „Herrschaft“, nicht nach „Freiheit“. D. h., der Widerspruch zwischen demokratischen Forderungen und deren reaktionären Einschränkungen nimmt in der Epoche des Finanzkapitals zu. Generell geht der Imperialismus mit der Einschränkung der Demokratie einher, er ist „Reaktion auf ganzer Linie“. Auch wächst die Bedeutung reaktionärer Ideologien wie Nationalismus, Chauvinismus, Rassismus in der imperialistischen Epoche.
Das führt zu einer Transformation des bürgerlichen Staates zur Formierung eines imperialistischen Staates/Staatapparats. Das sichert zugleich, dass die Vertiefung und viel stärkere Durchdringung der Gesellschaft durch den Staat einhergehen mit der Ausdehnung der formalen parlamentarischen Demokratie in bestimmten Perioden der Entwicklung, insbesondere in den imperialistischen Staaten.
Die Ursache dafür liegt neben der Entwicklung des imperialistischen Staatsapparates auch in der Auswirkung des Imperialismus auf die Klassenformierung der Gesellschaft. In diesem Zusammenhang können wir eine weitere Stärke von Lenins Imperialismustheorie festhalten: Mit der theoretischen Herausarbeitung der Entstehung und Existenz einer privilegierten Schicht der ArbeiterInnenklasse, der „ArbeiterInnenaristokratie“ in den imperialistischen Ländern gelingt es ihm, eine materialistische, klassenanalytisch fundierte Erklärung für den Opportunismus in der ArbeiterInnenbewegung und die Existenz einer ArbeiterInnenbürokratie zu geben.
Schon Engels beobachtete die Entstehung einer solch privilegierten Schicht im Britannien der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts und bemerkte, dass sie eine soziale Basis des Opportunismus und bürgerlicher ArbeiterInnenpolitik bilde. Er führt diese Entwicklung auf das Welthandelsmonopol des britischen Kapitalismus und dessen industrielle Überlegenheit zurück. Mit deren Niedergang verknüpft er die Erwartung, dass die sozialen Grundlagen für eine ArbeiterInnenaristokratie erodieren und damit auch der Opportunismus zurückgedrängt würde.
Entgegen seiner Prognose verallgemeinerte sich diese Entwicklung jedoch in allen imperialistischen Ländern. Selbst in den Halbkolonien entwickeln sich mehr oder weniger große Schichten der ArbeiterInnenaristokratie. Deren Entstehung (und das Wachstum bestimmter Teile der lohnabhängigen Mittelschichten) bedeutet in den imperialistischen Ländern auch eine wichtige Verbreiterung der sozialen Basis des Imperialismus. Zu Recht charakterisiert Lenin die ArbeiterInnenaristokratie als eine „soziale Hauptstütze“ des Imperialismus, deren Existenzquelle wesentlich die Extraprofite aus der kolonialen Ausbeutung bilden.
„Diese Schicht der verbürgerten Arbeiter oder der „Arbeiteraristokratie“, in ihrer Lebensweise, nach ihrem Einkommen, durch ihre ganze Weltanschauung vollkommen verspießert, ist die Hauptstütze der II. Internationale und in unseren Tagen die soziale (nicht militärische) Hauptstütze der Bourgeoisie.“ [xlvii]
Die Etablierung und Reproduktion einer relativ stabilen ArbeiterInnenaristokratie wird in der imperialistischen Epoche zu einem Kennzeichen aller wichtigen kapitalistischen Länder. Erst auf dieser Grundlage kann sich eine ArbeiterInnenbürokratie auf politischer und gewerkschaftlicher Ebene festigen und über Jahrzehnte halten. Die Gewerkschaften wie die gesamte reformistische ArbeiterInnenbewegung werden durch die institutionelle Regulation des Lohnarbeitsverhältnisses (Tarifsystem, Betriebsräte, …) und dessen Verlängerung auf politischer Ebene (Reformen, Systeme der Inkorporation) eingebunden. Diese Institutionalisierung des Klassenverhältnisses geht mit einer Entpolitisierung und Formalisierung einher, die die bürokratische Kontrolle einer solcherart verknöcherten ArbeiterInnenbewegung befördert und verstärkt.
Hinzu kommt die Tendenz zur Inkorporation der Gewerkschaften und reformistischen ArbeiterInnenbewegung in den bürgerlichen Staat – insbesondere seit dem New Deal und mit Entwicklung der Nachkriegsordnung. Wie Trotzki in seinen Arbeiten über die Gewerkschaften nachgewiesen hat, war diese Tendenz auch in der tiefen Krise der 1920er und 1930er Jahre manifest. Kurz rekapituliert, Lenins Imperialismustheorie hatte erwiesenermaßen eine ausreichende Tiefe, um daraus richtige, revolutionäre Schlussfolgerungen zu ziehen.
5. Lenins Imperialismustheorie und ihr Alter Ego – Trotzkis Theorie der permanenten Revolution
Der Beginn der imperialistischen Epoche läutet eine wichtige Transformation der internationalen sozialistischen Bewegung ein, die Entstehung vergleichsweise stabiler bürgerlicher Agenturen in der ArbeiterInnenklasse, die nicht nur eine spontane Tendenz zum bürgerlichen Bewusstsein in der Klasse zum Ausdruck bringen, sondern auch eine soziale Basis im imperialistischen System haben, einer ArbeiterInnenaristokratie (sowie die Ausweitung lohnabhängiger Mittelschichten) v. a. in den imperialistischen Ländern, später auch in den Halbkolonien.
Zugleich war es auch eine Periode, in der das theoretische, programmatische und taktische Rüstzeug der ArbeiterInnenbewegung, wie es in der vorimperialistischen Epoche entwickelt und kodifiziert wurde, einem geschichtlichen Test unterzogen wurde.
Es waren große historische Ereignisse – darunter die erste Russische Revolution, der imperialistische Krieg –, die zur Zuspitzung der politischen Kämpfe in der Zweiten Internationale und ihren Parteien führten und zu einer Weiterentwicklung und zunehmend zu einer systematischen Abrechnung mit den inneren Schwächen der Zweiten Internationale zwangen.
Zweifellos haben nicht nur Lenin und Trotzki Anteil an den theoretischen und programmatischen Fortschritten dieser Periode. Aber sie stehen für zwei miteinander verbundene bahnbrechende Fortentwicklungen der marxistischen Theorie.
Trotzkis „Theorie der permanenten Revolution“, die zuerst anhand der Russischen Revolution 1905 entwickelt und später im Zuge des Kampfes gegen die stalinistische Degeneration und in deren Gefolge anhand der Erfahrungen der chinesischen Revolution weiterentwickelt und verallgemeinert wurde, gilt es hier besonders hervorzuheben.
In seiner Analyse der Russischen Revolution knüpft Trotzki (wie viele andere russische Revolutionäre) an Marx’ und Engels’ Charakterisierung der Rolle der Bourgeoisie in der 1848er Revolution und folgenden an. Die KapitalistenInnenklasse hätte die Revolution verraten, weil sie die sich entwickelnde ArbeiterInnenklasse und deren Bestrebungen, die Revolution „zu weit“ zu treiben, schon mehr fürchtete als die Reaktion der alten Feudalklassen, zumal sie auch erkannt hatte, dass letztere zwar das politische Regime, keineswegs aber die Produktionsverhältnisse, also die Gesellschaftsordnung selbst zurückzudrehen vermochte.
Diese Unfähigkeit der russischen Bourgeoisie, die demokratische Revolution zu führen und ein ihr gemäßes politisches Regime gegen den Zarismus zu erkämpfen, erkannten auch Lenin und die Bolschewiki. Doch der entscheidende Schritt Trotzkis bestand darin, dass er erkannte, dass die Forderungen der Demokratie nur durch die Herrschaft der ArbeiterInnenklasse, nur durch das Weitertreiben der demokratischen Revolution zur sozialistischen erfüllt werden konnten – und dass umgekehrt, die ArbeiterInnenklasse diese Aufgabe nur lösen kann, wenn sie selbst an die sozialistische Umgestaltung der Produktion geht und die Russische Revolution untrennbar mit der sozialistischen Revolution im Westen verbindet.
Diese Konzeption wurde von der Geschichte spektakulär bestätigt. Anders als von den StalinistInnen und teilweise auch den SozialdemokratInnen später behauptet, stellte sie überhaupt keinen Bruch mit der Marx’schen Theorie dar. Im Gegenteil, schon im Kommunistischen Manifest oder vor allem in der Märzansprache an den Bund der Kommunisten vom März 1850 findet sich die Vorstellung der permanenten Revolution:
„Während die demokratischen Kleinbürger die Revolution möglichst rasch und unter Durchführung höchstens der obigen Ansprüche zum Abschlusse bringen wollen, ist es unser Interesse und unsere Aufgabe, die Revolution permanent zu machen, so lange, bis alle mehr oder weniger besitzenden Klassen von der Herrschaft verdrängt sind, die Staatsgewalt vom Proletariat erobert und die Assoziation der Proletarier nicht nur in einem Lande, sondern in allen herrschenden Ländern der ganzen Welt so weit vorgeschritten ist, daß die Konkurrenz der Proletarier in diesen Ländern aufgehört hat und daß wenigstens die entscheidenden produktiven Kräfte in den Händen der Proletarier konzentriert sind. Es kann sich für uns nicht um Veränderung des Privateigentums handeln, sondern nur um seine Vernichtung, nicht um Vertuschung der Klassengegensätze, sondern um Aufhebung der Klassen, nicht um Verbesserung der bestehenden Gesellschaft, sondern um Gründung einer neuen.“ [xlviii]
In den Briefen an Sassulitsch [xlix] entwickelt Marx in einer genialen Skizze den Gedanken der Verbindung der Russischen Revolution mit der des Westens – ein Beleg unter vielen, der zeigt, wie fremd Marx und Engels das Schema einer „Etappentheorie“ war, die in der „Orthodoxie“ der Zweiten Internationale Einzug gehalten hatte und zum politischen Credo des Stalinismus geworden war.
Die Fassung der Theorie der permanenten Revolution, die Trotzki im Laufe der Revolution 1905 entwickelt und in „Ergebnisse und Perspektiven“ [l] darlegt, bricht entschieden mit der Vorstellung, dass die Russische Revolution nur einen bürgerlichen Charakter annehmen könne. Im Vorwort zur Neuauflage der Schrift 1919 fasst er den Standpunkt der Theorie der permanenten Revolution knapp zusammen:
„Der Standpunkt, den der Autor damals einnahm, kann in schematischer Weise folgendermaßen formuliert werden: Gemäß ihren nächsten Aufgaben beginnt die Revolution als bürgerliche, bringt dann aber sehr bald mächtige Klassengegensätze zur Entfaltung und gelangt nur zum Sieg, wenn sie die Macht der einzigen Klasse überträgt, die fähig ist, an die Spitze der unterdrückten Massen zu treten – dem Proletariat. Einmal an der Macht, will und kann sich das Proletariat nicht auf den Rahmen eines bürgerlich-demokratischen Programms beschränken. Es kann die Revolution nur dann zu Ende führen, wenn die russische Revolution in eine Revolution des europäischen Proletariats übergeht. Dann wird das bürgerlich-demokratische Programm der Revolution zugleich mit seinem nationalen Rahmen überwunden werden, und die zeitweilige politische Herrschaft der russischen Arbeiterklasse wird sich zu einer dauernden sozialistischen Diktatur weiterentwickeln. Wenn sich aber Europa nicht vom Fleck rührt, dann wird die bürgerliche Konterrevolution die Regierung der werktätigen Massen in Rußland nicht dulden und das Land weit zurückwerfen – weit hinter die demokratische Republik der Arbeiter und Bauern. An die Macht gekommen, darf sich das Proletariat daher nicht auf den Rahmen der bürgerlichen Demokratie beschränken, sondern muß die Taktik der permanenten Revolution entfalten, d. h. die Grenzen zwischen dem Minimal- und dem Maximalprogramm der Sozialdemokratie aufheben, zu immer tiefgreifenderen sozialen Reformen übergehen und einen direkten und unmittelbaren Rückhalt in der Revolution des europäischen Westens suchen. Diese Position soll die jetzt wieder herausgegebene Arbeit, die 1904 – 1906 geschrieben wurde, entwickeln und begründen.“ [li]
In diesem Vorwort verweist Trotzki zugleich auf eine objektivistische Schwäche seiner Position und der Schriften aus den Jahren 1904 – 1906, nämlich die Vorstellung, dass alle Flügel der russischen Sozialdemokratie – Bolschewiki wie Menschewiki – unter dem Druck der Revolution „gezwungen“ wären, eine ArbeiterInnenregierung zu bilden, die bürgerliche Revolution permanent zu machen und in eine sozialistische Richtung zu treiben. Er schreibt:
„Der Autor hat anderthalb Jahrzehnte den Standpunkt der permanenten Revolution verteidigt, er erlag aber bei der Einschätzung der miteinander kämpfenden Fraktionen der Sozialdemokratie einem Irrtum. Da sie damals beide von den Perspektiven einer bürgerlichen Revolution ausgingen, nahm der Autor an, daß die Meinungsverschiedenheiten nicht so tief wären, als daß sie eine Spaltung rechtfertigten. Zur gleichen Zeit hoffte er darauf, daß der weitere Gang der Ereignisse einerseits die Kraftlosigkeit und Ohnmacht der russischen bürgerlichen Demokratie, andererseits die Tatsache, daß es für das Proletariat objektiv unmöglich sei, sich im Rahmen eines demokratischen Programms an der Macht zu halten, allen deutlich zeigen und so den Meinungsverschiedenheiten der Fraktionen den Boden entziehen würde.“ [lii]
Spätestens 1917, mit dem Übergang zum Bolschewismus bricht Trotzki mit diesem versöhnlerischen Verständnis der Partei und der objektivistischen Vorstellung, die durchaus den spontaneistischen Schwächen Luxemburgs ähnelte, dass die Macht der Ereignisse auch die OpportunistInnen wider Willen und Bewusstheit zum revolutionären Handeln zwingen würde.
Für unseren Zusammenhang – also das Verständnis der Bedeutung des Imperialismusbegriffes – noch wichtiger ist, dass Trotzki in den 1920er Jahren die Verallgemeinerung der Theorie mit dem Verständnis der Epoche knüpft.
Den kolonialen und halbkolonialen Ländern ist keine „aufholende“, die fortgeschritteneren Länder nachahmende Entwicklung mehr möglich, weil das kapitalistische Weltsystem bereits etabliert und unter einer Reihe imperialistischer Großmächte aufgeteilt ist. Die demokratische Revolution kann daher in den halbkolonialen Ländern nur unter Führung der ArbeiterInnenklasse im Bündnis mit der Bauern-/Bäuerinnenschaft durchgeführt, also nur durch das Hinüberwachsen zur sozialistischen Revolution durchgeführt werden.
„In bezug auf die Länder mit einer verspäteten bürgerlichen Entwicklung, insbesondere auf die kolonialen und halbkolonialen Länder, bedeutet die Theorie der permanenten Revolution, daß die volle und wirkliche Lösung ihrer demokratischen Aufgabe und des Problems ihrer nationalen Befreiung nur denkbar ist mittels der Diktatur des Proletariats als des Führers der unterdrückten Nation und vor allem ihrer Bauernmassen.“ [liii]
Auch wenn das Proletariat daher in den „rückständigeren“ Ländern leichter an die Macht kommen mag, so kann die Umwälzung zum Sozialismus im nationalen Rahmen nicht geleistet werden. Diese Möglichkeit hängt vielmehr von Beginn an von der internationalen Entwicklung entscheidend ab.
Schließlich verweist Trotzki immer wieder darauf, dass von einer endgültigen sozialistischen Umwälzung überhaupt nur im internationalen Rahmen gesprochen werden kann. Ein „nationaler Aufbau“, der „Sozialismus in einem Land“ ist nirgendwo möglich, selbst im fortgeschrittensten kapitalistischen Land der Welt nicht.
„Der Abschluß einer sozialistischen Revolution ist im nationalen Rahmen undenkbar. Eine grundlegende Ursache für die Krisis der bürgerlichen Gesellschaft besteht darin, daß die von dieser Gesellschaft geschaffenen Produktivkräfte sich mit dem Rahmen des nationalen Staates nicht vertragen. Daraus ergeben sich einerseits die imperialistischen Kriege, andererseits die Utopie der bürgerlichen Vereinigten Staaten von Europa. Die sozialistische Revolution beginnt auf nationalem Boden, entwickelt sich international und wird vollendet in der Weltarena. Folglich wird die sozialistische Revolution in einem neuen, breiteren Sinne des Wortes zu einer permanenten Revolution: sie findet ihren Abschluß nicht vor dem endgültigen Siege der neuen Gesellschaft auf unserem ganzen Planenten.“ [liv]
Trotzkis Theorie der permanenten Revolution stellt für die Entwicklung des revolutionären Marxismus einen Meilenstein des 20. Jahrhunderts dar. Für die theoretische und programmatische Fortentwicklung des Kommunismus steht sie auf einer Stufe mit Lenins Imperialismustheorie oder mit der Marx’schen Analyse des 18. Brumaire des Louis Bonaparte und später der Commune [lv].
Dass Lenin selbst zur Theorie der permanenten Revolution überging, die er vor dem Ersten Weltkrieg scharf bekämpft hatte (wenn auch keineswegs in der „Schärfe“, wie die StalinistInnen gern darstellen), bedarf aber einer Erklärung. Sicherlich mag Trotzkis Übergang zum bolschewistischen Parteiverständnis dabei geholfen haben, erklärt dies aber nicht.
Wichtiger ist vielmehr erstens, dass Lenins Verständnis der Russischen Revolution und der Losung der „demokratischen Diktatur der ArbeiterInnen und Bauern/Bäuerinnen“ immer eine eingeständige Klassenpolitik des Proletariats inkludierte. Hierin liegt übrigens ein substantieller Unterschied zur Verwendung dieses Terminus durch den Stalinismus, bei dem diese Formel zu einer der Unterordnung der ArbeiterInnenklasse unter die nationale Bourgeoisie führt. Insofern hatte sie einen, wie Trotzki richtig bemerkt, „algebraischen“ Charakter, was zur Folge hatte, dass jede zukünftige Revolution eine genauere Bestimmung des Verhältnisses zur Bauern-/Bäuerinnenschaft, des Inhalts dieser Klassenpolitik und des Klassencharakters der Regierungsform, die die Revolution hervorbringen sollte, erfordern würde. In den Aprilthesen hatte sich Lenin anhand der Erfahrungen der Russischen Revolution diesem Problem gestellt – und war, wie Kamenew und andere rechte Bolschewiki zu dieser Zeit richtig bemerkten, zur Position Trotzkis übergangen, ein Übergang, ohne den der Sieg des Proletariats in der Oktoberrevolution, ja, die Oktoberrevolution selbst unmöglich gewesen wäre.[lvi]
Diese Wende hatte sich jedoch schon länger vorbereitet, nämlich in der Analyse des imperialistischen Krieges, der Entwicklung der Politik des revolutionären Defätismus und der politischen Schlussfolgerung, dass die Aufgabe des Proletariats im Kriege darin bestünde, den imperialistischen Krieg zu einem „Bürgerkrieg gegen die eigene Bourgeoisie“ umzuwandeln und zur Machtergreifung der ArbeiterInnenklasse zu nutzen. Darin zeigt sich im Grunde schon ein Übergang zur Theorie der permanenten Revolution. Es ist kein Zufall, dass Lenin die politischen und programmatischen Konsequenzen, überhaupt die revolutionäre Politik im Krieg gründlicher und klarer als jede/r andere MarxistIn seiner Zeit ausarbeitete.
Ein Verdienst dieser Arbeit bestand gerade darin, dass Lenin in der Kritik des „imperialistischen Ökonomismus“[lvii] das Verhältnis von demokratischen (insbesondere des Rechts auf nationale Selbstbestimmung) und ökonomischen Forderungen im Kampf für die sozialistische Revolution präzise darlegte.
Lenin geht im Anschluss an seine Imperialismustheorie, und auch hier im Grunde in einer Parallele zur Theorie der permanenten Revolution, davon aus, dass die imperialistische Epoche generell eine der Einschränkung demokratischer Rechte bedeutet, dass die Entrechtung unterdrückter Nationen und Nationalitäten verschärft wird usw. Daraus folgert er, dass die demokratischen Fragen einen überaus explosiven Charakter erhalten werden, dass sich daher das Proletariat, will es die nichtproletarischen Massen in den Kolonien und Halbkolonien gewinnen, als Verbündeter auf die Seite der Unterdrückten stellen und um die politische Führung im Kampf um die demokratischen Aufgaben kämpfen müsse.
Andersherum: Lenin zeigt, dass in der imperialistischen Epoche eine systematische Verknüpfung der Aufgaben der bürgerlichen Revolution mit dem sozialistischen Kampf möglich ist. Er verweist dabei schon gelegentlich darauf, dass ebenso eine systematische Verknüpfung der ökonomischen Tagesaufgaben mit dem Kampf um die sozialistische Revolution notwendig ist.
6. Der programmatisch-methodische Durchbruch der Kommunistischen Internationale und des Übergangsprogramms
Diese beiden theoretischen Errungenschaften, untrennbar mit Lenin und Trotzki verknüpft, sind freilich nicht einfach nur das Werk zweier großer Theoretiker und Revolutionäre. Sie bilden vielmehr Teil einer kollektiven Anstrengung und lebendigen Debatte, gründlichen Forschung und scharfer Polemik, die die Entwicklung der Linken in der Zweiten Internationale und die Frühphase der Kommunistischen Internationale prägte.
In der Zweiten Internationale war – auch bei den Linken – das programmatische Verständnis vom Erfurter Programm der deutschen Sozialdemokratie geprägt. Diese klassische Fassung eines Minimal-/Maximalprogramms stand als Blaupause für die Programme vieler sozialdemokratischer, formell marxistischer Parteien, darunter auch der österreichischen, der Parteien auf dem Balkan oder der russischen.
Es wäre eine ahistorische Verkürzung, das Erfurter Programm mit den reformistischen Programmen unserer Epoche nur textlich zu vergleichen. Gerade der von Kautsky verfasste und von Engels begrüßte einleitende Teil stellt einen großen Fortschritt gegenüber dem Gothaer Programm dar und verortet den Grundsatzteil auf den Boden des Marxismus. Der Minimalteil war schon 1891 von Engels heftig kritisiert worden wegen seines opportunistischen Charakters.[lviii]
Die Trennung von Minimal- und Maximalprogramm stellte außerdem nicht einfach eine politische und theoretische Abweichung dar, sondern spiegelte den Charakter einer ganzen Entwicklungsphase, vor allem nach der Niederschlagung der Pariser Commune, wider, einer relativ stetigen Entwicklung, die auch einer ebensolchen Entwicklung der Politik von Partei und Gewerkschaften entsprach.
„Der Begriff der revolutionären Strategie hat sich erst in den Nachkriegsjahren durchgesetzt, ursprünglich zweifellos unter dem Einfluß der militärischen Terminologie. Aber er hat sich keineswegs zufällig durchgesetzt. Vor dem Krieg sprachen wir nur von der Taktik der proletarischen Partei, und dieser Begriff entsprach genau genug den damals herrschenden gewerkschaftlichen und parlamentarischen Methoden, die nicht über den Rahmen alltäglicher Anforderungen und Aufgaben hinausgingen. Die Taktik bezieht sich auf ein System von Maßnahmen, die auf eine besondere, naheliegende Aufgabe oder oder auf ein besonderes Feld des Klassenkampfes bezogen sind. Die revolutionäre Strategie hingegen umfaßt ein kombiniertes System von Aktionen, die in ihrer Kombination und Konsequenz darauf abzielen, das Proletariat zur Eroberung der Macht zu führen.“ [lix]
Doch mit dem Beginn der imperialistischen Epoche werden die Grenzen des sozialdemokratischen Programms deutlicher, die innerparteilichen Gegensätze in der sozialistischen Bewegung verschärften sich. Der rechte Flügel schritt praktisch zur Tat bis hin zum Ministerialismus in Frankreich, verfocht dies organisatorisch, z. B. im Ruf nach der Unabhängigkeit der Gewerkschaften von der Partei und in jeder Zurückweisung verpflichtender – als zu radikal begriffener –, Fragen, wie sich z. B. in der Generalstreikdebatte oder auch bei den Kongressen der II. Internationale zeigte. Interessanterweise versuchten zuerst TheoretikerInnen des rechten Flügels der opportunistischen Praxis höhere Weihen zu verleihen und eine Revision des Marxismus vorzunehmen. Beispielhaft dafür steht der theoretische Angriff Bernsteins auf die revolutionäre Theorie.
Schon diese Tatsache ist bezeichnend, weil sie die veränderte, zunehmend rein ökonomisch reduzierte Arbeit der Gewerkschaften und die parlamentarische, reformistische Ausrichtung vieler Parteien widerspiegelt. Noch mehr zeigt sich eine wachsende Differenz zwischen dem formell marxistischen (zentristischen) Zentrum der Zweiten Internationale und der internationalen Linken, die die zuerst um Fragen der Parteitaktik hervorbrechenden Differenzen als Grundsatzfragen zu begreifen beginnt und einen entschlosseneren Kampf gegen die Rechten fordert.
Die historischen Errungenschaften dieser Kämpfe – oft mit dem Namen Luxemburgs verbunden – bestehen darin, die marxistische Orthodoxie auf theoretischer Ebene (z. B. in Sozialreform oder Revolution) zu verteidigen und zur Entwicklung der revolutionären Taktik der ArbeiterInnenbewegung neue Anstöße zu geben. Die Linke greift in ihren Polemiken und Aktivitäten nicht zufällig Themen auf, die auch heute oft den Gegenstand der Auseinandersetzung zwischen gemäßigtem und radikalem Flügel der ArbeiterInnenbewegung bilden – Fragen der Unterdrückung der Frauen und der Jugend; die Kolonialfragen und Fragen der Migration; Militarismus und Kriegsfrage; Verhältnis von Kampfmethoden zu Reform und Revolution (siehe Generalstreikdebatte).
Aber ihre Kritik bewegt sich selbst noch wesentlich auf der Ebene des Minimal-/Maximalprogramms, sprich auf der der grundsätzlichen Revision des Marxismus durch die Rechten, oder auf der Ebene der Taktik. Die Frage der Strategie, ja, den Begriff der Strategie im Unterschied zur Taktik kennt die Zweite Internationale nicht.
In den Revolutionen 1917/1918 wird die Notwendigkeit des Bruchs mit den alten Programmen der sozialdemokratischen Parteien offensichtlich (wie die Neugründung Kommunistischer Parteien). Das trifft nicht nur auf Russland und die Bolschewiki zu. Es zeigt sich auch in Deutschland.
Auf dem Gründungsparteitag der KPD bezieht sich Luxemburg direkt auf die Notwendigkeit, das Erfurter Programm, das Minimal-/Maximalprogramm hinter sich zu lassen. In der Programmrede auf dem Gründungspartei der KPD erklärt sie zum Programm:
„Es befindet sich im bewußten Gegensatz zu dem Standpunkt, auf dem das Erfurter Programm bisher steht, im bewußten Gegensatz zu der Trennung der unmittelbaren, sogenannten Minimalforderungen für den politischen und wirtschaftlichen Kampf von dem sozialistischen Endziel als einem Maximalprogramm. Im bewußten Gegensatz dazu liquidieren wir die Resultate der letzten 70 Jahre der Entwicklung und namentlich das unmittelbare Ergebnis des Weltkrieges, indem wir sagen: Für uns gibt es jetzt kein Minimal- und kein Maximalprogramm; eines und dasselbe ist der Sozialismus; das ist das Minimum, das wir heutzutage durchzusetzen haben.“ [lx]
Ihre Lösung ist freilich ungenügend, zum Teil problematisch: Das Maximalprogramm sei nun das Minimalprogramm, das Minimalprogramm gleich der Diktatur des Proletariats. Diese Aussage mag für eine revolutionäre Lage angehen, insbesondere, wenn man bedenkt, dass sich Luxemburg sehr wohl der Notwendigkeit bewusst war, dass die neu gegründete KPD Tages- und Übergangslosungen brauchte, um die Revolution zu vertiefen, und Taktiken entwickeln musste, um überhaupt erst in der Avantgarde der Klasse, geschweige denn in der Masse des Proletariats Fuß zu fassen.
Bei Luxemburgs Formulierung erhebt sich jedoch auch die Frage, wie sich das Verhältnis von Minimal- und Maximalteil gestaltet, sollte die ArbeiterInnenklasse den revolutionären Ansturm nicht zur Machtergreifung nutzen können, sollte die herrschende Klasse neues Selbstvertrauen gewinnen und die Lage zeitweilig stabilisieren können. Musste dann das alte Minimal-/Maximalprogramm doch wieder herhalten? Oder sollte die revolutionäre Lage künstlich durch die permanente Offensive der revolutionären Minderheit wiederhergestellt werden, wie es die Ultralinken vorschlugen?
Genau auf diese Frage gibt die Kommunistische Internationale auf ihren ersten vier Kongressen (v. a. auf dem zweiten, dritten und vierten) eine Antwort – die Entwicklung der Übergangsforderungen, genauer: der Methode des Übergangsprogramms. Auch wenn die KI letztlich nie ein solches Programm annahm, so hat sie auf den ersten vier Kongressen einen historischen Beitrag dazu geleistet. Ihre Debatten, Thesen und Resolution sind bis heute eine unerlässliche Schule der kommunistischen Strategie und Debatte. Die ersten vier Kongresse waren auch eine wichtige Quelle für die Bestimmung nicht nur des Charakters der Epoche, sondern auch konjunktureller Entwicklungen des Klassenkampfes.
„Revolutionäre Politik ist ohne revolutionäre Theorie undenkbar. Hier wenigstens müssen wir nicht von vorn anzufangen. Wir stehen auf dem von Marx und Lenin geschaffenen Fundament. Die ersten Kongresse der Kommunistischen Internationale haben uns ein unschätzbares programmatisches Erbe hinterlassen. Die Charakterisierung der gegenwärtigen Epoche als der Epoche des Imperialismus, d. h. einer Epoche des kapitalistischen Niedergangs; das Wesen des gegenwärtigen Reformismus und die Methoden zu seiner Bekämpfung; die Beziehung von Demokratie und proletarischer Diktatur; die Rolle der Partei in der proletarischen Revolution; die Beziehungen zwischen Proletariat und Kleinbürgertum, insbesondere zwischen Proletariat und Bauernschaft (die Agrarfrage); die nationale Frage und der Befreiungskampf der Kolonialvölker; die Arbeit in den Gewerkschaften; die Einheitsfront-Politik; das Verhältnis zum Parlamentarismus usw. – all diese Fragen sind von den ersten vier Kongressen in bisher unübertroffener Weise prinzipiell geklärt worden.“ [lxi]
Natürlich bildete auch die beste Debatte keine Garantin gegen Fehler. Das Ausbleiben der Weltrevolution und Niederlagen hatten natürlich schon vor der Degeneration der Russischen Revolution und der Komintern zu Bürokratisierungstendenzen geführt, die ihrerseits durch politische Fehler und daraus folgende Niederlagen verschlimmert wurden.
Ohne Zweifel war das Versäumnis, die revolutionäre Situation im Sommer 1923 in Deutschland überhaupt als solche wahrzunehmen, ein Kardinalfehler nicht nur der KPD, sondern auch der gesamten Komintern. Die Niederlage des deutschen Oktober warf das Proletariat in ganz Europa weit zurück und stabilisierte die bürgerliche Herrschaft (gemeinsam mit der Wirksamkeit des Dawes-Plans).
Die „Analyse“ der Niederlage durch die KPD und die Komintern signalisieren freilich auch einen Wendepunkt in der politischen Entwicklung der KI, auch ihrer Analyse. In „Die neue Etappe“ [lxii] aus dem Jahr 1921 nimmt Trotzki auf dem dritten Weltkongress eine genaue, konkrete Analyse der Weltlage und der Frage revolutionärer Strategie und Taktik vor. Er begnügt sich nicht damit, den Charakter der imperialistischen Epoche als solchen nachzuweisen, sondern zeigt, warum ein dauerhaftes „kapitalistisches Gleichgewicht“ nicht wiederhergestellt werden konnte (einschließlich der hypothetischen Betrachtung, auf welcher Grundlage das im Verlauf von zwei bis drei Jahrzehnten möglich wäre). Er zeigt, warum „die Weltsituation und die Perspektiven“ einen „tiefen revolutionären Charakter“ tragen. Zugleich stellt er aber in Rechnung, dass das „Gleichgewicht“ des Kapitalismus „sehr elastisch“ ist und „große Widerstandskraft“ besitzt, auch wenn die Lage, wie er selbst wiederholt betont, nach wie vor „äußerst revolutionär ist“.
Schließlich weist er – und das ist in gewisser Weise das Thema des KI-Kongress – darauf hin, dass die Niederlagen der ArbeiterInnenklasse und Fehler der revolutionären ArbeiterInnenbewegung auch die Herrschaft der Bourgeoisie gefestigt hätten, ihr Selbstvertrauen, ihren Apparat, die konterrevolutionäre Rolle der ArbeiterInnenbürokratie stärkten. Statt einer ultralinken, abenteuerlichen Politik wäre daher eine Politik der Eroberung der Massen notwendig. Trotzki verweist dabei darauf, dass es keine mechanische Ableitung aus ökonomischen Krisenphänomenen zu ihrer politischen Ausformung gibt, dass daher die taktischen Aufgaben der revolutionären Parteien nicht mechanisch aus dem Charakter einer Epoche oder der „fundamentalen“ Betrachtung der Widersprüche, die zu einer weiteren Auflösung relativer Stabilität (oder überhaupt zu deren Verhinderung) führen, „abgeleitet“ und deduziert werden können. Die Sphären der Politik und des Verhältnisses zwischen den Klassen sind sehr viel vermittelter und wirken auch ihrerseits auf die Möglichkeit (oder Nicht-Möglichkeit) der herrschenden Klasse ein, das Gesamtsystem weiter zu stabilisieren.
Ganz anders verhält sich die Dritte Internationale nach dem 4. Weltkongress. Angeführt von Sinowjew setzt eine impressionistische und sterile Politik ein.
Nach ganz offensichtlichen und schweren Niederlagen wie im Oktober 1923 in Deutschland hieß es auf dem 5. Kominternkongress dazu lapidar: „Die Fehler in der Einschätzung des Tempos der Ereignisse [was für Fehler? L. T.], begangen im Oktober 1923, haben der Partei viele Schwierigkeiten gebracht. Dies ist trotz allem nur eine Episode. Die grundlegende Einschätzung bleibt bestehen.“ [lxiii]
Statt die Ursachen der Niederlage zu analysieren und eine entsprechende Neuausrichtung der deutschen Sektion zu beschließen, wurde die falsche Politik der Komintern als „im Prinzip richtig“ fortgeschrieben und nur die verantwortlichen „Umsetzer“ in Deutschland – die damalige Parteiführung um Heinrich Brandler – als „Parteirechte“ abgesetzt. Hier zeigte sich die Komintern-Führung bereits als typisch bürokratische Maschinerie, der die Selbstbeweihräucherung wichtiger ist als eine wirklich revolutionäre Führung.
Auch wenn der 5. Kongress noch eine Reihe richtiger Positionen gegen prinzipienlose Blockpolitik, falsch verstandene Einheitsfrontpolitik und andere rechte Abweichungen beschloss, so gab er auf die entscheidenden Fragen der internationalen Politik keine Antworten: auf die der neuen strategischen Orientierung nach dem Ende der revolutionären Nachkriegsperiode in Europa wie auch auf die immer drückender werdende von Bürokratisierung der Sowjetunion und ihrer weiteren ökonomischen Entwicklung angesichts des Ausbleibens der Revolution im Westen. Wie Trotzki es formulierte, wurde auf dem Kongress „jede Mücke eingehend beschaut und die Kamele glatt“ übersehen. [lxiv]
Der fünfte Kongress begann außerdem auch mit einer Abkehr von der Methode der Übergangsforderungen – beispielsweise in der falschen Identifizierung von ArbeiterInnenregierung und Diktatur des Proletariats. Die Ultralinken in der KI (in der KPD z. B.) nutzten die Gelegenheit, Übergangsforderungen wie jene nach ArbeiterInnenkontrolle überhaupt als „reformistisch“ und „sozialdemokratisch“ zu denunzieren.
Diesen Kurs setzte die stalinisierte Komintern mit Siebenmeilenschritten fort. Mit der Proklamation einer neuen, „Dritten Periode“, die eine Vertiefung der kapitalistischen Krise proklamierte, wurde der Grundstein für eine ultralinke Wendung vollzogen. Das Programm der Komintern, entworfen von Bucharin und angenommen auf dem 6. Kongress, ersetzte die konkrete Analyse vollends durch eine Sammlung allgemeiner Wahrheiten und eine Kanonisierung der „richtigen Linie“, der ihr Verfasser kurz darauf selbst zum Opfer fiel.
Die Stalinparteien führten in der „Dritten Periode“ den Kampf gegen jede Form von Übergangsforderungen – ein historisches Erbe, das jeder Form von Stalinismus bis heute anhaftet. Unwillkürlich bereitete der Stalinismus wie auf vielen anderen Ebenen die Rückkehr zur Theorie und Programmatik der Sozialdemokratie – in diesem Fall zum Minimal-/Maximalprogramm vor. Auch die „Krisentheorie“ wurde unter Stalin zu einer Rechtfertigungsideologie.
Nur Trotzki und die Vierte Internationale verteidigten die Methode der frühen Komintern und kodifizierten sie im Übergangsprogramm von 1938, dessen Methode bis heute Grundlage für das Herangehen von RevolutionärInnen an die Fragen des Programm ist.
7. Partei als Kampforganisation, Internationale als internationaler Kampfverband
Ebenso wie die Frage des Charakters des Programms und der politischen Praxis der ArbeiterInnenbewegung stellt die imperialistische Epoche die vorherrschende Parteiform der Zweiten Internationale auf den Prüfstand der Geschichte.
Die Klassenkämpfe zu Beginn des 20. Jahrhunderts, die Debatten in der russischen Sozialdemokratie und insbesondere das Scheitern der Zweiten Internationale im Krieg verdeutlichten die Notwendigkeit einer Partei und Internationale „neuen Typs“.
Es waren revolutionäre Kampforganisationen, die auf einer gemeinsamen, wissenschaftlich fundierten Programmatik, gemeinsamer Disziplin, einer aktiven, klassenbewussten Mitgliedschaft und verantwortlichen Führung, auf einem durch die Prinzipien des demokratischen Zentralismus regulierten Parteileben beruhten.
Anders als für bürgerliche oder reformistische Parteien war und ist das Programm für KommunistInnen keine Sammlung von Wünschen oder beliebigen Zielen. Es stellt eine Anleitung zum Handeln dar, ist eine Grundlage, die die Partei nicht nur ideell verbindet, sondern auch für die Aktion, zum Kampf ausrichtet und ihren Weg weist, überprüfbar und auch korrigierbar macht.
Anders als die Zweite Internationale, die letztlich eine Föderation nationaler Parteien darstellte, bildete die Dritte bis zu ihrer stalinistischen Degeneration eine Internationale, der nationale Sektionen angegliedert und ihrer revolutionären Disziplin untergeordnet waren – ein Prinzip, auf dem auch die revolutionäre, frühe Vierte Internationale basierte.
Die Bestimmung der Partei als Kampforganisation stellt das zentrale und unverzichtbare Instrument dar, die Klasse zum Sturz des Kapitalismus zu führen. Das schließt notwendigerweise nicht nur den Kampf gegen die unmittelbaren VertreterInnen und Parteien der herrschenden Klasse ein, sondern auch gegen ihre AgentInnen in der ArbeiterInnenklasse – Sozialdemokratie, Stalinismus und Gewerkschaftsbürokratie.
Im Unterschied zu frühen OpponentInnen des Marxismus in der ArbeiterInnenbewegung des 19. Jahrhunderts, die keine feste soziale Basis in der Gesellschaft hatten oder oft den Standpunkt historisch überholter Klassen vertraten, besitzt die ArbeiterInnenbürokratie im imperialistischen System eine strukturelle, soziale Basis – die Absonderung der ArbeiterInnenaristokratie als privilegierte Schicht der Klasse –, die erst mit dem Untergang des Imperialismus selbst verschwinden wird, und auch das nicht mit einem Schlag, sondern nur während einer längeren oder kürzeren Übergangsperiode.
Umgekehrt bedeutet das aber, dass eine revolutionäre Avantgardepartei und Internationale in der imperialistischen Epoche umso unverzichtbarer sind: Ein Zurückweisen der leninistischen Partei und Führung als Voraussetzung jeder erfolgreichen, genuin proletarischen Revolution ist daher nicht nur mit dem marxistischen Revolutionsverständnis, sondern auch mit einem revolutionären Verständnis der imperialistischen Epoche unvereinbar.
8. Schwächen der Theorie Lenins
Nach der Darstellung von zentralen Errungenschaften der Lenin’schen Imperialismustheorie und ihres damit einhergehenden programmatischen Erbes, das bis heute eine unverzichtbare Grundlage jeder revolutionären Politik darstellt, müssen wir jedoch auch auf Schwächen seiner Theorie eingehen. Im Laufe der letzten Jahrzehnte wurden diese vom revolutionären wie vom akademischen Marxismus zwar immer wieder thematisiert, ohne jedoch zu einer befriedigenden Lösung, also zu einer Erweiterung und Reformulierung der Imperialismustheorie geführt zu haben. Im Gegenteil, viele KritikerInnen Lenins, die durchaus zu Recht auf die fehlende Integration der Marx’schen Krisentheorie, des Gesetzes vom tendenziellen Fall der Profitrate und auf Schwächen des Monopolbegriffs hinwiesen, kippten selbst das Kind mit dem Bade aus. Erstens identifizierten sie oft fälschlich die Theorie Hilferdings mit der Lenins, zweitens verwarfen sie auch gleich jede Imperialismustheorie – damit auch den Antiimperialismus.
Um die Schwierigkeiten von Lenin zu begreifen, seine Imperialismustheorie konsequent auf den Boden der Marx’schen Kapitalanalyse zu stellen, müssen wir diese im Kontext der theoretischen Entwicklung und Diskussion der 2. Internationale und der verschiedenen theoretischen Erklärungen sehen.
In seiner Broschüre definiert Lenin den Imperialismus ökonomisch als das monopolistische Stadium des Kapitalismus. „Würde eine möglichst kurze Definition des Imperialismus verlangt, so müßte man sagen, daß der Imperialismus das monopolistische Stadium des Kapitalismus ist.“ [lxv]
Oder ausführlicher:
„Zum kapitalistischen Imperialismus aber wurde der Kapitalismus erst auf einer bestimmten, sehr hohen Entwicklungsstufe, als einige seiner Grundeigenschaften in ihr Gegenteil umzuschlagen begannen, als sich auf der ganzen Linie die Züge einer Übergangsperiode vom Kapitalismus zu einer höheren ökonomischen Gesellschaftsformation herausbildeten und sichtbar wurden. Ökonomisch ist das Grundlegende in diesem Prozeß die Ablösung der kapitalistischen freien Konkurrenz durch die kapitalistischen Monopole. Die freie Konkurrenz ist die Grundeigenschaft des Kapitalismus und der Warenproduktion überhaupt; das Monopol ist der direkte Gegensatz zur freien Konkurrenz, aber diese begann sich vor unseren Augen zum Monopol zu wandeln, indem sie die Großproduktion schuf, den Kleinbetrieb verdrängte, die großen Betriebe durch noch größere ersetzte, die Konzentration der Produktion und des Kapitals so weit trieb, daß daraus das Monopol entstand und entsteht, nämlich: Kartelle, Syndikate, Trusts und das mit ihnen verschmelzende Kapital eines Dutzends von Banken, die mit Milliarden schalten und walten. Zugleich aber beseitigen die Monopole nicht die freie Konkurrenz, aus der sie erwachsen, sondern bestehen über und neben ihr und erzeugen dadurch eine Reihe besonders krasser und schroffer Widersprüche, Reibungen und Konflikte. Das Monopol ist der Übergang vom Kapitalismus zu einer höheren Ordnung.“ [lxvi]
Lenin leitet hier die Entstehung des Imperialismus und neuer, vorherrschender Kapitalformen im wesentlichen aus dem Zentralisations- und Konzentrationsprozess des Kapitals ab, der eine neue, qualitative Stufe der Vorherrschaft großer Kapitalgruppen in den Zentren eingenommen hätte. Lenin führt dies auch recht plastisch anhand der wichtigsten Großmächte seiner Zeit – insbesondere anhand der Entwicklung des deutschen Imperialismus aus. Er verweist in seiner Kritik am Utopismus der kleinbürgerlichen Antitrustbewegung in den USA darauf, wie hoffnungslos unmöglich und reaktionär die Rückkehr einer romantisierten Marktwirtschaft, kleiner, scheinbar unabhängiger ProduzentInnen geworden sei. Hoffnungslos und unmöglich, weil die höhere Konzentration und Zentralisation des Kapitals eine höhere Entwicklung der Produktivität und Technik, einen gesellschaftlich höher stehenden Stand der Produktion und Verteilung darstellt. Reaktionär wäre die Zerschlagung der Großunternehmen oder Monopole, weil sie einen Rückschritt bedeuten würde, da mit ihrer Zerschlagung auch ein integrierter, wenn auch für die bornierten Zwecke des Kapitals zurechtgestutzter, planmäßig abgestimmter, Arbeitsprozess zerstückelt würde.
Der rasche Konzentrations- und Zentralisationsprozess und darüber die Verwandlung der Konkurrenz in Monopole, besonders, aber nicht nur, im Bank- und Kreditwesen stellen zweifellos historische Entwicklungstendenzen und empirisch nachvollziehbare Fakten dar.
Problematisch erweist sich jedoch die Gegenüberstellung von Konkurrenz und Monopol. Wenn wir das Monopol oder Trusts, Kartelle und anderen Organisationsformen der Monopole betrachten, so zeigt sich ein ungelöstes Spannungsverhältnis bei Lenin. Die „freie Konkurrenz“ wird einerseits als Grundeigenschaft des Kapitalismus und der Warenproduktion überhaupt bestimmt. Andererseits wird mit dem Monopol nicht nur eine bestimmte Kapitalgruppe gebildet, sondern eine, in deren innerem Bereich die Konkurrenz weitgehend verschwunden und aufgehoben sei, selbst wenn es sich beim Monopol um mehrere Kapitale handle. Das Monopol tritt nicht einfach neben die Konkurrenz, sondern anstelle der Konkurrenz, was das Verhältnis der dominierenden Kapitalgruppen in einer Nationalökonomie zueinander betrifft.
Zweifellos liegt eine gewisse Stärke von Lenin darin, dass er diese Tendenz wie im obigen Zitat auch relativiert und darauf verweist. „Zugleich aber beseitigen die Monopole nicht die freie Konkurrenz, aus der sie erwachsen, sondern bestehen über und neben ihr und erzeugen dadurch eine Reihe besonders krasser und schroffer Widersprüche, Reibungen und Konflikte.“
Um welche Widersprüche, welche Reibungen und Konflikte es sich dabei handelt, bleibt jedoch unklar. Bei diesen Formulierungen zeigt sich aber auch der Einfluss von Hilferdings „Das Finanzkapital“ aus dem Jahr 1910, wo dem Verhältnis von Finanzkapital und freier Konkurrenz sowie dem von Finanzkapital und Krisen zwei Abschnitte gewidmet sind.
Hilferding verweist zwar an einigen Stellen auf die Bedeutung der Marx’schen Krisentheorie und des Gesetzes vom tendenziellen Fall der Profitrate, zugleich stellt er zum Verhältnis von Kartellierung und Konkurrenz Folgendes fest:
„Die Kartelle bewirken, daß die Konkurrenz innerhalb eines Produktionszweiges aufhört oder, besser gesagt, latent wird, daß die preissenkenden Wirkungen der Konkurrenz innerhalb dieser Sphäre nicht zur Geltung kommen; sie bewirken zweitens, daß die Konkurrenz der kartellierten Sphären auf Grund einer höheren Profitrate vor sich geht gegenüber den nichtkartellierten Industrien. Aber sie können nichts ändern an der Konkurrenz der Kapitalien um die Anlagesphären, an den Wirkungen der Akkumulation auf die Preisgestaltung und deshalb die Entstehung von Disproportionalitätsverhältnissen nicht verhindern.“ [lxvii]
Für Hilferding kann zwar die Kartellierung oder Monopolisierung einzelner Branchen die Konkurrenz nicht ausschalten. Entscheidend ist jedoch, dass – anders als bei Marx – die Ausgleichsbewegung der Profitraten zwischen den Branchen, genauer zwischen kartellierten und nichtkartellierten Sektoren nicht stattfindet. Diese bilden vielmehr beständig, der Tendenz nach zunehmend, unterschiedliche Profitraten heraus. Das Kartell kann sich der Ausgleichsbewegung einer einheitlichen Profitrate des Gesamtkapitals nicht nur entziehen, es breitet seine Sphäre beständig aus, vergrößert also den Bereich, in dem die Konkurrenz außer Kraft gesetzt ist. Damit kann die Ausgleichsbewegung zur gesellschaftlichen Durchschnittsprofitrate logischerweise nicht die Bewegungen des nationalen Gesamtkapitals regulieren. Sie wirkt allenfalls im nichtkartellierten Sektor. Dasselbe gilt für das Gesetz vom tendenziellen Fall der Profitrate. Hilferdings Verweise darauf, die sich im „Finanzkapital“ durchaus finden, wirken als Fremdkörper.
Anders als in den 1920er Jahren wird die Bildung eines Generalkartells, das die gesamte kapitalistische Ökonomie planmäßig regulieren könne und solle, von Hilferding 1910 noch als „soziale und politische Unmöglichkeit“ verworfen, auch wenn es rein ökonomisch möglich wäre. Die Ursachen für die Krise des Kapitalismus bilden freilich nicht die Überakkumulation von Kapital und der tendenzielle Fall der Profitrate, sondern die Disproportionen zwischen den verschiedenen Branchen, die aus dem anarchischen Charakter der Produktion erwüchsen und sich im Imperialismus aufgrund des Gegensatzes von kartellierten und nichtkartellierten Sektoren massiv steigerten.
Lenin übernahm Hilferdings „Finanzkapital“ keineswegs kritiklos, sondern er polemisierte durchaus heftig gegen bedeutende theoretische Schwächen, so z. B. gegen dessen falsche Geldtheorie und die damit verbundene Unterschätzung von Finanz- und Bankenkrisen in der imperialistischen Epoche. Zugleich schimmert jedoch auch bei Lenins Konzeptualisierung der Konkurrenzfrage Hilferding durch. Die Konkurrenz, Reibungen und Widersprüche erwachsen wesentlich aus den nichtmonopolisierten Sphären und ihrem Verhältnis zu den monopolisierten. Daher findet sich auch bei ihm keine Behandlung des Gesetzes vom tendenziellen Fall der Profitrate, daher auch keine Integration der Marx’schen Krisentheorie in seinem Werk.
Sicherlich hängt das damit zusammen, dass der zentrale Zwecke seiner Imperialismustheorie darin bestand, eine politische und theoretische Orientierung zu geben und eine revolutionäre Programmatik (Defaitismus, internationale Strategie, Programm für die Russische Revolution, zur nationalen Frage, …) herzuleiten und nicht 1916 „nebenbei“ sämtliche Fragen zu beantworten, die MarxistInnen in den letzten mehr als 100 Jahren umtrieben. Dass seine Theorie nicht primär an Fragen orientiert war, die sich im Laufe der Entwicklung als problematisch erwiesen, kann ihm daher, wenn überhaupt, nur sehr bedingt angekreidet werden.
Dennoch müssen wir nach diesen Ausführungen zu einem Kernpunkt der Schwäche kommen, der erklärt, warum die Integration von Krisen- und Imperialismustheorie bis heute solche Probleme bereitet. Lenins Konzeptualisierung des Verhältnisses von Monopol und Konkurrenz bleibt hinter einem wesentlichen Moment des Marx’schen Kapitalbegriffs zurück. Lenin gelingt es nicht, die Erscheinungsformen der Kapitalbewegung auf der Grundlage der allgemeinen Gesetzmäßigkeiten kapitalistischer Produktion und Reproduktion zu begründen.
Bei den Marx´schen Ausführungen (im „Kapital“) ist zu unterscheiden zwischen den allgemeinen Bestimmungen bzw. abstrakten Bewegungsgesetzen des Kapitals und den realen historischen Formen, in denen sie sich darstellen.
Im Band 3 des „Kapital“ geht es eben nicht um eine konkrete Phase der „freien Konkurrenz“ des Kapitalismus, sondern die „freie Konkurrenz“ ist hier eine Abstraktion. Marx will aufzeigen, wie die Bewegungsgesetze des Kapitals sich dem Einzelkapital aufzwingen. Es ist die Form, in der sich das Einzelkapital verwertet und auf das Gesamtkapital bezieht.
Marx abstrahiert hier von allem, was die Herausbildung einer Durchschnittsprofitrate in der Realität behindert (in der Wirklichkeit setzt sich die Durchschnittsprofitrate immer nur tendenziell durch).
Marx betont, dass sich die dem Kapitalismus inhärenten Eigenschaften über die „Zwangsgesetze“ der Konkurrenz durchsetzten. In den Grundrissen formuliert das Marx so: „Begrifflich ist die Konkurrenz nichts als die innre Natur des Kapitals, seine wesentliche Bestimmung, erscheinend und realisiert als Wechselwirkung der vielen Kapitalien aufeinander, die innre Tendenz als äußerliche Notwendigkeit.) (Kapital existiert und kann nur existieren als viele Kapitalien, und seine Selbstbestimmung erscheint daher als Wechselwirkung derselben aufeinander.)“ [lxviii]
Dadurch, dass die Einzelkapitale über die Konkurrenz und die Bildung einer Durchschnittsprofitrate die Ausbeutung „vergesellschaften“, zu einem nationalen Gesamtkapital werden, werden sie zu einer Macht, die der ArbeiterInnenklasse entgegentritt.
Natürlich ändern sich historisch die Formen, in denen die Einzelkapitale versuchen, (mindestens) einen Durchschnittsprofit abzuwerfen. Aber: „Das Monopol ist nur eine Form dieses Versuchs, ist eine Erscheinungsform der Konkurrenz und ist außer durch die Konkurrenz auch nicht zu erklären. Die Aussage, das Monopol löse die ,freie Konkurrenz’ ab … impliziert, daß die ,freie Konkurrenz’ nicht eine logische Abstraktion, sondern eine tatsächliche historische Phase der Kapitalentwicklung ist, daß also Marx im 3. Band nicht die allgemeinen Bestimmungen des Kapitals als Kapital entwickelt habe, sondern eine Phase des Kapitalismus real analysiert habe … “ [lxix]
Als Folge dieser Verwechslung der Analyseebenen steht dann bei Lenin das Monopol außerhalb und/oder neben der „freien Konkurrenz“. „Man stellt in seiner Schrift durchgängig fest, daß Lenin das Verhältnis der Konkurrenz der vielen Kapitale und der Monopole nur auf der Ebene der realen Beziehungen der Einzelkapitale zueinander analysiert.“[lxx]
Es müssen zwei Ebenen unterschieden werden: a) die bei Marx abstrakt entfalteten, dem Kapitalbegriff inhärenten Bestimmungen und b) die Durchsetzung kapitalistischer Bewegungsgesetze auf der konkreten Ebene. Aus der auch von Marx vermerkten Tendenz des Kapitals zur Konzentration und Zentralisation kann nicht unmittelbar die Existenz von Monopolen abgeleitet werden, um dann auf dieser Grundlage sämtliche (oder zumindest die wesentlichen) Bewegungsformen der Kapitalakkumulation zu begreifen. Die ökonomische Basis für die Analyse des Imperialismus kann (zumindest) nicht im Konzentrationsprozess allein liegen, sondern in der Entfaltung aller Widersprüche, die im Kapital angelegt sind.
9. Kapitalbegriff und Epochenwechsel
An dieser Stelle müssen wir jedoch auch auf einen fundamentalen methodischen Schwachpunkt vieler Lenin-KritikerInnen eingehen. Ihre durchaus wichtigen Kritikpunkte gebrechen freilich an einer Schwäche – sie schütten das Kind mit dem Bade aus und verwerfen mit ihrer Kritik an Schwächen des Monopolbegriffes und der Fassung des Finanzkapitals bei Hilferding und Lenin, sofern er Hilferding übernimmt, auch die Imperialismustheorie als solche. Allenfalls taucht der Begriff in einer letztlich kautskyanischen Fassung auf, also als expansive, militärisch vorgetragene Eroberungspolitik.
Die methodische Schwäche dieser AutorInnen liegt in einer letztlich rein begriffslogischen Bestimmung der Kategorien der Kapitalanalyse. Sie verfehlen dabei jedoch gerade das Spezifische an der Marx’schen Gesellschaftstheorie und seines Bruchs mit dem Hegel’schen Systemgedanken.
Im Buch „Die ontologischen Grundprinzipien von Marx“ [lxxi], Teil der „Ontologie des gesellschaftlichen Seins“, beschäftigt sich Lukács sehr ausführlich mit dem Verhältnis von logischer und historischer Analyse des Kapitals oder generell der Gesellschaft und ihre Entwicklung. Er verweist darauf, dass die einfache Gegenüberstellung von „logischer“ oder „historischer“ Herleitung z. B. des Kapitalbegriffs zu einer ungewollten Wiederkehr des Systemgedankens Hegels führt, sei es in Form einer letztlich idealistischen Illusionen, dass verschiedenste Formen der gesellschaftlichen Wirklichkeit (Staat etc.) einfach nur aus den Kategorien des Kapitals „abgeleitet“ werden müssten, oder sei es in Form eines Geschichtsobjektivismus, demzufolge wie z. B. in der stalinistischen Geschichtsphilosophie und der Etappentheorie alle Länder und alle Regionen dieselben Gesellschaftsformationen in der „richtigen“ Reihenfolge zu durchlaufen hätten.
Das Entscheidende an Marx’ neuer, revolutionärer Methode besteht gerade in der Überwindung des Gegensatzes:
„Nicht umsonst hat Marx im ‚Kapital’ den Wert als erste Kategorie, als primäres ‚Element’ untersucht. Besonders durch die Art, wie dieser hier in seiner Genesis erscheint: Diese Genesis zeigt einerseits abstrakt, auf ein entscheidendes Moment reduziert, den allgemeinsten Abriß einer Geschichte der gesamten ökonomischen Wirklichkeit, andererseits erweist die Auswahl sogleich ihre Fruchtbarkeit, indem diese Kategorien selbst, zusammen mit den Verhältnissen und Beziehungen, die aus ihrer Existenz notwendig folgen, das Wichtigste an der Struktur des gesellschaftlichen Seins, die Gesellschaftlichkeit der Produktion zentral erhellen. Die Genesis des Werts, die Marx hier gibt, beleuchtet sofort die Doppelheit seiner Methode: Diese Genesis selbst ist weder eine logische Deduktion aus dem Begriff des Werts noch eine induktive Beschreibung der einzelnen historischen Etappen seiner Entfaltung, bis er seine reine gesellschaftlichen Gestalt erhält, sondern eine eigenartige, neuartige Synthese, die die historische Ontologie des gesellschaftlichen Seins mit dem theoretischen Aufdecken seiner konkret und real wirksamen Gesetzlichkeiten theoretisch-organisch vereint.“ [lxxii]
Marx selbst reflektiert diese Zusammenhänge immer wieder in den methodischen Überlegungen zu den Grundrissen oder im Kapital. Entscheidend für unsere Diskussion der Imperialismustheorie erweist sich, dass auch der Kapitalbegriff von Marx notwendigerweise ein historisches Moment, ein Entwicklungsmoment enthält. Wenn Marx die geschichtlichen Tendenzen der kapitalistischen Akkumulation im ersten Band des Kapitals zusammenfasst: „Das Kapitalmonopol wird zur Fessel der Produktionsweise, die mit und unter ihm aufgeblüht ist. Die Zentralisation der Produktionsmittel und die Vergesellschaftung der Arbeit erreichen einen Punkt, wo sie unverträglich werden mit ihrer kapitalistischen Hülle. Sie wird gesprengt. Die Stunde des kapitalistischen Privateigentums schlägt. Die Expropriateurs werden expropriiert.“ [lxxiii]
Marx’ und Engels’ häufige Hinweise darauf, dass das Kapital in seinem Entwicklungsprozess mehr und mehr gesellschaftliche Formen (Aktienkapital, Rolle von Banken und Börse, Staatsintervention, … ) annehme, verbinden sie korrekterweise damit, dass sich darin unbewusst und auf Basis des Privateigentums der zunehmende gesellschaftliche Charakter der Produktion artikuliert. Die von Hilferding und Lenin konstatierten Monopolisierungstendenzen und die Herausbildung eines Finanzkapitals, also die enge Verbindung oder gar Verschmelzung von Banken- und Industriekapital sind selbst ein Teil dieser Tendenz zur Vergesellschaftung. Insofern kommt beiden das Verdienst zu, eine reale Veränderung der Kapitalbewegung mit dem Epochenwechsel in Verbindung zu bringen.
Der Monopolbegriff enthält jedoch entscheidende Schwächen, wie wir gesehen haben, als das Verhältnis von Monopol und Konkurrenz falsch bestimmt wird, als wären sie auf derselben Ebene der Abstraktion angesiedelt – übrigens ein ähnlicher Fehler wie die Ansiedelung des Gesetzes vom tendenziellen Fall der Profitrate und der entgegenwirkenden Ursachen auf derselben.
Vielmehr setzen die entgegenwirkenden Ursachen das Gesetz des tendenziellen Falls der Profitrate logisch und geschichtlich voraus. Sie heben es nicht auf oder setzen es auch nicht zeitweilig „außer Kraft“, als ob einmal jene geschichtliche Tendenz und einmal die andere dominieren würde, sie sind vielmehr Modifikationen einer grundlegenden Gesetzmäßigkeit und zugleich auch Formen, über die sich diese Gesetzmäßigkeit durchsetzt. Dasselbe kann von der Konkurrenz im Verhältnis zum Monopol gesagt werden, was Lenin in gewisser Weise auch andeutet und weit mehr als Hilferding u. a. betont, aber begrifflich nicht zu fassen kriegt.
Die begriffliche Schwäche hat aber nicht nur Auswirkungen auf den Monopolbegriff, Hilferdings „kartellierte Sphäre“, sondern auch auf den des Finanzkapitals. Die wachsende Bedeutung des zinstragenden Kapitals und seiner Institutionen diskutierten bekanntlich schon Marx und Engels. Diese Entwicklung konstatiert Lenins sicher zu Recht:
„Die Trennung des Kapitaleigentums von Anwendung des Kapitals in der Produktion, die Trennung des Geldkapitals vom industriellen oder produktiven Kapital, die Trennung des Rentners, der ausschließlich vom Ertrag des Geldkapitals lebt, vom Unternehmer und allen Personen, die an der Verfügung über das Kapital unmittelbar teilnehmen, ist dem Kapitalismus überhaupt eigen. Der Imperialismus oder die Herrschaft des Finanzkapitals ist jene höchste Stufe des Kapitalismus, wo diese Trennung gewaltige Ausdehnung erreicht. Das Übergewicht des Finanzkapitals über alle übrigen Formen des Kapitals bedeutet die Vorherrschaft des Rentners und der Finanzoligarchie, bedeutet die Aussonderung weniger Staaten, die finanzielle ‚Macht’ besitzen.“ [lxxiv]
Lenins Begriff des Finanzkapitals enthält jedoch zwei wichtige Probleme. Einerseits schwebt ihm die spezifische Organisationsform des Verhältnisses von Industrie und Geldkapital nicht nur als Beispiel zur Veranschaulichung dieser Tendenz vor, sondern geradezu als Muster einer globalen Entwicklungstendenz. Die extrem enge Verbindung von Industrie und Banken im Deutschen Reich, die im Ersten Weltkrieg noch massiv verstärkt wurde, stellte jedoch eine Besonderheit des deutschen Imperialismus dar, während sie insbesondere in den USA immer andere, losere Formen annahm. Erst recht trifft das auf die Entwicklungen nach dem Zweiten Weltkrieg zu.
Sicherlich ist Lenins Vorstellung einer Verallgemeinerung des Verhältnisses von industriellem und Geldkapital nach dem Modell des deutschen Imperialismus historisch nachvollziehbar. Angesichts der real viel stärkeren Integration von staatlichem Kommando und verschiedenen Kapitalgruppen im imperialistischen Weltkrieg drängte sie sich geradezu auf. Angesichts der historischen Entwicklung bedarf dies jedoch einer Korrektur. Sein Begriff des Finanzkapitals ist zu konkret auf spezifische historische Formen fokussiert.
Damit verbunden ist ein weiteres Problem, das das innere Verhältnis des Finanzkapitals betrifft. Die Konkurrenz erscheint bei Hilferding und Lenin im Wesentlichen außerhalb des monopolisierten oder kartellierten Sektors zu bestehen, d. h. auch außerhalb des Finanzkapitals. Die darin zusammengefassten Einzelkapitale erscheinen faktisch tendenziell als ein vereintes Kapital, jedenfalls als eines, dessen Binnenbeziehungen nicht durch die Konkurrenz vermittelt werden. Betrachten wir die Entwicklung des Finanzkapitals in der gesamten imperialistischen Epoche, erweist sich diese Vorstellung als unhaltbar. Selbst in ihren Frühphasen ist sie fragwürdig, auch wenn eine solche Entwicklungstendenz gerade im Ersten Weltkrieg durchaus plausibel gewesen sein mag.
Im Rückblick, also angesichts einer ein ganzes Jahrhundert umfassenden weiteren Entwicklung, erweist sich Lenins Fassung des Begriffs des Finanzkapitals als zu wenig abstrakt, und wir müssen ihn allgemeiner bestimmen.
Korrekt ist zweifellos (a) die Tendenz zur engeren Verbindung von Industrie und Finanzsektor und (b) die Dominanz des Geldkapitals bzw. des zinstragenden Kapitals. Die Dominanz des Letzteren ergibt sich daraus, dass es an keine stoffliche Basis gebunden ist, dass es rascher und freier von einer Anlagesphäre zur anderen geleitet werden kann. Zweitens bedarf jede große industrielle Unternehmung enormer zusätzlicher Aufwendungen für Investitionen über den im eigenen Betrieb erwirtschafteten Akkumulationsfonds hinaus, die über Aktienmärkte, Anlagefonds, Unternehmensanleihen, Kredite etc. gefunden werden müssen.
Marx selbst beschäftigt sich mit den Auswirkungen des Kredits auf das industrielle Kapital, insbesondere im Kapitel „Die Rolle des Kredits in der kapitalistischen Produktion“ und konstatiert dabei bedeutende Phänomene, die auf die Entstehung eines Finanzkapitals im Sinne Lenins durchaus hinweisen. Neben der Vermittlung der Ausgleichsbewegung der Profitrate, der Beschleunigung der Zirkulation und der Verringerung der Zirkulationskosten verweist er mit der Bildung des Aktienkapitals – wenn man so will, einer Form von Finanzkapital – auf folgende Auswirkungen:
„1. Ungeheure Ausdehnung der Stufenleiter der Produktion und Unternehmungen, die für Einzelkapitale unmöglich waren. Solche Unternehmungen zugleich, die früher Regierungsunternehmungen waren, werden gesellschaftliche.
2. Das Kapital, das an sich auf gesellschaftlicher Produktionsweise beruht und eine gesellschaftliche Konzentration von Produktionsmitteln und Arbeitskräften voraussetzt, erhält hier direkt die Form von Gesellschaftskapital (Kapital direkt assoziierter Individuen) im Gegensatz zum Privatkapital, und seine Unternehmungen treten auf als Gesellschaftsunternehmungen im Gegensatz zu Privatunternehmungen. Es ist die Aufhebung des Kapitals als Privateigentum innerhalb der Grenzen der kapitalistischen Produktionsweise selbst.
3. Verwandlung des wirklich fungierenden Kapitalisten in einen bloßen Dirigenten, Verwalter fremdes Kapitals, und der Kapitaleigentümer in bloße Eigentümer, bloße Geldkapitalisten. Selbst wenn die Dividenden, die sie beziehn, den Zins und Unternehmergewinn, d. h. den Totalprofit einschließen (denn das Gehalt des Dirigenten ist, oder soll sein, bloßer Arbeitslohn einer gewissen Art geschickter Arbeit, deren Preis im Arbeitsmarkt reguliert wird, wie der jeder andren Arbeit), so wird dieser Totalprofit nur noch bezogen in der Form des Zinses, d. h. als bloße Vergütung des Kapitaleigentums, das nun ganz so von der Funktion im wirklichen Reproduktionsprozeß getrennt wird wie diese Funktion, in der Person des Dirigenten, vom Kapitaleigentum. Der Profit stellt sich so dar (nicht mehr nur der eine Teil desselben, der Zins, der seine Rechtfertigung aus dem Profit des Borgers zieht) als bloße Aneignung fremder Mehrarbeit, entspringend aus der Verwandlung der Produktionsmittel in Kapital, d. h. aus ihrer Entfremdung gegenüber den wirklichen Produzenten, aus ihrem Gegensatz als fremdes Eigentum gegenüber allen wirklich in der Produktion tätigen Individuen, vom Dirigenten bis herab zum letzten Taglöhner. In den Aktiengesellschaften ist die Funktion getrennt vom Kapitaleigentum, also auch die Arbeit gänzlich getrennt vom Eigentum an den Produktionsmitteln und an der Mehrarbeit.“ [lxxv]
Darüber hinaus verweist er auch darauf, dass diese bestimmten Formen des zinstragenden Kapitals zeitweilig dazu führen können, dass diese Gesellschaftsunternehmungen von der Ausgleichsbewegung der Profitrate ausgenommen werden können [lxxvi] und auch auf die Tendenz zur Monopolbildung.
Allerdings bleibt die Bewegung, diese Tendenz zur Aufhebung des Kapitalismus auf Basis des Kapitalismus, in inneren Widersprüchen befangen:
„Es ist dies die Aufhebung der kapitalistischen Produktionsweise innerhalb der kapitalistischen Produktionsweise selbst und daher ein sich selbst aufhebender Widerspruch, der prima facie (anscheinend, offensichtlich; d. Red.) als bloßer Übergangspunkt zu einer neuen Produktionsform sich darstellt. Als solcher Widerspruch stellt er sich dann auch in der Erscheinung dar. Er stellt in gewissen Sphären das Monopol her und fordert daher die Staatseinmischung heraus. Er reproduziert eine neue Finanzaristokratie, eine neue Sorte Parasiten in Gestalt von Projektenmachern, Gründern und bloß nominellen Direktoren; ein ganzes System des Schwindels und Betrugs mit Bezug auf Gründungen, Aktienausgabe und Aktienhandel. Es ist Privatproduktion ohne die Kontrolle des Privateigentums.“ [lxxvii]
Und weiter: „In dem Aktienwesen existiert schon Gegensatz gegen die alte Form, worin gesellschaftliches Produktionsmittel als individuelles Eigentum erscheint; aber die Verwandlung in die Form der Aktie bleibt selbst noch befangen in den kapitalistischen Schranken; statt daher den Gegensatz zwischen dem Charakter des Reichtums als gesellschaftlicher und als Privatreichtum zu überwinden, bildet sie ihn nur in neuer Gestalt aus.“ [lxxviii]
Daraus erklärt sich auch, warum die Bewegungen des zinstragenden Kapitals, zumal wenn wir den Kredit nicht nur auf das industrielle, sondern auf Kapitaleigentum selbst, auf Kapital als Ware beziehen, dass sich – ähnlich wie das Monopol – das zinstragende Kapital von den Schranken der Ausgleichsbewegung der Durchschnittsprofitrate zu „befreien“ versucht, was die Form von Spekulation, Finanzblasen, abgeleiteten Geschäften, Glücksritterei annimmt. In jedem Fall geht diese mit einer Zunahme des Parasitismus einher, weil eine ganze Schicht von VermögensbesitzerInnen geschaffen wird, die keine Rolle für die eigentliche Produktion spielt, wohl aber eben, weil sie Kommando über das gesellschaftliche Gesamtkapital immer wesentlicher mit ausübt, sich daran bereichert.
Letztlich bleibt aber auch das Finanzkapital an die Ausgleichsbewegung der gesellschaftlichen Durchschnittsprofitrate und die Mehrwertproduktion gebunden – so sehr es sich auch über längere Zeitabschnitte davon zu befreien scheint (oder den AnlegerInnen ein solche Befreiung mit ständig steigenden Renditeversprechen verheißt). Daher bleibt letztlich auch das Verhältnis der verschiedenen Seiten des Finanzkapitals – von industriellem und zinstragendem, der verschiedenen Profitabilitätserwartungen auch der Großkapitale – über die Konkurrenz vermittelt.
Eine solche Korrektur des Begriffs des Finanzkapitals erscheint uns notwendig, weil er so für die gesamte Epoche nutzbar gemacht werden kann und weil er so gerade der Phase nach 1945 weitaus mehr entspricht.
10. Vereinseitigungen der Theorie und ihre Folgen
Wir haben gesehen, dass im Monopolbegriff von Hilferding, aber auch von Lenin bereits ein grundlegendes Problem angelegt ist – die Frage der Bestimmung des Verhältnisses von Konkurrenz und Monopol.
Bei Hilferding kommt dies schon im „Finanzkapital“ zum Ausdruck, wenn er die theoretische Möglichkeit eines organisierten, regulierten Kapitalismus ins Auge fasst. Hinzu kommt, dass er – unter anderem auch eine Folge seiner falschen Geldtheorie, die dieses wesentlich als Zirkulationsmittel auffasst und die Wertbestimmung des Geldes in die Zirkulation verlagert – die Ungleichgewichte (Disproportionen) in den Tauschbeziehungen als eigentliche Krisenursache im Kapitalismus betrachtet. Es ist daher in seinem Sinne nur folgerichtig, dass, je stärker monopolisiert eine Ökonomie, je mehr sie über Kartelle oder staatliche Intervention reguliert und staatskapitalistisch geplant wird, die Krisen in den Hintergrund treten – jedenfalls bei einer richtigen staatlichen Lenkung.
„Mit der Entwicklung des Bankwesens, mit der immer enger werdenden Verflechtung der Beziehungen zwischen Bank und Industrie verstärkt sich die Tendenz, einerseits die Konkurrenz der Banken untereinander immer mehr auszuschalten, anderseits alles Kapital in der Form von Geldkapital zu konzentrieren und es erst durch die Vermittlung der Banken den Produktiven zur Verfügung zu stellen. In letzter Instanz würde diese Tendenz dazu führen, daß eine Bank oder eine Bankengruppe die Verfügung über das gesamte Geldkapital erhielte. Eine solche ‚Zentralbank’ würde damit die Kontrolle über die ganze gesellschaftliche Produktion ausüben.“ [lxxix]
Von hier ist es nicht mehr weit zum „Generalkartell“, das bei Hilferding die kapitalistische Ökonomie umfasst:
„Es entsteht aber die Frage, wo die Grenze der Kartellierung eigentlich gegeben ist. Und diese Frage muß dahin beantwortet werden, daß es eine absolute Grenze für die Kartellierung nicht gibt. Vielmehr ist eine Tendenz zu stetiger Ausbreitung der Kartellierung vorhanden. Die unabhängigen Industrien geraten, wie wir gesehen haben, immer mehr in Abhängigkeit von kartellierten, um schließlich von ihnen annektiert zu werden. Als Resultat des Prozesses ergäbe sich dann ein Generalkartell. Die ganze kapitalistische Produktion wird bewußt geregelt von einer Instanz, die das Ausmaß der Produktion in allen ihren Sphären bestimmt. Dann wird die Preisfestsetzung rein nominell und bedeutet nur mehr die Verteilung des Gesamtprodukts auf die Kartellmagnaten einerseits, auf die Masse aller anderen Gesellschaftsmitglieder anderseits. Der Preis ist dann nicht Resultat einer sachlichen Beziehung, die die Menschen eingegangen sind, sondern eine bloß rechnungsmäßige Art der Zuteilung von Sachen durch Personen an Personen. Das Geld spielt dann keine Rolle. Es kann völlig verschwinden, da es sich ja um Zuteilung von Sachen handelt und nicht um Zuteilung von Werten. Mit der Anarchie der Produktion schwindet der sachliche Schein, schwindet die Wertgegenständlichkeit der Ware, schwindet also das Geld. Das Kartell verteilt das Produkt. Die sachlichen Produktionselemente sind wiederproduziert worden und werden zu neuer Produktion verwendet. Von dem Neuprodukt wird ein Teil auf die Arbeiterklasse und die Intellektuellen verteilt, der andere fällt dem Kartell zu beliebiger Verwendung zu. Es ist die bewußt geregelte Gesellschaft in antagonistischer Form. Aber dieser Antagonismus ist Antagonismus der Verteilung. Die Verteilung selbst ist bewußt geregelt und damit die Notwendigkeit des Geldes vorüber. Das Finanzkapital in seiner Vollendung ist losgelöst von dem Nährboden, auf dem es entstanden. Die Zirkulation des Geldes ist unnötig geworden, der rastlose Umlauf des Geldes hat sein Ziel erreicht, die geregelte Gesellschaft, und das Perpetuum mobile der Zirkulation findet seine Ruh’.“ [lxxx]
Im „Finanzkapital“ betrachtet Hilferding das Generalkartell jedoch noch als bloß theoretische Möglichkeit, weil es nur aus enormen Klassenkämpfen und Erschütterungen der Gesellschaft entstehen könne. Die reformistischen und harmonistischen Schlussfolgerungen liegen jedoch schon in der „Hypothese“ klar auf der Hand. Mit seinem Übergang vom marxistischen Zentrum der II. Internationale zum offenen Reformismus und Sozialpatriotismus geht Hilferding auch in seinen politischen Schlussfolgerungen nach rechts. Das „Generalkartell“ soll, mit ihm als sozialdemokratischem Finanzminister, als „organisierter Kapitalismus“ Wirklichkeit werden.
Auf dem Kieler Parteitag der SPD 1927 präsentierte Hilferding seine Theorie und stellte fest, dass wir „zu einer kapitalistischen Organisation der Wirtschaft kommen, also von der Wirtschaft des freien Spiels der Kräfte zur organisierten Wirtschaft. (…) Organisierter Kapitalismus bedeutet also in Wirklichkeit den prinzipiellen Ersatz des kapitalistischen Prinzips der freien Konkurrenz durch das sozialistische Prinzip der planmäßigen Produktion.“ [lxxxi]
Hier zeigt sich, welche fatalen Schlussfolgerungen in der Theorie Hilferdings angelegt sind. Natürlich sind es nicht einfach seine Schwächen, die dazu führen. Der Übergang der Sozialdemokratie ins bürgerliche Lager bildet die Triebkraft, die Hilferding nach rechts treibt und damit das Generalkartell von einer theoretischen Möglichkeit in eine Form des „organisierten Kapitalismus“ zur theoretischen Rechtfertigung bürgerlicher ArbeiterInnenpolitik verwandelt.
Natürlich wird nicht jede/r ReformistIn, der/die einen falschen oder unzureichenden Begriff von Monopol, Finanzkapital und ihrem Verhältnis zu den allgemeinen Gesetzen des Kapitalismus hat. Aber unabhängig vom Willen Einzelner enthalten die Theorien und Begrifflichkeiten immer eine Eigenlogik, deren innere Probleme früher oder später als politische Fehler, im schlimmsten Fall als Revisionismus zum Vorschein treten.
Es ist jedenfalls kein Zufall, dass die Hilferding’sche falsche Konzeption von Krisen, Geldtheorie und der geschichtlichen Tendenzen des Finanzkapital zu reformistischen Schlussfolgerungen führte, ja führen musste.
Lenin war sich dieser Tatsache durchaus bewusst – und zwar nicht nur, weil sich Hilferding als Sozialpazifist im Weltkrieg erwies und, ähnlich Kautsky, die Rolle eines Versöhnlers gegenüber der Mehrheitssozialdemokratie spielte, in deren Schoß er schließlich zurückkehrte. Lenin bemerkt und kritisiert in den Exzerpten zum „Finanzkapital“ [lxxxii] wie in seinen Schriften Hilferdings idealistische philosophische Anschauungen (seinen „Machismus“), die Vorstellung, dass Geld ohne Wert in die Zirkulation eingehe, seine harmonistische Vorstellung, dass die zunehmende Konzentration und Zentralisation von Banken die Krise abschwäche. Lenin notiert in den Exzerpten auch, dass „von den einzelnen Kartellen eine Aufhebung der Krisen erwarten“ einer „Einsichtslosigkeit“ [lxxxiii] auf Seiten Hilferdings gleichkomme.
Im Unterschied zu Letzterem geht Lenin auch nicht von einer Beseitigung der Konkurrenz und der Krisen aus – er betrachtet die zunehmende Tendenz zum Monopol durchaus auch als etwas, das gegenläufige Tendenzen mit hervorbringt. Aber wie wir gesehen haben, greift hier Lenins Kritik gegenüber Hilferding zu kurz. Seine ausgewogenere, offenere und dialektischere Position unterscheidet sich daher jedoch durchaus grundsätzlich vom Reformismus als Kernelement der Hilferding’schen Auffassung.
Doch gerade dessen Fehler wirken bis heute nach. Einerseits greifen sehr viele reformistische Konzeptionen auf eine falsche Krisentheorie, sei es eine Disproportionalitätstheorie oder eine Unterkonsumtionstheorie zurück. Letztere Auffassung findet sich bei Kautsky (und auch bei Rosa Luxemburg). Die Krisen werden nicht aus der Akkumulation des Kapitals, also seiner inneren Bewegung hergeleitet, sondern aus der Zirkulationssphäre oder dem beschränkten Konsum, sodass es naheliegt, dass sie mithilfe staatlicher Regulierung und Intervention beseitigt, durch Umverteilung gelöst werden können. Während die Sozialdemokratie (und die von ihr dominierten Gewerkschaften) nach dem Ersten Weltkrieg die Theorie des „organisierten Kapitalismus“ in eine bürgerlich-harmonistische Politik einbetteten und nach 1945 mit bürgerlichen Theorien wie dem Keynesianismus kombinierten, griffen einige kommunistische TheoretikerInnen, vor allem Bucharin, die Hilferding’sche Vorstellung einer Ausschaltung der Konkurrenz im Rahmen einer Nationalökonomie auf und radikalisierten sie gewissermaßen, wenn auch zuerst mit ultralinken und keineswegs mit harmonischen Vorstellungen der Weltwirtschaft.
Für Bucharin entwickelt sich, wie er in „Imperialismus und Weltwirtschaft“ [lxxxiv] darlegt, die nationale kapitalistische Ökonomie zu einem einzigen staatskapitalistischen Trust. Auch wenn das noch nicht ganz vollzogen sein mag.
„Das Finanzkapital schlägt das gesamte Land in eiserne Fesseln. Die „Volkswirtschaft“ verwandelt sich in einen einzigen gewaltigen kombinierten Trust, dessen Teilhaber die Finanzgruppen und der Staat sind. Solche Bildungen nennen wir staatskapitalistische Trusts. Es ist natürlich unmöglich, ihre Struktur mit der Struktur eines Trusts im engeren Sinne des Wortes zu identifizieren; dieser ist eine mehr zentralisierte und weniger anarchische Organisation. Aber bis zu einem gewissen Grade und besonders im Vergleich zu der vorhergehenden Phase des Kapitalismus haben die wirtschaftlich entwickelten Staaten sich in einem bedeutenden Grade bereits dem Punkt genähert, wo man sie als eine Art von trustähnlichen Organisationen oder, wie wir sie genannt haben, als staatskapitalistische Trusts betrachten kann. Deshalb kann man jetzt von einer Konzentration des Kapitals in staatskapitalistischen Trusts als den Bestandteilen eines viel bedeutenderen gesellschaftlich-wirtschaftlichen Feldes, der Weltwirtschaft, sprechen.“ [lxxxv]
Anders als bei Hilferding hebt diese Entwicklung jedoch die Konkurrenz nicht auf, sie beseitigt sie nur im Rahmen des nationalen gesellschaftlichen Gesamtkapitals, um sie umso heftiger und in Permanenz auf dem Weltmarkt und in der Weltpolitik zum Ausbruch kommen zu lassen.
„Der Kapitalismus hat versucht, seine eigene Anarchie dadurch zu überwinden, daß er ihr die eiserne Fessel der staatlichen Organisation anlegte. Indem er aber die Konkurrenz innerhalb des Staates aufhob, ließ er alle Teufel im internationalen Kampf los.“ [lxxxvi]
Oder an anderer Stelle: „Die Konkurrenz erreicht die höchste und letzte denkbare Entwicklungsstufe: die Konkurrenz der staatskapitalistischen Trusts auf dem Weltmarkt. In den Grenzen der ,nationalen’ Wirtschaften wird sie auf ein Minimum reduziert, aber nur, um in gewaltigem, in keiner der vorhergehenden Epochen möglichen Umfange aufs neue zu entbrennen.“ [lxxxvii]
Diese enge Verschmelzung von Staat und Kapital bedeutet aber auch, dass die Konkurrenz eine andere Form annimmt:
„Hier feiert die Konkurrenz ihre wildesten Orgien, und zugleich mit ihr verwandelt sich der Prozeß der Zentralisation des Kapitals und erreicht eine höhere Phase. Die Aufsaugung kleiner Kapitale, die Aufsaugung schwacher Trusts, ja sogar die Aufsaugung großer Trusts tritt in den Hintergrund und erscheint als ein Kinderspiel gegenüber der Aufsaugung ganzer Länder, die gewaltsam von ihren wirtschaftlichen Mittelpunkten losgerissen und in das wirtschaftliche System der siegreichen ,Nation’ einbezogen werden. Die imperialistische Annexion ist somit ein Sonderfall der allgemeinen kapitalistischen Tendenz zur Zentralisation des Kapitals, zu seiner Zentralisation in dem maximalen Umfang, der der Konkurrenz der staatskapitalistischen Trusts entspricht.“ [lxxxviii]
Der Begriff der kapitalistischen Konkurrenz bezieht sich hier nicht darauf, wie die Gesetzmäßigkeiten des Kapitals im Allgemeinen den Einzelkapitalien aufgezwungen werden können, sondern wird eigentlich zu einer politischen Kategorie. Es stehen sich Staatenkapitale als Konkurrenten gegenüber, die mit allen Mitteln um die Vorherrschaft auf der Welt kämpfen. Krieg wird, wie Bucharin weiter ausführt, zum Mittel das Anschlusses eines Trusts an einen anderen (z. B. Eroberung Belgiens durch Deutschland) oder eines Agrargebietes an einen Trust (Eroberung Ägyptens durch Britannien).
Bucharins Fehler besteht nicht darin, dass er auf die zentrale Bedeutung bestimmter Eroberungen von Kolonien und Krieg im Rahmen des imperialistischen Systems und der Verfolgung von Interessen nationaler Kapitalgruppen hinweist. Im Gegenteil, angesichts des Flächenbrands des imperialistischen Weltkrieges rückt diese Form der Verfolgung des Kapitalinteresses wie auch die Zentralisierung der Ökonomien im Krieg in den Mittelpunkt des Interesses.
Bucharin begeht hier aber den Fehler, die kapitalistische Konkurrenz als ökonomische Kategorie mit den Aktionen des bürgerlichen Staates, des konzentrierten Gesamtkapitalisten zu identifizieren. Die Tendenz zur staatlichen Zwangsregulierung (und damit auch zum Monopol) während des Krieges interpretiert Bucharin fälschlicherweise als lineare geschichtliche. Die Krise wird für ihn permanent, weil der ständige Kampf um die Neuaufteilung der Welt ständig zur brutalsten Austragungsform, zu Eroberung, Plünderung, Krieg drängt.
Die konzeptionelle Nähe zu Hilferding ist bei den theoretischen Grundvorstellungen (Generalkartelle und Staatstrust) offenkundig, die Schlussfolgerungen sind jedoch entgegengesetzt.
Jedoch problematisch und politisch falsch sind die Schlussfolgerungen von Bucharin auch. Seine „linksradikale“ Weiterführung von Hilferding kennt im Grunde keine Stabilisierung mehr. Wenn, dann sei diese nur vorübergehend, nebensächlich angesichts der Permanenz der „Krise“, der ständig sich verschärfenden innerimperialistischen Widersprüche, die eigentlich keine Atempause für die herrschende Klasse erlauben.
In der „Ökonomik der Transformationssperiode“ [lxxxix] radikalisiert er dieses Ansicht noch:
„Die kapitalistische ,Volkswirtschaft’ ist aus einem irrationalen System zu einer rationalen Organisation geworden, aus einer subjektlosen zu einem wirtschaftenden Subjekt. Diese Umwandlung ist durch das Wachstum des Finanzkapitalismus und die Verschmelzung der wirtschaftlichen und politischen Organisation der Bourgeoisie gegeben. Zugleich aber wurde weder die Anarchie der kapitalistischen Produktion überhaupt, noch die Konkurrenz der kapitalistischen Warenproduzenten aufgehoben. Diese Erscheinungen sind nicht nur geblieben, sondern haben sich vertieft, indem sie sich im Rahmen der Weltwirtschaft reproduzieren.” [xc]
Der Kapitalismus sei insgesamt in eine Phase der „negativen erweiterten Reproduktion“ getreten, also eines permanenten Niedergangs, einer Dauerkrise:
„Wir sahen bereits deutlich, daß der Zerfallsprozeß mit absoluter Unvermeidlichkeit einsetzt, nachdem die erweiterte negative Reproduktion den gesellschaftlichen Mehrwert (m) verschluckt hat … Die konkrete Sachlage in der Wirtschaft Europas in den Jahren 1918 – 1920 zeigt deutlich, daß diese Verfallsperiode bereits eingetreten ist und daß Anzeichen für eine Auferstehung des alten Systems der Produktionsverhältnisse fehlen. Umgekehrt. Alle konkreten Tatsachen weisen darauf hin, daß die Elemente des Zerfalls und der revolutionären Auflösung der Verbindungen mit jedem Monat fortschreiten.” [xci]
Und daraus folgt die Schlussfolgerung:
„Aber jetzt dürfen wir behaupten, daß eine Wiederherstellung des alten kapitalistischen Systems unmöglich ist … Die Menschheit steht also vor dem Dilemma: entweder ,Untergang’ der Kultur oder Kommunismus, nichts Drittes ist möglich.” [xcii]
Diese theoretische Konzeption führte Bucharin und andere zu mehreren, potentiell fatalen politischen Schlussfolgerungen. Erstens einer sektiererischen Haltung zu demokratischen Fragen (siehe z. B. die nationale Frage) und Teilforderungen. Zweitens machte es ihn zu einem Befürworter einer voluntaristischen Offensive, bei der das konkrete Kräfteverhältnis eine nachrangige Rolle spielte. Hier lässt sich der innere Zusammenhang zwischen einer ultralinken Lesart der Endkrise und „negativen erweiterten Reproduktion“ mit seiner Ablehnung des Friedens von Brest-Litowsk und seiner Befürwortung eines revolutionären Krieges leicht erkennen. Diese politischen Differenzen zwangen Lenin schließlich auch, selbst die Vereinseitigungen der Bucharin’schen Theorie kritisch in den Blick zu nehmen. So kritisiert er in der Diskussion um ein neues Parteiprogramm die Tendenz, den Imperialismus als mehr als eine Entwicklungsstufe des Kapitalismus zu sehen:
„Der Imperialismus gestaltet in Wirklichkeit den Kapitalismus nicht von Grund aus um, und er kann es auch nicht. Der Imperialismus kompliziert und verschärft die Widersprüche des Kapitalismus, er ‚verknotet’ die Monopole mit der freien Konkurrenz, aber den Austausch, den Markt, die Konkurrenz, die Krisen usw. beseitigen kann der Imperialismus nicht. ( … ) Nicht reine Monopole, sondern Monopole neben dem Austausch, dem Markt, der Konkurrenz, den Krisen – das ist überhaupt die wesentlichste Eigenart des Imperialismus.
Darum ist es theoretisch falsch, die Analyse des Austauschs, der Warenproduktion, der Krisen usw. überhaupt zu streichen und sie durch die Analyse des Imperialismus als eines Ganzen zu ‚ersetzen’. Denn ein solches Ganzes gibt es nicht. Es gibt einen Übergang von der Konkurrenz zum Monopol, und daher wird ein Programm, das die allgemeine Analyse des Austauschs, der Warenproduktion, der Krisen usw. beibehält und eine Charakteristik der heranwachsenden Monopole hinzufügt, viel richtiger sein, die Wirklichkeit viel exakter wiedergeben. Gerade diese Verkoppelung der einander widersprechenden ‚Prinzipien’ – Konkurrenz und Monopol – ist für den Imperialismus wesentlich, gerade sie bereitet den Zusammenbruch, d. h. die sozialistische Revolution vor.“ [xciii]
In den Diskussionen um den VIII. Parteitag der KPR(B) im Jahr 1919 wendet sich Lenin explizit gegen Bucharins Vorstellungen und deren Untauglichkeit für eine Neufassung des Programms:
„Theoretisch begreift das Gen. Bucharin vollkommen, und er sagt, das Programm müsse konkret sein. Aber etwas begreifen ist eins, es tatsächlich durchführen ist etwas anderes. Das Konkretsein des Gen. Bucharin – das ist eine büchergelehrte Darlegung des Finanzkapitalismus. In der Wirklichkeit beobachten wir verschiedenartige Erscheinungen. In jedem landwirtschaftlichen Gouvernement beobachten wir neben der monopolisierten Industrie freie Konkurrenz. Nirgendwo in der Welt hat der Monopolkapitalismus ohne freie Konkurrenz in einer ganzen Reihe von Wirtschaftszweigen existiert und wird er je existieren. Ein solches System aufstellen heißt ein vom Leben losgelöstes, ein falsches System aufstellen. (…) Auf dem Standpunkt stehen, es gäbe einen einheitlichen Imperialismus ohne den alten Kapitalismus, heißt das Gewünschte für die Wirklichkeit nehmen.“ [xciv]
Lenins Bemerkungen verweisen auf zwei wichtige Aspekte. Erstens wendet er sich gegen die „leblose“ Vorstellung, dass das Monopol und Finanzkapital die Konkurrenz stetig mehr und mehr verdrängen oder gar ersetzen und die Gesetze des „alten Kapitalismus“ aufheben würden, auch wenn er selbst keine korrekte begriffliche Bestimmung von Konkurrenz und Monopolkapital leistet. Gerade Lenins Insistieren auf der „konkreten Analyse der konkreten Situation“ wappnet gegen den Versuch, komplexe historische Verhältnisse in starre Schemata zu pressen.
Zweitens verweist Lenin in obigen Passagen und seinen längeren Ausführungen darauf, dass Schematismus leicht dazu führt, sich anstelle eines konkreten Aktionsprogramms für eine bestimmte Situation oder Phase des Klassenkampfes mit Generalisierungen, allgemeinen Erwägungen zu begnügen und in einen abstrakten Maximalismus und Pseudoradikalismus abzugleiten.
Unglücklicherweise knüpfte jedoch die Kommunistische Internationale nach Lenins Tod wesentlich an die Methode Bucharins an – das betrifft sowohl den von Sinowjew inspirierten V. Weltkongress als auch Bucharins Programmentwurf für den VI.
Einerseits wurden die programmatischen Errungenschaften der ersten vier Weltkongresse, also die gesamte Methode der Übergangsforderungen, mehr und mehr über Bord geworfen und entweder durch opportunistische (Anglo-Russisches Gewerkschaftskomitee, Chinesische Revolution) oder durch ultralinke Fehler („Dritte Periode“, Ablehnung der Einheitsfrontpolitik, Sozialfaschismustheorie) ersetzt. Vor allem aber verabschiedete sich die Komintern vom Internationalismus und ersetzte diesen durch die Theorie vom Aufbau des Sozialismus in einem Land, einer reaktionären Rechtfertigungsideologie der sich mehr und mehr verfestigenden Herrschaft der Bürokratie in der Sowjetunion unter Stalin.
Die schematische Fassung des Monopolkapitals durch Hilferding und dann auch durch Bucharin ging jedoch in mehrfacher Hinsicht in die theoretische Begründung der Politik der kommunistischen Parteien nach der Wende zur Volksfrontpolitik ein.
Insbesondere die Theorie des „staatsmonopolistischen Kapitalismus“ wurde zur Leitideologie von Parteien wie der DKP oder KPÖ. Diese Konzeption knüpfte an Vorstellungen von Hilferding und Bucharin an, namentlich, dass die großen Kapitalgruppen und der Staat miteinander verschmolzen wären und die gesamte Wirtschaft und sozialen Verhältnisse dominieren würden. Dies würde das Monopolkapital und die von ihm dominierten politischen Institutionen in einen Gegensatz zu allen anderen Teilen der Gesellschaft, ArbeiterInnenklasse, KleinbürgerInnentum bis hin zum „nichtmonopolistischen“ Kapital, bringen. Gegen die Herrschaft des Monopols bräuchte es ein Bündnis all dieser Klassen, die gemeinsam eine „antimonopolistische Demokratie“ errichten sollten, die ihrerseits irgendwann auf wundersame Weise zur Diktatur des Proletariats führen würde, ganz so, wie die sozialdemokratische Regierungsbeteiligung irgendwann in den friedlichen Übergang zum Sozialismus münden sollte.
Im Grunde war und ist die „antimonopolistische Demokratie“ nur eine Neuauflage reformistischer Politik und der Volksfrontpolitik, die über ein Bündnis mit einem „fortschrittlichen“, in diesem Fall dem „nichtmonopolistischen“, also eigentlich ökonomisch rückständigsten, Teil des Kapitals realisiert werden sollte. Auch wenn es nie zu einer solchen Regierung kam – am ehesten wurden noch Regierungsbeteiligungen westlicher KPen an sozialdemokratischen Regierungen in diesem Sinn interpretiert –, so waren die Wirkungen dieser Strategie auf die ArbeiterInnenklasse dieselben wie bei jeder reformistischen. Um „antimonopolistische“ Bündnisse überhaupt herstellen zu können, mussten selbstverständlich auch die Interessen des „nichtmonopolistischen“ Kapitals berücksichtig werden, im Klartext also die der ArbeiterInnenklasse mit jenen dieser Kapitalfraktion in Einklang gebracht, also letztlich untergeordnet werden.
Anders jedoch als die Theorie Bucharins – von Lenin ganz zu schweigen – bildete in der Theorie des staatsmonopolistischen Kapitalismus der internationale Klassenkampf allenfalls eine Nebenrolle. Das „antimonopolistische“ Bündnis war immer als eines in einem Nationalstaat gedacht. Dies drückte sich auch in den Programmen der eigentlich reformistischen „Kommunistischen Parteien“ der Nachkriegsperiode aus, die einen „britischen“, „italienischen“ usw. Weg zum Sozialismus versprachen. Die KPÖ nannte ihr Programm gar „Sozialismus in rot-weiß-roten Farben“. Rückblickend erscheint das fast schon wie eine unfreiwillige Selbstparodie. Nichtsdestotrotz sollten die verheerenden Auswirkungen dieser Theorien, zu deren Rechtfertigung reihenweise Leninzitate herangezogen und oft genug auch entstellt wurden, nicht unterschätzt werden. Die sogenannte „Stamokaptheorie“ und ähnliche Vorstellungen über den zeitgenössischen Imperialismus prägten die Politik der westlichen Kommunistischen Parteien und etlicher linker AktivistInnen für ganze Generationen – und banden sie letztlich an eine reformistische Theorie und Praxis.
Die Kritik dieser Theorie bildete daher eine wichtige Aufgabe von RevolutionärInnen, genauso wie jeder Rückbezug darauf, jede Rehabilitierung dieser Konzeption bekämpft werden muss.
Dies erfordert freilich nicht nur Kritik, sondern auch eine ständige Aktualisierung der Imperialismustheorie selbst.
11. Wertgesetz auf dem Weltmarkt
11.1 Wertbildung und gesellschaftliches Gesamtkapital
Die Diskussionen über die Modifikation des Wertgesetzes und dessen generelle Wirkungsweise auf dem Weltmarkt, die in der deutschsprachigen Linken Anfang der 1970er Jahre geführt wurden, versuchten, einige dieser Probleme und offene Stellen der Lenin’schen Theorie und ihre Entstellungen zu überwinden. Bei allen Schwächen, die eine Reihe dieser Beiträge auch hatte – insbesondere die mit einer rein begriffslogischen Betrachtung der Gesetzmäßigkeiten des Kapitalismus und der damit einhergehenden Verwerfung des Imperialismus- und Epochenbegriffs –, warfen sie wichtige Fragen auf, die jede Imperialismustheorie auch zu beantworten hat.
Schließlich hatten sich die Erscheinungsformen des Imperialismus seit dem Tod Lenins und seit der frühen Kommunistischen Internationale nach dem 2. Weltkrieg fundamental verändert, und dies bedurfte daher einer theoretischen Erklärung und Begründung. Die Frage der werttheoretischen Fundierung der internationalen Beziehungen oder generell des Imperialismus drängte sich geradezu auf. Wie eigentlich das Wertgesetz auf dem Weltmarkt wirkt, wie es modifiziert wird, wie Extraprofit aus den halbkolonialen Ländern gezogen werden kann usw. usf. musste notwendigerweise beantwortet werden. Mit dem Zusammenbruch der großen Kolonialreiche und der folgenden Entkolonialisierung, also dem Übergang zur halbkolonialen Form der imperialistischen Durchdringung und Ausbeutung der sog. Dritten Welt, musste notwendigerweise auch die Frage der Wirkung des Wertgesetzes auf dem Weltmarkt eine größere Bedeutung einnehmen als in der Ära des Kolonialsystems.
Die Behandlung dieser Fragestellung schließt notwendigerweise eine Betrachtung der Wertbestimmung selbst ein, die wir auch an den Beginn der folgenden Ausführungen stellen werden. Hier liegt zweifellos ein Verdienst verschiedener AutorInnen dieser Strömung, die sich um Zeitschriften wie „Probleme des Klassenkampfes“ gruppierte. [xcv] Die folgende Darstellung verdankt diesen Beiträgen wichtige Anregungen, insbesondere Wolfgang Schoellers „Weltmarkt und Reproduktion des Kapitals“ [xcvi].
Um die Modifikationen des Wertgesetzes auf dem Weltmarkt genauer darstellen zu können, müssen wir kurz wesentliche Momente der Wertbestimmung im Rahmen einer Nationalökonomie, genauer die Herstellung eines nationalen Gesamtkapitals betrachten.
a) Wertbestimmung der Ware
Wenn wir der Marx’schen Theorie folgen, so bereitet die Wertbestimmung einer Ware zunächst keine weiteren Schwierigkeiten. „Gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit ist Arbeitszeit, erheischt, um irgendeinen Gebrauchswert mit den vorhandenen gesellschaftlich-normalen Produktionsbedingungen und dem gesellschaftlichen Durchschnittsgrad von Geschick und Intensität der Arbeit darzustellen.“[xcvii]
Der Wert einer Ware wird durch die Menge der gesellschaftlichen Durchschnittsarbeit bestimmt, die dem vorherrschenden Entwicklungsgrad einer Ökonomie zu einem bestimmten Zeitpunkt entspricht. Dies kann, ja wird mit dem Fortschritt der Produktionsbedingungen wechseln, aber zu einem bestimmten Zeitpunkt kann sie als gegeben betrachtet werden. Den Durchschnitt darf man außerdem auch nicht einfach als „statistisches Mittel“ ansehen, sondern als vorherrschende Produktionsbedingung.
In einer entwickelten kapitalistischen Gesellschaft – also einer, deren Produktion auf der großen Industrie beruht – erfolgte die Reduktion der verschiedenen Arbeiten auf den jeweiligen gesellschaftlichen Durchschnitt, vermittelt durch die Zirkulation der Waren und des Kapitals.
In diesem Zusammenhang erhalten auch ergänzende Bemerkungen von Marx, die sich auf die Realisierung des Werts beziehen und Gebrauchsquanten der Arbeit in die Wertbestimmung einfließen lassen, ihre Bedeutung:
„Wie es Bedingung für die Waren, daß sie zu ihrem Wert verkauft werden, daß nur die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit in ihnen enthalten, so für eine ganze Produktionssphäre des Kapitals, daß von der Gesamtarbeitszeit der Gesellschaft nur der notwendige Teil auf diese besondre Sphäre verwandt sei, nur die Arbeitszeit, die zur Befriedigung des gesellschaftlichen Bedürfnisses (demand) erheischt. Wenn mehr, so mag zwar jede einzelne Ware nur die notwendige Arbeitszeit enthalten; die Summe enthält mehr als die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit, ganz wie die einzelne Ware zwar Gebrauchswert hat, die Summe aber, unter den gegebnen Voraussetzungen, einen Teil ihres Gebrauchswerts verliert.“ [xcviii]
Diese ergänzende und untergeordnete Bestimmung bildet einen notwendigen Bestandteil jeder Gesellschaft, die auf Warenproduktion basiert, da sich immer erst im Nachhinein, also im Kauf/Verkauf der Waren herausstellt, ob eine bestimmte Arbeit auch wirklich einen Gebrauchswert für andere darstellt, also KäuferIn findet. Findet sie diese nicht, wird das Resultat der Arbeit entwertet, bleibt als nutzlose Ware liegen, wird vernichtet. Gesamtgesellschaftlich erzwingt dies eine Anpassung der Produktion und der Verteilung der Arbeit auf die verschiedenen Branchen. Insofern stellt dieser zweite Aspekt der Wertbestimmung eine Form dar, die gesellschaftliche Durchschnittsarbeit immer wieder neu zu bestimmen.
b) Extramehrwert
Die Steigerung der Produktivität der Ware reduziert den Wert der Ware. Im selben Zeitraum werden zwar mehr Waren, also auch mehr Gebrauchswerte geschaffen, es wird aber kein zusätzlicher Wert gebildet, weil keine zusätzliche Arbeitsmenge verbraucht wird.
Der/die einzelne KapitalistIn jedoch, der/die zu überdurchschnittlichen gesellschaftlichen Bedingungen produziert, also in der Regel über höhere organische Zusammensetzung seines Kapitals verfügt, was zumeist einer fortgeschritteneren technischen Ausstattung entspricht, kann gegenüber der Konkurrenz, die zu durchschnittlichen Bedingungen schafft, einen Extramehrwert erzielen. Diesen eignet sich der/die produktivere KapitalistIn einer Branche an, indem er/sie seine/ihre Waren entweder über ihren individuellen Kosten verkaufen kann und damit mehr Mehrwert aneignet. Oder er/sie kann die Waren zum Wert verkaufen und damit die Konkurrenz unterbieten, da der Wert seiner Waren unter dem gesellschaftlichen Durchschnitt liegt. Diese wird dann ihrerseits gezwungen, entweder unter Wert zu verkaufen oder den Verlust von Marktanteilen zu riskieren. In jedem Fall wird sie versuchen müssen, den Produktivitätsvorsprung des/r fortgeschritteneren WarenproduzentIn einzuholen.
Höhere Intensität der Arbeit bedeutet, dass z. B. durch Verdichtung der Arbeit in derselben Zeit mehr Arbeit verausgabt wird. Das heißt, es werden/wird nicht nur mehr Gebrauchswerte, also Warenquanta, geschaffen, sondern auch größerer Wert. Auch das Kapital, das eine höhere Intensität der Arbeit einsetzt als der Durchschnitt, kann sich Extramehrwert aneignen.
Es findet in diesen Fällen jedoch kein Werttransfer statt, sondern das Einzelkapital nutzt zeitweilig günstigere Bedingungen, die solange bestehen, wie es über den gesellschaftlichen Durchschnittsbedingungen produzieren kann.
Schoeller beschreibt das als „ungleichen Tausch von Arbeitsquanta“: „Die ‚Substanz’ des Extramehrwerts beruht nicht auf einer Umverteilung von Werten innerhalb einer Branche, sondern darauf, daß das produktivste Kapital pro aufgewendeter Menge Arbeitszeit ein vergleichsweise umfangreicheres Mehrprodukt erhält und sich somit durch einen ungleichen Tausch von Arbeitsquanta in der Zirkulation mehr Ansprüche auf fremde produzierte Warenwerte aneignen kann, als dieses selbst in die Zirkulation gegeben hat.“ [xcix]
c) Marktwert und Marktpreis
Die Veränderungen der Produktivität sowohl innerhalb einer Branche wie zwischen den Branchen werden über die Bewegungen des Marktpreises um den Marktwert vermittelt. Nehmen wir z. B. eine Branche mit Unternehmen verschiedener Produktionsbedingungen an. Bei relativ ausgeglichen Verhältnissen bestimmen die Unternehmen mittlerer Produktionsbedingungen den Marktwert, um den die Preise bei kurzzeitigen Schwankungen von Angebot und Nachfrage oszillieren.
Bei anhaltenden Ungleichgewichten zwischen Angebot und Nachfrage jedoch kann es auch zu einer Verschiebung des Marktwertes kommen. Wenn z. B. die Unternehmen mit mittleren und überdurchschnittlichen Produktionsbedingungen die Bedürfnisse der (zahlungsfähigen) Nachfrage nicht mehr bedienen können, kann der Marktwert von Unternehmen mit den schlechtesten Produktionsbedingungen bestimmt werden. Auch dies kann eine Quelle von Extramehrwert sein, wie oben beschrieben, indem Unternehmen mit höheren oder durchschnittlichen Produktionsbedingungen ihre Waren unter Wert verkaufen können.
Ein weiterer Aspekt tritt hier hinzu, der jedoch von den TheoretikerInnen der „Ableitungsschule“ wenig behandelt wird, nämlich dass Zentralisations- und Monopolisierungstendenzen des Kapitals eine solche Situation auch verlängern können, wie natürlich das große Kapital generell auf Verstetigung solcher Bedingungen drängt. Dies kann durchaus unterschiedlich behauptet werden, einerseits durch Anhalten von gesellschaftlicher Entwicklung (z. B. indem wie etwa im Energiesektor Innovation zurückgehalten wird, um auf fossilen Energieträgern basierende Produktion weiterzuführen), andererseits auch durch die Jagd nach Extramehrwert (indem die marktbeherrschenden Konzerne Innovationen monopolisieren, ihre Konkurrenz faktisch von diesen ausschließen und ihnen überhaupt erst keinen Marktzugang ermöglichen. Solche Fälle, wo faktisch Monopolpreise durchgesetzt werden, finden wir im heutigen Kapitalismus zuhauf, z. B. im Energiesektor, wo wenige Konzerne, die die Märkte unter sich aufgeteilt haben, durchsetzen, dass der „Übergang“ zu anderen Energieträgern von der Gesellschaft subventioniert wird und Preise für die KonsumentInnen entstehen, die einen Monopolprofit für faktisch jede/n ProduzentIn garantieren.
d) Durchschnittsprofit, Werttransfer
Die gesamtgesellschaftliche Verteilung der Waren wird über die Durchschnittsprofitrate und die Transformation der Werte zu Produktionspreisen vermittelt. Das Kapital mit einer höheren organischen Zusammensetzung eignet sich über die Ausgleichsbewegung der Profitrate und die Herstellung einer gesellschaftlichen Durchschnittsprofitrate einen größeren Teil des Mehrwerts an. Es findet also ein Werttransfer statt innerhalb der KapitalistInnenklasse selbst.
Die Ausgleichsbewegung der Profitrate konstituiert auch einen Druck zur Angleichung der Produktionsbedingungen innerhalb verschiedener Branchen sowie die Tendenz zum Fluss von Kapital in neue Anlagesphären.
Sie zwingt die Kapitale mit geringerer organischer Zusammensetzung zur Erneuerung des konstanten Kapitals, um ihren Konkurrenznachteil auszugleichen. Schließlich konstituiert sich mit der Ausgleichsbewegung der Profitrate auch ein gemeinsames Interesse der KapitalistInnenklasse hinsichtlich der Steigerung der Ausbeutungsrate. Wie auch immer der Gesamtprofit zwischen verschiedenen Branchen und Formen des Kapitals, ob als industrieller Gewinn, Handelsprofit oder Zins, verteilt sein mag: Die Masse, die verteilt werden kann, steigt natürlich mit der Masse der Mehrarbeit, die sich das Gesamtkapital aneignet.
e) Zentralisation, Monopolisierungstendenzen und Finanzkapital
Unter den einzelnen konkurrierenden Kapitalen versuchen jene, die eine marktbeherrschende Stellung erlangt haben, die z. B. Kartelle, Trusts, Monopole oder Oligopole in einer oder mehreren Branchen bilden, ihre Stellung zu verewigen. Dies liegt schon in der Logik der Zentralisation des Kapitals.
In der Diskussion um die Bewegung der Profitrate führt Marx auch eine Reihe von Faktoren an, die dem Fall der Profitrate entgegenwirken. Einige betreffen direkt die Erhöhung der Mehrwertrate, andere die Herausbildung von gesellschaftlichen Formen des Kapitals (Aktiengesellschaft, Kredit), schließlich die Ausdehnung der Operationen des Kapitals auf dem Weltmarkt (Waren- und Kapitalverkehr; Reduktion des Wertes der Ware Arbeitskraft infolge des Imports günstigerer Waren).
Die Entwicklung von gesellschaftlichen Formen des Kapitals inkludiert zugleich auch eine Tendenz, die Bewegung der Profitrate zu modifizieren. Nicht zuletzt vermittelt das Finanzkapital (in Form des Kredits, in Form der Verbindung der großen industriellen oder auch kommerziellen Kapitale mit Banken und Finanzinstitutionen) die Neuinvestitionen des gesellschaftlichen Gesamtkapitals.
Daraus entstehende Zentralisation und Monopolisierungstendenzen führen daher immer wieder dazu, die Ausgleichsbewegung der Profitrate zu modifizieren oder einschränken zu können. Durch die Sicherung von Monopolprofiten können sich die stärker zentralisierten, dominierenden Sektoren der Industrie der Ausgleichsbewegung der Profitrate zeitweilig entziehen. Es findet ein Werttransfer vom nichtmonopolisierten Sektor zum zentralisierteren statt.
Diese Bewegung darf jedoch nicht als eine lineare Entwicklung hin zu einem Staatskapitalismus missverstanden werden. Das Monopol stellt nicht „die“ Form des vergesellschafteten Kapitals dar, sondern nur eine von ihnen. So war z. B. die Situation nach dem Zweiten Weltkrieg in den imperialistischen Zentren in der Regel von der Konkurrenz verschiedener Großkapitale auf den nationalen Märkten geprägt, und zwar sowohl in der Phase des „langen Booms“ als auch im Neoliberalismus. Staatlich monopolisierte Sektoren, die privatkapitalistisch lange als unrentabel galten (z. B. Infrastruktur, Eisenbahnen, Gesundheitssektor, Bildungswesen) wurden privatisiert und zur Quelle privater Akkumulation. Ein ähnlicher Prozess kann bei der Privatisierung ehemaliger staatlicher Monopole (z. B. Post, Telekommunikation) beobachtet werden, die sich zu riesigen privatwirtschaftlichen Konzernen (teilweise auch zu privaten Monopolen) transformierten.
Die Zentralisationstendenz freilich ist am größten im Bereich des zinstragenden Kapitals, wo sie zugleich, die imperialistische Epoche in ihrer Gesamtheit betrachtet, mit großen Formveränderungen einhergeht. Damit verändert sich die relative Bedeutung von Banken, Börse, Fonds, Versicherungen in den verschiedenen Entwicklungsphasen.
Gemeinsam ist der Herausbildung des Finanzkapitals jedoch, dass das zinstragende Kapital, wie auch immer das Verhältnis zum industriellen Kapital sei, letzteres dominiert, weil ersteres die Akkumulation des gesellschaftlichen Gesamtkapitals vermittelt. Mit der wachsenden Mindestgröße an Kapital, die für industrielle Unternehmungen erforderlich ist, um überhaupt am Markt agieren zu können, kann dieses Startkapital nur über Kapitalmärkte aufgebracht werden, muss also über das Finanzkapital laufen.
Seine dominierende Rolle hängt ferner damit zusammen, dass es die abstrakteste Form des Kapitals darstellt, dass seine Bewegung die Form G – G’ annimmt, in der jeder Bezug zur Mehrwertproduktion als Basis dieser Bewegung ausgelöscht scheint. Mit seiner eigenen Entwicklung nimmt diese Bewegung immer bizarrere, abgeleitetere Formen an. Das Kapital versucht, sich gewissermaßen von den Schranken seiner Expansion loszureißen, die mit der Produktion und Realisierung des Mehrwerts unvermeidbar einhergehen, z. B. durch die Fixierung des Kapitals in Produktionsmittel und Arbeitskraft während der Produktion oder in Warenform beim kommerziellen Kapital.
Die Reduktion der Lagerhaltung, Just-in-Time-Produktion, Verringerung der Umschlagszeit sind Mittel, nicht nur den Wert des konstanten Kapitals zu reduzieren, sondern auch die Bindung des Kapitals an die Produktion möglichst zu verringern. Wie gering diese Transaktionszeit und Kosten auch werden mögen, wie sehr die Produktion auch „verschlankt“ werden mag, letztlich kann sie nie eine zeitliche Fixierung des konstanten Kapitals gänzlich überwinden. Im Gegenteil, alle diese Versuche gehen oft auch mit einer Erhöhung der organischen Zusammensetzung des Kapitals und des im Kapitalstock gebundenen Teils des Gesamtkapitals einher. So sehr das Finanzkapital auch versucht, sich von diesen Fixierungen freizumachen, letztlich kann es dieser Bindung nicht entfliehen.
Als herrschendes Kapital weist das Finanzkapital die stärksten Tendenzen zur Monopolisierung, zur Verewigung seiner beherrschenden Stellung auf und verfügt dazu auch über enorme Hebel. Umgekehrt ist seine Bewegung, sind seine Investitionsentscheidungen selbst an Profitabilitätserwartungen orientiert und damit über die Konkurrenz vermittelt. Wo sie selbst bestimmte Operationen für Nationalökonomien vornehmen (z. B. Schulden in der sog. Dritten Welt finanzieren oder auf monopolisierten Märkten wie dem Wohnungsmarkt agieren), können sie natürlich auch reinste Formen von Parasitismus und Plünderung annehmen.
Mit der Entwicklung des Außenhandels und der zentralen Bedeutung des Kapitalexports vervielfacht sich die Macht des Finanzkapitals.
f) Begriff des gesellschaftlichen Gesamtkapitals und der allgemeinen Voraussetzungen der kapitalistischen Produktion
Bevor wir jedoch auf die globalen Verhältnisse eingehen, müssen wir uns noch mit einer Kategorie beschäftigen, die für das Verständnis des Imperialismus von zentraler Bedeutung ist: dem Begriff des gesellschaftlichen Gesamtkapitals.
In jeder imperialistischen Ökonomie entwickelt sich ein gesellschaftliches Gesamtkapital, das die allgemeinen Voraussetzungen der kapitalistischen Produktion sichert. Diesem kommt eine eigenständige Realität zu.
Marx zeigt in den drei Bänden des Kapitals in verschiedenen Schritten, wie das Kapital selbst solche allgemeinen Durchschnittsbedingungen der Reproduktion erzeugt, die den einzelnen Kapitalien aufgezwungen werden, bzw. über welche Mechanismen eine solche Ausgleichung erfolgt (z. B. bei der Diskussion von Metamorphosen des Kapitals im 2. Band, bei den Reproduktionsschemata, bei der Diskussion um Profit, Profitrate, Zins, …).
Den „Durchschnittsbedingungen“ kommt eine Realität zu, die nicht bloß eine Addition einzelner Kapitale darstellt oder deren Ausgleichung. Das gesellschaftliche Gesamtkapital erstreckt sich auf mehr als die Summe der Einzelkapitale. Es schließt vielmehr auch die Sicherung allgemeiner Reproduktionsbedingungen ein.
Dazu gehören allgemeine gesellschaftliche Produktivkräfte, ob diese nun privat oder staatlich geleistet werden wie z. B. Kommunikation, Infrastruktur, Verkehr, Wissenschaft. In diesen Bereich fallen auch die Sicherung der Geldstabilität, die Festlegung einer allgemeinen Zinsrate oder die Währungspolitik. Ein weiteres, für die Kapitalakkumulation wesentliches, Moment besteht in der Sicherung eines bestimmten Niveaus der Reproduktion der Arbeitskraft, so dass genügend hinreichend ausgebildete Arbeitskräfte für die Erfordernisse des Kapitals und die Institutionen zur Sicherung der gesellschaftlichen Gesamtreproduktion produziert und reproduziert werden.
Hier tritt der Staat als ideeller Gesamtkapitalist auf den Plan, eben nicht bloß als passiver Garant des Privateigentums, sondern als Verfechter des Interesses des gesellschaftlichen Gesamtkapitals, nicht bloß einzelner Kapitale oder einiger Kapitalgruppen. Der Staat des Kapitals ist zwar über verschiedene Institutionen staatlicher wie zivilgesellschaftlicher Art (Stiftungen, Unternehmerverbände, Parteien, Medien) mit dem Kapital verbunden. Er muss aber zugleich bis zu einem gewissen Grad unabhängig von den konkurrierenden Einzelkapitalen bleiben, um seine Rolle als Vermittler des Gesamtinteresses der herrschenden Klasse überhaupt nach innen wie nach außen erfüllen zu können.
Um die Bedeutung der Konstituierung eines gesellschaftlichen Gesamtkapitals zu verstehen, wollen wir daher noch einmal schematisch seine wesentlichen Leistungen für die Sicherung und Reproduktion des Kapitalverhältnisses anführen:
- Ausgleichsbewegung zu ideellem Durchschnitt, Werttransfer zwischen Branchen, damit überhaupt erst Ausgleichung der Profitrate möglich ist
- Etablierung eines durchschnittlichen Grades der Intensität und Produktivität der Arbeit
- Etablierung einer nationalen Währung, Sicherung des Geldwerts
- Sicherung der allgemeinen Produktions- und Reproduktionsbedingungen des Kapitals
- Staat als ideeller Gesamtkapitalist; Vermittlung des Gesamtinteresses des Kapitals.
Die Herausbildung eines gesellschaftlichen Gesamtkapitals kennzeichnet die Entwicklung praktisch aller imperialistischer Staaten. Wie wir sehen werden, ist sie jedoch wesentlich verschieden, wenn wir die von imperialistischen Mächten beherrschte Welt, – sei sie kolonial oder halbkolonial verfasst – betrachten. Bevor wir dazu kommen, wollen wir auf die Modifikation des Wertgesetzes auf dem Weltmarkt eingehen und dieses kurz umreißen. Anders als in der Nationalökonomie existiert kein „Weltstaat“, keine Weltwährung, die unabhängig von den nationalen Währungen wäre, und auch keine Ausgleichsbewegung der Profitraten.
11.2 Weltmarkt und kapitalistisches System
Der Weltmarkt ist für Marx und Engels, wie wir schon gesehen haben, im Begriff des Kapitals eingeschlossen. Wir dürfen daher die Betrachtung des Weltmarktes, auch wenn wir oben den Rahmen eines nationalen Gesamtkapitals skizziert haben, nicht so auffassen, als würden Wert, Preis, Produktion, Profitrate, Akkumulation usw. „zuerst“ auf nationaler Basis entstehen und bestimmt werden und erst ab einem bestimmten Entwicklungsstadium auf den Weltmarkt „expandieren“.
Dieser stellt vielmehr von Beginn an eine Realität dar, in deren Rahmen sich das Kapital bewegt und entwickelt. Der Weltmarkt ist also etwas von Beginn an Gesetztes, Vorhandenes – zugleich entwickelt er sich aber auch. Die Entdeckung der Amerikas, der sog. Dreieckhandel zwischen Afrika, den Amerikas und Europa, v. a. Britanniens, belegen, wie eng die Entwicklung des Kapitalismus mit dem Weltmarkt verbunden ist.
Dessen Realität und damit auch jene eines globalen Austauschs zeigen sich zudem auch an der Bestimmung der Bedürfnisse einer Gesellschaft und der verschiedenen Klassen, die notwendigerweise von der vorherrschenden, entwickeltsten kapitalistischen Ökonomie bestimmt werden.
Schließlich verändert sich auch die Bedeutung des Weltmarktes für die nationale Kapitalentwicklung mit Entwicklung und Verallgemeinerung der kapitalistischen Produktionsweise. So erweist sich beispielsweise im 19. Jahrhundert, dass Schutzzölle und eine Abschottung des nationalen Marktes eine nachholende und aufholende industrielle Entwicklung v. a. Deutschlands und der USA, später auch Japans, ermöglichten.
Auch die Hauptformen der Bewegung am Weltmarkt ändern sich mit der Entwicklung der Produktionsweise, wie die von Hilferding, Lenin und anderen konstatierte zunehmende und zentrale Bedeutung des Kapitalexports, im Verhältnis zum Warenexport, in der imperialistischen Epoche veranschaulichen.
Nun aber zur Frage der Modifikationen des Wertgesetzes auf dem Weltmarkt. Im ersten Band des „Kapital“ verweist Marx selbst darauf bei der Diskussion der nationalen Verschiedenheit der Arbeitslöhne und richtet die Aufmerksamkeit auf die Frage von Intensität und Produktivität der nationalen Durchschnittsarbeiten auf dem Weltmarkt:
„In jedem Lande gilt eine gewisse mittlere Intensität der Arbeit, unter welcher die Arbeit bei Produktion einer Ware mehr als die gesellschaftlich notwendige Zeit verbraucht, und daher nicht als Arbeit von normaler Qualität zählt. Nur ein über den nationalen Durchschnitt sich erhebender Intensitätsgrad ändert, in einem gegebnen Lande, das Maß des Werts durch die bloße Dauer der Arbeitszeit. Anders auf dem Weltmarkt, dessen integrierende Teile die einzelnen Länder sind. Die mittlere Intensität der Arbeit wechselt von Land zu Land; sie ist hier größer, dort kleiner. Diese nationalen Durchschnitte bilden also eine Stufenleiter, deren Maßeinheit die Durchschnittseinheit der universellen Arbeit ist. Verglichen mit der weniger intensiven, produziert also die intensivere nationale Arbeit in gleicher Zeit mehr Wert, der sich in mehr Geld ausdrückt.
Noch mehr aber wird das Wertgesetz in seiner internationalen Anwendung dadurch modifiziert, daß auf dem Weltmarkt die produktivere nationale Arbeit ebenfalls als intensivere zählt, sooft die produktivere Nation nicht durch die Konkurrenz gezwungen wird, den Verkaufspreis ihrer Ware auf ihren Wert zu senken.
Im Maß, wie in einem Lande die kapitalistische Produktion entwickelt ist, im selben Maß erheben sich dort auch die nationale Intensität und Produktivität der Arbeit über das internationale Niveau. Die verschiedenen Warenquanta derselben Art, die in verschiedenen Ländern in gleicher Arbeitszeit produziert werden, haben also ungleiche internationale Werte, die sich in verschiedenen Preisen ausdrücken, d. h. in je nach den internationalen Werten verschiednen Geldsummen. Der relative Wert des Geldes wird also kleiner sein bei der Nation mit entwickelterer kapitalistischer Produktionsweise als bei der mit wenig entwickelter. Folgt also, daß der nominelle Arbeitslohn, das Äquivalent der Arbeitskraft ausgedrückt in Geld, ebenfalls höher sein wird bei der ersten Nation als bei der zweiten; was keineswegs besagt, daß dies auch für den wirklichen Lohn gilt, d. h. für die dem Arbeiter zur Verfügung gestellten Lebensmittel.“[c]
Diese Passage nimmt eine bedeutende Stellung in den gesamten Debatten um die Modifikation des Wertgesetzes ein, weil hier jedenfalls eine entscheidende Form, nämlich wie Ungleichheit zwischen verschiedenen Nationalökonomien unterschiedlicher Entwicklungsstufen auf dem Weltmarkt reproduziert und verstärkt wird, in den Blick genommen wird.
Wenn wir von einer Wertbildung im nationalen Rahmen und deren Erscheinen auf dem Weltmarkt ausgehen, so wirft Marx hier zuerst die Frage auf, wie unterschiedliche, im nationalen Rahmen gebildete Durchschnittsarbeit auf dem Weltmarkt auftritt. Höhere Intensität der Arbeit wie auch höhere Produktivität werden auf eine Stufenleiter der „universellen Arbeit“ bezogen.
Dies hat zur Folge, dass die Waren aus den Ländern mit unterschiedlicher Durchschnittsintensität und höherer Produktivität auf dem Weltmarkt verschieden „gewichtet“ sind, sich also in mehr oder weniger Geld darstellen. Die Waren jener aus der entwickelteren kapitalistischen Nation werden also billiger sein und daher auf dem Weltmarkt einen Vorteil genießen, solange die andere Nation nicht an dieses Niveau anschließen kann. Dies bedeutet, dass zwar kein Werttransfer von einem Kapital/Land in das andere analog zum Werttransfer bei der Ausgleichsbewegung der Profitrate stattfindet, wohl aber kann das Land mit höherer Durchschnittsproduktivität einen Extramehrwert erzielen, analog zum Wertbildungsprozess auf dem nationalen Markt.
Im Rahmen einer nationalen Ökonomie kann sich ein Kapital den Extramehrwert in der Regel nur vorübergehend aneignen. Anders im System der universellen Arbeit. Natürlich kann auch dort immer wieder eine Angleichung in bestimmten Entwicklungsphasen stattfinden und bis zu einem gewissen – aber auch nur bis zu einem gewissen – Grad können die weniger entwickelten Ökonomien dem Nachteil durch Abwertungen der nationalen Währung entgegenwirken. Aber generell zeichnet die Weltwirtschaft auf Grund der Ungleichzeitigkeit der Entwicklung der Nationalökonomien und aufgrund der internationalen Arbeitsteilung, in die „abhängige Länder“ verspätet und immer schon auf den Weltmarkt bezogen eintreten, eine viel größere Festigkeit dieser Ungleichheit. Sie wird im imperialistischen System nicht rasch überwunden, sondern auf Dauer gestellt und bildet daher eine bedeutende Form der Aneignung von in den Halbkolonien geschaffenem Reichtum durch die (Gesamt-)Kapitale der imperialistischen Metropolen.
Auf internationaler Ebene findet – wie wir an anderer Stelle gezeigt haben und im Gegensatz zu den theoretischen Grundnahmen verschiedener Theorie des ungleichen Tauschs – keine Ausgleichung der Profitraten zu einer internationalen Durchschnittsprofitrate statt. Diese findet auch in der imperialistischen Epoche im nationalstaatlichen Rahmen statt. Umgekehrt dürfen wir uns aber die Entwicklung des Weltmarktes, die Entstehung internationaler Wertschöpfungsketten usw. nicht so verstellen, dass das Verhältnis zwischen nationalen Ökonomien und der Weltwirtschaft hinsichtlich der Bildung von Profitraten ein konstantes, unveränderliches wäre.
Der Nationalstaat stellt nicht nur einen Garanten des gesellschaftlichen Gesamtkapitals und einen Rahmen zur Bildung nationaler Profitraten dar, er bildet auch eine Schranke für die Internationalisierungstendenzen des Kapitals, einen inneren Widerspruch. Mit seiner eigenen Entwicklung versucht das Kapital immer wieder, die Enge des Nationalstaates zu überwinden, was sich z. B. in der Ausdehnung des Weltmarktes und der Entstehung globaler Produktionsketten zeigt bis hin zur Herausbildung regelrechter Weltmarktbranchen. In diesen Branchen können wir durchaus eine Tendenz zur Herausbildung internationaler Produktionspreise und zu einer Ausgleichung von Profitraten auf Branchenebene beobachten, die jedoch immer prekär bleibt, weil es keine globale Ausgleichung zu einer Durchschnittsprofitrate gibt oder geben kann.
Wo sich solche Tendenzen zur Ausgleichung einer branchenübergreifenden internationalen Profitrate herausbilden, entwickeln sich logischerweise auch Formen des Werttransfers auf globaler Ebene, ähnlich jener im nationalen Rahmen. Aber diese werden nicht nur durch andere Formen des Weltmarktes (Währungsbewegungen etc.) durchkreuzt, sondern bleiben im Rahmen des kapitalistischen Gesamtsystems letztlich partiell, weil es zu einer Angleichung der unterschiedlichen Entwicklungsniveaus der nationalen Gesamtkapitale nicht kommt und auch nicht kommen kann.
Entscheidend für unsere Betrachtung ist daher, dass wir diese Tendenzen als Widerspruch fassen müssen, der im Rahmen der kapitalistischen Ökonomie nicht aufgelöst werden kann, sondern nur im Übergang zu einer sozialistischen Gesellschaftsordnung.
Bisher haben wir die Fragen des Tausches von Waren auf dem Weltmarkt behandelt. Marx verweist auf einige andere, folgenreiche Wirkungen des Welthandels auf die nationalen Profitraten und Akkumulationsbewegungen, die in der imperialistischen Epoche eine wichtige Rolle spielen.
Im dritten Band des „Kapital“ geht er direkt auf den Außenhandel ein, wo er diesen unter den „entgegenwirkenden“ Ursachen zum Fall der Profitrate behandelt.
„Soweit der auswärtige Handel teils die Elemente des konstanten Kapitals, teils die notwendigen Lebensmittel, worin das variable Kapital sich umsetzt, verwohlfeilert, wirkt er steigernd auf die Profitrate, indem er die Rate des Mehrwerts hebt und den Wert des konstanten Kapitals senkt. Er wirkt überhaupt in diesem Sinn, indem er erlaubt, die Stufenleiter der Produktion zu erweitern. Damit beschleunigt er einerseits die Akkumulation, andrerseits aber auch das Sinken des variablen Kapitals gegen das konstante und damit den Fall der Profitrate. Ebenso ist die Ausdehnung des auswärtigen Handels, obgleich in der Kindheit der kapitalistischen Produktionsweise deren Basis, in ihrem Fortschritt, durch die innere Notwendigkeit dieser Produktionsweise, durch ihr Bedürfnis nach stets ausgedehnterm Markt, ihr eignes Produkt geworden. Es zeigt sich hier wieder dieselbe Zwieschlächtigkeit der Wirkung.“ [ci]
Der Import billigerer Lebensmittel und Konsumgüter für die ArbeiterInnenklasse führt zur Senkung des Werts der Ware Arbeitskraft und damit, bei sonst gleichbleibenden Bedingungen, zur Erhöhung des relativen Mehrwerts und der Profitrate. Diese Faktoren haben bis heute enorme Bedeutung, weil sie ein Stück weit die Senkungen der Löhne, Verschlechterungen der Arbeitsbedingungen, Ausweitung von Billiglohnsektoren im Zuge neoliberaler Angriffe abfedern und zugleich eine Erhöhung der Ausbeutungsrate erlauben. Der Aufstieg Chinas und anderer asiatischer Ökonomien als industrieller Produktionsstandort von Konsumgütern spielte für die Senkung des Werts der Ware Arbeitskraft v. a. in den USA in den letzten Jahrzehnten eine wesentliche Rolle.
Zweitens erfüllt der Außenhandel auch eine Funktion hinsichtlich der Akkumulationsbedingungen des nationalen Gesamtkapitals. Der akkumulierte Mehrwert kann so zur Erweiterung der Produktion für den Weltmarkt oder in anderen Ländern investiert werden und Anlage suchen, die das Kapital sonst auf dem begrenzten nationalen Markt nicht mehr finden kann. Kapitalexport stellt in diesem Zusammenhang einen Weg dar, auf die Überakkumulation im imperialistischen Zentrum zu reagieren und überschüssiges Kapital im Ausland zu investieren.
Drittens findet das Kapital aus den fortgeschrittenen (imperialistischen) Ländern aufgrund der höheren Produktivität der gesellschaftlichen Durchschnittsarbeit gegenüber jenem aus Kolonien und Halbkolonien Konkurrenzvorteile vor und kann sich so einen Extramehrwert aneignen (siehe oben).
Viertens erlaubt die geringere organische Zusammensetzung des Kapitals in der Halbkolonie dem investierten Kapital mit höherer organischer Zusammensetzung aus dem imperialistischen Land, einen höheren Extraprofit/Wertanteil aus der Ausgleichung der Durchschnittsprofitrate in der Halbkolonie zu ziehen. Es findet hier ein Werttransfer innerhalb der KapitalistInnenklasse (wie bei jeder Ausgleichsbewegung der Profitrate), und zwar von den halbkolonialen zu den imperialistischen Unternehmen statt. Dieser bildet nicht nur eine wesentliche Quelle von Extraprofiten, sondern erklärt auch, warum im halbkolonialen System die Sicherung der Freiheit des Kapitaltransfers eine so große Rolle spielt, sowohl hinsichtlich der Abschaffung aller Investitionsbeschränkungen des imperialistischen Kapitals als auch zur Sicherung der Repatriierung der Profite. (Gleichzeitig unterliegt der Zugang der imperialistischen Märkte für halbkoloniale ProduzentInnen und InvestorInnen in der Regel viel größeren Beschränkungen.)
Die Dauerhaftigkeit und Reproduktion ungleicher Verhältnisse auf dem Weltmarkt wären jedoch vollkommen unerklärlich, wenn wir nicht die Frage des Währungs-, des Finanzsystems und sein Verhältnis zum Staatensystem betrachten würden. Dem einzelnen Nationalstaat ist es durchaus möglich, das nationale Kapital gegenüber ungünstigeren Bedingungen auf dem Weltmarkt zu schützen. Aber diese Fähigkeit ist beschränkt, wie die Geschichte zeigt, und hängt letztlich von der wirtschaftlichen Stärke des jeweiligen Landes ab.
Im Rahmen der Nationalökonomie wird Geld von der Zentralbank emittiert. Der Staat tritt als dessen Garant auf. Auf dem Weltmarkt existiert kein Weltstaat oder auch nicht irgendeine Staatengemeinschaft als Garant der allgemeinen Verhältnisse der Kapitalreproduktion.
Im Weltgeld, so Marx, kommt das Geld eigentlich zu sich, hier wird seine Daseinsweise seinem Begriff adäquat, weil es direkt als Verkörperung abstrakter Arbeit fungiert (während bestimmte Geldfunktionen immer nur auf eine nationale Währung bezogen sind oder sein können). Aber das Weltgeld braucht, wenn es keinen Weltstaat gibt, einen Garanten. Auch wenn Gold und Silber weiter als Geldware fungieren, so monopolisiert in einem entwickelten kapitalistischen System entweder eine Währung den internationalen Zahlungsverkehr und vor allem das Kredit- und Schuldensystem, oder es besteht Konkurrenz zwischen den Leitwährungen der dominierenden Großmächte. So fungierte in der Phase der britischen Weltmarktdominanz im 19. Jahrhundert das Pfund Sterling als Weltwährung. Selbst im Niedergang versuchte der britische Imperialismus, weiter an der Goldparität und der Dominanz des Pfunds in der Weltmarktkonkurrenz gegenüber den USA festzuhalten.
Nach 1945 setzte sich der US-Dollar als Leitwährung durch. Mit dem Aufstieg Deutschlands und Japans, der Bildung der EU und vor allem mit der Etablierung Chinas als imperialistischer Macht wurde natürlich auch die Vorherrschaft der USA auf diesem Gebiet unterminiert, ein Prozess, der im Grunde schon seit den 1970er Jahren mit dem Ende des Bretton-Woods-Systems vor sich geht. Dieses legte einen festen Wechselkurs zwischen der Ankerwährung Dollar und den Währungen der Teilnehmerländer zugrunde und verpflichtete die US-Notenbank zum Umtausch von Dollar aus deren Zentralbanken zu einem festen Kurs in Gold (flexibler Goldstandard). Dennoch fungiert der Dollar bis heute als die entscheidende internationale Währung, in der die Mehrheit aller Finanztransaktionen notiert wird, in der Börsengeschäfte abgewickelt werden, in der Schulden auf den internationalen Kreditmärkten aufgenommen und bedient werden müssen. Der Dollar stellt bis heute faktisch Weltgeld dar, auch wenn er mit dem Euro und dem Aufstieg Chinas unter Druck geraten ist. Der als Weltgeld fungierenden Leitwährung treten also allenfalls die Währungen imperialistischer KonkurrentInnen als annähernd gleichwertig hinzu.
Die Frage, welches Geld sich als Weltgeld durchsetzt, ist somit Ausdruck des Stellenwertes eines nationalen Gesamtkapitals im Verhältnis zu den anderen. In bestimmten Perioden der kapitalistischen Entwicklung vermögen einzelne Staaten aufgrund ihrer weltmarktbeherrschenden Stellung, die auf überlegener Produktion beruht und von militärischer und politischer Vormacht begleitet wird, als „Demiurgen“ (Hervorbringer, Schöpfer) des Weltmarktes zu fungieren.
Das Monopol auf Weltgeld macht zwischen den nationalen Währungen einen enormen Unterschied aus. Es bringt die unterschiedliche Stellung der verschiedenen Staaten in der weltweiten Arbeitsteilung und in der geopolitischen Ordnung nicht nur zum Ausdruck, sondern reproduziert und verfestigt sie zugleich.
Im Kolonialsystem waren Geld und Geldfunktionen in der Regel ohnedies vom jeweiligen Mutterland bestimmt, da keine politisch-staatliche Unabhängigkeit der Kolonie existierte. Im halbkolonialen System der imperialistischen Herrschaft monopolisieren die imperialistischen Mächte das Weltwährungssystem, bestimmen das Weltgeld. Die Währungen der imperialistischen Mächte, die nicht als Demiurgen des Weltmarktes fungieren, gelten als relativ stabil tauschbare Währungen zur Leitwährung. Ein großer Teil des Warenverkehrs wird über die zentrale Leitwährung oder andere imperialistische Währungen vermittelt. Noch viel wichtiger ist freilich, dass die Währungen der imperialistischen Staaten, besonders der Leitwährung, auch gehortet werden, z. B. als Schatzpapiere. Währungen halbkolonialer Länder üben diese und andere Geldfunktion außerhalb ihres Landes faktisch nicht aus.
Kapitalverkehr, Anlagen, Börsen, Staatsschulden usw. werden also faktisch ausschließlich in Dollar oder einer anderen harten Währung notiert (Euro, Pfund, Renminbi/Yúan, Yen). Das bedeutet aber auch, dass die halbkolonialen, ökonomisch schwächeren Länder im Voraus zu den Bedingungen und in Währungen der imperialistischen Zentren ihre Geld- und Kapitalgeschäfte abwickeln müssen.
Um am internationalen Kapitalmarkt agieren zu können, muss das halbkoloniale Land über Weltgeld oder eine leicht gegen dieses tauschbare Währung verfügen. Nur so kann es Investitionen anziehen, Güter importieren oder Schulden bedienen und aufnehmen. Je mehr ein halbkoloniales Land von den Finanzmärkten abhängig wird, desto drückender auch die Abhängigkeit von deren Institutionen (IWF, Weltbank) und den Bedingungen, die diese diktieren.
Schon die Bezugspunkte zu Marx hinsichtlich der Modifikation des Wertgesetzes auf dem Weltmarkt verweisen darauf, dass unterschiedliche Intensität und Produktivität nicht bloß als unterschiedliche Produktivität oder Intensität eines Einzelkapitals, sondern eines gesellschaftlichen Durchschnitts begriffen werden müssen. Dies reflektiert schon die unterschiedliche Entwicklung des Kapitalstocks, der Produktivkräfte, der Stellung in der internationalen Arbeitsteilung.
Offenkundig war es für – im Vergleich zu Großbritannien – später gekommene Nationen auf dem Weltmarkt (z. B. Frankreich, Deutschland, USA, Japan) unter bestimmten Bedingungen möglich, im 19. Jahrhundert eine Ökonomie zu entwickeln, die mit der fortgeschrittensten kapitalistischen gleichzog.
Dies verweist darauf, dass es durchaus eine Wirkung des Wertgesetzes auf dem Weltmarkt zur Ausgleichung der Produktions- und Verkaufsbedingungen gibt, d. h., es gibt auch eine Angleichung verschiedener „nationalen Werte“ auf dem Weltmarkt. Wichtig ist hier aber zu betonen, dass diese keineswegs nur spontan, sondern unter kräftiger Zuhilfenahme des Staates erfolgt, insgesamt mit dem Ziel, im Rahmen der Weltmarktkonkurrenz ein wettbewerbsfähiges nationales Gesamtkapital zu schaffen. Ab einem bestimmten Punkt schlug das in ein Zurückbleiben der ursprünglich führenden Macht (Britannien) um. Ähnliche Entwicklungen lassen sich auch im Verhältnis USA-Europa-Japan ab den späten 1960er Jahren beobachten, als sich letztere zu Weltmachtkonkurrenten entwickelten.
Heute versucht sich China als Konkurrent zu etablieren, was unter anderem auch bedeutet, dass die KP-geführte Regierung sich als Sachwalterin „ihres“ gesellschaftlichen Gesamtkapitals (nicht „nur“ als Geburtshelferin weltmarktfähiger Einzelkapitale und Monopole) zu erweisen versucht.
Wenn wir aber auf die dauerhafte, systematische Unterordnung von kolonialen und halbkolonialen Ländern und deren Ausbeutung eingehen und diese erklären wollen, so kann das nicht einfach durch eine modellhafte „Ableitung“ von internationalen Marktbeziehungen erfolgen.
Die Wirkungsweise des Wertgesetzes auf dem Weltmarkt – nehmen wir z. B. die Kredit- und Geldgeschäfte – reproduziert und verschärft die Unterschiede zwischen den imperialistischen und den vom Imperialismus beherrschten Ländern.
Die Ursache dafür kann freilich nicht einfach auf dem Weltmarkt gefunden werden. Wir müssen uns vielmehr vor Augen halten, dass die kolonialen und später die halbkolonialen Länder unter Bedingungen in den Weltmarkt gezogen wurden und werden, die ihnen einen Platz im Rahmen der internationalen Arbeitsteilung unter den Bedingungen zuweisen, die von den entwickelten Kapitalen der Metropolen geschaffen wurden und in diesem System reproduziert werden. Anders als in den „entwickelten“, imperialistischen Ländern gestaltet sich die Konstituierung eines gesellschaftlichen Gesamtkapitals von Beginn an prekär.
Daher wollen wir uns noch einmal seine wesentlichen Funktionen vor Augen halten:
- Ausgleichsbewegung zu ideellem Durchschnitt, Werttransfer zwischen Branchen, damit überhaupt erst Ausgleichung der Profitrate möglich ist
- Etablierung eines durchschnittlichen Grades der Produktivität und Intensität der Arbeit
- Etablierung einer nationalen Währung, Sicherung des Geldwerts
- Sicherung der allgemeinen Produktions- und produktionsbedingungen des Kapitals
- Staat als ideeller Gesamtkapitalist; Vermittlung des Gesamtinteresses des Kapitals.
Betrachten wir die halbkolonialen Staaten hinsichtlich der Erfüllung dieser Funktionen, so zeigt sich rasch, dass sie diese nur eingeschränkt, wenn überhaupt, einhalten können.
Die Etablierung einer durchschnittlichen nationalen Intensität der Arbeit findet oft nicht oder nur sehr beschränkt statt (z. B. in Indien). Extreme Ungleichzeitigkeit der Entwicklung kennzeichnet die halbkoloniale Ökonomie und sie wird über Jahrzehnte oft genug reproduziert.
Das betrifft daher auch den Werttransfer zwischen den Branchen, also die Ausgleichsbewegung der Profitrate. Die halbkolonialen Ökonomien sind – gerade in ihren kapitalistisch entwickelteren Teilen – in der Regel auf den Weltmarkt bezogen. Das Gesetzt der ungleichzeitigen und kombinierten Entwicklung begegnet uns in den halbkolonialen Ländern in besonders drastischer Form auf Schritt und Tritt.
Die geschichtlichen Voraussetzungen der Arbeitsteilung, die selbst Folge des Kolonialismus und Imperialismus sind und zugleich von ihm reproduziert werden, bedeuten daher die Etablierung einer ungleichen internationalen Arbeitsteilung, die die innere Struktur, wie sie von der tradierten Abhängigkeit herrührt, aufgreift, reproduziert und festigt.
In den halbkolonialen Ländern drückt sich das in der Reproduktion einer einseitigen Kapitalentwicklung, die von den Akkumulationsbedürfnissen des Kapitals im imperialistischen Land bestimmt wird, aus. Daher begegnen uns in Ländern wie Indien moderne, auf den Weltmarkt bezogene Hightechindustrien neben extremer Rückständigkeit, sei es in den städtischen Armutsvierteln, bei der Wanderarbeit oder auf dem Land.
Die Industrialisierung und Entwicklung der Ökonomie war in der Regel auf Exporte bestimmter Branchen (Rohstoffe, Nahrungsmittel), später auch bestimmte selektive Produktion von Zwischenprodukten, bezogen. Für diese Sparten äußert sich die extreme Ungleichzeitigkeit der Entwicklung in der Kombination besonders ausbeuterischer, rückständiger Formen (Kontraktarbeit, … ) mit der Produktion für den Weltmarkt.
Wir haben es bei der Wirkungsweise des Wertgesetzes auf dem Weltmarkt daher einerseits mit einer widersprüchlichen Tendenz zur Angleichung der Nationalökonomien (beobachtbar insbesondere im Verhältnis zwischen imperialistischen Staaten) und andererseits mit der Reproduktion einer internationalen Hierarchie der Kolonien und Halbkolonien zu tun.
Deren Quelle muss auch in der Zusammensetzung des gesellschaftlichen Gesamtkapitals gesucht werden, genauer: in der Blockade von dessen Herausbildung in der Halbkolonie.
Das halbkoloniale Ausbeutungsregime des Finanzkapitals bildet somit die eigentlich angemessene Form der abhängigen Akkumulation der „Dritten Welt“ unter der Dominanz einer entwickelten imperialistischen Weltwirtschaft.
12. Epoche, Periode, Zyklus, Metazyklen, Klassenkampfperiode
Weiter oben haben wir die imperialistische Epoche grundsätzlich als ein bestimmtes Entwicklungsstadium der kapitalistischen Gesellschaftsformation, als Übergangskapitalismus oder sterbenden Kapitalismus charakterisiert.
Die zyklische industrielle Krise besteht zweifellos nicht nur in der vorimperialistischen, sondern auch in der imperialistischen Epoche. Aber der industrielle Zyklus wird modifiziert durch die Vorherrschaft des Finanzkapitals.
Erstens dahingehend, dass die Zyklen in der Regel einen flacheren Verlauf annehmen, weil a) der monopolistische Charakter des Finanzkapitals die Perioden für Ersatzinvestitionen des fixen Kapitals dehnt, b) das Monopolkapital zeitweilig nicht in die Ausgleichsbewegung der Profitrate eingeht und daher in seinem Investitionsrhythmus von den Bewegungen des industriellen Zyklus teilweise freigespielt ist. Dies wird noch durch den parasitären Charakter des Monopols und seine Tendenz zur Stagnation verstärkt.
Zweitens führt die Krise dazu, dass die Monopolisierungstendenzen, die Dominanz des Finanzkapitals weiter verstärkt werden (Aufkäufe, Abwälzung der Krisenkosten auf nichtmonopolistische Kapitale etc.). D. h., jeder neue industrielle Zyklus findet nicht nur einfach auf mehr oder minder neuer technischer Basis, auf Grundlage einer neuen Zusammensetzung des Gesamtkapitals, sondern auch auf Grundlage eines im Vergleich zum vorherigen Zyklus und im Verhältnis zu anderen Kapitalen gestärkten Finanzkapitals statt.
Neben den einzelnen industriellen Zyklen lassen sich auch Reihen von ihnen mit ähnlicher Akkumulationsdynamik konstatieren. Ihre gemeinsame Basis findet sich – wie jene des einzelnen industriellen Zyklus – in der vorhergegangenen Krise, sprich: ob diese die Bedingungen für eine expansive Akkumulationsdynamik herstellen konnte oder nicht, also in letzterem Fall zu einer stagnativen oder gar depressiven Entwicklungsdynamik geführt hat.
Die Frage ist jedoch, was eine bestimmte Dynamik, die verschiedene Zyklen umfasst, in Gang setzt. Im Folgenden nennen wir diese Reihen von Konjunkturzyklen Akkumulationsperioden. Im Anschluss an Trotzkis „Kurve der kapitalistischen Entwicklung“ unterscheiden wir zwischen solchen mit expansivem, stagnativem und depressivem Charakter.
Perioden mit stagnativem oder gar depressivem Charakter sind immer durch eine, ihrer Krisenhaftigkeit ökonomisch zugrundeliegenden strukturellen Überakkumulation von Kapital geprägt. Die industriellen Zyklen in den Stagnationsperioden tendieren außerdem dazu, „flacher“ auszufallen, da aufgrund geringer Profitraten und -erwartungen relativ geringe Kapitalmengen in den industriellen, Mehrwert schaffenden Sektor fließen und damit auch in die Neuausstattung des fixen Kapitals.
Auch die vorherrschende Form der Mehrwertaneignung ändert sich – nämlich von der relativen Mehrwertproduktion, die in expansiven Perioden vorherrscht, zur Produktion absoluten Mehrwerts – eine logische Folge der geringeren Erneuerungs- und Erweiterungsinvestitionen, der „Flucht“ in spekulatives Kapital.
Die Ausweitung des Kreditsystems im Zeitalter des Finanzkapitals ermöglicht es speziell den imperialistischen Zentren, die Wirkungsweise von industriellen Zyklen und längerfristigen Krisentendenzen eine gewisse Zeit aufzuhalten. Diese Behinderung der bereinigenden Wirkungen der kapitalistischen Krise führt umgekehrt dazu, dass der folgende Kriseneinbruch umso heftiger und einschneidender wird. Auf diese Weise überlagert den normalen Krisenzyklus ein scheinbar eigenständiger Finanzmarktzyklus, der in der imperialistischen Epoche zum wesentlichen Bestimmungsmoment von Akkumulationsperioden wird. Der Finanzmarktzyklus ist wesentlich bestimmt durch die Organisierungsformen des Finanzkapitals, der Steuerungsmechanismen des Produktivkapitals, seiner Verbindungen zu staatlichen Strukturen sowohl im ökonomischen als auch im politischen Sinn etc. Vor allem aber ist er bestimmt durch die Formen internationaler Kapitalströme, ob in Direktinvestitionen, Kredite, Beteiligungen, Geldmarktbewegungen etc. Gerade in Bezug auf internationale Kapitalströme sind in der imperialistischen Epoche klare Auf- und Abwärtsbewegungen von großem Ausmaß festzustellen, die jeweils mit dem Wechsel wesentlicher AkteurInnen bzw. Institutionen verbunden sind: z. B. Goldstandard und Vorherrschaft von Staatskredit in der „klassischen“ imperialistischen Periode; institutionelle Kredite (Privatbanken unter Schirmherrschaft des IWF), Bretton-Woods-System und System direkt beherrschter Tochterunternehmen in der Zeit des „langen Booms“; fondsgestütztes Investmentbanking, Dollar als Weltwährung und durch den Finanzmarkt organisiertes Unternehmensbeteiligungssystem in der „Globalisierungs“periode. Diese unterschiedlichen Strukturen des Finanzkapitals bedingen unterschiedliche Krisendynamiken am Ende des Finanzmarktzyklus, die sich auch unterschiedlich auf die Krisentendenz der Akkumulationsperiode als Ganze auswirken. Finanzmarktkrisen können auch eingedämmt werden oder nur den Auftakt einer sich entwickelnden Krisenphase der Periode bilden, so z. B. die Börsenkräche 1907 und 1986 (mitsamt der Krise des US-Hypothekenbanksystems) oder die Asienkrise der 1990er Jahre und die folgende Internetblase.
Die Ausgangsbasis für diese Akkumulationsperioden wird jedoch nicht einfach durch die ökonomische Entwicklung der Kapitalbewegung bestimmt, sondern durch Klassenkämpfe zwischen Lohnarbeit und Kapital, geopolitische Verschiebungen, imperialistische Konkurrenz und Kriege, Revolutionen und Konterrevolutionen. In der Tat bildet die Herstellung einer bestimmten Weltordnung die Basis (resp. der Zusammenbruch einer vorhergehenden aufgrund politischer Ereignisse – z. B. Erster Weltkrieg, Zusammenbruch des Weltmarktzusammenhangs etc.), auf der sich längerfristige, mehrere Zyklen umfassende Akkumulationsperioden überhaupt bilden können.
Kurzum, wenn wir von geschichtlichen Perioden im Rahmen der imperialistischen Entwicklung sprechen, können diese nicht einfach durch Referenz auf eine Folge von industriellen Zyklen ökonomisch bestimmt werden. Die Akkumulationsperioden bilden vielmehr die ökonomische Basis für geschichtliche Perioden im Rahmen der imperialistischen Epoche.
Um den Gesamtcharakter geschichtlicher Perioden zu bestimmen, müssen wesentlich auch andere Fragen des Verhältnisses zwischen den imperialistischen Mächten und zwischen den Klassen einfließen. Während Akkumulationsperioden (oder metazyklische Perioden) ökonomische Kategorien darstellen, bezieht sich der Begriff der historischen Periode – ebenso wie jener der Epoche selbst – auf die Gesamtheit der Entwicklung der Gesellschaftsformation.
Ihr Beginn oder Ende können, müssen aber keinesfalls, mit dem Beginn ökonomischer Zyklen zusammenfallen. Ja, in der Regel werden sie das nicht tun. Vielmehr sind für den Beginn (oder das Ende) einer Periode einschneidende weltpolitische Ereignisse konstitutiv, die eine grundlegende Veränderung des Kräfteverhältnisses zwischen den Klassen und den imperialistischen Mächten markieren.
Die Akkumulationsdynamik einer bestimmten historischen Periode (und auch andere Faktoren wie die historisch spezifische Form der Kapitalbildung, das innerimperialistische Verhältnis usw.) führt notwendig dazu, dass bestimmte Merkmale und Wesenszüge der Epoche stärker oder weniger stark in den Vordergrund treten. So ist z. B. in der Periode des „langen Booms“ – selbst eine außergewöhnliche Periode – die Tendenz zum Niedergang und zur Stagnation vergleichsweise gering ausgeprägt. Das hat ja auch viele RevisionistInnen zur Annahme geführt, dass es gar keine imperialistische Epoche mehr gäbe.
In der ersten Phase der Globalisierungsperiode wiederum erscheint die innerimperialistische Konkurrenz eliminiert. Dies wird noch durch die Formierung gigantischer Konzerne verstärkt, deren Terrain der Weltmarkt ist, und die, so die „moderne“ revisionistische Argumentation, zur Bildung eines „transnationalen Kapitals“ geführt hätten, das nicht mehr mit bestimmten imperialistischen Staaten verbunden wäre, dass es nur noch „globalen Norden“ und „globalen Süden“ gäbe, dass der „Imperialismus“ einer neuen Form des Ultraimperialismus gewichen sei.
In diesen längeren historischen Perioden sind kürzere „Klassenkampfperioden“ inkludiert. In der kommunistischen Literatur werden diese auch öfter als „Situationen“ oder „Lagen“ bezeichnet. Wir haben dafür gelegentlich den Begriff „Phasen“ verwendet.
Die Klassenkampfperioden werden durch politische Ereignisse von globaler Bedeutung bestimmt, sowohl was ihren Beginn als auch ihr Ende betrifft. Das sind politische Phasen, die in der Regel nur wenige Jahre umfassen.
Die Bestimmung dieser kurzen Klassenkampfperioden ist umgekehrt erstens sehr wichtig, weil sie grundlegende Auswirkungen auf die Strategie und Taktik des revolutionären Proletariats in einer bestimmten Periode mit sich bringen. Zweitens sind insbesondere Perioden von revolutionärem oder vorrevolutionärem Charakter von größter Wichtigkeit, weil sich in ihnen der allgemeine Charakter der Epoche sowie der historischen Periode konzentriert ausdrückt.
Auch wenn die Dauer der Klassenkampfperioden relativ kurz ist – einige Jahre, vielleicht bis zu einem Jahrzehnt umfassend –, so können wir generell davon ausgehen, dass der Wechsel zwischen verschiedenen Klassenkampfperioden umso rascher vonstattengeht, je instabiler und revolutionärer der Charakter der historischen Periode ist, deren Bestandteil sie verkörpert. Der vergleichsweise rasche Wechsel zwischen revolutionären und konterrevolutionären Klassenkampfperioden, jenen relativer Stabilität mit jenen größerer revolutionärer (und konterrevolutionärer) Erschütterungen, konstituiert ein Wesensmerkmal von historischen Perioden der sozialen Revolution, revolutionären Perioden wie, in klassischer Form, jener von 1914 – 1948.
Es macht außerdem Sinn, zwischen Klassenkampfperiode und -situation zu unterscheiden, auch wenn dies keineswegs einfach und immer trennscharf ist. Das ist kein Zufall. Erstens handelt es sich in beiden Fällen um politische Kategorien. Zweitens tendieren diese in revolutionären historischen Perioden (z. B. in der Zwischenkriegszeit) dazu zusammenzufallen. Das ist durch den Charakter der historischen Periode, den raschen Wechsel der Weltlage usw. bedingt.
In anderen historischen Perioden macht es einen offenkundigen Sinn, zwischen der Klassenkampfperiode und einer Situation zu unterscheiden (wobei letztere einen Wechsel des Charakters der Klassenkampfperiode einläuten kann, aber nicht muss). So kann der Beginn des Krieges gegen Afghanistan nach dem 11. September 2001 durch die globale „Allianz der Willigen“ durchaus als konterrevolutionäre Situation beschrieben werden, in der, allerdings nicht für allzu lange Zeit, der Widerstand, die Antiglobalisierungs-, die ArbeiterInnenbewegung usw. paralysiert wurden.
Die längeren, historischen Perioden in der imperialistischen Epoche lassen sich in sechs Abschnitte einteilen:
a) Entstehungsperiode des klassischen Imperialismus bis 1914
b) Revolutionäre Krisen- und Zusammenbruchsperiode 1914 – 1948
c) Periode des langen Booms und der konterrevolutionären Nachkriegsordnung 1948 – 1968
d) Periode des Niedergangs der Nachkriegsordnung 1968 – 1989
e) Globalisierungsperiode seit 1989 – 2007/2008
f) Periode einer neuen globalen Krise des Kapitalismus seit 2007/2008 – Periode der Krise der Globalisierung.
13. Perioden der imperialistischen Epoche, ihre grundlegenden Charakteristika und die in ihnen inkludierten Klassenkampfperioden
Im Folgenden wollen wir einen kurzen Abriss der geschichtlichen Perioden der imperialistischen Epoche liefern. Wir werden darin auch beispielhaft wichtige Klassenkampfperioden darstellen, freilich ohne jedes Jahr und jeden Tag der letzten hundert Jahre zuzuordnen. Ein besonderes Augenmerk wollen wir auf die Übergänge von einer Periode zur anderen legen.
13.1 Die Entstehungsperiode des Imperialismus bis 1914
Die Periode bis 1914 kann im Anschluss an Trotzki als eine der Herausbildung der Widersprüche des Imperialismus charakterisiert werden. Die Krise von 1873 stellte einen wichtigen Bruchpunkt in der Entwicklung des Kapitalismus im 19. Jahrhundert dar. [cii] Verglichen mit den vorhergehenden zyklischen Krisen trat der internationale Charakter besonders stark hervor, die Krise traf alle wichtigen Nationalökonomien. In den jüngeren kapitalistischen Ländern oder Mächten (Vereinigte Staaten, Deutschland, Österreich-Ungarn) war sie besonders ausgeprägt, wirkte sich aber auch auf England and Frankreich stark aus. Vordergründig erschien sie durch ein massives „Spekulationsfieber“ indiziert, aber das verschleierte eher ihre Ursachen und vor allem ihre Auswirkungen.
Rückblickend können wir feststellen, dass sie eine wirkliche Weltmarktkrise darstellte, in allen Ländern zu einer massiven Vernichtung von überschüssigem Kapital und zu einer massiven Erneuerung des Kapitalstocks, vor allem im Bereich der Herstellung von Produktionsmitteln, führte. Die Krise signalisierte und verstärkte also eine Durchsetzung der industriellen Großproduktion in allen wichtigen Sektoren, sie gab der Zentralisation und Konzentration von Kapital einen mächtigen Schub und damit auch der Bildung und Durchsetzung des Finanzkapitals.
Natürlich lässt sich der Übergang von einer Epoche des Kapitalismus zur nächsten nicht genau datieren, wohl aber können wir vom Beginn einer neuen Epoche beim Übergang vom 19. zum 20. Jahrhundert sprechen.
Mit ihr fallen auch die Herstellung des Weltmarktes und der Abschluss der Aufteilung der Welt unter die großen Kapitale und Großmächte zusammen. Es ist die Periode des Übergangs zum Imperialismus. Es ist die Periode, in der die Verschmelzung von industriellem und zinstragendem Kapital unter Dominanz des Letzteren zur Bildung und Durchsetzung des Finanzkapitals führte. Die wesentliche Form dieser Verschmelzung ist in jener Periode sowie auch in der folgenden jene von industriellem Kapital mit den Banken. Die Börse und die Finanzmärkte spielten in vielen Ländern in dieser Periode eine relativ geringe Rolle.
Die Aufteilung der Welt ist zu Beginn der imperialistischen Epoche faktisch bereits abgeschlossen. Britannien bildete die dominierende, hegemoniale Macht aufgrund der Funktion des Pfunds als Weltgeld, des riesigen Kolonialreiches und der überlegenen militärischen Schlagkraft der britischen Flotte. Während Frankreich als zweitgrößte Kolonialmacht zwar einen globalen, geopolitischen Rivalen darstellte, wurde es von anderen aufsteigenden Mächten bedrängt und in vieler Hinsicht bereits überflügelt.
Die USA und Deutschland als größte industrielle Mächte etablierten sich als wichtigste aufstrebende RivalInnen des britischen Hegemons. Hinzu kam Japan. Während die USA über einen gigantischen Binnenmarkt verfügten und frühe Formen der halbkolonialen Dominanz in den Amerikas entwickelten, waren Deutschland und Japan bei der kolonialen Aufteilung der Welt „zu kurz“ gekommen. Drei Imperien befanden sich schon in der frühen imperialistischen Epoche in äußerst prekärer Lage. Das traf vor allem auf das Osmanische Reich zu, das praktisch in Schuldknechtschaft der imperialistischen Banken gezwungen wurde. Der Widerspruch zwischen imperialer Ambition und einer Ökonomie, die einem halbkolonialen oder kolonialen Gebiet entspricht, trat hier am deutlichsten hervor. Aber auch in der Habsburger Monarchie und im zaristischen Russland zeigte sich der Gegensatz zwischen imperialer Stellung und Ambition einerseits und extremer Rückständigkeit andererseits in äußerst widersprüchlicher Form. Beide entwickelten im Gegensatz zum Osmanischen Reich neben Formen der Rückständigkeit auch modernste und gigantische Großindustrien (Russland) oder ein bedeutendes Bankkapital (Österreich), für das die unterdrückten Länder der Doppelmonarchie bevorzugte Ziele des Kapitalexports darstellten.
Kleinere oder schwächere imperialistische Staaten, wie z. B. Belgien oder Portugal, fungierten faktisch als Mitpartizipierende einer globalen Arbeitsteilung und politischen Ordnung, als Pufferstaaten oder untergeordnete Vasallen einer Großmacht.
All das verdeutlicht schon am Beginn der imperialistischen Epoche, dass Imperialismus vor allem eine globale politische und ökonomische Ordnung ist und nicht einfach eine Ansammlung von Eigenschaften voneinander isoliert betrachteter Ökonomien und Staaten darstellt. Ob ein Land als imperialistisch zu charakterisieren ist oder nicht, kann daher nur im Rahmen einer Betrachtung der Totalität der ökonomischen und politischen Weltordnung erfasst werden, die den Ländern ihren Platz in der globalen Hierarchie der kapitalistischen Ökonomien und Mächte zuweist.
Die technologischen Neuerungen in Schwerindustrie, Chemie, Transport und Kommunikation bildeten ein weites Feld für rasante Akkumulation. Gleichzeitig war genug Anlagekapital zu günstigen Zinsen verfügbar. Mit dem Aufschwung der Monopolindustrien ging eine „Explosion“ der Kapitalexporte einher. Wie Lenin ausführlich zeigt[ciii], konzentrierte sich dieser Kapitalexport auf die Jahre 1900 – 1914. Vor dem Ersten Weltkrieg wurde in England, Frankreich und Deutschland ein Niveau erreicht, das jenes von Mitte des 19. Jahrhunderts fast um das Hundertfache übertraf.
Dabei wurde der Kapitalexport vor allem durch Staatsanleihen und Kredite organisiert, die über Regierungen und Bankenkonsortien vermittelt wurden. Dieser Kapitalfluss war an die Bedingungen geknüpft, Infrastrukturaufträge an große Industriemonopole der imperialistischen Staaten zu vergeben. Zur Sicherung dieser Kapitalbeziehungen wurde in bestimmten Regionen in bisher ungekanntem Ausmaß zum Mittel des direkten Kolonialismus gegriffen, während anderswo die „Unabhängigkeit“ formal bestehen blieb, aber de facto der Status von „Halbkolonien“ entstand.
Die USA und Deutschland als aufstrebende industrielle und finanzielle Mächte gerieten mehr und mehr an die Grenzen der unter britischer Vorherrschaft vorgenommenen Aufteilung der Welt. Das traf vor allem auf Deutschland zu, das, im Kolonialsystem zu kurz gekommen, an die Grenzen eines für die Akkumulationsbedürfnisse des Großkapitals zu klein gewordenen Binnenmarkts stieß. Die USA befanden sich in einer weit besseren Situation wegen des größeren und noch nicht entwickelten inneren Marktes und ihrer Dominanz über Lateinamerika als halbkoloniale Einflusssphäre.
Ökonomisch war diese Periode von 1900 – bis 1914 expansiv, da Monopol- und Finanzkapital mit der enormen Ausdehnung der Produktion, den großen industriellen und sonstigen Unternehmungen auch fortschrittliche Potenzen an den Tag legten.
Aber das Monopol verschärft die krisenhaften Tendenzen gerade auch deshalb, weil es entwertende und damit expansive Voraussetzungen wiederherstellende Wirkungen der industriellen Krise modifizieren kann – z. B. indem die Vernichtung überschüssigen Kapitals aufgeschoben wird und die Kosten seiner Erhaltung der Gesellschaft aufgebürdet werden.
Das sich entwickelnde Finanzkapital begann in dieser Periode, sich alle Aspekte des Wirtschaftslebens unterzuordnen. Überaus wichtige Beispiele dafür waren Forschung und Wissenschaft, die mehr und mehr auf die Bedürfnisse des Großkapitals bezogen wurden, immer größere Kapitalauslagen brauchten oder staatlich organisiert werden mussten. Daher nahm logischerweise auch die Bedeutung des Eigentums und exklusiven privatkapitalistischen Anspruchs auf Resultate der Forschung und Wissenschaft (inkl. Patentrecht) zu. Insgesamt verschärfte all das die Dominanz des Finanzkapitals gegenüber nichtmonopolistischem Kapital und der Gesellschaft insgesamt.
Die industriellen Krisen trieben die Monopolisierungstendenzen mit voran, führten zur Verschärfung der internationalen Konkurrenz, schließlich zum Krieg.
Politisch ging diese Periode einher mit einer ökonomischen Vertiefung des Kolonialsystems und damit auch der Notwendigkeit seiner militärischen Absicherung und Durchsetzung. Der Militarismus bildete ein immer stärker werdendes Kennzeichen aller imperialistischen Mächte. Seine Durchsetzungsformen reichten von der Kanonenbootpolitik bis hin zu größeren, ins Landesinnere ausgreifenden kolonialen „Missionen“.
Der Russisch-Japanische Krieg, die erste Russische Revolution, die Marokkokrise und die Balkankriege signalisierten schon den Übergang zur nächsten Periode, verdeutlichten, dass sich die inneren Widersprüche zuspitzten.
Die Periode bis zum Ersten Weltkrieg stellte eine der Entwicklung der Widersprüche auch in dem Sinne dar, dass sich die gesellschaftlichen Hauptklassen (auch mit inneren Kontroversen) des Epochenbruchs zum Imperialismus bewusst wurden.
Die ArbeiterInnenbewegung machte in dieser Periode mit der Vergrößerung der ArbeiterInnenaristokratie, Veränderungen des Gewerkschaftswesens und der Entwicklung einer ArbeiterInnenbürokratie als Resultat erfolgreicher gewerkschaftlicher und politischer Kämpfe für Reformen einen wichtigen Formwandel durch.
Auch die sozialen Verhältnisse in den Kolonien und Halbkolonien wurden dahingehend umgewälzt, dass eine, wenn auch kleine, aber oft hoch konzentrierte moderne ArbeiterInnenklasse entstand. Zugleich war ihnen eine, gegenüber dem Westen, einfach „nachholende Entwicklung“ aufgrund des kolonialen oder halbkolonialen Charakters ihres Landes im Rahmen des imperialistischen Weltsystems nicht möglich. Gerade was die Entwicklung dieser, vom imperialistischen Finanzkapital beherrschten Länder betrifft, zeigte sich der hemmende Charakter der bürgerlichen Eigentumsverhältnisse in der imperialistischen Epoche, was die Entwicklung der Produktivkräfte der Menschheit betrifft, und zwar für ihren weitaus größeren Teil.
In dieser Periode spitzten sich in der ArbeiterInnenbewegung auch die inneren politischen Gegensätze zu. Die reformistische Alltagspraxis, die in den westlichen ArbeiterInnenparteien und Gewerkschaften mehr und mehr dominierte, suchte mit den Vorstößen des Revisionismus auch nach einem theoretischen Ausdruck ihrer Politik.
Insgesamt kann man jedoch konstatieren, dass sich das Bewusstsein der sich formierenden Fraktionen in der internationalen Sozialdemokratie hinsichtlich des Charakters ihrer Meinungsverschiedenheiten und deren politischer und organisatorischer Konsequenzen erst allmählich entwickelte und dieser von allen Fraktionen an bestimmten Punkten unterschätzt wurde.
Der imperialistische Weltkrieg und der Zusammenbruch der Zweiten Internationale zwangen die RevolutionärInnen dazu, sich die Frage nach den materiellen Wurzeln des Verrats der Zweiten Internationale in allen Aspekten zu stellen und grundlegende, radikale Konsequenzen daraus zu ziehen, d. h., den konsequenten Bruch mit dem reformistischen Sozialchauvinismus zu vollziehen sowie die Notwendigkeit einer Dritten Internationale zu proklamieren und diese schließlich als Weltpartei der proletarischen Revolution zu gründen.
13.2 1914 – 1948: Periode des Zusammenbruchs der imperialistischen Ordnung – Revolution und Konterrevolution
Die Periode von 1914 bis 1948 entsprach offensichtlich in ihrer Erscheinungsform am deutlichsten den klassischen Imperialismustheorien der revolutionären ArbeiterInnenbewegung.
Mit dem Ersten Weltkrieg traten die inneren Widersprüche, die sich in der vorhergehenden Periode aufgeladen hatten, explosiv hervor. Doch der Weltkrieg löste diese nicht. Die Frage der imperialistischen Führung und der Neuaufteilung der Welt blieben ungelöst, ja, verschärfte sich. Die USA wurden zur führenden Wirtschaftsmacht, zur Industriellen der Welt. Auch Japan verzeichnete einen starken industriellen Aufschwung.
Britannien und Frankreich konnten jedoch ihr Kolonialmonopol behaupten, aber auf ungleich schwächerer industrieller Grundlage. Das Pfund blieb Leitwährung. Seine Weltmarktfunktion als Weltgeld vermochte es jedoch nicht mehr recht auszufüllen, was den britischen Imperialismus vielmehr von innen aushöhlte. In der prekärsten Lage befand sich jedoch der deutsche Imperialismus.
Die unmittelbare Nachkriegsperiode war neben den politischen auch durch massive ökonomische Erschütterungen, v. a. in Deutschland, charakterisiert – bis hin zur Hyperinflation 1923. Diese konnte durch eine Änderung der US-Politik und deren Weltmachtrolle (neben dem für das Kapital positiven Scheitern der Revolution) ab Ende 1923 relativ stabilisiert werden. Aber die Probleme blieben.
Die 1920er Jahre sahen einen enormen Anstieg von privaten Investitionen, speziell aus den USA in Form von Anleihen in lateinamerikanischen und osteuropäischen Staaten sowie in Deutschland, die durch US-Investmentbanken gebündelt und vermittelt wurden. Diese Anlagen wiederum dienten als Deckung für eine Kreditausdehnung auf Basis niedriger Zinsen. Mit dem Steigen der US-Zinsen Ende der 1920er Jahre und den wachsenden Problemen bei der Schuldentilgung durch die Schuldnerstaaten platzte die Spekulationsblase in der ausgedehnten Finanzkrise nach 1929. Die nächsten Jahre sahen einen gewaltigen Rückfluss an Schuldentilgung, Auflösung von Reserven, sinkenden Wechselkursen und stark ungünstige „Terms of Trade“ auf Seiten der betroffenen Länder. Insbesondere in Lateinamerika war „Importsubstitution“ eine logische Antwort auf diese Probleme. Ebenso wechselte damit die vorherrschende Form des Kapitalexports in die der Direktinvestition, insbesondere in Landesgesellschaften der US-Konzerne in Lateinamerika.
Gleichzeitig bedeutete das Kolonialsystem für die USA, Deutschland und Japan aus unterschiedlichen Gründen enorme Einschränkungen. Das US-Kapital investierte auch wegen des Kolonialsystems in den 1920er Jahren v. a. in Deutschland, Lateinamerika und Osteuropa, während ihm die britischen und französischen Kolonialgebiete oft verschlossen waren.
Das deutsche Monopolkapital war zu groß für den inneren Markt. Zugleich verhinderten Schutzzölle und andere Auflagen des französischen und britischen Imperialismus den Zugang zum Weltmarkt, v. a. für die Stahl- und Chemieindustrie.
Damit verschärfte sich der Gegensatz zwischen den größten Kolonialmächten sowie den USA, Deutschland und Japan weiter. Der Gegensatz musste sich, sofern nicht die proletarische Revolution zuvorkommen würde, in einem weiteren Weltbrand, dem Zweiten Weltkrieg, entladen.
Insgesamt waren weite Teile dieser Periode gekennzeichnet durch die Erschütterungen, ja, den Zusammenbruch der imperialistischen Ordnung und des Weltmarktes. Die imperialistische Vormachtstellung Britanniens ist in offenen und akuten Gegensatz zu seiner ökonomischen Potenz getreten. Anders als vor dem Ersten Weltkrieg und unmittelbar danach gab es keine imperialistische Hegemonialmacht, die als „Weltmarktgarantin“ hätte fungieren können.
Gerade deshalb stellen die kurzen, fieberhaften wirtschaftlichen Aufschwungsperioden von 1923 – 29 ökonomische Entwicklungen dar, die große Katastrophen vorbereiteten, weil die globalen geopolitischen Verhältnisse und die klassenmäßigen Voraussetzungen nicht in der Lage waren, eine anhaltende Stabilisierung herbeizuführen.
Das zeigte sich auch in der Entwicklung der Technik. So bereiteten die 1920er und 1930er Jahre viele Entwicklungen vor, die später, in der Periode des langen Booms (s. u.), verallgemeinert wurden und wichtige Elemente der ökonomischen Grundlagen dieser Periode darstellten (Anwendung des Taylorismus in der US-Autoindustrie ab 1913 und dessen beginnende Ausbreitung nach dem Ersten Weltkrieg, Zentralisation des Kapitals im Handelssektor, „Entdeckung“ der ArbeiterInnenklasse als Massenkonsumentin, „Entdeckung“ der kolonialen oder halbkolonialen Länder für Direktinvestitionen).
Doch all diese Entwicklungen konnten ihr ökonomisches Potential in dieser Periode unmöglich realisieren, weil die globalen Bedingungen dafür, d. h. massive Vernichtung bestehender Kapitale, Neuaufteilung der Welt und Etablierung einer imperialistischen Hegemonialmacht, über Jahrzehnte fehlten.
Die Zwischenkriegsperiode und der Zweite Weltkrieg markierten auch aus einem anderen Grund einen Wendepunkt., eine globale Durchsetzung des Imperialismus. Anders als in jeder vorhergehenden Periode waren die Kolonialländer und die Halbkolonien direkt in die Weltpolitik, in das globale politische System im Rahmen der globalen Auseinandersetzung eingefügt, in der diesen Ländern, respektive den sich bildenden, in ihrer Formierung durch das imperialistische Weltsystem letztlich blockierten, modernen Gesellschaftsklassen in diesen Ländern (ArbeiterInnenklasse und Bourgeoisie), eine ungleich größere Rolle zukam als in der vorimperialistischen Epoche oder in der ersten Periode des Imperialismus. Die Kolonialvölker wurden in viel größerem Maße als je zuvor AkteurInnen im revolutionären Kampf.
Wir können also von einer globalen Periode des Zerfalls des Kapitalismus, seines Niedergangs sprechen, in der der Übergang zum Sozialismus den einzigen möglichen Ausweg bildete, um historische Katastrophen – Krieg, Faschismus, Barbarei – abzuwenden. In dieser insgesamt revolutionären Geschichtsperiode, einer von Revolution und Konterrevolution, kam dem subjektiven Faktor, der Frage des Bewusstseins, der Reife, Organisiertheit, der strategischen und taktischen Richtung der kommunistischen Bewegung, eine bis dahin nie dagewesene geschichtliche Bedeutung zu.
Die Periode von 1914 bis 1948 muss also auch von dieser Seite charakterisiert werden, und zwar als eine revolutionäre Periode, weil sie wiederholt einen Ansturm der WeltarbeiterInnenklasse auf die politische Macht im Weltmaßstab mit sich brachte. Der Sieg und das Behaupten der Russischen Revolution, die Errichtung der Sowjetunion usw. belegen auch den Charakter der imperialistischen Epoche als „Übergangskapitalismus“.
Zugleich offenbart sich der Charakter der weltgeschichtlichen Periode keineswegs immer in derselben Form. In seiner Kritik des 6. Weltkongresses der Kommunistischen Internationale verwies Trotzki auf dieses Problem folgendermaßen:
„Der revolutionäre Charakter der Epoche besteht nicht darin, dass er es in jedem gegebenen Augenblick gestattet, die Revolution durchzuführen, d. h. die Macht zu ergreifen, sondern in scharfen Schwankungen und abrupten Übergängen von einer unmittelbar revolutionären Situation, in der die Kommunistische Partei Anspruch auf die Macht erheben kann, zu einem Sieg der faschistischen oder halbfaschistischen Konterrevolution, und von letzterem zu einem provisorischen Regime der goldenen Mitte (dem „Linken Block“, der Einbeziehung der Sozialdemokraten in die Koalition, dem Übergang der Macht an die Partei MacDonalds usw.), um gleich darauf wieder die Gegensätze auf die Spitze zu treiben und in aller Schärfe die Machtfrage zu stellen.“ [civ]
Wenn wir einmal beiseitelassen, dass Trotzki hier die geschichtliche Periode mit der gesamten imperialistischen Epoche identifiziert, so zeigt das für diese Zeit sehr deutlich, welche zentrale Bedeutung die Einschätzung der Klassenkampfperiode oder der konkreten Lage für die konkrete revolutionäre Politik, für die Bestimmung ihrer konkreten Taktik, der Losungen, Forderungen, die in den Mittelpunkt ihrer Agitation und Propaganda gerückt werden, hat. Eine Politik, die der jeweils konkreten Lage nicht Rechnung trägt, ist, unbeschadet aller guten Vorsätze und des Heroismus ihrer AnhängerInnen, letztlich zum Scheitern verurteilt. Sie führt unvermeidlich zur politischen Desorientierung der Klasse. Darin liegt eben eine der großen Tragödien des Linksradikalismus, ultralinker politischer Ungeduld oder auch opportunistischer Passivität. Wenn die sich verändernden Situationen nicht rechtzeitig erkannt werden, wird die revolutionäre Organisation notwendigerweise unangemessene Taktiken verwenden oder die falschen Losungen in den Mittelpunkt stellen. Ein solches Unvermögen wirkt sich bei allen Wendungen im Klassenkampf – sowohl bei revolutionären Zuspitzungen als auch nach grundlegenden Niederlagen – verheerend aus. Trotzki verdeutlicht das Problem unter anderem nach der Niederlage des deutschen Oktober 1923, als sich die Komintern weigerte, die Niederlage zur Kenntnis zu nehmen:
„Nach der Periode der Sturmflut während des Jahres 1923 begann die Periode einer langdauernden Ebbe. In der Sprache der Strategie bedeutete das einen geordneten Rückzug, Nachhutgefechte, die Befestigung der Stellungen innerhalb der Massenorganisationen, die Überprüfung der eigenen Reihen und die Reinigung und Schärfung der theoretischen und politischen Waffen. Diese Haltung wurde als Liquidatorentum gebrandmarkt. Mit diesem, wie auch mit anderen Begriffen aus dem Wörterbuch des Bolschewismus wurde in den letzten Jahren der allergrößte Missbrauch getrieben. Man lehrte und erzog nicht mehr, sondern säte nur Zwietracht und Verwirrung. Liquidatorentum bedeutet die Zurückweisung der Revolution, es ist der Versuch, deren Wege und Methoden durch die Wege und Methoden des Reformismus zu ersetzen. Die leninistische Politik hat nichts mit Liquidatorentum gemein. Doch genausowenig hat sie mit einer Mißachtung der Veränderungen in der objektiven Lage zu tun, damit, den Kurs des bewaffneten Aufstands in Worten aufrechtzuerhalten , wenn die Revolution uns bereits den Rücken gekehrt hat und es notwendig ist, wieder den langwierigen Weg hartnäckiger, systematischer und mühseliger Arbeit unter den Massen einzuschlagen, um die Partei auf eine neue Revolution vorzubereiten .
Um eine Treppe hinaufzusteigen, braucht der Mensch eine andere Art der Bewegung, als wenn er sie hinuntergeht. Am gefährlichsten wird es, wenn der Mensch, nachdem er das Licht gelöscht hat, den Fuß zum Hinaufsteigen hebt, während es vor ihm die Stufen hinuntergeht. Stürze, Verletzungen und Verrenkungen sind dann unvermeidlich. Die Führung der Komintern hat im Jahre 1924 alles getan, um die Kritik der Erfahrungen des deutschen Oktobers und jede Kritik überhaupt zu unterdrücken. Sie wiederholte halsstarrig: Die Arbeiter steuern unmittelbar auf die Revolution zu – die Treppe führt hinauf. Kein Wunder, daß die Direktiven des 5. Kongresses, angewandt während des Zurückflutens der Revolution, zu schweren politischen Stürzen und Verrenkungen führten!“ [cv]
Die Bedeutung einer konkreten Analyse der politisch-ökonomischen Lage, der kurzfristigen Klassenperiode oder Situation ergibt sich daraus, dass diese jeweils unterschiedliche, konkrete Politik erfordern. Daher bilden die Einschätzung und Charakterisierung der aktuellen Lage ein unterlässliches Moment revolutionärer Tätigkeit. Ohne diese agiert eine Organisation oder Gruppe blind. Die Einschätzung der Veränderung solcher Perioden und von deren Übergängen bereiten naturgemäß oft Schwierigkeiten, weil diese nur aus einer Gesamteinschätzung der Lage gewonnen werden können, deren alternative Entwicklungsmöglichkeiten durchaus offen sein mögen – nicht zuletzt, weil sie selbst im Klassenkampf und nicht am Kopf des/r Analysierenden entschieden werden. Das relativiert ihre Bedeutung und die ständige kritische Überprüfung von Prognosen und Einschätzungen jedoch nicht. Im Folgenden wollen wir zur Illustration kurz die politischen Klassenkampfperioden in dieser längeren Periode von 1914 – 1948 skizzieren.
1914 – 1916: Imperialistische Schockwelle, Phase der Defensive und Vorbereitung
Die historische Katastrophe des Ersten Weltkrieges und des Zusammenbruchs der II. Internationale eröffnete eine Periode der nationalistischen Verhetzung der ArbeiterInnenklasse und der Masse der Unterdrückten. Die sozialpatriotische, tatkräftige Hilfe der Sozialdemokratie und der bürokratischen Gewerkschaftsapparate bildeten dabei in den meisten Ländern eine wesentliche soziale Stütze, die den Einfluss nationalistischer Ideologien und der Kriegshetze in der ArbeiterInnenklasse verstärkte.
Viele Untersuchungen zeigen, dass die Kriegsbegeisterung im Proletariat, anders als bürgerliche, aber auch viele sozialdemokratische IdeologInnen verbreiten, keineswegs allgemein war, sondern ein bedeutender Teil der Klasse dem Krieg von Beginn an skeptisch bis offen ablehnend gegenüberstand. Der Verrat der Sozialdemokratie bedeutete aber gerade die Illegalisierung, Isolierung und gezielte Marginalisierung dieser Teile.
In dieser weltgeschichtlichen Lage stellte der Kampf der Bolschewiki und anderer internationalistischer Linke für einen Bruch mit der II. Internationale, einschließlich des unversöhnlichen Kampfes gegen das Versöhnlertum, eine unerlässliche Voraussetzung für die Neuformierung der ArbeiterInnenklasse.
1917 – 1919: Periode des offen revolutionären Ansturms
Diese Periode des revolutionären Ansturms wurde durch politische Ereignisse, erste internationalistische Massendemonstrationen gegen den Krieg und v. a. die Februarrevolution, eingeläutet. Gegen Ende des Krieges und danach stellte sich in einer Reihe europäischer Länder unmittelbar die Machtfrage bis hin zur Errichtung von landesweiten oder städtischen bzw. lokalen Räterepubliken und Doppelmachtorganen. Doch in Deutschland, Italien, Deutsch-Österreich, Ungarn, der Slowakei usw. wurde die Revolution geschlagen durch das Zusammenwirken von Reaktion und Sozialdemokratie. Mit den Niederlagen dieser Revolutionen wurde diese Klassenkampfperiode beendet.
1920 – 1923: Instabile Periode der Defensive und des Kampfes um die Massen
Dies war die Periode, die vor allem dadurch gekennzeichnet war, dass das revolutionäre Proletariat aus der Organisierung von Abwehrkämpfen heraus die Offensive vor dem Hintergrund einer nach wie vor turbulenten und höchst instabilen Weltlage organisieren musste.
Aber aufgrund der Niederlagen des unmittelbar revolutionären Ansturms konsolidierten sich die bürgerliche Herrschaft und die Sozialdemokratie und die Gewerkschaftsbürokratie einigermaßen.
Ökonomisch und politisch blieb diese Periode jedoch weiter äußerst instabil. Sie zeigte enorm große Zuspitzungen des Klassenkampfes in einzelnen Ländern (z. B. Kapp-Lüttwitz-Putsch, Ruhrkrise). Sie kulminierte und endete 1923 im deutschen Oktober, der einer strategischen Niederlage der WeltarbeiterInnenklasse gleichkam.
Diese Periode erforderte von den KommunistInnen, die Lehren aus dem Scheitern des ersten Ansturms zu ziehen und ihr strategisches Ziel mit dem Kampf um die Massen in Phasen der Defensive, der leicht in den um die Macht umschlagen konnte, zu verbinden. Auch wenn die kommunistische Bewegung in dieser Phase viel Lehrgeld zahlen musste, wurden entscheidende politische, taktische und programmatische Schlussfolgerungen entwickelt (Einheitsfront, Übergangsforderungen), die bis heute ihren Wert behalten haben.
1924 – 1929: Periode der relativen Stabilisierung
Die Niederlage im Oktober 1923 ging Hand in Hand mit einer politischen Kursänderung der imperialistischen Mächte, v. a. mit einer stärkeren und die Lage in Europa stabilisierenden Rolle des US-Imperialismus (Zurückdrängen des rabiaten französischen Revanchismus, Währungsreform und Stabilisierung in Deutschland durch die USA). Diese Periode der relativen Stabilisierung der bürgerlichen Herrschaft kannte auch wichtige verpasste Chancen der ArbeiterInnenbewegung (Britannien), vor allem aber die Niederlage der chinesischen Revolution und die Stärkung der Stalinbürokratie sowie das massive Voranschreiten der Degeneration der Kommunistischen Internationale nach 1924.
Diese veränderte ihren Charakter von einer revolutionären zu einer zentristischen Organisation. Diese Degeneration stellte selbst einen Faktor dar, der den Spielraum der Weltbourgeoisie vergrößerte.
1929 – 1936: Weltwirtschaftskrise, große Depression, Zuspitzung der Klassenkämpfe
Die Weltwirtschaftskrise, die verschiedene Länder ab 1929 zeitversetzt traf, führte zu massiven inneren Erschütterungen, einer Reihe von Revolutionen und Konterrevolutionen.
Verschiedene Länder (Deutschland, Frankreich, Spanien) bildeten in dieser Phase den Schlüssel zur internationalen Lage, weil die Klassenkämpfe derartig intensive Formen angenommen hatten, dass deren Ausgang wesentlich nicht nur über Revolution und Konterrevolution im Inneren entschied, sondern auch das Kräfteverhältnis zwischen den Klassen auf weltweiter Ebene prägte.
Deutschland bildete am Beginn der 1930 Jahre in mehrfacher Hinsicht das Zentrum des Klassenkampfes. Erstens warf die tiefe Krise die Alternative Faschismus oder sozialistische Revolution und damit die zentrale Frage der ArbeiterInneneinheitsfront gegen die drohende Naziherrschaft und deren Verknüpfung mit dem Kampf um die Macht auf. Während die Sozialdemokratie die Klasse an das Bündnis mit der „demokratischen“ Bourgeoisie zu binden versuchte, einschließlich der Unterstützung bonapartistischer Herrschaftsformen, erlebte die ultralinke Politik der KDP und der von Stalin geführten Komintern ihren historischen Bankrott. Sie erwies sich als unfähig, ja, als Hindernis, die sozialdemokratischen ArbeiterInnen zu gewinnen und so überhaupt die Grundlage zu schaffen, den Nationalsozialismus zu schlagen.
Mit dieser historischen Niederlage und der Weigerung, dieses Fiasko selbstkritisch überhaupt nur zu diskutieren, war auch das Schicksal der Kommunistischen Internationale als revolutionärer Kraft besiegelt.
Die Erschütterungen durch die Weltwirtschaftskrise, aber auch die Schockwirkungen des Versagens der deutschen ArbeiterInnenbewegung eröffneten vorrevolutionäre und revolutionäre Möglichkeiten in Frankreich und Spanien, die jedoch von Sozialdemokratie und Stalinismus durch die Politik der Volksfront konterrevolutionär gestoppt wurden bzw. dem Sieg der Reaktion (Franco in Spanien) den Weg bereiteten.
Die Niederlage in Spanien vollzog sich im Grunde schon 1936 und eröffnete eine neue Periode im internationalen Klassenkampf, die vom Vormarsch der Konterrevolution auf allen Ebenen geprägt war.
1936 – 1943: Vormarsch der Konterrevolution
Die Niederlage in Spanien vollzog sich im Grunde schon 1936, und sie eröffnete, wie oben gesagt, eine neue Periode im internationalen Klassenkampf, die von einem Vormarsch der Konterrevolution auf allen Ebenen geprägt war. In Deutschland festigte sich die Nazidiktatur. Doch auch viele andere Länder griffen mehr und mehr zu bonapartistischen Herrschaftsformen. Die Vorbereitungen eines neuen Weltkriegs und dessen Ausbruch prägten diese Phase.
Für die ArbeiterInnenklasse waren das denkbar ungünstige Bedingungen. Nach dem Übergang der Sozialdemokratie ins bürgerliche Lager muierte eine weitere Internationale, die Komintern, zum Instrument einer reaktionären Bürokratie und zu einem Hindernis für die Revolution. Die Politik des Kreml nahm einen offen konterrevolutionären Charakter an, der sich direkt gegen das Proletariat bzw. die kommunistische Avantgarde richtete (spanischer Bürgerkrieg, Moskauer Prozesse, Hitler-Stalin-Pakt).
1943 – 1948: Revolutionäre Periode
Mit der Wende für den deutschen Imperialismus im Russlandfeldzug nach Stalingrad, der Konferenz von Jalta, aber vor allem auch mit der Entwicklung des Partisanenkriegs in Italien, Frankreich, Griechenland, Jugoslawien zeichnete sich der abschließende offene Kampf um die Neuordnung der Welt ab.
Die innerimperialistischen Kräftefragen waren im Grunde schon zu diesem Zeitpunkt bereits gelöst. Der Gegensatz einer zukünftigen US-dominierten Weltordnung zur Sowjetunion trat mehr und mehr in den Vordergrund. Zugleich führten das kommende Kriegsende und die Nachkriegsperiode zu Doppelmachtsituationen in halb Europa. Die ehemaligen Kolonialmächte standen außerdem Aufstands- oder jedenfalls Massenbewegungen der Kolonialbevölkerungen gegenüber. Die Frage des Kampfes um die Macht stand insbesondere in Europa auf der Tagesordnung, und zwar in Gestalt des Ringens zwischen proletarischer Revolution und bürgerlicher Konterrevolution (wenn auch oft in „demokratischer“ Form, mitunter aber auch äußerst blutig, z. B. Griechenland).
Das waren die zentralen Voraussetzungen, damit andere ökonomische und politische Resultate des Zweiten Weltkriegs wirken konnten: die massive Vernichtung überschüssigen Kapitals, die Revolutionierung der Technik der US-Wirtschaft, die Ausdehnung der Konsumgüterindustrie in den USA, die damit verbundene Erhöhung der „Produktionsweise“ des relativen Mehrwerts und die Integration der ArbeiterInnenschaft als KonsumentInnen, die Etablierung einer globalen, vom US-Imperialismus bestimmten und garantierten globalen Finanz- und Wirtschaftsordnung, u. a. in Form der Gründung von IWF und Weltbank (Bretton Woods), der Zusammenbruch des Kolonialsystems (auch wenn die Entkolonialisierung noch mehr als ein Jahrzehnt brauchte und blutiger und heroischer Befreiungskämpfe bedurfte) und damit die Durchsetzung der US-Hegemonie (Open Door Policy).
Die Niederlagen der ArbeiterInnenklasse in Frankreich, Italien, Griechenland, kurzum die konterrevolutionäre Befriedung wären unmöglich gewesen ohne die Kollaboration von Sozialdemokratie, Stalinismus und Gewerkschaftsbürokratie.
Schon im Zweiten Weltkrieg und im Aufbau der Nachkriegsordnung wurden die britischen und US-amerikanischen Gewerkschaften, die Labour Party und die schwedische ArbeiterInnenbewegung als zuverlässige, antikommunistische Bollwerke aufgebaut. Diese unterstützten tatkräftig die Rekonstruktion der reformistischen Parteien und der Gewerkschaften in der westlichen Einflusssphäre im Sinne des Imperialismus. Nicht minder wichtig war die Kooperation des Stalinismus mit seiner Politik der „friedlichen Koexistenz“, die zwar einerseits als Gegnerin der US-geführten imperialistischen Welt im Kalten Krieg auftrat, zugleich aber unverzichtbare, konterrevolutionäre Garantin der Nachkriegsordnung war.
Die Degeneration der Vierten Internationale 1948 und ihr organisatorischer Zerfall 1953 waren ein wichtiges, wenn auch keineswegs unvermeidliches Resultat der historischen Niederlagen der ArbeiterInnenklasse in der Nachkriegsperiode und der darauf aufbauenden konterrevolutionären Stabilisierung. Die Vierte Internationale war trotz ihrer geringen Größe – ähnlich wie die InternationalistInnen am Beginn des Ersten Weltkriegs – ein gewichtiger Faktor der Weltpolitik. Die Tatsache, dass sie zu keinem Generalstab der Weltrevolution wurde, ihre Degeneration und ihr Zerfall und der damit verbundene Abbruch der revolutionären Kontinuität, das Fehlen einer revolutionären Internationale seit Jahrzehnten verkörpern ebenfalls einen wesentlichen Faktor der Weltpolitik und Weltordnung, der die kommenden Perioden mit charakterisierte.
Allein die Tatsache, dass die verschiedenen Reste der Vierten Internationale, dass der Trotzkismus nach 1948 bei allen wichtigen Wendepunkten des Klassenkampfes versagt hatte, verdeutlicht, dass die Vierte Internationale für die Revolution gestorben ist, dass der Aufbau einer neuen, revolutionären Fünften Internationale die drängende Aufgabe unserer Zeit schlechthin bedeutet. Ein wesentlicher Grund für dieses Versagen bestand darin, dass die Vierte Internationale nach dem Zweiten Weltkrieg nicht in der Lage war, eine veränderte Weltlage konkret zu analysieren, die relative Stabilisierung des Weltkapitalismus spätestens nach 1948 lange bestritt. Dies führte tragisch-ironisch mit dazu, dass zugleich zentrale revolutionäre Momente des programmatischen Verständnisses der Vierten revidiert wurden (Stalinismus, Bedeutung der revolutionären Partei).[cvi]
13.3 1948 – 1968: Periode des Langen Booms und der unumstrittenen US-Vorherrschaft
Die USA waren die eindeutige Hegemonin, die den Dollar als Weltgeld durchgesetzt hat. Mit dem Abkommen von Bretton Woods war ein System fester Wechselkurse gegenüber dem Dollar, seine Goldanbindung und ein Mechanismus des Gegensteuerns gegen Währungsungleichgewichte (IWF = Internationaler Währungsfonds) geschaffen. Die Struktur der Kapitalströme im Nachkriegsboom kennzeichnete ein großer Anstieg von Kapitalexporten zwischen den imperialistischen Zentren USA, Deutschland und Japan, die gleichzeitig ökonomische Netze von Landesgesellschaften in den Halbkolonien aufbauten.
Die wichtigsten Voraussetzungen für mehrere Zyklen erweiterter Reproduktion des Kapitals in allen imperialistischen Zentren waren folgende:
- Die massive Vernichtung fixen Kapitals in Europa und Japan im und auch nach dem Zweiten Weltkrieg sowie die Erneuerung des Kapitalstocks.
- Die Öffnung der britischen und französischen Kolonien für den Weltmarkt des Kapitals.
- Die Etablierung einer auf die fast absolute Hegemonie des US-Imperialismus gestützten internationalen Finanzordnung
- – Damit verbunden die Herstellung zentraler Felder für den Export des US-Kapitals nach 1945 und somit die Überwindung seiner eigenen inneren Expansionsschranken.
- Die hohen Profitraten im industriellen Sektor und die damit verbundene Expansionsdynamik.
- Die dramatische Erhöhung der Ausbeutungsrate der ArbeiterInnenklasse in allen imperialistischen Staaten während des Zweiten Weltkrieges und weitere Entwertung der Einkommen der Lohnabhängigen durch die Währungsreformen nach 1945.
- Die größere Bedeutung der Arbeitsmigration (v. a. halbkoloniale Arbeitsmärkte, aber in Deutschland auch Vertriebene) nach 1945 und ein damit verbundener „Neustart“ der Akkumulation in Japan und Westeuropa unter Einschluss von Arbeitskräften, deren Preis weit gedrückt wurde oder deren Herstellung das eigene Kapital nichts gekostet hat (und damit verbunden Senkung des Durchschnittswerts der Ware Arbeitskraft).
- Weitaus stärkere Einbeziehung von Frauen in die Lohnarbeit, was umgekehrt auch eine Veränderung der privaten Hausarbeit erforderte.
- Die Vernichtung von Kapital und die relativ billige Arbeitskraft nach 1945 gingen einher mit einer massiven, über mehrere Zyklen laufenden Ausdehnung der Produktion.
- Ein wesentlicher Aspekt der Ausdehnung der Produktion bildete die Ausdehnung des Konsumgütersektors, die stetige Steigerung der Produktivität der zu ihrer Herstellung verwandten Arbeitskraft und damit die Kombination von erweiterter Reproduktion des Kapitals, steigenden Profitmassen, Erweiterung der Nachfrage nach Arbeitskraft sowie Aneignung von Mehrwert, v. a. durch relative Mehrwertproduktion.
Auf der Grundlage der zyklenübergreifenden erweiterten Reproduktion des Kapitals haben die USA und ihre Verbündeten eine ganze Reihe globaler Institutionen geschaffen, die diese Ordnung zugleich absichern: Bretton Woods und Goldstandard; Dollar als Weltgeld; internationaler Währungsfonds und Weltbank; die UNO als Institution, die alle imperialistischen Staaten und alle degenerierten ArbeiterInnenstaaten umfasst. Hinzu kamen die imperialistischen Allianzen wie die NATO, die Gründung der EG usw. Zum Teil existieren diese Institutionen, wenn auch mit großen Veränderungen bis hin zu veränderten Zielsetzungen (z. B. EG – EU), bis heute.
All das erlaubte eine ganze Periode mehrerer expansiver industrieller Zyklen, eine Akkumulationsperiode der erweiterten Reproduktion. Die Produktivkraft der Arbeit wuchs über mehrere Zyklen.
Die USA fungierten in dieser Periode faktisch als Demiurgin des Weltmarktes. Sie stellten nicht nur das Weltgeld (Dollar), der US-Konjunkturzyklus bestimmte nach dem Zweiten Weltkrieg auch den Weltmarktzyklus, der faktisch parallel zur US-Konjunktur verlief.
„Innerhalb des Welthandels dominieren die USA nach dem 2. Weltkrieg absolut. Gemessen an den Weltexporten bestritten sie in den 1950er Jahren eine Quote von rund 20 %. Dies war doppelt so viel wie die der nächstfolgenden Nation Großbritannien, die trotz der fortbestehenden Begünstigung durch Handelsschranken nur auf 10 % kam. Wiederum die Hälfte des britischen Anteils konnte Frankreich in diesem Zeitraum auf sich vereinigen (5 %), sodass die westlichen Siegermetropolen des 2. Weltkriegs in dem dem Krieg folgenden Jahrzehnt mehr als ein Drittel der Weltexporte bestreiten. ( … )
Diese ausgeprägte Ungleichheit der Welthandelsanteile zwischen den führenden kapitalistischen Weltmarktmetropolen, wie sie sich als Ergebnis langfristiger ökonomischer Entwicklungstendenzen sowie politischer Konstellationen im Anschluss an den 2. Weltkrieg ergab, verschaffte dem zyklischen Verlauf der Kapitalakkumulation in den USA zunächst den prägenden Einfluss auf die Konjunkturen des Weltmarkts. Obwohl das US-Nationalkapital aufgrund seines großen Binnenmarkts nur eine vergleichsweise niedrige Außenhandelsverflechtung ausweist, war die prägende Kraft des USA-Zyklus für die Konjunkturen des Welthandels und in weiterer Instanz für die nationalen industriellen Zyklen der nachgeordneten kapitalistischen Metropolen evident.“ [cvii]
Die 20 % müssen ins Verhältnis zum Gewicht der US-Ökonomie nach dem Zweiten Weltkrieg in der Weltwirtschaft gestellt werden. Rund 40 % der Industrieproduktion entfielen auf die USA, ihr Markt stellte den mit Abstand größten und bedeutendsten Binnenmarkt dar. Sie verfügten im eigenen Land und in Venezuela über Zugang zu relativ günstigem Öl als dem entscheidenden Energieträger, die US-Landwirtschaft erzeugte Überschüsse. Europa und die Öffnung des Weltmarktes erlaubten dem US-Kapital zu expandieren, faktisch als Monopolist hinsichtlich von Industriewaren- und Kapitalexport zu fungieren und sich gleichzeitig auf die den Weltmarkt prägende Binnenökonomie zu stützen.
Es sind also Sonderbedingungen, die nach dem Zweiten Weltkrieg, nach erfolgter Neuaufteilung der Welt und der faktisch absoluten Hegemonie der USA gegenüber ihren imperialistischen RivalInnen durchgesetzt wurden, die die Grundlage für den außergewöhnlichen Charakter der Nachkriegsperiode bildeten und deren Sonderstellung für die gesamte imperialistische Epoche erklären.
Bestimmte Aspekte der Epoche traten jedoch sogar stärker hervor. Zugleich etablierte das Finanzkapital mit der halbkolonialen Neuordnung der Welt die dem Kapitalismus eigentlich entsprechende Form der Unterordnung und Abhängigkeit der von den imperialistischen Mächten beherrschten Teile der Welt.
Die Vorherrschaft des Finanzkapitals festigte sich noch mehr durch die enge Bindung zwischen Banken, Industriekapital und staatlicher Politik. In jenen imperialistischen Ländern, wo die großen Monopole der vorherigen Periode z. T. zerschlagen wurden (z. B. IG Farben in Deutschland) etablierten sich rasch neue Großkonzerne, die in Summe eine nicht minder marktbeherrschende Stellung im globalen Rahmen einnahmen (Bayer, Höchst, BASF). Gerade im Agrar- und Konsumgütersektor erreichte die Tendenz zur Monopolisierung oder eine oligarchische Aufteilung der Märkte einen Umfang, der vor dem Zweiten Weltkrieg nicht oder nur ausnahmsweise bekannt war. Dies reflektiert nicht nur die Zentralisations- und Konzentrationstendenzen in den Metropolen, sondern vor allem auch die Erweiterung der Operationen dieser Kapitale in den halbkolonialen Ländern und die Umwälzung der landwirtschaftlichen Produktion nach 1945 überhaupt.
Zweitens wurden die kolonialen und die halbkolonialen Länder stärker als vor 1945 qualitativ stärker in den kapitalistischen Weltmarkt integriert. Die kolonialen Befreiungsbewegungen und der Übergang der Länder Asiens und Afrikas von einer kolonialen zur indirekten, halbkolonialen Herrschaftsform und Einbindung in den Weltmarkt spiegelten einerseits den Druck demokratischer und revolutionärer Bewegungen wider. Andererseits brach auf diese Weise nicht nur der privilegierte Zugang der alten Kolonialmächte zu diesen Märkten auf. Die staatliche, formale Unabhängigkeit entsprach auch der Verbreiterung des kapitalistischen Verhältnisses in den Ländern, was zu ihrer auf den Weltmarkt bezogener Teilindustrialisierung und zu einem Wachstum des Proletariats führte, aber auch zur Umwälzung der Verhältnisse auf dem Land und der prekären Einbindung der Agrarproduktion in den Weltmarkt. Die sog. Grüne Revolution in Indien illustriert diese Veränderung, indem sie Millionen und Abermillionen von Bauern abhängig machte von Saatgut und Pestiziden, die von wenigen Agrarkonzernen der imperialistischen Zentren monopolisiert werden. Die für Halbkolonien typische Form der Weltmarktabhängigkeit bedeutete auch, dass die formale Unabhängigkeit der Länder mit einer Verstärkung der Abhängigkeit vom Weltmarkt einherging. An die Stelle formeller Fremdbestimmung trat auch in diesen Ländern die stumme Macht der Verhältnisse, die im Zweifelsfall durch direkte Interventionen abgesichert wurde und wird.
Drittens war die Periode auch von einer Ausdehnung der degenerierten ArbeiterInnenstaaten nach 1948 geprägt (China, Osteuropa, Nordkorea, Kuba, Vietnam). Der polare Gegensatz von USA und UdSSR kennzeichnete die Weltpolitik, der aufgrund der Politik der stalinistischen Bürokratie selbst eine stabilisierende Funktion für die Gesamtperiode mit sich brachte – ja, ohne deren Politik wäre die relative Stabilität der Weltordnung unmöglich gewesen.
Die stalinistische Bürokratie unterdrückte nicht nur die ArbeiterInnenklasse in den von ihr beherrschten Staaten, sie stellte zugleich ein Haupthindernis für die Revolutionierung der antikolonialen Befreiungsbewegungen und des Proletariats dar. Sie offenbarte hier deutlich ihren Charakter als Agentur des Weltimperialismus.
Die erweiterte Reproduktion in den kapitalistischen Ländern ging auch mit einer Ausdehnung der industriellen und produktiven Basis in den degenerierten ArbeiterInnenstaaten, v. a. der UdSSR und Osteuropas auf Basis der Erneuerung der Industrie infolge der Zerstörungen des Krieges, einher. Dies führte mit zu einer Stabilisierung der bürokratischen Herrschaft nach 1953 – 1956, aber auch zu einer Festigung des globalen Status quo.
Die Zunahme von degenerierten Arbeiterstaaten nach 1948 verdeutlicht den Übergangscharakter der imperialistischen Epoche, aber auch, dass diese selbst in das imperialistische Weltsystem zeitweilig integriert werden können und die Politik der Bürokratie zu deren Stabilität funktional beiträgt.
Schließlich erlaubten die Expansion des Kapitalismus und die geopolitische Frontstellung zwischen dem US-Imperialismus und der Sowjetunion den halbkolonialen Ländern auch einen gewissen Spielraum. Die UdSSR versuchte, verbündete Staaten wie Kuba nach der Revolution zu stützen. Eine Reihe linksnationalistischer Regime verfolgte eine staatskapitalistische oder eine, jedenfalls über bedeutende staatliche Interventionen vermittelte, Strategie zur industriellen Entwicklung, was jedoch letztlich scheiterte. Interessanterweise konnten ähnliche Phänomene auch bei Ländern beobachtet werden, die von den USA gestützt wurden (z. B. Türkei, Israel, Südkorea, Taiwan), die zeitweilig günstige Bedingungen zur Kapitalakkumulation eingeräumt erhielten, weil sie als wichtige geostrategische Verbündete gegen „Kommunismus“ und Befreiungsbewegungen fungierten.
Damit wären wir bei einem weiteren zentralen Charakteristikum der Periode des Langen Booms und der uneingeschränkten US-Hegemonie unter den imperialistischen Staaten angekommen: die qualitativ stärkere Einbindung der ArbeiterInnenaristokratie und der ArbeiterInnenbürokratie in die bürgerliche Gesellschaftsordnung. Die Gewerkschaften und die bürgerlichen ArbeiterInnenparteien wuchsen nicht nur zu bislang unüblichen und ungeahnten Größen, sie wurden auch in die Formen staatlicher Herrschaft und die Regulation des Kapitalverhältnisses eingebunden. Die bürgerliche Herrschaft wurde in diese Organisationen verlängert. Die Gewerkschaftsbürokratie, die Führungen und der Apparat der Sozialdemokratie oder der Labourparteien agierten als politische Polizei in der ArbeiterInnenklasse.
Die Expansion des Kapitalismus führte in den 1960er Jahren zu einer massiven Ausdehnung der privilegierten Schichten des Proletariats in den imperialistischen Ländern, wobei auch in den Halbkolonien und in den degenerierten ArbeiterInnenstaaten solche Phänomen, wenn auch in geringerem Maße und auf einer schwächeren ökonomischen Grundlage, beobachtbar waren. Die Akkumulationsdynamik zog aber auch für einige Zeit die mittleren und selbst unteren Schichten der Klasse in ihren Bann, da die Masse der Gebrauchswerte zunahm, die die ArbeiterInnenklasse konsumieren konnte. Diese reale Ausdehnung der Konsummöglichkeiten und eine partielle Öffnung von Bildungschancen (aufgrund der Nachfrage nach qualifizierter Arbeitskraft) untermauerten das soziale Aufstiegsversprechen des Langen Booms. Schließlich schuf dieser auch die Basis für eine viel tiefere Durchdringung der ArbeiterInnenklasse mit bürgerlicher Ideologie und „Massen“kultur.
All das darf keineswegs zur falschen Einschätzung führen, dass diese geschichtliche Periode frei von massiven Klassenkämpfen und Krisen gewesen wäre. An dieser Stelle verweisen wir nur auf den Koreakrieg, antikoloniale Befreiungsbewegungen wie z. B. in Algerien, (StellvertreterInnen-)Kriege, Vertreibung der PalästinenserInnen, Aufstände und Revolutionen in der DDR, in Polen und Ungarn, die bolivianische und die kubanische Revolution, um zu verdeutlichen, dass auch diese Abschnitte reich an Kämpfen waren. Aber die expansive Dynamik der Kapitalakkumulation, die Vorherrschaft der USA und die konterrevolutionären Rolle von Stalinismus und Sozialdemokratie bildeten die Grundlage für eine längere Periode relativ stabiler Herrschaft in den imperialistischen Zentren, die auch Erschütterungen in anderen Regionen vergleichsweise unbeschadet überstand.
Das Fehlen einer revolutionären Alternative zum bürgerlichen und kleinbürgerlichen Nationalismus, zu Stalinismus und Sozialdemokratie, also zu den vorherrschenden Kräften in der ArbeiterInnenklasse und unter den Unterdrückten in dieser Periode, verstärkte diese Dynamik.
13.4 1968 – 1989: Periode des Niedergangs der Nachkriegsordnung
Das Ende des Langen Booms kündigte sich bereits mit dem Niedergang der Profitraten, dem Erlahmen der Akkumulationsdynamik an. Auch wenn der Akkumulationszyklus nach dem Zweiten Weltkrieg, streng genommen, bis Anfang der 1970er Jahre, bis zur Krise 1973/74 dauerte, so begann die neue geschichtliche Periode schon 1968. Gleichwohl müssen wir uns kurz mit der ökonomischen Entwicklung beschäftigten, die ihr zugrunde lag.
Die Profitraten in den imperialistischen Staaten entwickelten sich dabei schon vor der Krise ungleichmäßig. Im Folgenden stützen wir uns auf Berechnungen von Stefan Krüger.[cviii] Auch wenn die Zahlen verschiedener marxistischer AutorInnen im Einzelnen abweichen, so geben sie wieder, was für uns an dieser Stelle entscheidend ist: nämlich die gleiche Entwicklungslinie. Die Profitrate von US-Kapitalgesellschaften lag nach dem Krieg (bis 1954) auf ihrem höchsten Niveau (12 %), sank in den 1950er Jahren, um sich in den 1960er Jahren bis in die 1980er Jahre auf einem niedrigen Niveau von 6 bzw. 5 % einzupendeln. Die Profitrate des westdeutschen und japanischen Kapitals lag seit den 1950er Jahren deutlich höher als jene des US-Kapitals. Anfang der 1950er Jahre lag die des BRD-Kapitals bei über 25 % und sank in den folgenden Zyklen stetig, fiel aber langsamer als jene der USA, um sich in den 1970er Jahren bei unter 10 % einzupendeln. Die Kurve der Profitratenentwickelung des japanischen Gesamtkapitals zeigte eine wichtige Besonderheit. Sie erreichte in den 1960er Jahren mit rund 35 % ihren Höhepunkt, fiel in den siebziger Jahren deutlich ab und erreichte 10 – 15 % für die späten 1970er und 1980er Jahre.[cix]
Uns geht es an dieser Stelle nicht um eine Diskussion der Profitraten in einzelnen Ländern, wohl aber um einen internationalen Trend. Die Entwicklung des deutschen und japanischen Kapitals (Profitraten, Wachstumsraten ihrer Nationalökonomien, Weltmarktanteile) reflektieren das wachsende Gewicht der beiden wichtigsten und ökonomisch dynamischsten Rivalen der USA. Sie entwickelten sich für die USA zu Herausforderern ihrer ökonomischen Vorherrschaft, die Ende der 1960er Jahre ihren absoluten Charakter eingebüßt hatte. Auch der Weltmarktzyklus wurde nun nicht mehr bloß von einer Nation bestimmt, vielmehr gingen v. a. die Bewegungen des japanischen und westdeutschen Kapitals in diese ein. Beide konnten, was den Anteil am Welthandel betrifft, zu den USA in den 1970er und 1980er Jahren aufschließen oder diese gar überholen. Dass sich die USA gezwungen sahen, den Goldstandard aufzugeben, brachte die Verschiebung der Weltwirtschaft schlagend zum Ausdruck.
Zweitens verweisen die niedergehenden Profitraten in imperialistischen Weltökonomien wie auch eine Untersuchung für Frankreich, Britannien, Italien und Kanada darauf, dass die Weltwirtschaft insgesamt in eine lang andauernde strukturelle Überakkumulationsperiode des Kapitals geriet. Diese prägt die Weltwirtschaft bis heute entscheidend, auch wenn die verschiedenen Entwicklungsphasen seit den 1970er Jahren immer von bestimmten ökonomischen und geopolitischen Konstellationen geprägt sind, die dieses Problem überwinden oder zumindest kompensieren sollen.
Insofern markierte 1968 den einschneidenden, eigentlichen Periodenwechsel hinsichtlich der politisch-ökonomischen Gesamtentwicklung. Die Krisentendenzen des globalen Systems äußerten sich in der wachsenden, globalen Protest- und Widerstandsbewegung gegen den US-Imperialismus wie auch im „Prager Frühling“. Den entscheidenden Wendepunkt markierte jedoch der Mai 1968 in Frankreich und damit die Entwicklung einer revolutionären Situation in einem imperialistischen Kernland.
1968 – 1974/75: Revolutionäre Klassenkampfperiode
Anders als die Klassenkämpfe während des Langen Booms trug die Entwicklung nach 1968 einen globalen Charakter, die in allen wichtigen Regionen der Welt zu einem massiven Anwachsen von Klassenkämpfen bis hin zu revolutionären Erschütterungen und Krisen führte: revolutionäre Situationen in Frankreich und Italien 1968 und 1969, die Radikalisierung in den USA, das allgemeine abrupte Anwachsen der radikalen Linken wie der ArbeiterInnenbewegung weltweit, die bolivianische und chilenische Revolution, die Nelkenrevolution in Portugal, der Prager Frühling.
Bei aller Unterschiedlichkeit war den Kämpfen gemeinsam, dass sie die Aktualität der Revolution auf die Tagesordnung setzten – bis hin zur Entwicklung von Doppelmachtorganen, die die Machtfrage praktisch aufwarfen.
1968 bis 1974/75 stellte eine revolutionäre Klassenkampfperiode im Weltmaßstab dar. Die Tiefe der Führungskrise des Proletariats zeigte sich freilich auch darin, dass weit über die einzelnen Länder hinausgehende Niederlagen den Sieg der Konterrevolution markierten – sei es auf extrem blutige, diktatorische Art wie z. B. in Chile 1973 oder durch die konterrevolutionären Befriedung wie in der portugiesischen Revolution 1974/75, deren Niederlage auch den Endpunkt dieser Klassenkampfperiode darstellte.
1975 – 1979: Die sozialdemokratische Befriedungsperiode
Die Niederlage des US-Imperialismus in Vietnam, der Aufstieg europäischer und japanischer Rivalen und die Unfähigkeit der imperialistischen Bourgeoisie, einerseits die ArbeiterInnenklasse in der ersten großen Nachkriegskrise „direkt“ zu schlagen sowie die Unreife und politische Schwäche der subjektiv revolutionären StudentInnen und ArbeiterInnen andererseits riefen die Sozialdemokratie als eine zentrale Agentur zur Rettung und Stabilisierung auf den Plan. Sie versuchte dabei auch, auf Reserven zur Befriedung und sozialpolitischen Abfederung der Krise zurückgreifen. Ihre ökonomische Hauptmethode bildete der Keynesianismus und die damit einhergehende enorme Ausweitung der Staatsschulden.
Schon Anfang der 1970er Jahre war die Goldbindung des Dollars längst Fiktion, ebenso das System fester Wechselkurse. Mit dem Zusammenbruch von Bretton Woods verlor die US-Zentralbank die Kontrolle über einen Teil der weltweiten Dollarguthaben. Durch das Entstehen der großen Offshore-Dollarguthaben („Petrodollars“ genannt, da ihre Quelle oft in ölexportierenden Ländern lag) in den 1970ern wurde mit dem Ende des Nachkriegsbooms eine neue Periode der Kreditvergabe in großem Stil an lateinamerikanische und asiatische Staaten eingeleitet. Diesmal waren es vor allem Geschäftsbanken in den imperialistischen Zentren, sofern sie über diese Dollarreserven verfügten, die diese Verschuldungswelle in Gang hielten.
Das Problem der sozialdemokratischen Politik war letztlich, dass sie keine Hauptklasse der Gesellschaft befriedigen konnte. Die Einkommen der ArbeiterInnenklasse erodierten schon aufgrund der Inflation und der geforderten „Zurückhaltung“ angesichts der krisenhaften Entwicklung. Zugleich war die ArbeiterInnenbewegung oft noch zu stark, um eine bürgerliche Krisenpolitik einfach zu schlucken. Konnte und wollte die Sozialdemokratie schon den Lohnabhängigen nicht geben, was diese erwarteten, so konnte ihre Politik der Vermittlung zwischen den Klassen erst recht nicht das Kapital zufriedenstellen.
1979 – 1989: Periode der neoliberalen Offensive
Die Bildung der Regierung Thatcher 1979 und ihr offensives, neoliberales Kampfprogramm markierten den Bruch mit der sozialdemokratischen Politik und bildeten den politischen Einschnitt in dieser geschichtlichen Periode. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten die neoliberalen IdeologInnen ihre Strategie nur in Halbkolonien, am blutigsten in Chile, umgesetzt. Der Thatcherismus präsentierte einen strategischen Angriff auf allen Fronten, einen regelrechten Krieg gegen die ArbeiterInnenklasse und ihre Avantgarde, die BergarbeiterInnen. Auf dem Weg dazu brach Thatcher aus gutem Grund den Malwinenkrieg vom Zaun, um damit ihre unangefochtene Führung im bürgerlichen Lager zu festigen, KleinbürgerInnentum und rückständige ArbeiterInnen an den Nationalismus zu binden. Gleichzeitig offenbarte sie auch die sozialpatriotische Ohnmacht der Labour-Führungen, die den reaktionären Krieg unterstützten und damit Thatcher in die Hände spielten. Die Niederlage der BergarbeiterInnen nach einem rund einjährigen Streik stellte eine historische Niederlage für die britische ArbeiterInnenklasse dar, die auch international nachhaltige, demoralisierende Auswirkungen hatte.
Der Reaganismus folgte auf dem Fuß. Er markierte nicht nur eine klare strategische Neuausrichtung des US-Imperialismus hin zu einem aggressiven Kurs gegenüber der UdSSR, sondern auch zur Reetablierung verlorengegangener US-Hegemonie und Dominanz. Ökonomisch gesehen hatten sich die keynesianischen Maßnahmen erschöpft. Ähnlich wie Thatcher in Britannien führte auch Reagan einen regelrechten Klassenkrieg gegen wichtige Sektoren der US-ArbeiterInnenklasse. So hatte z. B. die Niederlage des Fluglotsenstreiks eine weit über diesen Bereich hinausgehende Bedeutung.
Die veränderte US-Zinspolitik trug maßgeblich zur Ausbreitung der massiven Schuldenkrisen Anfang der 1980er Jahre bei, die durchaus auch als Kampfmittel, v. a. des US-Finanzkapitals, genutzt wurde. Das Resultat ist bekannt: Die Interessen der betroffenen Gläubigerstaaten wurden kombiniert durch den IWF vertreten und führten mindestens ein Jahrzehnt zu einem harten „Entschuldungsregime“ in Lateinamerika und Asien. Als Konsequenz des Endes von Bretton Woods und der Verschuldungskrise müssen halbkoloniale Länder nun einerseits große Währungsreserven in Dollar oder anderen harten Währungen (Yen; DM, später Euro) halten, andererseits restriktive Haushaltspolitik betreiben, um nicht zu Opfern massiver Spekulationswellen gegen ihre Währung oder ihren Anleihemarkt zu geraten.
Insgesamt markierten Thatcherismus und Reaganismus eine globale Offensive des US-Imperialismus gegen:
- die eigene ArbeiterInnenklasse. Ähnliche Angriffe wurden in anderen imperialistischen Ländern gefahren, wenn auch nicht in vielen und nicht mit demselben durchschlagenden Erfolg wie in Britannien. So blieb Kohls „geistig-moralische Wende“ in Ansätzen stecken;
- die halbkoloniale Welt durch die Politik der strukturellen Anpassungsprogramme und die Benutzung der Schulden und der Finanzpolitik als Instrumente, diese für imperialistisches, anlagesuchendes, überschüssiges Kapital zu öffnen;
- die degenerierten ArbeiterInnenstaaten durch die Hochrüstungspolitik der 1980er Jahre und zugleich die Schuldenfalle, in die v. a. die osteuropäischen Länder in den 1970er Jahren getappt sind;
- und schließlich einen erfolgreichen Versuch, die wichtigsten, auf den Plan getretenen imperialistischen Rivalen Japan und BRD dazu zu zwingen, einen Teil der Rettungskosten für die US-Ökonomie zu übernehmen (Volcker-Schock).
Der Reaganismus und der Thatcherismus stießen in den 1980er Jahren auf den Widerstand großer und starker Massenbewegungen, einschließlich des einjährigen Streiks der britischen BergarbeiterInnen, der Bewegung gegen die NATO-Nachrüstung, des Widerstands von Sandinismus und Bürgerkrieg in Nicaragua, der Kämpfe der brasilianischen und südafrikanischen ArbeiterInnenklasse, die zu militanten, klassenkämpferischen gewerkschaftlichen Bewegungen und zur Formierung einer zentristischen Massenpartei im Falle der PT führten.
Generell endete diese Periode der imperialistischen Offensive trotz heroischer Abwehrkämpfe mit einer Reihe wichtiger Niederlagen der ArbeiterInnen und einer Verschiebung des Kräfteverhältnisses zugunsten der imperialistischen Bourgeoisien. Die neoliberalen Reformen, die in den 1990er Jahren verallgemeinert wurden, bedeuteten für die Massen, insbesondere in Lateinamerika, ein „verlorenes Jahrzehnt“.
Vor allem aber erschütterte der Rüstungswettlauf die UdSSR und Osteuropa nachhaltig, da sie die seit den 1970er Jahren immer stärker hervortretende wirtschaftliche Stagnation weiter verschärften. Die stalinistische Bürokratie versuchte, auf die Offensive der USA mit einer Mischung aus „offensiver Friedenspolitik“ (Gorbatschows „Unser Haus Europa“), marktwirtschaftlichen Reformen (Perestroika) und begrenzter politischer Öffnung unter bürokratischer Kontrolle (Glasnost) zu antworten. Diese schlug fehl, ja, verschärfte die innere Krise der stalinistischen Staaten und führte zur zunehmenden Fragmentierung der Bürokratien selbst. Die Todeskrise des Stalinismus und damit der politischen Nachkriegsordnung war eingeläutet.
13.5 1989 – 2008: Globalisierungsperiode unter US-Hegemonie
Die Periode nach 1989 stellt in vieler Hinsicht eine Verallgemeinerung der neoliberalen Agenda dar. Doch sie bildet nicht einfach deren Fortsetzung, weil die Erfolge von Reagan und Thatcher auch die gesamte imperialistische Nachkriegsordnung erschütterten, als sie zur Todeskrise des weltpolitischen und geostrategischen Konkurrenten (der UdSSR und ihres Lagers) führten und, nach der Phase des Umbruchs 1989 – 1991, eine qualitativ andere Weltlage entstehen ließen.
1989 – 1991: Todeskrise des Stalinismus
Die Globalisierungsperiode begann mit einer kurzen, weltgeschichtlich revolutionären Klassenkampfperiode, die sich von 1989 bis spätestens 1991, dem Sturz Gorbatschows und der Etablierung eines bürgerlich restaurativen Staates in Russland erstreckte.
Aufgrund der Führungskrise der ArbeiterInnenklasse, der Passivität und ideologischen Schwäche wie auch akkumulierten Niederlagen des Proletariats im Westen dauerte diese jedoch nur sehr kurz an. Als die großen Siegerinnen dieser Periode gingen die imperialistischen Mächte, allen voran die USA und zu einem bedeutenden, wenn auch geringeren Teil, Deutschland hervor. Sie schaffte die politischen, klassenmäßigen Vorbedingungen für die Reetablierung der US-Hegemonie in einem noch in den 1980er Jahren für unmöglich gehaltenen Ausmaß.
Der deutsche Imperialismus ging als Sieger aus der ersten, kurzen Klassenkampfperiode der Globalisierung hervor a) wegen der Inkorporation eines ganzen Staates (der DDR) in ein Land, dessen Wiedervereinigung die Gestalt einer Ausweitung des Systems der BRD annahm, b) wegen des Abstreifens zentraler Einschränkungen der Handlungsfähigkeit des deutschen Imperialismus nach dem Zweiten Weltkrieg, c) wegen der Verschiebung des ökonomischen Kräfteverhältnisses zugunsten Deutschlands in Europa.
1992 – 1998: Blüte der Globalisierung, demokratisch-konterrevolutionäre Periode
Als unbestrittener Sieger des Kalten Kriegs und der Restauration des Kapitalismus versuchte der US-Imperialismus, sowohl die ökonomischen als auch politischen Früchte des Sieges zu ernten und dauerhaft zu nutzen. Die Niederlagen der ArbeiterInnenklassen in den USA und Britannien in den 1980er Jahren und die Restauration des Kapitalismus haben Anfang der 1990er Jahre die Kapitalistenklasse in die Offensive gebracht.
Gestützt auf eine Verschiebung des Kräfteverhältnisses zugunsten der herrschenden Klasse aufgrund realer materieller Erfolge sowie einer beginnenden Restrukturierung des Kapitals erleben wir seit Beginn der 1990er Jahre eine neue Entwicklungsphase der imperialistischen Epoche, welche gemeinhin „Globalisierung“ genannt wird.
In den 1970er Jahren hatten die imperialistischen Länder versucht, des Problems der Überakkumulation durch keynesianische Wirtschaftspolitik Herr zu werden. Ende der 1970er, Anfang der 1980er Jahre war dieses Mittel erschöpft. Statt einer Lösung kam es zu einer krisenhaften Zuspitzung in Form des weltweiten Schuldenproblems. Daher änderte sich auch die politische Strategie in allen großen kapitalistischen Ländern, wobei die USA unter Reagan und Britannien unter Thatcher eine Vorreiterrolle spielten.
Durch den Zusammenbruch des Stalinismus, den Sieg der USA und ihrer Verbündeten im Kalten Krieg erhielten diese Strategien auf dem Feld der internationalen Beziehungen einen enormen zusätzlichen Schub.
Was waren die entscheidenden Entwicklungen?
Erstens wurden Schranken des internationalen Handels, vor allem des Kapitalverkehrs seit den 1980er Jahren und besonders zu Beginn der 1990er in rasender Geschwindigkeit außer Kraft gesetzt. Auch wenn diese Internationalisierung notwendigerweise selektiv vor sich ging, auf die imperialistischen Länder und einige Halbkolonien konzentriert war, so hatte diese Ausdehnung des Welthandels insgesamt eine stützende Funktion für die kapitalistische Weltwirtschaft.
Wichtiger als diese waren und sind jedoch die Ausdehnung von Direktinvestitionen und der Spekulation.
Diese stellen selbst einen Ausdruck verschärfter Konkurrenz unter den großen Nationalökonomien und stärkerer Dominanz des Banken- und Fondskapitals über das industrielle dar. Schließlich spekulieren die großen Banken und Konzerne nicht, weil sie die Spekulation an sich der Profitmacherei in der Produktion vorzögen. Vielmehr ergibt sich die „Flucht“ in Aktienmärkte, Währungsspekulation, Termingeschäfte usw. selbst aus relativ geringen Profiterwartungen in der Industrie.
Die verschärfte Konkurrenz führt gleichzeitig zu immer größerer Zentralisation. Investiert wird nur zum geringen Teil in die Erweiterung bestehender Anlagen. Viel wichtiger sind die Fusion, die Übernahme, die Ballung des Kapitals in einer Hand oder Rationalisierungsinvestitionen, die rasche Einführung neuester Technik.
So können sich die größten Konzerne die entsprechenden Konkurrenzvorteile, nämlich Präsenz auf allen Märkten sowie Monopolpreise und Extraprofite aus kurzfristigen technologischen Vorsprüngen, sichern.
Es ist in diesem Zusammenhang nur folgerichtig, dass die großen multinationalen Konzerne nicht mehr wie noch Anfang der 1980er Jahre Diversifikation (also die Präsenz auf möglichst vielen Geschäftsfeldern) anstreben, sondern die Konzentration auf bestimmte Sparten, in denen die Weltmarktführerschaft oder zumindest Position zwei oder drei anvisiert oder verteidigt werden sollen.
Insgesamt führte das zu einer enormen Zentralisation des Kapitals (weniger der Konzentration), die selbst wiederum nur durch eine riesige Ausdehnung des Kredites und der Aktienmärkte möglich war, um das für die „Übernahmeschlacht“ notwendige Kapital bereitstellen zu können. Die stärker gewordene Dominanz der größten „multinationalen“ Konzerne lässt sich an allen Indikatoren der Weltwirtschaft ablesen.
Alle großen, die Weltwirtschaft (und in letzter Instanz die Welt) beherrschenden Konzerne beanspruchen den Weltmarkt als ihr Operationsfeld. Anders als noch vor 20 oder 30 Jahren brauchen sie sich aufgrund ihrer Größe nicht auf eine Region zu beschränken. Sie müssen wirklich „global“ agieren – oder sie werden früher oder später nicht mehr existieren, jedenfalls nicht unter den Top 100 oder Top 500 der Welt des Großkapitals.
Hier können wir tatsächlich von einer neuen Entwicklung innerhalb der imperialistischen Epoche sprechen, die aus dem quantitativen Anwachsen der großen Kapitale entstand, die jedoch auch durch die nach wie vor nationalstaatliche Gebundenheit der einzelnen Kapitale gebrochen wird. In den 1990er Jahren und im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts hat sich diese Tendenz sehr stark entwickelt, weil die USA als einzige Weltmacht die Konkurrenzbedingungen auf dem Weltmarkt und die geopolitische Ordnung bestimmen.
Der Heißhunger nach Profit treibt – gestützt auf nationale und internationale Organisationen – das Kapital außerdem in Sphären, die über Jahrzehnte staatlich oder halbstaatlich organisiert waren. Die kapitalistische Globalisierung wäre jedoch ohne Verschiebung des Kräfteverhältnisses zwischen den Klassen und ohne technische und arbeitsorganisatorische Basis nicht möglich gewesen.
Die Mischung aus technischen Innovationen, die Reorganisation von Arbeitsabläufen und des Arbeitsprozesses sowie die Schaffung internationaler Produktionsketten ermöglichten die Reduktion der Kosten für Lagerhaltung und die Verkürzung der Umlaufzeit. Die Restrukturierung der Arbeitsorganisation und die Zentralisation im internationalen Maßstab führten in einigen Branchen auch zur Herausbildung einer internationalen Profitrate (Autoindustrie).
Zusammen mit einer massiven Erhöhung der Ausbeutungsrate (aufgrund der Niederlagen der ArbeiterInnenbewegung) konnte so in einigen Ländern – insbesondere in den USA – in den 1990er Jahren zeitweilig die industrielle Profitrate in die Höhe getrieben werden, wenn auch bei weitem nicht auf das Niveau des Langen Booms.
Es ist müßig, darüber zu spekulieren, wie viel davon auf eine Revolutionierung der Technik und der Arbeitsorganisation, wie viel auf die Kürzung der Löhne, die Intensivierung der Arbeit und die Flexibilisierung zurückzuführen ist. Wichtig ist vielmehr, dass sich das US-amerikanische Modell nicht weltweit ausdehnen ließ und lässt, weil es die grundlegenderen Probleme der Überakkumulation des Kapitals nicht lösen konnte und kann.
In dieser Periode änderten sich auch die Strukturen der Kapitalflüsse wie jene des Finanzkapitals selbst.
Mit der Erholung der US-Konjunktur Anfang der 1990er Jahre setzte eine Welle sehr hoher Portfolio- und Direktinvestitionen, speziell in Asien, aber auch z. B. in Mexiko, ein und eröffnete die „Globalisierung“. Diesmal waren es wieder vor allem Privat- bzw. institutionelle AnlegerInnen aus den internationalen Finanzzentren, die in Aktien, Wertpapiere bzw. Derivate von Basiswerten in den halbkolonialen Ländern investierten. Daher konnte mit den in der IWF-Periode einstudierten Maßnahmen das Platzen der Spekulationsblase 1995 in Mexiko („Tequila-Krise“) und 1997 in Thailand (als Auslöser der „Asienkrise“) nicht verhindert werden.
In der Kapitalzuflussperiode 1990 – 1994 spielten „offizielle“ Schulden (z. B. Staatsanleihen) kaum mehr eine Rolle (nur noch 11 % des Kapitalzuflusses). Auch die Geschäftsbanken spielten eine weitaus geringere Rolle als in der Periode 1978 – 1981. Entscheidend waren einerseits Deregulierungen in den Halbkolonien (z. B. Privatisierungen), die Direktinvestitionen in die Höhe schnellen ließen.
Andererseits war es die wachsende Verbriefung internationaler Kapitalschulden (also die Deregulierung der internationalen Finanzmärkte), die es ermöglichte, Offshore-Anlagen auch ohne staatliche Absicherung gegen Risiken abzuschirmen (z. B. Ausweitung des Derivate- und Devisenmarktes).
Als die Phase der niedrigen Zinsen und des niedrigen Dollarkurses Mitte der 1990er Jahre zu Ende ging, ebbten sowohl der Kapitalzufluss ab, wie auch das exportorientierte Wachstum z. B. in Asien durch die Anbindung der Währungen an den Dollar in Schwierigkeiten geriet. Da half keine restriktive Haushalts- bzw. Hochzinspolitik mehr. Offshore-Banken, Investmentbanken, Hedgefonds, Derivate- und DevisenhändlerInnen erzeugten eine massive Spekulationsblase, die letztlich die betroffenen Währungen in die Knie zwang und tief verschuldete Privatunternehmen in den Halbkolonien hinterließ. Der Kapitalfluss bewegte sich fortan massiv in Richtung USA, während in den von der Finanzkrise betroffenen Ländern eine neue Welle von Firmenübernahmen bzw. Kapitalvernichtung durch das imperialistische Finanzkapital vor sich ging.
Die US-Konjunktur der 1990er Jahre beruhte schon stark auf einer Ausdehnung fiktiven Kapitals und war auch durch Kapitalabfluss aus anderen imperialistischen Staaten und Stagnation in Japan und Fast-Stagnation in Deutschland erkauft.
Die Ausdehnung des Weltmarktes, die viel stärkere Durchdringung der Halbkolonien und der ehemaligen degenerierten ArbeiterInnenstaaten wirkten dem Fall der Profitrate entgegen und halfen bei der Aneignung von Extraprofiten für das imperialistische Finanzkapital.
Zugleich ging die Periode der „Hochblüte“ mit massiver Kapitalvernichtung in Osteuropa und der ehemaligen UdSSR einher. Die osteuropäischen Länder wurden als Halbkolonien in den Einflussbereich des deutschen Kapitals und, in Konkurrenz dazu, anderer europäischer Länder und der USA einbezogen. Russland machte eine permanente Krisenperiode durch, die mit einer historisch fast einzigartigen Deindustrialisierung des vormals zweitgrößten Industrielandes der Erde einherging, die, würde sie nicht gebremst werden, auch die Zukunft Russlands als imperialistischen Staat in Frage stellen würde.
Modernes Finanzkapital
Die eigentliche Triebkraft der kapitalistischen Globalisierung stellt das imperialistische Finanzkapital dar. Das Monopolkapital – jedenfalls sein stärkster und konkurrenzfähigster Teil – tritt als multinationaler oder transnationaler Konzern auf und ist der eigentliche Herrscher des globalen Kapitalismus.
Multinational oder transnational hat hier nichts mit einer Entbindung der nationalstaatlichen „Verankerung“ bestimmter Kapitale zu tun. Es bedeutet nur, dass wir es mit einem wichtigen Wandel des wirtschaftlichen Operationsgebietes des Großkapitals zu tun haben.
Das Finanzkapital macht jedoch gleichzeitig einen wichtigen Formwandel durch. Wir erleben eine Neuorganisation des Verhältnisses von Geldkapital und produktivem Kapital. Es ist dabei keineswegs so, dass die „SpekulantInnen“ und „Finanzhäuser“ dem produktiven Kapital entgegengestellt wären. Wir haben es vielmehr mit einer anderen Form der Verschmelzung von Industrie- und Geldkapital zu tun.
In der Geschichte des Imperialismus bildeten sich immer wieder unterschiedliche Formen mehr oder weniger enger, direkter Verschmelzungen (z. B. unmittelbarer Besitz der Unternehmen durch Banken und vice versa, wie lange Zeit in Deutschland vorherrschend) oder – wie in den USA – als eine über Aktienmärkte regulierte, „losere“ Verbindung von zinstragendem zu industriellem Kapital. Der Unterschied besteht darin, dass das Kapital in der zweiteren Form stärker versucht, sich von bestimmten stofflichen Schranken der Expansion zu befreien, nämlich den konkreten Produktionsmitteln, in denen das industrielle Kapital vergegenständlicht ist.
Eine gänzliche Befreiung des Kapitals aus dem inneren Widerspruch zwischen einer bestimmten stofflichen (und damit die Expansion des Kapitals begrenzenden) Form und dem schrankenlosen Trieb zur ständigen Selbstverwertung ist selbstverständlich unmöglich. In den 1990er Jahren, ja, bis hin zur Krise 2007/2008 und darüber hinaus erlebten wir in allen westlichen imperialistischen Ländern eine Verschiebung zu dieser Form.
Dies liegt an mehreren Faktoren. Erstens stellt es eine Weise dar, wie die dominierenden Fraktionen des gesellschaftlichen Gesamtkapitals der Überakkumulation entgegenwirken wollen, die sie umgekehrt zu dieser Formveränderung unter den Bedingungen der Globalisierung treibt. Zweitens bringt diese Entwicklung eine innere Tendenz des Kapitals selbst zum Ausdruck, sich von seiner stofflichen Basis freizumachen. Drittens hängt sie jedoch auch mit bestimmten historischen Bedingungen, der Erneuerung und versuchten Festigung der US-Hegemonie zusammen, weshalb die USA auch versuchten, die Operationen dieser Form von Finanzkapital durch ihr gemäße Regularien der Weltwirtschaft (WTO, Freihandelsabkommen … ) zu stärken.
Der Aufstieg Chinas und die Festigung Russlands im 21. Jahrhunderts verdeutlichen jedoch, dass diese Form keineswegs die einzige ist, wie Finanzkapital auf dem Weltmarkt auftritt. Eine Verstärkung der imperialistischen Konkurrenz, somit auch die Tendenz zur Bildung von Blöcken bis hin zur Fragmentierung des Weltmarktes, bedeutet wahrscheinlich auch, dass die Formen des Finanzkapitals, die eine direktere Bindung an den Staat kennzeichnen, verstärkt, teilweise auch parallel und in Konkurrenz zu anderen auftreten können.
Weltimperialismus
Die globale Struktur des Finanzkapitals erfordert in dieser geschichtlichen Periode eine, natürlich immer auch selektive, Open Door Policy bei gleichzeitigem Schutz des „Heimatblocks“. Sie erfordert internationale Institutionen wie den Internationalen Währungsfonds (IWF) oder die Weltbank bzw. ihre regionalen Entsprechungen (z. B. Europäische Entwicklungsbank).
Sie erfordert von den imperialistischen Mächten, global interventionsfähig zu sein, und zwar nicht nur ökonomisch, sondern auch politisch und militärisch, um eigene Interessensphären gegen die Massen der Halbkolonien oder missliebige Regime, aber auch gegen imperialistische Konkurrenten absichern zu können. Politisch wird der Weltimperialismus durch folgende Faktoren geprägt:
• Politische, militärische und ökonomische Vorherrschaft des US-Imperialismus;
• Institutionen wie IWF, Weltbank, WTO, G 7/8 agieren als ideelle GesamtimperialistInnen unter US-Hegemonie;
• Massive Verelendung der Halbkolonien, stärkere direkte imperialistische Kontrolle;
• Suche nach neuen, der „Globalisierung“ adäquaten Formen politischer, diplomatischer und militärischer imperialistischer Herrschaft, was zu einer Wiederkehr der Kanonenbootpolitik (in einigen Aspekten ähnlich jener am Beginn der imperialistischen Epoche) führt.
Die Widersprüche zwischen den imperialistischen Ländern sind keineswegs verschwunden, sondern verschärfen sich unter der Oberfläche, teils auch offen. Alle potentiellen Rivalen der USA achten darauf, den Gegner nicht zu einem ungünstigen Zeitpunkt herauszufordern. Vielmehr müssen unter dem Deckmantel der Kooperation eigene Positionen gegen die USA gehalten oder neue erobert werden. Das geht umso leichter, als es immer auch ein reales Element gemeinsamer Interessen der imperialistischen Mächte gegenüber den Massen und den Halbkolonien gibt.
Die Herausbildung transnationaler Monopole führt keineswegs zu einem „Ultraimperialismus“ oder zu einer kollektiven imperialen Friedensordnung. Sie verringert auch nicht die Rolle des bürgerlichen Staates als Sicherer und Garant der nationalstaatlich verwurzelten Großkapitale. Aber sie treibt zunehmend den Widerspruch zwischen internationaler Produktion und internationalisiertem Austausch einerseits und nationalstaatlicher oder blockmäßiger Verwurzelung des Kapitals andererseits auf die Spitze. Die Blockbildung (oft missverständlich als „Regionalisierung“ bezeichnet) stellt selbst eine Form der Internationalisierung des Kapitals dar.
Die Neuzusammensetzung des Kapitals verändert auch die ArbeiterInnenklasse. Damit Kapital rascher die Wandlung von einer Form in die andere vollziehen kann, Stockungen im Produktionsprozess vermieden werden, muss sich auch das variable Kapital uneingeschränkt bewegen können und zugleich in seiner Bewegung kontrolliert werden. Alle kollektiven Sicherungsrechte der ArbeiterInnenklasse, die die möglichst unbeschränkte Flexibilität der Arbeitskraft einschränken, stehen daher notwendigerweise auf der Abschussliste. Der Vorsprung der USA, die Vorherrschaft des am meisten entwickelten Kapitals, d. h. einer Form des Kapitals, die mehr seinem Begriff entspricht als in anderen Ländern, wäre ohne die Niederlagen der US-ArbeiterInnenklasse in den 1980er Jahren undenkbar.
Die Schaffung einer „neuen Weltordnung“ bildete über fast drei Jahrzehnte, also bis zu Trump, Leitideologie und Doktrin des US-Imperialismus. Schon in den frühen 1990er Jahren formulierten US-IdeologInnen, aber auch deren geostrategische Doktrin offen das Ziel, die durch den Zusammenbruch des Stalinismus gewonnene Rolle als einzige Weltmacht möglichst zu verewigen, mit dem Ziel keine potentiellen Rivalen – Deutschland, Frankreich, China, Russland – emporkommen zu lassen.
Zbigniew Brzezinski, Sicherheitsberater mehrerer US-Präsidenten, stellte die Konzeption in seinem 1997 erschienenen Buch „Die einzige Weltmacht. Amerikas Strategie der Vorherrschaft“ wie folgt dar: „Eurasien ist das Schachbrett, auf dem der Kampf um globale Vorherrschaft auch in Zukunft ausgetragen wird.“[cx]
Schon 1992 formulierte das Pentagon in einem strategischen Papier (Defense Planning Guidance) den sog. „No Rivals-Plan“, in dem es u. a. heißt: „Wir müssen versuchen zu verhüten, dass irgendeine feindliche Macht eine Region dominiert, deren Ressourcen – unter gefestigter Kontrolle – ausreichen würden, eine Weltmachtposition zu schaffen. Solche Regionen sind Westeuropa, Ostasien, das Gebiet der früheren Sowjetunion und Südwestasien.“ [cxi]
Die US-Strategie unterschied zwischen den vermeintlichen und wirklichen Herausforderern. Die europäischen Mächte und die EU sollten durch Bündnispolitik, Allianzen und PartnerInnenschaft eingehegt werden. China und Russland gelten als mögliche Konkurrenten und als besonders gefährlich, weil sie auch eine Systemalternative zur westlichen „Wertegemeinschaft“ verkörpern könnten. Aus diesem Grund tauchte auch schon zu diesem Zeitpunkt der islamische Fundamentalismus als Bedrohung auf, obwohl dieser weder eine militärische noch eine staatliche Macht darstellte – sich aber umso besser als ideologischer Gegner zur inneren, rassistischen Mobilisierung als auch zum Angriff auf diverse „Schurkenstaaten“ und zur Rechtfertigung asymmetrischer Kriege eignet. Dass der antimuslimische Rassismus zur vorherrschenden Form des Rassismus in den meisten westlichen Staaten geriet, stellt keinesfalls eine Reaktion auf islamistische Anschläge im 21. Jahrhundert dar, sondern wurde in den 1990er Jahren bewusst forciert und popularisiert (z. B. in Huntingtons 1996 erschienenem Bestseller „Krieg der Kulturen“).
Wandel der ArbeiterInnenklasse
Die letzten Jahrzehnte sahen einen starken Wandel der ArbeiterInnenklasse als Resultat der Restrukturierung des Kapitals und der Angriffe der herrschenden Klasse. Worin bestehen deren wichtigsten Elemente?
- Anwachsen der Klasse in einigen imperialistischen Ländern und wichtigen, fortgeschrittenen Halbkolonien;
- Schrumpfen der produktiven Arbeit, Ausdehnung der unproduktiven Arbeit;
- Proletarisierung lohnabhängiger Mittelschichten aus ehemaligen höheren“ Berufen (z. B. IngenieurInnen) oder dem Staatsdienst (z. B. LehrerInnen);
- Schaffung einer gigantischen Masse nicht- oder unterbeschäftigter ProletarierInnen, prekär Beschäftigter und von „working poor“, teilweises Absinken dieser Schichten ins Lumpenproletariat, Millionen und Abermillionen, die in ständiger Armut leben;
- Verringerung und Schwächung des Proletariats in dramatischem Ausmaß in Osteuropa, Russland und vielen Halbkolonien; Ausdehnung der langfristig überausgebeuteten Schichten der ArbeiterInnenklasse, die unter ihren Reproduktionskosten bezahlt werden (Kontraktarbeit, …);
- Verringerung, teilweise auch Auflösung der tradierten ArbeiterInnenaristokratie im industriellen Sektor bei gleichzeitiger Schaffung einer neuen ArbeiterInnenaristokratie (oft aus ehemaligen lohnabhängigen Mittelschichten);
- Schaffung eines zunehmend international kooperierenden Proletariats in den großen Konzernen (im Sinne der realen Kooperation in international integrierten Produktionsprozessen), Teile davon gehören gleichzeitig Kernschichten der ArbeiterInnenaristokratie in verschiedenen Ländern an.
In den relativ entwickelten Halbkolonien in Ostasien und Lateinamerika sowie im kapitalistischen China wachsen die ArbeiterInnenklassen in dieser Periode. Letztere nimmt zunehmend eine strategische Bedeutung für das Weltproletariat ein. In Kontinentaleuropa und zumal in (West-)Deutschland haben wir es damit zu tun, dass die ArbeiterInnenklasse zwar in ihrer Kampfkraft geschwächt, jedoch noch nicht strategisch geschlagen ist.
Diese Veränderungen haben auch die historisch gewachsenen Organisationen des Proletariats, insbesondere die Gewerkschaften, die stalinistischen und sozialdemokratischen Parteien massiv beeinflusst – und die Veränderungen sind seither in Riesenschritten weitergetrieben worden. Die Gewerkschaften sind in den Zentren zunehmend Organisationen der traditionellen ArbeiterInnenaristokratie. Ihr Überleben hängt davon ab, ob und wie sie neuen proletarisierten Schichten, insbesondere aber den nichtarbeiteraristokratischen Teilen der Klasse, eine Perspektive bieten können.
Die sozialdemokratischen Parteien haben in den letzten Jahrzehnten einen Wandel hin zu neu entstehenden arbeiteraristokratischen Schichten und lohnabhängigen Mittelschichten gemacht. Ein Teil der Gewerkschaftsbürokratie ist diesen Schritt mitgegangen, ein anderer hat sich auf die „Kernschichten“ konzentriert. Für die nichtorganisierten Teile des Proletariats (und dabei geht es keineswegs nur um abfällig als „Randschichten“ bezeichnete Sektoren) haben alle Flügel der ArbeiterInnenbürokratie immer weniger zu bieten. Die stalinistischen Parteien haben in Europa weitgehend an Bedeutung verloren, nicht jedoch in wichtigen Halbkolonien. Sie unterscheiden sich jedoch oft nur im Namen von der Sozialdemokratie.
Die Hinwendung des Reformismus zur neuen ArbeiterInnenaristokratie und zu den neuen Mittelschichten hat sich politisch-programmatisch in der Neuen Mitte (oder im „Dritten Weg“) manifestiert. Sie drückt auch einen stärkeren Einfluss der Mittelschichten (und über diese der Bourgeoisie) auf die bürgerlichen ArbeiterInnenparteien, aber auch auf die Gewerkschaften aus.
1998 – 2007: Zuspitzung der inneren Widersprüche der Globalisierung
Die Asienkrise und die Börsenkrise Ende der 1990er Jahre verdeutlichten schlagartig die Krisenhaftigkeit der Globalisierung. Sie brachten zum Ausdruck, dass die grundlegenden Probleme der Weltwirtschaft nicht gelöst wurden, sondern die fiktive Blüte der 1990er Jahre erkauft wurde um den Preis einer weiteren Vertiefung und Zuspitzung der Widersprüche.
Spiegelbildlich zur Asienkrise und zur Entwicklung der Schuldenblase in den USA begann das chinesische „Exportwunder“. Dessen Voraussetzung bildete die nur beschränkte, kontrollierte Öffnung für Direktinvestitionen, bei einem weiterhin stark regulierten chinesischen Finanzmarkt. Damit konnten lange Zeit sowohl eine Aufwertung der chinesischen Währung verhindert als auch Exportüberschüsse in großen Dollarreserven in China gehalten werden. Zugleich floss Kapital nach der Asienkrise von den Börsen hin zum US-Immobilienmarkt, wo es über die folgenden Jahre einen neuen, spekulativen Zyklus entwickelte.
Diese Faktoren führten dazu, dass die Krise um die Jahrhundertwende relativ flach blieb und aufgeschoben wurde.
Aber zugleich eröffnete sie schon wichtige, vorbereitende Elemente des Niedergangs und der folgenden Krise der Globalisierung:
a) Die Dynamik der Weltwirtschaft konnte im Wesentlichen nur durch die Ausweitung fiktiven Kapitals angeschoben und aufrechterhalten werden, der eine Stagnation des industriellen Sektors gegenüberstand, insbesondere in den imperialistischen Kernländern.
b) Die Ausweitung der Finanzmärkte, der Spekulation und der Verschuldung in den USA waren wesentliche Mittel, die Expansion des Welthandels sicherzustellen sowie des US-Konsums als „Lokomotive“ vor der Weltwirtschaft.
c) Auch wenn die ökonomischen Auswirkungen der Krise relativ abgemildert werden konnten, so wurden ihre Ursachen nicht beseitigt, sondern verstärkten vielmehr die Krisentendenzen, die jetzt zum Ausbruch kommen.
d) Untrüglich zeichnete sich eine kommende Schwächung der US-Hegemonie auf ökonomischer Ebene – Einführung des Euro, Voranschreiten der EU-Integration (trotz alle Schwächen ist sie nun der größte Wirtschaftsraum der Erde), Aufstieg Chinas und Restabilisierung Russlands – ab.
e) Der sog „permanente Krieg“ Bushs – eine Neuformulierung der US-Doktrin – stand im engen Verhältnis zur ökonomischen Basis des US-„Booms“ – sprich Kriegskeynesianismus, Eroberung, Sicherung von Rohstoffen und Reichtümern anderer Länder als Faustpfande gegenüber imperialistischen und anderen potentiellen Rivalen.
f) Die imperialistische Politik des US-Imperialismus sicherte in dieser Periode nicht nur die US-Hegemonie, sondern auch, dass das Wachstum der US-Binnenwirtschaft auf Kosten anderer Staaten und Rivalen weiter aufrechterhalten werden konnte. Allerdings geschieht das schon (anders als in den 1990er Jahren unter Clinton) auf Kosten der US-Industrie, also bei gleichzeitiger Unterminierung ihrer Wettbewerbsfähigkeit.
g) Entscheidend für die veränderte politische Lage und den Beginn einer neuen Klassenkampfperiode sind jedoch nicht nur die ökonomische Stagnationstendenz und die zunehmende Aggressivität des US-Imperialismus, sondern auch die nachhaltige Erschütterung der neoliberalen Hegemonie. Auch wenn der Neoliberalismus vorherrschende Ideologie der herrschenden Klassen in den imperialistischen Staaten und in den meisten Halbkolonien bleibt, auch wenn er in Form des „Neuen Realismus“ und „Dritten Weges“ in den großen, bürokratisierten Gewerkschaften der imperialistischen Welt sowie in den sozialdemokratischen Parteien faktisch anerkannt wird, so entstand nach der Asienkrise auch eine globale Gegenbewegung.
h) Diese Gegenbewegung, ihre Entstehung und Geschichte stellte keinen Nebenaspekt, sondern einen prägenden Faktor der Periode von 1998 – 2007/8 als Periode der Zuspitzung der inneren Widersprüche der Globalisierung dar.
i) Diese äußerte sich:
– in revolutionären Bewegungen und Situationen (Indonesien … )
– der riesigen Antikriegsbewegung
– im Widerstand gegen EU/Euro, in vorrevolutionärer Situation in Frankreich
– dem entschlossenen und heroischen Widerstand in Afghanistan, Irak, Libanon und seinen Erfolgen gegen den Imperialismus (wenigsten in dem Sinne, dass die Ziele des Imperialismus nicht erreicht werden konnten)
– der Entstehung linkspopulistischer und/oder linksbonapartistischer Regime und Bewegungen – insbesondere Chávez und Morales – inkl. ihrer kontinentalen und internationalen Ausstrahlung
– der Entstehung einer globalen internationalen Bewegung, der Antiglobalisierungs- oder auch antikapitalistischen Bewegung. Implizit warf diese die Frage einer neuen Internationalen auf und mit den Sozialforen schuf sie bei all ihren Schwächen eine Form des globalen Austausches von AktivistInnen der radikalen Linken, der ArbeiterInnenbewegung, der Bauern-/Bäuerinnenschaft, rassistisch und national Unterdrückter, die die Internationalisierung des Kapitals und des Klassenkampfes reflektierten. Diese spontane Entwicklung konnte ihr fortschrittliches Potential jedoch aufgrund der politischen Hegemonie von linkem Reformismus, Populismus und kleinbürgerlichem Radikalismus in der Bewegung nicht realisieren.
13.6 Seit 2007/2008: Historische Krisenperiode und Krise der Globalisierung
Mit dem Platzen der Immobilienblase, Finanzkrise, weltweiten Wirtschaftskrise begann eine neue historische Periode.
Diese kennzeichnet erstens eine tiefe, historische Weltwirtschaftskrise. Im Unterschied zu früheren Umschlägen der globalen Lage markierte sie jedoch nicht ein politisches Ereignis, sondern einen globalen ökonomischen Einbruch, einen Periodenwechsel. Dies reflektiert die viel größere Bedeutung des Weltmarktes, die zu einer viel rascheren Verbreitung eines großen wirtschaftlichen Zusammenbruchs im Gesamtsystem führt. Dies gilt übrigens noch viel stärker für die aktuelle globale Krise, deren Kombination mit der Corona-Pandemie zu einer Unterbrechung der Kapitalzirkulation in weiten Teilen der Weltwirtschaft führt und somit die tiefste Krise seit dem Zweiten Weltkrieg hervorgebracht hat.
Doch zurück zu 2007 und folgenden Jahren. Schon die damalige Rezession erforderte eigentlich eine Vernichtung überschüssigen Kapitals von geschichtlichem Ausmaß und zugleich eine riesige Steigerung der Ausbeutung des Proletariats und der Unterdrückten, um den ihr zugrundeliegenden geringen Profitraten und der strukturellen Überakkumulation entgegenzuwirken. Dem standen aber enorme innere Hindernisse des Kapitals selbst und auch des Klassenverhältnisses entgegen.
Die imperialistische Bourgeoisie verfolgte eine Politik der Rettung des Finanzkapitals – und insbesondere seines zinstragenden Teils. Diese schob zugleich die eigentlich notwendige Vernichtung von Kapital auf oder wälzte sie auf schwächere Teile ab (industrielles Kapital, kleinere und mittlere Unternehmen, Halbkolonien usw.). Anders als z. B. in der Großen Depression der 1930er Jahre fand jedoch kein „Ausbluten“ des Finanzsektors, also keine strukturelle Vernichtung von fiktivem Kapital statt. Im Gegenteil, gerade diese Teile wurden gerettet und diese Politik fand schon Mitte des Jahrzehnts vor dem Hintergrund sich formierender imperialistischer Konkurrenz der Blöcke (EU) und der aufstrebenden Weltmacht China und einzelner Regionalmächte statt (Indien, Brasilien … ).
Die gegenwärtige Krise unterscheidet sich von der Weltwirtschaftskrise 1929 und folgenden in einem wichtigen Punkt: Der Weltmarktzusammenhang war nicht zusammengebrochen, der Dollar weiter die wichtigste Währung der Welt.
Die USA agierten weiter als Hegemonialmacht. Der US-Imperialismus organisierte im Bund mit der EU, auch mit China, die Welt so weit, dass ökonomische Gegenmaßnahmen ergriffen wurden, um die Weltwirtschaft wieder zum Laufen zu bringen (Politik des billigen Geldes). Anders als zu Beginn der Globalisierungsperiode streifen die USA dafür aber keine ökonomische Dividende mehr ein.
Die hegemoniale Rolle ließ sich nur aufrechterhalten durch die weitere, zwangsläufige Unterminierung ihrer wirtschaftlichen, industriellen Basis. Die anderen ImperialistInnen und potentiellen KonkurrentInnen „stützten“ die USA, doch wollten sie sich diese Stützung durch größere Anteile am Weltmarkt, mehr „Mitsprache“rechte und größeren Einfluss auf die Weltordnung „bezahlen“ lassen, sprich durch weitere Aushöhlung der US-Hegemonie.
Aber die USA können die Einheit unter den großen Mächten, den G 20, vor allem noch dadurch herstellen, dass ihr Zusammenbruch die ganze Welt in den Untergang mitreißen würde. Ein positives Programm für eine neue Periode der „Expansion“ haben sie nicht.
Allerdings fürchten auch die RivalInnen den Zusammenbruch der Weltwirtschaft, des Terrains, auf dem sie die USA zugleich zu besiegen oder jedenfalls weiter zurückzudrängen versuchen.
Daher kommt die Konferenzkonjunktur, der Neuordnungs- und Regulierungshype in den herrschenden Klassen, permanentes Krisenmanagement, das immer mehr auf die Grenzen verstärkter gegensätzlicher Interessen trifft.
Die „Ratlosigkeit“, das Fehlen eines gemeinsamen „Plans“ oder Programms, einer klaren Wirtschaftsdoktrin der herrschenden Klasse ist jedoch nicht nur ein Resultat verschärfter innerer Gegensätze des Kampfes, wer innerhalb der Kapitalistenklassen und unter den imperialistischen Bourgeoisien die Krisenkosten tragen soll.
Es ist auch ein Zeichen für die Überlebtheit der bürgerlichen Herrschaft selbst – so wie jede Krise auch die Zusammenbruchstendenzen des Systems selbst in Erinnerung ruft. Die herrschende Klasse kann ihr System nur retten, wenn sie bestehende Formen der Vergesellschaftung und Produktivkräfte zurückdrängt, weitere Kriege vorbereitet und zugleich die Welt einem ökologischen Desaster entgegenführt.
Gerade die Globalisierung hat als ein Moment, um dem Fall der Profitraten und dem Problem der Überakkumulation entgegenzuwirken, den Weltmarkt massiv ausgedehnt und auch die Produktionsabläufe in enormem Ausmaß international vorangetrieben. Doch die nationalstaatliche Form erweist sich als unüberwindbare Schranke, eine Barriere, auf die die herrschende Klasse zur Rettung ihrer nationalen Interessen und imperialen Ambitionen zugleich mehr und mehr zurückgreifen muss.
Schon die Krise ab 2007 verdeutlichte schlagartig, dass ihre Überwindung eigentlich eine globale, bewusste Planung erfordert, um die weitere Entwicklung, die Entwicklung der Produktivkräfte zu gewährleisten und den Fortbestand und die Schaffung wahrlich menschlicher Lebensverhältnisse überhaupt zu sichern. Dazu ist die herrschende Klasse nicht in der Lage.
Diese widersprüchliche Situation, historisch tiefe Krise des Produktionsverhältnisses und zugleich Bestehen einer untergehenden Hegemonialordnung und innerimperialistischen Kooperation, die die Herrschenden noch hoffen lässt, dass sie „das Schlimmste“ verhindern können, eröffnete eine längere Periode des „permanenten Krisenmanagements“, der Kooperation auf ökonomischer, politischer und diplomatischer Ebene, um „den Zusammenbruch“ (oder verschiedene, jäh auftauchende Zusammenbruchsszenarien) zu verhindern. Zugleich aber werden sich die inneren Konflikte zwischen den imperialistischen Mächten (und jenen, die solche werden möchten) weiter zuspitzen.
Bei aller Unterschiedlichkeit und „Schwankungen“ der herrschenden Klassen, wenn es um eine „pragmatische“ Lösungsstrategie für das Kapital geht, so bedeutet die Krise für die ArbeiterInnenklasse und Unterdrückten eine Periode des Frontalangriffs, bis in die ArbeiterInnenaristokratie und Mittelschichten hinein, von dramatischem, weltweit verallgemeinertem Ausmaß.
In jedem Fall führte die historische Krise, die 2007 begonnen hatte, rasch zu großen Kämpfen: Hungerrevolutionen und Massenproteste in einem Viertel aller Länder der Erde, vorrevolutionäre Situationen, Aufstände usw. Sie eröffnete eine Periode, in der die Frage, wer herrscht, wer bestimmt den weiteren Gang der geschichtlichen Entwicklung, also die Machtfrage, direkt gestellt wurde, auch wenn sich die Gesellschaftsklassen erst allmählich des Charakters der Entwicklung bewusst wurden. Das traf auch auf die herrschenden Klassen zu, die von der Krise „überrascht“ wurden, aber auch die SozialimperialistInnen in der ArbeiterInnenbürokratie, die noch bis Ende 2008 die Existenz der Krise zu leugnen versuchten und behaupteten, dass doch alles beim Alten geblieben sei (eine jener tröstlichen „Wahrheiten“, mit denen die Bürokratie sich selbst über jeden historischen Wendepunkt zu „retten“ versucht).
Zweifellos hatte die spezifische Form des Wendepunktes – eine ökonomische Krise – damit zu tun. Ein Weltkrieg oder eine Revolution in einem bestimmten Land stellen per se die Machtfrage. Eine Wirtschaftskrise trägt einen zeitlich ausgedehnteren Charakter. Außerdem erscheint sie als „Sachzwang“, als „Verhängnis“, als fast natürliche Katastrophe, die alle „gleichermaßen“ trifft. D. h., selbst wo sie am tiefsten wirkt, erscheint ihre Ursache nicht direkt, offen als notwendiges Resultat des Kapitalverhältnisses, sondern ihre Oberflächenerscheinungen prägen des Bewusstsein. Daher bleibt das Bewusstsein in solchen historischen Umbrüchen auch oft zurück, wodurch die Führungskrise und die konterrevolutionäre Rolle der bürgerlichen Apparate in der ArbeiterInnenklasse noch verstärkt werden.
Schließlich wurde die gegenwärtige Periode von Beginn an auch davon geprägt, dass die ökologische Frage zu einer Menschheitsfrage geworden ist, dass die Fortexistenz des Kapitalismus das Überleben der Menschheit selbst in Frage stellt. Diese Bedrohung wird selbstredend in der aktuellen Krise dramatisch verschärft.
Klassenkampfperioden seit 2008
Die ersten Jahre der Krise waren von einer Erschütterung des bürgerlichen Systems gekennzeichnet, die die Legitimität der kapitalistischen Ordnung in Frage stellte. Die bürgerlichen Medien und die herrschenden Klasse trieb die Furcht um, dass die globale Linke, die ArbeiterInnenklasse von der Krise profitieren würden. Schließlich hatten alle Kräfte links von der Sozialdemokratie immer schon auf die Krisenhaftigkeit des Systems verwiesen. Seit Beginn der Antiglobalisierungsbewegung hatte sich eine, wenn auch reformistisch und populistisch geführte, Bewegung gegen den Neoliberalismus gebildet, deren linker Flügel offen, wenn auch theoretisch und programmatisch sehr heterogen, direkt antikapitalistisch auftrat.
Die Kämpfe gegen die große Krise konnten nicht nur daran, sondern auch an wichtige Mobilisierungen und Massenkämpfe anknüpfen, an Bewegungen wie Blockupy und die Platzbesetzungen im Süden Europas, die, gewissermaßen als Vorbotinnen der historischen Krise, eine tief sitzende Unzufriedenheit, aber auch Handlungsbereitschaft großer Bevölkerungsschichten zum Ausdruck brachten.
Dabei stellten sie selbst nur das Vorspiel zu den revolutionären Erhebungen des Arabischen Frühlings oder der vorrevolutionären Krise in Griechenland dar, die scheinbar fest etablierte Regime stürzten und Millionen im Kampf um eine andere Gesellschaftsordnung in Bewegung brachten. In anderen Ländern wie Indien oder China erwachten hunderte Millionen von Lohnabhängigen zum gewerkschaftlichen und politischen Leben. In Brasilien, in den USA oder in Frankreich unter Hollande demonstrierten Millionen ihren Willen, sich einem putschistischen Regime (Temer), einem rassistischen Präsidenten oder knallharter Austeritätspolitik in den Weg zu stellen. Die sog. „Flüchtlingskrise“, also der zeitweilige Zusammenbruch der rassistischen Grenzen der EU, hat zu Beginn auch eine Solidarisierung unter großen Teilen der Bevölkerung hervorgebracht.
Aber die meisten dieser Bewegungen endeten in bitteren Niederlagen. Insbesondere der faktische Sieg der Konterrevolution im Arabischen Frühling (Ägypten, Syrien, Libyen) bis spätestens 2016, Kapitulation und Verrat von Syriza gegenüber der Troika aus EU-Kommission, EZB und dem IWF im Jahr 2015 markierten einen Wendepunkt der internationalen Lage. Die antirassistische Solidarität am Beginn der massiven Fluchtbewegungen aus dem Nahen Osten und Afrika verwiesen zwar auf das Potential für eine fortschrittliche Bewegung, aber erlitten auch eine Niederlage mit dem Aufstieg des Rassismus und der Formierung einer europaweiten und internationalen rechtspopulistischen Welle. So verschob sich das Kräfteverhältnis auf der ganzen Welt zugunsten der herrschenden Klassen oder gar Elementen der extremen Reaktion – zu rassistischen, rechtspopulistischen, autoritären und diktatorischen Regimen und Kräften.
Diese Niederlagen verdichteten sich 2016. Innerhalb der aktuellen globalen Krisenperiode, deren grundlegende Ursachen längst nicht gelöst sind, begann eine Phase, die vom Vormarsch der Reaktion, der Konterrevolution auf allen Ebenen und von einer weiteren dramatischen Verschärfung des Kampfes um eine Neuaufteilung der Welt gekennzeichnet ist. Die politische Klassenkampfperiode, die damals begann, wird vom Vormarsch der Konterrevolution, des Rechtspopulismus und des Irrationalismus geprägt. Dies bedeutet keineswegs, wie wir bei den Kämpfen der letzten Jahre sehen können, dass es keine Massenbewegungen, ja selbst Generalstreiks oder Aufstandsbewegungen geben kann. Aber diese werden in der Regel durch vorhergehende Angriffe der Rechten, als Reaktion aus einer Situation der Defensive ausgelöst. Beispiele finden sich zuhauf: die befristeten Generalstreiks in Brasilien oder in Indien gegen Modi, die Aufstände im Sudan oder im Libanon, die Massenbewegungen des internationalen Frauen*streiks, die auch durch die extreme Reaktion eines Trumps entfacht wurde, antirassistische Massenbewegungen wie Black Lives Matter und die Rebellionen in den USA, die globale internationale Umweltbewegung, die mit den Schulstreiks von Fridays for Future einen ersten Höhepunkt erreichte.
Zugleich verdeutlichen diese Kämpfe die Führungskrise auch von einer anderen Seite. Linkspopulistische, linksbürgerliche und kleinbürgerliche Kräfte prägen oft und zunehmend auch die politische Ausrichtung dieser Bewegungen. Das Erstarken dieser Ideologien stellt selbst einen Ausdruck der Defensive dar, eines zunehmenden Einflusses von bürgerlichen oder kleinbürgerlichen Bewegungen unter den Unterdrückten und selbst in der ArbeiterInnenklasse. Diese Entwicklung wurde durch die Niederlagen in Griechenland oder in den Arabischen Revolutionen und durch die klassenkollaborationistische Politik der Führungen von Gewerkschaftsbürokratie und Reformismus begünstigt, ja, in diesem Ausmaß überhaupt erst ermöglicht. Ebenso wie der Kampf gegen Reformismus und NurgewerkschafterInnentum einen unverzichtbaren Teil des ideologischen und theoretischen Klassenkampfes bildet, muss dieser auch gegen die klein- und linksbürgerlichen Kräfte geführt werden, deren theoretischen Ausdruck z. B. Linkspopulismus, Identitätspolitik, Intersektionalismus, Postmodernismus oder kleinbürgerlicher Ökologismus bilden.
Die innerimperialistischen Gegensätze, der Kampf zwischen „alten“, tradierten Mächten (den USA, Japan, den europäischen Mächten wie Deutschland) und „neuen“ Imperialismen (China und Russland) machten sich zugleich bei jedem globalen Konflikt, in jeder „Krisenregion“ bemerkbar. Der Vormarsch der Reaktion im Nahen Osten, die Dauerkrise in Zentralasien, der neue „Run um Afrika“ usw. können nur im Rahmen dieser Konkurrenz verstanden werden. Dasselbe gilt für die US-Offensive gegen missliebige „linke“, also linkspopulistische oder reformistisch geführte Regierungen in Lateinamerika, ebenso für Chinas Jahrhundertprojekt der neuen „Seidenstraße“.
Die verschärfte Ausbeutung der sog. „Dritten Welt“, Interventionen der führenden Großmächte, aber auch regionaler, in der imperialistischen Ordnung untergeordneter Staaten führen dazu, dass die Weltlage immer explosiver wird. Die Kriegsgefahr steigt. Sog. „Stellvertreterkriege“ oder nukleare Drohungen wie gegen Nordkorea können unter diesen Umständen zu einem Weltenbrand werden.
Gerade weil die strukturellen Probleme der kapitalistischen Weltwirtschaft ungelöst sind, müssen sich sowohl die Angriffe auf die Massen als auch die innerimperialistische Konkurrenz weiter verschärfen.
Die Ursache der Finanzkrise, der tiefen Rezession und des Rückgangs der Produktion in allen tradierten imperialistischen Staaten war und ist die Überakkumulation von Kapital. Eine immer größere Masse an Kapital kann im produktiven Sektor nicht mehr mit ausreichend hohen Gewinnerwartungen angelegt werden. Die „Flucht“ in den Finanzsektor, das Entstehen spekulativer Blasen war und ist die unvermeidliche Folge.
Innerkapitalistisch kann das nur durch zwei miteinander verbundene Wege gelöst werden – einerseits die Vernichtung „überschüssigen“ Kapitals, andererseits durch eine Neuaufteilung der Welt, bei der auch entschieden wird, wessen Kapital zerstört wird, welcher Imperialismus (oder welcher Block) sich letztlich durchsetzt. Daraus ergibt sich auch, warum die Frage der Formierung Europas für den deutschen Imperialismus so entscheidend ist.
Daraus ergibt sich aber auch, warum eine Lösung der grundlegenden Menschheitsprobleme wie z. B. der ökologischen Krise, also der drohenden und rapide fortschreitenden Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen, von Hungerkatastrophen, Armut und Verelendung immer größerer Massen unter dem kapitalistischen System zunehmend unmöglich wird. Die Krise und der Kampf um die Neuaufteilung der Welt verschärfen vielmehr notwendigerweise diese Probleme, gerade und vor allem in den von imperialistischen Staaten beherrschten Ländern. Die gegenwärtige Krisenperiode umfasst alle Aspekte des gesellschaftlichen Lebens wie des Mensch-Natur-Verhältnisses.
Zugleich bestätigt sie auch die Aktualität der Methode des Übergangsprogramms. Losungen wie die nach Aufteilung der Arbeit auf alle, Enteignung der Banken und Konzerne, Notpläne unter ArbeiterInnenkontrolle, Generalstreik, Besetzungen, die Frage der ArbeiterInnenregierung – also alles Losungen, die zur Machtfrage führen und zum Übergang zur proletarischen Diktatur, sind zentral für jedes Aktionsprogrammen, das einen Weg zur Lösung der entscheidenden Fragen bietet, vor denen nicht nur die ArbeiterInnenklasse, sondern die gesamte Menschheit steht.
Der Sturz des Imperialismus, das Programm der proletarischen Machtergreifung, der sozialistischen Reorganisation der Weltwirtschaft wird auch strategisches Ziel zur Rettung der Menschheit vor sozialem Verfall und zur Rettung ihrer natürlichen Lebensgrundlagen.
14. Imperialismus, Weltwirtschaftskrise und der Übergang zum Sozialismus
Die gegenwärtige Krisenperiode bestätigt Lenins Analyse des Imperialismus als Epoche des Übergangs vom Kapitalismus zum Sozialismus, als Epoche, die weltgeschichtlich die Alternative Sozialismus oder Barbarei aufwirft.
Der Imperialismus ist eine Epoche, in der die Bourgeoisie aufgehört hat, eine fortschrittliche Klasse zu sein, in der die weitere Herrschaft der Kapitalistenklasse, in der die kapitalistische Produktionsweise insgesamt reaktionär ist, weil sie zu einem Hemmnis für die Entwicklung der Produktivkräfte und Gesellschaft geworden ist.
Es geht nicht einfach um die Epoche der Herrschaft „des Kapitals“, sondern des Finanzkapitals, der Fusion von industriellem und zinstragendem (financial) Kapital, einer schon gesellschaftlichen Form des Kapitals, die, historisch betrachtet, immer schon beinhaltet, dass das Kapital zu Mitteln seiner eigenen Negation greifen muss, um sich selbst als herrschendes gesellschaftliches Verhältnis zu behaupten.
Die Epoche des Imperialismus ist nicht nur eine Epoche, wo die Produktionsweise reaktionär wurde, wo der Kapitalismus zu Niedergang und Stagnation tendiert, wo zur Sicherung der Herrschaft des Finanzkapitals die gesamte Welt unter wenige große Kapitale und Mächte aufgeteilt ist (resp. immer wieder neu aufgeteilt werden muss). Mit der Bildung des Finanzkapitals, der Entstehung riesiger, weltumspannender Monopole wird gleichzeitig auch die direkte, bewusste Vergesellschaftung der sich jetzt in den Händen einer kleinen Gruppe von Konzernen, Banken und Finanzinstitutionen befindenden Produktionsmittel zu einer unmittelbaren Möglichkeit und Notwendigkeit.
Im Kapitalismus ist das natürlich unmöglich. New Deal, keynesianischer Sozialstaat, Staatskapitalismus in den Halbkolonien, aber auch die weniger augenscheinliche staatliche Protektion des nationalen Finanzkapitals unter Globalisierung/Neoliberalismus sind Zeichen dafür, dass der bürgerliche Staat ein weit wichtigeres Element der Ökonomie des Kapitalismus darstellt, als dies in der vorimperialistischen Epoche der Fall war.
Der reaktionäre Charakter der Epoche zeigt sich wohl am sinnfälligsten darin, dass sich die Herrschaft des Finanzkapitals nur durch äußerst barbarische Mittel (Völkermord, faschistische Herrschaft samt industrieller Massenvernichtung des jüdischen Volkes, zwei Weltkriege, nukleare Auslöschung von Hiroshima und Nagasaki, generell Krieg als großindustrielles Vernichtungsunternehmen) überhaupt halten konnte. Ohne Vernichtung solchen Ausmaßes hätte es die Prosperitätsphasen des Imperialismus, insbesondere den Langen Boom, nicht geben können.
Doch auch der „Normalzustand“ des Imperialismus grenzt an Barbarei. Die systematische „Unterentwicklung“ der Halbkolonien, täglicher Hungertod Tausender, Hunger und Elend für Milliarden Menschen sind Erscheinungen, die sich durch alle Perioden seiner Entwicklung ziehen.
Zeichen für den reaktionären Charakter der Epoche sind diese Perioden jedoch nicht nur wegen der barbarischen Ausmaße von Ausbeutungs- und Herrschaftsverhältnissen und ihres gigantischen Blutzolls. Reaktionär sind sie v. a., weil sie von einem Großteil der Staaten und Menschen der Erde erzwingen, in einem Zustand der „Unterentwicklung“, der sozialen Paralyse zu verharren.
Zugleich war der Kapitalismus in seiner langen Entstehungsphase wie in seiner Blüte und industriellen Durchsetzung im 19. Jahrhundert keineswegs „nichtbarbarisch“ gewesen. Die Kolonisierung, die Schaffung von Märkten für die Arbeitskraft der SklavInnen und Kulis gingen einher mit der Ausradierung eines Großteils der indianischen Bevölkerung Amerikas und einer Stagnation der Bevölkerungsentwicklung Afrikas im 18./19. Jahrhundert.
Sie gingen aber auch einher mit eine Umwälzung gesellschaftlicher Verhältnisse, der Zerstörung vorkapitalistischer Gesellschaftsformationen und mit der Schaffung globaler moderner Produktions- und Klassenverhältnisse. Doch dieses Werk ist längst vollendet.
Der Imperialismus des 20. und 21. Jahrhunderts zerstört im Wesentlichen keine vorkapitalistischen Verhältnisse mehr, er hat den Weltmarkt schon verallgemeinert. Er verunmöglicht dem Großteil der Menschheit, aus halbkolonialer Abhängigkeit samt Unterentwicklung zu entfliehen, und hat zugleich die vorkapitalistischen Produktionsweisen als relativ stabile Verhältnisse zerstört. Zugleich schafft er immer wieder auch „hybride“ Produktionsweisen, die die Nachteile beider verchmelzen.
Die Wiederherstellung des Kapitalismus in Osteuropa, Russland, China, Vietnam hat der imperialistischen Bourgeoisie politisch wie auch wirtschaftlich Mittel zur Expansion oder jedenfalls zur Abfederung der Krisentendenzen des Systems geliefert. Aber sie hat das in einer ganz anderen Form getan als bei der Zerstörung vorkapitalistischer Eigentumsverhältnisse im 19. Jahrhundert. Der Kapitalismus hat in Russland, Osteuropa China, Vietnam keine rückständige Produktionsverweise zerstört, zurückgesetzt oder inkorporiert. Er hat vielmehr einen gesellschaftlichen Rückschritt mit sich gebracht: bürokratische Planwirtschaften durch halbkoloniale Staaten oder schwache Imperialismen ersetzt und/oder äußerst autokratische Formen der Herrschaft des Kapitals und Formen, die der ursprünglichen Akkumulation ähneln (mafiose Strukturen, kriminelle Formen der Aneignung … ), errichtet.
Noch dramatischer ist das Bild im Großteil der halbkolonialen Länder. In der sog. „Subsistenzwirtschaft“ der „Dritten Welt“, in den Megastädten und Slums, aber auch in den Ghettos der großen imperialistischen Metropolen sammelt sich ein immer größerer Teil der Weltbevölkerung, der nicht vor und nicht zurück kann, der in der permanenten Krise einer Gesellschaftsformation gefangen ist.
Zugleich ist diese Abhängigkeit eine unvermeidliche Funktion der Herrschaft des Finanzkapitals. Bis auf wenige Ausnahmeperioden ist das Fortschreiten der Unterentwicklung notwendige Kehrseite der fortschreitenden Zusammenballung und Bereicherung des Finanzkapitals. Die Globalisierung hat dies auf bisher ungeahnte Spitzen getrieben.
Dabei musste das Finanzkapital auch auf Mittel zurückgreifen, die die Produktion und den gesellschaftlichen Verkehr über die bestehenden nationalstaatlichen Grenzen und Formen hinaustreiben: die Zunahme internationaler, koordinierter Produktionsketten und Planungszusammenhänge in Konzernen mit 100.000en Beschäftigen samt einem Vielfachen von ArbeiterInnen in Zulieferindustrien. Die logistischen Leistungen auf dem Gebiet des Transportwesens usw. bezeugen alle auch, zu welchem Ausmaß globaler Wirtschaftsplanung die Menschheit, d. h. die gesellschaftliche Arbeit, fähig geworden ist. Selbst die Einführung des Euro bezeugt nicht nur die imperialen Ambitionen Deutschlands und Frankreichs – sie bezeugt auch, wenn auch im Rahmen des Kapitalismus, dass die modernen Produktivkräfte über den Nationalstaat hinausdrängen.
Programm der herrschenden Klasse
Aber worin besteht das Programm der herrschenden Klasse angesichts dieser Problemstellung in der gegenwärtigen Krise?
Um der schärfsten Explosion vorzubeugen, besteht die unmittelbare Reaktion v. a. der US-Bourgeoisie darin, der Krise durch Staatsverschuldung, also Ausdehnung des Kredits und damit der „Vorbereitung“ der nächsten spekulativen Blase, zu begegnen. Das wird den Prozess einer Kapitalvernichtung nicht aufheben, auch wenn es diesen verzögern oder sogar zu einem kurzfristigen Aufschwung führen kann.
Angesichts der gigantischen Massen fiktiven Kapitals, das in den letzten Zyklen angehäuft wurde, angesichts der gigantischen Massen von Kapital, das in Industrien vergegenständlicht ist, die von chronischer Überproduktion betroffen sind, angesichts der gigantischen Widersprüche droht nach wie vor eine „Bereinigung“, die bisherige Ausmaße dramatisch übersteigt – und die keineswegs sicherstellt, dass danach „der Kapitalismus“ wieder seinen Lauf nimmt.
Die gegenwärtige Krise kann und wird zwar nach einer bestimmten Phase einem zeitweiligen konjunkturellen Aufschwung Platz machen. Die Frage ist jedoch: Werden neue Bedingungen geschaffen, die eine ganze, längerfristige Periode der Expansion ermöglichen? Wird ein relativ stabiles Gleichgewichtig zwischen den großen Kapitalen und Mächten hergestellt werden können, auf dessen Basis auch ein politisches, zwischenimperialistisches Gleichgewicht neu aufbauen kann? Die Frage zu stellen, heißt schon die Probleme zu benennen, die dem gegenüberstehen: Ein neuer tieferer Aufschwung des industriellen Zyklus müsste schließlich nicht nur eine Vernichtung bestehender Kapazitäten, sondern auch eine grundlegende technische Erneuerung des Produktionsapparates oder wenigstens der Zirkulationskosten (wie z. B. Ende der 1980er Jahre und dann v. a. in der Globalisierungsperiode durch die Computerisierung) beinhalten.
Hinzu kommt, dass Kapitalvernichtung ein ungleicher Prozess sein wird und im Rahmen des imperialistischen Gesamtsystems sein muss. Manche kapitalistischen und imperialistischen Staaten und Kapitale gewinnen auf Kosten anderer. Das verschärft wie schon in früheren Phasen die Ungleichgewichte der Weltwirtschaft und die Konkurrenz untereinander. Der Aufstieg Chinas zur imperialistischen Macht hat diese weiter angeheizt, er hat die Weltwirtschaft und die internationale Politik nicht stabilisiert, sondern bringt sie längerfristig aus dem Gleichgewicht.
Die Konkurrenz zwischen den alten imperialistischen Staaten und aufstrebenden Mächten wie China führt dazu, dass das Hauen und Stechen verschärft wird, dass Blockbildung und Protektionismus voranschreiten werden.
Die Lösung der herrschenden Klasse in der aktuellen Krise besteht also letztlich darin, schon erreichte Formen des globalen Austausches, der Produktion zu vernichten, das Rad der Geschichte zurückzudrehen – ein Beleg mehr dafür, dass die Bourgeoisie eine reaktionäre Klasse ist. Das ist auch der Grund, warum wir es heute mit einer historischen Krise des gesamten Systems zu tun haben.
Wie wenig die herrschende Klasse Herrin ihrer eigenen Produktionsweise ist, wie sehr ihr die gesellschaftlichen Probleme über den Kopf gewachsen sind, zeigt die drohende ökologische Katastrophe. Der Kapitalismus war, wie schon oben dargestellt, immer mit der Zerstörung der menschlichen Umwelt, neben der lebendigen Arbeit die andere große Quelle des Reichtums, verbunden. Von sich aus vermag der Kapitalismus – wie alle früheren Gesellschaftsformationen – keinen rationalen, bewussten Umgang mit der Natur, kein vernünftiges Mensch-Natur-Verhältnis zu etablieren. Als verallgemeinerte Warenproduktion stellt sich eben immer erst im Nachhinein heraus, welche Arbeit gesellschaftlich nützlich war, welche vergebens etc. Die „Umwelt“ tritt in diesem Verhältnis immer nur als Kostenfaktor auf, der individuelle Unternehmens- und Investitionsentscheidungen gemäß ihrer Profiterwartungen modifizieren mag, dessen gesamtgesellschaftliche Folgen aber immer unbewusst bleiben müssen.
Ein rationales Verhältnis zur Natur kann nur vorausschauend, auf Basis von Wissenschaft und rationaler Planung gemäß den Bedürfnissen der Menschen und den Reproduktionserfordernissen ihrer natürlichen Lebensgrundlagen (selbst auch ein menschliches Bedürfnis), verankert werden. Mit dem Kapitalismus ist das unvereinbar. Er treibt vielmehr das Problem als Produktionsweise, die auf den Weltmarkt bezogen ist, also immer schon global bestimmt ist, auf die Spitze.
Ebenso wie die modernen Produktivkräfte dem Nationalstaat entwachsen sind, so ist die Frage der Schaffung eines vorausschauenden und nachhaltigen Verhältnisses zur Natur (inkl. der Wiederherstellung menschengerechter Bedingungen) im nationalstaatlichen Rahmen nicht machbar. Es erfordert internationale Planung, offene und transparente Bestandsaufnahme, offenen Austausch von Erfahrung, Wissen, Wissenschaft, Technologie usw. – alles Dinge, die mit einer Weltgemeinschaft imperialistischer Staaten und der großen Monopole, die im immer schärfer werdenden politischen und ökonomischen Wettstreit liegen, einfach unmöglich sind.
Imperialismus und Sozialismus
Doch die imperialistische Epoche hat nicht nur die inneren Widersprüche, die Probleme auf die Spitze getrieben. Sie hat auch den Weg zu ihrer Lösung sichtbar gemacht.
Die imperialistische Epoche ist somit nicht nur die Epoche des Niedergangs, der Tendenz zu Stagnation. Sie stellt auch den Sturz des Kapitalismus und den Übergang zum Sozialismus, zur zukünftigen klassenlosen Gesellschaft auf die Tagesordnung.
Die imperialistische Epoche ist daher auch die Epoche der proletarischen Diktatur. Die Oktoberrevolution 1917 hat nicht von ungefähr die Welt des 20. Jahrhunderts geprägt wie kein anderes Ereignis.
Die Oktoberrevolution und der revolutionäre Ansturm nach 1917 sowie die Gründung der Dritten Internationale, die zahllosen Revolutionen, Krisen, ja, auch die Entstehung der degenerierten ArbeiterInnen0staaten haben bewiesen, dass die sozialistische Revolution ein gesellschaftliches Bedürfnis geworden ist in der imperialistischen Epoche. In seiner Einleitung zur Kritik der politischen Ökonomie verweist Marx zu Recht darauf, dass die Menschheit, die Geschichte nur solche Probleme und Fragen aufwerfen, die sie auch zu lösen vermögen. Die Häufung revolutionärer Krisen, Situationen, ja, die Entstehung von Übergangsgesellschaften, die sich auf der Basis bürokratischer Planung über Jahrzehnte behaupten und reproduzieren konnten, zeigen auch, dass die gesellschaftliche Entwicklung objektiv über den Kapitalismus hinausdrängt.
Die Russische Revolution hat außerdem auch bewiesen, dass die ArbeiterInnenklasse, auch wenn sie unter äußerst schwierigen Bedingungen an die Macht kommt, diese behaupten und beginnen kann, die Gesellschaft in ihrem Sinne bewusst umzugestalten. Die ersten Jahre der Russischen Revolution sind, ohne dass wir unkritisch zu Schwächen und Fehlern sein wollen, eine heroische Periode der größten revolutionären Umwälzung der bisherigen Geschichte, die auch für zukünftige Transformationen reich an Erfahrung und Lehren ist.
Die Erfahrung zeigt aber auch die Grenzen des Weges. Die Isolierung der Oktoberrevolution hat zu ihrer bürokratischen Entartung und Degeneration, zum Stalinismus, der Liquidierung der revolutionären Partei und zur Machtergreifung der Bürokratie geführt. Trotz aller Unterschiede waren sie durch die Herrschaft einer bürokratischen Kaste und die politische Unterdrückung der ArbeiterInnenklasse charakterisiert.
Stalinismus bedeutete auf dem Feld der Theorie einen vollständigen Bruch mit dem Marxismus, in der Praxis wandte er nicht nur barbarischste Mittel des „Aufbaus“ bis hin zum Massenmord und Zwangsarbeit an. Die bürokratische und letztlich national fixierte Planung ging auch bis hin zu absurden Formen der Nichtkooperation zwischen den Staaten des Ostblocks, zur Spaltung in feindliche „sozialistische Lager“ um China und die Sowjetunion herum, zum Bruch von Tito und Stalin, zur Einschränkung der Bewegungsfreiheit der ArbeiterInnenklasse selbst im Landesinneren (also nicht nur bezüglich des „eisernen Vorhangs“, sondern auch in der SU und China).
All diese Auswüchse waren und sind in den verbleibenden degenerierten ArbeiterInnenstaaten Resultat der Herrschaft der Bürokratie und ihrer reaktionären, konterrevolutionären Politik. Die Politik des „Aufbaus in einem Land“ bedeutet nicht Überwindung der Fesseln, die der Kapitalismus der Entwicklung der Produktivkräfte auflegt, sondern stellt selbst eine Fesselung der Produktivkräfte in das Zwangsbett des Nationalstaates dar.
Diese Politik führt keineswegs nur zur technologischen Rückständigkeit, überflüssiger selbstgenügsamer Anstrengung, jede Erfindung oder Neuerung im „eigenen Land“ parallel zu entwickeln. Vor allem bedeutet sie auch ein Hindernis für die Entwicklung der Produktivkraft der lebendigen Arbeit. Nicht nur die Technik und die ökonomischen Kreisläufe, auch die ArbeiterInnenklasse bleiben zwanghaft „national“.
Die politische Unterdrückung durch die Bürokratie heißt aber vor allem, dass sich die ArbeiterInnenklasse nicht als Klasse für sich konstituieren kann (das wäre nur möglich, wenn sie die bürokratische Herrschaft selbst stürzt). In den stalinistischen Regimen wurde gewissermaßen der „Versuch“ unternommen, eine sozialistische Umgestaltung bei gleichzeitiger zwangsweiser Verhinderung der Bildung von Bewusstsein der revolutionären Klasse über diese Umgestaltung durchzuführen. Eine solche Utopie kann nur reaktionär sein und enden. Sie musste scheitern, und sie ist gescheitert – und das mit vollem Recht.
Die sozialistische Umwälzung muss aber ihrem Wesen nach international sein und muss bewusst durchgeführt werden. Die Frage der ArbeiterInnendemokratie, der in Räten und anderen Formen der direkten und aktiven Demokratie als Staatsmacht und Selbstverwaltung der Gesellschaft organisierten ArbeiterInnenklasse und ihrer Verbündeten ist keineswegs eine bloß politische, sondern auch ökonomische Frage der Übergangsperiode.
Die Frage der Räte und ihrer Demokratie darf daher niemals nur negativ gefasst werden – z. B. als Mittel, die Etablierung einer Bürokratie, die Verselbständigung neuer „Eliten“ zu verhindern und diese an gesellschaftliche Kontrolle, Verantwortlichkeit und Abwählbarkeit zu binden. Sie ist auch unbedingt positiv zu fassen als unverzichtbares Mittel, wie sich die Gesellschaft in der Epoche des Übergangs, der Diktatur des Proletariats mit sich selbst über ihre eigenen Bedürfnisse, wirtschaftliche (und politische) Prioritäten, Schwerpunkte verständigen kann. Sie ist das Mittel, wie die technischen Notwendigkeiten der Planung mit den gesellschaftlichen Zielen, Schwerpunkten, Teilzielen usw. in Einklang gebracht werden können, so dass die einzelnen ArbeiterInnen, ja, alle Gesellschaftsmitglieder zunehmend bewusster in diesen Prozess eingreifen.
Nur so kann das Proletariat zu einer bewusst herrschenden Klasse werden und zugleich das Überflüssigmachen seiner Herrschaft vorbereiten und durchsetzen.
Die Tendenz dazu, die Produktivkräfte bewusst nach den Zielen der gesamten Gesellschaft auszurichten, wurde nicht nur im Stalinismus blockiert (bei gleichzeitiger Einführung bestimmter Voraussetzungen dafür). Sie wird noch viel mehr im Kapitalismus blockiert, auch wenn (oder gerade weil) die Entwicklung der Produktivkräfte in diese Richtung drängt. Das trifft nicht nur auf die internationale Arbeitsteilung und Produktion zu, die auf die Möglichkeit, ja Notwendigkeit internationaler Planung verweisen.
Es trifft auch darauf zu, dass im Kapitalismus die Steigerung der Produktivität der ArbeiterInnen immer wieder auch auf dem zwiespältigen Prozess der Enteignung ihres Wissens basiert. So muss das Kapital selbst in bestimmten Phasen auf „modernere“, scheinbar „partizipativere“ Formen der Arbeitsorganisation (wie Gruppenarbeit) zurückgreifen, um dieses Wissen über den Produktionsprozess besser inkorporieren zu können. Alle großen Kapitale kennen mehr oder weniger haarsträubende Formen des „Verbesserungswesens“. Aber dies geht immer auch mit einem gewissen Konflikt in Bezug auf die Erfordernisse des Ausbeutungsregimes einher. So werden Gruppen in der Gruppenarbeit von den Vorgesetzten nach bestimmter Zeit regelmäßig zerschlagen, weil diese nicht nur die Arbeitsorganisation verbessern, sondern ab einem bestimmten Zeitpunkt auch dazu tendieren, den Zusammenhalt unter den ArbeiterInnen gegen ihre Vorgesetzten zu stärken. Hinzu kommt z. B., dass auch viele Lohnabhängige sehr genau wissen, wie eigentlich besser, schonender produziert werden kann oder einfach bessere Produkte gefertigt werden könnten, dass dies jedoch den Profitinteressen des/r jeweiligen KapitalistIn entgegensteht. Kurzum, die lebendige Arbeit wird einerseits befähigt, immer mehr Reichtum hervorzubringen, und die ArbeiterInnen wie die Gesamtarbeit werden im Zuge der technischen Entwicklung oft auch viel qualifizierter, aber sie werden zugleich immer drakonischer und offensichtlicher den bornierten Zwecken des Kapitals unterworfen.
Schließlich verweist die Frage der Ökologie, die drohende Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen, aber auch andere große Menschheitsfragen wie jene nach der Bekämpfung von Hunger und Seuchen, die Frage der Umgestaltung der Landwirtschaft darauf, dass auch durchdacht werden muss, wofür was produziert wird.
Stalinismus und Sozialdemokratie haben die Frage nach der Umwandlung der Gesellschaft, nach dem Sozialismus, nach dem Fortschritt nicht von ungefähr technisch und organisatorisch behandelt: Sicherung von Arbeitsplätzen, von Einkommen, eines bestimmten Lebensstandards.
Die Umwandlung des Verhältnisses der ProduzentInnen zu ihren Arbeitsmitteln und zum Produkt waren für sie keine Fragen, weil sie mit ihrer „Vision“ von „Sozialismus“ nichts zu tun hatten und auch nicht haben konnten. Für beide war die ArbeiterInnenklasse im Grunde nicht Subjekt, sondern Objekt einer „Umwandlung“.
Wenn sie jedoch nicht zum bewussten Subjekt der Umwandlung wird und das Verhältnis zwischen den Menschen zunehmend bewusst zu gestalten beginnt, so ist natürlich auch ein bewusstes, rationales Verhältnis zur Natur unmöglich.
Die objektiven Voraussetzungen für die sozialistische Umgestaltung der Weltwirtschaft bestehen schon seit über einem Jahrhundert. Sie ist heute brennend aktuell und notwendig, weil sowohl die aktuelle Weltwirtschaftskrise und alle größeren, tieferen Probleme der Menschheit danach drängen. Ohne diese sind massive Zerstörung, Vernichtung, Heraufbeschwören neuer „natürlicher“ und zivilisatorischer Katastrophen unabwendbar. Die Alternative „Sozialismus oder Barbarei“ droht – und weist zugleich auf den Ausweg.
Doch so dramatisch zugespitzt die Verhältnisse sind, so sehr nicht nur moderne Technik, Produktions- und Kommunikationsmittel und eine wissenschaftlich und technisch hochqualifizierte ArbeiterInnenklasse vorhanden sind, die schon jetzt die Fähigkeit hat, unter ihrer Regie die ganze Weltwirtschaft neu, rational und vernünftig zu reorganisieren, so ist sie sich dieser Fähigkeiten als Klasse aber nicht bewusst.
Ein solches Bewusstsein kann in ihr freilich nicht spontan entstehen – so wie revolutionäres Klassenbewusstsein nicht. „Spontan“ erscheint es den ArbeiterInnen so, dass ihr Zugewinn an Wissen und Fähigkeiten, den Gesamtprozess zu organisieren, zusätzliche Potenzen für das Kapitals wären.
Dieser Schleier, diese Umkehrung der realen Verhältnisse, die der Kapitalismus aber notwendig als „falsches Bewusstsein“ hervorbringt, kann nur durch den revolutionären Kampf um Kontrolle, Enteignung des Kapitals, gesellschaftliche Planung, also den Kampf um ein Programm von Übergangsforderungen durchbrochen werden.
Was dazu fehlt, ist eine politische Strategie, ein Programm der sozialistischen Revolution und wirtschaftlichen Umgestaltung zum Sozialismus, eine Partei, eine Führung.
Auch in diesem Sinne ist die Krise der Menschheit die Krise der proletarischen Führung. Es gibt nur ein Mittel, diese Krise zu überwinden: die Schaffung einer neuen Weltpartei der sozialistischen Revolution – einer neuen, Fünften Internationale.
Endnoten
[i] Degenerierte ArbeiterInnenstaat sind Staaten, in denen zwar das Kapital enteignet wurde, die politische Herrschaft jedoch nicht von der ArbeiterInnnenklasse ausgeübt wird, sondern von einer bürokratischen Kaste, einer privilegierten Schicht. Während die Sowjetunion erst durch die stalinistische Konterrevolution zu einem solchen Staat degenerierte, stellten jene Osteuropas, China, Nordkorea, Kuba, Vietnam oder Kambodscha von Beginn an degenerierte, von einer ihrem Wesen nach konterrevolutionen Bürokratie beherrschte ArbeiterInnenstaaten dar.
[ii] Francis Fukayama, Das Ende der Geschichte, Kindler, München 1992
[iii] Siehe dazu: Georg Lukács, Die Zerstörung der Vernunft, Aufbau-Verlag, Berlin und Weimar 1984 bzw. Lukács, Existenzialismus oder Marxismus? Aufbau-Verlag, Berlin 1951
[iv] Siehe die Kritik der Postkolonialismustheorie in diesem RM und die Kritik von Chibber, Vivek: Postkoloniale Theorie und das Gespenst des Kapitals, Dietz Verlag, Berlin 2018
[v] Michael Hardt undAntonio Negri, Empire – Die neue Weltordnung, Campus Verlag, Frankfurt/M. 2020
[vi] Rodney Edvinsson und Keith Harvey, „Empire“: Jenseits des Imperialismus?, in: Revolutionärer Marxismus 33, Theoretisches Journal der Liga für die Fünfte Internationale, Global Red, Berlin 2003, und Martin Suchanek, Das reformistische Schaf im autonomen Wolfspelz, in: Revolutionärer Maxismus 41, Global Red, Berlin 2010
[vii] David Harvey, Der neue Imperialismus, VSA Verlag, Hamburg 2005 und ders., Das Rätsel des Kapitals entschlüsseln, VSA Verlag, Hamburg 2014
[viii] Elmar Altvater, Konkurrenz für das Empire, Verlag Westfälisches Dampfboot, Münster/Westf. 2007
[ix] Joachim Bischoff, Die Herrschaft der Finanzmärkte, VSA Verlag Hamburg 2012
[x] Siehe insbesondere PROKLA 194: Welmarktgewitter: Politik und Krise des globalen Kapitalismus, Verlag Westfälisches Dampfboot, Münster/Westf. 2019, PROKLA 195: Umkämpfe Arbeit – reloaded, Verlag Westfälisches Dampfboot, Münster/Westf. 2019, PROKLA 198: Globale Stoffströme und internationale Arbeitsteilung, Verlag Bertz + Fischer, Berlin 2020; PROKLA 199: Politische Ökonomie des Eigentums, Verlag Bertz + Fischer, Berlin 2020
[xi] Utsa Patnaik und Prabhat Patnaik, A Theory of Imperialism, Columbia University Press, New York 2017
[xii] Grossmann, Das Akkumulations- und Zusammenbruchsgesetz des kapitalistischen Systems, Verlag Neue Kritik, Frankfurt/M. 1970; ders., Aufsätze zur Krisentheorie, Verlag Neue Kritik, Frankfurt/M. 1971
[xiii] Paul Mattick, Economic Crisis and Crisis Theory, The Merlin Press, London, 1981; ders., Kritik der Neomarxisten, Fischer Taschenbuchverlag, Frankfurt/M. 1974
[xiv] Rosdolsky, Zur Entstehungsgeschichte des Marxschen ,Kapital’, Bd. I und II, EVA, Frankfurt/M. 1973
[xv] Marx, Zur Kritik der politischen Ökonomie, Vorwort, MEW 13, Dietz Verlag, Berlin/Ost 1964, S. 8
[xvi] Marx, Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, MEW 42, Dietz Verlag, Berlin/Ost 1983, S. 420
[xvii] Marx, Kritik des Gothaer Programms, MEW 19, Dietz Verlag, Berlin/Ost 1974, S. 28
[xviii] Rosa Luxemburg, Sozialreform oder Revolution, Gesammelte Werke, Band 1, 1. Halbband, Dietz Verlag, Berlin/Ost 1987, S. 367ff.
[xix] Trotzki, Schriften über Deutschland, Band 1, EVA, Frankfurt/M. 1971
[xx] Mandel, Trotzkis Faschismusanalyse, Einleitung zu Schriften über Deutschland, in: a. a. O., S. 14.
[xxi] Marx/Engels, Manifest der Kommunistischen Partei, MEW 4, Dietz Verlag, Berlin/Ost 1964, S. 463
[xxii] Marx, Grundrisse, a. a. O., S. 321
[xxiii] Marx, Das Kapital, Band 1, MEW 23, Dietz Verlag, Berlin/Ost 1964, S. 777 f.
[xxiv] Ebenda, S. 779
[xxv] Siehe dazu z. B. Marx, Grundrisse, a. a. O., S. 95
[xxvi] Marx, Kapital Band 1, a. a. O., S. 790f.
[xxvii] Marx, Kapital Band 3, MEW 25, Dietz Verlag, Berlin/Ost 1969, S. 260
[xxviii] Marx, Grundrisse, a. a. O., S. 641
[xxix] Ebenda, S. 642
[xxx] Rosdolsky, Zur Entstehungsgeschichte des Marxschen ‚Kapital’, Bd. 2, a. a. O., S. 449, FN 38
[xxxi] Marx, Das Kapital Band 1, a. a. O., S. 662 (in Einschaltung 1* aus der autorisierten französischen Ausgabe)
[xxxii] Marx, Das Kapital Band 3, a. a. O., S. 381
[xxxiii] Marx, Theorien über den Mehrwert Band 2, MEW 26.2, Dietz Verlag, Berlin/Ost 1972, S. 510
[xxxiv] So zum Beispiel im Abschnitt „Große Industrie und Agrikultur“ im 1. Band des Kapitals, siehe: Das Kapital, Band 1, a. a. O., S. 527 – 530
Zur ausführlichen Darstellung unserer Position: Gruppe ArbeiterInnenmacht, Umwelt und Kapitalismus. Zu den grundlegenden Widersprüchen zwischen Nachhaltigkeit und kapitalistischer Produktionsweise, Berlin 2019, http://arbeiterinnenmacht.de/2019/06/26/umwelt-und-kapitalismus/
[xxxv] Marx, Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte, MEW 8, Dietz Verlag, Berlin/Ost 1973, S. 111 – 207
[xxxvi] Ebenda, S. 117
[xxxvii] Hilferding, Das Finanzkapital, Dietz Verlag, Berlin/Ost 1955
[xxxviii] Rosa Luxemburg, Die Akkumulation des Kapitals oder Was die Epigonen aus der Marxschen Theorie gemacht haben. Eine Antikritik, in: Luxemburg, Gesammelte Werke, Band 5, Dietz Verlag Berlin 1975, S. 431
[xxxix] Grossmann, a. a. O.
[xl] Ebenda, S. 21
[xli] Lenin, Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus. Gemeinverständlicher Abriß, in: LW Band 22, Dietz Verlag, Berlin/Ost 1988, S. 189 – 309
[xlii] Ebenda, S. 230
[xliii] Ebenda, S. 270
[xliv] Marx, Grundrisse, a. a. O., S. 551
[xlv] Trotzki, Die permanente Revolution, in: ders.: Ergebnisse und Perspektiven. Die permanente Revolution, EVA, Frankfurt/M. 1971
[xlvi] Lenin, Der Imperialismus … , a. a. O., S. 271
[xlvii] Ebenda, Vorwort zur französischen Ausgabe, a. a. O., S. 198
[xlviii] Marx, Ansprache der Zentralbehörde an den Bund vom März 1850, MEW 7, Dietz Verlag, Berlin/Ost 1964, S. 247f.
[xlix] Marx, Entwürfe einer Antwort auf den Brief von V. I. Sassulitsch, MEW 19, Dietz Verlag, Berlin/Ost 1974, S. 384 – 406
[l] Trotzki, Ergebnisse und Perspektiven. Die permanente Revolution. Mit Einleitungen von Helmut Dahmer und Richard Lorenz, a. a. O.
[li] Ebenda, S. 122f.
[lii] Ebenda, S. 123f.
[liii] Trotzki, Was ist nun die permanente Revolution? Grundsätze, These 2, in: ders., Ergebnisse und Perspektiven … , a. a. O., S. 158
[liv] Trotzki, Was ist nun die permanente Revolution; Grundsätze, These 10, in: ders., Ergebnisse und Perspektiven … , a. a. O., S. 161
[lv] Marx, Der Bürgerkrieg in Frankreich. Adresse des Generalrats der Internationalen Arbeiterassoziation, in: MEW 17, Dietz Verlag, Berlin/Ost 1973, S. 313 – 365
[lvi] Zur Ausführlichen Darstellung der Entwicklung der bolschewistischen und Lenin’schen Konzeption siehe: Martin Suchanek, Bruch und Wandel des Bolschewismus. Das Programm der Russischen Revolution, in: Revolutionärer Marxismus 49, global red, Berlin 2017, S. 5 – 82
[lvii] Lenin, Über die aufkommende Richtung des „imperialistischen Ökonomismus“, in: LW Band 23, Dietz Verlag, Berlin/Ost 1972, S. 1 – 10; ders., Antwort auf P. Kijewski (J. Pjatakow), ebenda, S. 11 – 17; ders., Über eine Karikatur auf den Marxismus oder über den „imperialistischen Ökonomismus“, ebenda, S. 18 – 71
[lviii] Engels, Zur Kritik des sozialdemokratischen Programmentwurfs 1891, in: MEW 22, Dietz Verlag, Berlin/Ost 1977, S. 225 – 240
[lix] Trotzki, Die internationale Revolution und die Kommunistische Internationale, Zweiter Teil: Strategie und Taktik in der imperialistischen Epoche; in: ders., Kritik des Programmentwurfs für die Kommunistische Internationale (29.6.1928), Schriften Band 3.2, Linke Opposition und IV. Internationale 1927 – 1928, Rasch und Röhring Verlag, Hamburg 1997, S. 1251; auch in: ders., Die Dritte Internationale nach Lenin, Arbeiterpresse Verlag, Essen 1993, S. 89
[lx] Luxemburg, Gründungsparteitag der KPD 1918/19, III: Unser Programm und die politische Situation, 31. Dezember 1918, in: dies., Gesammelte Werke Band 4, Dietz Verlag, Berlin/Ost 1987, S. 494
[lxi] Trotzki, Der Zusammenbruch der beiden Internationalen. Erklärung der Bolschewiki-Leninisten auf der Pariser Konferenz (17.8.1933), in: ders., Schriften Band 3.3., Linke Opposition und IV. Internationale 1928 – 1934, Neuer ISP Verlag, Köln 2001, S. 440
[lxii] Trotzki, Die neue Etappe. Die Weltlage und unsere Aufgaben, Verlag der Kommunistischen Internationale, Hamburg 1921, Reprint
[lxiii] Inprekorr vom 24. April 1924, zitiert nach Trotzki, Die Dritte Internationale nach Lenin, a. a. O., S. 111
[lxiv] Trotzki, Die Dritte Internationale nach Lenin, a. a. O., S. 113
[lxv] Lenin, Der Imperialismus … , a. a. O., S. 270
[lxvi] Ebenda, S. 269f.
[lxvii] Hilferding, Das Finanzkapital, a. a. O., S. 439
[lxviii] Marx, Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, a. a. O., S. 327; in der deutschen Erstausgabe, noch außerhalb der MEW, Dietz Verlag, Berlin/Ost 1953, findet sich das Zitat nahezu gleich auf S. 317
[lxix] Margaret Wirth, Zur Kritik der Theorie des staatsmonopolistischen Kapitalismus, in: Probleme des Klassenkampfs Nr. 8/9, Berlin/West 1973, S. 24
[lxx] Joachim Schubert, Die Theorie des Staatsmonopolistischen Kapitalismus – Kritik der zentralen Aussagen, in: Mehrwert (Beiträge zur Kritik der politischen Ökonomie) Nr. 4, Berlin/West 1973, S. 8
[lxxi] Lukács, Ontologie – Marx, Zur Ontologie des gesellschaftlichen Seins. Die ontologischen Grundprinzipien von Marx, Sammlung Luchterhand 86, Darmstadt/Neuwied 1972
[lxxii] Lukács, Ontologie – Marx, a. a. O., S. 45
[lxxiii] Marx, Das Kapital Band 1, a. a. O., S. 791
[lxxiv] Lenin, Der Imperialismus … , a. a. O., S. 242
[lxxv] Marx, Das Kapital Band 3, a. a. O., S. 452f.
[lxxvi] Ebenda, S. 453
[lxxvii] Ebenda, S. 454
[lxxviii] Ebenda, S. 456
[lxxix] Hilferding, Das Finanzkapital, a. a. O., S. 258
[lxxx] Ebenda, S. 349
[lxxxi] Zitiert nach Oelßner, Vorwort zur Neuausgabe von „Das Finanzkapital“, a. a. O., S. XXXIII
[lxxxii] Lenin, Heft Hilferding. „Das Finanzkapital“, LW 39, Dietz Verlag, Berlin/Ost 1965, S. 330 – 336
[lxxxiii] Ebenda, S. 334
[lxxxiv] Bucharin, Imperialismus und Weltwirtschaft, Archiv Sozialistischer Literatur 13, Verlag Neue Kritik, Frankfurt/M. 1969
[lxxxv] Ebenda, S. 131
[lxxxvi] Ebenda, S. 191
[lxxxvii] Ebenda, S. 133
[lxxxviii] Ebenda, S. 133
[lxxxix] Bucharin, Ökonomik der Transformationsperiode, Texte des Sozialismus und Anarchismus, rororo Klassiker 261 – 263, Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek 1970
[xc] Ebenda, S. 19
[xci] Ebenda, S. 50
[xcii] Ebenda, S. 54f.
[xciii] Lenin, Einige Erwägungen zu den Bemerkungen der Kommission der gesamtrussischen Aprilkonferenz, LW 24, Dietz Verlag, Berlin/Ost 1972, S. 465f.
[xciv] Lenin, VIII. Parteitag der KPR (B), 18. – 23. März 1919, Bericht über das Parteiprogramm, 19. März, LW 29, Dietz Verlag, Berlin/Ost 1971, S. 153
[xcv]Busch/Schoeller/Seelow, Weltmarkt und Weltwährungskrise, Bremen 1971; Christel Neusüss, Imperialismus und Weltmarktbewegung des Kapitals, Verlag POLITLADEN, Politladen-Druck Nr. 4, Erlangen 1972; Wolfgang Schoeller, Werttransfer und Unterentwicklung – Bemerkungen zu Aspekten der neueren Diskussion um Weltmarkt, Unterentwicklung und Akkumulation des Kapitals in unterentwickelten Ländern (anhand von E. Mandel, Der Spätkapitalismus), in: Probleme des Klassenkampfes 6, März 1973, S. 99 – 120, Verlag Politladen, Erlangen1973; Margaret Wirth, Zur Kritik der Theorie des staatsmonopolistischen Kapitalismus, in: Probleme des Klassenkampfs 8/9, S. 17 – 44, Verlag Politladen, Erlangen 1973; Klaus Busch, Ungleicher Tausch – Zur Diskussion über internationale Durchschnittsprofitrate, Ungleichen Tausch und Komparative Kostentheorie anhand der Thesen von Arghiri Emmanuel (1), Probleme des Klassenkampfs 8/9, a. a. O., S. 47 – 88; Ders., Die multinationalen Konzerne. Zur Analyse der Weltmarktbewegung des Kapitals, Suhrkamp Verlag, edition suhrkamp 741, Frankfurt/M., 1974
[xcvi] Wolfgang Schoeller, Weltmarkt und Reproduktion des Kapitals, EVA, Frankfurt/M., Köln 1976
[xcvii] Marx, Kapital, Bd. 1, a. a. O., S. 53
[xcviii] Marx, Theorien über den Mehrwert Band 2, a. a. O., S. 521
[xcix] Schoeller, Weltmarkt und … , a. a. O., S. 23
[c] Marx, Kapital Band 1, a. a. O., , S. 583f.
[ci] Marx, Das Kapital Band 3, a. a. O., 247
[cii] Zur Darstellung der Krise von 1973 und ihrer Bedeutung siehe: Oelßner, Die Wirtschaftkrisen. Die Krisen im vormonopolistischen Kapitalismus, Reprint Frankfurt/Main 1973, S. 244 – 262
[ciii] Lenin, Der Imperialismus … , a. a.O., S. 246
[civ] Trotzki, Die Dritte Internationale nach Lenin, a. a. O., S. 94f.
[cv] Ebenda, S. 125f.
[cvi] Zu einer ausführlichen Darstellung siehe: Gruppe ArbeiterInnenmacht, Der Letzte macht das Licht aus. Die Todesagonie des Vereinigten Sekretariats der Vierten Internationale http://arbeitermacht.de/broschueren/vs/index.htm
[cvii] Stephan Krüger, Profitraten und Kapitalakkumulation in der Weltwirtschaft. Arbeits- und Betriebsweisen seit dem 19. Jahrhundert und der bevorstehende Epochenwechsel, VSA Verlag, Hamburg 2019, S. 117f.
[cviii] Stephan Krüger, Profitraten und Kapitalakkumulation in der Weltwirtschaft … , a. a. O.
[cix] Ebenda, S. 119 – 122
[cx] Zbigniew Brzezinski, Die einzige Weltmacht, Fischer Verlag (7. Auflage), Frankfurt/M. 2003, S. 57
[cxi] Zitiert nach Leo Mayer und Fred Schmid: Welt-Sheriff NATO. Weltwirtschaftsordnung und neue NATO-Doktrin, isw report 40, München 1999, S. 22